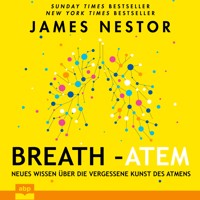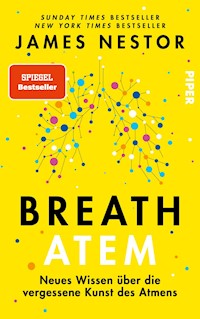
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Atmen heißt Leben - James Nestor bringt uns mit seinem Buch die verlorene Kunst des guten Atmens wieder näher Die Atmung ist die einzige Körperfunktion, die der Mensch wirklich kontrollieren kann, bei der aber am meisten schief geht. Unsere Atmung kann uns helfen abzunehmen, unseren allgemeinen Gesundheitszustand positiv beeinflussen und sogar unser Leben verlängern. Wer richtig atmet, ist selbstbewusster und kann sich besser fokussieren. James Nestors Leben gestaltete sich einst ziemlich chaotisch: Ihm ging es gesundheitlich schlecht, er war gestresst, lebte in einem baufälligen Haus und erholte sich von seiner dritten Lungenentzündung. Das alles änderte sich schlagartig, nachdem er einen Kurs für Sudarshan-Kriya-Atmung besuchte. Wie viele andere Menschen machte sich Nestor bis zu diesem Zeitpunkt wenig Gedanken über diesen alltäglichen, aber lebensspendenden Akt. Schon nach der ersten Sitzung fühlte er sich jedoch wesentlich besser. Indem er sich einfach nur auf eine langsame Sauerstoffzufuhr durch die Nase konzentrierte, schlief er in der folgenden Nacht so gut wie schon lange nicht mehr. Atmen Sie einmal tief durch und lassen Sie sich anschließend von Autor James Nestor in seinem Buch "Breath – Atem" zeigen, wie es richtig geht. Zehn Jahre hat James Nestor akribische Nachforschungen betrieben, Experteninterviews auf der ganzen Welt geführt, verschiedene Atemtechniken und die Auswirkung von Atembeschwerden am eigenen Körper getestet. Er bringt uns das Wissen von Schwimmtrainern ebenso nahe wie das von indischen Mystikern und strengen russischen Kardiologen, um zu zeigen, was die Atmung in unserem Körper auslösen kann. "Breath – Atem: Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atems" ist eine aufschlussreiche Odyssee durch die spannende und gelegentlich etwas seltsam anmutende Welt des Atmens. »Rund 10 000 Atemzüge braucht es, sein Buch durchzulesen, sagt James Nestor. Die Mühe lohnt – nicht nur wegen der erstaunlichen Fakten und Geschichten zu Atmen und Gesundheit. Dazu ist das Buch auch ein Selbstversuch und gerade deshalb so überzeugend.« ― P.M.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür K. S.© 2020 by James NestorTitel der amerikanischen Originalausgabe: »Breath« bei Riverhead Books, New York 2020All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.This edition published by arrangement with Riverhead Books, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.© Piper Verlag GmbH, München 2021Covergestaltung: FAVORITBUERO, München nach einem Entwurf von Grace Han & Lauren Peters-CollaerCoverabbildung: Bild unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Einleitung
Teil I
Das Experiment
1 Die schlechtesten Atmer im Tierreich
2 Mundatmung
Teil II
Die vergessene Kunst und Wissenschaft des Atmens
3 Nase
4 Ausatmen
5 Langsam
6 Weniger
7 Kauen
Teil III
Atmen+
8 Gelegentlich mehr
9 Anhalten
10 Schnell, langsam und gar nicht
EpilogEin letztes Keuchen
Mund zu
Durch die Nase atmen
Ausatmen
Kauen
Mehr atmen, zumindest manchmal
Luft anhalten
Auf die Atemtechnik kommt es an
Dank
Anhang
Atemtechniken
Anmerkungen
Um den Atem zu transportieren, muss das Einatmen voll sein. Wenn es voll ist, hat es große Kapazität. Wenn es große Kapazität hat, kann es ausgedehnt werden. Wenn es ausgedehnt ist, kann es nach unten dringen. Wenn es nach unten dringt, wird es still zur Ruhe kommen. Wenn es still zur Ruhe gekommen ist, wird es stark und fest. Wenn es stark und fest ist, wird es keimen. Wenn es keimt, wird es wachsen. Wenn es wächst, wird es sich nach oben zurückziehen. Wenn es sich nach oben zurückzieht, wird es den Scheitel erreichen. Die geheime Macht der Vorsehung bewegt sich oben. Die geheime Macht der Erde bewegt sich unten.
Wer dies befolgt, wird leben. Wer dagegen verstößt, wird sterben.
Chinesische Inschrift, Zhou-Dynastie (um 500 v. Chr.)[1]
Einleitung
Es sah aus wie ein Haus in Amityville: Von den Wänden blätterte die Farbe, die Fenster waren staubig, das Mondlicht warf drohende Schatten. Ich ging durch ein Tor, eine knarrende Freitreppe hinauf und klopfte.
Die Tür öffnete sich, eine Frau in den Dreißigern mit buschigen Augenbrauen und übergroßen weißen Zähnen bat mich herein. Ich musste die Schuhe ausziehen, dann geleitete sie mich in ein riesiges Wohnzimmer mit himmelblauer Decke, die mit weißen Wölkchen bemalt war. Ich setzte mich neben ein Fenster, das im Wind klapperte, und schaute im Licht der gelbsüchtigen Straßenlampen zu, wie die anderen hereinkamen. Ein Mann mit Augen wie ein Häftling. Ein streng dreinblickender Typ mit Jerry-Lewis-Koteletten. Eine Blondine mit einem unsymmetrisch platzierten Bindi auf der Stirn. Das gedämpfte Geräusch von Fußtritten und geflüsterten Hallos wurde überlagert von einem die Straße entlangrumpelnden Lkw; aus der Fahrerkabine dröhnte Paper Planes, die unentrinnbare Hymne des Tages. Ich legte den Gürtel ab, öffnete den Knopf am Bund der Jeans und setzte mich zurecht.
Ich war auf Empfehlung meines Arztes hier, der mir gesagt hatte: »Ein Atemtechnikkurs würde Ihnen guttun.« Ich sollte meine versagenden Lungen stärken, mein zerfahrenes Gemüt beruhigen, vielleicht eine neue Perspektive gewinnen.
Mir ging es schon seit Monaten ziemlich schlecht. Ich hielt den Druck der Arbeit nicht mehr aus, und mein 130 Jahre altes Haus fiel auseinander. Ich hatte mich gerade von einer Lungenentzündung erholt. Im letzten Jahr hatte ich ebenfalls eine gehabt. Und im Jahr davor. Ich verbrachte die meiste Zeit zu Hause, keuchte vor mich hin, arbeitete und aß drei Mahlzeiten am Tag aus derselben Schüssel – auf dem Sofa, über wochenalte Zeitungen gebeugt. Ich war in einer Routine gefangen – körperlich, geistig und auch sonst. Nachdem ich einige Monate so dahinvegetiert hatte, befolgte ich den Rat des Arztes und meldete mich für einen Einführungskurs in einer Atemtechnik namens Sudarshan Kriya an.
Um 19 Uhr schloss die Frau mit den buschigen Augenbrauen die Haustür ab, setzte sich in die Mitte der Gruppe, legte eine Audiokassette in einen alten Gettoblaster und drückte die Play-Taste. Über dem Zischen der Grundfrequenz hörte man eine Männerstimme mit indischem Akzent. Die Stimme klang hoch, leiernd und unnatürlich melodiös; unweigerlich dachte ich an eine Comicfigur. Sie wies uns an, langsam durch die Nase einzuatmen und dann langsam wieder auszuatmen. Uns auf den Atem zu konzentrieren.
Wir atmeten ein paar Minuten lang nach Anweisung. Ich griff mir eine Decke aus einem Stapel und wickelte sie mir um die Beine, um meine besockten Füße vor der Zugluft des undichten Fensters zu schützen. Ich atmete und atmete, aber nichts geschah. Keine Gelassenheit überkam mich, keine Anspannung wich aus meinen verkrampften Muskeln. Nichts.
Zehn Minuten vergingen, vielleicht auch zwanzig. Ich begann mich zu ärgern und bereute schon, dass ich einen Abend damit verschwendete, auf dem Fußboden einer viktorianischen Bruchbude staubige Luft zu atmen. Ich öffnete die Augen und schaute mich um. Alle schauten ernüchtert und gelangweilt drein. Der mit den Häftlingsaugen schien zu schlafen. Jerry Lewis sah aus, als machte er sich in die Hose. Die Bindi-Frau saß erstarrt da und grinste wie ein Honigkuchenpferd. Ich überlegte, ob ich einfach gehen sollte, aber das kam mir unhöflich vor. Die Sitzung war kostenlos, die Kursleiterin war eine Freiwillige. Es gehörte sich, dass ich ihre Wohltätigkeit respektierte. Also schloss ich wieder die Augen, wickelte die Decke fester um mich und atmete weiter ein und aus.
Dann geschah etwas, auch wenn ich mir gar keiner Verwandlung bewusst war. Ich spürte keine Entspannung, der Schwarm nervtötender Gedanken verschwand nicht aus meinem Kopf. Aber es war, als wäre ich von einem Ort weg an einen anderen versetzt worden, und zwar übergangslos.
Die Kassette war zu Ende. Ich öffnete die Augen. Auf meinem Kopf spürte ich etwas Nasses. Ich hob die Hand, um es abzuwischen, und merkte, dass mein Haar triefnass war. Ich wischte mit der Hand übers Gesicht, spürte das Brennen von Schweiß in den Augen und schmeckte Salz. Ich schaute an mir hinunter und sah Schweißflecken auf Pullover und Jeans. Im Zimmer herrschten vielleicht 20 Grad, unter dem zugigen Fenster war es noch um einiges kühler. Alle trugen Jacken und Kapuzensweatshirts, um sich warm zu halten. Aber ich hatte meine Sachen unerklärlicherweise nass geschwitzt wie bei einem Marathonlauf.
Die Kursleiterin kam zu mir und fragte, ob alles in Ordnung sei, ob ich mich krank fühlte oder Fieber hätte. Ich antwortete, es gehe mir gut. Dann sagte sie etwas über Körperwärme und wie jedes Einatmen uns mit neuer Energie versorge und jedes Ausatmen alte, verbrauchte Energie freisetze. Ich versuchte, das zu verstehen, konnte mich aber nur schlecht konzentrieren. Mir ging dauernd im Kopf herum, wie ich in meinen durchweichten Sachen auf dem Fahrrad die fünf Kilometer von Haight-Ashbury nach Hause überstehen sollte.
Am nächsten Tag ging es mir sogar noch besser. Ich spürte tatsächlich die versprochene Ruhe und Gelassenheit in mir, die ich schon lange nicht mehr kannte. Ich schlief gut. Die kleinen Alltagsprobleme machten mir nicht mehr so zu schaffen. Meine Schultern- und Nackenmuskeln waren nicht mehr verspannt. Dieser Zustand hielt einige Tage an, bevor er langsam nachließ.
Was genau war da geschehen? Wie kann es zu einer so tiefgreifenden Reaktion kommen, wenn man sich eine Stunde lang in einem schäbigen Haus mit gekreuzten Beinen auf den Boden setzt und ein- und ausatmet?
Ich besuchte auch die nächste Sitzung des Atemtechnikkurses: wieder dasselbe Erlebnis, diesmal aber mit weniger Schweiß. Meiner Familie und den Freunden erzählte ich nichts davon, aber ich gab mir Mühe, zu verstehen, was geschehen war, und verbrachte schließlich mehrere Jahre damit, es herauszubekommen.
Während dieser folgenden Jahre reparierte ich mein Haus, riss mich zusammen und fand aus meiner erstarrten Routine heraus. Und ich entdeckte eine mögliche Antwort auf meine Fragen zur Atmung. Ich fuhr nach Griechenland, um eine Geschichte über das Apnoetauchen zu schreiben – die uralte Kunst, mit angehaltenem Atem Dutzende Meter tief zu tauchen. Zwischen den Tauchgängen befragte ich Dutzende Experten und hoffte, so eine Anschauung ihrer Technik und ihrer Beweggründe zu gewinnen. Ich wollte wissen, wie diese äußerlich unauffälligen Menschen – Programmierer, Werbeagenturmanager, Biologen, Ärzte – es schafften, ihren Körper so zu trainieren, dass er zwölf Minuten am Stück ohne Luft auskam, und dabei Tiefen erreichten, die die Wissenschaft vor einigen Jahren noch für unmöglich hielt.
Die meisten Leute, die im Schwimmbad zu tauchen versuchen, geben bei drei Meter Tiefe nach wenigen Sekunden auf, weil die Ohren heftig schmerzen. Die Apnoetaucher erzählten mir, sie hätten auch so angefangen. Ihre Verwandlung war reine Übungsleistung; sie hatten ihre Lungen gezwungen, härter zu arbeiten und ihre schlummernden Fähigkeiten zu nutzen, die wir anderen ignorieren. Sie bestanden darauf, dass sie nichts Besonderes seien. Jeder einigermaßen gesunde Mensch, der bereit sei, die Trainingszeit zu investieren, könne 30, 60, sogar 100 Meter tief tauchen. Es komme nicht aufs Alter, aufs Körpergewicht oder die erblichen Voraussetzungen an. Apnoetauchen, sagten sie, erfordere nichts weiter, als die Kunst des Atmens zu beherrschen.[1]
Für sie war das Atmen keine unbewusste Handlung – nichts, das einfach so ablief. Es war eine Kraft, eine Arznei und ein Mechanismus, durch den sie fast übermenschliche Macht gewinnen konnten.
Eine Ausbilderin, die einmal über acht Minuten lang die Luft angehalten und einmal tiefer als 100 Meter getaucht war, sagte: »Es gibt so viele Arten des Atmens, wie es Nahrungsmittel gibt. Und jede Atemtechnik wirkt sich anders auf den Körper aus.« Ein anderer Taucher erklärte mir, dass manche Atemtechniken das Gehirn mit Nährstoffen versorgen, während andere die Neuronen abtöten; dass manche gesund sind, andere aber das Leben verkürzen.
Sie erzählten verrückte Geschichten, wie sie durch besonderes Atmen die Ausdehnung ihrer Lungen um mehr als 30 Prozent vergrößert hatten. Sie berichteten von einem indischen Arzt, der mehrere Pfund Gewicht verloren hatte, indem er einfach anders einatmete, und von einem anderen Mann, der sich das bakterielle Endotoxin E. coli injizieren ließ und in einem rhythmischen Muster atmete, das sein Immunsystem stimulierte und so die giftigen Bakterien in wenigen Minuten vernichtete. Sie erzählten von Frauen, die ihren Krebs in Remission geschickt hatten, und von Mönchen, die mit ihrem nackten Körper über Stunden hinweg den Schnee im Umkreis zum Schmelzen brachten. Das klang alles absurd.
Wenn ich bei meinen Unterwasserrecherchen ein bisschen Freizeit hatte, meistens spätabends, arbeitete ich mich durch Stapel von Literatur zu diesem Thema. Sicher hatte sich doch die Forschung mit den Wirkungen des bewussten Atmens auf Landratten befasst? Irgendwo musste es doch Belege für die fantastischen Geschichten der Apnoetaucher über Atemtechniken zum Abnehmen, für mehr Gesundheit und Langlebigkeit geben?
Ich fand genug Material, um eine Bibliothek zu füllen – allerdings waren die Quellen allesamt Hunderte, teils Tausende Jahre alt.
Sieben Bücher des chinesischen Tao, die auf etwa 400 v. Chr. datiert werden, befassen sich ausschließlich mit dem Atmen – wie es uns tötet oder heilt, je nachdem, wie man es einsetzt.[3] Diese Manuskripte enthielten genaue Anweisungen, wie man den Atem reguliert, verlangsamt, anhält und hinunterschluckt. Die Hindus hielten in noch früheren Zeiten Atem und Geist für identisch und schilderten aufwendige Verfahren, um die Atmung ins Gleichgewicht zu bringen und körperlich und geistig gesund zu bleiben. Es folgten die Buddhisten, die mit der Atemtechnik nicht nur ihr Leben verlängern, sondern höhere Bewusstseinsstufen erreichen wollten. Für alle diese Menschen und Kulturen war das Atmen starke Medizin.
»Daher wird der Gelehrte, der sein Leben nähren will, die Form verfeinern und seinen Atem nähren. Ist dies nicht offenbar?«, heißt es in einem alten Tao-Text.[4]
So offenbar ist es wohl nicht. Ich schaute mich nach einer Bestätigung dieser Behauptungen in der neueren pulmonologischen Forschung um. Die Pulmonologie befasst sich innerhalb der Medizin mit Lungen und Atemwegen. Ich fand so gut wie nichts. Die Atemtechnik, so hieß es höchstens, sei nicht wichtig. Viele Ärzte, Forscher und Wissenschaftler, die ich befragte, bestätigten diese Haltung: 20-mal pro Minute, 10-mal durch den Mund, die Nase oder einen Tubus, egal.[5] Wichtig ist, Luft in die Lungen zu bekommen – der Körper erledigt den Rest.
Um eine Vorstellung zu bekommen, wie die moderne Medizin das Atmen betrachtet, müssen Sie nur an Ihre letzte Vorsorgeuntersuchung denken. Der Arzt hat wahrscheinlich Blutdruck, Pulsfrequenz und Temperatur gemessen und Ihnen ein Stethoskop auf die Brust gedrückt, um den Zustand von Herz und Lunge zu prüfen. Vielleicht hat er mit Ihnen über Ernährung, Vitaminzufuhr, Arbeitsstress gesprochen. Irgendwelche Verdauungsbeschwerden? Schlafprobleme? Werden die Pollenallergien schlimmer? Asthma? Was machen Ihre Kopfschmerzen?
Er wird aber kaum Ihre Atemfrequenz gemessen haben oder das Gleichgewicht von Sauerstoff und Kohlendioxid im Blutkreislauf. Wie Sie atmen und welche Qualität die einzelnen Atemzüge haben, stand nicht zur Debatte.
Wenn die Apnoetaucher und die alten Texte jedoch recht haben, hängt alles davon ab, wie wir atmen. Wie kann etwas gleichzeitig so wichtig und unwichtig sein?
Ich grub weiter, und langsam schälte sich eine Geschichte heraus. Wie ich feststellte, war ich nicht der Einzige, der in letzter Zeit diese Fragen stellte. Während ich Texte durchging und Apnoetaucher und Superatmer befragte, waren Forscher an den Universitäten Harvard und Stanford und anderen angesehenen Institutionen gerade dabei, einige der fantastischsten Geschichten, die ich zu hören bekam, zu bestätigen. Aber das geschah nicht etwa in den Labors der Pulmonologie. Pulmonologen, so erfuhr ich, befassen sich hauptsächlich mit spezifischen Lungenkrankheiten – Kollaps, Krebs, Emphysem. »Wir sind für die Notfälle zuständig. So funktioniert das System«, erklärte mir ein erfahrener Vertreter des Fachs.
Nein, diese grundsätzliche Atemforschung spielt sich anderswo ab: in den schlammigen Ausgrabungsstätten antiker Gräber, den Behandlungsstühlen von Zahnarztpraxen und den Gummizellen psychiatrischer Krankenhäuser. Nicht gerade Orte, an denen man Spitzenforschung zu einer grundlegenden Lebensfunktion erwarten würde.
Wenige dieser Forscher hatten sich ursprünglich mit Atmung befassen wollen, aber sie stellten fest, dass sie es nicht vermeiden konnten. Sie fanden heraus, dass unsere Atemfähigkeit sich im Laufe der langen menschlichen Evolutionsgeschichte verändert und unsere Atemtechnik sich seit Beginn des Industriezeitalters beträchtlich verschlechtert hat. Sie entdeckten, dass 90 Prozent der Menschen – darunter sehr wahrscheinlich ich, Sie und fast jeder, den Sie kennen – falsch atmen und dass dieser Fehler eine lange Liste chronischer Krankheiten entweder verursacht oder verschlimmert.
Immerhin nicht ganz so deprimierend ist, dass einige dieser Forscher auch zeigen konnten, wie viele moderne Krankheiten – Asthma, Angstzustände, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität, Schuppenflechte und andere – gemildert oder sogar überwunden werden können, wenn man nur lernt, anders ein- und auszuatmen.
Diese Ergebnisse stellten traditionelle Annahmen in der westlichen Medizin auf den Kopf. Doch, Atmen in verschiedenen Rhythmen kann wirklich unser Körpergewicht und die Gesundheit insgesamt beeinflussen. Doch, unsere Atemtechnik verändert wirklich Größe und Funktion der Lungen. Doch, mit Atemübungen können wir unser Nervensystem bewusst beeinflussen, unsere Immunreaktionen kontrollieren und unsere Gesundheit verbessern. Doch, eine veränderte Atmung verlängert das Leben.
Wie sehr wir auch auf die Ernährung achten, wie viel Sport wir treiben, wie widerstandsfähig unsere Gene sein mögen, wie schlank, jung und klug wir auch sind – das alles hilft nichts, solange wir nicht richtig atmen. Das haben diese Forscher herausgefunden. Der fehlende Stützpfeiler der Gesundheit ist die Atmung. Sie steht am Anfang.
Das vorliegende Buch ist eine wissenschaftliche Abenteuerreise zur verlorenen Kunst und Technik des Atmens. Es erforscht die Verwandlung, die alle 3,3 Sekunden in unserem Körper stattfindet – so lange braucht der Durchschnittsmensch für einen Atemzug. Es erklärt, wie die Milliarden und Abermilliarden Moleküle, die man mit jedem Einatmen in seinen Körper holt, Knochen, Muskelscheiden, Blut, Gehirn und Organe aufbauen, und die neuen Erkenntnisse, wie diese mikroskopisch kleinen Bausteine Gesundheit und Zufriedenheit jedes Einzelnen morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr und die nächsten Jahrzehnte beeinflussen.
Ich spreche von einer »verlorenen Kunst«, weil viele dieser neuen Erkenntnisse so neu gar nicht sind. Die meisten Methoden, mit denen ich mich im Folgenden befasse, gibt es seit Hunderten, manchmal Tausenden von Jahren. Sie wurden in einer anderen Kultur zu einer anderen Zeit geschaffen, beschrieben, vergessen und entdeckt, um wieder vergessen zu werden. Das ging jahrhundertelang so.
Viele Pioniere dieses Fachgebiets waren keine Wissenschaftler. Sie waren Bastler, eine Gruppe unabhängiger Geister, die ich »Pulmonauten« nenne und die über die Kraft des Atmens stolperten, weil ihnen nichts sonst mehr half. Sie waren Feldarzt im Amerikanischen Bürgerkrieg, französischer Friseur, anarchistischer Opernsänger, indischer Mystiker, reizbarer Schwimmtrainer, streng dreinblickender ukrainischer Kardiologe, tschechischer Olympiateilnehmer oder Chorleiter aus North Carolina.
Wenige dieser Pulmonauten haben zu Lebzeiten viel Ruhm oder Respekt geerntet, und mit ihnen wurden auch ihre Forschungsergebnisse begraben und zerstreut. Noch faszinierender war es, zu erfahren, dass ihre Methoden in den letzten Jahren wiederentdeckt, wissenschaftlich erforscht und bewiesen wurden. Die Früchte dieser ehemals abseitigen, oft vergessenen Forschungen bestimmen jetzt das Potenzial des menschlichen Körpers neu.
Aber wieso soll ich denn atmen lernen? Ich atme schon mein ganzes Leben lang.
Diese Frage, die Sie sich jetzt vielleicht gerade stellen, begegnet mir seit dem Beginn meiner Recherchen immer wieder. Wir nehmen einfach an, Atmen sei eine passive Tätigkeit – etwas, das halt zum Leben gehört: Solange man atmet, lebt man; wenn man aufhört, stirbt man. Aber Atmen ist nicht binär, und je mehr ich mich mit dem Thema befasste, desto mehr wurde es mir zum persönlichen Anliegen, diese grundlegende Erkenntnis weiterzugeben.
Wie die meisten Erwachsenen habe ich schon einen Haufen Atemwegserkrankungen durchgemacht. Das hat mich damals auch in den Atemtechnikkurs geführt. Und wie die meisten Menschen merkte ich, dass kein Antiallergen, Inhalator oder Vitaminpräparat und keine Diät besonders viel bewirken. Heilung – und noch weit mehr als Heilung – fand ich erst durch eine neue Generation von Pulmonauten.
Der durchschnittliche Leser braucht ungefähr 10 000 Atemzüge, um dieses Buch ganz durchzulesen. Wenn ich meine Sache gut gemacht habe, werden Sie von jetzt an mit jedem dieser Atemzüge ein vertieftes Verständnis des Atmens gewinnen und lernen, wie man es am besten anfängt. Ob 20-mal oder 10-mal pro Minute, ob durch Mund, Nase, Luftröhrenschnitt oder Beatmungsschlauch, ist eben nicht dasselbe. Es ist wichtig, wie man atmet.
Beim 1000. Atemzug werden Sie wissen, wieso der moderne Mensch die einzige Tierart mit chronisch schiefen Zähnen ist und was das für die Atmung bedeutet. Sie werden erfahren, wie unsere Atemfähigkeit im Laufe der menschlichen Entwicklung abgenommen hat und warum der Urmensch nicht geschnarcht hat. Sie werden zwei Männern mittleren Alters bei ihren Bemühungen gefolgt sein, eine 20-tägige, ebenso bahnbrechende wie masochistische Studie der Stanford University durchzustehen, die klären sollte, ob es wirklich nicht darauf ankommt, ob man durch Mund oder Nase atmet. Einige Ihrer neuen Erkenntnisse werden Ihnen Tage und Nächte ruinieren, besonders wenn Sie schnarchen. Aber in den folgenden Atemzügen finden Sie Rezepte zur Heilung.
Beim 3000. Atemzug kennen Sie die Grundlagen der heilenden Atmung. Diese langsamen und langwierigen Methoden stehen jedem offen – Alten und Jungen, Kranken und Gesunden, Reichen und Armen. Sie werden im Hinduismus, Buddhismus und Christentum sowie in anderen Religionen seit Jahrtausenden praktiziert, aber erst seit Kurzem wissen wir, dass man damit den Blutdruck senken, sportliche Leistungen steigern und das Nervensystem ins Gleichgewicht bringen kann.
Mit dem 6000. Atemzug befinden Sie sich im Land ernsthaften, bewussten Atmens. Sie werden über Mund und Nase hinaus tiefer in die Lungen vorstoßen, und wir begegnen einem Pulmonauten des 20. Jahrhunderts, der Veteranen des Zweiten Weltkriegs von ihren Emphysemen heilte und Kurzstreckenläufer trainierte, die bei Olympischen Spielen Goldmedaillen gewannen – beides, indem er die Kraft des Ausatmens nutzte.
Beim 8000. Atemzug werden Sie noch tiefer in den Körper vorgedrungen sein, um – ausgerechnet – das Nervensystem anzuzapfen. Sie werden die Kraft der Hyperventilation entdecken. Sie werden Pulmonauten treffen, die mithilfe der Atmung verkrümmte Wirbelsäulen begradigen, Autoimmunerkrankungen beherrschen und sich bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt innerlich aufheizen. Das ist alles eigentlich gar nicht möglich, aber Sie werden sehen, dass es doch funktioniert. Auch ich werde auf dieser Reise einiges lernen und zu verstehen versuchen, was vor einem Jahrzehnt in dieser viktorianischen Villa mit mir geschehen ist.
Wenn Sie den 10 000. Atemzug und das Ende dieses Buchs erreichen, werden Sie und ich wissen, wie die Luft, die in Ihre Lungen eintritt, jeden Augenblick Ihres Lebens beeinflusst und wie Sie Ihr volles Potenzial bis zu Ihrem letzten Atemzug ausnutzen.
In diesem Buch geht es um viele Fachgebiete: Evolutionsgeschichte, Medizingeschichte, Biochemie, Physiologie, Physik, Sportwissenschaft und andere. Aber hauptsächlich geht es darin um Sie.
Als Durchschnittsmensch werden Sie 670 Millionen Atemzüge im Leben tun. Vielleicht haben Sie die Hälfte schon hinter sich. Vielleicht sind Sie schon bei Nummer 669 000 000. Vielleicht möchten Sie ja noch ein paar Millionen dazu.
Teil I
Das Experiment
1 Die schlechtesten Atmer im Tierreich
Der Patient, bleich und träge, traf um 9:32 Uhr ein. Männlich, mittleren Alters, 85 Kilo. Gesprächig und freundlich, aber sichtbar ängstlich. Schmerzen: keine. Ermüdung: geringfügig. Grad der Ängstlichkeit: mittel. Befürchtungen hinsichtlich des zukünftigen Gesundheitszustands und zunehmender Symptome: stark.
Der Patient gibt an, er sei in einer modernen vorstädtischen Umgebung aufgewachsen, anfänglich gestillt, mit sechs Monaten entwöhnt und aus der Flasche ernährt und später aus Babygläschen gefüttert worden. Diese sehr weiche Ernährung, die kaum Kautätigkeit erforderte, führte zu verringertem Knochenwachstum in den Kieferbögen und der Nasenhöhle, was eine chronisch verstopfte Nase zur Folge hatte.[1]
Mit 15 Jahren ernährte sich der Patient von noch weicheren, hochgradig vorverarbeiteten Nahrungsmitteln, hauptsächlich Weißbrot, gesüßten Fruchtsäften, Gemüsekonserven, Steak-umms,[7] Schmelzkäsebrötchen, Mikrowellen-Taquitos, Hostess Sno Balls[8] und Schokoriegeln. Sein Kieferbereich war inzwischen so unterentwickelt, dass die 32 Zähne des Dauergebisses darin keinen Platz mehr hatten; Schneide- und Eckzähne schoben sich übereinander, mussten teilweise gezogen und mit Spangen begradigt werden. Drei Jahre orthodontischer Behandlung verkleinerten seinen Kieferbogen noch weiter, sodass die Zunge nicht mehr richtig zwischen die Zähne passte. Wenn er sie herausstreckte, was er oft tat, sah man deutlich Zahnabdrücke an den Seiten, ein Vorbote des Schnarchens.
Mit 17 Jahren bekam er alle vier Weisheitszähne gezogen, wodurch sich seine Mundhöhle weiter verengte und gleichzeitig das Risiko für chronische nächtliche Atemnot, die sogenannte Schlafapnoe, stieg.[9] In den Zwanzigern und Dreißigern fiel ihm das Atmen immer schwerer, die Atemwege waren immer stärker blockiert. Sein Gesicht wuchs weiter in die Länge, was Tränensäcke, teigige Wangen, eine fliehende Stirn und eine vorstehende Nase zur Folge hatte.
Dieser atrophierte, unterentwickelte Mund, dieser Rachen und Schädel gehören leider mir.
Ich liege auf dem Untersuchungsstuhl des Zentrums für Kopf- und Halschirurgie des Department of Otorhinolaryngology an der Stanford University und schaue mich selbst an, vielmehr in mich selbst hinein. Seit mehreren Minuten schiebt der Nasen- und Nebenhöhlenchirurg Dr. Jayakar Nayak vorsichtig, aber beharrlich eine Endoskopkamera immer weiter in meine Nasenhöhle. Er ist inzwischen so tief in meinem Kopf, dass die Kamera auf der anderen Seite, im Kehlkopf, wieder herauskommt.
»Sagen Sie iii«, bittet er mich. Dr. Nayak hat eine Wolke schwarzer Haare auf dem Kopf, eine viereckige Brille auf der Nase, und er trägt Laufschuhe mit gepolsterten Sohlen und einen weißen Kittel. Aber ich kann weder seine Kleidung noch sein Gesicht sehen, weil ich eine Videobrille trage, mit der mir die Bilder dieser Reise durch die hügeligen Dünen, sumpfigen Marschwiesen und Stalaktiten in meinen schwer geschädigten Nasenhöhlen direkt vor Augen gebracht werden. Ich versuche, nicht zu husten oder zu würgen, während sich das Endoskop noch ein Stück weiter hinunterschiebt.
»Sagen Sie iii«, wiederholt Dr. Nayak. Ich sage iii und sehe, wie sich das weiche Gewebe um meinen Larynx, rosa, fleischig und schleimüberzogen, wie die Stop-Motion-Animation einer Blume auf einem Gemälde von Georgia O’Keeffe öffnet und wieder schließt.
Das ist keine Vergnügungsreise. 25 Trilliarden Moleküle[10] (250 mit 20 Nullen) machen diese Reise 18-mal pro Minute, 25 000-mal am Tag. Ich bin hier, um zu sehen, zu spüren und zu erfahren, wo diese Riesenmenge Luft in den Körper eintreten soll. Und ich bin hier, um mich für die kommenden zehn Tage von meiner Nase zu verabschieden.
Seit etwa 100 Jahren gilt die Nase in der westlichen Medizin mehr oder weniger als Hilfsorgan. Wir sollten mit ihr atmen, wenn möglich, so die Ansicht der Ärzte, aber wenn nicht, auch egal. Dafür haben wir ja den Mund.
Viele Ärzte, Forscher und Wissenschaftler hängen dieser Ansicht noch heute an. Die National Institutes of Health der USA haben 27 Abteilungen, jeweils eine für Lungen, Augen, Hautkrankheiten, Ohren und so weiter. Für die Nase und die Nasennebenhöhlen ist keine zuständig.
Dr. Nayak findet das absurd. Er leitet die rhinologische Forschung an der Stanford University und damit ein international anerkanntes Labor, das sich ganz auf die verborgenen Kräfte der Nase konzentriert. Er hat herausgefunden, dass diese Dünen, Stalaktiten und Marschen im menschlichen Kopf eine Vielzahl an Körperfunktionen steuern. Lebenswichtige Funktionen. »Diese Strukturen haben alle ihren Sinn!«, hat er mir zuvor erklärt. Dr. Nayak hat großen Respekt vor der Nase, die seiner Meinung nach missverstanden und unterschätzt wird. Deshalb will er auch unbedingt herausfinden, was mit dem Körper geschieht, wenn er ohne sie auskommen muss. Und deshalb bin ich hier.
Von heute an werde ich die nächste Viertelmillion Atemzüge mit Silikonstopfen verbringen, die meine Nasenlöcher verschließen, und noch zusätzlichen Pflasterstreifen darüber, die verhindern, dass auch der kleinste Lufthauch meine Nase verlässt oder in sie eintritt. Ich werde ausschließlich durch den Mund atmen – ein grässliches, erschöpfendes Experiment, bei dem ich mich elend fühlen werde, das aber einen klaren Zweck hat.
40 Prozent der heutigen Menschheit leiden unter chronisch verstopfter Nase, und etwa die Hälfte von uns sind chronische Mundatmer, wobei Frauen und Kinder am meisten betroffen sind.[11] Die Ursachen sind vielfältig: von trockener Luft bis zu Stress, von Entzündungen bis Allergien, von Luftverschmutzung bis Medikamentenunverträglichkeit.[12] Aber ein Großteil der Schuld trifft, so soll ich bald erfahren, den immer knapperen Platz im Vorderteil des menschlichen Schädels.
Wenn der Mund nicht in die Breite wachsen kann, neigt der Gaumen dazu, sich nach oben statt nach den Seiten zu dehnen, und bildet eine V-Form mit hoher Wölbung.[13] Das Höhenwachstum behindert die Entwicklung der Nasenhöhle, nimmt ihr Platz weg und stört ihr fein gegliedertes Innenleben. Der fehlende Platz in der Nasenhöhle führt zu Verstopfung und behindert den Luftstrom. Insgesamt hat der Mensch das traurige Prädikat der verstopftesten Spezies der Welt.
Ich muss es wissen. Bevor Dr. Nayak meine Nasenhöhle sondierte, hat er meinen Kopf geröntgt und eine scheibchenweise Bestandsaufnahme sämtlicher Winkel und Ecken in Mund, Nase und oberen Atemwegen gewonnen.
»Sie haben da … Zeug drin«, sagte er. Ich hatte nicht nur ein steiles Gaumendach, sondern auch eine »starke« Verengung im linken Nasenloch durch eine »stark« verkrümmte Nasenscheidewand. Meine Nebenhöhlen waren dazu voller Deformationsbildungen namens concha bullosa. »Extrem ungewöhnlich«, sagte Dr. Nayak. Das möchte man von seinem Arzt nicht hören.
Meine Atemwege waren so kaputt, dass Dr. Nayak sich wunderte, warum ich nicht noch mehr Infektionen und Atemprobleme gehabt hatte, an denen ich als Kind litt. Er war sich aber ziemlich sicher, dass ich für die Zukunft ernsthafte Schwierigkeiten beim Atmen zu erwarten hatte.
In den kommenden zehn Tagen erzwungener Mundatmung werde ich eine Art schleimiger Zukunftsschau betreiben, indem ich die schädlichen Auswirkungen auf meine Atmung und Gesundheit, die mit dem Alter immer schlimmer werden, verstärke und beschleunige. Ich werde meinen Körper in einen Zustand versetzen, den er schon kennt – den die halbe Menschheit kennt –, aber diesen Zustand um ein Vielfaches verstärken. »Okay, jetzt bitte stillhalten«, sagt Dr. Nayak. Er nimmt eine Stahlnadel mit einem Drahtbürstchen am Ende, etwa so groß wie ein Wimperntuschbürstchen. Ich denke noch: Das Ding will er mir ja wohl nicht in die Nase stecken. Ein paar Sekunden später steckt er mir das Ding in die Nase.
Ich schaue durch die Videobrille zu, wie Dr. Nayak die Bürste immer tiefer manövriert. Er schiebt so lange, bis die Bürste nicht mehr an meinen Nasenhaaren herumspielt, sondern sich mehrere Zoll tief in meinem Kopf bewegt. »Schön stillhalten«, mahnt er.
Wenn die Nasenhöhle verstopft, wird der Luftstrom schwächer und die Bakterien gedeihen. Diese Bakterien vermehren sich und können zu Infektionen und Erkältungen und stärkerer Verstopfung führen. Aus einer Verstopfung wird die nächste, und wir haben keine Wahl, als durch den Mund zu atmen. Niemand weiß, wie schnell das passiert. Niemand weiß, wie schnell sich Bakterien in einer verstopften Nasenhöhle ansammeln. Dr. Nayak braucht eine Kultur des Gewebes tief aus meiner Nasenhöhle, um das zu erforschen.
Ich zucke zusammen, als ich sehe, wie er die Bürste noch ein Stück tiefer schiebt und sie dann dreht, um eine Schicht Schleim abzuschrappen. Die Nervenenden so tief drin in der Nase sind dafür gedacht, sanfte Luftströmungen und geringe Temperaturschwankungen zu registrieren, nicht für Drahtbürsten. Dr. Nayak hat zwar ein lokales Betäubungsmittel in meine Nase getupft, aber ich spüre noch genug. Mein Gehirn weiß nicht recht, wie es reagieren soll. Es ist schwer zu erklären, wie sich das anfühlt – ungefähr so, als quälte jemand einen Siamesischen Zwilling von mir, der irgendwo außerhalb meines Kopfs existiert, mit Nadelstichen.
»Dass Sie so etwas durchmachen würden, haben Sie sich bestimmt nicht vorgestellt«, bemerkt Dr. Nayak lachend und legt die blutige Spitze des Bürstchens in einem Reagenzglas ab. Die 200 000 Zellen aus meinen Nebenhöhlen wird er in zehn Tagen mit einer weiteren Probe vergleichen, um die Wirkungen der Nasenverstopfung auf das Bakterienwachstum zu messen. Er schüttelt das Reagenzglas, reicht es seiner Assistentin und bittet mich höflich, die Videobrille abzunehmen und den Untersuchungsstuhl für den nächsten Patienten frei zu machen.
Patient Nummer zwei lehnt bereits am Fenster und fotografiert mit der Kamera seines Mobiltelefons. Er ist 49 Jahre alt, hat eine tiefe Sonnenbräune, weißes Haar und stahlblaue Augen. Er trägt fleckenlose beige Jeans und Lederslipper ohne Socken. Sein Name ist Anders Olsson, und er ist 8000 Kilometer weit aus Stockholm hierhergeflogen. Wie auch ich hat er 5000 Dollar lockergemacht, um sich an diesem Versuch zu beteiligen.
Ich hatte Olsson vor mehreren Monaten interviewt, nachdem ich auf seine Webseite gestoßen war. Sie hatte alle Warnzeichen des Verrückten: Archivfotos von Blondinen, die sich auf Berggipfeln in heldische Posen werfen, Neonfarben, viel zu viele Ausrufungszeichen und aufgeblähte, wabbelige Schriftarten. Aber Olsson war gar kein Verrückter. Er sammelte seit zehn Jahren Daten und betrieb ernsthafte wissenschaftliche Forschung. Er hatte Dutzende Beiträge im Internet veröffentlicht und im Selbstverlag ein Buch herausgebracht, in dem er die Atmung von der subatomaren Ebene an erklärt – alles belegt mit Hunderten von Studien. Außerdem war er inzwischen einer der angesehensten und gesuchtesten Atemtherapeuten Skandinaviens und hatte Tausenden Patienten mit der sanften Kraft des gesunden Atmens geholfen.
Als ich in einem unserer Skype-Gespräche erwähnte, dass ich für ein Experiment zehn Tage lang nur durch den Mund atmen würde, krümmte er sich. Als ich ihn fragte, ob er gerne mitmachen würde, weigerte er sich. »Nein, will ich nicht«, erklärte er. »Aber ich bin neugierig.«
Jetzt, einige Monate später, lässt Olsson seinen vom Jetlag erschöpften Körper auf den Untersuchungsstuhl fallen, setzt die Videobrille auf und holt zum letzten Mal für die folgenden 240 Stunden durch die Nase Luft. Neben ihm wirbelt Dr. Nayak das stählerne Endoskop wie ein Heavy-Metal-Schlagzeuger seine Sticks. »Okay, bitte den Kopf nach hinten legen«, sagt er. Er dreht das Handgelenk, biegt dem Patienten den Hals zurück, und schon ist er tief drin.
Das Experiment setzt sich aus zwei Phasen zusammen. Phase I besteht darin, dass wir beide die Nasen zugestöpselt bekommen und dann versuchen, unseren ganz normalen Alltag weiterzuführen. Wir werden essen, Sport treiben und schlafen wie immer, aber dabei die ganze Zeit durch den Mund atmen. In Phase II werden wir genauso essen, trinken, Sport treiben und schlafen wie in Phase I, aber den Atemweg wechseln, durch die Nase atmen und dabei jeden Tag einige Atemtechniken einüben.
Zwischen den beiden Phasen werden wir an die Stanford University zurückkehren und alle Untersuchungen wiederholen, die wir jetzt zu Beginn gemacht haben: Blutgase, Entzündungsmarker, Hormonspiegel, Geruchsvermögen, Rhinometrie, Lungenfunktion und so weiter. Dr. Nayak wird die Daten vergleichen, um zu erkennen, ob und was sich in unserem Gehirn und im Körper verändert hat, als wir unsere Atemtechnik wechselten.
Freunde, denen ich von dem Experiment erzählt habe, reagierten oft entsetzt. »Lass das bloß sein«, warnten mich ein paar Yoga-Adepten. Aber die meisten zuckten nur mit den Schultern. »Ich atme schon seit zehn Jahren nicht mehr durch die Nase«, murrte ein Freund, der schon fast sein ganzes Leben lang unter Allergien leidet. Alle anderen meinten etwas in der Art von: Na und? Atmen ist Atmen.
Stimmt das? Olsson und ich werden die kommenden 20 Tage damit verbringen, es herauszufinden.
Vor einer ganzen Weile, so etwa vier Milliarden Jahre, erschienen unsere allerfrühesten Vorfahren auf dem nackten Fels.[14] Wir waren damals noch sehr klein, ein mikroskopischer Schleimklumpen. Und wir hatten Hunger. Wir brauchten Kraft, um zu leben und uns zu vermehren. Wir fingen an, die Luft zu fressen.
Die Erdatmosphäre bestand damals großenteils aus Kohlendioxid – nicht der effizienteste Treibstoff, aber er reichte aus. Diese sehr frühen Versionen von uns lernten, wie man das Gas aufnimmt, in seine Bestandteile zerlegt und die Überbleibsel wieder ausspuckt, in diesem Fall den Sauerstoff. Eine Milliarde Jahre lang war der Urschleim damit befasst, Kohlendioxid einzusaugen, sich zu vermehren und dabei ständig Sauerstoff auszuscheiden.
Vor etwa zweieinhalb Milliarden Jahren hatte sich dann genug von dem ausgeschiedenen Sauerstoff in der Atmosphäre angesammelt, dass ein abfallfressender Organismus als Nächster in der Reihe unserer Vorfahren entstehen konnte, der ihn verdauen und davon leben konnte.[15] Das Ausscheidungsprodukt dieses Sauerstofffressers war Kohlendioxid – der erste aerobische Lebenskreislauf war angelaufen.
Und Sauerstoff liefert 16-mal mehr Energie als Kohlendioxid. Sauerstoff atmende Lebensformen bezogen genug Kraft daraus, um eine Evolution zu starten, sich weiterzuentwickeln, die schleimüberzogenen Felsen hinter sich zu lassen, zu wachsen und komplexer zu werden. Sie krabbelten an Land, tauchten tief ins Meer, stiegen in die Lüfte auf. Aus ihnen entstanden die Pflanzen, Bäume, Vögel und Bienen und auch die frühesten Säugetiere.[16]
Säugetiere entwickelten eine Nase, die ihre Atemluft vorwärmte und reinigte, einen Kehlkopf, der die Luft in die Lunge weiterleitete, und ein Netzwerk aus Säcken, die den Sauerstoff aus der Atemluft zogen und ihn ins Blut weitergaben. Die sauerstofffressenden Zellen, die viele Zeitalter zuvor den Schleim auf den Felsen entwickelt hatten, bildeten jetzt das Körpergewebe der Säugetiere. Diese Zellen entnahmen den Sauerstoff aus dem arteriellen Blut und gaben dafür Kohlendioxid ab, das in den Venen zurück in die Lungen und wieder an die Atmosphäre abgegeben wurde: Die Atmung war entstanden.
Die Fähigkeit, so effizient und auf verschiedene Weise zu atmen – bewusst und unbewusst; schnell, langsam, gar nicht –, ermöglichte unseren Säugetiervorfahren, ihre Beute zu fangen, Raubtieren zu entkommen und sich an verschiedene Lebensräume anzupassen.
Alles lief prächtig – bis vor etwa anderthalb Jahrmillionen, als die Atemwege, durch die wir Luft einzogen und wieder ausstießen, begannen, sich zu verschieben und zu spalten. Es war eine Verschiebung, die viel später in der Evolutionsgeschichte die Atmung jedes Menschen weltweit beeinträchtigen sollte.
Ich hatte mit diesen Spalten den Großteil meines Lebens über zu tun gehabt, und Sie wahrscheinlich auch: verstopfte Nase, Schnarchen, ein wenig Keuchen, Asthma, Allergien und so weiter. Ich hatte immer geglaubt, das sei normal für Menschen. Praktisch jeder, den ich kannte, hatte Probleme mit den Atemwegen.
Aber ich sollte erfahren, dass diese Probleme nicht zufällig entstanden. Sie hatten eine Ursache. Und die Lösung fand sich in einem verbreiteten und anheimelnd menschlichen Charakterzug.
Einige Monate vor dem Experiment an der Stanford University flog ich nach Philadelphia zu Dr. Marianna Evans. Die Orthodontistin und Gebissforscherin hat die vergangenen Jahre damit verbracht, historischen wie rezenten menschlichen Schädeln in den Mund zu spähen. Wir standen im Keller des Museums für Archäologie und Anthropologie der University of Pennsylvania, umgeben von mehreren Hundert solcher Schädel. Jeder war mit eingravierten Buchstaben und Ziffern versehen und mit seiner »Rasse« gestempelt: Beduine, Kopte, ägyptischer Araber, Schwarzer (gebürtig aus Afrika). Es gab brasilianische Prostituierte, arabische Sklaven und persische Häftlinge. Das berühmteste Exemplar, so hörte ich, war ein irischer Häftling, der 1824 gehängt worden war, weil er Mithäftlinge umgebracht und aufgegessen hatte.
Die Schädel waren zwischen 200 und mehrere Tausend Jahre alt. Sie gehörten zur Morton Collection, einer nach dem rassistischen Naturforscher Samuel Morton benannten Sammlung. Er hatte in den 1830er-Jahren angefangen, Skelette zu sammeln, um die Überlegenheit der weißen Rasse zu beweisen. Das war ihm zwar nicht gelungen, aber immerhin hat er uns die Schädel hinterlassen, die er über viele Jahre zusammengetragen hat und die uns jetzt Momentaufnahmen liefern, wie die Menschen früher ausgesehen und geatmet haben.
Wo Morton minderwertige Rassen und genetischen »Verfall« sehen wollte, entdeckte Dr. Evans etwas nahezu Vollkommenes. Um mir zu zeigen, was sie meinte, ging sie zu einer der Vitrinen hinüber und holte einen der Schädel, der mit Parsee (gemeint war »Perser«) beschriftet war, hinter dem schützenden Glas hervor. Mit dem Ärmel ihres Kaschmirpullovers wischte sie den Staub vom Schädel und fuhr mit einem adrett manikürten Fingernagel über Kiefer und Gesicht.
»Die hier sind doppelt so groß wie heutige«, erklärte sie mit dem Stakkato ihres ukrainischen Akzents und zeigte dabei auf die Choanen oder posterioren Nasalaperturen, die beiden Öffnungen der Nasenhöhle in die Mund- und Rachenhöhle, die zu den Nasengängen führen. Sie drehte den Schädel herum, sodass er uns anstarrte. »Breit und ausgeprägt«, meinte sie anerkennend.
Dr. Marianna Evans hat mit ihrem Kollegen Dr. Kevin Boyd, einem Kinderzahnarzt aus Chicago, in den vergangenen vier Jahren über hundert Schädel aus der Morton Collection geröntgt und die Winkel zwischen Ohrenspitze und Nase und zwischen Stirn und Kinn gemessen. Diese Messgrößen, die sogenannte Frankfort-Ebene und N-Perpendikular-Ebene, zeigen die Symmetrie jeden Exemplars, wie wohlproportioniert der Mund im Verhältnis zum Gesicht, die Nase im Verhältnis zum Gaumen war, und damit letztlich auch, wie gut die Inhaber dieser Schädel atmen konnten.
Bei sämtlichen alten Schädeln der Sammlung fanden sich dieselben Merkmale wie bei diesem Parsee. Sie hatten allesamt mächtige vorstehende Kiefer, weite Nasenhöhlen und breite Münder. Und außerdem hatte kein Einziger von ihnen schiefe oder übereinanderstehende Zähne, obwohl sie ja ihre Zähne nicht geputzt hatten und nie zum Zahnarzt gegangen waren.[17]
Das vorwärtsgerichtete Gesichtswachstum und die großen Mundhöhlen vergrößerten auch die Atemwege. Diese Menschen haben wahrscheinlich nie geschnarcht, litten nicht an Schlafapnoe oder Nebenhöhlenentzündung und den vielen anderen chronischen Atemwegsproblemen heutiger Menschen, und zwar, weil sie es gar nicht konnten. Ihre Mundhöhlen waren viel zu groß, ihre Atemwege zu geräumig, als dass etwas sie hätte verstopfen können. Sie konnten leicht atmen. Fast allen frühen Menschen ist dieser vorwärtsgerichtete Schädelbau gemeinsam – nicht nur in der Morton Collection, sondern weltweit. Das war seit dem ersten Erscheinen des Homo sapiensvor etwa 300 000 Jahren so und blieb so bis vor wenigen Hundert Jahren.
Dr. Evans und Dr. Boyd verglichen die historischen Schädel mit denen heutiger Menschen – ihrer eigenen Patienten und anderer. Jeder einzelne wies genau umgekehrte Merkmale auf: Die Winkel der Frankfort- und N-Perpendikular-Ebenen hatten sich umgekehrt, das Kinn war hinter die Stirn zurückgewichen, der Kiefer war nach hinten gerutscht, die Nebenhöhlen geschrumpft. Alle rezenten Schädel wiesen mehr oder weniger schiefe Zähne auf.
Unter den 5400 Arten von Säugetieren ist der Mensch die einzige, bei der Kieferfehlstellungen, Überbiss, Unterbiss und übereinandergeschobene Zähne, medizinisch als Malokklusion bezeichnet, der Normalfall sind.
Für Dr. Evans stellte sich eine grundlegende Frage: »Wieso macht unsere Evolution uns krank?« Sie stellte den Parsee-Schädel wieder in die Vitrine und nahm einen anderen mit der Aufschrift Saccard heraus. Seine vollkommene Gesichtsform war ein Spiegelbild der anderen. »Das versuche ich herauszufinden«, sagte sie.
Evolution, so erklärte Dr. Evans weiter, bedeutet nicht immer Fortschritt, sondern Veränderung, und das Leben kann sich zum Besseren wie zum Schlechteren verändern. Der menschliche Körper verändert sich heute auf eine Art und Weise, die nichts mehr mit dem »Überleben des Stärksten« zu tun hat. Vielmehr entwickeln und vererben wir Merkmale, die unserer Gesundheit abträglich sind. Diese Theorie, die der sogenannten Dysevolution, wurde durch den an der Harvard University lehrenden Biologen Daniel Lieberman bekannt und erklärt, warum wir Rückenschmerzen und wehe Füße haben und unsere Knochen spröde werden.[18] Dysevolution erklärt auch, warum wir solche Mühe mit dem Atmen haben.
Um zu verstehen, wie und warum das geschah, so Dr. Evans, müsse ich weit zurück in der Zeit gehen. Sehr weit, in eine Zeit, als der Homo sapiens noch nicht einmal sapiens war.
Was für seltsame Geschöpfe! Sie stehen im hohen Gras der Savanne, mit schlenkernden Armen und spitzen Ellenbogen, und schauen unter Stirnen, die wie haarige Visiere aussehen, in die weite wilde Welt hinaus. Die Brise streicht über das Gras, und unsere Nüstern, groß wie Bonbons, schnuppern senkrecht über unseren kinnlosen Kiefern, um aufzufangen, was der Wind an Gerüchen mitbringt.
Das war vor 1,7 Millionen Jahren, und der erste Frühmensch, Homo habilis, durchwanderte Ostafrika. Wir waren schon lange von den Bäumen herabgestiegen, hatten gelernt, auf den Hinterbeinen zu laufen und den kleinen Extrafinger an der Innenseite der Hand umzudrehen, und ihn den übrigen Fingern gegenüberzustellen. Mit diesem Greifwerkzeug konnten wir zum Beispiel Gräser und andere Pflanzen aus dem Boden ziehen, Wurzeln ausgraben und Steine zu Jagdwerkzeugen machen, die scharf genug waren, um einer erlegten Antilope die Zunge herauszuschneiden und ihr Fleisch zu entbeinen.[19]
Dieses rohe Fleisch zu essen war dann allerdings mühsam und langwierig. Wir sammelten also Steine und klopften die Beute damit weich. Weich geklopfte Nahrungsmittel, besonders Fleisch, waren leichter zu kauen und zu verdauen. Damit sparten wir Energie, und die investierten wir in ein größeres Gehirn.[20]
Die Jagdbeute zu braten war noch besser.[21] Vor etwa 800 000 Jahren fingen wir an, unser Essen im Feuer zuzubereiten, und das setzte enormen zusätzlichen Nährwert darin frei.[22] Unser Dickdarm, der dafür zuständig war, grobe, faserige Früchte und Gemüse zu verarbeiten, schrumpfte durch diese neue Ernährung beträchtlich, und allein das sparte eine Menge weiterer Energie. Dieser neue Frühmensch, Homo erectus,legte sich davon ein noch größeres Gehirn zu[23] – um erstaunliche 50 Prozent voluminöser als das seines Vorfahren Homo habilis.[24]
Langsam sahen wir nicht mehr wie Affen, sondern wie Menschen aus. Könnten wir einen Homo erectus in einen Straßenanzug stecken und in die U-Bahn setzen, fiele er dort vermutlich nicht weiter auf.[25] Diese frühen Vorfahren des heutigen Menschen waren uns genetisch bereits ähnlich genug, dass wir uns vermutlich fruchtbar hätten mit ihnen kreuzen können.
Die Neuerung, Nahrungsmittel weich zu klopfen und zu braten, hatte allerdings Folgen. Das Gehirn wuchs rasch und brauchte Platz, und den nahm es sich aus dem Gesichtsschädel auf Kosten unserer Nasen- und Mundhöhlen und Atemwege. Mit der Zeit lockerten sich die Muskeln in der Mitte des Gesichts, die Kieferknochen wurden schwächer und dünner. Das Gesicht verkürzte sich, die Mund- und Nasenpartie schrumpfte und ließ nur einen Knochen- und Knorpelvorsprung zurück, der die stumpfe Schnauze unserer Vorfahren ersetzte. Dieser neue Gesichtszug, die vorstehende Nase, gehörte uns allein und unterschied uns von allen anderen Primaten.
Das Problem war nur, dass diese kleine, senkrecht angeordnete Nase die Luft schlechter filterte und uns Krankheitskeimen und Bakterien in der Atemluft aussetzte.[26] Die kleinere Nasen- und Mundhöhle ging mit einem verkleinerten Rachen einher. Je mehr wir unser Essen brieten, je mehr weiche, kalorienreiche Nahrung wir zu uns nahmen, desto mehr wuchs unser Gehirn und schrumpften unsere Atemwege.[27]
Homo sapiens entstand vor rund 300 000 Jahren in der afrikanischen Savanne. Wir gehörten damals zu einer ganzen Clique von Menschenarten: Homo heidelbergensis, ein robuster Geselle, der schon Schutzdächer baute und Großwild jagte, im heutigen Europa; Homo neanderthalensis, der Neandertaler, mit seiner dicken Nase und den kurzen Beinen, der gelernt hatte, sich zu bekleiden, und auch in kalten Gegenden gedieh;[28] und Homo naledi, ein Rückschritt in Richtung Frühmensch mit winzigem Gehirn, breiten Hüften und dünnen Armen, die von einem stämmigen Torso baumelten.[29]
Was wäre das für ein Anblick gewesen, dieser zusammengewürfelte Haufen, wenn sich alle diese Menschenarten abends an einem lodernden Lagerfeuer versammelt hätten, eine Krieg-der-Sterne-Kantine der Urmenschen, die Flusswasser aus der hohlen Hand tranken, einander lausten, ihre Brauenwölbungen verglichen und hinter Felsblöcken verschwanden, um im Sternenschein artenübergreifenden Sex zu genießen!
Dann waren sie alle verschwunden. Der Neandertaler mit der großen Nase, der ungeschlachte naledi und der stiernackige heidelbergensis wurden von Krankheiten, Klimaverschlechterung, anderen Menschenarten, Tieren, Faulheit oder was auch immer ausgerottet. Nur eine einzige Art des langen Stammbaums blieb übrig: wir.
In kälteren Zonen wurde unsere Nase länger und schmaler, um die Luft besser zu erwärmen, bevor sie in die Lunge strömte; unsere Haut hellte sich auf, um mehr Sonnenlicht für die Erzeugung von Vitamin D aufnehmen zu können. In sonnigen, warmen Gegenden hingegen wurde die Nase breiter und flacher,[30] besser geeignet zum Einatmen feuchtwarmer Luft;[31] unsere Haut wurde dunkler, um uns vor der Sonne zu schützen. Gleichzeitig rutschte auch der Kehlkopf tiefer in den Rachen hinunter, um eine weitere Anpassung zu ermöglichen: Verständigung durch Lautäußerungen.
Der Kehlkopf ist eine Art Ventil, das den Durchgang von Nahrung in die Speiseröhre regelt und uns davor bewahrt, die Nahrung sowie andere Fremdkörper einzuatmen. Alle anderen Tiere – und auch alle anderen Homo-Arten – hatten den Kehlkopf höher sitzen, ganz oben im Rachen. Das war sinnvoll, weil ein hoch sitzender Kehlkopf am effektivsten ist und ein schnelles Aushusten etwaiger Fremdkörper gestattet.
Als der Mensch aber anfing zu sprechen, sank der Kehlkopf nach unten,[32] um die Mundhöhle nach hinten zu vergrößern und eine breitere Palette von Lautäußerungen und Lautstärkestufen zu ermöglichen.[33] Schmalere Lippen ließen sich leichter kontrollieren als wulstige, also wurden unsere Lippen dünner. Mit beweglicheren und geschickteren Zungen ließen sich Schattierung und Struktur der Laute besser kontrollieren, also rutschte die Zunge weiter nach unten im Kehlkopf und schob den Unterkiefer nach vorne.
Aber dieser abgesenkte Kehlkopf war nun weniger gut für seine ursprüngliche Bestimmung geeignet. Hinten im Mund war jetzt zu viel Platz; der Frühmensch war in Gefahr zu ersticken, wenn ihm Fremdkörper dort hineingerieten.[34] Ein zu großer Bissen oder kleinere, die zu schnell oder unachtsam geschluckt wurden, verstopften uns die Atemwege. Homo sapiens war das einzige Tier und die einzige Menschenart, die leicht an ihrer Nahrung ersticken konnte.
Seltsamerweise und traurigerweise sollten also dieselben evolutionären Entwicklungen, die unsere Vorfahren klüger, gewandter und langlebiger als andere Tiere machten – die Beherrschung des Feuers, die Zubereitung von Nahrungsmitteln, ein großes Gehirn und die Fähigkeit, sich mit einem großen Repertoire an Schallsignalen zu verständigen –, uns Mund und Rachen zusammendrücken und das Atmen erschweren. Dass unsere Atemwege schrumpften, sollte uns viel später sogar in Gefahr bringen, im Schlaf an unserem eigenen Körper zu ersticken: Wir fingen an zu schnarchen.[35]
Den Frühmenschen selbst war das natürlich egal. Zehntausende Jahre lang benutzten unsere Vorfahren ihren überentwickelten Kopf und hatten keine Probleme beim Atmen. Mit Nase, Stimme und Riesengehirn bewaffnet eroberte der Mensch die Welt.
Ich hatte seit dem Besuch bei Dr. Marianna Evans vor einigen Monaten immer wieder an unsere haarigen Ahnen denken müssen. Da hockten sie auf den Felsen der afrikanischen Küste, artikulierten mit ihren beweglichen Lippen die ersten Vokale, holten durch gähnende Nasenlöcher tief Atem und mampften gegrilltes Kaninchen mit ihren vollkommenen Zähnen.
Ich hingegen hänge hier mit schlaffem Kiefer unter einer LED-Lampe, starre auf die Wikipedia-Website zu Homo floresiensis auf meinem Smartphone und nage mit meinen schiefen Zähnen an einem kohlenhydratarmen Riegel, keuche und hechele und bekomme durch meine verstopfte Nase keine Luft. Überhaupt keine.
Es ist der Abend meines zweiten Tages im Mundatmer-Experiment der Stanford University. Ich liege im Bett, die Nasenlöcher mit festgetapten Silikonstöpseln verstopft. In den vergangenen Nächten habe ich mich in einen Teil meines Hauses zurückgezogen, der normalerweise Verwandten und Freunden vorbehalten ist. Ich hatte das Gefühl, mein neues Leben als Mundatmer könne eine Belastung für meine Frau sein. Jetzt, da ich hier liege, mich rastlos herumwälze, über Höhlenmenschen grübele und nicht schlafen kann, bin ich froh, dass ich umgezogen bin.
Ums Handgelenk trage ich ein Pulsoximeter in der Größe eines Streichholzbriefchens geschnallt. Ein rot leuchtendes Kabel geht von ihm aus und schlingt sich um den Mittelfinger. Alle paar Sekunden zeichnet das Gerät meine Pulsfrequenz und den Blutsauerstoffspiegel auf. Mit dieser Information rechnet es aus, wie oft und wie heftig meine zu tief liegende Zunge in meinem zu kleinen Mund festsitzt, sodass ich unfreiwillig den Atem anhalte – besser bekannt als Schlafapnoe.
Um festzustellen, wie schlimm mein Schnarchen und die Apnoe sind, habe ich eine App auf mein Smartphone heruntergeladen, die während der Nacht durchgängige Tonaufzeichnungen macht und daraus jeden Morgen einen minutengenauen Graphen erstellt, der mir sagt, wie gesund meine Atmung ist. Eine Nachtsicht-Überwachungskamera über dem Bett hält jede meiner Bewegungen fest.
Rachenentzündungen und Polypen verschlimmern Schnarchen und Schlafapnoe noch. Nasenverstopfung löst das nächtliche Luftanhalten ebenfalls aus, aber niemand weiß, wie schnell die Schädigung eintritt oder wie schwer sie werden kann.[36] Bis jetzt hatte das noch niemand getestet.
In der vergangenen Nacht, meiner ersten mit freiwilliger Nasenverstopfung, habe ich 1300 Prozent mehr geschnarcht, insgesamt 75 Minuten. Bei Olsson war es noch schlimmer. Er hatte vorher gar nicht geschnarcht, jetzt waren es vier Stunden und zehn Minuten. Meine Schlafapnoe-Anfälle hatten sich vervierfacht. Das alles in nur 24 Stunden.
Jetzt, da ich hier liege, muss ich mich schon zum Durchhalten zwingen, sosehr ich auch um des Experiments willen versuche, mich zu entspannen. Alle 3,3 Sekunden kommt ein weiterer Stoß ungefilterter, unbefeuchteter und ungewärmter Luft durch meinen Mund, trocknet die Zunge aus, reizt den Rachen und verärgert die Lungen. Und weitere 175 000 Atemzüge stehen mir noch bevor.
2 Mundatmung
Es ist Viertel nach acht, und Olsson kommt wie Kramer in Seinfeld durch die Seitentür in die Gästewohnung im Erdgeschoss gestürmt, in der ich mich eingerichtet habe. »Guten Morgen!«, ruft er laut. Seine Nasenlöcher sind mit Silikonkügelchen verstopft, er trägt abgeschnittene Jogginghosen und ein Sweatshirt von Abercrombie & Fitch.
Olsson hat ein Studio-Apartment für einen Monat gemietet, direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite – nahe genug, um im Schlafanzug vorbeizuschauen, aber nicht nahe genug, um dabei nicht ziemlich lächerlich auszusehen. Sein ehemals gebräuntes, strahlendes Gesicht ist inzwischen hager und fahl, und er sieht wie Gary Busey auf diesem Verbrecheralbumbild aus. Er hat dieselbe abgedrehte Miene wie gestern, dasselbe angespannte Grinsen wie vorgestern und am Tag davor.
Heute haben wir die Hälfte der Mundatmungsphase des Experiments hinter uns, und auch heute setzt sich Olsson wie an jedem anderen Tag dreimal – morgens, mittags, abends – mir gegenüber an den Tisch. Eins, zwei, drei – wir werfen einen Haufen piepsender und rülpsender Geräte an, die sich vor uns auf dem Tisch stapeln, legen uns Manschetten um die Arme, klemmen Sensoren an die Ohren, stecken Thermometer in den Mund und fangen an, unsere physiologischen Daten in Tabellen zu notieren. Das digitale Display zeigt, was es schon an den vergangenen Tagen gezeigt hat: Mundatmung ist schlecht für die Gesundheit.
Mein Blutdruck ist gegenüber dem Wert vor dem Experiment um 13 Punkte gestiegen, was mich tief ins Stadium 1 des Bluthochdrucks versetzt. Bleibt dieser chronisch erhöhte Blutdruck, wie ihn ein Drittel der US-Amerikaner hat, unbehandelt, kann er Herz- und Schlaganfälle und andere ernsthafte Leiden verursachen.[37] Die Variabilität meines Herzschlags, ein Maß für das Gleichgewicht des Nervensystems, ist dagegen stark abgesunken, was auf eine starke Stressbelastung des Körpers deutet. Meine Pulsfrequenz ist angestiegen, meine Körpertemperatur gefallen und meine Geistesklarheit völlig abgestürzt. Bei Olsson sieht es nicht besser aus.
Am schlimmsten ist aber, wie wir uns fühlen: grässlich. Jeden Tag scheint es schlimmer zu werden. Und jeden Tag um genau diese Zeit beendet Olsson seinen letzten Test, zieht sich die Atemmaske aus dem watteweißen Haar, steht auf und rammt sich die Silikonstopfen ein bisschen tiefer in die Nasenlöcher. Er zieht sein Sweatshirt wieder über, sagt »Bis später« und geht. Ich nicke und schaue ihm nach, wie er in seinen Hausschuhen durch den Korridor und zurück über die Straße trabt.
Den letzten Test, beim Essen, erledigen wir alleine. In beiden Phasen des Experiments essen wir zur selben Zeit dasselbe und zeichnen dabei laufend unseren Blutzuckerspiegel auf. Täglich gehen wir dabei dieselbe Anzahl Schritte, um festzustellen, wie Mundatmung und Nasenatmung sich jeweils auf Gewicht und Stoffwechsel auswirken. Heute besteht das Frühstück aus drei Eiern, einer halben Avocado, einem Stück Graubrot und einer Kanne Lapsang-Souchong-Tee. Das heißt, dass ich in zehn Tagen wieder in dieser Küche sitzen und genau diese Mahlzeit einnehmen werde.
Nach dem Essen wasche ich ab, räume benutzte Filter, pH-Messstreifen und Post-it-Zettel aus dem Wohnzimmerlabor und beantworte ein paar E-Mails. Manchmal sitzen Olsson und ich herum und versuchen, bequemere und effektivere Methoden zu finden, unsere Nasen zu verstopfen: wasserdichte Ohrstöpsel (zu hart), Schaumgummi-Ohrstöpsel (zu weich), Nasenklemmen für Schwimmer (zu schmerzhaft), ein CPAP-Nasenkissen (trägt sich angenehm, sieht aber wie ein BDSM-Sexspielzeug aus), Toilettenpapier (zu luftdurchlässig), Kaugummi (zu schleimig) und zu guter Letzt chirurgisches Klebeband über Silikon- oder Schaumgummi-Ohrstöpseln. Das scheuert und wird zu warm, ist aber immer noch die am wenigsten grässliche Methode.
Die meiste Zeit über – den ganzen Tag, jeden Tag seit fünf Tagen inzwischen – sitzen Olsson und ich alleine in unseren Wohnungen und hassen das Leben. Ich fühle mich oft wie gefangen in einer schlechten Sitcom ohne Lacher, wie Bill Murray in der Rolle des Wetteransagers Phil Connors in dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier, der in einer Zeitschleife festsitzend immer denselben elenden Tag erleben muss.
Heute gibt es immerhin eine Abwechslung. Olsson und ich wollen eine Fahrradtour machen, allerdings weder auf der Strandpromenade noch im Schatten der Golden-Gate-Brücke, sondern hinter den Betonmauern und im Leuchtstoffröhrenlicht eines Fitnessstudios in der Nähe.
Das Radfahren war Olssons Idee. Er forscht seit zehn Jahren über die Leistungsunterschiede bei Nasen- und Mundatmern im Sport. Er hat eigene Studien zu CrossFit-Sportlern durchgeführt und mit Trainern zusammengearbeitet. Dabei war er zu der Überzeugung gelangt, dass Mundatmung den Körper in einen Stresszustand versetzt, der zu schnellerer Erschöpfung und einem Rückgang der sportlichen Leistung führt. Er hat darauf bestanden, dass wir uns an einigen Tagen während der beiden Phasen des Experiments auf Standfahrräder schwingen und bis an die Grenze unserer aerobischen Möglichkeiten in die Pedale treten. Daher wollen wir uns um Viertel nach zehn am Studio treffen.
Ich ziehe ein Paar Shorts an, schnappe mir den Fitnesstracker, ein Extrapaar Silikonstöpsel und eine Wasserflasche und gehe durch den Garten hinaus. Am Zaun wartet Antonio, ein Handwerker und langjähriger Freund, der mit Renovierungen im oberen Stockwerk beauftragt ist. Er schaut zu mir herüber, und bevor ich mich durchs Gartentürchen davonmachen kann, sind ihm schon die rosa Ohrstöpsel in meiner Nase aufgefallen. Er lässt einen Armvoll Dachsparren fallen und kommt angelaufen, um sich das genauer anzusehen.
Ich kenne Antonio seit 15 Jahren; er kennt die Geschichten meiner seltsamen Recherchen an merkwürdigen Orten und war bis jetzt immer interessiert und verständnisvoll. Als ich ihm jetzt von dem Experiment erzähle, kann er das nicht mehr nachvollziehen.
»Keine gute Idee«, sagt er. »Als ich noch klein war, in der Schule, sind die Lehrer immer durch die Bankreihen gegangen, Mann, und klatsch-klatsch-klatsch.« Er schlägt sich demonstrierend mit der eigenen Hand an den Hinterkopf. »Wenn du durch den Mund geatmet hast, kriegtest du eins übergezogen.« Mundatmung, erläutert er mir, macht krank und ist respektlos, und deshalb haben er und alle anderen, die im mexikanischen Puebla aufgewachsen sind, gelernt, durch die Nase zu atmen.
Seine Frau Janet, berichtet Antonio weiter, leidet an chronischer Nasenverstopfung, und ihre Nase läuft dauernd. Janets Sohn Anthony ist chronischer Mundatmer, bei ihm kündigen sich dieselben Leiden an. »Ich sage ihnen immer wieder, das ist schlecht, und sie versuchen aufzuhören. Aber es ist nicht leicht, Mann.«
Eine ganz ähnliche Geschichte habe ich vor ein paar Tagen von einem indischstämmigen Briten namens David gehört, als Olsson und ich zum ersten Mal mit verstopfter Nase die Golden-Gate-Brücke entlangjoggten. David fielen unsere Nasenbandagen auf. Er sprach uns an, fragte, was das solle, und erzählte uns anschließend, seine Nase sei schon immer verstopft. »Entweder sie ist zu, oder sie läuft. Richtig offen ist sie eigentlich nie.« Er spritzt sich seit 20 Jahren alle möglichen Medikamente in die Nasenlöcher, aber die wirkten mit der Zeit immer weniger. Inzwischen leidet er an chronischen Atemwegserkrankungen.
Um mir nicht noch mehr Leidensgeschichten anhören zu müssen oder unerwünschte Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, gehe ich nur noch vor die Tür, wenn es sein muss. Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Leute in San Francisco mögen ihre Originale. Eine Zeit lang konnte man auf der Haight Street einem Mann begegnen, dessen Jeans ein Loch am Hintern hatten, damit sein Schwanz – ein wirklicher Schwanz am Steißbein, ein evolutionärer Atavismus – frei schwingen konnte. Kaum jemand schaute zweimal hin.
Ende der Leseprobe