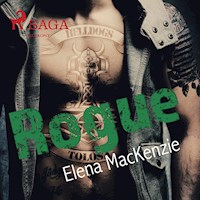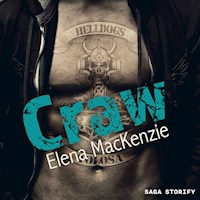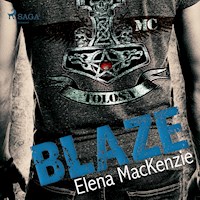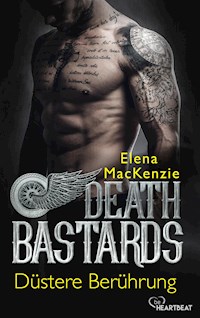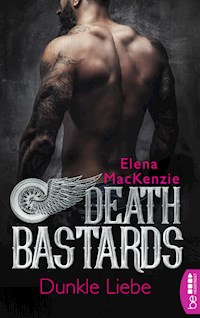5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Romance Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nur noch eine letzte Schicht in der Bar, dann kann Raven die Kleinstadt Black Falls endlich hinter sich lassen und hoffentlich so der Dunkelheit entkommen, die sie schon ihr ganzes Leben lang quält. Doch sie hat nicht mit Ice gerechnet, der in die Stadt gekommen ist, um sich an ihrem Vater zu rächen. Plötzlich findet sie sich kniend auf dem Waldboden wieder und starrt in den Lauf einer Waffe. Ist es Glück, dass Ice es nicht fertigbringt, sie zu töten und sie stattdessen entführt? Obwohl er sie in seiner Gewalt hat und damit droht, sie für seine Rache zu benutzen, spricht er die verhasste Dunkelheit in ihr an und löst so etwas aus, das sie beide in einem alten Krieg auf die selbe Seite zwingt und Raven in eine fremde Welt. Ice Ich will meinen Bruder beschützen. Wenn nötig, um jeden Preis. Aber ich habe nicht mit Raven gerechnet. Sie ist die Tochter des Mannes, der meine Mutter getötet hat. Und der jetzt meinen Bruder jagt. Sie zu entführen, war der größte Fehler meines Lebens oder ihre Rettung. Raven In mir gibt es schon immer diese Dunkelheit, die mich dazu zwingt, Dinge zu tun, die nicht gut für mich sind. Als Ice mich entführt, spricht er genau diese Seite in mir an und löst etwas aus, dem wir beide uns nicht entziehen können. Eine spannende Geschichte voller Mythen, wo nichts so ist wie zu Anfang gedacht und an deren Ende das Credo steht: Sei stets Du selbst! Valeska Réon, Autorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
BREATHE
GEFANGEN
ELENA MACKENZIE
INHALT
Für Dich
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Danksagung
Nichts mehr verpassen
Copyright: Elena MacKenzie
Lektorat: Valeska Leon
Cover: Elena MacKenzie unter Verwendung von Bildmaterial von Adobe Photostock.
Kontakt: Elena MacKenzie
Dr.-Karl-Gelbke-Str. 16
08529 Plauen
ÜBER DIESES BUCH
Nur noch eine letzte Schicht in der Bar, dann kann Raven die Kleinstadt Black Falls endlich hinter sich lassen und hoffentlich so der Dunkelheit entkommen, die sie schon ihr ganzes Leben lang quält. Doch sie hat nicht mit Ice gerechnet, der in die Stadt gekommen ist, um sich an ihrem Vater zu rächen. Plötzlich findet sie sich kniend auf dem Waldboden wieder und starrt in den Lauf einer Waffe. Ist es Glück, dass Ice es nicht fertigbringt, sie zu töten und sie stattdessen entführt? Obwohl er sie in seiner Gewalt hat und damit droht, sie für seine Rache zu benutzen, spricht er die verhasste Dunkelheit in ihr an und löst so etwas aus, das sie beide in einem alten Krieg auf die selbe Seite zwingt und Raven in eine fremde Welt.
FÜR DICH
1
Für einen Moment schließe ich die Augen und sauge den schwachen Duft ihres Shampoos ein, der noch für wenige Sekunden, nachdem sie an meinem Tisch war, in der Luft hängt. Es ist ein fruchtig-frischer Duft, der gut zu Raven passt. Nicht zu süß, nicht zu dominant, eher wie ein warmer Tag auf einer Sommerwiese. Als ich nach Black Falls gekommen bin, hätte ich nicht gedacht, dass Sherwood eine so gut aussehende Tochter zustande gebracht hat. Der alte Mann hat nichts an sich, das annähernd attraktiv ist. Seine Tochter muss ihr Aussehen den Genen ihrer Mutter zu verdanken haben, die vor einem halben Jahr einfach die Stadt verlassen hat. Wenn ich den Gerüchten in der Kleinstadt glauben darf, musste Raven aber schon viel länger ihr Leben allein in den Griff bekommen.
Eigentlich bin ich wegen der Mutter gekommen. Sie wollte ich töten. Dass es eine Tochter gibt, habe ich nur zufällig herausgefunden. Sherwood hat niemandem von einer Tochter erzählt. Nicht einmal mir, seinem Stiefsohn. Ich bezweifle, dass meine Mutter von seiner zweiten Familie wusste. Meiner Mutter war bewusst, dass es eine Exfrau gibt, aber dass Sherwood sie immer wieder besucht hat in all den Jahren und sogar eine Tochter mit ihr hat, das hat sie bestimmt nicht geahnt. Ich kann ihm nicht einmal verübeln, dass er Raven geheimgehalten hat. Er wollte sie vor unserer Welt schützen. Ganz offensichtlich hat sie nichts mit dieser Welt zu tun. Sie ist nicht wie wir.
Seit einer Woche sitze ich jetzt schon Abend für Abend in dieser dunklen Ecke des Pubs und beobachte Raven dabei, wie sie Tische abwischt, Bierkrüge füllt und Gäste bedient, statt endlich meinen Plan umzusetzen. Ich schiebe das, was nötig ist, nur hinaus, indem ich weiter hier sitze und darauf hoffe, dass Sherwoods Frau nach Black Falls zurückkehrt. Aber sie wird nicht zurückkommen. Ich habe mich mit fast jedem hier unterhalten, und sie alle haben berechtigte Zweifel, dass Ravens Mutter jemals zurückkommen wird. Sie hat ihre Tochter einfach allein zurückgelassen. Und Sherwood scheint keine Ahnung davon zu haben, sonst wäre er jetzt hier, um Raven vor mir zu beschützen.
Stöhnend reibe ich mir über das unrasierte Kinn und schließe die Augen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles ist jetzt anders. Mein Plan war, nach Black Falls zu kommen, mir Sherwoods heimliche Schlampe zu schnappen und mit ihr irgendwo in einen Wald zu fahren, wo ich sie umbringen wollte. Sherwood wäre dabei noch gut weggekommen, immerhin hätte ich seine Frau nur abgeknallt. Das ist so viel netter als das, was er meiner Mutter angetan hat.
Meine Augen öffnen sich ganz von allein, als ich das helle Lachen von Raven höre. Vor ihr steht schon wieder dieser Typ, der ständig in ihrer Nähe herumhängt und versucht, zwischen ihre Beine zu kommen. Raven scheint nicht einmal zu merken, was er vorhat, sie lacht zwar über seine Witze, aber ihr gelangweilter Blick zeigt deutlich ihr Desinteresse. »Junge, du hast keine Chance«, murmle ich. »Ein Mädchen wie die bekommst du nicht ins Bett.«
Raven ist eine Schönheit, nicht einmal ihre zerschlissene Kleidung und ihre kurze knabenhafte Frisur können das verstecken. Auch nicht, dass sie selbst keine Ahnung hat, wie sie auf Männer wirkt. Sogar mir wird ganz heiß im Magen, wenn ich ihren Hüftschwung sehe und ihren nachdenklichen Blick auf mir spüre. Sie sieht mich häufig an. Immer dann, wenn sie glaubt, ich würde es nicht bemerken. Wahrscheinlich versucht sie nur herauszufinden, wer ich bin und was ich hier will. In diesem Kaff kennt jeder jeden, niemand bleibt freiwillig länger als nötig. Deswegen falle ich hier auf. Alle in dieser Bar sehen mich mit diesem Blick an, selbst nach Tagen noch. Vielleicht auch genau deswegen, weil ich schon viel zu lange hier bin und mit all meinen Tattoos nicht in diese Spießerwelt passe.
»Du verlässt die Stadt?«, höre ich den Jungen entrüstet ausrufen. Er dürfte ein paar Jahre jünger sein als Raven, aber ist bis über beide Ohren verknallt in sie. Er schiebt die Hände in seine Jeans und tritt etwas vom Tresen zurück, der die beiden trennt. Seine schlaksige Figur wirkt plötzlich noch viel kindlicher. Auf sein Gesicht ist Trotz und Unverständnis getreten. Was gibt es daran nicht zu verstehen, dass eine Frau wie Raven hier nicht versauern will? Sie gehört hier ebenso wenig her wie ich. In ihrem Blick liegt ein Feuer, das Teile von mir entzündet, die ich schon vor einer Weile vergessen hatte. Auf der Flucht denkt man nicht oft an Frauen, schon gar nicht, wenn man mit seinem kleinen Bruder unterwegs ist. Aber Raven hat mich in der ersten Sekunde, in der ich sie gesehen habe, aufgeweckt. Und deswegen sitze ich selbst nach einer Woche noch hier und warte, statt endlich zu handeln. Ich zögere nie. Aber bei ihr tue ich es. Und das macht mich verdammt noch mal ziemlich wütend.
Ich konzentriere mich auf Raven, damit ich hören kann, was sie ihm antwortet. »Ja, schon heute. Gleich nach der Schicht. Ich hab bei deinem Vater schon vor ein paar Tagen gekündigt.«
Damit habe selbst ich nicht gerechnet. Ich versteife mich und falle fast in so etwas wie eine Schockstarre. Verdammter Mist, ich habe mich noch nicht entschieden, was ich tun soll. Mein ursprünglicher Plan ist hin. Die zweite Option wäre gewesen, mir Raven zu schnappen und sie zu erschießen. Wahrscheinlich würde das Sherwood sogar noch mehr treffen, immerhin hat er seine Tochter vor allen geheim gehalten. Er wollte sie beschützen, also muss sie ihm etwas bedeuten. Aber bisher konnte ich mich nicht dazu durchringen, weil Raven nichts mit alldem zu tun hat. Aber ich kann auch nicht auf meine Rache verzichten. Ich muss meinem Zorn ein Ventil geben. Sherwood hat Sam und mir zu viel genommen. Unseren Vater, unsere Mutter, das Leben, das wir hatten, und unsere Kindheit.
Meine Hände umklammern zitternd mein Bierglas. Mir läuft die Zeit davon. Ich muss mich entscheiden. Töte ich sie oder vergesse ich meinen Plan? Schon der Gedanke, Sherwood mit dem, was er unserer Mutter angetan hat, durchkommen zu lassen, ist mir so zuwider, dass mein Magen krampft und mein Puls sich beschleunigt. Niemals kann ich ihn damit davonkommen lassen. Wut rollt über mich hinweg und weckt in meinem Körper den Drang, herausgelassen zu werden. Ich muss tief und langsam einatmen, um mich wieder unter Kontrolle zu bekommen. Meine Finger zittern, in meinen Ohren rauscht es und in meinem Kopf brüllt das unbeherrschte Monster auf, das ich kaum in der Lage bin, zu kontrollieren, wenn die Wut mich übernommen hat. Das Monster in mir will töten, es will sich am Geruch von Blut laben und seinen Trieben nachgeben. Ein Teil von mir wurde so geboren. Ein anderer wurde dazu gemacht und erzogen. Aber dann steigt mir ihr Duft in die Nase, als ein Gast die Tür öffnet, um die Bar zu verlassen, und ein Windhauch hereinweht. Und etwas passiert in mir. Die Wut wird zurückgedrängt, kurz bevor sie mich zerreißen kann. Als würde ein Schwall kaltes Wasser mich treffen. Nur auf eine angenehme, erregende Art.
Ich mustere Raven, die langsam an meinen Tisch kommt und deren Augen bei jedem Schritt fest auf mich gerichtet bleiben. Ich balle die Hände zu Fäusten, damit sie das Zittern nicht sieht, und setze ein Lächeln auf. »Kann ich dir noch was bringen? Wir schließen gleich.«
Ich lasse mir Zeit damit, jeden Zentimeter ihres schlanken Körpers zu betrachten, der in langärmeligen Shirt und knielangen Shorts steckt und nicht viel nackte Haut zeigt. Aber ihre Kleidung kann nicht ihre schlanken Kurven verbergen. Als mein Blick über ihre Oberschenkel gleitet, kann ich sehen, wie sich ihre Muskeln unter dem Stoff der Jeans anspannen. Ich sehe in ihr Gesicht, ihre Lippen sind leicht geöffnet und ihre Atmung geht viel schneller als sie sollte. Siehst du Junge, denke ich, was diese Frau braucht, ist einen Mann wie mich. Einen Mann, der ihr gibt, was sie will, obwohl sie selbst es nicht einmal ahnt. Aber ein Blick in diese tiefblauen Seen und ich weiß, wonach sie sucht. Sehnsucht flammt in ihrem Gesicht auf, als sie mich nervös ansieht und ihre Unterlippe zwischen ihre Zähne zieht. Eine Geste, die, ob beabsichtigt oder nicht, ihre Wirkung bei mir nicht verfehlt. Raven ist noch jung, gerade erst der Highschool entkommen, aber sie strahlt eine Selbstsicherheit aus, der ich selbst bei älteren Frauen nicht häufig begegne. Ich sehe sie an und mir wird klar, vor mir steht eine Frau, die genau weiß, was sie will, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie schon früh auf sich allein gestellt war. Aber sie ist Sherwoods Tochter, das darf ich niemals vergessen. Auch wenn sie keine von uns ist und mit alldem nichts zu tun hat, sie ist die Tochter meines Feindes.
»Nein danke«, antworte ich ihr völlig gelassen, während ich mir in Gedanken schon ausmale, wie sie vor mir knien wird, der Waldboden wird sich in ihre empfindliche Haut drücken, ihre Augen werden schreckgeweitet zu mir aufsehen und über ihre Lippen wird kein einziger wimmernder Ton kommen, denn sie wird mich nicht um ihr Leben anflehen. So ist sie nicht. Und dann werde ich abdrücken.
Mit jeder Sekunde, die verstreicht, mit jeder Sekunde, in der das Schichtende näher rückt, fühle ich mich nervöser. Ich kann mich kaum noch auf meine Arbeit konzentrieren. In meinem Magen steigt ein flaues Gefühl auf, und ich kann lediglich daran denken, dass es nur noch Minuten sind, bis ich dieser Stadt und all den Menschen hier endlich den Rücken kehren werde. Der Gedanke verängstigt mich etwas, obwohl ich in Black Falls immer eine Außenseiterin war und nie wirklich Freunde hatte, schmerzt mich die Vorstellung, alle hier zurückzulassen. Sie vielleicht nie wiederzusehen. Es ist, als würde etwas tief in mir drin versuchen, mich zurückzuhalten. Aber ich werde mich von meiner Angst nicht zurückhalten lassen. Das lasse ich auf gar keinen Fall zu. Es ist doch normal, etwas Angst vor einer unbekannten Zukunft zu haben. Aber davon sollte niemand sich aufhalten lassen, auch ich nicht. Besonders ich nicht. Die Angst macht alles erst aufregend. Und ich liebe es aufregend, weil ich mich lebendig fühlen möchte. In Black Falls fühlt jeder sich tot. Als stecke die ganze Stadt in einem immerwährenden Schlaf. Besonders seit meine Mutter fort ist, die es in ihren schlimmen Phasen geschafft hat, die ganze Stadt gegen sich aufzubringen.
Meine Mutter ist schon vor Monaten einfach verschwunden. Sie ist in das Auto ihres aktuellen Kerls und Drogendealers gestiegen und hat mich allein in unserem Trailer zurückgelassen. Aber das war mir gleich, sie war seit Jahren schon keine Mutter mehr. In unserer Beziehung war ich die Erwachsene. Ich habe dafür gesorgt, dass ihre Kleidung sauber war, sie etwas zu essen hatte und wir die Miete für den Trailer bezahlen konnten, damit wir unser Zuhause nicht verlieren. Ich habe ihre aufgeplatzten Lippen und blauen Flecken versorgt, wenn mein Vater mal wieder vorbeigeschaut hat. Ich habe sie in den Armen gehalten, wenn sie Angst vor seinem nächsten Besuch hatte. Und ich habe versucht, die Dinge in Ordnung zu bringen, die sie während ihrer betrunkenen Anfälle zerstört hat, damit die Bewohner von Black Falls uns nicht noch mehr hassen. Dass ich in der Bar arbeiten durfte, um unseren Unterhalt zu verdienen, verdanke ich nur Nick, unserem Nachbarn und dem Mann, dem ich erlaubt habe, die Finsternis in mir zu befriedigen. Der Rest der Stadt hat uns gemieden. Ich denke, niemand hier hat mich gehasst, aber dank meiner Mutter hatte ich es nicht leicht. Auch in der Schule nicht. Die Menschen sind mir aus dem Weg gegangen und waren nur aus der Distanz nett zu mir. Haben mir höchstens diese mitleidigen Blicke zugeworfen und eilig ein paar Worte mit mir gewechselt.
Ich freue mich, dass heute endlich der Tag ist, an dem ich Black Falls verlassen werde. Ich werde nichts in dieser langweiligen Stadt vermissen. Außer vielleicht meinen Garten vor dem Trailer, den ich vor vielen Jahren angelegt habe. Es gibt ein Stück Rasen, auf dem steht die Liege, auf der ich die meiste Freizeit mit einem Buch verbracht habe, es gibt eine bunte Mischung Phlox-Blumen und einen Fliederstrauch. Ich liebe es, meine Hände in dunkle Erde zu tauchen, etwas anzupflanzen und dabei zuzusehen, wie es wächst. Ich liebe es, in der Natur zu sein, zu laufen, zu wandern und mich bis zur Erschöpfung zu verausgaben und die frische Luft tief in meine Lunge zu saugen. Die Natur entspannt die Unruhe in meiner Seele.
Da ist etwas Düsteres in mir, das ich mir nicht erklären kann. Es fühlt sich an, als wäre es auf der Suche nach etwas, das ich einfach nicht finden kann. Aber in der Natur verwandelt diese Dunkelheit sich in Licht und schenkt mir die Ruhe, nach der ich mich oft sehne. Dunkelheit, so nenne ich das, was mich manchmal dazu treibt, mich zu verletzen oder mich verletzen zu lassen. Ein rasender Drang, der wild in meinem Inneren wütet und herausgelassen werden will.
Der Trailer selbst ist heruntergekommen und abgewohnt, aber ich habe immer mein Bestes gegeben, ihn zumindest sauber zu halten. Besonders in den Phasen, in denen Mutters Alkoholkonsum sehr hoch war und sie ihre Tage betrunken und depressiv damit verbracht hat, unser Zuhause vollzukotzen und überall leere Flaschen zu hinterlassen. Ihn werde ich wohl nicht vermissen, aber ich werde die winzige Küche vermissen, die meine Mutter zusammen mit mir irgendwann gelb gestrichen hat, und auf die wir lauter bunte Blüten gemalt haben. Das war, als es ihr vor ein paar Jahren noch deutlich besser ging. Ich war etwa 5 oder 6 Jahre alt und hin und wieder kam dieser vollbärtige, stark tätowierte Mann auf seiner Harley vorbei und hat etwas Geld zum Leben vorbeigebracht und nach dem Rechten gesehen.
Ich kann mich noch erinnern, ich mochte den Geruch seiner Lederkutte. Und ich mochte, dass er viel mit mir gespielt hat. Er war einer der wenigen Männer in meinem Leben, der mich gut behandelt hat. Er war der Bruder meines Vaters, und ich war froh, wenn er vorbeikam. Meine Mutter ist dann immer regelrecht aufgeblüht, als wäre eine große Last von ihren Schultern gerollt, weil sie wusste, wenn Rage uns besucht, dann würde mein Vater uns eine Weile keinen Besuch abstatten.
Ich glaube, mein Vater ist nicht nur gewalttätig und herrschsüchtig, er ist auch kriminell. Es gab immer etwas an ihm, vor dem meine Mutter besonders viel Angst hatte. Etwas, das weit furchterregender sein musste, als seine Fäuste und Tritte und seine unbeherrschte Wut. Ich habe nie herausgefunden, was das war. Und sobald ich die Stadt hinter mir gelassen habe, werde ich es hoffentlich auch nicht mehr herausfinden. Zumal mein Vater sowieso schon seit fünf Jahren nicht mehr in Black Falls war. Ich denke, deswegen hat meine Mutter sich sicher genug gefühlt, um sich endgültig von ihm zu lösen.
Aber als sie gegangen ist, hat sie meine Einsamkeit und die Leere in mir noch größer werden lassen. Ich hatte ein paar flüchtige Kontakte im Trailerpark, wenn man so eng nebeneinander wohnt, kann man sich kaum aus dem Weg gehen. Einer dieser Kontakte war Nick, einer von Mutters Dealern und mein Chef in der Bar.
Wahrscheinlich werde ich sogar ihn vermissen. Immerhin hat er mir gezeigt, dass es etwas gibt, mit dem ich die Dunkelheit in mir für kurze Zeit besiegen kann: schmutzigen, harten, düsteren Sex, der mich für wenige Augenblicke in eine so tiefschwarze Finsternis stürzt, dass ich die traurige Dunkelheit nicht mehr fühle, sondern nur noch den Dreck, den der Sex mit einem Mann wie ihm auf meiner Haut hinterlässt. Einem Mann, der mit Drogen dealt, seinen Sohn schlägt und auch sonst gern alles zerstört, was ihm zu nahe kommt. Mit ihm zusammen zu sein, hat mir das Gefühl gegeben, mich nicht mehr ganz so leer zu fühlen. Aber das muss jetzt vorbei sein. Ich kann das nicht länger. Deswegen gehe ich weit weg.
Das Einzige, was ich mitnehme aus meinem alten in mein neues Leben, ist die Smith & Wesson, die Rage uns Mädchen irgendwann dagelassen hat, als er für einen kurzen Besuch im Auftrag meines Vaters bei uns war, mein Abschlusszeugnis der Black Falls High, das ich heute bekommen habe, ein paar Jeans, Shirts und meine Papiere. Alles andere werde ich zurücklassen. Nur wegen des Abschlusszeugnisses bin ich überhaupt noch geblieben. Ich wollte nur eine Sache in meinem Leben mal beendet haben. Etwas besitzen, das mir das Gefühl gibt, etwas erreicht zu haben. Nicht dass ich Pläne habe, wirklich etwas zu schaffen. Ich werde kein College besuchen oder eine Ausbildung machen. Über solche Dinge habe ich nie wirklich nachgedacht. Ich war immer der Meinung, ich würde mich bis an ihr Lebensende um meine Mutter kümmern und in der Bar arbeiten. Als sie gegangen ist, hat sie mir auf ihre Art die Freiheit geschenkt, etwas anderes mit meinem Leben anzufangen. Ich werde vielleicht erstmal einfach von Stadt zu Stadt ziehen, hier und dort mein Geld mit einem Job in einem Diner oder einer Bar aufbessern und nach etwas suchen, das die Leere in mir ausfüllt.
Vielleicht werde ich Wochen irgendwo auf der Straße unterwegs sein, mir das Land angucken, wandern gehen, die großen Parks besuchen. Vielleicht werde ich im Pick-up schlafen müssen. Wahrscheinlich werde ich das tun, denn mein gesamtes Erspartes sind 2.458 Dollar. Nach der Schicht heute Abend werden es 2.494 Dollar sein. Ich kann jeden Dollar gut gebrauchen, weswegen ich seit meiner ersten Schicht vor fast 2 Jahren beiseitegelegt habe, was mir möglich war. Ich habe das Geld vor meiner Mutter hinter der Heizung in meinem Zimmer versteckt, weil ich mir sicher war, dass es gut wäre, ein bisschen zu sparen, da man nie weiß, was noch kommen könnte. Jetzt werde ich das Geld benutzen, um hier wegzukommen.
Ich wische den Tresen ab und werfe einen Blick in die düstere Ecke, wo noch immer der Fremde sitzt und mich beobachtet. Wenn er mich ansieht, prickelt es nicht nur auf meiner Haut. Es prickelt sogar an Stellen, wo dieses Gefühl absolut unwillkommen für mich ist, weil es mich an die dunkelsten Stunden in meinem Leben erinnert. Stunden, die ich mit Nick verbracht habe.
Der Fremde schaut mich schon seit Tagen so an, und ich warte schon seit Tagen, dass er irgendetwas sagen wird, aber das tut er nie. Wahrscheinlich haben seine Blicke gar nichts zu bedeuten. Und doch wird mir unter ihnen ganz heiß. Es fühlt sich an, als würde er diesen düsteren Teil in mir ansprechen, der schon immer auf der Suche nach etwas ist, das er nicht finden kann.
Ich wende mich ab und tue so, als wäre ich schwer beschäftigt, dabei habe ich die Theke schon mindestens drei Mal in den letzten drei Minuten abgewischt. Trotzdem tue ich es jetzt noch einmal, nur um meine Hände beschäftigt zu halten und mich von ihm und seinen zahlreichen bunten Tattoos, die seine Arme und Hände bedecken, abzulenken. Vermutlich auch seinen gesamten Oberkörper. Aber das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, weil er ein enges T-Shirt trägt, das zwar seine Haut bedeckt, aber nicht seinen breiten, muskulösen Körperbau.
Und diese Ringe an seinen Fingern: breit, silbern und maskulin. Seit wann sind Männer, die Schmuck tragen, so verdammt sexy? Es sind sechs, an jeder Hand drei. Ich zwinge meine Konzentration auf meine eigenen Hände und meinen Puls zur Ruhe. Es muss an seiner Ausstrahlung liegen, die ihn umgibt, aber er löst ein ganz merkwürdiges Gefühl in mir aus. Eine innere Unruhe, die sich schon in den letzten Tagen immer nur dann gelegt hat, wenn er die Bar verlassen hatte.
Obwohl ich nicht hinsehe, fühle ich seinen Blick. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie er sich mit einer Hand über die Wangen reibt, die von einem schwarzen Sieben-Tage-Bart bedeckt sind. Seit dem Tag, an dem er hier aufgetaucht ist, kriecht mir seine Nähe schon unter die Haut. Ich hasse diese Empfindungen, denn ich wollte diese Dunkelheit nie wieder fühlen. Wollte nicht einmal daran erinnert werden, dass ich zu dem fähig bin, was Nick mit mir getan hat. Ich habe mich erst vor ein paar Wochen von Nick gelöst, aber unsere heimliche Beziehung - oder das, was da auch immer zwischen uns lief - hat schon Monate vor Mutters Verschwinden begonnen.
Ich lecke mir über die trockenen Lippen und nicke Tara und Steve zu, als sie die Bar verlassen. Jetzt sind da nur noch er und ich. Ganz allein mit ihm. Und plötzlich scheint es, als würde sein Blick sich verfinstern und sein Körper sich anspannen. Genau wie meiner. Und mein Puls rast so heftig, dass ich das Hämmern in meinen Ohren höre. Und zwischen meinen Schenkeln entwickelt sich eine Hitze, die ich so intensiv noch nie zuvor gespürt habe. Was, wenn er jetzt aufsteht, zu mir rüberkommt und … Ich schließe stöhnend die Augen. Seit Monaten arbeite ich hier, aber solche Fantasien hatte ich noch nie. Peinlich berührt schrubbe ich noch heftiger auf der Theke herum und vermeide es, den Blick auch nur für Sekunden in seine Richtung zu heben. Das ist diese Dunkelheit in mir. Sie tut diese Sachen, lässt mich nach Dingen lechzen, die ich eigentlich nicht will.
»Beruhig dich«, ermahne ich mich flüsternd. »Er ist nur ein Typ, der in einer Ecke sitzt und sein Bier trinkt.« Genau wie alle anderen, die hierherkommen. Aber alle anderen kenne ich schon mein ganzes Leben lang. Und alle anderen sorgen mit ihren Blicken nicht dafür, dass mir ganz heiß wird. Ihn in der Nähe zu wissen, löst dieses nervöse, aufregende Kribbeln in mir aus, das mich glauben lässt, gefunden zu haben, wonach ich so lange gesucht habe. Was völlig irre ist, denn ich kenne diesen Mann gar nicht. Es liegt nur daran, dass er mich und meinen Körper auf so viele Arten in Aufruhr versetzt. Er zieht mich an, schürt mein Verlangen, meine Neugier und macht mir so viel Angst, dass sich alle Härchen auf meiner Haut aufrichten.
Ich versuche, mich zusammenzureißen, indem ich tief einatme und die Fäuste balle. Ich habe eindeutig einen ungesundes Faible für düstere, furchteinflößende, tätowierte Männer. Für Bikertypen. Das muss ich von meiner Mutter geerbt haben, die ihre Finger auch nicht von den gefährlich aussehenden Männern lassen konnte, selbst dann nicht, wenn diese sie geschlagen haben, wie mein Vater es getan hat. Deswegen habe ich ihn auch nie vermisst. Die meiste Zeit war ich froh, dass er nur ein bis zwei Mal im Jahr vorbeikam, und irgendwann gar nicht mehr.
Ich räume ein paar Gläser hin und her, denn eigentlich habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe alle Arbeiten schon während der Schicht erledigt, damit ich pünktlich hier rauskomme. Jetzt muss nur noch er gehen.
Ich gehe um die Bar herum, beginne alle Stühle auf die Tische zu stellen, damit es Liz morgen Vormittag leichter hat, wenn sie kommt, um zu putzen. Danach sammle ich etwas Papier auf, das auf dem Boden liegt, und kontrolliere, ob die Fenster verschlossen sind. Hinter mir höre ich, dass sich ein Stuhl über den Boden bewegt.
Ich sehe auf, er kommt auf mich zu, seine Lippen sind fest aufeinandergepresst und seine faszinierenden Augen auf mich gerichtet. Er hat ernste Augen. Meine sind dunkelblau, eher so wie der Nachthimmel. Seine sind wie klirrendes Eis. Das weiß ich, weil sie meinen Blick immer anziehen, wenn ich an seinen Tisch komme. Selbst auf die Entfernung sind sie das Herausstechendste in seinem Gesicht. Augen, deren frostiges Eisblau fast schon unnatürlich wirkt. Seine Schritte sind langsam, aber zielstrebig, sein Blick intensiv. Wahrscheinlich ist es gar nicht seine Absicht, solch einen Aufruhr in meinem Körper auszulösen. Er kann ja nichts dafür, dass er jede Faser meines Körpers anspricht. Er sieht mich an, bleibt neben mir stehen und um seine Mundwinkel herum zupft ein Lächeln.
»Wir sehen uns, Raven«, sagt er mit rauer Stimme, zieht dabei eine seiner starken, dichten Brauen hoch und zwinkert mir zu, was meinen Puls noch einmal beschleunigt. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Zwinkern so anzüglich wirken kann, dass es eine mittlere Explosion in meinem Magen auslöst.
»Bis morgen?«, sage ich und ärgere mich, dass das wie eine Frage geklungen hat. Wieso sollte es mich interessieren, ob er morgen wieder hier sein wird, denn ich werde es nicht sein. Ich schüttle den Kopf. »Nein, morgen werde ich nicht mehr hier sein, aber meine Kollegin. Also ich meinte das anders.«
Er lächelt sanftmütig, fast ein wenig, als hätte er Mitleid mit mir. »Schon gut«, sagt er. »Ich werde morgen auch nicht mehr hier sein.«
Als die Tür hinter ihm ins Schloss fällt, stoße ich die Luft aus meiner Lunge und lehne mich gegen einen der Tische. Mir war nicht einmal bewusst gewesen, dass ich die Luft angehalten hatte. Männer sollten wirklich nicht so attraktiv und zugleich rau und düster sein. Aber das sind sie ja eigentlich auch nicht. Nur er ist es, und er trägt diese herablassende Art mit sich herum, als wäre ihm sehr wohl bewusst, dass er eine Frau nur ansehen muss und sie wird sich ihm sabbernd zu Füßen werfen.
So wie ich. Und ich sabbere eigentlich nie. Nicht einmal bei Nick. Selbst dann nicht, wenn er tief in mir war und mich mit sich in den Abgrund gerissen hat. Ich sollte es besser wissen. Männer wie der Fremde - Männer wie Nick - sind gefährlich. Sie zerstören. Und obwohl ich das weiß, fühlt es sich an, als wäre ein Teil von mir immer auf der Suche nach dieser Dunkelheit. Nach Gefahr, Schmerz und etwas, das meinen Puls zum Rasen bringt. Danach, geführt zu werden. Danach, dominiert zu werden.
Vielleicht ist es ganz gut, dass ich den Fremden nicht wiedersehen werde, dann muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, was das alles zu bedeuten hat.
Ich beende meine Arbeit, schließe den Inhalt der Kasse wie jeden Abend im Tresor im Büro ein, dann verlasse ich die Bar und werfe den Schlüssel in den Briefkasten. Ein wenig fühle ich mich traurig und muss gegen den Kloß in meinem Hals ankämpfen, aber da ist auch dieser plötzliche Schwall Energie, der sich durch meinen Körper arbeitet und mir unerwartet Kraft gibt, meinen Plan durchzuziehen und nicht in letzter Sekunde zu kneifen. Mein Puls beschleunigt sich bei dem Gedanken, dass es jetzt soweit ist. Ich verlasse die Stadt und sehe einer unbekannten Zukunft irgendwo anders entgegen. Einer Zukunft, die mich herausfordert, die mir Aufgaben stellt. Die mir jeden Tag ein bisschen mehr gibt und mich aus der Eintönigkeit holt.
Entschlossen wende ich mich zu meinem Truck um, und da steht er. Der unbekannte Gast, dessen Arme mit bunten Tattoos überzogen sind und dessen Blick mich auch jetzt zwischen meine Schenkel trifft. Er blickt von seinem Motorrad auf, als er mich sieht und zieht einen Mundwinkel zu einem leicht verkniffenen Lächeln hoch. In den Händen hält er einen schmutzigen Lappen, den er benutzt, um seine Finger abzuwischen, dann steckt er ihn in die hintere Tasche seiner Hose und grinst mich schief an.
»Sie springt nicht mehr an«, sagt er knapp, als wüsste er, dass ich eine Sekunde lang beunruhigt war, ihn noch hier auf dem Parkplatz zu sehen. Er steht direkt neben meinem Truck, die Reklametafel hinter mir für ›Dark Beer‹ erhellt sein Gesicht und lässt es zugleich noch kantiger wirken.
Ich nähere mich ihm langsam. »Wir haben leider keine Werkstatt in Black Falls«, kläre ich ihn auf.
Er stößt ein unglückliches Seufzen aus und mustert sein Bike mit besorgter Miene. Es ist eine bullige Harley Davidson in mattem Schwarz und mit viel blitzendem Chrome. Der Anblick des Bikes löst ein nervöses Kribbeln in mir aus. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es sich wohl anfühlen würde, auf so einem Motorrad in rasendem Tempo über eine Straße zu donnern. Mein Vater hat mich nicht ein einziges Mal auf sein Bike gesetzt. Er hat mich nicht einmal in die Nähe seiner Harley gelassen. Aber die Vorstellung, wie es sein würde, bei hoher Geschwindigkeit den Wind im Gesicht zu spüren, hat mich immer mit dieser freudigen Erregung erfüllt, die ich sonst nur spüre, wenn ich durch den Wald laufe, bis ich vor Erschöpfung zusammenbreche.
»Das ist nicht gut, eigentlich müsste ich spätestens morgen Früh weiter. Besser noch heute Nacht.« Er zeigt auf die Reisetasche, die er hinten auf seinem Motorrad befestigt hat. Der Fremde erinnert mich etwas an meinen Vater. Als ich kleiner war, kam er alle paar Monate mal für ein paar Tage vorbei, blieb ein paar Nächte, um mit meiner Mutter zu schlafen, und verschwand dann wieder aus unserem Leben. Ähnlich wie der Bruder meines Vaters.
»Das ist ein verfickter Mist«, sagt er brummig, sieht zu mir auf und schüttelt den Kopf. »Tut mir leid.«
»Ich arbeite in einer Bar«, erinnere ich ihn. Gossensprache ist nichts, was mich schockiert. Besonders, da die Footballspieler der Schule auch nicht wählerisch in ihrer Ausdrucksweise sind. Ich weiß nicht, wie das anderswo in den USA ist, aber in Black Falls ist Fluchen so normal wie essen und trinken. »In Riverside gibt es eine kleine Werkstatt«, erwähne ich und wende mich meinem Truck zu. Ich werfe einen Blick auf meine Sachen auf dem Rücksitz, um sicherzugehen, dass alles noch da ist. Aber wer sollte in Black Falls schon Interesse an meinem Kram haben?
»Du bist nicht zufällig auf dem Weg dorthin?«, will er wissen.
Ich stecke den Schlüssel in das Schloss des alten Pick-ups und sehe über die Schulter zu ihm zurück. Es ist, als würden diese hellen Augen mich jedes Mal in ihren Bann ziehen, denn sie sind das Erste, an dem mein Blick immer hängenbleibt, wenn ich ihn ansehe, weil sie so wie klirrender Frost erscheinen. Es ist, als könnte ich mich nicht an ihnen sattsehen. Als würden sie mich anziehen, um mich in diese Tiefen saugen zu wollen. »Eigentlich nicht.«
»Das ist schade, denn so wie es aussieht, müsste ich unbedingt nach Riverside.«
Ich öffne die Tür meines Trucks und schließe ergeben die Augen. Man kann nicht sagen, dass ich eine gute Kinderstube genossen habe, denn das habe ich definitiv nicht. Meine Erziehung hat einzig daraus bestanden, meiner Mutter bei ihren wechselnden Beziehungen zuzusehen, für sie den Haushalt zu erledigen und mein Leben schon mit zehn Jahren so ziemlich allein zu bewältigen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, bin ich schon immer jemand gewesen, der nicht dazu in der Lage ist, andere Menschen im Stich zu lassen, wenn sie Hilfe benötigen. »Vielleicht liegt es ja auf meinem Weg.«
Er lächelt breit und reicht mir die Hand. »Ich bin Ice. Und es wäre wirklich praktisch, wenn es auf deinem Weg liegen würde.«
Ich stoße die Luft geräuschvoll aus, nehme seine Hand nur widerwillig, denn eigentlich habe ich keine Lust darauf, mein neues Leben mit einer Verzögerung zu beginnen, indem ich auf halbem Weg nach Riverside noch einmal am Trailerpark vorbeifahren muss. Nicht, weil der Park so trostlos ist, sondern weil ich befürchte, ich könnte den Mut verlieren und am Ende doch noch hierbleiben. Ich stoße seufzend die Luft aus und lasse die Schultern fallen. Ich will hier einfach nur so schnell wie möglich weg, bevor ich noch einknicke und am Ende wieder in Nicks Trailer lande. Ich will das nicht mehr. Nie wieder. Ich will lieber laufen, mich bewegen und wandern, meinen Körper beanspruchen, bis die Dunkelheit weg ist. Bis sie still ist.
»Meinen Namen kennst du ja schon, Ice.« Ich betone seinen Namen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht so heißt, aber er passt zu der Farbe seiner Augen. »Pack deine Maschine einfach auf die Ladefläche, da müssten auch ein paar Gurte sein, damit du sie festschnallen kannst«, sage ich, gehe um den Pick-up nach hinten und öffne die Klappe.
»Danke, nett von dir.« Ice schiebt die schwere Maschine, unter deren breiten Rädern leise die Kiesel knirschen, mit denen der Parkplatz befestigt ist, nach hinten. Wie viel wiegt so ein Bike eigentlich? Ich bezweifle, dass er es allein auf die Ladefläche bekommt und überlege, ob ich mit anfassen soll, zögere aber, denn mein Vater hätte mir gedroht, meine Finger mit seinem Messer abzuschneiden.
»Soll ich dir helfen?«, frage ich vorsichtshalber, bevor ich die Maschine berühre und es ihm dann vielleicht nicht gefällt.
Er grinst. »Diese Maschine wiegt 460 Pfund«, sagt er und sieht sich auf dem Parkplatz um. Sein Blick fällt auf das Wohnhaus nebenan, das derzeit renoviert wird. »Ich bin gleich wieder zurück, nicht ohne mich fahren.«
Frustriert lehne ich mich an die Seite meines Autos und warte, bis sich aus dem Dunkel kurze Zeit später ein Schatten schält. Ice trägt ein langes breites Brett über der Schulter. Es federt leicht bei jedem Schritt, den er sich nähert, aber ansonsten wirkt er nicht, als würde er Mühe damit haben, es zu tragen. Mit dem breiten Winkel an einem der Enden hängt er das Brett an die Ladefläche meines Trucks.
»Damit sollte es funktionieren«, meint er, läuft prüfend seine selbst gebaute Rampe nach oben, bleibt in der Mitte stehen und wippt auf dem etwa einen halben Meter breiten Brett auf und ab.
»Und wie willst du das Bike dann wieder runterbekommen?«, hake ich nach.
»Wir nehmen das Brett mit.«
»Es ist viel zu lang«, protestiere ich, weil es bestimmt einige Zentimeter über die Ladefläche hinausgehen würde.
»Ist es nicht«, sagt Ice bestimmt. Mittlerweile denke ich, dass mir eigentlich alles egal ist, Hauptsache, wir können endlich los, bevor doch noch jemand kommt, der mich aufhalten könnte. Wer sollte das sein? Nicht einmal Nick war sonderlich erpicht darauf, mich in der Stadt zu behalten, als ich ihm gesagt habe, dass ich kündige. Es schien ihm egal zu sein. Aber es war ihm auch egal, dass ich gerade erst 18 geworden war, als unsere Affäre vor ein paar Monaten begonnen hat.
Ice löst den Ständer seiner Maschine und packt mit beiden Händen die Griffe. Es kostet ihn einiges an Mühe, aber schlussendlich steht das Bike ohne meine Hilfe auf der Ladefläche. Er kriecht auf der Ladefläche umher, um das Bike sicher zu verschnüren, dabei rutscht ihm sein Shirt aus der Hose und ich kann die Pistole sehen, die er hinten im Bund stecken hat. Mein Herz setzt einen Schlag aus und ich bekomme Zweifel, dass es eine gute Idee ist, ihn mitzunehmen. Mit ihm allein im Auto zu sitzen. Was weiß ich schon über den Kerl? Er wirkt noch nicht einmal besonders vertrauenserweckend mit all diesen Tattoos, seinen wilden glänzend schwarzen Haaren, die in alle Richtungen abstehen und dem dunklen Bartschatten im Gesicht. Aber jetzt steht dieses Bike auf meiner Ladefläche, was soll ich also tun? Ihm sagen, dass ich es mir anders überlegt habe? Das hier sind die USA, viele Menschen haben eine Waffe, versuche ich mich zu beruhigen. Ich habe auch eine im Truck. Nur weil er eine hat, heißt das nicht, dass er mich töten wird. Oder vergewaltigen. Offensichtlich ist er mit seinem Bike allein unterwegs, da sollte man eine Waffe haben, oder?
Angespannt beobachte ich, wie Ice das Brett vom Pick-up löst und es dann mit dem einen Ende gegen das Fahrerhaus lehnt, es dort mit einem Gurt befestigt und das andere Ende innen gegen die geschlossene Klappe lehnt, dann springt er darüber und landet sicher direkt vor meinen Füßen. Wenn er wirklich vorhat, mir etwas anzutun, dann könnte er es hier an Ort und Stelle tun, niemand würde ihn davon abhalten. Er hätte es in der Bar tun können, als wir allein waren. Er hätte jede Chance der Welt gehabt. Ich schiebe meine Bedenken weg.
»Ich hab doch gesagt, es funktioniert.«
»Dann können wir jetzt endlich los?«, möchte ich wissen und verberge nicht, wie genervt ich mittlerweile bin. Ich will endlich raus aus dieser Stadt. Mit jeder Sekunde steigen die Zweifel in mir mehr auf und drohen mich unter sich zu begraben. Wenn ich nicht bald hier wegkomme, dann vielleicht nie.
»Können wir«, sagt er, geht um den Pick-up herum und steigt ein, ohne mich noch ein weiteres Mal anzusehen.
»Vergiss einfach, dass er eine Waffe hat«, flüstere ich und versuche, meinen Puls etwas zu beruhigen, bevor ich mich hinter das Lenkrad setze. Trotzdem sind meine Hände verschwitzt, als ich das Leder umfasse, denn ich mag Waffen nicht besonders gern. Mein Vater hat versucht, mir beizubringen, wie man mit ihnen umgeht, als ich noch nicht einmal sieben war. Wir haben im Wald auf Blechbüchsen gezielt. Er hat die Büchsen getroffen, ich habe die meiste Zeit danebengeschossen. Bis auf das eine Mal, als meine Kugel meinen Hund Tiger traf. Er war in den Wald gelaufen, um mich zu suchen. Danach habe ich nie wieder eine Waffe in die Hand genommen, bis jetzt. Danach hatte ich auch nie wieder einen Hund. Verstohlen werfe ich einen flüchtigen Blick hinter den Beifahrersitz, unter dem ich meine Waffe versteckt habe.
2
Sie wirkt nervös, während sie das Auto vom Parkplatz auf die einzige Hauptstraße in diesem Kaff steuert. Da es in dieser Stadt weder tagsüber noch nachts wirklich Verkehr gibt, rührt ihre Nervosität wohl nicht daher. Entweder beunruhige also ich sie oder ihr Plan, die Stadt zu verlassen. Ich setze mich etwas schräg, um sie besser sehen zu können. Der Gedanke, ich könnte diese Unruhe in ihr auslösen, gefällt mir. Wie unruhig sie wohl werden wird, wenn ich ihr meine Waffe gegen die Stirn drücke und ein Loch in diesen hübschen Kopf schieße?
»Du verlässt also die Stadt?«, sage ich möglichst desinteressiert zu ihr. Sie hat dieses kurze, fast schon zu kurze schwarze Haar, das ihr aber perfekt steht. Diese Frisur würde nicht vielen Frauen stehen, aber bei ihr sieht es einfach perfekt aus. So wie bei dieser Schauspielerin aus den 50ern. Audrey Hepburn. Es ist gerade so noch lang genug, um es beim Sex packen und die Finger darin vergraben zu können.
Sie zieht eine Augenbraue hoch und sieht mich flüchtig an. Ihr Gesicht wird von der Beleuchtung der Armaturen erhellt. Entschlossen nickt sie, bevor sie den Blick wieder auf die Straße richtet. Noch vier Häuser, dann sind wir schon wieder aus der Stadt raus und auf der schlechten Straße unterwegs, die Black Falls mit dem nächsten Nest verbindet. Zwischen hier und dort gibt es nur ein paar Farmen und einen kleinen Wald. Der Wald ist mein Ziel, weil wir dort abgeschirmt vor neugierigen Blicken sind. Auch wenn die Chance gering ist, dass jemand uns sehen könnte, ich muss ganz sicher sein, dass mein Gesicht demnächst nicht über die Nachrichtenkanäle tickert. Dass sie die Stadt verlassen will und jeder es weiß, spielt mir in die Hände. Nur ihr Vater soll hiervon wissen. Er soll den gleichen Schmerz fühlen wie ich, als er meine Mutter ausgeweidet hat.
»Warum?«, frage ich sie, als sie nichts weiter sagt.
Sie stößt genervt die Luft aus und verzieht dieses hübsche Gesicht. Sie ist eine von diesen Frauen, die nicht süß und unschuldig wirken. Sie wirkt stark, sportlich, ein wenig wild und geheimnisvoll. Und der Blick aus diesen sturmblauen Augen wirkt so viel älter und schmerzerfahrener als er eigentlich wirken sollte. Ich denke, das ist es, was mich an ihr so anzieht: Ich sehe sie an und erkenne den gleichen Schmerz, den auch ich fühle, den nur eine abgefuckte Kindheit auslösen kann. Ich frage mich, wie abgefuckt ihre war. Weiß sie überhaupt, wer ihr Vater ist? Meine Kindheit war abgefuckt. Ihr Vater hat meinen im Zweikampf besiegt und getötet, seinen Platz eingenommen, meine Mutter geheiratet und mich und meinen Bruder großgezogen. Er hat die Familie, die ich kannte, ausgelöscht. Das Zuhause, das ich kannte, vernichtet. Innerlich grinse ich abfällig, die Schönheit neben mir ist eigentlich meine Stiefschwester. Und doch gehört sie in eine ganz andere Welt. Eine ohne Gewalt, Tod und Kinder, die zu Killern erzogen werden.
»Du bist schon seit Tagen in Black Falls, musst du das wirklich fragen? Ist das nicht offensichtlich?«
Ich wiege grinsend den Kopf hin und her. »Entschuldige, ich wollte nur ein Gespräch in Gang bringen«, sage ich und zucke mit den Schultern. Ich beginne einen der Siegelringe an meinen Fingern zu drehen. Man sieht es den Ringen nicht an, aber an ihnen klebt eine Menge Blut. Mit ihnen habe ich auf der Jagd oder im Training schon einige Gesichter demoliert. »Aber wir müssen nicht reden, wenn du nicht willst.«
Sie sieht mich wieder an, verzieht seufzend das Gesicht und lächelt verbissen. »Tut mir leid, ich bin nur müde«, meint sie.
»Und dann willst du heute noch hier weg? Stunden im Auto?«
»Ja, will ich.« Sie seufzt. »Ich werde mir ein Motelzimmer nehmen, sobald ich weit genug weg bin, dass mich nichts dazu treiben kann, wieder umzukehren.«
»Du hast also Zweifel?«, frage ich sie neugierig. Ich lasse meinen Blick über ihr Gesicht streifen und überlege, ob ihr Vater weiß, was seine Tochter hier treibt. Den Ort verlassen, an dem er sie vor der Gewalt beschützt, die er ausgelöst hat.
»Nein. Keine Zweifel, nur ein wenig Angst. Ich war noch nie weiter als zwei Stunden von Black Falls entfernt«, erklärt sie.
Ich sehe zum Fenster raus, die Scheinwerfer des Autos huschen über die schlechte Straße und leuchten nur wenige Meter vor uns aus, aber ich erkenne die Kurve, die wir gerade nehmen. Dahinter kommen noch zwei größere Felder, eine Einfahrt zu einer Farm und dann der Wald, auf den ich es abgesehen habe. Und jetzt ist nicht mehr nur sie nervös, ich bin es auch. In mir spannt sich jeder Muskel bei dem Gedanken an, was ich gleich mit ihr tun werde. Kaltblütig zu töten, damit hatte ich noch nie Probleme. Ich bin darauf konditioniert worden, zu töten: schnell und ohne Gewissen. Sherwood ist der Richter und ich bin der Vollstecker. Aber dieses Mal ist es etwas anderes. Dieses Mal habe ich vor, ein Mädchen zu töten, das mit der Welt, in der ich aufgewachsen bin, nichts zu tun hat, außer, dass ihr Erzeuger zufällig in dieser Welt zu Hause ist.
»Also doch Zweifel. Du befürchtest, du könntest es dir anders überlegen.«
Sie schnaubt. »Wenn du willst, nenn es Zweifel. Was hast du denn in Black Falls gesucht?«, will sie wissen und sieht mich kurz an. Ich spüre es bis in meine Lenden, als ihr Blick über mich gleitet. Brennend heiß. So heiß, dass mein Puls sich beschleunigt und ich mich verspanne, weil ich so nicht fühlen will. Ich habe einen Plan. So wie sie auch einen hat. Nur wird sie ihren Plan nicht mehr durchziehen können, weil ich meinen durchziehen werde. Und doch muss ich mir eingestehen, dass ihre Nähe etwas in mir auslöst. Ein Gefühl, das ich noch niemals zuvor empfunden habe. Ein aufregendes Prickeln, eine träge Hitze, die sich durch meinen Körper schleicht. Das hier ist mehr als pure sexuelle Anziehung.
»Ich habe jemanden gesucht, der dort leben soll.«
»Und, hast du ihn gefunden?«
Ich starre auf ihre Finger, als sie sich damit über ihren schlanken Hals fährt, als hätte etwas ihre Haut berührt. Vielleicht hat sie meinen Blick gespürt, der für eine Sekunde auf ihrer Kehle lag. »Nein, habe ich nicht.«
»Und jetzt suchst du weiter?«
»Das habe ich noch nicht entschieden.« Ich deute nach vorn, wo das Licht der Scheinwerfer über die ersten Bäume hüpft. »Kannst du da vorn halten? Ich müsste mal pinkeln«, sage ich zu ihr.
Sie runzelt die Stirn, mustert mich kurz und nickt. Offensichtlich hat sie entschieden, mir vertrauen zu können. Ein Fehler, der sie gleich ihr Leben kosten wird. Aber sie weiß ja nicht, wer neben ihr sitzt. Ihre Welt und meine sind völlig verschieden. Ich weiß zumindest, dass es ihre Welt gibt. Sie hat keine Ahnung, dass es meine gibt. Unser Leben, unsere Geheimnisse, unsere Gesetze. Wir haben unsere eigenen Regeln. Regeln, die ihr Vater nochmal verschärft hat, als er nach dem Tod meines Vaters der Anführer des Clans geworden ist und die Führung in Nordamerika übernommen hat.
»Okay«, sagt sie, und jetzt kann ich doch Unsicherheit in ihrer Stimme hören. Sie kennt mich nicht, ist mitten in der Nacht mit einem Fremden unterwegs und soll jetzt auch noch am Rand eines Waldes anhalten. In ihr klingeln gerade sämtliche Alarmglocken, und das ziemlich laut. Und doch tut sie es, weil alle es tun würden. Weil niemand daran glaubt, dass ausgerechnet ihm schlimme Dinge widerfahren würden. Nur Menschen wie ich würden daran glauben und deswegen jemanden wie mich nicht in ihre Autos lassen. Der Rest der Menschheit hat dabei vielleicht ein komisches Gefühl, mehr nicht.
»Danke«, sage ich. »Das Bier muss raus.« Noch ein paar Sekunden lang soll sie glauben, alles wäre in Ordnung. Während ich diese Sekunden nutze, um mich gedanklich damit abzufinden, dass ich dieses Mal einen Mord begehen werde, der meine letzte Grenze einreißen wird. Dieser Mord wird meine Seele direkt in die Hölle befördern. Kein Zurück mehr.
Raven fährt das Auto in eine kleine Einbuchtung, die hier gebaut wurde, damit entgegenkommende Autos einander ausweichen können, dann schaltet sie den Motor aus, lässt aber das Licht an. »Also dann«, meint sie und lehnt sich zurück.
Ich grinse sie genüsslich an. »Was, wenn ich ein Mörder wäre?«, frage ich sie und halte ihren fragenden Blick fest, als sie mich ungläubig ansieht. Alles in mir hat auf Jagd geschaltet. Ich bin der Jäger und sie meine Beute. Mein Blut pulsiert gierig durch meine Adern. »Ich könnte ein Serienmörder sein, der dich hierhergebracht hat, um dich zu töten. Du willst mit deinem Wagen wer weiß wohin fahren, nimmst einen Fremden mit und denkst nicht an die Möglichkeit, dass dieser Fremde ein Mörder sein könnte?« Mein Puls rast in aufgeregter Vorfreude, als ich sie das frage und in ihrem Blick deutlich die Furcht erkenne. Sie versucht mich abzuschätzen und schafft es nicht, sich vorzustellen, dass ich ihr wirklich etwas antun könnte. Eigentlich spiele ich nicht mit meinen Opfern, aber ich habe auch noch nie eine Frau töten müssen, die die Dunkelheit in mir anspricht. Alles fühlt sich anders an bei ihr. Zum ersten Mal spüre ich Zweifel, zum ersten Mal hasse ich mich selbst. Zum ersten Mal will ich das nicht tun müssen. Aber da ist auch das Monster in mir, und das erwacht mit einer perfiden Lust auf Blut zum Leben bei dem Gedanken, gleich töten zu dürfen. Ich dränge es zurück, denn das hier wird ein schneller Tod werden. Keine Jagd.
»Dann werde ich jetzt wohl sterben«, sagt sie, versucht es belustigt klingen zu lassen, aber es gelingt ihr nicht ganz, die Unsicherheit in ihrer Stimme zu verbergen. »Willst du mir eine Lektion erteilen, indem du mir Angst machst? Glückwunsch, ist dir gelungen. Ich werde nie wieder jemanden mitnehmen. Nicht einmal, wenn er wie ein verlorener Welpe aussieht.«
»Du meinst, ich sah wie ein verlorener Welpe aus?«, frage ich sie lachend. Ich beobachte genau jede Reaktion in ihrem Gesicht. Wenn sie wüsste, wie sehr sie recht hat. In den letzten Wochen fühle ich mich verlorener als jemals zuvor. Wahrscheinlich sollte ich mich schäbig fühlen, weil ich dieses Spiel mit ihr treibe, bevor ich sie gleich wirklich töte. Aber statt mich schäbig zu fühlen, erregt es mich, ihr das anzutun. So bin ich nun mal, Dreck.
»Musst du jetzt oder nicht?«, will sie harsch wissen und legt die Finger um den Zündschlüssel.
Ich reiße die Tür auf, bevor sie den Motor wieder starten kann. »Ich muss. Leider«, murmle ich, als ich schon aus dem Wagen gesprungen bin. Ich weiß nicht, warum ich das eben getan habe, aber es hat sich gut angefühlt. Vielleicht wollte ich nur wissen, wie sie reagiert. Vielleicht diesen hilflosen Blick in ihren Augen sehen. Vielleicht sie noch einmal anschauen, ohne Abscheu in ihrem Blick zu sehen. Oder die Zeit, die ich mit ihr habe, einfach noch ein wenig rauszögern.
Aber all das ist jetzt egal. Ich habe einen Plan, eine Sache, die ich erledigen muss, weil ich ihrem Vater eine Botschaft senden muss: Du musst mit mir rechnen, Sherwood.
Wenn ich eine Chance gehabt hätte, ihn zu töten, dann würde jetzt er mit mir hier sein. Aber ich kann ihn nicht töten. Nicht zuletzt, weil er trotz allem, was er uns angetan hat, wie ein Vater für mich ist und ich gelernt habe, ihn zu lieben. Er hat aus mir gemacht, wer ich bin. Er hat mich erzogen, unterrichtet und geformt. Er hat für Sam, meine Mutter und mich gesorgt. Deswegen wollte ich ihn, wenn überhaupt, in einem Zweikampf töten. Nicht hinterrücks ermorden. Nur er und ich, so wie es unsere Gesetze sind. Aber er hat mir die Chance dazu verweigert. Auch weil mir das Recht dazu fehlt, ihn herauszufordern.
Also muss er den Schmerz über seinen Verrat an unserer Familie, den ich empfinde, auf eine andere Weise erfahren. Ich will, dass er leidet. Ich will, dass er innerlich zerbricht. Ich will ihn fühlen lassen, was ich fühle, jetzt wo ich nichts mehr habe. Nicht einmal mehr den Clan. Und töten ist alles, was ich kenne, was ich je gelernt habe. Also ist das der einzige Weg, ihm klarzumachen, dass er einen Fehler begangen hat. Der einzige Weg, um ihm zu zeigen, dass er nicht tun kann, was er getan hat.
Ich gehe um den Wagen herum zur Fahrertür, reiße sie auf und richte meine Waffe auf sie. »Aussteigen«, sage ich hart, packe mit der freien Hand ihren Arm und reiße sie aus dem Auto. Ich ignoriere ihre weit aufgerissenen Augen und zerre sie in das Scheinwerferlicht, dann stoße ich sie auf ihre Knie und richte die Waffe wieder auf sie. Meine Hände zittern. Meine Knie zittern. Mein Herz rast. Adrenalin peitscht durch meine Venen. Einen Menschen zu töten, löst die unterschiedlichsten Emotionen in mir aus. Beim ersten Mal habe ich gezittert, geheult und mich mehrmals davor und danach übergeben. Beim nächsten Mal hat sich mein Körper, jeder Muskel, jede Zelle angefühlt, als wäre ein Truck über mich hinweggerollt. Beim dritten Mal habe ich gar nichts gefühlt. Und jetzt? Jetzt brennt unbändige Wut auf mich, sie und ihren Vater in mir. Nein, ich will das hier nicht tun. Aber ich muss. Ich muss alles tun, um Sherwood dazu zu bringen, sich auf mich zu konzentrieren. Damit er keine Sekunde mehr an Sam denkt. Sherwood muss mich jagen.
Sie kniet vor mir, ihr Blick verfinstert sich, wird regelrecht hart und zornig. Sie wirkt, als hätte sie weniger Angst als ich in diesem Augenblick. Und das macht mich fertig.
»Schieß schon«, sagt sie herausfordernd, ihr Blick glüht vor Wut. Ich wusste, sie würde nicht flehen. In dem Punkt hat sie mich nicht enttäuscht. Aber diesen Mut, diese Stärke hätte ich nicht erwartet. Als wäre sie eine von uns. Was sie nicht ist. Weil es unmöglich ist.
Ich stehe da, die Waffe auf ihren Kopf gerichtet. Sie kniet, das Kinn stolz vorgereckt, blickt sie zu mir auf. In ihrem Blick nichts weiter als eisige Härte. Als würde sie das hier jeden Tag erleben und es könnte sie nicht mehr überraschen. Ich konzentriere mich auf das Blut auf dem Körper meiner Mutter und krame jede Einzelheit aus meinem Gedächtnis hervor: Ihre toten Augen, ihre zerrissene Kleidung. Ich rufe mir den Geruch von Blut und Erbrochenem zurück ins Gedächtnis und die Gefühle, die mich überwältigt haben, als ich sie so gefunden habe. Ihr Oberkörper war aufgerissen, ihre Gedärme herausgerissen, ihr Blick noch immer entsetzt. Ich konzentriere mich auf meine Wut und meinen Hass, den Schmerz, und versuche nicht, Ravens Gesicht zu sehen, sondern seins, auf das ich ziele.
»Worauf wartest du?«, schreit sie mich an. »Ich werde nicht betteln, vergiss es.« Sie spuckt mir vor die Füße.
Ihr Mut erschüttert mich. Und er nimmt mir die Luft zum Atmen. Zerreißt meine Wut regelrecht. Meine Hände zittern. Eigentlich tun sie das nie.
Mein Blick fällt auf das Grim Wolves Color auf der Innenseite meines Unterarms. Ich war einmal stolz, ein Teil des Clubs zu sein. Sherwood hat es zu einer großen Ehre gemacht, Mitglied in seinem MC zu sein. Und ich hatte mir nach drei Jahren als Vollstrecker seiner Urteile diese Ehre verdient. Ich hatte für ihn Abtrünnige gejagt und die getötet, die sich dem Clan und seinen Regeln nicht unterwerfen wollten. In den Augen der Abtrünnigen bin ich das größere Monster. Ein Verräter. Aber ich habe diese Aufgabe nie hinterfragt. Jeder Befehl meines Präsidenten war ein Befehl, dem ich gefolgt bin. So wurde ich ausgebildet.
Ich stelle mir vor, wie es sich anfühlen wird, Sherwood ein Foto von ihrer Leiche zu schicken. Aber diese Vorstellung fühlt sich nicht so an, wie ich erwartet hätte. Nicht, als könnte ich besser atmen, wenn ich sie erst getötet habe. Jetzt bin ich derjenige, der zweifelt. Und das alles wegen ihr. Ich wünschte, ich hätte sie sofort getötet, als ich sie zum ersten Mal in der Bar gesehen habe. Spätestens, als mir klar wurde, dass ihre Mutter nicht mehr auftauchen wird. Stattdessen habe ich zugelassen, dass sie mich ablenkt. Mich zögern lässt und sogar die Dunkelheit in mir anspricht.
Sie schnaubt abfällig, als ich die Waffe sinken lasse und steht auf. Ich stecke die Waffe weg, sie kommt auf mich zu und donnert mir eine recht beeindruckende Faust gegen mein Kinn. »War das jetzt ein Witz?«, will sie wissen und stapft an mir vorbei zum Auto. »Du kannst mich mal, ich fahr ohne dich weiter.«
»War es nicht«, sage ich und hole die Glock wieder hervor. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tue. Warum ich es mir anders überlegt habe. Ich weiß nur, ich kann sie nicht gehen lassen. Ich trete nah hinter sie, bevor sie einsteigen kann, und drücke ihren Körper mit meinem gegen den Pick-up. Der Lauf meiner Glock drückt gegen ihre Schläfe. Ich atme tief ihren süßen Geruch nach Frau ein. Was tut sie mit mir? Wieso kann ich sie nicht töten, obwohl ich nichts mehr will als das? Ich will meine Rache. Ihr Blut für das meiner Mutter. Ich will, dass Sherwood mich durch das ganze Land jagt, damit Will Zeit hat, Sam zu verstecken, wo Sherwood ihn niemals zwischen die Finger bekommen wird. Ich vergrabe meine Nase in ihrem Haar und treffe eine Entscheidung, die ich wahrscheinlich noch bereuen werde. Aber jede verdammte Zelle in meinem Körper verlangt danach, sie nah bei mir zu behalten. Ich muss sie gar nicht töten, um zu bekommen, was ich will. Sie muss nur bei mir bleiben. »Ich werde dich nicht töten, aber ich lasse dich auch nicht entkommen.«
»Fick dich«, flüstert sie mit zitternder Stimme abfällig.
»Fick dich«, stoße ich hervor. Meine Stimme zittert, aber nicht aus Angst, sondern vor Wut. Ich bin wütend auf ihn und wütend auf mich. »Was soll der Mist? Warum tust du das?«, fordere ich zu wissen und bin mir bewusst, dass ich ihn nur noch mehr provoziere, aber es ist mir egal, was sollte ich sonst tun? Wie sollte ich ihm sonst zeigen, dass nichts, was er tut, mich dazu bringen wird, ihn um mein Leben anzuflehen? Diese Genugtuung werde ich ihm nicht geben.
Sein heißer Atem trifft auf meine Wange, eine Hand liegt an meiner Kehle und mit der anderen drückt er seine Waffe gegen meine Schläfe. Sein Körper lehnt schwer gegen meinen. So nahe, dass ich sogar das heftige Trommeln seines Herzens spüren kann. Meins schlägt mindestens genauso schnell. Durch meinen Körper schießt Adrenalin. Ein beängstigendes und zugleich berauschendes Gefühl. Ich muss wahnsinnig sein, aber den dunklen Teil in mir spricht alles an dieser Situation an. »Steig in das Auto und rutsch rüber auf den Beifahrersitz«, knurrt er mich an. Er drückt den Lauf der Waffe noch fester gegen meine Schläfe, als wolle er mir damit verdeutlichen, wie ernst es ihm ist.
»Hast du mich nicht verstanden?«, fauche ich ihn an. Meine Hände liegen flach auf der Autotür. Wenn ich könnte, würde ich sie jetzt gern wie Krallen in das harte Material treiben, um meiner Wut irgendwie Ausdruck zu verleihen. »Ich habe ›Fick dich‹ gesagt.«
Er lacht düster hinter mir, löst seine Hand von meiner Kehle und tritt von mir weg. Seine freie Hand packt meinen Oberarm und zerrt mich von der geschlossenen Tür weg. »Aufmachen und einsteigen. Jetzt!«, brüllt er mich an. »Tu es, bevor ich die Geduld verliere, Kleine.«
Ich drehe mich zu ihm um und spucke ihm ins Gesicht, aber er zuckt nicht einmal mit der Wimper, stattdessen lacht er noch lauter. Sein Lachen scheint von überall um uns herum von den Bäumen zu hallen. »Bring es einfach hinter dich«, sage ich und kann nicht verbergen, dass meine Stimme meine Hoffnungslosigkeit widerspiegelt. Er steht vor mir, zwischen seinen Brauen hat sich eine Furche gebildet, so zornig ist er. Seine breiten Schultern heben und senken sich unter harten Atemzügen. Ich habe das Gefühl, er kämpft um jeden Funken Kontrolle, den er finden kann. Er senkt sogar seinen Blick und schließt für mehrere tiefe Atemzüge die Augen. Und doch kann ich ihm ins Gesicht blicken, weil er so viel größer ist als ich. Ich reiche ihm gerade einmal bis zur Brust. Ich bin ihm körperlich unterlegen. Was kann ich also tun?
Ich lege meine Hände an den Bund meiner Jeans und öffne den Knopf. Ich hebe trotzig meinen Blick und schlucke schwer, als Hitze sich durch meinen Körper frisst. Eigentlich wollte ich ihn mit dieser Geste provozieren, stattdessen erregt mich die Vorstellung, er könnte es wirklich tun. Mir die Kleidung vom Leib reißen und mich in den Dreck drücken. So wie Nick es häufig getan hat. Er hat mein Gesicht auf den dreckigen Boden seines Trailers gedrückt und mich dann zwischen Spritzen und leeren Flaschen gefickt, meine Hände gefesselt, in meinen Unterarmen und Schenkeln blutige Schnitte, die er oder ich selbst mir zugefügt haben, bis mein Körper so voller Adrenalin war, dass ich das Gefühl hatte, zu zerbersten. Nur wenn ich diesen Punkt erreiche, füllt sich die dunkle Leere in mir. Nur dann fühle ich wirklich. Ich schließe die Augen und kämpfe gegen die Bilder in meinem Kopf an. Das will ich eigentlich nicht. Ich hasse mich für diese Gedanken und Gefühle. Und ich hasse mich, dass ich jetzt in diesem Augenblick darüber nachdenke, es zuzulassen, dass ein Fremder all das mit mir tut. Jemand, der mit einer Waffe auf mich zielt. Auf gar keinen Fall. Das ist die Finsternis in mir, die das hier will. Aber wenn ich es zulasse, dann lässt er mich vielleicht gehen.
»Was zur Hölle machst du da?«, knurrt er und stößt mit der Waffe meine Hände von der Hose.
»Ich will es dir nur leichter machen, damit wir es schneller beenden können«, stoße ich aus. Denn genau das ist mein Plan: Ihm geben, was er will, damit er mich hoffentlich schnell wieder gehen lässt. Wenn ich mich nicht wehre, vielleicht sind dann meine Überlebenschancen viel größer. Ich reibe mir mit den Händen über meine fröstelnden Oberarme. Es ist nicht kalt, die Luft ist noch immer dick und warm, aber der Schock jagt mir Eis durch die Adern. Je länger wir hier stehen, desto mehr beginnt mein Körper zu zittern. Desto mehr weicht die Wut der Panik. Und das will ich nicht, weil ich dann schwach wäre. Und er soll nicht glauben, dass ich schwach bin.
»Ich werde dich nicht anfassen.«
»Was willst du dann von mir?«, fahre ich ihn an.