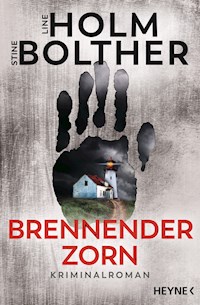
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Maria-Just-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn die Polizei machtlos ist, wem kannst du vertrauen?
In Jütland wird das Skelett einer jungen Frau gefunden. Sie starb durch einen Schuss in den Nacken. Die Tat liegt über siebzig Jahre zurück, Polizeihistorikerin Maria Just übernimmt die Ermittlungen. Währenddessen wird der Leiter des Dezernats für Gewaltverbrechen in Kopenhagen überfahren und beinahe getötet. Die Polizei steckt in einer tiefen Krise, und in diesem aufgeheizten Klima soll Kommissar Mikael Dirk herausfinden, wer den Anschlag auf seinen Chef verübt hat und das Land destabilisieren will. Als es zu einem weiteren Attentat kommt, erhält Mikael unerwartete Hilfe von Maria. Wer profitiert davon, wenn die Polizei ihr Gewaltmonopol verliert, und was verbindet die tote junge Frau mit den Tätern von heute?
Die neuen Co-Autorinnen von Jussi Adler-Olsen mit ihrer eigenen Krimireihe: Spannend, mit Tiefgang und psychologischem Geschick.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Jütland: Arbeiter stoßen durch Zufall auf die sterblichen Überreste einer jungen Frau. Todesursache: Genickschuss. Der schlammige Boden hat die Spuren des über siebzig Jahre alten Verbrechens konserviert. Ein Medaillon mit dem Bild zweier Frauen ist der einzige Hinweis auf die Identität der Toten. Polizeihistorikerin Maria Just soll herausfinden, wer die Frau war und warum sie sterben musste.
Kopenhagen: Auf den Straßen gibt es Unruhen. Trotz zahlreicher Anfeindungen gegen die Polizei unternimmt die Regierung nichts. Als der Leiter der Kopenhagener Mordkommission Niels Carlsen bei seiner morgendlichen Joggingrunde überfahren wird, muss Kommissar Mikael Dirk zusammen mit seinem Partner Frederik Dahlin alles daransetzen herauszufinden, wer es auf seinen Vorgesetzten abgesehen hat und das Land in den Zustand der Gesetzlosigkeit versetzen will.
Das Medaillon bringt Maria schließlich auf eine Spur, die ins Dänemark der Nachkriegszeit führt. Auch damals wollte man die Polizei ausschalten. Suchen Maria und Mikael in Wahrheit dieselben Täter?
Die Autorinnen
Line Holm wurde 1975 geboren und ist eine mehrfach ausgezeichnete Investigativjournalistin. Sie arbeitet für die Berlingske, eine der größten dänischen Zeitungen.
Stine Bolther wurde 1976 geboren. Sie ist Fernsehmoderatorin und seit achtzehn Jahren als Kriminalreporterin tätig.
Hautnah bei den echten Ermittlungen dabei zu sein hat die beiden dazu inspiriert, ihren ersten gemeinsamen Kriminalroman zu schreiben. Mit ihrem Debüt »Gefrorenes Herz«, dem Auftakt der Reihe um Kriminalhistorikerin Maria Just, gelang den beiden Autorinnen auf Anhieb ein SPIEGEL-Bestseller. Auch der zweite Fall für Maria Just schlägt ein düsteres Kapitel der dänischen Geschichte auf und ist gleichzeitig aktueller denn je.
Lieferbare TitelGefrorenes Herz
BRENNENDER ZORN
KRIMINALROMAN
Aus dem Dänischen von Franziska Hüther und Günther Frauenlob
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe Lovløs erschien erstmals 2022 bei Politikens Forlag, Kopenhagen.
Deutsche Erstausgabe 12/2022
Copyright © 2022 Line Holm and Stine Bolther and JP/Politikens Hus A/S in agreement with Politiken Literary Agency
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Maike Dörries
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO GbR, München, unter Verwendung von © Shutterstock.com (Mara Fribus, Pierette Guertin, ms_pics_and_more, Kochneva Tetyana, LenaML, STILLFX)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28253-0V003
www.heyne.de
Mein kleiner Schatz,
dieser letzte Brief an Dich existiert nur hier. Als Worte, die durch meinen Kopf wirbeln, indes sie mich, strauchelnd und blind, über Torf und Baumstümpfe zerren.
Die Winterkälte zerreißt mich. Schneidet mir in die nackten Füße. Der Nebel legt sich klamm auf meine bloßen Arme. Dringt als schwere Feuchtigkeit in mein Kleid.
Die Männer haben kalte Augen, starre Blicke, schwarze Herzen.
Ich spüre kaltes Metall am Hinterkopf.
Schon bald bin ich tot.
Ich konnte mein Versprechen Dir gegenüber nicht einhalten.
Eines Tages wirst Du es vielleicht verstehen. Das Jüngste Gericht tagt nicht am Ende des Lebens. Das Jüngste Gericht tagt jetzt. Tagtäglich. Ein jedes Menschenleben hältst Du in Deinen Händen.
Die Rollen sind nun vertauscht. Du musst mich finden. Sei Dir gewiß, dass meine Liebe Dich hier erwartet, immer.
Finde mich.
MAI 2021
1
Er rannte. So schnell wie seit Kindertagen nicht mehr. Schneller, als sein Körper es eigentlich verkraftete.
Stürzte er, hätte er keine Chance. In diesem albernen Kostüm käme er aus eigener Kraft nicht wieder auf die Beine. Hilflos zuckend würde er am Boden liegen, überwältigt, ausgeknockt und gedemütigt von dem Gestank, wie eine große Made von einem Meter achtzig.
Also rannte er. Floh vor dem feuchten Brodem nach Verwesung und Tod, der in seine Lunge drang und sich in sein Herz bohrte. Er rannte panisch und gleichzeitig im peinlichen Bewusstsein, welchen Anblick er dabei bot: ein angestochenes Michelin-Männchen, das in weißen Gewändern mit einem Zelt auf dem Kopf und einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken davonstürzte. Er floh vor den Gräbern und vor den Containern mit ihren schleimigen Fleisch- und Knochenresten und Pelzbüscheln, vor den überraschend vielen intakten Nerzköpfen mit den leeren Augenhöhlen, floh vor den Baggern, den randvoll gefüllten Schlammsaugfahrzeugen und vor den Kollegen, die in ihrer verbissenen Arbeit innehielten und ihm nachblickten.
Der süßliche Gestank hätte ihn nicht derart überrumpeln dürfen. Der Mief hing über der ganzen Gegend. Mehrere Kilometer entfernt, selbst noch in Holstebro, wurde einem übel, sobald man die Fenster öffnete. Seit Beginn der Grabungen rieten Frauen einander davon ab, draußen Wäsche aufzuhängen, Schulkinder weigerten sich, in den Pausen auf den Hof zu gehen, und Babys hielten ihren Mittagsschlaf drinnen. Alle verfluchten »sie« – die Regierung, die Polizei, die Behörden, das Gesundheitsamt, ja, die gesamte diffuse Gruppe von Beschlussträgern, die für diese Schweinerei verantwortlich waren – in sicherer Entfernung. Den Leuten hier blieb nur, auf baldige Tage mit steifer Brise zu hoffen. Und auf frischen Wind in der Politik.
Er hatte im Laufe der Jahre so einiges gesehen. Kloakenschlamm, Giftaustritte, allen möglichen Dreck hatte er beseitigt. Das hier war etwas anderes. Die Verwesung hatte sich von hinten angeschlichen. Er stellte sie sich als gelbgrünes Gas vor, das seine Wirbelsäule hinauf über die Schultern gekrochen war und sich jetzt auf seinen Schleimhäuten in Nase und Mund sammelte. Es sei nicht lebensbedrohlich, behaupteten sie, doch ein Jahr globaler Pandemie rumorte in seinem Hinterkopf; sein Alter und sein Lebensstil konnten ihn leicht auf der tragischen Seite der Todesstatistik enden lassen. Wie zum Henker war der Geruch in seinen Schutzanzug gedrungen?
Er klopfte sich Arme, Hintern und Beine ab. Umständlich versuchte er, den Kopf in dem Plastikhelm zu drehen und über die rechte Schulter zu schauen, was bedeutete, seinen Körper auf eine Weise zu verrenken, wie er es sicher die letzten zwanzig Jahre nicht mehr getan hatte, aber … Teufel noch mal, tatsächlich, hinten am rechten Oberschenkel hatte der Schutzanzug einen Riss. Drei, vier Zentimeter, mehr nicht, aber das reichte schon. Wahrscheinlich hatte er sich den Stoff aufgerissen, als er vor zehn Minuten aus dem Bagger gestiegen war, und der kleine Spalt reichte schon, um die Gase von Millionen verwesender Nerze eindringen zu lassen.
Als er das Ufer des Sees erreichte, fühlte er sich wie nach einem Halbmarathon. Tatsächlich waren es höchstens drei- oder vierhundert Meter gewesen, aber das Innere seines Schutzanzugs triefte vor Kondenswasser, der See lag als unüberwindbares Hindernis vor ihm, und seine Kondition entsprach exakt der, die man von einem Mann mittleren Alters erwarten konnte, der täglich zwanzig Pall Mall rauchte und literweise Rahmsauce aß. Er konnte nicht mehr.
Eine Hand auf den Oberschenkel gestützt, beugte er sich vornüber, presste die Maske fest ins Gesicht und sog gierig den Sauerstoff aus der Flasche ein. Ga-a-anz ruhig, sagte er sich. Die Gase, der Gestank, die Verwesung würden nicht durch die Maske dringen, solange er dafür sorgte, dass sie dicht auflag.
Er sank auf die Knie und starrte zurück zu den Nerzgräbern und den brummenden Maschinen, während er seine Atmung zu beruhigen suchte. Die Männer, die dort auf Stundenbasis schufteten … Sie sollten einen Orden bekommen. Er selbst inklusive. Aber er wusste so gut wie jeder andere, dass kein Politiker, kein einziger Mensch in Machtposition, auch nur einen Gedanken an gewöhnliche Leute wie ihn verschwendete, wenn sie die Anweisung erteilten, das von ihnen angerichtete Schlamassel zu beseitigen.
Die Nerze waren im Herbst, als das Coronavirus sich unkontrolliert auf den dänischen Nerzfarmen ausbreitete, in aller Eile gekeult worden. Wie zum Geier irgendein Anzugträger auf die Idee kam, vier Millionen Nerze hier zu verbuddeln, verblieb wie andere Schreibtischentscheidungen unklar. Vor allem, als Experten wenige Wochen später darauf aufmerksam machten, dass Phosphor und Stickstoff von den pelzigen Kadavern in den geschützten See gelangen könnten.
Deshalb war er hier, und deshalb waren seine Kollegen hinzugerufen worden. Die Schlammsauger. Die Dunkelmänner, die es gewohnt waren, bis zum Hals in Scheiße zu stehen, wenn alle anderen angewidert wegschauten.
Er erachtete sich selbst als ziemlich abgebrüht. Aber das hier … Das war selbst für ihn zu krass. Die Nerze sollten wieder ausgegraben und verbrannt werden, so der Plan, aber keiner hatte ihnen gesagt, dass die Viecher noch keine verwesten Skelette, sondern eine schleimige, käseartige Masse waren. Buchstäblich Fäulnis im Pelz.
Schnaufend drehte er sich in seinem Schutzanzug zur Seite und blickte wieder über den See. Unbeeindruckt vom Gestank lag dieser umgeben von immergrünen Bäumen, die sich in der himmelblauen Oberfläche spiegelten. Eine Libelle schwirrte einen halben Meter vor dem Plastikvisier des Helms, der sein Sichtfeld eingrenzte, in der Luft. Seine Enkel hatten ihm erzählt, dass es Libellen schon vor den Dinosauriern auf der Erde gegeben habe, und ihm schien, als glotze sie ihn höhnisch an – ihn, eine nicht überlebensfähige Menschenpuppe, die in ihre Domäne eingedrungen war.
Er schlug nach der Libelle und schwang die Beine über die Uferböschung. Hier saß es sich wahrlich gut, mit den Füßen über dem Wasser baumelnd, wie auf einem Stuhl, der weder zu hart noch zu weich war. Er hätte sterben können für eine Zigarette und ein Bier.
Es war gesetzeswidrig hoch zehn, dem gesamten Nerzgewerbe den Garaus zu machen. Und saudämlich, die Nerze hier zu vergraben. Hatten die hohen Herren und Damen denn gar keinen Funken Respekt mehr im Leib? Vor gewöhnlich Sterblichen?
»Ich werde gut auf Dänemark aufpassen«, lautete Ministerpräsident Troels Mejdings Slogan während des Wahlkampfs vergangenen Herbst. Lieber Himmel.
Obwohl er zugeben musste, dass er ein Licht in Meijding gesehen hatte, als der Landwirtssohn mit der auffälligen grauweißen Strähne im Stirnhaar die Macht übernahm. Aber irgendwann zeigte jede Regierung Ermüdungserscheinungen. Die Leute wurden es leid, immer dieselben Personen auf dieselbe Art im Fernsehen auftreten zu sehen, genau wie man die Whiskysauce im Steakhaus leid wurde und es satt bekam, jahrein, jahraus die eigene Ehefrau anzuschauen. Mit dem Skandal um die Flüchtlingskinder 2020 konnte Meijding sich auch nicht eben schmücken. Er selbst war ganz bestimmt kein Halalhippie, wie man so schön sagte, aber wenn zwei unschuldige Kinder um ein Haar in den Händen des Systems ums Leben kamen, war für ihn eindeutig eine rote Linie überschritten. Und dann war da noch das Debakel mit den grönländischen Kindern … Eigentlich hatte er es aufgegeben, verstehen zu wollen, wer die Schuld an der ganzen Geschichte trug, aber irgendwie musste Mejding darin verwickelt gewesen sein, da er fast erschossen worden wäre. Er hatte es selbst live im Fernsehen gesehen. Mitten beim Nachmittagskaffee. Meijding hatte überlebt, aber ein Spindoktor, der Name war längst vergessen, war tot, und Schloss Christiansborg hatte monatelang von Streitereien widergehallt.
Aber dann war Corona über alle hereingebrochen. Der Skandal mit den Kindern wurde in den Hintergrund gedrängt, während Meijding das Land durch die erste Welle der Pandemie steuerte und in der Coronapause Anfang Herbst wiedergewählt wurde. Die zweite Welle verlief weniger glimpflich, und nun, im Frühjahr 2021, stand Meijding auf etwas wackligen Füßen.
Nein, es gab kaum noch jemanden, in den man sein Vertrauen setzen konnte. Wähler wie er waren heutzutage quasi abgehängt. Zur Bedeutungslosigkeit verdammt, obwohl sie in Krisenzeiten den Laden am Laufen hielten. Wozu waren Fernsehmoderatoren, Immobilienmakler oder sogenannte Debattanten schon zu gebrauchen, wenn diverse Krisen das Land trafen? Einen Dreck. Sie stellten eine Minderheit dar, trotzdem bestimmten die Politiker, die Medienfuzzis und Anzugträger, diese Arschlöcher auf ihren Chefsesseln, einfach alles. Die Reichen wurden mit jedem Tag reicher, egal wie sehr sie sich die Hände mit Geldwäsche und Steuerhinterziehung schmutzig gemacht hatten.
Diese Leute hatten während der gesamten Coronakrise in ihren Sommerhäusern gesessen und gejammert, weil sie ihren Champagnerpartys und Skiurlauben nicht im üblichen Umfang frönen konnten, während das arbeitende Volk morgens aufstand, Pausenbrote schmierte, Maske aufsetzte, die Kinder wegbrachte, sich in regelmäßigen Abständen ein Wattestäbchen ins Gehirn rammen ließ und einfach weiterschuftete. Natürlich tat auch er das, sonst übernahm womöglich noch irgendein Pole oder ein Roboter seinen Job.
Aber welchen Politiker scherte das schon?
Abgesehen vielleicht diese Neue. Katja Klargaard. Oder schlicht Katja, wie man sie hier in ihrer jütischen Heimatgegend nannte. Die Frau hatte wirklich Haare auf den Zähnen. Sie verstand Leute wie ihn, und sie sprach so, dass Leute wie er auch sie verstanden.
Katja war als eine von vier Abgeordneten aus einer neuen, deutlich rechtsgerichteten Partei gewählt worden. Normalerweise wurde diese Art Parteien nicht ins Zentrum der Macht eingeladen, aber Mejding brauchte die Mandate für seine Regierung, und er hatte klug bedacht der jungen Katja Klargaard den wichtigen Posten als Justizministerin zugewiesen. All ihre Wahlversprechen waren schließlich Varianten von »mehr Gesetz und Ordnung« gewesen. Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis sollten nach Hause geschickt, Kriminelle ins Gefängnis verfrachtet und missratene Kinder erzogen werden; Klargaard war für mehr Polizei an den Grenzen und auf den Straßen, vor allem in den strukturschwachen Regionen in Jütland, wo wochenends fast schon gesetzlose Zustände herrschten, sowie generell für härtere Strafen, speziell für Verbrechen wie Unfallflucht, Mord, Pädophilie und Vergewaltigung.
Schluss mit Larifari.
»Konsequenz-Katja« wurde sie in den Boulevardzeitungen und in den sozialen Medien genannt, wenn sie wieder einmal eine Gesetzesverschärfung durchgeboxt hatte. Die Opposition zeterte natürlich und bezeichnete sie als platt und populistisch, aber er fand sie gut. Und attraktiv obendrein, das schadete nie.
Katja Klargaard wollte, daran bestand kein Zweifel, die Dinge anders machen. Für ein wenig Ordnung sorgen, gegen den in Christiansborg herrschenden Sumpf der Verderbtheit vorgehen. Ja, man bekam verdammt noch mal selber Lust, das Ganze bis auf die Grundmauern abzufackeln und neu anzufangen. Einfach nur das Ganze brennen zu sehen …
Jemand tippte ihm hart auf die Schulter, und er erschrak derart, dass er mit der schweren Sauerstoffflasche auf dem Rücken zur Seite kippte und die Böschung hinunterkugelte. Er landete auf dem Bauch, alle viere von sich gestreckt, die in den Gummistiefeln steckenden Füße im Seewasser und der Plastikhelm in die Erde gedrückt. Gott verdammt, war das demütigend.
Mühsam hob er den Kopf, schaute auf und sah natürlich, er hätte es sich denken können, seinen halb so alten Kollegen, der zum Teamleiter berufen worden war und die Aufgabe auf eine Art beschwingt anging, dass es die Älteren ankotzte. Was zur Hölle sollte man mit der ganzen guten Laune? Das allein reichte, um einem die Stimmung zu vermiesen.
»Was hast du? Geht’s dir nicht gut?«, erkundigte sich der Jungspund hinter seiner Maske. Er klang wie ein Kind, das in eine Trinkflasche spricht.
»Mein Anzug hat ein Loch«, prustete er als Antwort und wies umständlich auf seinen hinteren Oberschenkel.
»Am Hintern?« Der Bursche reichte ihm die Hand, um ihm aufzuhelfen.
Er ignorierte die Hand und den Versuch des Kollegen, witzig zu sein. Stattdessen stemmte er die Hände gegen die Böschung und versuchte aufzustehen, doch die Füße rutschten im Uferschlamm weg, und er musste besagten Hintern in einer gelinde gesagt wenig eleganten Yogaposition nach oben drücken, während er erst den einen, dann den anderen Gummistiefel fest in die Böschung stieß, um Halt zu finden.
Mit der rechten Hand griff er nach einer aus der Erde ragenden Wurzel und wollte sich gerade mit einem Stöhnen hochziehen, als die Wurzel zu seinem Schrecken nachgab. Mit einem allzu vernehmlichen »Hrmpf« kippte er um und landete auf dem Allerwertesten im dreißig Zentimeter tiefen Wasser.
Er betrachtete die Wurzel in seiner Hand und den kleinen Erdrutsch, den er mit seinem Seelöwenmanöver verursacht hatte. Die Wurzel sah merkwürdig aus.
»Stammt das auch von einem Tier?«, fragte der junge Kollege, der sich neugierig über den grau-weißen Gegenstand in seiner Hand beugte.
Das war eindeutig keine Wurzel. Es war ein Knochen.
»So weit hier drüben liegen doch keine Nerze, oder?« Jetzt klang der Kollege skeptisch.
Er gab keine Antwort. Es war ja wohl offensichtlich, dachte er, während kaltes Seewasser das Loch hinten am Oberschenkel fand, in den Anzug sickerte und einen in jeglicher Hinsicht beschissenen Tag vollendete.
Das da … das war nie ein Nerz gewesen.
ERSTER TEIL
29. Juli bis 8. August 2021
2
Maria Just stand, den Blick aufs Meer gerichtet, knietief im Wasser. Sie schloss für einen Moment die Augen. Eine wohltuende Brise blies ihr die rötlichen Locken von den Schultern und ließ kleine, kühle Wellen über ihre Knie schwappen. Das dreijährige Mädchen an ihrer linken Hand juchzte vor Freude.
Am Horizont fuhren zwei Containerschiffe wie Miniaturmodelle vorbei. Als Kind hatte sie davon geträumt, mit ihnen zu fahren, weit fort von diesem windgepeitschten Fleckchen am äußersten Rande Dänemarks, wo der Tod ihres ertrunkenen Vaters und die jahrelange Verzweiflung der Mutter ihre Jugendjahre vergiftet hatten.
»Maria«, sagte das Kind an ihrer rechten Hand, doch sie gestattete sich, den fragenden Ton kurz zu ignorieren.
Damals war ihr jeder andere Ort besser erschienen als Thorup Strand. Jetzt neigte sich ihr Sommerurlaub dem Ende zu, und sie wusste, wie sehr sie die salzige Luft, die sporadischen Schreie der Möwen und die Abwesenheit von Menschenmassen vermissen würde, wenn sie nach Kopenhagen zurückkehrte und wieder täglich zwischen ihrer Wohnung in Østerbro und ihrer Arbeit als Historikerin im Polizeimuseum in Nørrebro pendelte.
Das, und Jakob natürlich.
»Maria, Jakob ruft.« Das Kind zog ungeduldig an ihrer Hand, und sie sah zu dem blauäugigen, sommersprossigen Jungen hinab, dem die Schneidezähne fehlten. Ihr Neffe Lau.
»Was?«, murmelte sie, schläfrig von der Sonne und in Gedanken versunken.
Sie hatte ihren kompletten Urlaub hier oben verbracht. War joggen gegangen, hatte mit Lau und seiner kleinen Schwester gespielt, im Meer gebadet, lange geschlafen, gegrillt und etwas zu viel Wein getrunken, gelacht und gelesen. Und nicht selten ins Leere gestarrt.
Sie hatte versucht, nicht in Selbstanalysen und Grübeleien zu versinken, denn eigentlich fühlte sie sich gut, stärker als früher. Aber man brauchte kaum einen Doktortitel in Psychologie, um sich auszurechnen, dass die Ereignisse im letzten Jahr ihre Spuren hinterlassen hatten.
»Sie wären fast gestorben. Dieses Trauma müssen Sie bearbeiten«, hatte eine Krisenpsychologin am Rigshospital sie ermahnt.
Maria zog es vor, derlei Dinge im Unterbewusstsein ablaufen zu lassen. Als Kind hatte sie ausreichend Psychoanalysen und bekümmerte Blicke fremder Therapeuten über sich ergehen lassen müssen. Inzwischen vertrat sie die Meinung, dass Therapien und ewiges Stochern in offenen Wunden alles nur schlimmer machten. Wunden heilten von allein, wenn man sie nur in Ruhe ließ. Und ihnen Zeit gab.
Anderthalb Jahre war es her, seit Maria auf eine Verbindung zwischen einem ungelösten Doppelmord aus den Sechzigerjahren und der Ermordung des Rotkreuzgeneralsekretärs gestoßen war. Eine Entdeckung, die damit endete, dass sie entführt wurde und fast ertrunken wäre. Jakob hatte wochenlang im Rigshospital bei ihr gesessen. Und sie »mein Liebling« genannt, als sie aufwachte. Nichts von wegen mal eben abklären »Hey, wo stehen wir?« oder »Was möchtest du?«. Nein, es war selbstverständlich für ihn gewesen, dass sie ab jetzt zusammen waren. So wie es selbstverständlich für ihn gewesen war, sich in den eiskalten Øresund zu stürzen und sie Sekunden vor dem Ertrinken aus dem Wasser zu ziehen. Maria war von Natur aus mehr Zynikerin denn Romantikerin, doch selbst für eine vom Leben geprüfte Single von zweiunddreißig Jahren war es schwer, ein überzeugenderes Argument für die Liebe zu finden:
Er hatte ihr das Leben gerettet.
»Maria! Guck!«
Jetzt zog auch die andere Kinderhand an ihrer. Mads’ jüngstes Kind, die dreijährige Emilie, zeigte mit ihrer freien Hand zum Strand. Widerwillig drehte Maria sich zu den Klippen, wo Jakob und ihr älterer Bruder mit ihrem Nachmittagsbierchen standen.
Standen, nicht saßen. Die beiden Männer waren seit dem ersten Schultag Freunde, und sie verband weit mehr als die lebenslange Freundschaft. Beide wachten mit Argusaugen über Maria: Jakob mit seiner Liebe, die über so viele Jahre hinweg unerfüllt und unglücklich gewesen war. Mads mit der väterlichen Verantwortung, die er bereits als Teenager übernommen hatte.
»Was!?«, rief sie ihnen zu.
Jakob wedelte mit einem in der Sonne glänzenden Gegenstand.
»Das Museum! Du sollst zurückrufen!«
Maria stutzte. Es musste wichtig sein, wenn die Kollegen an einem Donnerstagnachmittag während ihres Urlaubs anriefen, aber glücklich war sie darüber nicht.
Normalerweise ließ sie für ihren Job jederzeit alles stehen und liegen und vergaß alles und jeden um sich herum, wenn sie sich in die Kriminalrätsel der Vergangenheit vertiefte, in ungelöste Mordfälle oder die Kriminalitätsstatistik, die zu der umfassenden Geschichte darüber beitrug, wer die Dänen eigentlich waren.
Und jetzt? War sie wirklich verärgert, weil das Museum sie störte?
Oder waren es Jakob und seine vorsichtigen Fragen über ihre gemeinsame Zukunft, die ihr im Hinterkopf herumspukten? Waren es die Ereignisse des letzten Jahres, die sich meldeten? Die ganze Sache hatte damals als simples Projekt für das Museum begonnen, sie aber letztlich um ein Haar das Leben gekostet. Machte die Arbeit ihr auf einmal Angst?
Nein, verdammt, so weit kam’s noch. Es würde schön sein, in die Stadt zurückzukehren, und sie vermisste ihre Freundin Mette, die eingefleischte Kopenhagenerin, die sich nur im äußersten Notfall aus dem Servicegebiet der U-Bahn oder von ihrer Arbeit als Journalistin bei der Morgenavisen wegbewegte. Und Mikael Dirk, den Polizisten, der einen ebenso großen Teil dazu beigetragen hatte, dass sie damals aus dem Øresund gerettet wurde – ihn wollte sie ebenfalls nicht missen. Wie oft fand man schon einen neuen Freund?
Mikael Dirk machte diese Woche Urlaub mit seinem Sohn. Zum ersten Mal sollte er eine ganze Woche mit seinem siebenjährigen Jungen allein sein, und der Polizist, der seine Gefühle sonst stets unter Verschluss hielt, war ziemlich nervös gewesen. Maria wusste nicht genau, warum, aber zwischen Hectors viertem und siebtem Lebensjahr hatte Mikael keinen Kontakt zu ihm gehabt. Mikael hatte ausweichend erklärt, dies sei allein seinem Versagen als Vater geschuldet, doch nachdem er während der Festnahmeaktion verwundet worden war, habe er sich »zusammengerissen«. Es steckte aber wohl etwas mehr dahinter. Soweit Maria bekannt war, hatte Mikael seiner Ex-Frau Karin einen dreizehn Seiten langen Brief geschickt, in dem er sich wortreich entschuldigt und seine Reue zu Papier gebracht hatte.
Karin hatte sich überraschenderweise erweichen lassen und nach und nach zugestimmt, dass Mikael zunächst einen Tag, dann hin und wieder ein Wochenende und nun eine ganze Woche allein mit Hector verbrachte. Womöglich aufgrund der Erkenntnis, dass Mikael mit dem Job, den er ausübte, eines Tages für immer aus Hectors Leben verschwinden könnte.
Der Junge war Mikaels Ein und Alles, und in den letzten Monaten hatte Maria beobachtet, wie ein schwermütiger und verbitterter Mann dem Leben mit neuem Blick begegnete. Er lächelte öfter.
Vor zwei Tagen waren Mikael und Hector in Thorup Strand zu Besuch vorbeigekommen. Mikael hatte ein Ferienhaus in der Nähe gemietet und dankbar zugesagt, als Maria ihn und Hector zum Grillen und Spielen mit Mads’ Kindern eingeladen hatte. Lau und Hector hatten sich gut verstanden, und Mikael war allmählich aufgetaut. Es war sehr nett gewesen. Wenngleich Jakob sich an diesem Tag merkwürdig wortkarg gegeben hatte. Maria war sich bewusst, dass Mikaels Anwesenheit ihn einschüchterte. Schließlich war er nicht auf den Kopf gefallen, und ihm entging nicht, dass zwischen seiner Freundin und dem schroffen Polizisten irgendeine unerklärliche Chemie herrschte, sowie eine fachliche Zusammengehörigkeit, an der er nicht teilhaben konnte. Aber in Marias Augen war das unbegründet. Erstens gab es keinerlei Grund zur Eifersucht, zweitens sollte ihr niemand vorschreiben, mit wem sie befreundet war. Sie liebte Jakob, und sie hatten eine gemeinsame Vergangenheit, an die keine neue Bekanntschaft heranreichen konnte. Das musste Bestätigung genug sein.
Seufzend hob sie Emilie auf ihre Hüfte.
»Kommt, ihr Racker, wir gehen«, sagte sie und hielt Lau fest an der Hand, als sie zum Strand wateten. Der Respekt vor dem Meer war nach dem Tod des Vaters tief in ihr verankert, wobei die Panik vor dem Wasser seit ihrem Beinahe-Ertrinken merkwürdigerweise abgenommen hatte. Sie hatte »der Angst in die Augen gesehen«, wie Mads es formulierte.
»Bodil hat sechsmal angerufen.« Jakob reichte ihr ein Handtuch und das Telefon, während Mads ihr die protestierende Emilie vom Arm nahm.
»Was wollte sie?«
Jakob zuckte mit den Schultern.
»Ich bin nicht drangegangen. Aber es scheint wichtig zu sein, wenn sie in deinem Urlaub bei dir Sturm klingelt.« Ein Lächeln spielte um seine Mundwinkel. »Wie bin ich doch froh, mein eigener Chef zu sein. Das solltest du auch mal probieren.«
»Freelance-Polizeihistorikerin? Herzlichen Dank für die lausigste Geschäftsidee der Welt.«
Maria küsste ihn und ging etwas zur Seite, um in Ruhe zu telefonieren. Bodil Toft, ihre Chefin im Polizeimuseum, war die Sorte Mensch, die leicht gekränkt war, wenn einer ihrer Mitarbeiter es wagte, sich im Urlaub zu amüsieren.
»Na endlich«, sagte Bodil beim Abnehmen. Kein »Tut mir leid, dass ich dich störe« oder »Genießt du deinen Urlaub?«. Höfliche Konversation reservierte Bodil für Leute, zu denen sie aufsah oder bei denen sie sich einschmeicheln wollte.
»Ich war schwimmen. Schließlich habe ich Urlaub.« Maria antwortete bewusst etwas spitz.
»Hast du nicht langsam genug im Meer herumgeplanscht, das sollte doch bald für ein Leben reichen?« Bodil ließ die schamlose Bemerkung einen Moment lang in der Luft hängen. »Heute Morgen … der 29. Juli, das ist doch heute? Heute wurden mir die Unterlagen zu einem Fall der Polizei Mittel- und Westjütland zugeschickt, der dem Polizeimuseum übertragen wird. Gesetzt den Fall, wir sind interessiert. Wir sollen schnellstmöglich Bescheid sagen, darum hätte ich gern, dass du einen Blick darauf wirfst, sobald du zur Arbeit kommst. Wie du weißt, bin ich auf dem Weg in die Ferien.«
Interessiert? Maria fasste das als rhetorische Frage auf. Trotzdem kam es darauf an, worum es bei dem Fall ging. Ohne einen museumsrelevanten Aspekt würde er bloß als weitere Kuriosität im Archivkeller enden.
Bodil räusperte sich.
»Im Frühjahr hat ein Arbeitstrupp eine Leiche gefunden, in der Gegend von … Moment, Nordre … nein, Nørre Felding heißt das. Sagt dir das was? Das ist doch bei dir in der Nähe, oder?«
»Ich weiß, wo der Ort liegt, ja.«
Maria unterdrückte ein genervtes Stöhnen. Bodil war in einem Vorort Kopenhagens geboren und aufgewachsen, und es gab für Maria kaum etwas Provinzielleres als einen Hauptstädter, für den ganz Jütland ein einziger blinder Fleck auf der Karte war.
»Dann weiß ich auch, worum es bei dem Fall geht.«
Ende Mai war bei einem See südlich von Holstebro ein vergrabenes Skelett gefunden worden, im selben Gebiet, wo man ein halbes Jahr zuvor Millionen tote, potenziell mit Covid-19 infizierte Nerze begraben hatte.
Der Leichenfund war Breaking News gewesen, mit Helikopter und Live-Berichterstattung vor Ort, wobei man immer darauf geachtet hatte, die schöne Natur rund um den Fundort möglichst makaber aussehen zu lassen.
»Hier stinkt es nach Tod«, hatte der Entsandte berichtet.
Das Medieninteresse war jedoch rasch versiegt, nachdem ein hinzugerufener Rechtsmediziner zu dem Ergebnis kam, dass das Skelett bereits seit mehreren Jahrzehnten am See begraben lag und es sich dementsprechend nicht um ein aktuelles Verbrechen handelte. Und dass der Gestank nach Tod von den verwesenden Pelztieren ausging, nicht von besagtem menschlichem Skelett.
»Schön, dann kann ich mir diese Information ja sparen«, erwiderte Bodil. »Das Skelett wurde zur C-14-Datierung ins Rechtsmedizinische Institut in Aarhus gebracht, aber allzu weit sind sie dort nicht gekommen, weil die einzige auf Rechtsanthropologie spezialisierte Mitarbeiterin mit Burnout krankgeschrieben ist. Die übrigen Mitarbeiter sind mit anderen Fällen beschäftigt und generell stark im Verzug nach dieser Corona-Sch…«
»Die Leiche ist also noch nicht identifiziert?«, fuhr Maria dazwischen.
»Bisher nicht, nein. Es handelt sich um eine Frau, soweit ich verstanden habe, und wir müssen einige Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit. Aber die Rechtsmedizin in Aarhus ist wie gesagt unterbesetzt, und dasselbe gilt für die Polizeidirektion, die keine freien Personalkapazitäten hat, um einem … wie sollen wir es nennen? Einem antiken Fall nachzugehen? Du weißt ja, wie das ist. Vom Rigshospital höre ich, dass der Personalmangel allmählich kritische Ausmaße annimmt. Die Situation ist wirklich inakzeptabel.«
Bodil hielt inne, und Maria hörte sie zwischen ihren schmalen Lippen Luft einziehen. Offenbar rauchte Bodil noch immer heimlich. Jeder am Polizeimuseum wusste davon, dass sie es aber trotzdem vor allen verborgen hielt, verlieh der Chefin gleich zwei mildernde Züge: Bodil hatte ein Laster, und es war ihr peinlich, dies zuzugeben.
»Na jedenfalls, die irdischen Überreste wurden ans Rechtsmedizinische Institut in Kopenhagen überführt, wo sie anscheinend etwas mehr Kapazitäten haben«, fuhr Bodil fort. »Gerichtsanthropologin Margrethe Sandager hat mir geschrieben, dass wir sämtliche relevanten Informationen sowie einzelne Objekte aus dem Fall bekommen können. Sie meint, die Sache könnte interessant für uns sein.«
»Okay, ich schau’s mir gerne an.«
»Mein Urlaub beginnt ja, wenn du zurückkommst, die Einschätzung obliegt also dir. Ich kenne Sandager seit vielen Jahren, sie ist sehr erfahren, und ich wollte sie nicht abweisen. Es ist ein bisschen eine Zwickmühle. Mir ist nicht ganz klar, was wir mit einem namenlosen Skelett anfangen sollen. Andererseits ist es natürlich ein Vertrauensbeweis vonseiten der Polizei, dass sie uns einen Fall überlassen.«
Maria fand Bodils Tonfall unerträglich selbstgefällig.
»Irgendwie ist das aber schon ein Armutszeugnis, oder?«, konnte Maria sich die provokante Frage nicht verkneifen.
»Wieso Armutszeugnis?«
Maria sah Bodil am anderen Ende der Verbindung förmlich die Augen aufreißen. Ein Emoji mit Bernsteinkette um den Hals.
»Dass die Polizei so schnell aufgibt! Nach vierzig oder fünfzig Jahren muss es doch noch jemanden in der Gegend um Holstebro geben, der ein Familienmitglied vermisst! Oder etwas weiß! Wieso schließt die Polizei einen Fall ohne ernst zu nehmende Ermittlungen?«
Bodil schwieg einen Moment.
»Tja, das kann ich dir auch nicht sagen«, meinte sie dann. »Vielleicht haben sie es ja versucht, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen? Es war ein annus horribilis, auch für die Polizei. Ich habe vollstes Vertrauen, dass die Ermittler alles in ihrer Macht Stehende getan haben. Und Maria? Denk dran, wer dein Gehalt bezahlt.«
Maria verdrehte die Augen. Ja, auf dem Papier war sie von der Landespolizei angestellt, und sie hatte größten Respekt vor den Mitarbeitern der Polizei. Die aber stand finanziell, politisch und organisatorisch unter Druck, und durch die Historikerbrille betrachtet wusste Maria, dass jeder ungelöste Fall – ganz besonders ungelöste Mordfälle – am Ansehen der Polizei und an der Unterstützung durch die Bevölkerung kratzte. So etwas war gefährlich destabilisierend für die Gesellschaft.
Das alles brauchte sie jedoch nicht mit Bodil zu diskutieren. Der Ärger darüber, mitten im Urlaub von der Chefin angerufen worden zu sein, war verpufft, und Maria freute sich richtig, ins Museum zurückzukehren. Sie ließ sich sogar dazu hinreißen, Bodil ein wenig zu enthusiastisch »einen schönen, langen Urlaub« zu wünschen. Mit Betonung auf lang.
»Ich werde schon den zugehörigen Namen zu diesem Skelett finden«, versprach sie.
Bodil schnaubte.
»Das erwartet kein Mensch. Und Maria? Spiel um Gottes willen nicht wieder Detektivin«, erwiderte sie säuerlich und legte auf.
3
Sanft, mit einer Hand auf ihrem Bauch, versuchte er, seine Frau zu wecken. Er streichelte ihre Brustwarze. Küsste sie auf den Hals. Der Nippel wurde steif unter seiner Berührung, und er kroch näher zu ihr heran, doch sie schlummerte tief und fest. Viel zu fest.
Sein Blick fiel auf den Wecker auf dem Nachttisch. 05.45 Uhr. Was dachte er sich bloß? Es war früh, sie musste erschöpft sein, nachdem sie gestern spätabends nach Hause gekommen waren, und verdiente es weiterzuschlafen, während er – Gewohnheitstier, Frühaufsteher und Besitzer einer stetig schrumpfenden Blase – in die Alltagsroutine zurückfand.
Niels Carlsen, Leiter des Dezernats für Gewaltverbrechen, schlug die leichte Sommerdecke zur Seite. Vogelgezwitscher drang durch die offenen Fenster ins Schlafzimmer. Er stand auf, betrachtete seine schlafende Frau und zog ihr vorsichtig die Decke über die nackten Schultern. Anette hatte sich in den Jahren ihrer Ehe in vieles gefügt, wenn Carlsen zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten aufs Revier gerufen wurde und den Haushalt ihr überließ.
Natürlich hatte sie sich beklagt, wenn er mal wieder sämtliche Absprachen brach. Sie verstand es wie niemand sonst, ihm ein schlechtes Gewissen zu machen, ohne viel zu sagen. Verbissenes Schweigen, ein abgewandter Blick, zusammengepresste Lippen, das genügte schon.
Besonders ein inzwischen Jahre zurückliegendes Ereignis war Carlsen in Erinnerung geblieben. Für die Geburtstagsparty der Zwillinge hatten sie den Kindergarten eingeladen und erwarteten fünfzehn Knirpse, die an allem herumzuppelten und unerklärliche Wutanfälle bekamen, als er einen Anruf erhielt. Eine Klima-Demo war aus dem Ruder gelaufen, und sämtliche abrufbaren Leute sollten unverzüglich in die Uniform schlüpfen. Urlaub, freie Wochenenden, Überstunden – alles wurde ausgeschöpft. Es ging um die Sicherheit der Nation, hieß es. Mit dieser Erklärung hatte er auch Anette abgespeist, als er sie auf die Stirn küsste und mit einer unendlichen Serie von Toilettenbesuchen, Naschtüten und Schatzsuchen allein ließ. Es hatte seine Zeit gebraucht, aber Anette hatte ihm verziehen, die Mädchen hatten einen tollen Tag gehabt, und auch er hatte die Klima-Demo weitestgehend heil überstanden und nur ein bisschen Tränengas und einen herumfliegenden Pappkarton abbekommen.
Er lehnte die Stirn gegen das Schränkchen über der Toilette, ließ locker und entleerte in einem langen, erleichternden Strahl die Blase. Es war Montag und der erste Arbeitstag nach drei Wochen in ihrer Ferienwohnung in Spanien, wo sie Padel-Tennis gespielt, gut gegessen, Rioja getrunken und Besuch von Freunden und den Töchtern bekommen hatten. Er blickte an sich hinab. Die Sonne hatte großzügig geschienen, und seine skandinavische Haut hatte einen bronzebraunen Ton angenommen. Jetzt verlangten seine Muskeln nach Bewegung, und sein Hirn sehnte sich nach der gewohnten Routine, daher holte er seine Laufsachen hervor. Schwarze Shorts, ein rotes T-Shirt und wie immer leuchtend bunte Strümpfe aus der Schublade. Montags, mittwochs und freitags begann er den Tag mit einer zehn Kilometer langen Laufstrecke von ihrem Haus in Vanløse zum Damhussøen und um die Wiese herum.
Während er mit den Kontaktlinsen herumfummelte, musterte er sich im Spiegel. Kurz vor der Heimreise war er bei einem spanischen Barbier gewesen, und das sorgfältig gestutzte weiße Haar stand ihm gut zu dem sommerlichen Teint. Die bunte Brille, mit der ihn jeder beim Polizeikorps erkannte, ließ er im Flur liegen, sein Faible für Farben schlug sich jedoch in den Schuhen nieder. Es war das dritte Paar Laufschuhe dieses Jahr, diesmal grüne mit blauer Sohle und roten Schnürsenkeln. Schön waren sie nicht, aber … knallig? Man brauchte ja nicht auszusehen wie eine Excel-Tabelle, wenn man schon auf der Arbeit darauf reduziert wurde.
Die ersten zweihundert Meter waren immer die härtesten. Seine achtundfünfzig Lebensjahre waren nicht spurlos an seinem Körper vorbeigegangen, dennoch war er alles in allem recht zufrieden mit sich. Er war schlank und gut in Form, und das Laufen war seine Form der Alltagsflucht. Hier war er allein, konnte seine Gedanken bezüglich Arbeit oder Privatleben sammeln oder einfach abschalten.
Er schwang die Arme vor und zurück, gewann an Tempo und fand bald in den richtigen Atemrhythmus, während er auf den asphaltierten Straßen durchs Wohnviertel lief. An Häusern vorbei, die seinem eigenen zum Verwechseln ähnelten. Bewohnt von Rentnern, die noch hinter heruntergelassenen Rollos schliefen, oder von Familien mit kleinen Kindern, die mit verstrubbelten Haaren vor ihrem Müsli saßen, während die Eltern über ihrem Kaffee gähnten.
Wider Carlsens Willen wanderten seine Gedanken zurück zu einem Fall, der bald sein einjähriges Jubiläum hatte. Es war einer der Fälle, die ihn nicht losließen. Ein Familienmord, den man hätte vorhersehen können, wären die Kommune, die Kita, die Schule, vielleicht sogar die Nachbarn aufmerksam genug gewesen, um die kleinen, aber unverkennbaren Anzeichen von Missbrauch bei den Kindernzu erkennen.
Aber alle hatten weggeschaut. Weder die wiederholten Veilchen der Frau noch die bizarren Spielunfälle der Kinder waren den Behörden gemeldet worden, und eines Dienstags nach den Sommerferien war das Dezernat für Gewaltverbrechen zu einem roten, zweistöckigen Haus auf Amager gerufen worden.
Es gab drei Tote. Zwei Kinder waren aus kurzer Distanz im Schlaf erschossen worden. Ein erwachsener Mann hatte sich selbst in den Kopf geschossen. Die Toten waren von der Eigentümerin des Hauses gefunden worden, als diese von der Arbeit nach Hause kam. Der Mutter der Kinder. Die ihrem Mann in den Sommerferien mitgeteilt hatte, dass sie die Scheidung wünschte.
Ob solch eine Frau jemals wieder ein Mensch wurde?
Carlsen fiel es schwer, die Szenerie im Haus aus seinem Gedächtnis zu verbannen, sie hatte sich ihm für immer eingebrannt. Vielleicht wurde er langsam zu alt für derlei Fälle. Vielleicht hatte er zu viel gesehen, um die richtige Mischung aus Hoffnung, Entschlossenheit und Autorität auszustrahlen. Er hatte keine Worte für die Mutter gehabt, die in einem Streifenwagen gesessen und ihn mit erloschenen Augen angesehen hatte.
»Wecken Sie sie auf«, hatte sie gesagt.
Das war das Letzte, was in seiner Macht stand.
Es war alles so verdammt sinnlos.
Carlsen beschleunigte das Tempo, als könnte er vor dem Haus auf Amager und den Erinnerungen an damals davonlaufen. Nach der Geschichte hatte es Kritik gegen die Behörden gehagelt, und auch die Polizei war nicht verschont geblieben. Wie sich herausstellte, hatte die Mutter nämlich zwei Wochen vor den Morden die Polizei kontaktiert. Es war bloß nie eine Streife vorbeigekommen. Warum? Tja, gute Frage.
Die Kommune Kopenhagen setzte eine Untersuchungskommission ein, Christiansborg verlangte einen Bericht, und auch die Polizei selbst untersuchte den Fall. Die Ergebnisse aller drei Instanzen hätte Carlsen auch so liefern können: Diese Art Mord ließ sich verhindern. Es war bloß »eine Frage der Ressourcen«.
Diese elenden Ressourcen! Bei der Polizei hieß es bald hü, bald hott, je nachdem, mit welchem Bein die amtierende Regierung am Morgen aufgestanden war. Sein Magen krampfte sich zusammen, wenn er daran dachte, wie sich die Politiker in praktisch sämtliche interne Arbeitsabläufe der Polizei einmischten, und als ein Journalist ihn im Juni nach seiner Haltung zur Ressourcensituation der Polizei gefragt hatte, war das Fass übergelaufen. Er hatte eine gereizte Antwort geblafft, etwas in der Art wie: »Man kann wohl kaum eine erstklassige Ermittlung erwarten, wenn man über das Budget eines Entwicklungslandes verfügt.«
Dieses Zitat war durch ganz Dänemark gegangen. Verdammt, um die ganze Welt! So jedenfalls kam es ihm vor. Und wie erwartet waren die Politiker – und seine Vorgesetzte – explodiert.
»Sie sind immer noch nur Dezernatsleiter. Wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht und halten Sie gefälligst mit jeglicher politischer Meinung in der Öffentlichkeit hinterm Berg«, schnauzte die Kopenhagener Polizeipräsidentin Lone Kirtzner ihn an.
Dort, im mahagonigetäfelten Büro seiner Chefin, das mit kleinen Geheimverstecken und großen Porträts ihrer Vorgänger ausgestattet war, hatte er große Lust gehabt, alles hinzuschmeißen. Sein Kindheitstraum, Polizist zu werden und für Gerechtigkeit zu kämpfen, erschien ihm naiv und mausetot, und er hätte standhaft bleiben sollen. Für seine Leute einstehen. Mit gutem Beispiel vorangehen.
Aber er hatte getan, was er immer tat. Er hatte im Geiste bis zehn gezählt und aus dem Fenster hinunter auf den Kopenhagener Verkehr geblickt. Und dann hatte er die sprichwörtliche Scheiße geschluckt und sich mit einem devoten »Es wird nicht wieder vorkommen« entschuldigt.
Ein verdammter Feigling war er. Mehrere gute Leute aus dem Team hatten in letzter Zeit Mumm gezeigt und ganz einfach gekündigt. Sie waren die coronabedingten Überstunden leid, die Demonstrationen, den Ressourcenmangel, die schlechte Ausrüstung, den Spott und den Hohn der Bevölkerung, die Beleidigungen auf den sozialen Medien und all die Extraaufgaben, die nichts mit Polizeiarbeit zu tun hatten.
Während des Urlaubs hatte er begonnen, mit Anette über ihre weitere Zukunft zu sprechen.
Sollten sie gemeinsam in Frührente gehen? Vielleicht könnte er sich eine andere Arbeit suchen. Sie könnten in eine kleinere Stadt ziehen und vom Verkaufserlös des Hauses leben, vielleicht sogar ihren Wohnsitz permanent nach Spanien verlegen.
Carlsen war Polizist aus Leidenschaft, aber es hatte sich einiges verändert, seit er vor fast zwölf Jahren als Ermittler im Bereich Wirtschaftskriminalität aufgehört und die Stellung als Chef des Dezernats für Gewaltverbrechen in der Hauptstadt übernommen hatte.
Alle betrachteten den Jobwechsel als Beförderung, in Carlsens Augen war er das aber nicht. Die Arbeit war die gleiche, dafür waren die Fälle nervenaufreibender, und ständig schauten einem die Politiker über die Schulter.
Carlsen hatte immer gut mit der Einmischung von oben umgehen können. Er war geduldig, vertrauenerweckend und meist diplomatisch. Aber mit der Zeit war er es so leid geworden, dass immer jemand etwas von ihm wollte, und er entweder im Büro seiner Chefin oder falsch zitiert in der Presse landete.
Er drosselte das Tempo vor einer Umlaufsperre für Fußgänger und Radfahrer auf seiner ganz individuell für ihn zusammengesetzten Strecke. Er mochte es, auf verschiedenen Arten von Untergrund zu laufen – Asphalt, Schotter, Kies, Erde –, was diese Route alles abdeckte, die er immer in derselben Richtung lief. Manche fanden diese Eintönigkeit langweilig, Carlsen jedoch nicht. In just dieser Nische seines Lebens genoss er die Vorhersehbarkeit.
Vielleicht sollte er sich einen Job als Sicherheitsberater im privaten Sektor suchen? Oder in eine Altersteilzeitstelle in einer anderen Polizeidirektion wechseln? Auf diese Weise stünde er weniger im Rampenlicht. Er war all die Großmäuler leid, die eine Meinung zu allem hatten, was die Polizei tat, hatte genug von Fake News und Hassgruppen, in denen die ungeheuerlichsten Behauptungen über die Ordnungsmacht, Verschwörungstheorien und Irrtümer in großem Stil geteilt wurden.
Die hämischen Hassnachrichten auf Facebook hatten Carlsen bisher nie sonderlich beunruhigt, doch in letzter Zeit wurden sie feindseliger. Das Vertrauen der Bevölkerung in ihn und seine Leute war dahin. Gestern hatte er seinen nach dem Urlaub überquellenden Posteingang gecheckt und zwischen Hunderten arbeitsbezogener Mails eine direkte Drohung gefunden.
Du hast mein Leben zerstört, jetzt zerstöre ich deins, stand in der Betreffzeile. Die Mail selbst war leer und der Absender anonym. Carlsen fiel niemand ein, dessen Leben er zerstört hatte. Abgesehen natürlich von den Verbrechern, die jetzt hinter Schloss und Riegel saßen. Irgendetwas sagte ihm aber, dass er diese Drohung untersuchen lassen und jemanden bitten sollte, die Nachricht zurückzuverfolgen, sofern es in der Abteilung freies Personal dafür gab. Es war ihm schon unangenehm, seinen Kollegen damit zur Last zu fallen, aber die E-Mail war nicht das Einzige, was ihm Unbehagen bereitete. In der Woche vor seinem Urlaub hatte er das Gefühl gehabt, beobachtet zu werden. Mehrmals hatte dasselbe Auto vor dem neuen Gebäude der Polizei auf Teglholmen geparkt und war weggefahren, sobald er es verließ.
Carlsen schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu vertreiben. Bestimmt sah er nur Gespenster.
Eine Joggerin mit einem hellbraunen Hund mit lockigem Fell an der Leine kam ihm auf dem Bürgersteig entgegen. Sie schien auf dem Rückweg vom Damhussøen zu sein. Kaum zu glauben, dass jemand noch früher aufgestanden war als er.
Er nickte ihr freundlich zu, da hörte er das Aufheulen eines Motors gefolgt von quietschenden Reifen, die auf dem kalten Asphalt durchdrehten.
Carlsen blickte über die linke Schulter und sah ein Auto direkt auf sich zurasen. So schnell, dass ihm keine Zeit bleiben würde, sich mit einem Sprung zur Seite zu retten. So viel registrierte sein Hirn. Kühl und nüchtern. Er stand einfach da, paralysiert für Sekundenbruchteile, die unwirklich langsam verstrichen, während er auf das Auto starrte. Und auf die Person hinter dem Steuer.
War das nicht …?
Seine Gedanken wurden von einer kalten, kristallklaren Feststellung abgeschnitten:
Jetzt stirbst du, dachte er, und das Bild von Anette erschien vor seinem geistigen Auge.
So schön. Wie unglücklich sie jetzt sein würde. Wie viel sie noch vorgehabt hatten.
Er spürte nichts, als sein Körper wie ein Sack zerbrochener Knochen über dem Kühlergrill des Wagens zusammengefaltet wurde. Blutgeschmack explodierte in seiner Kehle, aber er fühlte keinen Schmerz. Über die Motorhaube hinweg sah er zwei ums Lenkrad geklammerte Hände. Wild aufgerissene Augen, ein hasserfüllter Blick, in dem die zerstörerische Entschlossenheit des Wahnsinns glühte.
Das Fahrzeug bremste. Sein zerschmetterter Körper führte die Vorwärtsbewegung fort und wurde zu Boden geschleudert. Ein einsamer, dreifarbiger Laufschuh, gefangen in seinem letzten Schritt, blieb auf dem Asphalt zurück, als das Auto zurücksetzte und verschwand.
Dann wurde alles schwarz.
4
Während ihres Urlaubs war ein Paket für Maria gekommen, und nun starrte sie gespannt auf den Inhalt: eine schwere Apparatur mit zwei entgegengerichteten Mikrofonen, zwei Lautstärkereglern und einem Display mit unverständlichen Informationen.
Die neue Rezeptionistin des Polizeimuseums, eine in Teilzeit eingestellte Frau in den Fünfzigern, hatte das Paket in Marias Abwesenheit in deren Büro hinterlegt, ansonsten schien die Tür im zweiten Stock wochenlang hermetisch verschlossen gewesen zu sein. Der staubige Mief alter Ordner und Nachschlagewerke schlug ihr entgegen. Sie riss das Fenster zur Feuerwache hinter dem Museum auf und merkte, dass sie Pelle vermisste, den schüchternen Geschichtsstudenten, der bisher am Eingang des Museums gesessen hatte. Pelle war sieben oder acht Jahre jünger als Maria und so hoffnungslos verschossen in sie, dass er in ihrer Nähe kaum ein Wort herausbrachte.
Sie hatte sich oft gefragt, weshalb Pelle mehr als drei Jahre bei dem lausig bezahlten Studentenjob geblieben war. Bodil, die gleich einem Sperber eine perfide Freude daran verspürte, über ihrem Territorium zu kreisen und sich gnadenlos auf die schwächste Beute zu stürzen, hatte den studentischen Mitarbeiter hinter dessen Rücken schamlos Pummel-Pelle genannt. Mehr als einmal hatte Maria erwogen, ein anonymes Wörtchen an die Personalabteilung der Landespolizei zu schicken, dass im Polizeimuseum gemobbt wurde, doch dann waren ihr Zweifel gekommen. Vermutlich wurden Spitznamen wie dieser unter Polizisten noch immer als Späßchen unter Kollegen angesehen. Mikael Dirk meinte, dass im Dezernat jeder zur Jagd freigegeben war, der sich in puncto Gewicht, Frisur, Essgewohnheiten oder Dialekt von den Kollegen unterschied – natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze. Der derbe Umgangston diente, so Mikael, in den meisten Fällen als eine Art Ventil für die unschönen Dinge, die die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit erlebten. Wo Scheiße hereinkam, musste sie auch wieder heraus, wie er es ausdrückte.
Offen gestanden war sie selbst phasenweise von Pelle genervt gewesen. Er besaß die Angewohnheit, durch die Gänge des Museums zu schleichen und hatte ihr nicht selten einen ordentlichen Schreck eingejagt, wenn er plötzlich wie aus dem Nichts hinter ihr aufgetaucht war. Aber als sie jetzt an ihn dachte, spürte sie Gewissensbisse. Warum hatte sie sich nicht für ihn eingesetzt? Warum hatte sie nicht Courage gezeigt und Bodil gesagt, dass sie es inakzeptabel fand, derart herablassend über einen Kollegen zu sprechen?
Pelle tat keiner Fliege etwas zuleide. Ganz im Gegenteil war der junge Kerl zu einem unersetzbaren Rädchen im Getriebe des Museums geworden. Er lüftete die Büros und goss die Blumen, wenn jemand im Urlaub war, räumte abgelaufene Lebensmittel aus dem Kühlschrank des Frühstücksraums, reparierte den Drucker und ölte die alten Scharniere der Eingangstür, bevor sie ihren Klagesang anstimmten. Als das Museum nach dem ersten Coronalockdown wieder öffnete, stellte Pelle frische Blumen in sämtliche Büros. Auch in das von Bodil.
Im April hatte Pelle dann auf seine ruhige Art mitgeteilt, dass er nun seine Masterarbeit in Geschichte eingereicht und eine Festanstellung als Archivar beim polizeilichen Nachrichtendienst PET bekommen habe. Bodil und Maria hatten nicht schlecht gestaunt. Der Geheimdienst hatte in den letzten Jahren mehrfach hart in der Kritik gestanden, weil er Informationen über dänische Bürger und politische Organisationen makuliert hatte, die in der Vergangenheit mehr oder weniger legal gesammelt worden waren. Politiker wie auch Historiker bezeichneten es als Sabotage und Geschichtsverfälschung, wenn eine polizeiliche Behörde in dieser Weise eigenmächtig Geschichtsschreibung betrieb. Daher stellte der PET nun also sicherheitsüberprüfte Historiker ein, die wussten, wie man Archivmaterial bestmöglich aufbewahrte, und gleichzeitig zu Stillschweigen verpflichtet waren.
Pelle, der in Gegenwart Fremder kaum ein Wort herausbrachte, war in dieser Hinsicht der perfekte Mitarbeiter. Ein James Bond war er aber weiß Gott nicht. Sie wollte ihm bei Gelegenheit schreiben und fragen, wie es in der Abteilung für falsche Bärte und verspiegelte Brillen so lief.
Seine Fähigkeiten könnte sie jetzt gut gebrauchen.
Maria drehte und wendete ihr neues technisches Equipment in den Händen. Es handelte sich um einen Zoom H5 Audio-Recorder, den sie nach monatelanger Diskussion mit Bodil hatte bestellen dürfen. Maria hatte die vage Idee, dass das Museum bei der gegenwärtigen Podcast-Welle mitziehen sollte. Aktuell überschwemmten alle möglichen Amateure den Markt. Da wäre es doch eindeutig besser, wenn das Polizeimuseum mit fundiertem Wissen zur gesellschaftlichen Bedeutung von Ermittlungstechniken und ausgewählten Mordfällen einen Beitrag leistete.
Das alte Skelett aus Nørre Felding wäre da ein guter Startpunkt. Überschaubar. Nur musste sie dafür natürlich herausfinden, wie das Gerät funktionierte.
Sie drückte wahllos auf den Knöpfen herum. In einer Dreiviertelstunde sollte sie bei der Gerichtsanthropologin sein, und sie fluchte, weil sie nicht besser vorbereitet war.
Sie war am Samstagvormittag von Thorup Strand zurückgefahren, einen Tag früher als geplant. Jakob hätte sie gerne noch bis Sonntag dabehalten, aber sie hatte auf ihrem Entschluss bestanden. Bis Kopenhagen waren es fünf Stunden Fahrt, und vor Arbeitsantritt wollte sie noch einkaufen und auspacken und sich erst wieder an die Stille gewöhnen. Ans Alleinsein.
Jakob verstand das zwar, doch die Pandemie hatte sie zwischendurch vergessen lassen, dass sie eine Fernbeziehung mit allen damit verbundenen Herausforderungen führten. Maria war für mehrere Monate ins Homeoffice geschickt worden und hatte einen Großteil dieser Zeit bei Jakob in Vester Torup verbracht. Die ruhigen Monate ohne Chefin und Deadlines hatten ihr Gelegenheit gegeben, sich von den Ereignissen im vergangenen Jahr zu erholen, und Jakob hatte sie in die Art Liebe gehüllt, die nur ein Mann, den sie schon ihr Leben lang kannte, zu geben vermochte. Sie fühlte sich zu Hause und geborgen. So einfach war das. Und ihre noch frische Beziehung hatte auf einmal die Chance erhalten, die sie zwölf Jahre zuvor nicht gehabt hatte.
Doch nun holte sie der Alltag in seine gewohnten Bahnen zurück. Und während Maria stets damit gerechnet hatte, kam es für Jakob offenbar völlig überraschend, dass sie nun nach Hause fuhr, um ihr Leben in Kopenhagen wiederaufzunehmen.
Sie fühlte sich elend, als sie das Navi auf die Viborggade in Østerbro einstellte und aus Jakobs Einfahrt fuhr. Die ersten hundertfünfzig Kilometer sah sie ihn unablässig vor sich: hochgewachsen und mit ebenso scharf geschnittenen Zügen wie die eisernen Skulpturen, an denen er in seiner Werkstatt arbeitete. Schwarzes Haar, von attraktiven silbernen Fäden durchzogen. Baggy Jeans, aus deren Gesäßtasche stets ein ölverschmierter Lappen hing. Mandelförmige, sanfte Augen, die ihr hinter einer zum Abschied erhobenen Hand nachschauten.
Maria seufzte und steckte den neuen Rekorder sowie das zugehörige Ansteckmikro in ihre Handtasche, in der schon Notizblock, Kugelschreiber und Handy lagen. Sie blickte in den kleinen Spiegel, den sie hinter ihrer Bürotür aufgehängt hatte. Ihre vom Salzwasser krausen Locken wallten als rotgoldene Mähne um Gesicht und Schultern. Sie band die Haare zu einem dicken Dutt nach hinten und schmierte sich etwas Lippencreme auf Wangen und Lippen, ehe sie sich auf den Weg zum Rigshospital machte.
Sie wusste, dass Jakob nicht allein sie vermisste, wenn sie nach Osten fuhr. Er vermisste ganz allgemein Gesellschaft, er vermisste Antworten, und er vermisste eine Zukunft. Jakob war im Frühling siebenunddreißig geworden, und er wünschte sich Kinder. Das hatte er ihr gegenüber nicht laut geäußert, aber sie kannte ihn. Und sie verstand es. Nach dem Tod seiner Mutter war er de facto vollkommen allein. Keine Geschwister, keine Eltern, keine nahen Verwandten. Sie hatte gesehen, wie liebevoll und sicher er mit Mads’ Kindern umging, und es wäre wider die Natur, wenn etwas so verflucht Wertvolles wie Jakobs Gene nicht weitergegeben würden.
Sie musste eben nur noch ihren Platz in dieser Geschichte finden.
5
Gerichtsanthropologin Margrethe Sandager hatte am Telefon nach einer älteren Frau geklungen, jedenfalls hatte ihre tiefe, raue Stimme in Marias Ohren etwas Großmütterliches gehabt. Sie hatte Maria für Montag 10 Uhr bestellt, und die schroffe, kurz gefasste Aufforderung hatte Maria überzeugt, dass sie besser pünktlich kam.
Als sie die wenigen hundert Meter hinüber zum Rechtsmedizinischen Institut ging, sah Maria auf die Uhr. 9.50 Uhr. Die Glastüren glitten auf, und sie schüttelte unbewusst den Kopf, um Jakob aus ihren Gedanken zu vertreiben, ehe sie an der Kapelle vorbeiging, wo Angehörige sich vor oder nach einer Obduktion von ihren Lieben verabschieden konnten. Der Anblick ihres Vaters, tot und kreidebleich in der Kapelle in Jütland, tauchte vor ihrem geistigen Auge auf. Dazu gesellte sich die noch schlimmere Erinnerung an ihre verzweifelte Mutter neben ihr, leer geweint und zerbrochen hinter einem verschleierten Blick, der sich in den folgenden Jahren dauerhaft festsetzen sollte.
Diese Kapelle markierte nicht bloß den Abschluss eines Lebens, sie veränderte das Leben aller Beteiligten.
Der Aufzug führte Maria in den Büroflur der Rechtsmediziner und Rechtsanthropologen im ersten Stock. Sie passierte die Sicherheitsschleuse und wandte sich wie angewiesen nach rechts, um zu Margrethe Sandagers Büro zu gelangen. Sie kam an Vitrinen mit Teilen des menschlichen Skeletts vorbei sowie an Wagen voller Aktenordner und vergessener Kaffeebecher, bevor sie die dritte Tür auf der linken Seite erreichte und anklopfte.
»Wer da?«, klang es barsch durch die Tür.
Maria checkte nochmals das Namensschild. Sie war richtig.
»Maria Just vom Polizeimuseum. Ich habe einen Termin bei Margrethe Sandager«, sagte sie laut zu der geschlossenen Tür, die sich Sekunden darauf einen Spalt breit öffnete. Eine untersetzte Frau mit grauer Dauerwelle und John-Lennon-Brille lugte durch den schmalen Schlitz. Sie musterte Maria von Kopf bis Fuß.
»Jung«, stellte sie nach einigen qualvollen Sekunden fest.
»Jung?«
»Sie sind jung. Sind Sie auch der politisch-korrekte Typ? Woke, meine ich?«
Maria sah die Frau verständnislos an.
»Woke …?«
»Gut!«
Sandager riss die Tür auf, packte Maria am Oberarm und zog sie ins Büro, dann spähte sie den Flur hinauf und hinunter, bevor sie mit einem zufriedenen Grunzen die Tür zuschlug. Die zwei kleinen Schiebefenster in Sandagers Büro waren geöffnet, aber die frische Luft von draußen vermochte den unverkennbaren Geruch süßlichen Rauchs im Zimmer nicht zu kaschieren.
»Hach, ich liebe es, sturmfreie Bude zu haben.«
Margrethe Sandager stand mit einem spitzbübischen Lächeln hinter Maria. Auf den ersten Eindruck schätzte Maria die Frau auf Mitte sechzig. Ihre Dauerwelle wirkte wie ein Anachronismus, als wäre die Zeit auf ihrem Kopf stehen geblieben, dasselbe galt für den unförmigen Wickelrock und das grüne Häkeltop. In Sandagers Augen aber funkelte eine jugendliche Energie.
»Möchten Sie auch eine?«
Marias Blick folgte Sandagers Zeigefinger und sah in einem Aschenbecher auf der Fensterbank eine halbe Cheroot-Zigarre qualmen. Ein 2021 wahrlich nicht alltäglicher Anblick.
»Nein danke«, lächelte sie.
»Stört es die junge Dame, wenn ich rauche? In diesem Gebäude darf man heutzutage nichts mehr. Weder rauchen noch trinken noch vom Buffet essen, aber ich habe den hohen Herren mitgeteilt, dass in meinem Büro meine Regeln gelten. Jeder von uns muss die Diktatur mit seinen jeweiligen Waffen bekämpfen!«
Sandager wartete Marias Antwort nicht ab, schnappte sich den Zigarrenstummel, ließ sich auf ihren Bürostuhl fallen und schwang mit beeindruckender Behändigkeit die kurzen Beine und ein paar ausgelatschte Klettverschlusssandalen auf den Schreibtisch.
»Ich weiß, dass die Dinger eines Tages mein Tod sein werden«, sagte sie und wedelte mit der Zigarre herum. »Ein bisschen was habe ich nach dreißig Jahren im Dienste der Rechtsmedizin über Todesursachen gelernt. Ha! Aber es ist mein Körper und meine Entscheidung, oder etwa nicht? Wir können den Leuten nicht jegliche Eigenverantwortung nehmen. Diese ständige staatliche Bevormundung macht uns zu hirnlosen Lemmingen. Tu dies nicht, tu das nicht, du lieber Himmel.« Sandager blies den Rauch der Cheroot aus, die munter unter ihrer Nase glühte. »Wir als Gesellschaft hätten es besser und unbeschwerter, wenn die Leute eigenständig denken, eigenständig eine Moral entwickeln und eigenständig Verantwortung übernehmen würden, finden Sie nicht? Auch wenn es mal nicht genau dem Zeitgeist entspricht oder dem, was der Nachbar denkt. Die meisten glauben, wir befänden uns auf dem Höhepunkt der Zivilisation, aber ich kann Ihnen versichern, in meinem Job sieht man zahlreiche Beweise dafür, dass das Reptilhirn im Jahr 2021 noch ebenso prächtig gedeiht wie 1621.«
Maria nickte, ohne genau zuzuhören, völlig abgelenkt von Sandagers Aschenbecher in Form eines Kristallschädels, dem man sozusagen direkt ins Hirn aschte. Aber das war mitnichten der einzig auffällige Gegenstand im Büro der Gerichtsanthropologin. In einer Ecke, im Fach eines alten Regals aus dunkel gebeiztem Holz, sah sie einen Hammer und daneben einen Fotorahmen mit dem Bild einer zerbrochenen Kokosnuss. Die Kokosnuss hatte ihr Leben vermutlich durch einen soliden Hammerschlag verloren – eine lehrreiche Übung für eine Gerichtsanthropologin, die herausfinden wollte, wie Verletzungen an einem Schädel entstehen können. Ein großer Knüppel lehnte an der Wand. Maria vermutete, dass es sich dabei um eine Tatwaffe handelte, die in Verbindung mit einer Ermittlung in Sandagers Obhut gelangt war. Historische Asservate gehörten eigentlich ins Polizeimuseum, dachte Maria, aber dies war weder der richtige Ort noch der passende Zeitpunkt, um darauf aufmerksam zu machen.
»Setzen Sie sich!«, bellte Sandager und zeigte auf einen Stuhl ihr gegenüber.
Maria wagte keinen Widerspruch.
»So! Das jütische Skelett, richtig?« Sandager schwang die Beine vom Tisch und blies eine Rauchwolke aus dem Fenster. »Alles die Schuld der Regierung, so viel kann ich sagen. Ha! Nein, nein, aber … ohne diesen Nerzzirkus, den die Behörden drüben auf Jütland veranstaltet haben, wäre das Skelett nie gefunden und hierhergeschickt worden.«
Maria nickte. Sie hatte ihr Aufnahmegerät aus der Tasche gezogen und hielt es fragend hoch, als wortlose Bitte, das Gespräch aufnehmen zu dürfen. Sandager zuckte gleichgültig mit den Achseln.
»Unsere Verstorbene in diesem Fall«, sagte Sandager und klopfte mit der Cheroot-Hand auf einen Aktenordner, sodass Ascheflocken auf den Schreibtisch rieselten, »wurde in einem Naturschutzgebiet bei Nørre Felding gefunden, am Ufer eines Sees. Seit den Sechzigern ist die Gegend dort oben militärisches Sperrgebiet, daher konnte die Regierung – das heißt, genauer gesagt waren es wohl die Lebensmittelbehörden – die getöteten Nerze einfach dort verscharren, ohne irgendwen um Erlaubnis zu fragen. Millionen von Tiere! Das haben sie bereut, als die Nerze sechs Monate später wieder ausgegraben werden mussten. Heiliger Bimbam, was für eine Schweinerei. Ich hätte ihnen gleich sagen können, dass die Verwesung nach einem halben Jahr noch voll im Gange ist, wenn man tote Tiere in fünf, sechs Schichten übereinander deponiert. Die Kadaver sollen ausgesehen haben wie eine Mischung aus Fetakäse und Schmierseife.«
»Sie sagen ›sie‹. Es handelt sich also mit Sicherheit um eine Frau?«, fragte Maria.
»Ja, es ist eine Frau, das Skelett ist vollständig und gut erhalten, das Geschlecht lässt sich anhand des Beckens und des Schädels also problemlos feststellen. Jung war sie außerdem.«
»Und was genau meinen Sie mit ›jung‹?«
»Ganz exakt lässt sich das nie sagen, aber mit Blick auf ihre Hüftknochen schätze ich sie erheblich jünger als mich, vermutlich sogar jünger als Sie. Um die zwanzig, würde ich meinen. Plus-minus fünf bis zehn Jahre. Ich habe ihren Schädel untersucht. Anhand der Deutlichkeit ihrer Knochennähte würde ich sagen, dass sie zum Todeszeitpunkt zwischen fünfzehn und fünfundzwanzig Jahre alt war. Verglichen mit den feinen Linien in den Faserknorpeln ihres Hüftbeins lande ich bei etwa zwanzig Jahren. Die Zähne sind ebenfalls jung, kaum kariöse Veränderung, sehr geringe Abrasion und wenig Zahnstein. Das erhärtet die Vermutung, dass wir es mit einer jungen Dame zu tun haben.«
Sandager betrachtete ihren Zigarrenstummel, der längst so weit abgebrannt war, dass man ihn kaum mehr zwischen die Lippen stecken konnte, ohne sich zu verbrennen. Mit einer hitzigen Handbewegung drückte sie die Cheroot im Glasschädel aus, dann sprang sie auf wie von der Tarantel gestochen, klemmte sich den Ordner unter den Arm und öffnete die Tür zum Flur.
»Kommen Sie! Sie müssen die Dame kennenlernen.«
6
Maria versuchte, mit Margrethe Sandager Schritt zu halten. Die ältere Frau führte sie zügig durch eine Reihe von Fluren zum Labor im Erdgeschoss. Dort angekommen blieb Maria abrupt stehen. Auf einem riesigen Holztisch lag ein korrekt angeordnetes Skelett. Der Schädel zuoberst, die Füße am Tischende. Ein grauschwarzes Gerippe.
»So, hier haben wir unsere Protagonistin. Ich hoffe, Sie ertragen den Anblick?« Sandager blickte Maria mütterlich an und gab sich mit deren schwachem Nicken zufrieden. »Anhand der Maße von Oberschenkel- und Oberarmknochen habe ich ihre Körpergröße auf etwa eins fünfundsechzig bis eins siebenundsechzig bestimmt. Die Größe sowie die intakten Zähne lassen darauf schließen, dass sie aus guten Verhältnissen stammte. Nicht unbedingt aus einer reichen Familie, aber aus dem gehobenen Bürgertum.« Sandager schritt zum Schädelende des Holztisches: »Jetzt fragen Sie sich bestimmt: Wie endet eine junge Frau aus wohlhabender Familie in einem provisorischen Grab weit weg von jedem Friedhof? Tja, diese Frau hier ist ziemlich eindeutig weder durch eine Krankheit noch durch einen Unfall gestorben. Es sieht ganz schlicht und ergreifend so aus, als wäre sie hingerichtet worden.«
Sandager musterte Maria prüfend, als wolle sie sichergehen, dass das Gesagte auch wirklich angekommen war.
»Hingerichtet?«
»Ja«, bestätigte Sandager und zeigte auf einen Computermonitor mit blauschwarzen CT-Scans des Schädels. »Im Genick sowie an der entsprechenden Stelle der Stirn findet sich je ein Loch.« Sandager demonstrierte mit einem Kugelschreiber den Weg des Projektils durch den Schädel – durchs Genick hinein und hinaus durch die Stirn, wo die Kugel lediglich ein konisches Loch hinterlassen hatte. »Mit anderen Worten: Sie wurde durch einen einfachen Genickschuss getötet. Das kann man sich nicht selbst zufügen.«
Maria wagte sich näher heran. Der Schädel sah porös aus.
»Lässt sich etwas mehr über die Tatwaffe sagen?«
»Ich kann sagen, dass es sich um eine großkalibrige Waffe handelt, genauer 9 mm. Der Tod trat augenblicklich ein.«
»Woher wissen Sie das so genau? Also, welches Kaliber es war?«
»Oh, meine Hand würde ich nicht dafür ins Feuer legen. Aber passen Sie auf«, sagte Sandager und zog ein Plastik-Zip-Tütchen aus ihrer Aktenmappe. Sie hielt es so ans Licht, dass Maria ein kleines goldenes, torpedoförmiges Objekt sehen konnte. »Die Kriminaltechniker in Jütland waren so freundlich, ein paar Runden mit dem Metalldetektor um den Fundort zu drehen. Und sie haben tatsächlich drei Projektile gefunden.«
»Drei?«





























