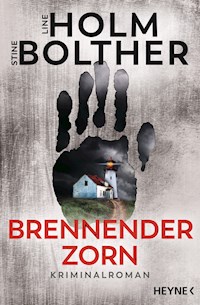10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Maria-Just-Reihe
- Sprache: Deutsch
Auftakt der SPIEGEL-Bestseller-Reihe mit Polizeihistorikern Maria Just aus Kopenhagen
Wenn die Verbrechen der Vergangenheit ihre Schatten in die Gegenwart werfen, ist Cold-Case-Expertin Maria Just gefragt
Polizeihistorikerin Maria Just bereitet gerade eine Ausstellung zum Thema »100 Jahre ungelöste Mordfälle« im Polizeimuseum von Kopenhagen vor. Da wird mitten in der Stadt der Generalsekretär des Roten Kreuzes auf bestialische Art ermordet. Der Tote hängt gekreuzigt an einem Geländer, auf seinem Körper wurde ein rätselhaftes Zeichen eingeritzt. Die Polizei ermittelt unter hohem Druck von Presse und Politik. Doch es ist Maria, die schließlich eine Verbindung zu einem ungeklärten Doppelmord entdeckt, der über fünfzig Jahre zurückliegt. Ein dunkles Kapitel dänischer Geschichte dringt ans Licht. So dunkel, dass jemand auch nach Jahrzehnten noch Vergeltung sucht. Kann Maria den Rachefeldzug stoppen, bevor es zu spät ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
An einem kalten Januarmorgen macht eine Spaziergängerin in Kopenhagen einen grausamen Fund: Vor der Zentrale des Roten Kreuzes hängt die blutige Leiche eines Mannes. Für Ermittler Mikael Dirk und seinen neuen Kollegen Frederik Dahlin kein leichter Fall, denn es handelt sich um Georg Schmidt, den einflussreichen Generalsekretär des Roten Kreuzes. Die Historikerin und Cold-Case-Expertin Maria Just hat derweil endlich den ungelösten Mordfall gefunden, der die Besucher in ihre geplante Ausstellung im Polizeimuseum locken soll. 1968 wurden in einem Vorort von Kopenhagen der damalige Polizeipräsident und seine Frau auf brutale Weise getötet. Der Mörder wurde nie gefunden. Als Dirk und Dahlin schließlich ein Detail aus dem Fall des ermordeten Georg Schmidt veröffentlichen, wird Maria klar, dass sie die Handschrift dieses Täters nur zu gut kennt. Ihr Cold Case scheint plötzlich aktueller denn je.
Die Autorinnen
Line Holm wurde 1975 geboren und ist eine mehrfach ausgezeichnete Investigativjournalistin. Sie arbeitet für die Berlingske, eine der größten dänischen Zeitungen. Stine Bolther wurde 1976 geboren. Sie ist Fernsehmoderatorin, seit achtzehn Jahren als Kriminalreporterin tätig und hat bereits mehrere True-Crime-Bestseller in Dänemark veröffentlicht. Hautnah bei den echten Ermittlungen dabei zu sein hat die beiden dazu inspiriert, ihren ersten gemeinsamen Kriminalroman zu schreiben. Mit »Gefrorenes Herz« eroberte das Duo die dänische Bestsellerliste im Sturm, und der zweite Fall wartet bereits auf Maria Just.
HOLMBOLTHER
GEFRORENES HERZ
Kriminalroman
Aus dem Dänischen von Franziska Hüther und Günther Frauenlob
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe For Barnets Bedste erschien erstmals 2020 bei Politikens Forlag, Kopenhagen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 01/2022
Copyright © 2020 Line Holm and Stine Bolther and JP/Politikens Hus A/S
in agreement with Politiken Literary Agency
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Maike Dörries
Umschlaggestaltung: Favoritbuero
unter Verwendung von © GW3ND0LIN/shutterstock, © Pictureguy/shutterstock, © Evelina Kremsdorf/Trevillion Images, © ConstantinosZ/shutterstock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-28257-8V003www.heyne.de
Prolog
Die Ältesten der Stadt behaupteten, im Fjord lebe ein Hunderte von Jahren altes Wesen. Ein Ungeheuer, das bereits hier geherrscht habe, lange bevor die Vorväter in diese gottverlassene Bucht vorstießen, und das noch immer da draußen unter der grauweißen Oberfläche herumschwamm.
Die Alten sagten, das Wesen habe alles Leben geschenkt und warte in der Tiefe, um die Toten zu empfangen. Es werde den Menschen samt seiner Sünden und Untaten verschlingen und so für eine Weile die natürliche Ordnung wiederherstellen. Aus dem Meer bist du gekommen. Ins Meer kehrst du zurück.
Abergläubischen Unsinn gab es genug in diesem Land. Die Alten benutzten diese Erzählungen, um den Kindern Angst einzujagen, damit sie gehorchten. Um Widrigkeiten, Katastrophen und Tod akzeptieren zu können oder einfach nur, um für sich selbst eine Erklärung zu finden für all das Unerklärliche in dieser atemberaubend schönen, jedoch lebensgefährlichen Landschaft.
Inzwischen hatten Gott sei Dank ein gewisser Glaube und eine gewisse Bildung Einzug gehalten, sodass die alten Mythen wohl hauptsächlich noch in den Touristenbroschüren zu finden waren. Im Tourismus steckte Geld, und Geld – Dollar, D-Mark, Kronen, you name it – war nötig, wenn es hier eine Zukunft geben sollte. Sehr viel mehr Geld. Sehr viel mehr Vernunft, verdammt.
Doch ein besorgniserregend großer Teil der Hohlköpfe da draußen lebte noch immer nach den alten Mythen und Gutenachtgeschichten. Diese Leute glaubten an Geister, Butzemänner, beseeltes Dies und beseeltes Das. Und gaben das Ganze an ihre Kinder weiter. Wie viele Generationen mussten durchlaufen werden, ehe man dieser Idiotie Herr wurde?
Sie blickte durch das Panoramafenster auf den Fjord und zog gedankenversunken an ihrer Zigarette. Eigens importierte Gauloises mit Filter, ein Mitbringsel von einem der Gäste des heutigen Abends. Der Rauch überdeckte für einen gesegneten Moment den Mief, den ihre Alkohol und Schweiß ausdünstende Abendgesellschaft hinterlassen hatte. Diese Dänen, was war nur los mit ihnen? Man konnte meinen, den in gemäßigten Breiten Geborenen fehle jede Fähigkeit, ihre Körpertemperatur zu regulieren, ganz gleich, ob sie sich in der Polarnacht unter freiem Himmel oder im Haus, umgeben von bollernden Heizkörpern, aufhielten.
Die Leute bezeichneten sie als stark. Eine Frau, die keinen Mann brauchte. Die das Drängen ihres Vaters auf Schwiegersohn und Enkelkinder freundlich, aber bestimmt beiseitegewischt hatte. Sie war eine Frau, die sich zum Entsetzen der älteren Frauen gegen die Mutterschaft entschieden hatte.
Eine alte Freundin hatte ihr neulich – im Irrglauben, sie sei unfruchtbar – angeboten, ein Kind für sie zu empfangen und auszutragen. Ein Gabenkind. Der Vorschlag war sicher lieb gemeint, aber ganz ehrlich: Sie hatte noch Tage später gelacht.
»Tut mir leid, aber kennen wir uns überhaupt?«, hatte sie die Freundin scherzhaft gefragt, und die Freundin hatte ihr Angebot und ihre dienstwillige Gebärmutter weggepackt. Beschämt, gekränkt und vielleicht auch verärgert. Seitdem hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen.
Wie auch immer: Der Gedanke ans Muttersein lockte sie nicht, und ein Mann hätte es schwer, sich an ihrer Seite zu behaupten. Nicht nur aufgrund ihres Abschlusses an einer der renommiertesten Universitäten Europas und des gesellschaftlichen Status ihrer Familie. Nein, es hatte etwas mit der Art zu tun, wie sie nach außen hin auftrat. Mit einem Selbstbewusstsein und einer aufrechten Haltung, die sie größer erscheinen ließen als ihre bescheidenen eins zweiundsechzig. Überheblich, würden böse Zungen in der Stadt sagen.
Sollten sie ruhig. Auf deren Anerkennung konnte sie gut verzichten. Ihr Gesellschaftsleben war in erster Linie Leuten von außerhalb gewidmet. Gebildeten Menschen. Die dem Abschied der Gäste folgende Leere mochte sie nicht. Den eintönigen, prunklosen Alltag zwischen zwei Festen. Sie befand sich am liebsten im Zentrum der Aufmerksamkeit. Am Kopfende des Tisches, in der Mitte der Tanzfläche, alle Augen auf sich gerichtet.
Sie gab sich einen Ruck. Überlegte, eine Schallplatte auf dem Grammofon aufzulegen, aber nein, es war spät. Sie sollte besser schlafen, statt sentimental am Fenster herumzustehen.
Sie stutzte, als die Zigarette erneut in ihrem Sichtfeld erschien. Die graue Asche war beinahe bis zum Filter gewandert, während sie sich ihren Gedanken hingegeben hatte. Sie betrachtete den dünnen weißen Rauch, der nicht nach oben stieg, sondern unruhig zur Seite tanzte.
Sie sah sich im Wohnzimmer um. Irgendwo musste ein Fenster gekippt sein. Mit einem Seufzen begab sie sich auf einen leicht schwankenden Rundgang durchs Haus, durchs Esszimmer, die offene Küche und weiter hinaus in den Flur, wo sie sich einen Moment im Spiegel betrachtete. Die Pumps mit den acht Zentimeter hohen Absätzen hatte sie letzten Herbst viel zu teuer in Kopenhagen gekauft. Pinkes Kleid mit modischem Schnitt: figurbetont um Schultern und Brüste, weit ausgestellter Rock, ultrakurz. Die Frisur ein strenger Pagenschnitt mit noch strengerem Pony. Schwarz geschminkte Augen, rote Lippen. Zumindest waren sie rot gewesen, als der Abend begann.
Sie schlüpfte aus den Schuhen. Die überhitzten, schmerzenden Füße in der dünnen Nylonstrumpfhose registrierten augenblicklich den kalten Luftzug, der offenbar durch das gekippte Fenster hereindrang. Die Dielen knarzten kaum hörbar unter ihren Schritten. Vielleicht waren es die Putzfrauen. Planmäßig sollten sie erst morgen Vormittag kommen, aber sie wusste, dass die beiden katzbuckelnden, ununterbrochen schnatternden Weiber die Angewohnheit hatten, bereits in aller Herrgottsfrühe aufzutauchen, wenn sie außer Landes war. Vielleicht hatten sie sich im Datum geirrt.
Dann stand er auf einmal hinter ihr im Flur. Sie spürte seinen Atem und drehte sich um. Er hielt mit einer Art unterdrücktem Knurren die Luft an, als er sich aus den Schatten materialisierte. Wie ein Raubtier.
Ihr Körper, der instinktiv mit Furcht auf die unerwartete Gestalt reagiert hatte, entspannte sich. Er hatte sie schon den ganzen Abend lang angesehen. Sie schweigend über den Tisch hinweg mit seinen ungewöhnlich eisblauen Augen und diesem unergründlichen Blick beobachtet, mit dem Männer sie häufig anstarrten, wenn sie zur Höchstform auflief. Er hatte mit ernster Miene an ihren Lippen gehangen und ihren Gesten, was sie wie stets in solchen Situationen dazu verleitet hatte, ihre Stimme zu heben und noch pointierter zu argumentieren. Ihr Vater hatte immer gesagt, sie sei die geborene Politikerin, sollte sie eines Tages in seine Fußstapfen treten; sie besaß nicht nur den Mut, ihre Meinung offen kundzutun, sie verstand es auch, sie zu untermauern.
Für gewöhnlich deutete sie diesen Gesichtsausdruck bei Männern als perplexe Bewunderung. Als fasziniertes Staunen angesichts der modernen selbstständigen Frau, bei der selbst die Erfolgreichsten unter ihnen nicht recht wussten, wie sie sich verhalten sollten, die sie aber natürlich jagen und erlegen mussten. Gewisse Dinge änderten sich niemals.
»Oh, du?«, sagte sie und versuchte, die zwei Wörter nonchalant und gleichzeitig einladend klingen zu lassen.
Sie bereute die beiden letzten Drinks des Abends. Die Kontrolle über ihre Feinmotorik war beeinträchtigt. Aber sie hatte auch wirklich nicht mit einem ergiebigen Ende des Abends gerechnet, falls man es so bezeichnen konnte. Ihr Interesse an einer Beziehung hielt sich in Grenzen, doch sie stand zu ihren körperlichen Bedürfnissen, und in dieser Hinsicht kam ihr der Mann wie gerufen. Mit etwas Glück war er in einigen Tagen über alle Berge. Sie bräuchten einander nie wiederzusehen.
»Komm rein«, fuhr sie mit einer Handbewegung fort, ehe sie sich umwandte und zurück in Richtung Wohnzimmer ging. Er folgte ihr. Erst zögernd, dann mutiger, wie sie zufrieden feststellte. Einleitendes Geplänkel und höfliches Abwarten waren manchmal der reinste Stimmungskiller.
Sie hatte den Gedanken gerade zu Ende gedacht, als er unvermittelt dicht hinter ihr stand. Sie spürte dieselbe atemlose Anspannung wie zuvor von ihm ausgehen, doch nun schwang etwas anderes mit, etwas ganz und gar nicht Sinnliches. Weder Verlegenheit noch Erregung, sondern Wut. Sie erhaschte einen Blick auf ihren überraschten Gesichtsausdruck im Spiegel, als er sie nach hinten riss, zu Boden, und etwas um ihren Hals spannte. Es fühlte sich an, als würde ihr Kehlkopf durchgeschnitten. Sie schlug mit der rechten Hand nach ihm, bekam einen ihrer Pumps zu fassen und jagte ihm den spitzen Absatz in den Oberarm, vielleicht erwischte sie auch seinen Hals, doch er gab nicht den leisesten Schmerzenslaut von sich und zog die Schlinge nur noch strammer zu. Sie lag nun auf dem Rücken und sah ihm direkt in die Augen. Sie trat mit aller Kraft nach ihm, doch er drehte sie brutal auf den Bauch und hockte sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie, sodass sie mit Brust und Gesicht auf die Dielen gepresst wurde.
Wie lange sie gebraucht hatte, genau diese Holzsorte, genau diesen Lack auszuwählen. Nun lag sie mit blutig zerschlagenem Gesicht auf ebendiesem Holz, ebendiesem Lack und wusste, dass sie sterben würde.
Sein in ihren Rücken gebohrtes Knie schnürte ihr weiter die Luft ab. Der Puls pochte hinter den Lidern, als würde sie unter Wasser gezogen. Fast meinte sie zu sehen, wie die kleinen Blutgefäße in ihren Augen platzten. Sie sah Rot, dann Schwarz.
Er sagte etwas, das sie nicht verstand. Es war ihre Sprache, allerdings mit einem merkwürdigen Akzent, was nicht nur daran lag, dass er Ausländer sein musste. Er sprach altmodisch. Wie ein Echo vergangener Zeiten.
Er wiederholte es wieder und wieder, und da endlich verstand sie: »Teufelsbrut … Teufelsbrut.«
Sie dämmerte weg und kam wieder zu sich, als er sie erneut umdrehte wie eine Stoffpuppe. Sie vernahm das Geräusch von reißendem Stoff. Fühlte die Nylonstrumpfhose von ihrer Taille gleiten, als er das Bündchen aufschnitt. Ein brennender Schmerz schoss durch ihre Haut, als er zwei, drei, nein vier Linien in ihren Bauch ritzte. Durch den Nebel aus Schmerz sah sie verschwommen, wie er sein Werk mit zusammengekniffenen Augen begutachtete. Dann zog er die Hand abermals quer über ihren Bauch und verlängerte einen der Schnitte, aus dem bereits das Blut quoll.
Sie wollte sich wehren, doch ihre Glieder gehorchten ihr nicht. Es war so leicht für ihn. Ihr ganzes Leben hatte sie gewusst, dass sie ihre eigene Herrin sein, allein zurechtkommen, unabhängig und stolz sein wollte. Er hatte sie im Bruchteil einer Sekunde gebrochen. Er sah sie an, und in den meerblauen Augen stand abgrundtiefer Hass. Sie konnte nicht mehr. Die Dunkelheit wollte sie umfangen.
In diesem Moment hörte sie wieder die Stimme aus der Vergangenheit. Sie klang nicht länger zornig, sondern klein. Lieblich. Lockend und vertrauenerweckend. Sie sang.
In der tiefen Stimme des erwachsenen Mannes schwang etwas Unschuldiges mit. Wie bei einem Kind, das eine Strophe auswendig gelernt hat und sie unermüdlich herunterleiert. Die Worte waren ihr wohlvertraut. Natürlich waren sie das. Es war das Schlaflied über die Seele des Meeres, das auch ihre Mutter für sie gesungen hatte. Das Mütter seit jeher in diesem Land sangen.
Schlaf jetzt.
Sie ließ sich von dem Gesang der Kinderstimme einlullen, während die Kälte von unten in sie hineinströmte wie eisiges Meerwasser in ein leckes Boot. Und sie sah das mythische Meereswesen aus der Dunkelheit auf sich zukommen. In einem flüchtigen Moment der Überraschung bemerkte sie die wunderschöne Silhouette des Tieres. Unglaublich. Die Alten hatten recht gehabt. Die ganze Zeit über. Das Meer gibt, das Meer nimmt, und jetzt, dachte sie, jetzt kommt das Meer, um mich zu holen.
Das Letzte, was sie hörte, war der Refrain der Jungenstimme:
Ich bin das Meer. Das Meer ist in mir.
Ich bin das Meer. Das Meer ist in mir.
Ich bin das Meer …
ERSTE WOCHE
6. Januar bis 12. Januar 2020
1
Falls es physikalisch irgendwie möglich war, hätte Ilse Svann schwören können, dass ihr Nervensystem mit der Blase ihres Hundes verbunden war.
Sie wurde zu unchristlich früher Stunde wach, setzte sich ruckartig im Bett auf und schwang die Beine mit einer für ihr Alter bewundernswerten Geschmeidigkeit auf den Orientteppich. Angeberei lag Ilse Svann fern; sie stellte lediglich fest, dass sie bereits hellwach im Dunkeln saß und mit den Füßen nach ihren Pantoffeln tastete, als der Hund sein klägliches Winseln ausstieß. Bella musste raus.
Manche Leute behaupteten, Hundebesitzer würden mit der Zeit ihren Haustieren immer ähnlicher. Ilse strich sich über den schlohweißen Pagenkopf, knipste die Nachttischlampe an und schaute hinunter auf die Hündin mit ihren dunkelbraun gelockten Schlappohren. Rein äußerlich hätten sie kaum verschiedener sein können, aber Bellas innerer Uhr passte sie sich gern an.
»Ja, ja, Frauchen kommt ja schon«, sagte sie und spürte einen Druck auf der Brust. Ein Stich vorweggenommener Trauer. Eines Tages würde sie auch den Hund verlieren.
Ilse zog die Gardine ein Stück zur Seite und schaute hinaus. 2020 war sechs Tage alt, und bisher war das neue Jahrzehnt eine graue und regnerische Angelegenheit. Laut Wettervorhersage sollte dieser Montag ähnlich trübselig weitergehen, doch das ließ sich so früh am Tag noch nicht abschätzen. Es war erst 04.53 Uhr und stockduster da draußen auf der Østerbrogade.
Bella stand bereits an der Tür, als Ilse in ihre Ecco-Stiefel und den olivgrünen Thermo-Overall geschlüpft war, ein wattierter, dem Hintern wenig schmeichelnder Anzug, der sich in einem Laden für Anglerzubehör bestimmt für dreihundert Kronen erwerben ließ, den Ilse aber zum vierfachen Preis in einem Modegeschäft im Kopenhagener Stadtteil Østerbro gekauft hatte. Als »Fischersuit« hatte die Verkäuferin das Teil bezeichnet. Ilse hatte sich wahnsinnig modisch gefühlt, als sie das Geschäft mit dem Thermo-Overall verließ, bis sich herausstellte, dass so ziemlich jede Frau in einem ähnlichen »Fischersuit« durchs Viertel spazierte.
Dafür war das Teil verflucht praktisch. Im September hatte sie Bella nur mit einem Baumwollschlüpfer unter dem Thermo-Overall Gassi geführt. Beim bloßen Gedanken daran musste sie kichern. Rückblickend betrachtet, war es einer der Höhepunkte des Monats gewesen.
Zu dieser Tageszeit begegneten sie und Bella auf der Straße in aller Regel nur maßlos betrunkenen Gestalten oder solchen, die Ilse in privaten Zusammenhängen als »das neue Proletariat« zu bezeichnen wagte. Die Ausländer. Fremde. Dunkelhäutige.
Keine Frage: Eine gewisse Zahl an Gastarbeitern war natürlich notwendig. Die Dänen waren im Laufe der Jahre ein fauler Haufen geworden. Nicht wie Ilse, die nach ihrer Versetzung in den Ruhestand nach zweiunddreißig Jahren in der Buchhaltung der A. P. Møller-Mærsk-Gruppe mit Freuden zweimal die Woche zum Friedhof in Hellerup radelte, um dort die Buchführung des Friedhofsbüros zu machen.
Finanziell lohnte sich das kaum. Den Ansporn, sich zusätzlich zu betätigen, hatte eine rote Regierung nach der anderen längst ausgebremst. Im heutigen Dänemark war man fast ein Trottel, wenn man im Ruhestand auch nur einen Finger krumm machte. Aber Ilse mochte … nein, als alleinstehende, kinderlose Frau brauchte sie das Gefühl, nützlich zu sein. Für irgendjemanden. Und sei es nur für A. P. Møller, dem sie mit Stolz ein Menschenalter lang gedient hatte und der nun hier auf dem Friedhof begraben lag.
Doch weil die Dänen keinen Stolz mehr dabei empfanden, früh aufzustehen, etwas zu leisten und ihr eigenes Geld zu verdienen, strömten diese dunkelhäutigen Menschen ins Land und führten die Tätigkeiten aus, zu denen immer weniger Dänen sich herablassen wollten: Zeitungen austragen, Straßen fegen oder Putzen.
Ilse hatte grundsätzlich nichts gegen diese Menschen. Man konnte den Leuten schließlich schlecht vorwerfen, dass sie vor Krieg und Zerstörung flüchteten, wenn die Alternative darin bestand, ihre Kinder einem Regen aus Bomben und pulverisierten Steinbrocken auszusetzen. Sie gab gern ihren Obolus zum jährlichen Spendenaufruf des Roten Kreuzes und der Welthungerhilfe, UNICEF und wie sie noch alle hießen. Offen gestanden, war es ihr aber am liebsten, wenn die Gelder dort eingesetzt wurden, wo die Menschen herkamen. In diesem Punkt stimmte sie mit der Mehrheit der Dänen überein, wie sie neulich in der Morgenavisen gelesen hatte.
An einem Sommertag vor einigen Jahren wurde sie wie die meisten fernsehenden Dänen Zeugin, wie eine Schar von Flüchtlingen in Rødby ankam und sich von dort auf einen unkontrollierten Fußmarsch über die dänische Autobahn machte. Sie sagte es selten laut, da sie nicht mit ordinären Rassisten in einen Topf geworfen werden wollte, aber sie mochte die dunkelhäutigen Männer mit ihren leeren Blicken und dem wilden Gestikulieren nicht. Genauso wenig wie die jungen Afrikaner, die lieber die Verantwortung für die Entwicklung in ihren Heimatländern übernehmen sollten, statt hier im Norden ihr Glück zu suchen. Die unterdrückten Frauen in ihren bauschenden Gewändern und mit viel zu vielen Kindern am Rockzipfel sahen – ja, jetzt wurde Ilse womöglich ein wenig grob – schlicht und ergreifend undänisch aus.
Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie die Frauen ihrer Generation für eine angemessene Bezahlung auf dem Arbeitsmarkt gekämpft hatten. An einem männerdominierten Arbeitsplatz wie Mærsk war Gleichberechtigung alles andere als selbstverständlich gewesen. Sie hatten lange darum gerungen, und sie sah nicht ein, dass die dänische Gesellschaft diesbezüglich Abstriche machen sollte. Nicht eine Sekunde. Sie würde sich nie daran gewöhnen, in Kopenhagen verhüllte Frauen auf der Straße zu sehen.
Den armen Kinderchen wollte sie jedoch von Herzen gern helfen. Sie sahen entzückend aus und lernten die Sprache im Handumdrehen. In der richtigen Umgebung untergebracht und frühzeitig von den dänischen Werten geprägt, konnte man ihnen, wenn es nach Ilse ging, ohne Weiteres einen Platz in Dänemark anbieten.
Die Eltern hingegen … Ja, das war schon ein Dilemma, aber hier musste man wohl zuallererst an Dänemark, die Dänen und die unschuldigen Kinder denken. Wenn die Immigranten nicht in der Lage oder willens waren, nach den dänischen Werten zu leben, musste man die Kinder wohl oder übel aus den Familien entfernen. Zur Adoption freigeben, so einfach war das. Natürlich ging es um das Wohl des Kindes, letzten Endes aber auch um den Zusammenhalt der Nation, wie der von Ilse sehr geschätzte Ministerpräsident Troels Mejding letzte Woche in seiner Neujahrsansprache gesagt hatte.
Ilse Svann rief Bella zu sich und überquerte die Østerbrogade an der Ecke zur großen Kreuzung Trianglen. So früh am Morgen bei den menschenleeren Straßen ließ sie den Hund ohne Leine laufen. Bella kam immer beim ersten Pfeifen, wohlerzogen wie sonst nur wenige.
Normalerweise ging sie über den noch unfertigen Platz an der U-Bahn-Station in den angrenzenden Fælledparken zur Hundewiese, aber jetzt war es zu dunkel dafür. Außerdem sah es gefährlich aus. Auf dem Boden lagen überall Bierbecher und Plastikverpackungen, ein einsamer Herrenhandschuh, eine verlorene Monatskarte und zerknülltes 7-Eleven-Papier – ein sicheres Zeichen, dass gestern Abend ein Konzert im Parken-Stadion stattgefunden hatte. Stattdessen bog Ilse in den Blegdamsvej ein. Einige hundert Meter weiter gab es einen Grasstreifen, auf dem Bella ungestört ihr Geschäft verrichten konnte.
»Bella!«, kommandierte sie etwas verärgert, als die Hündin plötzlich davonsauste. Sie schien wirklich dringend zu müssen. Ilse beschleunigte ihre Schritte. In der Dunkelheit hatte sie den Hund aus den Augen verloren.
»Bella, wo bist du?«, rief sie mit wachsender Unruhe, als sie am Studentenwohnheim mit den hohen, schmalen Fenstern vorbeihastete.
»Bella, komm zu Frauchen … Hörst du?«
Sie schaute sich um. Die Parkplätze vor dem Hauptsitz des Roten Kreuzes waren belegt, wodurch die Sicht auf Straße und Bürgersteig versperrt war.
»Bella!«, rief sie schrill und probierte es anschließend mit einer tieferen, vorwurfsvollen Stimmlage, um Bellas gut ausgebildetes Schamgefühl anzusprechen: »Pfui, pfui, Bella, jetzt wird Frauchen aber sauer! Komm sofort hierher!«, rief sie, unsicher, wohin sie ihren Ruf richten sollte.
»Bella, Leee-cker-li«, machte sie einen neuerlichen Versuch und griff in die Hosentasche ihres Thermo-Overalls.
Ilse sah am Rotkreuzgebäude hinauf. Der pyramidenförmige Anbau, der vor einigen Jahren vor dem Hauptgebäude errichtet worden war, beherbergte ein großes Auditorium und Konferenzräume für die Freiwilligen der Organisation, doch von außen glich die gestufte Fassade aus ockerfarbenen Klinkersteinen vor allem einer Tribüne, unterbrochen von einem geländerumsäumten Einschnitt, in dem sich der Haupteingang befand. Das Bauwerk war eine großzügige Schenkung der A. P. Møller-Stiftung. Daher war sie grundsätzlich positiv gestimmt, wenn sie hier vorbeiging, aber schön war das Ganze weiß Gott nicht.
In diesem Moment kam Bella fröhlich hechelnd aus dem tiefen Einschnitt gelaufen. Sie hinterließ feuchte Pfotenabdrücke auf dem Bürgersteig, als sie auf Ilse zusteuerte, dann aber kurz vor ihr kehrtmachte und erneut im Eingangsbereich verschwand.
»Bel-la!«
Ilse marschierte wütend dem Hund hinterher. Bella lief sonst nie einfach so davon.
Am Eingang fand sie sie mit der Schnauze und den Vorderpfoten in einer Ansammlung dunkler Flecken auf den Fliesen. Bella schaute glücklich zu ihr auf und schnaufte verzückt. Ihre Schnauze war mit irgendeinem klebrigen Zeug verschmiert.
Ilse hob verwundert den Blick und schlug sich die Hand vor den Mund. Am Treppengeländer über der Eingangstür und dem Rotkreuzemblem hing ein Mann an einem Nylonseil, das unter den Armen um die Brust gestrafft war. Um den Hals war eine Krawatte geschnürt, und sein nach vorn gekippter Kopf war blau angelaufen und aufgequollen. Die Arme waren seitlich ausgebreitet am Geländer festgebunden, als sei er in einem missglückten Versuch, aus eigener Kraft zu fliegen, erstarrt. Seine Beine hingen schlaff und leblos herab und endeten in einem Paar hässlicher Mokassins mit Zierbommeln. Sie hatte noch nie verstanden, weshalb ältere Männer meinten, solche Hugh-Hefner-Schuhe tragen zu müssen. Schließlich riskierte man – wie in diesem Fall –, tot darin aufgefunden zu werden.
Denn tot war er. Tot und gekreuzigt wie Jesus, der für die Sünden der Menschheit gestorben war.
Und auch dieser Mann, dieser Jesus vom Blegdamsvej, war Jude, dachte Ilse. Aber welche Sünden sühnst du? Deine eigenen? Unsere?
Sie senkte den Blick, beschämt über den taktlosen Zynismus ihrer Gedanken. Dann wurde ihr bewusst, dass wer auch immer hinter dieser … dieser bestialischen Schweinerei steckte, noch in der Nähe sein könnte. Ihr womöglich in dieser Sekunde auflauerte. Sie spürte förmlich den warmen Atem des Bösen in ihrem Nacken und suchte fieberhaft in ihren Taschen nach ihrem Handy, bis ihr einfiel, dass es zu Hause lag.
Sie hatte den Toten sofort erkannt. Jeder Däne, der die Gesellschaftsdebatten auch nur einigermaßen mitverfolgte, würde ihn erkennen, auch wenn er grauenhaft aussah, so öffentlich zur Schau gestellt, im Anzug, den behaarten, blutig verunstalteten Bauch entblößt.
Ilse stand wie versteinert da, als sie einen Stups gegen ihr Knie spürte und nach unten schaute. Bella sah schmutzig, vergnügt und erleichtert aus. Befreit. Sie hatte einen formvollendeten Haufen unter den toten Mann gesetzt.
Ilse nickte.
»Ja, Bella. Lass uns nach Hause gehen.«
2
Maria bekam keine Luft. Ihr Verstand wusste genau, was geschehen würde. Wenn sie den Kopf nicht über Wasser bekam, würden ihr Hirn und ihre Lunge bald so verzweifelt nach Sauerstoff schreien, dass die Panik übernehmen würde. Sie würde den Mund öffnen und Wasser schlucken, und durch den Hustenreflex nur noch mehr. Es wäre eine Frage von Sekunden, bis sie das Bewusstsein verlor. Minuten, bis sie tot wäre.
Sie schlug die Augen auf, die augenblicklich zu brennen begannen. Vor sich im Wasser meinte sie das bläulich-fahle, aufgedunsene Gesicht ihres Vaters treiben zu sehen. Sie ruderte hektisch mit den Armen, stieß gegen etwas Hartes, griff danach und schlug ein paarmal ins Leere. Als sie erneut dagegenstieß, klammerte sie sich fest.
Hoch, Maria, hoch.
Maria Just durchbrach die Wasseroberfläche mit einem schluchzenden Luftschnappen und eisernem Griff um den Vollbart des Schwimmlehrers.
»Au, verdammt«, brüllte er und packte Marias Handgelenk, während er ihr half, Halt zu finden. »Steh! Stell dich hin. Hier ist es nicht tief, okay?«
Maria nickte hustend, während sie sich mit nassen Händen das Chlorwasser und die Scham aus den Augen zu wischen versuchte.
Der Schwimmlehrer fuhr sich unter der Nase entlang, schaute auf seine Hand und drückte mit Daumen und Zeigefinger die Nasenflügel zusammen.
»Jetzt habe ich wegen dir auch noch Nasenbluten«, sagte er.
Sein vorwurfsvoller Ton provozierte Maria. Schließlich warb Thomas Jæger auf seiner Homepage damit, jedem das Schwimmen beibringen zu können. Maria hatte ihn gleich in der ersten Stunde vorgewarnt, dass sie ein hoffnungsloser Fall und sicher nicht »jeder« sei. Aber ihr Herz pochte noch immer wie wild, und sie hatte nicht den Nerv, das neue Jahr mit der Suche nach einem weiteren Schwimmlehrer einzuleiten, der anfangs geduldig, dann immer gereizter und zum Schluss resigniert sein würde. Es war zu teuer und zu erniedrigend, daher schluckte sie ihren Ärger hinunter.
»Tut mir leid, das war wirklich keine Absicht. Ich habe einfach vergessen, was du mir gesagt hast.«
»Ich habe dich doch festgehalten. Wenn du mir nicht vertraust, weiß ich nicht, wie …«, setzte er an, unterbrach sich jedoch. »Hör mal, lass uns für heute Schluss machen. Wenn ich noch weiter ins Wasser blute, muss das ganze Becken geschlossen werden. Hygienevorschriften, du weißt schon«, sagte er und deutete an die Decke, als kämen die erwähnten Hygienevorschriften von einer höheren Macht dort oben. Mit der anderen Hand drückte er noch immer seine Nasenflügel zusammen, den Kopf hatte er in den Nacken gelegt. Alles in allem erinnerte er trotz seines beeindruckenden v-förmigen Oberkörpers an ein verletztes Tier.
»Na gut, okay. Dann sehen wir uns am Montag, hoffe ich. Noch mal Entschuldigung«, sagte Maria und tastete sich mit kleinen Schritten seitwärts bis zum Rand. Mit festem Griff um das Geländer zog sie sich durch das bauchtiefe Chlorwasser zur Leiter und hoch an den Beckenrand. Normalerweise schaute Thomas ihr und ihren durchs Joggen durchtrainierten Beinen am Ende der Stunde hungrig nach. Davon war er nun wohl ein für alle Mal kuriert, dachte Maria und warf einen Blick über die Schulter. Thomas hatte sich zum entgegengesetzten Ende des Beckens getrollt, wo er von einer Rettungsschwimmerin mit Verbandskasten und mütterlichem Blick versorgt wurde.
Erst unter der Dusche sank Marias Puls allmählich wieder auf normales Niveau. Mist, verdammter. Sie hatte sich feierlich geschworen, dass 2020 das Jahr würde, in dem sie endlich schwimmen lernte. Als einunddreißigjährige moderne, studierte, sportliche und grundsätzlich fähige Frau, die obendrein von der Nordseeküste stammte, war es ausgesprochen peinlich, das nicht zu können.
Sie hoffte inständig, dass Thomas ihren Aufwärtshaken nicht allzu persönlich nahm und sie trotzdem weiter unterrichtete. Sonst hätte sie vielleicht etwas härter zuschlagen sollen.
Maria unterdrückte ein Kichern und dachte an die Psychologin, zu der sie die gesamte Oberstufe hindurch regelmäßig gegangen war. Birthe W. Poulsen, die in jeder Sitzung dasselbe beigefarbene Rollkragenoberteil in Kombination mit einem leicht missbilligenden Ausdruck getragen hatte, hätte diese Art sarkastische Bemerkungen als Bewältigungsstrategie bezeichnet. Ihrer Ansicht nach verbarg Maria ihre wahren Gefühle nach dem Unglück hinter einer Mauer aus Ironie, die weder sie selbst noch andere durchbrechen konnten.
Damit hatte die Psychologin zweifellos recht gehabt. Doch damals wusste Maria nicht, wie ihre »wahren Gefühle« aussahen. Im Grunde war sie sich darüber noch immer nicht recht im Klaren.
Nach zwanzig effektiven Sekunden unter dem kalten Strahl wickelte sie sich ein Handtuch um den Körper und ging zu ihrem Garderobenschrank im praktisch menschenleeren Umkleideraum. Sie liebte das alte Schwimmbad mit seiner gewölbten Decke beinahe ebenso sehr, wie sie das Becken fürchtete. Ministerpräsident Thorvald Stauning und König Christian X. persönlich hatten es 1930 eingeweiht, das damals erste offizielle Schwimmbad Dänemarks. Solcherart lexikalische Fakten speicherten sich beinahe automatisch bei einer Historikerin wie Maria ab. »Königin unnützen Wissens und kurioser Fakten« hatte ihr großer Bruder Mads sie hänselnd bei einer Runde Trivial Pursuit in den Weihnachtsferien genannt. Gewohnheitsgemäß hatte Maria souverän gewonnen, und wie immer war es in gutmütigen Sticheleien geendet.
»Lass Mads doch auch mal zum Zug kommen«, hatte ihre Mutter Maria vom Sofa aus ermahnt.
»Das ist ja wohl nicht der Sinn des Spiels!«, hatte Maria erwidert. Etwas zu schnippisch. Ihre Mutter hielt immer zu Mads. Mads, der in Thorup Strand geblieben und Fischer geworden war. Wie ihr Vater. Mads, der geheiratet und zwei entzückende Kinder bekommen hatte. Mads, der ein Haus in fußläufiger Entfernung zum Elternhaus gebaut hatte und stets zur Stelle war, wenn die Mutter Hilfe benötigte. Mads machte niemals etwas falsch. Maria hingegen …
Maria tippte den Code zu ihrem Schrank ein.
2-3-0-3. 23. März. Der Geburtstag ihres Vaters.
Sollte sich ein Hacker für ihr nicht existentes Vermögen oder ihr nicht existentes Liebesleben interessieren, hätte er bei ihr leichtes Spiel. Sie benutzte 2-3-0-3 für so gut wie alles – ihr iPhone, das Kettenschloss ihres Fahrrads, ihren Bibliotheks-Log-in und das Schloss für ihr Dachbodenabteil. Nicht nur die Eingangstür zum Polizeimuseum, sondern auch ihr Arbeits-PC wurden mit 2-3-0-3 geöffnet. Was das anging, nahm sie in etwa denselben Platz auf der Trottel-Skala ein wie all jene, die »iloveu«, »1234« oder »password« als Passwort benutzten. Maria wusste, dass man nicht ein und dasselbe Passwort für alles verwenden sollte, aber es interessierte sie herzlich wenig.
2-3-0-3. Der Geburtstag ihres Vaters und sein Todestag.
Als Erstes fischte sie ihre Armbanduhr aus dem Schrank. Shit. Schon 08.20 Uhr. Idealerweise war sie um Viertel vor neun im Museum, damit sie Zeit hatte, sich einen Kaffee zu holen und angemessen vertieft auszusehen, wenn ihre Chefin um Punkt 08.55 Uhr durch die Tür trat.
Maria schlüpfte schnell in Unterwäsche, Jeans und Socken, raffte ihre Sachen zusammen und eilte hinüber zum Hand- und Haartrockner an der Wand, der sich nach Bedarf höher- oder tieferstellen ließ. Sie schob den Apparat in die oberste Position, sodass sie trotz ihrer eins siebenundsiebzig aufrecht unter dem warmen Luftstrom stehen konnte, während sie gleichzeitig versuchte, sich zu schminken. Ein ästhetisch riskantes Manöver. Zum Schluss begutachtete sie das Ergebnis im Spiegel. Wie zu erwarten, sahen ihre Haare aus, als sei sie zu lang bei steifer Brise auf hoher See gewesen. Ein Wirrwarr ungezähmter Locken. Seit ihrer Jugend kriegte sie immer wieder zu hören, sie sehe aus wie die Dunkelhaarige aus Thelma & Louise. Damals hatte sie der Vergleich genervt, doch jetzt, da sie die dreißig überschritten hatte, fand sie es gar nicht so schlecht. Geena Davis mochte ein schräger Charakter sein, aber damit konnte sich die erwachsene Maria leicht identifizieren.
Mit notdürftig zugebundenem Mantel rannte Maria die Treppe hinunter und sprang auf ihr Fahrrad. Sie strampelte in Richtung Trianglen los, bog an der Kreuzung rechts ab und fuhr beinahe einem Motorradpolizisten in die Arme, der die Zufahrt zum Blegdamsvej mit seinem Fahrzeug versperrte.
Für den Bruchteil einer Sekunde ärgerte sie sich, weil sie nun sicher einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Licht bekommen würde. Aber der Polizist winkte sie bloß vorbei.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
»Die Straße ist bis zum Rigshospital gesperrt. Sie können hier nicht durch. Wenn Sie nach Nørrebro wollen, müssen Sie südlich um den Sortedams-See fahren.«
Er zeigte die Østerbrogade hinunter Richtung Innenstadt. Maria ignorierte ihn, stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte in den Blegdamsvej. Polizeiautos und Kastenwagen standen als mobile Barriere quer über der Straße vor einer Reihe weißer Zelte, und sie sah einen Rettungswagen mit geöffneten Hecktüren sowie mehrere Personen mit Mundschutz, Handschuhen und blauen Overalls, die hinter einer Absperrung umherliefen. Eine Handvoll Pressefotografen wartete mit Thermoskannen, Teleobjektiven und kleinen Trittleitern ausgerüstet vor der Absperrung.
Es sah aus wie ein Mordschauplatz.
Nicht dass Maria eine Expertin gewesen wäre. Das heißt … eigentlich war sie es doch. In den ersten zwei Jahren und drei Monaten als Mitarbeiterin des Polizeimuseums hatte sie sich um die steigende Zahl von Medienanfragen gekümmert. Ihre Chefin war nicht gerade begeistert über diese Entwicklung, doch Marias Journalistenfreundin hatte ihr versichert, dass zumindest gewisse Pressevertreter es liebten, junge, wortgewandte Frauen ihrer Liste von Expertenquellen hinzuzufügen. Viel zu wenige Frauen hatten den Mut, sich ebenso selbstbewusst und freimütig zu äußern wie ihre männlichen Kollegen.
»Kann ich nicht einfach durch den Fælledparken fahren? Ich muss in zweieinhalb Minuten am Sankt Hans Torv sein …«, versuchte Maria ihr Glück mit einer westjütisch angehauchten Charmeoffensive.
»Hallo, haben Sie nicht verstanden, was ich gesagt habe? Da drüben liegt ein toter Mann, kapiert? Fahren Sie außen herum«, antwortete er in unterkühltem Kopenhagener Dialekt.
Maria hob abwehrend die Hände, mimte ein Sorry und wendete das Fahrrad. Während sie energisch in die Pedale tretend am Sortedams-See entlangradelte und rechts in den Tagensvej einbog, erwog sie, ihr Handy aus der Tasche zu angeln und die Homepage des Ekstra Bladet aufzurufen. Die Boulevardzeitung musste doch wissen, was im Blegdamsvej passiert war.
Aber sie hatte es eilig. Es war fast neun, und sie hatte heute bereits zwei Männer verärgert. Wie sie ihre Chefin Bodil Toft kannte, wartete der dritte Anschiss auf sie, wenn sie in Kürze zum ersten Arbeitstag des Jahres durch die Tür trat.
Viel zu spät bemerkte sie die rote Ampel und das rechts abbiegende Auto, als sie in vollem Tempo auf die Kreuzung zwischen Tagensvej und Blegdamsvej brauste.
3
Mikael Dirk stieg so hart in die Bremsen, dass der Gurt sich über seiner Brust straffte. Die Radfahrerin war wie aus heiterem Himmel aufgetaucht und hatte ihn rechts überholt.
»Scheiße«, fluchte er und umklammerte das Lenkrad. Er hatte die Frau übersehen, was untypisch für ihn war. Nur der rot wirbelnde Schimmer ihrer Lockenmähne hatte sie davor bewahrt, von ihm überfahren zu werden. Sie wäre schuld gewesen, aber wer hatte schon Mitleid mit dem Fahrer, wenn ein Auto einen Radfahrer ummähte?
Die Frau blieb auf der anderen Straßenseite stehen und schaute zurück. Mit geröteten Wangen, leicht schräg gelegtem Kopf und den Haaren über die eine Schulter geworfen, blickte sie ihm direkt in die Augen. Nicht provozierend, im Gegenteil, sie sah aus wie eine einzige große Entschuldigung. Und sie sah aus wie jemand, für den man gern jeden Morgen aufstand.
Nein, es bestand kein Anlass, ihr wütend hinterherzurufen, er selbst war in Gedanken schließlich auch woanders gewesen als bei dem selbstmörderischen Kopenhagener Berufsverkehr.
Die morgendliche Meldung war eindeutig gewesen: »Möglicher Mord im Blegdamsvej 27. Täter auf freiem Fuß. Achtet auf die eigene Sicherheit.«
Er seufzte. Was für ein Start ins Jahr 2020, das direkt mit einem Mord auf offener Straße begann.
Er hatte miserabel geschlafen und war übel gelaunt aufgewacht. Das Bild eines kleinen blonden Jungen hatte klar und deutlich in seinen Träumen gestanden, eine von Sehnsucht und schlechtem Gewissen befleckte Erinnerung. Eigentlich hatte er vorgehabt, im Bett zu bleiben, doch dann hatte der Leiter des Dezernats für Gewaltverbrechen angerufen, und wenn Carlsen rief, erschien man. Dafür hatten sie im Alltag keine festen Arbeitszeiten. Solange man seine Aufgaben erledigte und da war, wenn ein Fall es verlangte, konnte man praktisch kommen und gehen, wie man wollte.
Er sah der Frau auf dem Fahrrad nach, als sie wieder auf den Sattel stieg und Richtung Sankt Hans Torv weiterfuhr, bis ein Auto hinter ihm ungeduldig hupte. Gereizt bog er in den Blegdamsvej ein und warf einen Blick auf das linker Hand aufragende Rigshospital. Seine Gedanken wanderten zurück zu dem Tag vor genau sechs Jahren, als da oben im zweiten Stock sein Sohn zur Welt gekommen war. Das Wetter war ähnlich wie heute gewesen: kalt, feucht, grau und trist. Es war einer seiner letzten richtig glücklichen Tage gewesen.
Karin hatte nach der langen Geburt geschlafen, während er mit seinem neugeborenen Sohn auf dem Arm durch die Gänge gewandert war. Hector. Er erinnerte sich noch daran, wie der Junge ihn ohne zu blinzeln angestarrt hatte, als suche er nach einer Bestätigung, dass Mikael bereit war. Manns genug. Vater zu sein.
Damals hatte er geglaubt, es zu sein. Hector war schließlich sein Sohn! Er war Hectors Vater und Karins Mann. Damals.
Stimmengewirr erklang, als Mikael sich der Traube von Kollegen und Kriminaltechnikern vor dem Gebäude des Roten Kreuzes näherte. Er kannte die meisten Gesichter, konnte sich aber nur an einzelne Namen erinnern. An die für ihn wichtigsten. Er hatte noch nie Zeit darauf vergeudet, sich die Namen von Kollegen, ihre Geburtstage oder ihren Familienstand einzuprägen. Es scherte ihn herzlich wenig.
Mittendrin stand sein neuer Partner, Frederik Dahlin.
Niels Carlsen hatte Mikael kurz nach Weihnachten in sein Büro gerufen und ihm mitgeteilt, dass ab dem neuen Jahr Frederik sein Partner wäre, weil sie so »ein ungleiches und daher perfektes Paar« abgäben. Wie auch immer man diese Worte interpretieren wollte. Mikael war nicht umhingekommen, sie als Kritik aufzufassen.
Er hatte gern mit seinem vorherigen Partner zusammengearbeitet, einem sattelfesten Ermittler der alten Schule, der unzählige Vorgesetzte, finanzielle Einsparungen und die fixen Ideen wechselnder Führungskräfte bezüglich »moderner Ermittlungsmethoden« überlebt hatte. Doch dann war die Frau des Kollegen gestorben, und er hatte zu Mikaels Überraschung eine höchstwahrscheinlich sterbenslangweilige Stelle in einer Polizeidirektion in der Provinz angenommen, um näher bei seinen Enkelkindern zu sein.
Mikael musterte seinen neuen Partner. Laut Carlsen hatte der frisch eingestellte Frederik »außergewöhnliche Fähigkeiten auf dem Gebiet datengestützter Ermittlungen«, womit er gleichzeitig implizierte, dass Mikael ebensolche vermissen ließ. Mikael hatte ein bleichgesichtiges Bürschchen mit Mundgeruch, fettigen Haaren und Gamerbuckel erwartet. Stattdessen stand dort ein charmanter Mann mit dichten dunkelbraunen Locken, lächelnden Augen und perlweißen Zähnen.
Frederik war laut Intranet drei Jahre jünger als er, dafür aber kleiner. Zum Glück. Hoffentlich war dieser Mann bloß eine Eintagsfliege, ein Musterknabe, der auf seinem Weg die Karriereleiter hinauf nur einen kurzen, schnell wieder vergessenen Zwischenstopp in der Abteilung einlegte.
Mikael seufzte und ging mit drei langen Schritten auf ihn zu.
»Tag«, sagte er und streckte die Hand aus.
Frederik ergriff sie zögernd, während er sein Handy in die Seitentasche seiner großen blauen Winterjacke steckte.
»Kennen wir uns?«, fragte er.
Mikael zog die Hand zurück. Arrogant war er also auch noch. Jetzt fehlte bloß, dass er obendrein nichts taugte.
»Nein, aber das soll sich laut unserem Chef wohl ändern. Ich schlage vor, wir machen uns an die Arbeit«, gab Mikael scharf zurück.
Der Mordfall hatte augenscheinlich bereits das Interesse der Medien geweckt. Zu beiden Seiten des abgesperrten Blegdamsvejs tummelten sich Pressefotografen, Journalisten und Übertragungswagen, und auf den gegenüberliegenden Balkonen standen schaulustige Bürger mit gezückten Handys. Am Himmel nahm Mikael schwach das dumpfe Knattern des NEWS-Hubschraubers wahr. Er spürte ein wachsendes Unbehagen. Nicht weil er sich ungern von der Öffentlichkeit über die Schulter schauen ließ. Er hatte unzählige Male in ähnlichen, wenn nicht drastischeren Situationen in Nørrebro und dem Nordvest-Viertel gestanden, wo er über zehn Jahre hinweg an der Aufklärung von Drogendelikten gearbeitet hatte. In Fällen, die mit Bandenkriminalität in Verbindung standen, gingen sowohl die Presse als auch die ansässigen Bürger äußerst aggressiv vor. Häufig waren er und seine Kollegen dadurch in ihrer Arbeit behindert worden. Nicht selten hatte er sich mit einer ganzen Familie konfrontiert gesehen, die wissen wollte, was passiert war, warum und wann ihr Sohn wieder freikäme.
Nein, er dachte vor allem an Karin. Sie würde ihn im Fernsehen oder auf Pressefotos erkennen und es ihm übel nehmen, dass er ausgerechnet heute hier herumlief. Als ob Hector nicht existierte. Als ob heute nicht sein Geburtstag wäre. Aber was sollte er tun? Sie ließ ihn das Kind ja nicht einmal sehen.
4
Die weißen Zelte der Katastrophenschutzbehörde zogen sich wie ein viereckiger Tausendfüßler am Anbau hinauf und schützten den Fundort wirkungsvoll gegen Wind und Wetter. Mikael merkte, wie Frederik an seine Seite trat. Beide beobachteten sie das zielgerichtete Hin und Her der Kriminaltechniker in ihren blauen Schutzanzügen in das Zelt hinein und wieder heraus.
»Hören Sie, das war nur ein Witz eben. Ich weiß natürlich alles über Sie. Sie sind eine Legende im Dezernat für Gewaltverbrechen.« Frederik reichte ihm die Hand. »Lassen Sie uns noch mal von vorn anfangen. Frederik Dahlin. Von mir aus können wir uns gern duzen. Ich bin Frederik. Dahlin ist für die Bad Boys reserviert«, sagte er mit einem Lächeln auf den Lippen.
Mikael drückte seine Hand, ohne das Lächeln zu erwidern. Er wies mit dem Kinn auf das Zelt, in dem der Tote lag. Oder besser gesagt hing, wie Carlsen heute Morgen am Telefon kryptisch gesagt hatte. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der Rechtsmediziner kam und im Beisein der Ermittler den Toten in Augenschein nehmen konnte.
»Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, an Tatorten keine Witze zu reißen. Niemals«, antwortete er spitz.
Niels Carlsen kam ihnen entgegen. Der Dezernatsleiter war leicht an seiner farbenfrohen Brille zu erkennen, über die Mikael zu gern seine Kommentare abgab, sobald sich eine Gelegenheit dazu bot. Mit dem tadellos sitzenden Anzug, dem stets akkurat gestutzten weißen Haar und den gepflegten Fingernägeln sah Carlsen aus wie ein Wirtschaftsprüfer. Abgesehen eben von der bunten Brille, die wie der Versuch wirkte, eine Illusion jugendlicher Frische zu bewahren.
Vor Jahren hatte Carlsen im Dezernat für Wirtschaftskriminalität gearbeitet, und es machte den Eindruck, als vermisse er diese Tätigkeit. Seine Mitarbeiter witzelten hinter seinem Rücken, dass die Toten ihm Unbehagen bereiteten. Doch als Leiter des Dezernats für Gewaltverbrechen wurde er nun mal immer als einer der Ersten an den Fundort gerufen.
»Guten Morgen, alle zusammen. Dirk, Dahlin, ich sehe, ihr habt schon zusammengefunden. Stellt euch darauf ein, dass ihr euch in den nächsten Tagen und Wochen sehr gut kennenlernen werdet. Es ist ein heftiger Fall, mit dem wir hier konfrontiert sind. Wie ihr seht, haben wir bereits das Interesse der Öffentlichkeit.« Carlsen deutete in die Luft, wo direkt über ihren Köpfen der Nachrichtenhelikopter wie ein infernalischer Kolibri am grauen Himmel hing. »Und das Interesse wird wohl kaum nachlassen, wenn unser Mann da drinnen sicher identifiziert ist.« Mit einem Kopfnicken wies er auf das weiße Zelt und fuhr in seiner kurzen Einführung in den Fall fort. »Eine ältere Frau hat um 05.26 Uhr die Notrufzentrale verständigt. Sie ist mit ihrem Hund Gassi gegangen, der sie um etwa Viertel nach fünf auf den Toten aufmerksam gemacht hat. Da sie kein Handy dabeihatte, hat sie erst angerufen, als sie wieder zu Hause war. Nachdem sie die Pfoten ihres Hundes zunächst sorgfältig gewaschen und abgetrocknet hatte«, bemerkte Carlsen trocken.
Das bedeutete, dass die Frau möglicherweise wichtige Spuren vernichtet hatte. DNA des Täters, Mikrospuren im Fell oder anderes, das zu einer schnellen Auflösung des Falles beitragen könnte.
»Die Frau hat erzählt, dass der Hund am Tatort sein großes Geschäft erledigt hat. Genau gesagt, hat er einen Haufen direkt unter dem Toten hinterlassen. Damit ihr zumindest schon mal wisst, wer sich dieses Vergehens schuldig gemacht hat.«
Mikael schmunzelte. Es war typisch Carlsen, einen Ausdruck wie »großes Geschäft« zu verwenden. Der biedere, stets so korrekte Mann.
Frederik verzog keine Miene. Er hatte den Blick konzentriert auf Carlsen gerichtet, der nun zum Kern der Sache kam.
»Was den Toten angeht … Tja, vermutlich handelt es sich um den Generalsekretär des Roten Kreuzes, Georg Schmidt. Ihr kennt ihn sicher aus den Medien«, sagte Carlsen.
Ja, vielen Dank, Schmidt war für Mikael kein Unbekannter. Ein diskussionsfreudiger, besserwisserischer und aufgeblasener Typ, der einem vom ersten Moment an auf den Geist ging. Aber reichte das, um ermordet zu werden?
»Die Identifizierung ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen, aber er sieht aus wie Schmidt und hat einen auf ihn ausgestellten Führerschein im Portemonnaie. Wir können uns in puncto Identität also relativ sicher sein. Der Notarzt hat ihn für tot erklärt, ich habe hier eine Kopie des Totenscheins. Der diensthabende Rechtsmediziner ist bereits benachrichtigt worden. Das Rechtsmedizinische Institut ist ja nur ein paar hundert Meter von hier entfernt, er macht sich also einfach auf den Weg, sobald die Kriminaltechniker das Okay geben. Wir haben die Situation eingefroren. Die Leiche hängt noch so dort, wie wir sie vorgefunden haben, und keiner betritt das Zelt ohne die Erlaubnis des NKC«, sagte Carlsen mit Verweis auf das Nationale Kriminaltechnische Center der Landespolizei.
Mit zwei Klicks auf seinem Laptop öffnete er ein Video. Frederik, Mikael und die übrigen Ermittler rückten dichter um ihn zusammen und sahen sich schweigend die zwei Minuten zweiundvierzig Sekunden lange Aufzeichnung an, die den Toten aus verschiedenen Winkeln zeigte.
Sowohl Frederik als auch Mikael stöhnten leise, als die Leiche ins Bild kam, die mit ausgebreiteten Armen am Geländer über dem Haupteingang des Gebäudes hing. Als hätte Georg Schmidt über den Blegdamsvej fliegen wollen, über die Hausdächer und hinauf in den Himmel. Aber er flog nirgendwohin.
»Wir müssen herausfinden, weshalb er umgebracht wurde – und warum ausgerechnet auf diese Weise. Lösen wir dieses Rätsel, finden wir auch den Täter«, sagte Carlsen.
»Sind die dringlichsten Ermittlungsschritte eingeleitet worden?«, fragte Frederik.
»Die Leerung sämtlicher Abfalleimer in der Umgebung ist angeordnet. Der U-Bahn-Betrieb wurde unterbrochen, damit das Gebiet untersucht werden kann. Einige Kollegen sind bereits dabei, ein Tatortprotokoll über sämtliche Personen zu erstellen, die heute Morgen hier waren: die Frau mit Hund, die Rettungssanitäter, der Notarzt und so weiter. Außerdem haben sie die Schuhabdrücke aller Beteiligten genommen. Zwei Mann wurden losgeschickt, um die nähere Umgebung nach Überwachungskameras zu durchforsten«, antwortete Carlsen.
Überwachungsvideos waren inzwischen zu einer der effektivsten Waffen bei der Jagd nach einem Täter geworden. Mikael dachte an die Zeit, als noch nicht an jeder Straßenecke, in jedem Geschäft und jedem öffentlichen Gebäude Überwachungskameras hingen. Damals musste man sich damit begnügen, von Haus zu Haus zu gehen und mit den Anwohnern zu sprechen. Wobei die altmodische Polizeiarbeit natürlich auch etwas für sich hatte. An den Türen klingeln, das Vertrauen der Leute gewinnen. Heutzutage konzentrierten sich viele der neuen Kollegen allzu sehr auf datengestützte Ermittlungen und elektronische Beweise. Obwohl er erst achtunddreißig war, fühlte Mikael sich eher den älteren Kollegen in der Abteilung zugehörig. Frederik mit seinen fünfunddreißig Jahren hingegen war laut Carlsen einer der Jungen, die moderne Ermittlungsmethoden der traditionellen Polizeiarbeit vorzogen. Mikael seufzte innerlich. Es würde kompliziert werden.
Frederik meldete sich erneut zu Wort.
»Wie sieht es mit der Erfassung der Handydaten aus? Wurde schon eine Funkzellenabfrage durchgeführt? Wann ist seine Kreditkarte zuletzt benutzt worden? Hat jemand seine elektronischen Geräte, Laptop, iPad und so weiter gesichert, damit wir sie näher in Augenschein nehmen können?«
Carlsen sah Frederik an.
»Ich dachte eigentlich, dass Sie sich um diese Dinge kümmern könnten. Wir haben uns jedenfalls schon mal den schwarzen Volvo V90 gesichert, der vor dem Gebäude steht. Er gehört dem Generalsekretär.«
Mikael stampfte mit den Füßen auf. Ihm war kalt, trotz der vorgeschriebenen Uniform mit dunkelblauem Pullover, Wollunterhemd und langer Unterhose. Na, ihm würde schon warm werden, wenn er erst mal loslegen durfte, dann konnte ihn nichts mehr stoppen. Weder Hunger noch Durst, Müdigkeit oder Kälte. Aber diese Warterei hasste er.
»Ich habe heute eine wichtige Besprechung beim PET«, sagte Carlsen zu Mikael, womit er sich auf den polizeilichen Nachrichtendienst bezog. »Ich gehe davon aus, dass du ab hier übernimmst?«
Er drückte ihm einen Stapel Unterlagen mit den vorläufigen Informationen zum Fall in die Hand und ging, ohne eine Antwort abzuwarten. Mikael schaute ihm nach und schickte seinem weißhaarigen Chef ein stummes »Danke« hinterher. Er war soeben zum Ermittlungsleiter ernannt worden.
5
Der Rechtsmediziner Professor Dr. med. Andreas Juul ging mit einem gemurmelten »Tag« an Carlsen vorbei und tauchte mitsamt seinem Instrumentenkoffer unter dem Absperrband hindurch.
Er zeigte einem dort wachhabenden Polizisten seinen Ausweis, hielt sich aber höflich im Hintergrund, als ein Polizeihund nach erfolgter Spurensuche mit seinem Hundeführer angehechelt kam. Der Hundeführer gab Mikael einen kurzen Bericht. Man hatte gehofft, den Fluchtweg des Täters verfolgen zu können, doch in dem geschäftigen Kopenhagener Stadtteil, nur einen Steinwurf vom Nationalstadion und einer U-Bahn-Station entfernt, hatte sich das als unmöglich erwiesen.
»So, was haben Sie denn heute für mich?«, fragte der Rechtsmediziner mit dunkler und rauer Stimme, als er zu Mikael trat.
»Einen Mann mittleren Alters, vermutlich der Generalsekretär des Roten Kreuzes«, antwortete Mikael.
Frederik war tief versunken über sein Handy gebeugt.
Was konnte wichtiger sein als der Moment, wenn der Rechtsmediziner an einem Tatort eintraf? Mikael räusperte sich, und Frederik steckte mit entschuldigendem Blick das Handy weg.
»Sie sind heute also die glücklich Auserwählten«, sagte Juul trocken. »Na dann, wollen wir?«
Mikael und Frederik sollten dabei sein, wenn Andreas Juul die äußere Leichenschau durchführte. Alle drei kleideten sich schweigend in die blauen Einweganzüge, Mundschutz, Handschuhe, Haarnetz und Überschuhe. Anschließend gingen sie im Gänsemarsch über die einen Meter breite Papierbahn, die die Kriminaltechniker für sie ausgelegt hatten, die Treppe am Gebäude hinauf bis zu dem Geländer über dem Eingang, an dem die Leiche hing. Eventuelle Spuren unter dem Papier waren bereits gesichert worden, daher konnten sie nun den Tatort betreten.
Der Generalsekretär hing mit dem Rücken zu ihnen und offenbarte eine beginnende Glatze am Hinterkopf. Schmidt schien ein bisschen kleiner als der dänische Durchschnittsmann zu sein. Vielleicht war ihm deshalb so daran gelegen, sich in intellektuellen Diskussionen hervorzutun, dachte Mikael. Dafür war der Tote kräftig. Nicht direkt dick, aber mit der Wampe eines Rotwein trinkenden Genussmenschen und dem Ansatz eines Doppelkinns. Der Täter musste über Kraft und die entsprechende Konstitution verfügen, um diese … tja, wie sollte man es nennen … biblische Hinrichtung in Szene zu setzen.
Juul tastete die Leiche ab, ging dann über die Papierbahn zurück nach unten in den Eingangsbereich und stieg auf die Stehleiter, die die Kriminaltechniker aufgestellt hatten. Er begutachtete den Toten eingehend, maß die Körpertemperatur und inspizierte die Verletzungen an Bauch und Hals. Mikael und Frederik ließen ihn einige Minuten in Ruhe arbeiten.
»Der Rigor ist bereits eingetreten«, teilte Juul mit. Die Leichenstarre war einer von vielen Indikatoren, anhand derer die Rechtsmediziner Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt ziehen konnten. »Die Schnitte in der Bauchwand sind etwa einen halben Zentimeter tief. Ich würde schätzen, er hat um die fünfzig Milliliter Blut verloren, auch wenn es nach sehr viel mehr aussieht. Es handelt sich um oberflächliche Schnitte, die nicht bis in die Bauchhöhle reichen. Sonst wäre der Darm nach außen gedrückt worden«, erklärte Juul, während er auf Schmidts blutigen Bauch zeigte.
»Sie meinen, sodass er heraushängt?« Frederik konnte seinen Ekel angesichts der Vorstellung nur schlecht verbergen.
»Jep.«
Juul sprang mit einer für einen Mann in den Fünfzigern bewundernswerten Geschmeidigkeit von der Leiter.
»Wie lange ist er schon tot?«, fragte Mikael.
»Tja, wann wurde er das letzte Mal lebend gesehen?«
»Wenn es sich tatsächlich um den Generalsekretär handelt, hat seine Frau angegeben, gestern Abend um halb sieben mit ihm gesprochen zu haben. Vielleicht wurde er aber auch noch später gesehen, das versuchen wir gerade in Erfahrung zu bringen«, antwortete Mikael, nachdem er Carlsens Unterlagen konsultiert hatte.
»Dann ist er zwischen 18.35 und fünf Uhr morgens, als er gefunden wurde, gestorben«, sagte Juul mit einem meckernden Lachen. »Schauen wir mal. Seine Körpertemperatur liegt bei achtundzwanzig Grad. Die Lufttemperatur heute Nacht hat zwei Grad betragen, eine vorsichtige Schätzung wäre also ein Zeitpunkt zwischen ein Uhr nachts und kurz bevor er gefunden wurde. Bei kaltem Wetter lässt sich das nur schwer eindeutig sagen. Normalerweise fällt die Körpertemperatur um ein Grad pro Stunde, aber das ist nur ein Richtwert. Er könnte zum Beispiel bereits vor Eintritt des Todes unterkühlt gewesen sein, daher ist dieser Zeitraum mit großer Unsicherheit behaftet.«
Andreas Juul holte sein Diktiergerät hervor und begann seine monotone Eingabe.
»Leichnam mit einem Nylonseil am Geländer festgezurrt, beide Arme mit Kabelbinder fixiert. Um den Hals ist eine Krawatte gebunden, es sind deutliche Livores vorhanden. Unmittelbar scheinen einige davon umlagerbar zu sein, andere fixiert. Beim Fundort handelt es sich vermutlich auch um den Tatort, da sich Blut unter dem Toten findet.«
Juul hielt inne. Mikael wusste, dass er den Mund halten sollte, bis der Rechtsmediziner seine Notizen fertig diktiert hatte, doch er konnte seine Ungeduld nicht länger zügeln. Er war oft genug bei der Durchführung einer Leichenschau dabei gewesen, um zu wissen, dass Livores Totenflecke bedeutete.
»Woran ist er gestorben?«, fragte er. »Wie wurde er ermordet?«
Jetzt würde Juul hoffentlich mit einer Information herausrücken, die nicht auch für jeden Polizeischüler im ersten Semester offensichtlich war.
Juul schaltete das Diktiergerät ab.
»Dazu möchte ich mich noch nicht äußern. Lassen Sie ihn mich erst mal für die Obduktion ins Institut überführen, dann hören Sie von mir. Oder Sie kommen einfach vorbei.«
»War gestern irgendetwas Besonderes hier in Østerbro?«, fragte Frederik, als er und Mikael wieder frierend auf dem Blegdamsvej standen.
»Ich weiß nur, dass es ein Konzert im Stadion gab. Irgendeine Metal-Band. Wir müssen schauen, ob wir Zeugen finden. Ich übernehme das, kümmerst du dich um die Dinge, die Carlsen erwähnt hat? Funkzellenabfrage, Kreditkarte, Sicherung von Schmidts Computer. Videoüberwachung in der Umgebung?«
Mikael ging, ohne eine Antwort abzuwarten. Es war wichtig, gleich von Anfang an zu markieren, wer der Leiter dieser Ermittlung war – Partner hin oder her. Er schielte über die Schulter zurück zu seinem Kollegen, nur um festzustellen, dass dieser schon wieder dabei war, etwas in sein Handy zu tippen.
Er fragte sich, ob der offensichtlich vollkommen handyfixierte Dahlin überhaupt den Ernst der Lage begriff. Immerhin handelte es sich um einen Mordfall.
Seit Mikael im Dezernat für Gewaltverbrechen angefangen hatte, war er mental nicht in der Lage, sich mit sehr viel anderem als der Arbeit zu beschäftigen. In ihrem Dezernat waren sie für die schlimmsten Dinge zuständig, die ein Mensch einem anderen antun konnte: Gewalt, Vergewaltigung, Brandstiftung, Raub, Frauenhandel, Kindesmissbrauch und natürlich Mord. Das Leben eines anderen Menschen auszulöschen, war und blieb das ultimative Verbrechen. Die Sicherheit der Menschen in Dänemark basierte darauf, dass Menschen wie Frederik und Mikael ihr Äußerstes gaben. Insbesondere in den ersten entscheidenden Tagen. Ob Dahlin, dieser Wunderknabe mit seinem Colgate-Lächeln, das begriff?
Mikael ging hinüber zu drei Kollegen – zwei davon versierte Ermittler, der dritte ein Polizeischüler –, die mit je einem braunen Pappbecher dampfenden Kaffees beim Mannschaftswagen standen.
»Wir müssen uns unter sämtlichen Anwohnern in der Nachbarschaft umhören. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Wer fährt hier nachts durch die Gegend? Taxifahrer, ambulante Pflegedienste, Zeitungsausträger?«
Mikael erhielt mühelos die volle Aufmerksamkeit der drei Kollegen. Endlich ging es zur Sache, ihrer Meinung nach standen sie schon viel zu lange hier herum und warteten darauf, dass die Leichenschau überstanden war.
»Ich schlage vor, wir teilen uns auf«, sagte Mikael und bat die beiden Ermittler, sich die Wohneinheiten um die Trianglen-Kreuzung herum vorzunehmen, während er selbst mit dem Polizeischüler die dem Fundort gegenüberliegenden Wohnungen abklappern wollte.
Im Erdgeschoss des Gebäudes direkt gegenüber dem Tatort befand sich ein Netto, der zu dieser Zeit üblicherweise gut besucht war. Nun war er aufgrund der Polizeiarbeiten geschlossen, lediglich die unmittelbaren Anwohner durften über einen schmalen Fußgängerweg entlang der Hausmauer das Gebäude betreten und verlassen.
Mikael legte den Kopf in den Nacken und sah an dem hohen Klinkerbau hoch. Über dem Supermarkt waren sieben bewohnte Stockwerke.
»Lass uns oben anfangen«, sagte er zu dem Polizeischüler, der schweigend nickte.
Bevor sie die Straße überquerten, fiel Mikael im obersten Stock rechts eine reglos am Fenster stehende Gestalt auf, die zu ihnen nach unten starrte. Instinktiv hob Mikael die Hand zum Gruß, woraufhin die Gestalt zurückwich und die Jalousien herunterließ.
Mit ihm oder ihr mussten sie ein paar Worte wechseln. Jetzt sofort.
6
Die alte Haustür fiel schwer hinter Maria Just ins Schloss, während sie versuchte, sich zu beruhigen. Der Beinaheunfall steckte ihr noch in den Knochen.
In Sicherheit auf der anderen Seite der Kreuzung hatte sie zu dem Autofahrer zurückgeschaut. Ihre Blicke waren sich begegnet, und sie hatte einen gereckten Mittelfinger erwartet. Doch der Mann hatte sie nur ernst angesehen. Drei, vier lange Sekunden. Nicht wütend, sondern auf eine traurige und fürsorgliche Weise, die ihr ein schlechtes Gewissen bereitet hatte.
Mann, was für ein Morgen.
Einen Moment blieb sie still stehen und lauschte auf die Geräusche des alten Hauses. Das Gebäude des Polizeimuseums im Fælledvej im Stadtteil Nørrebro hatte bis ins Jahr 1977 die Polizeistation 6 beherbergt. Vor zehn Jahren war die rußgeschwärzte Fassade saniert und das Innere des Hauses mit den originalen Türen und den alten Böden sorgfältig instandgesetzt worden. Maria liebte den Klang der hallenden Schritte, wenn die Museumsbesucher die steinerne Treppe hinaufgingen. Man konnte sich lebhaft vorstellen, wie beklommen sich ein in Gewahrsam genommener Taschendieb oder Hochstapler vor einhundert Jahren gefühlt haben musste, wenn die Tür zur Freiheit mit einem markerschütternden Dröhnen hinter ihm ins Schloss fiel.
Maria warf einen Blick zum Schalter, aber von Pelle war, wie erwartet, nichts zu sehen. Pummel-Pelle, wie Bodil den studentischen Mitarbeiter ungeachtet jeglicher Political Correctness hinter dessen Rücken nannte, arbeitete nur dienstags, donnerstags und sonntags, wenn das Museum geöffnet hatte.
Maria stellte sicher, dass die Alarmanlage abgeschaltet war, ehe sie die Treppe hinauf in den bei den Besuchern beliebtesten Bereich des Museums ging: die Etage mit den True-Crime-Fällen, darunter der nicht für Kinder geeignete »Mordraum«.
Die Stelle im Museum war nicht Marias Traumjob gewesen. Und gleichzeitig doch. Denn wenn Bodil ihr zwischendurch erlaubte, sich nach bester Nerdmanier in die Schicksale der Kriminalgeschichte zu vertiefen, war Maria beinahe glücklich. Viele Besucher waren der Auffassung, die besonders grausamen, im Museum dokumentierten Verbrechen seien sinnlos. Doch Marias Aufgabe als Historikerin bestand eben darin, diesen Sinn zu finden. Natürlich konnte keine noch so gute Erklärung Mord, Gewalt, Missbrauch, Terroranschläge und Ähnliches mildern oder gar entschuldigen. Doch für den Täter oder die Täterin ergab das Verbrechen in dem Moment, in dem es begangen wurde, in aller Regel einen Sinn, und Maria war es wichtig zu versuchen, diese Rationalität zu verstehen. Nicht zu entschuldigen, aber zu verstehen.
Manchmal war ihre Arbeit ein bisschen so, als würde sie einen Krimi rückwärtslesen. In den meisten Fällen wusste sie von Anfang an, wer der Täter war. Ihr Job war es nun, der Nachwelt aufzuzeigen, weshalb der Täter oder die Täterin so gehandelt hatte, unter welchen Rahmenbedingungen er oder sie agiert und welche Bedeutung die Tat für die Nachwelt erlangt hatte.
Historische Verbrechen boten eine Flut an Informationen darüber, wie sich Dänemark und das Leben der Dänen im Laufe der Zeit entwickelt hatten. Vor Entstehung des Wohlfahrtsstaats gründeten die meisten Verbrechen in sozialer Not. In jüngeren Zeiten bewogen eher Eifersucht, verletztes Ehrgefühl, Machtgier, Habsucht und Rache die Menschen dazu, bis an die Grenzen zu gehen – und darüber hinaus. In der Erforschung dieser Motive fand Maria einen Sinn. Erst wenn man die Beweggründe des Täters wirklich verstand, bestand die Hoffnung, verhindern zu können, dass sich die Geschichte wiederholte.
Am Ende der Treppe wandte sich Maria nach links und schloss eine Tür mit dem Schild »Zugang verboten« auf, die zu den Büros des Museums führte.
Ein kleiner Seufzer entwich ihr, als sie einen Augenblick später in ihrem Büro aus dem Mantel schlüpfte. Keine Spur von Bodil, Standpauke abgewehrt. Sie konnte loslegen.
Ein Blick auf den Schreibtisch ließ sie stutzen. Es war jemand hier gewesen. Ihr Lieblingskaffeebecher – handgetöpfert in rosa Keramik – stand auf der Fensterbank. Sie war sich sicher, ihn auf einem Stapel Fallakten aus dem Keller abgestellt zu haben, bevor sie vor gut zwei Wochen in den Weihnachtsurlaub gegangen war. Jetzt hatte der Becher den Standort gewechselt, und die Ordner waren verschwunden.
Irritiert schaute Maria unter einem Stapel Papiere nach, aber da war nichts. Jemand musste die Akten weggenommen haben. Die Reinigungskraft kam kaum infrage. Und für einen Einbrecher gab es hier im Museum schwerlich etwas zu holen. Selbst an viel besuchten Tagen enthielt die Kasse kaum Bargeld, und die ausgestellten Schusswaffen waren unschädlich gemacht worden. Nein, jemand von Marias Kollegen, vielleicht sogar Bodil höchstselbst, musste in ihrem Büro gewesen sein. Dabei sollten die Mitarbeiter des Museums es eigentlich besser wissen.
Wenn ein Fall aufgeklärt wurde, gingen die Akten ans Polizeimuseum über, sofern der Fall von besonderem Interesse für die Nachwelt war. Die Asservate landeten im Keller des Museums.
Die ungeklärten Fälle wurden in einem Archivraum des Kopenhagener Polizeipräsidiums aufbewahrt, bis die zuständige Staatsanwaltschaft zu dem Schluss kam, dass ein Fall inzwischen so alt war, dass der Täter entweder verstorben oder über alle Berge war und es sinnlos erschien, weitere Ressourcen darauf zu verwenden. Auch diese Fälle wurden dann dem Polizeimuseum angeboten. Einige der Fallordner enthielten daher einzigartiges und unersetzbares Material der dänischen Polizeigeschichte: Originalfotografien des Tatorts oder des Toten, gesicherte Spuren oder die letzten Lebenszeichen von Opfern, die in manchen Fällen niemals Gerechtigkeit erfahren hatten. Aus Historikersicht war es eine Katastrophe, wenn solches Material verloren ging.