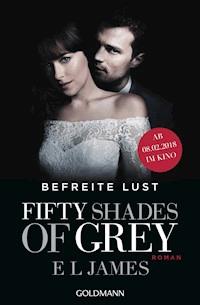Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotika-Reihe
- Sprache: Deutsch
Bronski treibt es mit seiner Halbschwester Kim, einer Halbblut, die aus einer Beziehung seines Vaters mit einer Japanerin stammt. Doch kreuzen auch andere Frauen seinen Weg – und schließlich seine Große Liebe.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert Seidler
Bronkis Herbst II
SAGA Egmont
Bronkis Herbst II
Copyright © 1996, 2018 Herbert Seidler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711717332
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Paul Bronski griff zur Whiskyflasche. Zum ersten Mal fiel dabei bewußt sein Blick auf das Etikett. Er stutzte, betrachtete es. Lebhaft stiegen Bilder der Erinnerung in ihm auf; Erinnerungen aus der Kindheit und Jugendzeit …
46 Jahre war er nun alt; seine Ehe mit Sabine war vor einigen Wochen geschieden worden. Es sei etwas Zerstörerisches in ihm, sie könne nicht mehr mit ihm leben, habe einen neuen Freund, Jonas.
Bronski ist am Ende. Ohne Sabine fühlt er sich vollkommen verlassen. Sein Freund wird mehr und mehr der Alkohol. Bald ist Bronski nicht mehr fähig, seiner Arbeit wie in den guten Jahren nachzugehen. Zusammen mit Frank hatte er eine Agentur gegründet. Frank mit seinem kaufmännischen Geschick und Bronski mit seinem künstlerischen Fotografenauge hatte sich als gutes Gespann erwiesen. Frank hatte es verstanden, die Agentur auszubauen, und gleichzeitig hatte Bronski seinen Ruf als wirklich ausgezeichneter Fotograf gefestigt. Mode, Autos, Werbung …: Bronski hatte alles mit der ihm eigenen Intensität fotografiert.
Und wenn Frank das große Büro an der Alster verließ, freute er sich auf seine von starken ethischen Grundsätzen geleitete Frau Marlene und seine beiden Töchter. Er hatte es zu etwas gebracht.
Bronski dagegen hat auf großem Fuß gelebt und zudem viel Geld am Roulettetisch verloren; sehr zum Leidwesen von Sabine.
Seit sie nun zu Jonas gezogen war, irrte Bronski oft ziellos umher, zog von einer Kneipe in die andere. Zwar hatte er noch einen jüngeren verheirateten Bruder und eine zwanzig Jahre jüngere Halbschwester; doch die Verbindung zu Ralf und Kim waren sehr vage.
In einer Kneipe wird Paul Bronski von Dieter angesprochen. Er läßt sich von ihm zu einer Party mitnehmen: Professor Oskar, immer von drei Knaben umgeben, feiert seinen 60. Geburtstag in großem Stil. Schnell stellt Paul fest, daß er in eine reine Männergesellschaft geraten ist; die einzige Frau, Martina, ist ein Zwitter. Fluchtartig verläßt er die Orgie – und landet in einer Disco.
Ein Import-Export-Kaufmann aus Nigeria, der 35jährige Isaak, und seine schwarze Freundin laden Bronski zu sich ein. Das intime Zusammensein mit der wunderschönen 27jährigen Studentin Naomi und ihrem Landsmann Isaak in ihrer nach afrikanischem Stil eingerichteten Wohnung und die Klänge afrikanischer Musik ließen Bronski nie mehr los. Vor allem hatte er immer wieder das Verlangen nach Isaak. Naomi und Paul treffen sich öfter, verlieben sich mehr und mehr. Paul möchte eine feste Bindung, kann aber Naomis Plänen von Heirat, Kindern, beruflicher Tätigkeit der beiden in Nigeria und einem Leben dort in Luxus nichts abgewinnen, muß sie schließlich schweren Herzens ablehnen.
Nach einer telefonischen Eifersuchtsszene mit Naomi – er will sie nicht mit Isaak teilen, sie nur bei sich haben –, flüchtet er wieder in eine Bar, lernt dort Max kennen, der bisexuell ist. Durch den Verkehr mit Max wird Bronski klar, daß das sexuelle Berührenwollen eines männlichen Körpers stärker bei ihm ausgeprägt war, als er bisher angenommen hat.
Und immer wieder muß er an Sabine denken: solange er mit ihr zusammen war, hatte es das nicht gegeben. Es ärgert ihn, ist ihm zuwider, sich charakterliches Versagen eingestehen zu müssen, Versagen, das sich in letzter Zeit gehäuft hat.
Noch einmal trifft er sich auf Naomis Initiative hin mit ihr. Er ist voll Erwartung, denkt an einen Sinneswandel Naomis: sie wird doch zu ihm ziehen. Voll Liebe empfängt er sie. Sie teilt ihm ihren Entschluß mit: „Paul, meine Gefühle für dich werden von Woche zu Woche stärker. Das ist aber nur dann eine Voraussetzung für eine gute Partnerschaft, wenn der andere Partner ein ähnlich starkes Gefühl entgegenbringt. Aber in dir ist etwas Zerstörerisches …“Sie verläßt ihn endgültig.
Paul Bronski ist außer sich. Voll Verzweiflung fährt er zur „Kate“ und trifft Max …
Wieder hat er nach dem Zusammensein mit ihm nur das Gefühl der Leere, nicht das heitere beschwingte Gefühl, das er nach einem intimen Zusammensein mit einer Frau hat. Ist Max nur ein Medium; will er nur Naomi und Enttäuschung und Schmerz vergessen?
Und Bronski trinkt und trinkt; zieht von einem Lokal ins andere, Tag und Nacht. Es kommt zum Kollaps.
Im Krankenhaus und später zuhause hat er Halluzinationen. Ein Greis mit schlohweißem Haar spricht immer wieder auf ihn ein: „Nicht wahr, Paul Bronski, du hast keine Freude mehr am Leben! Deine Gefühlswelt ist ein einziges Tohuwabohu! Du haderst mit dem Schicksal und gibst ihm die Schuld! Dabei hast du vergessen, daß du deines Glückes Schmied bist. Hol dir neue Kraft, Bronski!“
„Es gibt Tage, Paul Bronski, da verzweifelt selbst der Teufel. Doch diese Tage ziehen vorüber wie dunkle Gewitterwolken am Himmel. Geh deinen Weg, Paul Bronski!“
Neue Kraft für den Weg, woher sollte er sie nehmen? Bislang hat er sie immer aus der Whiskyflasche geholt …
Auf dem Bild des Flaschenetiketts waren zwei Pferde zu erkennen, ein weißes und ein braunes. Sie standen mit hocherhobenen Köpfen an einem Koppelzaun. Ihre Mähnen schienen vom Wind bewegt, standen teilweise etwas ab von ihren schlanken Hälsen. Konzentriert blickten sie in eine Richtung, so, als habe etwas ihre Neugier geweckt oder als erwarteten sie jemanden. Im Hintergrund sah man die Silhouette eines Gebäudes. Wahrscheinlich ein Farmhaus. Daneben standen Büsche und Bäume.
Dieses Bild schlug eine Saite in Paul Bronski an, die er längst verschüttet glaubte, der er seit langem keine Bedeutung mehr beimaß.
Bronskis Blick haftete auf diesem unscheinbaren Bild, seine Augen wurden größer, vertieften sich in dieses Bild, und er sah einen Jungen, einen Jungen, der über eine Wiese lief.
Der Junge kam vom Fluß. Er hatte dort gebadet. Der Fluß war an dieser Stelle ruhig, floß träge dahin. Erst ein paar Kilometer oberhalb dieses Platzes nahm die Strömung zu, wurde schneller, wies auch einige Strudel auf. Doch hier konnte man unbesorgt planschen, mußte nur darauf achten, sich nicht zu weit vom Ufer zu entfernen, da das Wasser abrupt tiefer wurde. Der Junge wollte versuchen, noch diesen Sommer schwimmen zu lernen. Sein Vater hatte zuwenig Zeit, es ihm beizubringen, so mühte er sich selber. Mit Paddeln und Strampeln, den Kopf möglichst weit aus dem Wasser gereckt, um ja nichts zu schlucken, brachte er es schon auf runde zehn Meter. Fünf hinein in den Fluß, fünf zurück ans Ufer. Sein Freund Jan war genausogut. Vielleicht würden sie es auch in diesem Jahr schaffen, den Fluß zu überqueren. Der Fluß war an dieser Stelle zwanzig Meter breit. Die älteren Jungs aus dem Dorf feuerten sie jedenfalls immer an, je weiter sie zur Mitte des Flusses kamen.
Ungern hatte er den Fluß und die anderen verlassen, doch seine Mutter würde schimpfen, käme er zu spät zum Kaffee. Es war Sonntag. Der einzige Tag in der Woche, an dem auch sein Vater zu Hause war. Sein Vater war Handelsvertreter in Sachen Landmaschinen und Maschinenbauteilen und reiste die ganze Woche umher. Er hatte einen großen Bezirk zu betreuen, was ihn dazu zwang, außerhalb zu nächtigen. Meistens traf er Samstag nachmittag erst wieder ein. Mutter wollte sie deshalb zu den Mahlzeiten immer zusammen wissen.
Der Junge stockte. Er vernahm das Trällern einer Lerche, konnte sie aber nirgendwo ausmachen. Er legte sich ins Gras, spähte in den blauen Himmel. So endlos fern erschien ihm dieses Blau. Kleine Schäfchenwolken trieben am Horizont.
Mit scharfen Blicken versuchte der Junge, den Vogel zu erkennen. Doch es gelang ihm nicht.
Vielleicht hatte sich der Sänger hinter einem der Wölkchen versteckt, um nicht gestört zu werden? Wie mochte es da oben wohl sein? Manchmal sah er ein Flugzeug als dunklen Punkt am Himmel. Erstaunlich, daß es nicht abstürzte, konnte es doch seine Flügel nicht bewegen. Er blieb noch einen Augenblick liegen, vernahm das Summen der Bienen, roch den Duft des Grases. Man würde es bald mähen. Später dann durfte er mit der Magd oder dem Knecht auf dem Heuwagen stehen, das hochgeworfene, trockene Gras verteilen und festtreten. Er half gerne, hatten sie doch meistens auch Spaß dabei.
Der Junge stand auf, setzte seinen Weg fort, vorbei an grasenden Kühen und Pferden, hatten doch auch sie heute Ruhetag, würden erst am Abend in die Ställe getrieben werden.
Ich werde Mutter fragen, ob ich dabei sein darf. Sein Vater, gutmütig und großzügig, würde bestimmt keine Einwände haben. Er war auch einverstanden gewesen, als er sehr früh heute morgen aufgestanden war, um angeln zu gehen. Es gab da eine bestimmte Stelle am Fluß, die kannten nur er und Jan. Dort bissen fast immer Fische an. Etwa zwei Kilometer von ihrem Badeplatz entfernt. Er war dort mit Jan verabredet gewesen.
Ein wirklich guter Ort. Von außen nicht einzusehen. Das Gebüsch grenzte direkt ans Ufer. Hohe, alte Bäume reckten ihre Äste gen Himmel. Dahinter begannen die Äcker und Wiesen. Ein schmaler Schilfgürtel erstreckte sich am Ufer, bot Schutz für Käfer, Spinnen, Vögel und Fische, die zwischen den Schilfhalmen schwammen. Aber auch die verdammten Stechmücken bevorzugten diesen Ort, wurden jedoch erst mit zunehmender Wärme aktiv.
Noch war die Sonne nicht aufgegangen. Ein leichter Dunstschleier stand am Horizont. Nebelschwaden zogen über den Fluß. Es war vollkommen still. Kein Vogel schickte seinen Gesang über das Wasser und die taubenetzten Wiesen. Nicht einmal der Wind ließ die Blätter der Pappeln wispern.
Doch es konnte nicht mehr lange dauern, bis die Natur vollends erwachen und die Luft mit neuem Leben erfüllen würde. Die Sonne würde aufgehen und ihre wärmenden Strahlen über das Land senken. Da, was war das? Ein leises, kaum wahrnehmbares Rascheln ließ den Jungen ins Schilf blicken. Ein schwarzer Schatten huschte durchs Wasser, verschwand in der Uferböschung. Eine große Maus? Nein, eine Ratte, eine Bisamratte mußte es gewesen sein.
Es gab da einen Platz am Ufer, der ohne Schilfbewuchs war. Das sandige Ufer, eine Art kleine Landzunge, ragte hier in den Fluß. Auf einem ihrer Streifzüge hatten sie diese Stelle entdeckt. Der Junge hockte sich auf seine Hacken, entnahm der mitgebrachten Dose einen Wurm, spießte ihn auf den Haken. Er holte aus, warf ihn, so weit es ihm möglich war, in den Fluß.
Sein Vater hatte ihm die Angel vor einigen Monaten zu seinem achten Geburtstag geschenkt. Im Frühjahr dann, hatte er ihm gezeigt, wie man sie handhabt.
Der Junge sah über den Fluß. Die aufgehende Sonne vertrieb die Dunstschleier. Die Nebelschwaden über dem Wasser lösten sich auf, gaben den Blick frei auf das jenseitige Ufer. Eine Taube schwirrte aus dem Geäst einer Weide. Die Sonne stieg höher. Ihr grelles Licht spiegelte sich im Wasser, ließ für Augenblicke den Fluß wie einen Goldstrom schimmern. Glänzend und glitzernd brachen sich die Strahlen im Wasser, verschwanden, um Sekunden später an anderer Stelle wieder aufzuflammen, ihr Spiel zu wiederholen. Es würde wieder heiß werden heute.
Der Junge wartete an diesem Morgen vergeblich. Vergeblich darauf, daß ein Fisch anbiß, vergeblich, daß sein Freund Jan eintraf. Der hatte entweder verschlafen oder wieder einmal Stubenarrest bekommen.
Der Junge schreckte aus seinen Gedanken. Er war in einen Kuhfladen getreten. Der dicke, grüne Brei quoll durch seine nackten Zehen. Er fuhr sich mit den Fingern durch sein kurzes, blondes Haar, schimpfte. Nun, im Garten hinter der Scheune gab es eine Pumpe, dort würde er seinen Fuß wieder säubern. Er wischte das Gröbste mit Gras ab, überquerte dann mit eiligen Schritten die Weide, schob sich unter dem Stacheldrahtzaun hindurch und stand auf einem staubtrockenen, rissigen Feldweg. Er sprang über einen schmalen, ausgetrockneten Graben, dessen Ränder mit Disteln und Brennesseln bewachsen waren. Einmal war er weggerutscht und in diesen stechenden und brennenden Pflanzen gelandet. Noch Tage später schmerzte und brannte die Haut auf Armen und Beinen.
Der Junge stand an der knapp mannshohen Mauer, die das hintere Gelände des Hofes abgrenzte. Er legte die Hände auf die Mauerkante, trat in eine Spalte, drückte sich hoch. Er setzte sich auf die Mauer, warf noch einen Blick zurück auf die große Weide, das grasende Vieh, die angrenzenden Weizenfelder mit ihren leuchtend roten Mohnblumen.
Die goldgelben Halme wogten im leichten Sommerwind. Dahinter erkannte er das dunkle Grün der Uferböschung.
Der Junge lauschte Richtung Dorf. Kein Laut war zu vernehmen. Dieser Hof, auf dem seine Familie lebte, lag am Rande des Dorfes. Sonst tönte das Geschrei fußballspielender Jungen vom Dorfplatz bis hierher. Doch heute herrschte Ruhe. Kein Pferdefuhrwerk rumpelte über die holprige Dorfstraße, keiner dieser noch seltenen Traktoren ratterte durch den Ort. Nur die sommerliche Hitze dieses Nachmittags lastete auf den Häusern, den Höfen, den stillen Gärten, den wenigen Straßen.
Der Junge ließ sich auf der anderen Seite der Mauer hinab, lief vorbei am weiten Gehege der Hühner, Gänse und Enten, die leise gurrend und schnatternd nach Käfern, Würmern, Wurzeln und Gräsern pickten. Einige suchten Kühlung im kleinen Teich am anderen Ende des Geheges. Er lief vorbei an Kirsch-, Birnen- und Apfelbäumen, deren Früchte bald geerntet werden konnten. Er lief vorbei an Johannisund Stachelbeersträuchern, an Erdbeer- und Gurkenstauden, deren Früchte in Reife standen.
Der Junge erreichte die Rückwand der Scheune. Unter einem alten Nußbaum stand die Pumpe. Sie holte das Wasser aus einem Brunnen, dessen Öffnung von einer kleinen, runden Mauer aus Ziegelsteinen umgeben war. Verwitterte Holzbohlen lagen quer auf dem Mauerrand.
Der Junge betätigte den Pumpenschwengel, hielt seine mageren, gebräunten Beine in das ausströmende Wasser, reinigte sorgfältig seinen kotbeschmierten Fuß. Ein staubiger Stoffetzen, der auf den Bohlen lag, diente als Handtuch. Dann schob er den verrutschten Hosenträger wieder auf die Schulter. Er verließ den Obstgarten durch eine mit Maschendraht bespannte Holzpforte, achtete darauf, daß sie verschlossen war, damit kein Geflügel eindringen konnte. Vorbei an der Seitenwand der Scheune erreichte er den Hof. Auch hier war es still. Über dem Misthaufen in der Mitte des Hofes tanzten Fliegen. Rechts an der Begrenzungsmauer zur Straße stand eine uralte knorrige Kastanie, deren Äste weit in den Hof und auf die Straße hinausragten.
Links neben dem Jungen unter dem verlängerten Dach der Scheune sah man Ackerwagen und eine klapprige Kutsche, die bald in einer Ecke der Scheune verschwinden sollte. Die Ställe für das Vieh und das hohe einstöckige Wohnhaus schlossen sich rechtwinklig an. Am Ende des Scheunendaches, direkt am Stallgebäude, befand sich die Hundehütte. Müde lag der große, zottelige Hofhund im Schatten des Daches, zu faul sogar, sich die krabbelnden Fliegen von der Schnauze zu wischen.
Der Junge ging über den Hof auf einen Seiteneingang des Wohnhauses zu. Er warf noch einen schnellen Blick auf den Hund, doch dieser blinzelte nur schläfrig, wedelte noch nicht einmal mit dem Schwanz. Zu sehr machte ihm die Hitze zu schaffen. An Spielen war nicht zu denken. Neben dem Seiteneingang zwischen Stall und Wohnung stand eine Bank, drei Meter weiter ein niedriger Geräteschuppen aus Holz.
Auf der Bank saß ein dürrer, alter Mann. Zum Schutz gegen die Sonne hatte er seine farblose verwaschene Schiffermütze tief über die Augen gezogen. In seinem faltenreichen Mund steckte eine kurze, vollkommen zerkratzte Pfeife, die er geschickt mit den ihm verbliebenen Zahnstummeln hielt. Seine Hände stützte er auf einen selbstgeschnitzten Krückstock. Er rührte sich nicht, als der Junge sich neben ihn setzte. Eine Weile schmatzte der Knecht an seinem Pfeifenstiel. Brauner Saft tropfte auf sein verblichenes Arbeitshemd. Auf dem Boden neben der Bank stand eine halbvolle Flasche Malzbier. Der Alte liebte Malzbier über alles. Malzbier und Virginia-Tabak. Immer, wenn es ihm möglich war, brachte sein Vater dem alten Mann Virginia-Tabak mit. Dann erhellte ein Leuchten dieses eingefallene, runzelige Gesicht. Der Krieg hatte sie hierher verschlagen. Die Eltern des Jungen kamen als Flüchtlinge, der kleine, alte Mann kam als Kriegsgefangener, der dann später als freier Knecht hierblieb.
Er ist ein harmloser Dummbatz, hatte die Bäuerin immer gesagt, wenn der Knecht wieder mal unbegründeterweise vor sich hinkicherte. Ein Granatsplitter hatte ihm sein Gehirn angekratzt. Aber er tat keinem etwas und arbeitete ganz ordentlich.
Nun, seit gut einem Jahr, war es vorbei mit dem ordentlichen Arbeiten. Eine Pflugschar fuhr dem Knecht in einem unachtsamen Augenblick in den Fuß, machte ihn zum Invaliden. Seitdem verrichtete er nur noch leichtere Arbeiten. Nun war da nur noch die Magd, die fast für zwei arbeiten mußte, denn der halbwüchsige Sohn des Bauern konnte wegen seiner Schulausbildung nicht voll eingesetzt werden. Die Magd allerdings wollte demnächst heiraten und den Hof verlassen. Es war zur Zeit schon eine vertrackte Situation für den geplagten Bauern.
„Na, Junge, warst du wieder am Fluß?“
Der Knecht nuckelte weiter an seiner erkalteten Pfeife, seine kleinen Augen blinzelten. Der Junge hatte schon immer gewußt, der Alte war kein Dummbatz. Was die Bäuerin da bloß für einen Unsinn redete.
„Ja, Josef, vielleicht schwimm ich diesen Sommer noch ’rüber.“
„Du weißt, daß du achtgeben mußt, nicht wahr? Der Fluß kann gefährlich werden. Hab ich dir schon die Geschichte …?“
Und dann erzählte er wieder einmal von seiner Heimat, jenem fernen Land, von dem der Junge meinte, es müsse soweit weg sein, daß es das vielleicht gar nicht gab. Er erzählte von seinen Leuten, der kleinen Dorfgemeinschaft, seiner Arbeit auf den Feldern und den Flußkähnen. Er erzählte von heißen Sommern und bitterkalten Wintern, wenn der Frost durch Türritzen und undichte Fenster in ihre kleinen Steinhäuser drang, das Feuer ausgegangen war und sie sich, vor Kälte zitternd, tiefer in ihre Strohsäcke gedrückt hatten. Aber er erzählte auch von lauten Festen, singenden, fröhlichen Menschen und Schnaps, der in Strömen floß.
Und dann waren sie gekommen, waren plötzlich da, spuckten Tod und Verderben. Zuerst aus der Luft, dann aus den Rohren ihrer Panzer. Gnadenlos zerfetzten sie das Dorf, die schreienden Menschen. Den Rest erledigten die Soldaten. Alle Arbeitsfähigen wurden aussortiert, die Übriggebliebenen erschossen. Alter und Geschlecht spielten keine Rolle. Dann rollten sie aus dem Ort, um ihren Vernichtungsfeldzug fortzusetzen.
„Sie sind alle tot. Verstehst du das, Junge?“
Tränen liefen dem alten Knecht über die mageren Wangen. Der Junge nickte.
„Meine ganze Familie ist tot, erschossen. Ich habe niemanden mehr.“
Tränen rannen weiter über sein Gesicht. Das Kinn lag auf der Brust. Die Mütze rutschte vom kahlen Schädel noch tiefer ins Gesicht. Seine knochige, verarbeitete Hand umklammerte die Pfeife, suchte nach Halt.
„Du mußt nicht weinen, Josef.“
Der Junge berührte den Arm des Alten, drückte ihn.
„Es ist niemand mehr da. Ich bin alt und verbraucht. Ich will jetzt auch sterben.“
Die Stimme Josefs klang brüchig, leise und traurig.
„Warum willst du sterben, Josef?“
Der Junge sah ihn an, sah auf die Pfeife in der faltigen Hand, sah auf die schiefsitzende Mütze des ausgemergelten Kopfes. Sein Vater hatte einmal scherzhaft gesagt, der alte Josef hat Mütze und Pfeife wohl über die Jahrhundertwende gerettet.
„Weil ich keine Freude mehr habe, Junge.“
„Will man dann sterben, Josef, nur weil man keine Freude mehr hat?“
„Manchmal, Junge, manchmal will man dann sterben.“
Sie schwiegen. Der dürre, alte Mann und der magere Junge saßen auf der Bank in der Sonne und schwiegen. Der Junge malte mit seinem großen Zeh Kreise auf den Boden. Staub wirbelte auf, verflüchtigte sich wieder. Die Glocke der kleinen Dorfkapelle schlug viermal.
„Ich muß jetzt gehen, Josef. Meine Eltern warten.“ Der Junge erhob sich.
„Ja, Junge, geh nur.“
Der alte Knecht schob sich wieder die Pfeife in den Mund. Als der Junge in die Stube trat, stand sein Vater am Fenster. Die Mutter hatte gerade den Tisch gedeckt, sein vierjähriger Bruder hockte auf dem Teppich und spielte mit seinen Bauklötzen.
„Der Josef hat gesagt, daß er sterben will. Glaubst du das, Papa?“
Sein Vater, ein mittelgroßer, kräftiger Mann mit dunkelblonden Haaren, drehte sich um. Seine hellen Augen blickten ernst und ruhig in das Gesicht des Jungen.
„Ja, Paul, ich glaube es.“
„Laßt dieses Thema. Es ist zu früh dafür. Geh dir die Hände waschen, Paul.“
Der Junge sah in das hübsche Gesicht seiner Mutter, suchte den Blick ihrer dunklen Augen.
„Aber er hat es gesagt, Mama.“
„Sicher hat er es gesagt. Und er meint es bestimmt auch so. Aber ich will jetzt nichts mehr davon hören.“ Sie griff zur Kanne, schenkte Kaffee ein.
Zwei Wochen vor Weihnachten starb Josef. Sie fanden ihn vormittags in seiner kalten Kammer neben dem Pferdestall. Ein Lächeln lag auf seinen eingefallenen Zügen. Er war dem Erdendasein entronnen. Sein Leben in der Heimat als Landarbeiter und Flußschiffer war hart gewesen, der Krieg hatte ihn ausgezehrt, seine Seele zerstört und die Arbeit hier auf dem Hof war auch nicht gerade ein Honigschlecken gewesen.
Nun war der alte Knecht tot. Nichts konnte ihn mehr quälen.
Als sie ihn in einem schmucklosen einfachen Holzsarg aus dem Haus trugen, stand der Junge in der Tür und weinte.
Der Totengräber und sein Gehilfe fluchten. Es wäre ihnen lieber gewesen, der Alte wäre im Frühling gestorben. Es war Schwerstarbeit, den gefrorenen Boden aufzuhacken. Und wer, zum Teufel, schätzte schon Knochenarbeit.
Die Todesschreie des Schweines zerschnitten die dunkle morgendliche Stille, gellten über den Hof, verklangen im Dorf.
Der Junge hockte am Fenster, hauchte gegen die zugefrorene Scheibe, kratzte ein Loch in die Frostblumen.
„Was ist das, Paul, ich hab’ Angst.“
Pauls kleiner Bruder lugte unter der Bettdecke hervor, versuchte, mit den Augen das Dunkel des Zimmers zu durchdringen.
„Du brauchst keine Angst zu haben, Ralfi. Es ist nur das Schwein. Es wird geschlachtet. Du weißt schon, wie letztes Jahr. Kriech unter die Decke und schlaf weiter.“
Beruhigt von den Worten seines Bruders, daß kein Geist im Zimmer war, der ihn holen wollte, tat Ralfi wie ihm geheißen und zog sich die Decke über den Kopf.
Paul spähte durch das Loch auf den Hof. Es mußte die Nacht über geschneit haben. Eine dicke Schneedecke bedeckte den Hof, den kahlen Kastanienbaum, die umliegenden Dächer und den Misthaufen. Der Schlachter und der Bauer zerrten an einem kurzen Strick, der um den dicken Hals des Tieres geschlungen war. Am Hinterteil des Schweines hielt die Bäuerin den Kringelschwanz in einer Hand, schob und drückte das sich sperrende Tier in Richtung Schlachtbank. Die große, starke Sau ahnte ihr Ende, stemmte ihre Füße in den Schnee, versuchte, ihren Tod hinauszuzögern, ja, vielleicht sogar ihm zu entgehen. Doch sie fand keinen Halt auf dieser rutschigen, weißen Fläche. Unter Flüchen und Schimpfen trieb man sie erbarmungslos zur Schlachtbank. Aus der offenen Stalltür fiel Licht in den Hof. An einem nahestehenden Stützpfosten des Scheunendaches hatte man eine große Lampe gehängt, deren Schein den Schlachtplatz ausleuchtete.
Das Schwein kam neben der Bank zum Stehen. Noch immer hallten seine Schreie durch den langsam anbrechenden Morgen. Der Junge sah, wie der Schlachter nach einem bereitliegenden Bolzenschußgerät griff. Er setzte den kurzen Lauf an die Stirn des Tieres und drückte ab. Plötzlich herrschte Totenstille. Der Junge wußte nicht, ob das Tier tot oder nur betäubt war. Die Sau brach zusammen. Unter Zuhilfenahme von Stricken wurde sie auf die Bank gehievt.
Mit einem langen, scharfen Messer schnitt der Schlachter dem Schwein den Hals auf. Der Kopf des Tieres sackte zurück. Ein dicker, dampfender Strahl dunkelroten Blutes ergoß sich in einen bereitgestellten Bottich. Das Blut spritzte gegen die dicke, graue Gummischürze des Schlachters, hinterließ schwarze Rinnsale beim Herablaufen, tropfte dann in den zerstampften Schnee.
War das Blut ausgelaufen, würde man das Schwein in einen breiten Holztrog mit kochendem Wasser legen. Hier würde es „aufgeweicht“ werden, damit sich die Borsten leichter abschaben ließen.
Später dann würde es an den Hinterbeinen aufgehängt, aufgeschlitzt und ausgenommen werden.
Der Junge empfand nichts, als er das Blut aus dem toten Körper des Tieres strömen sah. Da war kein Schmerz, kein Bedauern, kein Mitleid, nur Neugier, was weiter geschehen würde. Anders als zu Pferden, kleinen Kälbern, Katzen und vor allem seinem Lieblingstier Hasso, dem großen, zotteligen Hofhund, hatte er zu Schweinen keine innere Beziehung. Bei Hühnern und Gänsen war es ähnlich. Er war jetzt zehn, dachte nicht weiter darüber nach. Warum auch, es war einfach so. Er freute sich schon auf die Leberwürste und Koteletts, die seine Familie jedesmal nach dem Schlachten von der Bäuerin geschenkt bekam. Die Leberwurst aß er besonders gern.
Noch einmal sah der Junge auf die gespenstisch anmutende Szene im Hof. Das ausgeblutete Schwein wurde gerade in den Trog mit kochendem Wasser gerollt.
Fest drückte der Junge sein Auge auf die breite Ritze zwischen den Bohlen der Holztür. Er versuchte den Atem anzuhalten, befürchtete, Frieda könnte ihn hören. Sie stand nackt unter der Lampe ihrer Kammer und wusch sich. Der Junge sah ihr pralles Hinterteil, diese festen runden Arschbacken. Jetzt machte sie eine halbe Drehung, tauchte ihre Hand in das Wasser der Emailleschüssel. Die Augen des Jungen wurden größer, sein Atem ging schneller.