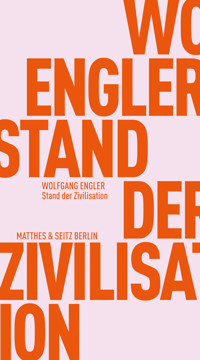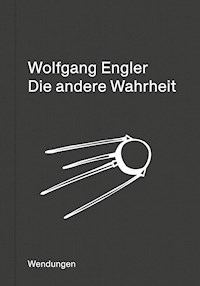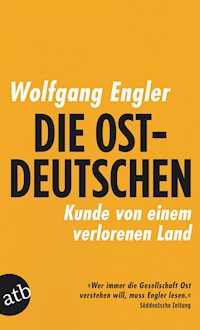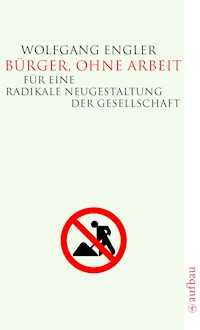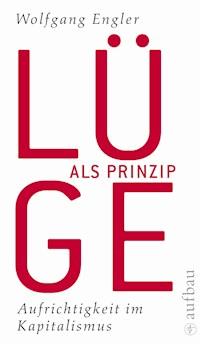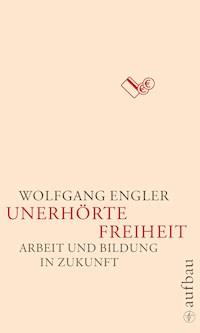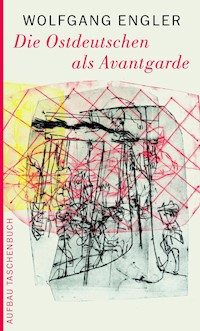15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Engler hat die ostdeutsche Seelenverfassung wie kein Zweiter erforscht.Nun erscheint das persönlichste Buch des großen ostdeutschen Soziologen: Unverwechselbar im Ton, spielerisch, ohne an analytischer Schärfe zu verlieren.
Mit Blick auf die gegenwärtigen Erosionen der deutschen Gesellschaft und nach einer eigenen tiefen inneren Krise schreibt der Soziologe Wolfgang Engler sein persönlichstes Buch. Mit großer Offenheit und Radikalität legt er Zeugnis ab, wie es kaum jemand seiner Generation und Herkunft bislang in Deutschland getan hat. Orientierung sind dabei vor allem die Bücher französischer Autoren der letzten Jahre. Édouard Louis, Didier Eribon und Annie Ernaux – ihre Schilderungen über Klassen- und Lagerwechsel, soziale Verwerfungen und politische Einschnitte sind Engler Wegmarken, anhand derer er seinen eigenen Lebensweg und den der Gesellschaft, aus der er kam und in die er ging, erzählt.
»Was Didier Eribon für Édouard Louis war, war Wolfgang Engler für mich.«Thomas Ostermeier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Manch einen mag verstören, was ich schreibe, auf welche Weise ich Zeugnis ablege, Erinnerungen nachgehe. Sie drängten an die Oberfläche, nach vielen Jahren, ohne dass ich wusste, warum. Die innere Krise, in der ich mich befand, führte mich wohl in Regionen, denen ich lange ausgewichen war. Ich selbst bin überrascht von der gelegentlichen Härte des Urteils mir selbst gegenüber. Dennoch ist sie Teil eines Erkenntnisdrangs, der mich in meiner Arbeit mein ganzes Leben begleitet hat. Im Grunde war er der Kern, stand ab einem bestimmten Zeitpunkt im Zentrum meines Lebens.«
Aus dem ersten Kapitel »Ein Schlag ins Gesicht«
Über Wolfgang Engler
Wolfgang Engler, geboren 1952 in Dresden, Soziologe und langjähriger Dozent an der Schauspielhochschule »Ernst Busch« in Berlin, von 2005 bis 2017 dort Rektor. Bei Aufbau erschienen »Unerhörte Freiheit. Arbeit und Bildung in Zukunft«, »Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land«, »Die Ostdeutschen als Avantgarde« und »Bürger, ohne Arbeit. Für eine radikale Neugestaltung der Gesellschaft«. Zuletzt, zusammen mit Jana Hensel, »Wer wir sind. Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein«. Er lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wolfgang Engler
Brüche
Ein ostdeutsches Leben
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Ein Schlag ins Gesicht
Zweierlei Aufstieg
Unter werktätigen Menschen
Ende der Naivität
Seitenwechsel
Der Bruch
Selbstgespräch
Scham
Wiener Lektionen
Polnischer August
Kältezone
Wärmezone
Hinter die Gesellschaft führt kein Weg zurück
Unter der Elite von morgen
Nachtrag für die Zukunft
Wachsamkeit
Kriege
Kurze Geschichte meines Rektorats
Nach uns
Anmerkungen
Ein Schlag ins Gesicht
Zweierlei Aufstieg
Unter werktätigen Menschen
Ende der Naivität
Seitenwechsel
Der Bruch
Selbstgespräch
Scham
Wiener Lektionen
Kältezone
Wärmezone
Hinter die Gesellschaft führt kein Weg zurück
Unter der Elite von morgen
Nachtrag für die Zukunft
Wachsamkeit
Kriege
Kurze Geschichte meines Rektorats
Nach uns
Danksagung
Impressum
Ein Schlag ins Gesicht
Einmal, ich ging noch zur Schule, in die achte oder neunte Klasse, bestahl ich eine Mitschülerin. Sie hatte ihrer Banknachbarin ein aus dem Westen nach Ostberlin eingeschmuggeltes Heft der Jugendzeitschrift Bravo gezeigt, ich saß eine Reihe hinter ihr und beobachtete das. Neid packte mich, allein wegen der großformatigen Poster von Bands, die ich verehrte. In der großen Pause entnahm ich das Begehrte ihrem Schulranzen und verstaute es in meinem. Sie bemerkte den Diebstahl sofort nach ihrer Rückkehr. Um jeden Verdacht von mir abzulenken, murmelte ich den Namen eines Mitschülers, den ich obendrein zu meinen engeren Freunden zählte. Eine gleich doppelte Verfehlung des Jugendlichen, der ich war. Eine Taschenkontrolle unter Aufsicht des Lehrers hätte Klarheit geschaffen. Aber dazu kam es nicht. Schließlich handelte es sich bei der Zeitschrift um Konterbande aus dem Westen. So kam ich unentdeckt davon.
Etwa um dieselbe Zeit, ich war fünfzehn, sechzehn Jahre alt, begannen meine Raubzüge, 1967, 68, in den gerade neu eröffneten Kaufhallen. Zusammen mit drei anderen klaute ich Zigaretten, die wir uns, mehrheitlich Arbeiterkinder vom Prenzlauer Berg, von unserem eng bemessenen Taschengeld nicht leisten konnten. Das ging eine Weile gut, dann flogen wir auf. Die Polizei erschien, wir kamen aufs Revier, die Eltern wurden verständigt und holten uns ab, wobei es, dem damaligen Stand der Erziehungssitten entsprechend, einigermaßen ruppig zuging. Tags darauf tauschten wir in der Schule aus, was uns daheim an Ärger widerfahren war. Am meisten ärgerten wir uns über uns selbst, unsere Ungeschicklichkeit, und dass man uns nun eine Zeit lang die »Bezüge« kürzen würde; dumm gelaufen. Die häusliche Lektion tat ihre Wirkung, um verschärften Konsequenzen zu entgehen, ließen wir von weiteren Beutezügen ab.
Ich war mir beide Male der Tatsache wohl bewusst, eine soziale Norm zu übertreten, schon, als ich den Vorsatz dazu fasste, hatte ich ein mulmiges Gefühl, das sich jedoch nur im ersten Fall zu echten Gewissensbissen steigerte. Zigaretten klauen war damals so etwas wie ein Kavaliersdelikt, das taten viele in meinem Alter. Auch gehörte das Diebesgut ja niemandem konkret, keiner litt persönlich Schaden. Und so machte ich, wie die drei anderen auch, kein Geheimnis aus der Angelegenheit, ließ mich sogar bedauern.
Mein Griff in die Tasche der Klassenkameradin löste weit stärkere Gefühle in mir aus. Mein Opfer hatte ein Gesicht, war eine von uns, seit Schulbeginn. Indem ich Hand an etwas legte, das ihr gehörte, überschritt ich eine allseits bewachte Grenze und riskierte meinen Ruf im Klassenverband. Das konnte schlimme Folgen haben, dauerhafte. Aber etwas beunruhigte mich in noch höherem Grade. Um meine Tat zu vertuschen, belastete ich einen Freund, setzte seine Freundschaft aufs Spiel. Wie konnte das geschehen? Wer war ich in diesem Augenblick? Schließlich überfiel es mich wie eine Offenbarung: In mir steckte einer, dem man nicht trauen konnte, dem ich nicht trauen konnte. Ich erschrak vor mir selbst, memorierte meinen Verrat: »Ich glaube, es war J.« Ich konnte das nicht von mir abtun, mich damit aber auch nicht identifizieren. Ratlos spürte ich, wie sich ein Gefühl mit derselben Plötzlichkeit in mir ausbreitete, mit der mir die unsäglichen Worte über die Lippen gekommen waren. Ich vermute, es war Scham. Sie klingt noch heute nach, wenn ich daran denke. Der Belastete blieb mein Freund, für viele Jahre. Ich habe ihm das nie erzählt. Ich schämte mich zu sehr.
Es blieb nicht die einzige Episode dieser Art. Die Erinnerung verzeichnet zahlreiche Momente einer unerklärlichen Fremdheit mir selbst gegenüber. Wiederkehrend dachte, schrieb, handelte ich auf eine Weise, die meinem Selbstbild grundsätzlich widersprach. Der Mensch, der sich mir dann im Rückblick zeigt, ist mir nicht geheuer. Er möchte zu mir aufschließen, sich mit mir versöhnen. Aber ich stoße ihn von mir.
Viele Jahrzehnte nach jenem Verrat verbrachte ich während eines Aufenthalts in einer psychiatrischen Klinik einige Tage auf einer »geschützten« Station. Der Ausgang war fest verschlossen, ich befand mich unter Mitpatienten, die es seelisch teilweise härter getroffen hatte. Manche liefen rastlos umher, andere schrien wie unter schweren körperlichen Schmerzen, wieder andere waren völlig in sich gekehrt, wirkten wie versteinert. Um mir, zumindest im Inneren der Station, etwas Auslauf zu verschaffen, lief auch ich umher. Da kam einer aus dem Nebenzimmer auf mich zu, schlug mir im Vorübergehen urplötzlich mit der Faust ins Gesicht und stahl sich wie ein Dieb sogleich davon. Ich geriet kurz aus der Fassung, rief um Hilfe, Pfleger kamen, schafften es schließlich, mich zu beruhigen. Was länger anhielt als der körperliche Schmerz, war das Gefühl, in meiner Integrität verletzt zu sein.
Aber war ich überhaupt persönlich gemeint? Wohl kaum. Es war nicht sein erster Ausraster. Dennoch: Er hatte mich als Punchingball benutzt, im wahrsten Sinne des Wortes getroffen. Sank meine Selbstachtung? Mein Selbstwertgefühl litt schon zuvor. Stieg Scham in mir auf? Vermutlich nicht. Ich konnte sogleich über das Geschehene sprechen, kann es heute, sogar darüber schreiben. Kann man sich als Opfer einer solchen Tat überhaupt selbst »richtig« schämen? Stünde das nicht vielmehr dem Täter zu? »Meiner« hat sich später, in einem seiner ruhigeren Momente, bei mir entschuldigt.
Um Scham zu empfinden, muss man weder Täter noch Opfer sein. Es gibt die Scham des Augenzeugen, der etwas mit ansieht, das er um seines Seelenheils willen niemals hätte mit ansehen dürfen. Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux erlebte als Zwölfjährige, wie ihr Vater ihre Mutter mit einem Beil erschlagen wollte. Davon kam sie nie wieder los. »Von nun an war unser ganzes Leben schambesetzt. Das Pissoir im Hof, das gemeinsame Schlafzimmer […] die Ohrfeigen und Schimpfwörter meiner Mutter, die betrunkenen Gäste und die Familien, die bei uns anschreiben ließen. […] Es war normal, sich zu schämen, als wäre die Scham eine Konsequenz aus dem Beruf der Eltern, ihren Geldsorgen, ihrer Arbeitervergangenheit, unserer ganzen Art zu leben. Die Scham wurde für mich zu einer Seinsweise. Fast bemerkte ich sie gar nicht mehr, sie war Teil meines Körpers geworden.«1
Keine häusliche Szene, deren Zeuge ich war, reicht an Dramatik an die von Ernaux geschilderte heran. Allerdings erzählte mir meine Mutter, dass ihr Mann sie geschlagen hätte, in den Dresdner Jahren, als er sie mit zahlreichen Geliebten betrog und sie dagegen aufbegehrte. Einmal wäre sie mit dem Gesicht gegen einen Bettpfosten geprallt, worauf ihre Schläfe platzte und Blut floss. Das und seine »Weibergeschichten« verzieh sie ihrem Gatten nie. Einmal, das war schon in Berlin, wollte sie ausbrechen, verlor dann aber den Mut und blieb, und so wurden sie zusammen alt. Dafür, dass ihre Ehe nicht zerbrach, verdiente sie nach ihren eigenen Worten einen »Durchhalteorden«. Demgemäß nüchtern, pflichtgemäß, von Alltagsroutinen bestimmt, gestaltete sich ihr Zusammenleben. Einzig am Wochenende tauten sie bei einem Glas Wein etwas auf, wurden gesprächig und riefen frühere Zeiten wach, ihr Kennenlernen, gemeinsame Erlebnisse, den Krieg. Liebkosungen, Zärtlichkeiten erinnere ich nicht. Auch sah ich sie niemals eng umschlungen. Mit einer Ausnahme. Und gerade die offenbarte ihre Erziehung der Gefühle. Das war während meiner Lehrzeit. Ich kam spät nach Hause, wollte vor dem Zubettgehen noch etwas trinken und öffnete die Küchentür. Da sah ich sie, meine Mutter auf dem Schoß meines Vaters, beide umarmten sich innig und küssten sich. Eine leere Weinflasche auf dem Tisch verriet, dass sie einiges getrunken hatten und mich wohl auch deshalb nicht bemerkten. Mein bloßes Hinzutreten erstickte das späte Aufflackern der Leidenschaft im Nu. Kaum sah mich meine Mutter, löste sie sich aus der Umarmung und setzte sich auf einen Stuhl neben meinem Vater. Sie benahm sich, als wäre etwas Unanständiges geschehen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Eltern meiner Lehrkameraden wie schon zuvor die meiner Schulfreunde ähnlich verstört reagiert hätten, wären sie »erwischt« worden. Die emotionalen Standards unserer Ernährer waren gänzlich andere als die vieler heutiger Eltern. Das betraf auch den Umgang mit uns, ihren Kindern. Sie hatten uns in die Welt gesetzt, versorgt, großgezogen, nahmen Anteil an unserer Entwicklung, aber liebten sie uns auch? Sagten sie uns das? Liebten wir sie? Tatsache ist, dass wir uns zeitig, mit vierzehn, fünfzehn Jahren, von unserem Zuhause abkoppelten, fast die gesamte Freizeit in der Clique abhingen, die »Heule« stets zu unseren Füßen. Die aktuellen Hits mitsingend, träumten wir uns ganz weit weg vom Leben mit unseren »Alten« und in das hinein, das unsere Vorbilder führten, die Rockstars mit den verführerischen Stimmen.
Aber so ganz gelang der Befreiungsschlag nicht. Insbesondere wir Jungen gingen sparsam mit Gefühlsbekundungen um, mieden körperliche Nähe oder Umarmungen, um nicht als »andersrum« zu gelten, akzeptierten, dass Muskelkraft über die Rangordnung in der Gruppe entschied, und duckten uns weg, wenn jemand Prügel bezog, der sich dem Anführer widersetzte. Wir wollten stark sein, aber auch biegsam, unerschrocken, aber auch versonnen; dem Ganzen unserer Seelenlage Raum zu geben, waren wir nicht mutig genug. Lieber ein cooler Spruch, eine rowdyhafte Gebärde als nur einmal Schwäche zeigen.
Diese Gehemmtheit begleitete mich mein ganzes Leben; Pate meiner Neigung, mich anderen gegenüber zu verschließen, mir selbst genug zu sein, was eine Lüge war. Eine Lüge, die der Unsicherheit entsprang, emotional zum Ausdruck zu bringen, was ich zum Ausdruck bringen wollte, stets in Sorge, zu viel oder zu wenig in Worte und Gesten hineinzulegen, als ich mit ihnen meinte; Heuchler im einen, Geizhals im anderen Fall.
Ich war in dieser Unberatenheit ein Kind meiner Zeit, hielt sie aber lange für einen individuellen Defekt, schämte mich, wenn ich mich wieder einmal vergriff. Als mich eine Mitschülerin als Einzigen aus unserer Klasse zu ihrem Geburtstag einlud, grübelte ich erfolglos, was ich ihr schenken sollte. Meine Mutter, ratlos wie ich, empfahl nahtlose Damenstrümpfe, und ich folgte ihr. Das Geburtstagskind empfing mich an der Wohnungstür und führte mich in ihr Zimmer. Beim Auspacken des Präsents färbten sich ihre Wangen schlagartig rot. Erst in diesem Moment erfasste ich das Anzügliche meiner Gabe, und nun rötete sich auch mein Gesicht. Eine Blamage, subjektiv aus Unbeholfenheit, objektiv aus Mangel an kulturellem Kapital. Schenken ist ein individueller und zugleich ein sozial kodierter Vorgang, der eine Aussage über das Vermögen des Schenkenden trifft, seinen Geschmack auf die Eigenarten und Wünsche des Beschenkten abzustimmen. Gänzlich unvertraut mit diesen ungeschriebenen Gesetzen, beschwor ich eine peinliche Situation herauf und fühlte mich allein dafür verantwortlich. »Das Schlimmste an der Scham ist, dass man glaubt, man wäre die Einzige, die so empfindet«, sagt Ernaux an anderer Stelle2 und schrieb ein ganzes Werk, um diesen Irrtum aufzuklären, die gesellschaftliche Überformung selbst höchstpersönlicher Akte und Empfindungen zu enthüllen; ein Leitfaden für meine eigene Spurensuche.
Was führte mich in die Psychiatrie? Corona? Das Virus war der Auslöser, aber nicht die Ursache eines Zustands, der mir schließlich keine andere Wahl ließ, als mich selbst dort einzuliefern. Von Hause aus zurückgenommen, eher schüchtern, scheu, gewohnt, mich angesichts unbehaglicher Situationen einzuigeln, war mir social distancing gleichsam auf den Leib geschrieben. Statt gegen die erzwungene Isolation so weit wie möglich anzukämpfen, zu zweit spazieren zu gehen, online zu kommunizieren, ausgiebig zu telefonieren, richtete ich mich in ihr ein, verspürte anfangs sogar Erleichterung. Niemand kam, niemand störte, na und?
Gerade hatte ich noch intensiv gearbeitet, zwei Bücher geschrieben. Da kam die Ruhe gar nicht ungelegen. Eine Pause machen, sich treiben lassen, frei von Termindruck und sozialen Verpflichtungen. Auch die Hochschule war im Lockdown. Geplante Buchvorstellungen gestrichen. Eine Gesprächsreihe unter meiner Leitung an der Berliner Volksbühne ließ sich gut an, wurde abgebrochen. Umso besser. Endlich Zeit zum Lesen, ohne Bezug auf ein Thema, einfach so, da wartete einiges. Oder in die Buchhandlung gehen, die hielten in Berlin offen, und die Neuerscheinungen auf Lesenswertes durchblättern. Ich tat nichts dergleichen und auch sonst nichts, was dem Tag Struktur gegeben hätte. Spulte lustlos ab, was vom Alltag übrig geblieben war. Ging früh zu Bett. Schlief schlecht. Hatte in meinem Empfinden immer schon schlecht geschlafen, zu kurz, zu unruhig. Hielt es mit Woody Allen: Wenn ich nicht sechzehn Stunden schlafe, bin ich am nächsten Tag kein Mensch.
Früher konnte ich über meine Schlafneurose lachen. Jetzt nicht mehr. Gut schlafen, das rückte in den Mittelpunkt des leer gezogenen Lebens. Die gesteigerte Aufmerksamkeit verschärfte das Schlafproblem. Lag lange wach. Hörte in mich hinein. Störte den Schlaf meiner Frau. Bemerkte eines Nachts, dass sich Musik in mein Ohr eingenistet hatte. Klangfetzen eines albernen Schlagers. Immer dieselben Töne, bis zum Morgen. Stand zermürbt auf, außerstande, mehr zu tun, als herumzustehen, sitzen, wieder aufstehen, laufen. Grübelte, was mich in diese Verfassung versetzt hatte. Attestierte mir Untätigkeit und nahm mir vor, das zu ändern, mich wieder in Debatten einzumischen, über ein neues Buch nachzudenken. Ging mit mir zurate. Nichts. Nicht der Zipfel eines tragfähigen Gedankens. Absolute Leere, wie draußen in der Stadt. Nicht zum Aushalten. Ich war gerade im Begriff, mit meiner Frau darüber zu sprechen, da zog sich alles zurück, was mir Deckung gegeben hatte, und ein Gedanke sprang mich an: so nicht mehr weiterleben zu wollen.
Zeitgleich mit dieser Erkenntnis trat ich aus mir heraus, sah ihn, den Anderen, der professionelle Hilfe benötigte. Sah ihm zu, wie er sich unter Begleitung in die Notaufnahme einer Psychiatrie begab. Dort aufgenommen wurde. Diagnose: mittelschwere depressive Episode. Dann trennte er sich von mir, zog in die Station St. Anna ein. Was ich von ihm weiß ist lückenhaft. Er wollte Tagebuch führen, schrieb aber keine einzige Zeile. Kam auf eine Station mit überwiegend weiblichen Patientinnen, die meisten jung, von Anfang zwanzig bis Mitte dreißig. Hatte Glück. Bezog ein Einzelzimmer. Gliederte sich in die Abläufe ein. Folgte seinem Therapieplan: Entspannungsübungen, Tai-Chi, Ergotherapie, Sport, Gedächtnistraining, Einzel- und Gruppengespräche, Visiten. Schluckte Antidepressiva zur Gemütsaufhellung, Antineuralgika gegen die Trugbilder seiner Sinne. Die Musik im Ohr blieb, nur hörte er jetzt Fragmente aus unterschiedlichen Genres, Schlager, Chansons, Klassik. Er konnte beeinflussen, was als Nächstes an die Reihe kam. Musste innerlich nur wenige Töne anstimmen, dann lief das von alleine weiter. Nur abstellen ließ sich der Singsang nicht.
Zusätzlich stellte sich ein Tinnitus ein, ein Ticken, so, als ratterte eine elektrische Nähmaschine in seinem Ohr. Starke Betäubungsmittel verhalfen ihm zu etwas Schlaf in der Nacht. Therapieerfolge ließen auf sich warten. Die Stimmung auf der Station war gedrückt. Man sprach wenig miteinander und wenn, dann verhalten. Die wegen Corona maskierten Gesichter verbargen innere Regungen. Er knüpfte kaum Kontakte. Blieb nach dem Durchlaufen der Maßnahmen für sich. Zog einsam seine Kreise durch das Außengelände. Lag auf dem Bett. Es war Mitte Oktober 2021, die Tage wurden rasch kürzer, die Dunkelheit kam früh. Eines Tages, zwei Wochen waren vergangen, wurde er von einer Pflegerin durch die Mitteilung aufgeschreckt, dass er sein Zimmer unverzüglich räumen müsse. Ein Neuzugang, in noch schlechterer Verfassung als er, würde dort einziehen. In Aussicht stand der Umzug in ein Dreibettzimmer. Ohne lange zu überlegen, packte er seine Sachen und entließ sich gegen den Rat der Ärzte.
November 2021. Wieder daheim, wieder ich. Versuchte, Tritt zu fassen, doch es gelang nicht. Das Gefühl der Leere und Fremdheit wollte nicht weichen. Innere Gespenster plagten mich, Phantasmen. Angst vor dem Tag schon beim Wachwerden. Tagsüber Angst vor der nächsten schlaflosen Nacht. Wachsende Verzweiflung, Ausweglosigkeit. Noch zweimal kehrte ich in die Klinik zurück. Im Dezember 2021 nach nur wenigen Wochen in »Freiheit«: Wieder war ein Bett frei, wieder in einem Einzelzimmer, auf der alten Station. Schon vertraute Abläufe. Aber diesmal ging ich gegen das Alleinsein an. Drehte meine Runden zu zweit, zu dritt. Erfuhr, was andere an diesen Ort geführt hatte. Manche hatte es aus dem Nichts getroffen. Eine kam von ihrer Arbeit als freiberufliche Kamerafrau von einer Dienstreise zurück, schnitt sich die Pulsadern auf, wurde rechtzeitig entdeckt und eingeliefert. Eine andere, verheiratet und Mutter einer Tochter, hatte schon mehrere depressive Schübe hinter sich. Sie spürte, wie ein neuer heraufzog, befestigte einen Strick an der Küchendecke. Der hing noch, als ihr Mann nach Hause kam. Sie hatte von ihrem Vorhaben abgelassen, aber nicht mehr die Kraft gefunden, die Spuren zu beseitigen. Diese Berichte lösten auch mir die Zunge. Mein Zustand besserte sich. Ich fasste wieder Mut, wurde entlassen.
Nach längerer Pause, im Oktober 2022 abermals in die Klinik, diesmal für zwei Monate. Den Ursachen meiner Lebenskrise kam ich auch diesmal nicht auf die Spur. Marterte meinen Kopf. Verfiel in Panik. Ging dem Pflegepersonal mit fortwährenden Klagen, Hilferufen auf die Nerven. Erweckte zunehmend den Eindruck eines Lebensmüden. Stand hinfort unter Beobachtung, sollte die Station nur noch in Begleitung verlassen. Verstieß gegen die Absprache, wurde daraufhin auf eine »geschützte« Station verlegt. Die Hölle. Heftigste Gefühlsausbrüche der bedrängten Kreatur, Schreie, die die Luft durchschnitten, Fäuste, die gegen Wände und Türen schlugen, eine davon flog in mein Gesicht. Bat bei der nächsten Visite um sofortige Rückverlegung. Die Oberärztin hatte ein Einsehen. Wenige Tage darauf verließ ich die Klinik, abermals auf eigenen Wunsch, abermals gegen den Rat der Ärzte.
Während der vielen Wochen meines dritten Klinikaufenthalts führte ich ein Buch mit mir, ohne es auch nur ein einziges Mal aufzuschlagen: Anleitung ein anderer zu werden steht auf dem Umschlag unter dem Namen seines Autors, Édouard Louis. Ich hatte dieses Buch als einzige Lektüre mit in die Klinik genommen, war dem Autor kurz zuvor begegnet und wollte mehr über ihn erfahren, aber mir fehlten Kraft und Konzentration fürs Lesen, für alles, was über die unmittelbaren Bedürfnisse hinausreichte. Erst daheim, in vertrauter Umgebung und nachdem ich mich so weit versammelt hatte, dass der Kopf bereit war, Neues aufzunehmen, las ich es. Und war sofort gefesselt. Hier erzählte jemand schonungslos von sich, seinem Weg durch die französische Gesellschaft, und sprach dabei von beinahe nichts anderem als von seiner Scham; wie er sie verleugnete, verdrängte, darunter litt und schließlich mit den Eliten abrechnete, die sie in ihn einpflanzten. Manches von dem, was er erzählte, erschloss sich mir unmittelbar, manches blieb mir zunächst unzugänglich. Aber gerade das bestärkte meinen Entschluss, um selbst klarer zu sehen, es ihm in gewisser Weise nachzutun, dem eigenen Gewordensein nachzuspüren – ohne Scheu vor Abgründen und Verfehlungen und, ja, auch vor Momenten, in denen ich mir selbst untreu wurde, zum Überläufer, Verachtung von mir Besitz ergriff und der Verrat an die Tür klopfte.
Manch einen mag verstören, was ich schreibe, auf welche Weise ich Zeugnis ablege. Erinnerungen nachgehe, wie den eingangs geschilderten. Sie drängten an die Oberfläche, nach vielen Jahren, ohne dass ich wusste, warum. Die innere Krise, in der ich mich befand, führte mich wohl in Regionen, denen ich lange ausgewichen war. Ich selbst bin überrascht von der gelegentlichen Härte des Urteils mir selbst gegenüber. Dennoch ist sie Teil eines Erkenntnisdrangs, der mich in meiner Arbeit mein ganzes Leben begleitet hat. Im Grunde war er der Kern, stand ab einem bestimmten Zeitpunkt im Zentrum meines Lebens.
Zweierlei Aufstieg
Édouard Louis’ Anleitung ein anderer zu werden – eine Mischung aus Autobiografie und Gesellschaftsroman – fasziniert durch den Behauptungswillen des Menschen, von dem berichtet wird, und von der Offenheit dessen, der berichtet. Der Autor beschönigt nichts, zeigt sich so, wie er war, als er sich voller Hass und Verachtung von seiner Herkunft losriss: ungerecht den Zurückbleibenden gegenüber, arrogant, blind zugleich für den Snobismus, den Klassendünkel derer, zu denen er gehören wollte. Er übernimmt die Üblichkeiten, die Weltsicht der vom Schicksal Begünstigten, blickt mit deren Augen auf die soziale Welt, der er den Rücken kehrte, und schluckt die Scham über diesen Verrat herunter, wenn sie einmal in ihm aufsteigt. Um das Leben der Privilegierten zu teilen, so, als wäre er nie ein anderer gewesen, greift er zum Äußersten und löscht sein vormaliges Selbst (beinahe) aus.
Das zentrale Thema seiner Aufstiegserzählung ist Scham, soziale Scham. Scham an Herkunft gebunden. Scham als ständiger Begleiter auf dem Weg durch die Gesellschaft von ganz unten nach weit oben. Scham über die Verleugnung der eigenen Ursprünge, gepaart mit dem Gefühl, ein Verräter sein.
Hass treibt den jungen Édouard an. Hass auf den kleinen Ort in der Picardie, in dem er aufwächst, Hass auf sein Zuhause, den Vater, den Fabrikarbeiter, der seinen Sohn, der früh bemerkt, dass er schwul ist, seine Abscheu spüren lässt, Hass auf die Schule, die Lehrer, die Klassenkameraden, die die »Tunte« hänseln, schneiden, Hass zuvorderst auf sich selbst, sein verhuschtes Wesen, sein Aussehen, seine schlechten Zähne, sein verschämtes Lachen, weil er sie verbergen will.
Dann lernt er die gleichaltrige Elena kennen, die aus gehobeneren Verhältnissen stammt – und hat zum ersten Mal in seinem Leben Glück. Sie nimmt sich seiner an, macht ihn mit den Werken von Schriftstellern vertraut, geht mit ihm ins Programmkino, ins Theater, in Konzerte, Ausstellungen, lädt ihn zu sich nach Hause ein und weist ihm einen Platz an, wo er endlich in Ruhe lernen kann. Umgehend identifiziert sich der junge Édouard mit dieser neuen, provinzbürgerlichen Welt, ihren Umgangsformen, ihrem Lebensstil, ihren Codes. Er merkt sich, was er hört, ahmt nach, was er sieht, blufft mit ausgeliehenem Wissen, wenn er wieder unter seinesgleichen ist, fühlt sich bei seiner Freundin geborgen, in seinem Elternhaus dagegen fremd.
Kenntnis davon zu erlangen, was unter gebildeten, kulturinteressierten Menschen zählt, ist in erster Linie eine Sache des Kopfes. Am nachhaltigsten wirkt die Umerziehung, wenn sie weiter unten ansetzt, am Körper, an seinen zumeist unbewussten Funktionen und Vollzügen. »Du musst lernen, wie man richtig isst«, bemerkt Elena eines Tages und unterweist Édouard sogleich im Einmaleins der Ess- und Tischsitten, zeigt ihm, wie man mit Besteck umgeht, Messer, Gabel, Löffel geziemend hält, Speisen behutsam zum Mund führt, wo die Werkzeuge nach vollendeter Mahlzeit hingehören.
Die Lehrstunde wird zur Initialzündung für den Aufbruch des gelehrigen Schülers. Es geht ums Ganze, um den vollständigen Bruch mit seiner bisherigen Existenz, das weiß er nun. »Durch die Szene mit dem Besteck in Elenas Zimmer verstand ich, dass meine Herkunft überall in mir war, sie bestimmte, was ich aß, aber auch, wie ich ging, wie ich mich kleidete, wie ich sprach. Mein Körper erzählte eine andere Geschichte als die, die ich durch meinen Willen formen wollte; es reichte nicht, die Namen von Schriftstellern zu kennen, ins Kino zu gehen oder neue Gesprächsthemen zu finden, um ein anderer zu werden. Meine Herkunft war mir in den Leib geschrieben, in die Stimme, in jede Bewegung, also beschloss ich, alles an mir zu verändern.«1
Als Erstes kommt der Dialekt an die Reihe, der muss weg; unter Tränen, der Ohnmacht nahe, übt er, Worte dialektfrei auszusprechen, noch ist die Muskulatur zu ungelenk, aber das gibt sich. Dann das Lachen, zu offen, zu laut, zu heftig. Vor dem Spiegel wird ein neues Lachen einstudiert, der Mund beinahe geschlossen, so soll es sein, auch in den komischsten Momenten, in denen einem die Kontrolle zu entgleiten droht. Sport treiben, leichter essen, abnehmen, neue Kleider, neue Schuhe, Krawatten, mit einem Windsor-Knoten gebunden – da ist Édouard schon weg aus seinem Kaff, in der Stadt, auf dem Gymnasium, und noch längst nicht mit sich fertig.
Er krempelt sein Verhältnis zur Schule um, zum Wissenserwerb; Lernen, Lesen aus Passion statt aus Pflicht, am besten rund um die Uhr, »wie verrückt«. Bester seiner Abschlussklasse, verlässt er das Gymnasium, und nun? Nach Paris, und dort an einer der Eliteuniversitäten studieren! Ein vermessenes Ziel für einen wie ihn, ein Wunschtraum. Gelegentlich eines Vortrags lernt er einen prominenten Pariser Intellektuellen kennen, Didier Eribon. Er spricht ihn an, unterbreitet ihm seinen Plan. Eribon, gleichfalls schwul, von ganz unten aufgebrochen, imponiert der junge Mann, sein Ehrgeiz, er spricht ihm Mut zu, bald wird er sein Mentor. Er hilft ihm, Tritt zu fassen in der Metropole, führt ihn in seine Kreise ein, gibt ihm Tipps für das strenge Auswahlverfahren der ENS, der École normale supérieure, dieser Kaderschmiede der guten französischen Gesellschaft.
Édouard in Paris. Endlich Freisein, endlich offen Schwulsein, frei von Nachstellung und Beschämung, das lebt er weidlich aus, und arbeitet weiter an seinem Projekt, das er »Selbstauslöschung« nennt. Etwas in ihm, unterhalb seiner bewussten Wahrnehmung, erträgt nicht, dass er so ist, wie er ist, so geht, so sitzt, so spricht, so aussieht. Von dieser stets mitlaufenden, untergründigen Scham verfolgt, gepeinigt, schreitet er zur Tat, lässt seinen Kiefer operieren, die Haarlinie versetzen, die Zähne richten, das dauert Jahre, Liebhaber, Gönner begleichen die Rechnungen. Sie führen ihn in die exklusivsten Bars und Restaurants, er schläft in den teuersten Hotels, bereist die Welt, pflegt Umgang mit den Spitzen der Pariser Gesellschaft, mit Politikern, Industriellen, Bankern, Künstlern, Intellektuellen, mit vielen hat er Sex. Die sexuelle Scham verfliegt, die soziale Scham bleibt sein Begleiter, aller erworbenen Fähigkeiten, aller Weltläufigkeit zum Trotz. Immer wieder beschleicht ihn das Gefühl, dieses Leben sei nicht für ihn bestimmt, er gehöre nicht hierher, unter diese Leute, die von Kindheit an mehr gelesen haben als er, feiner zu empfinden, selbstbewusster, beiläufiger aufzutreten gelernt haben als er. Diesen Vorsprung würde er niemals einholen. Hat er sich zu viel herausgenommen? Will er zu hoch hinaus?
Was Louis in dieser Phase durchlebt, sind die seelischen Konflikte des Aufsteigers. Er überschreitet sich selbst und scheut vor sich zurück. Für jene, die er verließ, ist er bereits zu weit gegangen, zu sehr ein anderer geworden; das lassen sie ihn spüren. Für sich selbst ist er nicht weit genug gekommen und wird es vielleicht niemals schaffen. Er bewegt sich im Zwischenreich zwischen unten und oben, zweifelt, wer er eigentlich ist. Diese Zweifel setzen ihn dem Urteil von Menschen mit klar umrissenen sozialen Status (gleich welcher Güte) schutzlos aus.
Auf sein Elternhaus angesprochen verleugnet er standhaft seine Ursprünge, behauptet, sein Vater sei Anwalt oder Professor, aus Sorge, man verlöre das Interesse an ihm, sagte er die Wahrheit. Sich gänzlich von seiner Vergangenheit abzunabeln, legt er seinen Nachnamen ab, Édouard nannte sich der als Eddy Bellegueule Geborene schon zuvor, nun heißt er amtlich Édouard Louis; die Neuerschaffung ist vollbracht. Er stellt sich dem Prüfungsmarathon, nimmt alle Hürden, ergattert tatsächlich einen der begehrten Studienplätze; jetzt ist er ENS-Student, jetzt ist er da.
Distanzlose Ankunft in der bourgeoisen Pariser Welt, Selbstverleugnung? So scheint es. Aber so rückstandslos lässt sich Eddy nicht entsorgen. Nach Jahren besucht Édouard seinen Vater. Und plötzlich ist alles wieder da: die Armut, die geistige Enge, die Hässlichkeit und Brutalität dieser Welt. Scham erfasst den Besucher seiner Kindheit, Scham darüber, dass er mit seinen Pariser Freunden nie darüber gesprochen hat, begleitet von der Erkenntnis, dass er mit ihnen nie darüber würde sprechen können: »Wenn ich in Paris versucht hätte, das alles zu erklären, hätte mich niemand verstanden, das wusste ich, ich hätte die Differenz nicht artikulieren können, weil sie außerhalb der Sprache lag. Mir wurde klar, dass ich, wenn Worte nichts dagegen ausrichten können, nicht versuchen durfte, die Leute in Paris zu überzeugen, sondern dass ich sie bekämpfen musste. Vielleicht nahm ich mir an jenem Nachmittag bei meinem Vater vor, dass ich ihn eines Tages rächen würde.«2 Louis tut dies öffentlich, beschuldigt die Eliten, die Repräsentanten, namentlich die Präsidenten der Französischen Republik der schändlichen Unterlassung, dieses Leben, solche Leben bei ihren Gesetzen und Verordnungen je in den Blick genommen zu haben; dass sie tatenlos zusahen, wie der alte Mann, der sich halb tot geschuftet hatte, um jeden Cent kämpfen musste, als er die Arbeit nicht mehr leisten konnte.
Sozialer Aufstieg, Seitenwechsel, Klassenverrat, Rache – französische Autoren besitzen eine besondere Affinität zu diesen Themen. Der Klassencharakter der französischen Gesellschaft ist ausgeprägter als etwa der der deutschen, die Grenzen zwischen den Klassen, Schichten, Milieus sind deutlicher markiert, die Bildungsinstitutionen gleichen Sortiermaschinen, ein Abitur minderer Güte kann in dieselbe soziale Sackgasse führen wie ein Schulabbruch, die Spitzen in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft rekrutieren sich überwiegend aus den Abgängern weniger Eliteuniversitäten, die sich in der Hauptstadt konzentrieren.
Ich erahne, das mitbedenkend, welch enorme Selbstüberwindung es Menschen wie Louis kostete, sich ihren Weg gegen alle Wahrscheinlichkeit zu bahnen. Auch in der deutschen Gesellschaft sind Aufstiege von ganz unten alles andere als selbstverständlich; die Erfahrung sozialer Scham ist ein Thema auch hierzulande.3Mein Erfahrungshintergrund war ein gänzlich anderer. Auch ich brach auf, stieß mich von meiner Herkunft ab, durchlief ähnliche Stationen der kulturellen Abnabelung. Aber ich empfand die Veränderung, die sich in und mit mir vollzog, nicht als Bruch mit meiner Herkunft, mich selbst nicht als »Aufsteiger«, die soziale Scham des Underdogs blieb mir zeitlebens fremd. Der Zufall meiner Geburt führte mich in eine andere Gesellschaft, in eine Gesellschaft mit anderen Chancen, anderen Widerständen, anderen Lebens-, anderen Karrieremustern.
Ich kam in der DDR zur Welt, 1952, in Dresden, als Sohn eines gelernten Brauers, der nach dem Krieg lange Zeit für die Staatsgewerkschaft tätig war, und einer Mutter, die als bleibende Hausfrau aus der ostdeutschen Norm fiel. Frauen arbeiteten, gingen einem Beruf nach, wie Männer auch, das war das Übliche.
Die Erinnerungen an meine ersten Lebensjahre, die ich am Rand von Dresden, nahe der Elbe, verbrachte, sind mit einer Ausnahme verschollen: Ich fahre auf meinem Dreirad in Sicht- und Hörweite meiner Mutter vor unserem Wohnhaus auf und ab. Plötzlich stürzte ich über den Lenker und falle ungebremst aufs Gesicht. Diagnose: Nasenbeinbruch. Ein Arzt begutachtete den Schaden und fand, das könnte man später richten, man sollte erst den Wachstumsprozess abwarten und dann mit mir zum Chirurgen gehen. Damit lag er falsch. Der Bruch war anfangs nicht besonders auffällig, wuchs sich erst in meiner Jugend zu einer »Boxernase« aus. Jetzt hätte ich die Initiative ergreifen können, unterließ es aber, und gewöhnte mich mit der Zeit an meine Dresdener Mitgift.
1957 zog die Familie in die Hauptstadt des Landes, nach Berlin, in den Prenzlauer Berg, damals ein Arbeiterbezirk, in einen Altbau, zwei Zimmer, Küche, Innenklo, immerhin. Die Kontakte mit Nachbarn knüpfte meine Mutter, mein Vater mied die anderen Bewohner, etliche arbeiteten in Westberlin, noch gab es keine Mauer, und ich vermute, diese mieden auch ihn. Auf die zahlreichen Kinder im Haus hatte das keinen Einfluss, sie gingen unbefangen mit mir um. Allerdings: Ich sächselte, sie berlinerten, und so kam es anfangs zu Missverständnissen. »Kiek mal«, sagte eine Spielkameradin zu mir wenige Tage nach meiner Ankunft. Der Ausdruck bedeutete in meinem Wortschatz, in irgendetwas hineinzustechen. Ich sah sie hilflos an. Erst als sie mit dem Arm auf etwas hinwies, verstand ich, dass ich ihrem Blick folgen sollte.
Seltsam, aber diese Begebenheit hinterließ in der Erinnerung tiefe Spuren. Es ist das erste Mal, dass ich mich von außen sah, auf einem leicht abfallenden Rasenstück am Helmholtzplatz neben Christina, dem Nachbarskind, das den Jungen aus Sachsen durch zwei beiläufige Worte aus ihrem Sprachraum kegelte. Bald sprach ich mich ins Berlinerische ein, verlernte meinen Dresdner Dialekt. Gänzlich, wie ich dachte, bis mich eine Bekannte Jahrzehnte später mitten im Gespräch fragte, ob ich aus Dresden stamme. Eine für die Dresdener Spielart des Sächsischen charakteristische Lautfärbung verriet mich. Man hört nie ganz auf, der zu sein, der man einmal war. Die vorbewussten Prägungen sind die unauslöschlichsten. Je weniger man über das nachdenkt, was man sich aneignet, Handbewegungen, Sprachmelodie, eine bestimmte Art zu lächeln, desto tiefer gräbt es sich in die Seinsweise ein und bestimmt den Habitus eines Menschen. Der ist formbar, aber dazu bedarf es bewusster, manchmal, wie bei Édouard Louis, radikaler Anstrengungen. Ich hatte keinen so existenziellen Grund, ein anderer werden zu wollen wie er, und wurde es doch. Mit dem Abtrainieren des Dresdner Dialekts begann es vielleicht. Denn das Sächsische schloss mich aus, war ein Loser-Dialekt, über den man sich lustig machte, der von Walter Ulbricht gesprochen wurde, dem diktatorisch, aber letztlich glücklos agierenden Staatsoberhaupt der DDR. Die Arbeiter im Prenzlauer Berg verwehrten ihm schon früh ihre Gefolgschaft, ließen es 1953 auf eine Machtprobe mit dem Staat, der offiziell ihrer war, ankommen. Ich liebe den Berliner Dialekt, freue mich, wenn jemand noch so spricht. Manchmal versuche ich das auch – und gebe waschechten Berlinern zu hören, dass ich kein gebürtiger Berliner bin.
1958 begann meine Schulzeit an einer zehnklassigen Polytechnischen Oberschule. Noch heute steht mir das Klassenzimmer deutlich vor Augen: die abgegriffenen Bänke, fest aneinander montiert und zu Reihen angeordnet, die jeweils sechs Schülerpaaren Platz boten; der Lehrertisch vorn, auf einem kleinen Podest, genau in der Mitte; die bläulich-grüne Wandtafel in der Form eines Triptychons; rechts daneben der hoch gereckte Kartenständer, an dessen Klappverschluss wachstuchartige, rouleauförmig sich entfaltende Landkarten befestigt wurden; die bogenförmige Fensterfront mit den kleinteiligen Scheiben, die den Blick auf den mit Schotter bedeckten Schulhof freigaben; die gegenüberliegende Seitenwand mit der improvisierten Garderobe und zugleich Ort der Wandzeitung; schließlich die Rückwand, an der sich allerlei Schautafeln befanden. Ein Kirchenschiff en miniature. Während ich mir dieses Stillleben vergegenwärtige, fallen mir die Namen der weitaus meisten meiner damaligen Mitschüler ohne die geringste Anstrengung zu. Die vom ersten Schultag an unumstößliche Sitzordnung, das lebende Tableau, das wir bildeten – auch nach noch so vielen Jahren befördert die Erinnerung an einen bestimmten Platz den Platzbesitzer unweigerlich mit zurück.
Vieles am Schulalltag war lästig. Stunde um Stunde erhoben wir uns, um den eintretenden Lehrer förmlich zu begrüßen, und oft genug geschah es, dass der- oder dieselbe drei Stunden später unter Abforderung des nämlichen Rituals erneut erschien. Wer beim wiederholten Schwatzen erwischt wurde, wechselte von seinem Platz in eine dafür bestimmte Raumecke, das Gesicht zu Wand. Bei größeren Vergehen gegen die Schulordnung winkte ein Besuch im Lehrerzimmer oder das berüchtigte Nachsitzen, bei dem irgendein Merksatz Dutzende Male ins Schreibheft zu notieren war. An ernstlichen Protest dachten weder wir noch unsere Eltern. Schließlich war es Generationen von Schülern vor uns ganz ähnlich ergangen.
Eine sonderbare Übung war das Stillsitzen, uns allen ein Gräuel. Sie bestand darin, minutenlang in gerader Haltung zu verharren, die Hände auf der Tischplatte und den Mund geschlossen. Zuwiderhandlungen zogen Ermahnungen oder, falls das nichts fruchtete, Eintragungen ins Klassenbuch nach sich. Wer davon genügend eingesammelt hatte, konnte seine Zensur in Betragen vergessen.
Schreiben, eine Tortur. Ich war Linkshänder, und zwar auf ganz besondere Weise. Ich drehte das Schreibheft um einhundertachtzig Grad, konnte, was ich schrieb, selbst nicht lesen, wohl aber der oder die vor mir Sitzende, sofern sie sich zu mir umdrehten. Das ließen die Lehrer nicht durchgehen. Ich sollte, wie alle anderen auch, mit der rechten Hand schreiben. Das misslang so gründlich, dass sie davon Abstand nahmen. Dann eben mit der linken Hand, aber ohne den Drehfimmel. Auch das ein Misserfolg. Man zog einen Schulpädagogen zurate. Der entschied nach einigem Bedenken, mich gewähren zu lassen. Mit der Zeit »normalisierte« sich mein Schreibstil, zumindest etwas. Ich drehte das Heft nur noch um neunzig Grad, so dass nun der neben mir Sitzende mitlesen konnte. So schreibe ich noch heute.
Lesen, Schreiben, Rechnen, das lernten wir zeitig und durch die Bank, wurden mit Grundkenntnissen in Naturwissenschaften ausgerüstet, Chemie, Physik, Biologie; Erdkunde stand auf dem Stundenplan, Geschichte, natürlich Mathematik, Russisch, später Englisch und die unvermeidliche Staatsbürgerkunde. Aber auch Nadelarbeit, Werken und der gemeinsame Gang zum Schulgarten; erste Einübungen in die Obliegenheiten werktätiger Menschen.
Eines Tages kam eine neue Lehrerin in unsere Klasse, mit einem Ball unter dem Arm. Den warf sie jedem zu, der eine Antwort auf ihre Fragen wusste oder zu wissen glaubte. Traf man das Richtige, erhielt sie den Ball zurück. Ansonsten war er dem oder der Nächstklügeren zuzuleiten. Das war ein paar Minuten lustig, dann nervte es. Sie versuchte es noch ein, zwei Mal auf die lockere Art, dann gab sie auf. Ihre kleine Rebellion gegen die Ordnung scheiterte an unserem Ordnungssinn.
Wir waren Kinder der Ordnung. Und Kinder und Enkel von Kriegern. Unsere Väter hatten dem Nationalsozialismus gedient, unsere Großväter dem letzten Kaiser. Manche von uns hatten Eltern, die noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs geboren worden waren und deren früheste Erinnerungen auf dessen unrühmliches Ende zurückgingen, auf die heimkehrenden Ernährer oder die zahllosen Kriegsinvaliden, die plötzlich die Straßen bevölkerten. Davon erzählten sie, nur selten vom Krieg, den Hitler angezettelt und den sie verloren hatten. Was sie hochhielten, waren die berühmten Sekundärtugenden Duldsamkeit, Fleiß, Ordnung, Disziplin. Dadurch hatten sie es wieder zu einiger Behaglichkeit und bescheidenem Wohlstand gebracht, und ebendadurch gedachten auch wir es zu etwas zu bringen. Unsere Lehrer, die dieselben Erfahrungen durchlaufen und dieselben Lehren daraus gezogen hatten, wussten uns in diesem Punkt an ihrer Seite, allem lärmenden Widerspruch zum Trotz. Einer hatte seine Nerven nicht im Zaum und warf, geriet er in Rage, sein Schlüsselbund durch den Raum. Wir zogen die Köpfe ein, waren aber nicht sonderlich erschrocken. Solche jähen Zornesausbrüche kannten wir von unseren Vätern.
Denke ich an meine Kindheit im Prenzlauer Berg, tauchen Sommer aus der Erinnerung auf, die heiß und sonnig waren; Hydranten, die die Bürgersteige säumten, allesamt intakt und jederzeit bereit, erfrischende Abkühlung zu spenden; Lastwagen, die an besonders warmen Tagen von Haus zu Haus fuhren, große Eisblöcke auf der Ladefläche, die gegen ein geringes Entgelt zerkleinert wurden, so dass sie in die mitgebrachten Eimer passten und, in die Wohnung getragen, einen Kühlschrank simulierten; stickige Hinterhöfe, in denen wir mit Matchboxautos oder fein marmorierten Glasmurmeln spielten, jeder Verlust ein Stich ins Herz. Aber auch sonst gab es reichlich Attraktionen. Der Alexanderplatz war ein metropolitanes Drehkreuz, wo Straßenbahnen um die Wette kreischten, Doppelstockbusse und Autos verkehrten. Von dort war es mit der S‑Bahn nur mehr eine gute halbe Stunde bis zum Müggelsee oder in die Müggelberge. Stiegen die Temperaturen um zehn Uhr auf fünfundzwanzig Grad, gab es hitzefrei; dann schwärmten wir aus.
Ein Ort wird immer unvergesslich bleiben, urbane Krönung von ganz Ostberlin und Lieblingssujet der Filmemacher – Berlin, Ecke Schönhauser; der schönste Ort der Welt. Hier, am U‑Bahnhof Dimitroffstraße konnte ich stundenlang verweilen, inmitten von Autos, Trams und rasselnder Metro, die immer neue Menschenströme ausstieß oder einsaugte. Keine 200 Meter weiter in westlicher Richtung, die Eberswalder Straße hoch zur Bernauer, begann das vielleicht größte Kindheitsabenteuer, der Westen.
Mal um Mal passierte ich den Grenzübergang an der Hand meiner Mutter. Sonderbarerweise sind sämtliche Begleitumstände der Passage aus der Erinnerung gelöscht, ausgenommen einer: Es roch drüben ganz anders, frischer, verführerischer, nach Weintrauben, Bananen, Zitrusfrüchten. Konzentration aller Sinne auf einen einzigen, den Geruch; zielsichere Vorwärtsbewegung bei geschlossenen Augen, dann Ankunft vor den übervollen Ständen und erster Blickkontakt mit den sich geradezu schamlos präsentierenden Köstlichkeiten. Der Mauerbau setzte dem ein jähes Ende. Für das Kind, das ich war, eher ein Faktum als eine Zäsur. Sprach es mit Klassenkameraden darüber? Ordneten Lehrer das einschneidende Ereignis in den Kampf der Systeme ein? Oder übernahm das der Direktor in seiner obligatorischen Ansprache zu Schulbeginn am ersten September? Die Katze Erinnerung verweigert die Auskunft.
Auch über mein Verhältnis zu Walter Ulbricht, dem Staatslenker. Gewiss war oft von ihm die Rede, in Schulbüchern, bei Pioniernachmittagen und im ganz anders eingestellten Alltag. Im Gedächtnis findet dieses Wissen keinen Rückhalt. Offenkundig blieb er mir ebenso fremd wie ich ihm. Die identifikationsbedürftigen Triebe hefteten sich an echte Helden, an German Titow, Nachfolger Juri Gagarins, und Valentina Tereschkowa, die erste Frau im All. Wie diese im offenen Wagen ins Rund des Strausberger Platzes einfuhren, weiter in Richtung Alexanderplatz, ist mir höchst präsent. Ulbricht steht mit im Fond und winkt den Schaulustigen zu. Ich aber, zwei kleine Fähnchen in der Hand, die Flagge der DDR und die der Sowjetunion symbolisierend, ignoriere ihn und jubele nur den Sternenfahrern zu. Das Postministerium legte aus diesem Anlass eine Sonderbriefmarke auf, die genau diese Szene zeigt. Mein Vater, ein eifriger Sammler, erwarb sie und fügte sie seinem Album ein, das ich noch heute besitze.