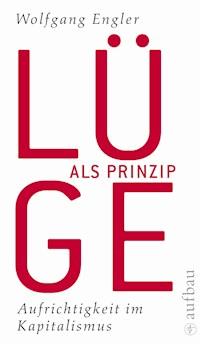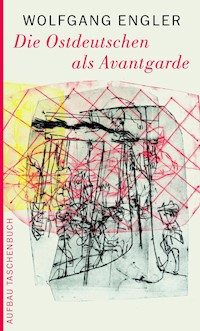9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk zur Mentalitätsgeschichte der Ostdeutschen.
Lebendig und präzise schildert Wolfgang Engler, wie die ostdeutsche Gesellschaft in vierzig Jahren DDR das, was von oben in sie eingepflanzt wurde, verarbeitete und umdeutete. Er ergründet, wie die Menschen ihre Würde im Umgang mit der Macht verteidigten und was sie unter Reichtum, Glück und Freiheit verstanden.
„Englers Kunde von einem verlorenen Land ist lesenswert.“ Deutsche Welle.
Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Wolfgang Engler
Wolfgang Engler, geboren 1952 in Dresden, Soziologe, Dozent an der Schauspielhochschule »Ernst Busch« in Berlin, von 2005 bis 2017 dort Rektor. Langjähriger Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen. Bei Aufbau erschienen »Unerhörte Freiheit. Arbeit und Bildung in Zukunft«, »Lüge als Prinzip. Aufrichtigkeit im Kapitalismus«, »Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land«, »Die Ostdeutschen als Avantgarde« und »Bürger, ohne Arbeit. Für eine radikale Neugestaltung der Gesellschaft«. Zuletzt, zusammen mit Jana Hensel, »Wer wir sind. Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein«.
Informationen zum Buch
Endlich wieder lieferbar – das Standardwerk zur Mentalitätsgeschichte der Ostdeutschen
Lebendig und präzise schildert Wolfgang Engler, wie die ostdeutsche Gesellschaft in vierzig Jahren DDR das, was von oben in sie eingepflanzt wurde, verarbeitete und umdeutete. Er ergründet, wie die Menschen ihre Würde im Umgang mit der Macht verteidigten und was sie unter Reichtum, Glück und Freiheit verstanden.
»Englers Kunde von einem verlorenen Land ist lesenswert.« Deutsche Welle
Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wolfgang Engler
Die Ostdeutschen
Kunde von einemverlorenen Land
Inhaltsübersicht
Über Wolfgang Engler
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorrede
Nach zwanzig Jahren …
»Die Russen kommen« Wie die Ostdeutschen Krieg und Nachkrieg erlebten und welche Folgen das hatte
Aufbau und Aufstand Wie die Ostdeutschen in neue Häuser und Städte zogen und über deren richtigen Gebrauch mit ihrer Führung stritten
Aufbruch und Reform Wie die Moderne zu den Ostdeutschen kam, Widerspruch auslöste und kleinlaut wurde
Krise und Engagement Warum die ostdeutsche Gesellschaft so oft von Krisen heimgesucht wurde und warum sie so wenig aus ihnen lernte
Die Jungen und die Alten Warum dieselben Faktoren, die den Erfolg des Aufbruchs verhießen, sein Scheitern begünstigten
Macht und Würde Wie sich persönliche Erwartungen von gesellschaftlichen lösten und zu neuen Vorstellungen von Glück und Freiheit führten
Eine arbeiterliche Gesellschaft Warum die Arbeiter in der ostdeutschen Gesellschaft sozial und kulturell dominierten und selbst aus der politischen Ungleichheit Vorteile zogen
Die Dinge und das Leben Warum die Herrschaft der Dinge über die Menschen keine unumschränkte war und was diese unter Reichtum noch verstanden
Form und Seele Was Ratgeber über Anstand und wahre Liebe dachten und was man ihnen glaubte
Nacktheit, Sexualität und Partnerschaft Warum die These von der sexuellen Liberalisierung für Ostdeutschland nur von begrenztem Erklärungswert ist
Überlistung und Verrat Wie die Regierenden mit Hilfe der Regierten herrschen wollten, abgewiesen wurden und dennoch ans Ziel gelangten
Die dritte Generation Warum die ostdeutschen Achtundsechziger in Etablierte und Außenseiter zerfielen und was das für bedeutete
Literaturhinweise
Impressum
Vorrede
Von den drei Entscheidungen, die mich beim Schreiben geleitet haben, ist die erste die heikelste.
Einige ermutigende Beispiele vor Augen, glaubte ich, dass es nach so vielen Arbeiten, die sich mit dem Herrschaftssystem der DDR beschäftigt haben, an der Zeit wäre, eine Darstellung der ostdeutschen Gesellschaft zu versuchen. Davon inspiriert, trug ich dem politischen System nur insoweit Rechnung, als mir dies zum Verständnis gesellschaftlicher Bewegungen und Prozesse unerlässlich schien.
Mir ist bewusst, dass ich mich damit einer ganzen Reihe berechtigter Nachfragen, aber auch moralischen Anklagen aussetze.
Kann man in einer durchherrschten Gesellschaft wie der ostdeutschen überhaupt eine definitive Grenze zwischen Staat und Gesellschaft, Politik und Alltagsleben ziehen?
War die ostdeutsche Gesellschaft nicht in jeder Hinsicht das Produkt politischer Entscheidungen, Eingriffe und Zwangsmaßnahmen?
Führt die Konzentration auf die Gesellschaft nicht notwendigerweise zu einer Beschönigung der DDR-Vergangenheit, zur Ausklammerung all dessen, was bedrückend und unerträglich war?
Dass eine auf den Alltag zielende Gesellschaftsgeschichte Gefahr läuft, zu verharmlosen, gemütlich, ja selbst süßlich zu werden, ist unbestreitbar. Ob ich dem Herrschaftsmechanismus die auch in diesem Rahmen nötige Aufmerksamkeit gezollt habe, muss dem Urteil des Lesers überlassen bleiben.
Was mich interessierte, war gerade nicht die Gesellschaft als ein von außen Geschaffenes, sondern als sich selbst Schaffendes, nicht als natura naturata, um mit dem großen Spinoza zu sprechen, sondern als natura naturans.
Je mehr ich diesem Interesse folgte, um so mehr faszinierte mich, wie die ostdeutsche Gesellschaft das, was von oben in sie eingepflanzt wurde, aufnahm, verarbeitete, umdeutete und abwandelte; wie sich nach und nach ein System gesellschaftlicher Normen, Ansichten und Erwartungen herausbildete, das auf eigenen Füßen stand; wie der politische Fremdzwang entweder am sozialen Eigensinn scheiterte oder auf verschlungenen Pfaden in Eigensinn umschlug.
Der ostdeutsche Herbst des Jahres 1989 besitzt eine lange und wechselvolle Vorgeschichte. So verkehrt es wäre, diese Geschichte nur vom Ende her zu lesen, als Befreiungsgeschichte, so unverzeihlich wäre es, die Vorboten und Zeichen dieses im Ganzen glücklichen Ausgangs zu übersehen und als Autor sein Heil in einer Unterdrückungsgeschichte zu suchen.
Der 89er Herbst war weder zwingend noch ein Wunder.
Die zweite Entscheidung fiel erst im Schreibprozess.
Ursprünglich dachte ich, die geistig-sozialen Eigenarten der Ostdeutschen würden am besten sichtbar, wenn ich sie durchgehend ins Verhältnis zum Habitus ihrer ost- und mitteleuropäischen Nachbarn sowie zu den charakteristischen Eigenschaften ihrer westdeutschen Landsleute setzte.
Von dieser Vergleichsperspektive bin ich zunehmend abgegangen.
Vergleiche kommen im Verlauf der Darstellung immer wieder vor, sind manchmal unumgänglich, aber sie leiten den Gedankengang nicht.
Auch dafür gibt es einen Grund.
Die vergleichende Methode setzt den Unterschied voraus. Sie ist dann am ertragreichsten, wenn die Besonderheiten von Nationen und Völkern schon mit großer Genauigkeit bestimmt worden sind. Das ist für den ost-mitteleuropäischen Erfahrungskreis ganz offenkundig nicht der Fall. Selbst für ein abschließendes Urteil über die DDR ist es noch viel zu früh. Eines Tages wird man Gesamtdarstellungen in Angriff nehmen können; bis dahin müssen wir uns mit Vorarbeiten und Annäherungen an dieses Ziel zufriedengeben.
Indem das Buch versucht, die ostdeutsche Erfahrung von innen zu rekonstruieren, versteht es sich zugleich als Beitrag einer noch zu schreibenden Universalgeschichte.
Das führt auf die dritte Entscheidung.
Wer eine Gesellschaft von innen verstehen will, muss sich hüten, Maßstäbe und Urteile an sie heranzutragen, die von außen genommen sind. Er muss auf starre begriffliche Masken, auf ideologisch aufgeladene Symbole verzichten, allen Denk- und Sprachmitteln misstrauen, die etwas beweisen wollen, was schon vorher feststeht.
Abwertende Termini wie »Unrechtsstaat« und »Kommandowirtschaft« vermögen die ostdeutsche Erfahrung ebensowenig aufzuschließen wie die Großbegriffe »Totalitarismus«, »Gewaltherrschaft« und »Diktatur«.
Was ist damit gewonnen, wenn man herausgefunden hat, dass die DDR keine bürgerliche Demokratie und keine Wettbewerbsgesellschaft war?
Das wusste man doch vorher.
Ich habe mich bemüht, die Ostdeutschen und ihre Gesellschaft ohne Voreingenommenheit zu schildern; so, als hätte sich dieser Abschnitt deutscher Geschichte in einer weit zurückliegenden Zeit und an einem schwer zugänglichen Ort ereignet.
Wo immer es ging, habe ich meine eigene Erfahrung an der Erfahrung anderer kontrolliert und eher ihnen das Wort erteilt, als den Leser mit persönlichen Mutmaßungen oder vorschnellen Verallgemeinerungen aufzuhalten.
Die Vielfalt der Stimmen und Ansichten gab mir immer wieder Sicherheit und das Gefühl, von einem Chor getragen zu sein.
Dass sich das persönliche Interesse nicht völlig ausschalten lässt, weiß ich nur zu gut. Wenn es die Form eines wohltemperierten Engagements annimmt, ist schon viel getan. Pathetische Selbstverleugnung, diese intellektuelle Spielart der Hybris, lag mir fern.
Ich wollte unparteilich sein, nicht unpersönlich, und bin für jede Kritik dankbar, die mich des Gegenteils überführt.
Dank schulde ich vielen, vorzüglich einer: ohne Anna Vandenhertz wäre dieses Buch nie entstanden.
Nach zwanzig Jahren …
Mehrmals pro Woche flattern Hinweise auf Diskussionsrunden oder größere Foren, die sich mit der DDR beschäftigen, in meine Briefkästen. So geht das seit Jahr und Tag. Für einen so kurzen Geschichtsabschnitt ein recht erstaunliches Nachleben. Aussichtslos das Unterfangen, einen auch nur annähernd kompletten Überblick über den je aktuellen Diskussions- und Forschungsstand zu gewinnen. Das war schon Ende der 1990er Jahre so, als ich nach Materialien und Quellen zu einer Studie über die DDR-Gesellschaft Ausschau hielt. »Ein überforschtes Feld« stöhnte damals ein Historiker, ohne zu ahnen, was noch folgen sollte.
Mich focht das wenig an. Mein Ehrgeiz galt nicht der Breite und Vollständigkeit der Darstellung. Was ich erfassen, nachzeichnen wollte, war der Grundriss dieser Art von Gesellschaft. Der würde sich aus den Einzelheiten der Untersuchung nicht einfach ableiten lassen, darüber war ich mir im Klaren. Ebenso wenig durfte er ihnen Gewalt antun, sie in ein abstraktes begriffliches Korsett zwängen. Die Lösung des Problems, die ich nach vielem Grübeln fand, kam wie aus dem Nichts, obwohl sie sich vermutlich seit Längerem vorbereitet hatte. Eine arbeiterliche Gesellschaft, darum handelte sich im Fall der DDR wie der ihr wesensgleichen Sozialverbände in Ost-Mitteleuropa.
Plötzlich sprachen die Details, kommunizierten miteinander, ergaben ein stimmiges Ganzes. Arbeiten, Wohnen, Geschlechterbeziehungen, Familienverhältnisse, Freizeitvergnügungen – überall dieselben Üblichkeiten, die Üblichkeiten einer Gesellschaft, der Arbeiter und das Gros der Angestellten ihren Stempel aufdrückten. Infolge einer vorab garantierten Position im Erwerbssystem existentiell gegründet, bildeten sie eine Gesellschaft der Ähnlichen und gingen sozial ungezwungen miteinander um.
Die Architektur der Macht durchkreuzte diese Freiheiten. Wenige maßten sich die Herrschaft über das Leben der großen Mehrheit an und rekrutierten Helfer aus der Mitte der Gesellschaft. Von diesem drückenden Alp befreiten sich die Ostdeutschen spät, aber eindrucksvoll im Herbst 1989.
Die Resonanz auf das Buch war umfänglich, viel Zustimmung, auch Kritik, aber ich denke, im Wesentlichen hat es sowohl den Einwänden als auch der seither verstrichenen Zeit gut standgehalten. Das Konzept der arbeiterlichen Gesellschaft wurde vielfach aufgegriffen, national wie international, von Historikern, Politologen, Kunst-, Literatur-, Theaterwissenschaftlern in ihren Forschungen angewandt, ausgearbeitet, konkretisiert.
Für weitreichende Änderungen anlässlich der Neuausgabe sah ich insofern keinen Anlass. Eingriffe in den Text, Berichtigungen, Ergänzungen betreffen jene Kapitel, die von den politischen Krisen, den kulturellen Zerwürfnissen der DDR-Geschichte handeln, die Darstellung des Kahlschlagplenums von 1965 etwa oder die Biermann-Affäre von 1976. Hier und da stieß ich auf Formulierungen, die ich so nicht stehen lassen konnte. Von »kleinen Leuten« las ich bei der Durchsicht des Ursprungstextes von 1999 an einer Stelle und war ehrlich irritiert. Die gab es in arbeiterlichen Gesellschaften so wenig wie die berühmten »Nischen«, die Interpreten mit westlichem Erlebnishintergrund der Osterfahrung unterjubeln wollten.
Warum? Näheres dazu auf den Folgeseiten.
Berlin, November 2018
Wolfgang Engler
»Die Russen kommen«
Wie die Ostdeutschen Krieg und Nachkrieg erlebten und welche Folgen das hatte
1945
Ich sah die Welt in Trümmern
Noch hatte ich nichts von der Welt gesehn
Ich sah den Tod und die Gewalt
Noch eh ich jung war, war ich alt
Und wusste, ohne zu verstehn.
Ich lernte Tote bergen
Lernte, Ertrunkene tragen (schwere Last)
Die Halbertrunkenen im Wege lagen
Den Fluss versperrend, so lernt ich laufen ohne Rast
Und Weinen ohne Tränen und Hassen
Eh die Liebe in mir einen Ausweg fand
Und war kein Lebendes das mir beistand
Wenn ich immer wieder fiel und aufstand weil da noch
Eins war, was mich nicht liegenließ
Das Fädchen, an dem aufgereiht
Wir alle hingen, wir, Zeugen, Samen
Dünner Faden gedreht aus Menschenhaut der sang
Und Hoffnung hieß und Brot und morgen weiterleben
Die Formel stand im zart gemeißelten Gipsgesicht des toten Fährmanns
In den weit offnen blinden Augen.
Inge Müller
Gleich zu Beginn des Jahres 1946 erging an die Schüler des Berliner Stadtbezirkes Prenzlauer Berg die Aufforderung, einen Hausaufsatz über ihre persönlichen Erlebnisse im Krieg und in den ersten Nachkriegsmonaten zu verfassen. Der oder die Initiatoren dieser Maßnahme lassen sich heute nicht mehr mit Bestimmtheit ermitteln, und dasselbe gilt für ihre Absichten. Vielleicht wollten sie in Erfahrung bringen, wie die Heranwachsenden und deren Eltern den Umbruch verarbeitet hatten, wie sie über die Hitlerzeit und insbesondere über die neuen Verhältnisse im sowjetischen Sektor dachten. Vielleicht wollten sie die noch frischen Eindrücke der Kinder ganz einfach nur festhalten, den Nachgeborenen zur Mahnung. Dafür spricht der Bestimmungsort der Aufsätze – das Heimatkundliche Archiv Prenzlauer Berg.
In jedem Fall kamen im Verlauf der nächsten Monate über 1300 Schüler aus 47 Schulen der Aufforderung nach, wobei die Klassenstufen 6 bis 8, also die damals 12- bis 14jährigen, am häufigsten vertreten waren. In sozialer Hinsicht dominierten bei weitem die Volksschüler. In dem traditionellen Arbeiterbezirk standen einer Erhebung vom Mai 1946 zufolge 1000 Besuchern höherer Schulen etwa 22000 Volksschüler gegenüber.
Entsprechend klar und unprätentiös sind die Aufsätze in ihrer übergroßen Mehrheit abgefasst. Natürlich ist hier und da das Bemühen spürbar, dem Lehrer zu gefallen, eher stilistisch zu überzeugen als durch Wahrhaftigkeit. Manchmal tut die leitende Hand der Eltern ein übriges, um die emotionellen Wogen zu glätten und den Ausdruck in die Bahnen des vermeintlich Gewünschten zu lenken. Aber solche nachträglichen Berichtigungen bilden die Ausnahme von der Regel, zumal die Einflussnahme äußerer Autoritäten gering blieb.
Nur ein verschwindend kleiner Teil der Aufsätze wurde zensiert. Ideologische Maßgaben höherer Schulbehörden oder sowjetischer Administratoren scheinen bei der Abfassung der Erlebnisberichte keine Rolle gespielt zu haben. Die vorgegebenen Spezialthemen – Fliegeralarm, Im Luftschutzkeller, Ausgebombt, Flüchtlingsnot, Wiederaufbau u. a. – sollten den Erinnerungsstrom der Kinder eher sachlich gliedern als geistig normieren. Wie sonst verstünde sich, dass eine der Aufsatzrubriken »Die Russen kommen« lautete und eben nicht »Die Sowjetsoldaten« oder »Die Rote Armee«.
Ausdrückliche Zensur hätte bei solchen Gegenständen ohnehin nichts vermocht. Die Eindrücke, die Krieg und Nachkrieg in den Gemütern der Kinder hinterlassen hatten, waren viel zu unmittelbar und heftig, um wirksam diszipliniert werden zu können. Der Schreibprozess aktualisierte sie im Gegenteil mit einer Wucht, die alle sonstigen Erwägungen konterkarierte oder gänzlich beiseite schob. Die Germanistin Annett Gröschner, die das fast fünf Jahrzehnte vor sich hin dämmernde Konvolut als erste sichtete und 1996 in einer Auswahl der Öffentlichkeit zugänglich machte, untertreibt noch, wenn sie feststellt, »dass sich die Schulaufsätze für die Arbeit an einer Kriegsgeschichte des Stadtbezirkes Prenzlauer Berg von unschätzbarem Wert erwiesen haben«.
Ihre Aussagefähigkeit ist weit allgemeinerer, mentalitätsgeschichtlicher Art. Die Aufsätze beinhalten kollektive Erzählungen, die teils allen Deutschen verständlich waren, die diese Zeit miterlebt hatten, teils ausschließlich jenen, die unter russische Besatzung gerieten. Sie erlauben Rückschlüsse auf die ersten Spuren einer spezifisch ostdeutschen Prägung.
So genau die Notate den Moment festhalten, an dem die Kriegs- und Nachkriegserzählungen der Ostdeutschen von denen ihrer westdeutschen Landsleute abzweigten, so genau fixieren sie Gemeinsamkeiten und Schnittpunkte der beiden Erzählstränge. Da sind die ersten großen, verheerenden Bombenangriffe auf Berlin von Ende November 1943, von denen die Schüler in noch halbtraumatisiertem Duktus berichten; das fluchtartige Verlassen der Wohnungen und die Suche nach Schutz; das Donnern der Einschläge und die Ungewissheit, ob das eigene Haus noch steht; der stechende Brandgeruch nach dem Verlassen der Unterstände; der Gang durch brennende Straßen und der Anblick verkohlter Leichen; die beschleunigten Schritte, der kürzlich verlassenen Wohnung entgegen, und die Erleichterung oder völlige Erschütterung je nach der Verfassung, in der sich die Heimstatt darbot.
»Das war wohl der schrecklichste Weg, den ich je gemacht habe«, beschließt ein 10jähriger Mittelschüler seine Darstellung. Ein kaum älteres Mädchen bekennt: »Ich werde diese Schreckensnacht nie vergessen, denn das schaurige Bild unseres brennenden Hauses taucht immer wieder vor meinen Augen auf.«
Was die Heranwachsenden vom Prenzlauer Berg in immer wiederkehrenden Wendungen desselben Sachverhalts formulieren, war deutsches Gemeingut, Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen gegenwärtig, den Einwohnern Berlins nicht weniger als denen Dresdens, Kölns oder Hamburgs. Höchstens, dass die Jüngeren das Grauen der Bombennächte auf eine besonders ohnmächtige Art erfuhren. Mochte anfänglich die Durchbrechung des gewohnten Lebens, der Ausfall der Schule noch einigen Reiz besitzen, etwas Abenteuerliches, so wich das alsbald schauerlicher Routine, dem tagtäglichen Laufen um das nackte Leben.
Welche Spuren und Langzeitwirkungen dieser Dauerwettlauf mit dem Tod in der kindlichen Psyche hinterließ, hinterlassen musste, vermitteln am eindringlichsten die rückblickenden Schilderungen von Situationen in Luftschutzkellern und Bunkern. Das ohnehin spärliche Licht erlosch bei schweren Treffern in der Nähe, und in dem völligen Dunkel obsiegten endgültig Angst und Panik. Auch die Erwachsenen, Frauen und vom Fronteinsatz dispensierte Männer, verloren oftmals die Beherrschung und verfielen in Weinen und Klagen, was die Kinder nur noch mehr verängstige. Da man nichts tun konnte außer abwarten und hoffen, die auf Abfuhr bedachte Motorik gehemmt war, fand die Angst keinen Ausweg und schoss, sich dabei selbst verstärkend, direkt ins Erleben. Das schärfte die Wahrnehmung, überforderte aber gleichzeitig die Verarbeitungsfähigkeit, besonders der Kinder, wie der folgende Bericht einer 14jährigen verdeutlicht:
»Rumms und rumms und immer wieder dasselbe. Die kleinen Kinder schlangen die Ärmchen um die Hälse der Mütter und verbargen ihre angstvollen Gesichter in den Mänteln der Mütter, und diese wieder strichen mit zitternden Händen über die Köpfe der Kinder. Jeder dachte nur an sich und seine nächsten Angehörigen, jeder fühlte sich einsam und hilflos; aber alle hatten nur den einen Gedanken: Durchhalten, stark sein und leben bleiben. Dieser Gedanke zeichnete sich auch auf den Gesichtern der Männer, Frauen und Kinder ab. Die einen hatten die Zähne so fest zusammengebissen, dass man glaubte, die Backenknochen müssten zerspringen, und die anderen wieder hatten die Fäuste geballt, als könnten sie damit die Gefahr abwenden. Es war dasselbe traurige Bild der Verzweiflung, wie man es bei jedem Bombenangriff und in jedem Luftschutzkeller sehen konnte.«
Die Verfasserin weiß, dass ihre Erfahrung eine allgemeine war, die Erfahrung aller Deutschen in allen Luftschutzkellern. Dennoch halten ihre Worte die eigentümliche Färbung fest, in die die kindliche Wahrnehmung das Geschehen tauchte. Man hat die Jahrgangsgemeinschaft, der sie angehört, die um 1930 herum Geborenen, später die »Aufbaugeneration« genannt und damit deren Funktion und Leistung beim Wiederaufbau der fünfziger und bei der Modernisierung der sechziger Jahre gewürdigt. Und häufig hat man in diesem Zusammenhang auf die dieser Generation noch mitgegebenen Tugenden von Dienst und sachlicher Hingabe verwiesen, in die sich ein kräftiger Schuss Verdrängungssehnsucht gemischt habe. Arbeiten, um zu vergessen also.
Gibt der in der Tat erstaunliche Leistungswillen aber nicht weit eher den Abkömmling des Dahinvegetierens in den Kellern und Kesseln des Zweiten Weltkrieges zu erkennen; die Erfüllung des langgehegten Wunsches, die schmerzliche Blockade der motorischen Reflexe aufzulösen und wieder zum Handeln zurückzufinden? Dann wäre das Aufbauwerk nicht (nur) der Absprung ins Vergessen, sondern (auch) der erfolgreiche Versuch, die tiefgreifend gestörte Balance von Handeln und Erleben durch anhaltende Konzentration auf die Handlungsseite, auf fruchtbringende Taten, ins Gleichgewicht zurückzuzwingen. Arbeiten, um leib-seelisch zu gesunden.
Kollektives Unbewusstes wäre auch hier im Spiel, nur hätte es einen leichter zu entziffernden Ursprung – den menschlichen Leib, den Körper im Zustand der Einschließung, der Gefangenschaft. Die Rede von der Befreiung gewönne so außer der politischen Dimension noch eine ganz elementare, vitale hinzu. Dergleichen muss Vermutung bleiben. Die Schüleraufsätze können sie erhärten, aber nicht beweisen. Zur Befragung zählebiger Klischees über deutsche Tugenden und Sünden laden sie indes ausdrücklich ein.
Soweit bewegen wir uns im Horizont gesamtdeutscher Erfahrungen. Das ändert sich erst, wenn der Krieg in seine abschließende Phase eintritt und Deutschland selbst zum Schlachtfeld wird. Gewiss, die in die Heimat zurückgeworfenen Verbände von Wehrmacht und SS kämpften an allen Fronten verbissen um jeden Meter Boden; es gab erbitterte Endkämpfe im Westen, die bis in die letzten Kriegsstunden währten, und gerade noch rechtzeitige Kapitulationen auf östlichen Kriegsschauplätzen, die das Schlimmste verhinderten. Dennoch wurde der Krieg im Osten und in der Mitte Deutschlands, überall dort, wo die Rote Armee anrückte, mit besonderer Härte und Grausamkeit geführt, bis zuletzt.
Auch davon zeugen die Schüleraufsätze. Um so mehr, als die Schlacht um Berlin gerade im Prenzlauer Berg zu Ende ging, wo noch bis in die Morgenstunden des 2. Mai gekämpft wurde. Schon Tage vorher waren Stalins Bataillone auch in diesen Bezirk eingedrungen, jedoch wieder zurückgeschlagen und dazu gezwungen worden, nunmehr Straße für Straße, Haus für Haus zu erobern. Die schon versprengten Restverbände der Deutschen fürchteten die Rache des Siegers offenbar mehr als den Tod und richteten noch während der beginnenden Auflösung jeder militärischen Ordnung Überläufer und Kapitulanten gnadenlos hin.
Wer sich in den ersten Friedensstunden ins Freie wagte, erblickte eine wahrhaft infernalische Stadtlandschaft. Was die Bombenangriffe noch verschont hatten, war durch Dauerbeschuss zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen. Überall in den Straßen taten sich Krater auf. Deutsche und russische Soldaten lagen im Tode vereint und säumten die Wege. Zusammen mit diesen letzten Kriegstoten bildeten Tierkadaver und verendende Pferde einen langsam vermodernden Teppich.
Wie in Berlin verhielt es sich entlang der gesamten, zur Elbe vordrängenden Ostfront. Die Angst, »Barbaren« in die Hände zu fallen, trieb den »totalen Krieg« auf die Spitze und lieferte, nachdem auch die Niederlage eine totale geworden war, die Bevölkerung einem Sieger aus, den zu fürchten sie allen Anlass hatte. Dass die Angst vor dem Krieg der Angst vor dem Frieden wich, grundierte die ostdeutschen Erzählungen der sogenannten Stunde Null.
Konrad Wolfs Spielfilm Ich war 19 fing diese Atmosphäre nervöser Gespanntheit, einer fröstelnden Ruhe wohl am eindringlichsten, weil aus der Doppelperspektive, ein: aus der Perspektive des mit der Roten Armee nach Deutschland heimkehrenden deutschen Kommunisten sowie aus jener der Geschlagenen, die ihn und seine Genossen erwarten. Eine der ersten längeren Einstellungen des Films zeigt aus der Höhe den menschenleeren Marktplatz von Bernau, der nordöstlich vor Berlin gelegenen Kreisstadt, und präsentiert dann Häuserfronten. In helles Sonnenlicht getaucht, klirren sie vor Kälte und artikulieren derart die stumme Angst der Bewohner, die sich dahinter verkrochen haben. Hier können Steine reden.
Sie konnten es auch später. Das steinerne Gedächtnis arbeitete im Osten Deutschlands mit besonderer Zuverlässigkeit.
Fotografien und Aufnahmen ostdeutscher Städte, die erst heute, nach den umfänglichen Stadtsanierungen der Nachwendezeit, historisch zu werden beginnen, bestätigen das. Natürlich bemühten sich die Kommunen, die Kriegsschäden zu überwinden, im Osten wie im Westen, mit erstaunlichem Erfolg. Dieser Erfolg veranlasste eine der wenigen optimistisch getönten Alltagserzählungen vom Nachkrieg. Auch darüber geben die Aufsätze Auskunft. So listet ein 10jähriges Mädchen jede Erleichterung mit Stolz und Freude auf, die das erste Friedenshalbjahr brachte, um dann hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken:
»Wir haben Licht, Wasser und Gas, wir bekommen unsere Zuteilungen ohne lange anzustehen, wir erhalten Post und Päckchen, die Zeitung wird ins Haus gebracht, die Straßen werden gefegt, die Aufräumungsarbeiten nehmen ihren Fortgang, sämtliche Bahnen fahren, die Typhusepidemie ist zurückgegangen, und in der Schule haben wir normalen Unterricht. Und nach einem Jahr werden wir noch viel weiter sein.«
Es ging weiter, doch der Ausgangszustand schimmerte im Osten auch Jahrzehnte später noch deutlich durch. Straßen und Bürgersteige wurden befahr- und begehbar gemacht, aber nur schleppend erneuert. Das Autobahnnetz auch der späten DDR war im wesentlichen noch immer das aus der Hitlerzeit. In den Häusern wohnten wieder Menschen, auch der Wohnkomfort wuchs, obschon langsam, aber viele Fassaden der Altstädte kündeten noch immer von den Kämpfen der letzten Kriegstage. Dass die Eisenbahnen wieder fuhren, war erfreulich; weniger Anlass zur Freude bot das Streckennetz, das auch in den Folgejahren kaum saniert, geschweige denn ausgebaut wurde, so dass sich die Reisezeiten mit den Jahren wieder verlängerten. Nimmt man die aus früheren Zeiten übernommenen Fabriken dazu sowie jene, die nach dem Abschluss der Aufbau- und Modernisierungsphase von der Substanz lebten, kann man dem Zeitgeschichtler Lutz Niethammer nur beipflichten: »der Krieg blieb [den Ostdeutschen] viel näher als den Westdeutschen; ihr Schicksal blieb mit ihm verkettet, überall konnte man seine Zeichen lesen, und seine Folgen ragten in viele Familien hinein, denen die Fürsorge für Kriegsopfer, -witwen und -waisen aufgebürdet worden war«. Unterschiedlicher Erinnerungsdruck und emotionaler Tiefgang der auf so unterschiedliche Art vergegenständlichten Zeiterfahrung bewirkten, dass sich die Nachkriegsdeutschen schon in den vorsprachlichen Bezirken ihres sozialen Daseins langsam, aber sicher voneinander entfernten.
Doch zurück zu den Ängsten der ersten Friedenstage. Die gab es natürlich überall in Deutschland. Nur manifestierten sie sich östlich der Elbe auf durchaus unverwechselbare Weise. Hier gab es nicht nur die Angst vor dem Morgen oder die von Funktionsträgern des Hitlerregimes vor Entdeckung und Bestrafung, sorgten sich nicht nur daheimgebliebene Männer im wehrfähigen Alter, für in Zivil geschlüpfte Soldaten gehalten und in Gefangenschaft geschickt zu werden. Hier war die Angst eine allumfassende, alles durchdringende, dabei unbestimmt und höchst konkret zugleich. Konkret und präzise benennbar war die Angst insofern, als es nicht beliebige Soldaten waren, die Ostdeutschland besetzten, sondern eben »die Russen«. Und dass die Deutschen gegen das Sowjetvolk keinen gewöhnlichen Krieg geführt hatten, war jedermann geläufig, auch wenn er nicht alle Einzelheiten des Vernichtungsfeldzugs kannte. Völlig offen war jedoch, wie sich die Soldaten in dem Fall verhalten würden, der einen selbst und die Nächsten betraf. Vielleicht gehörte man zu den Glücklichen, und die Schreckensmeldungen, die den Russen vorauseilten, bestätigten sich nicht. Vielleicht suchten einen aber auch die Rachegeister heim.
Die Schüleraufsätze protokollieren das Schwanken zwischen Angst und Hoffnung minutiös. Sie variieren ein und dieselbe Ur-Szene: die erste Begegnung mit einem Sieger, der nicht strahlend Einzug hält, sondern erschöpft und grimmig, in dessen Hand das eigene Geschick nunmehr gegeben ist. Auch die Begleitumstände des Zusammentreffens kehren wieder. Die Besiegten kauern im Keller ihres Hauses und warten in peinigender Ungewissheit auf das Unvermeidliche – die ersten Russen. Dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, zum Beispiel so:
»Es war dunkel draußen, als die ersten Russen unser Haus betraten. Kurz danach kamen zwei von ihnen zu uns in den Keller, sie fragten nach Soldaten und Waffen. Ein Herr fragte einen nach Zigaretten, der Russe gab sie ihm auch bereitwillig. Als er sich die Zigarette angezündet hatte, hob der Russe die Pistole und verlangte ›Uhri‹ die ihm der Mann unter dem Druck geben musste. Darauf verschwanden die Russen. Kaum waren sie gegangen, als fünf andere erschienen, diese sagten: ›Fünf Frau komm bei Offizier sauber machen.‹ Dann suchten sie sich fünf Frauen aus und gingen mit ihnen in eine der offenstehenden Parterrewohnungen und vergewaltigten sie dort.«
In diesem Fall hatten sich die bösesten Vorahnungen bewahrheitet.
Mitteilungen über oder wenigstens Andeutungen von Vergewaltigungen finden sich in einer größeren Zahl von Aufsätzen. Sie waren und blieben Bestandteil rein ostdeutscher Erzählungen über das Kriegsende und die Nachkriegszeit. In der Folge verschwanden diese Erzählungen zunehmend aus der Öffentlichkeit, um sich im Privaten einzunisten. Hier, im privaten Kreis, zirkulierten sie bis zum Ende der DDR. Es dauerte bis in die späten siebziger Jahre, ehe das heikle Thema in der öffentlichen, vor allem literarischen Erzählung wiederkehrte.
Die Prenzlauer-Berger Schüler gehen mit diesen Dingen noch recht unbefangen um, selbst dann, wenn sie kommunistisch erzogen wurden wie das 13jährige Mädchen, das seine noch kindliche Überzeugung und die Übergriffe der sowjetischen Soldaten scheinbar mühelos in Einklang bringt:
»Wenn auch die Russen die Frauen schändeten und den Leuten Vieles fortnahmen, so dürfen wir nie vergessen, wie unsere Soldaten in Russland hausten und dass an dem ganzen Elend allein, Hitler und seine Konsorten schuld daran sind und dass das, was die Russen taten, als Kriegsrecht gilt.«
Sollte die erwachsen Gewordene kommunistischen Überzeugungen treu geblieben sein, dürfte sie mehr Vorsicht geübt haben als das Kind, das sie war, zumindest im öffentlichen Sprachgebrauch.
Die Spontaneität, mit der sich die meisten Kinder seinerzeit äußerten, resultierte nicht nur aus der naturgemäß geringeren kindlichen Selbstkontrolle. Sie hat noch einen weiteren, im Zusammenhang dieser Überlegungen gewichtigeren Antrieb – Kinder wurden von den Rotarmisten weitaus freundlicher und zuvorkommender behandelt als Erwachsene. Das Bild des lächelnden, kinderliebenden Russen, vor dem man – als Kind – keine Angst haben muss, ist kein Klischee, sondern Standardmotiv der Schülerberichte, und zwar unabhängig vom politischen Standort des jeweiligen Elternhauses:
»Den Kindern waren die Russen sehr zugetan«, erinnert sich ein 13jähriger Volksschüler. »Viele von ihnen bekamen Schokolade, Brot und Mittagessen.« Ein 12jähriges Mädchen memoriert: »Durch die uns gemachte Propaganda erwarteten wir nun das Schlimmste und waren angenehm überrascht als ein russischer Kommissar auf unserem Hofe erschien und uns bat, vernünftig zu sein, damit nichts zu geschehen brauche. Die Kinder wurden auf den Arm genommen und bekamen Zucker und Schokolade.«
So geht es von Aufsatz zu Aufsatz.
Umgekehrt zeigten sich die Kinder den Besatzern gegenüber bei weitem am aufgeschlossensten; ihre Neugier siegte immer wieder über Scheu und Furcht, so dass sie von selbst aus den Kellern kamen, um sich die Russen einmal aus der Nähe anzusehen. Der folgende Bericht über die Vorgänge in der Ostberliner Wichertstraße steht für viele, nicht zuletzt wegen seiner abschließenden Wendung. Er sei daher etwas ausführlicher zitiert:
»Der Einmarsch ging nicht etwa lautlos vor sich. Man hörte Zurufe, Brüllen, seltsame Schreie, die ich nicht verstand. Maschinengewehrschüsse, auch Kanonendonner. Nun rasselte der bespannte Tross heran. Eine Unmenge Kastenwagen, bespannt mit gutgenährten Pferden, wie ich sie in Ostpreußen gesehen habe. Also waren die Pferde auch schon Siegesbeute. Ein Teil des Trosses fuhr auf den Hof unseres Wohnhauses, der bald einer Wagenburg glich. Nun hielt es mich aber nicht mehr in der Wohnung. Schnell war ich unten und nahm Deckung im Kellereingang. Ich wollte gern wissen, wie die Russen zu den Kindern sind. Schreckliches hatte ich schon früher gehört. In Wirklichkeit war der Russe anders. Die Russen brauchten Wasser für ihre Pferde. Wir Kinder halfen Wasser tragen. Der Lohn für unsere Arbeit ließ nicht lange auf sich warten. Der russische Kutscher hob den Wagenplan, griff in eine Kiste und stopfte uns die Hände voll Schokolade oder Bonbon oder Puffreis. Welche Marke Schokolade aßen wir? ›Trumpf‹! Also auch Beuteware, die der Russe noch gar nicht lange bei sich führte; denn die Schokoladenfabrik Trumpf steht in Weißensee.
Das Bild des Einmarsches der Russen änderte sich von Viertelstunde zu Viertelstunde. Der russische Stab … rückte heran. Automobile kamen, Motorräder mit Beiwagen, Kutschen mit ostpreußischen Trabern bespannt, rollten heran. Russische Jäger sausten durch die Luft. Ich wusste bald nicht, was mehr sehenswert war, die russischen Offiziere in schneidigen Uniformen, der mongolische Meldefahrer der nach jeder Rückkehr eine dicke Zigarre rauchte. Bis jetzt hatte ich die Russen von der guten Seite kennengelernt. Jetzt kamen einzelne Russen in den Keller. Sie forderten ›Uhri‹ und Schnaps. Oft fuchtelten die Russen meinem Vater vor der Nase herum und wollten ihn erschießen, weil sie glaubten, er wäre ›deutscher Soldat‹.«
Man sieht: Die Eroberer unterschieden in der Art, wie sie die Bevölkerung behandelten, so intuitiv wie rigoros. Sie bestätigten die Erwachsenen in ihrer Furcht, und sie gewannen gleichzeitig das Zutrauen der Kinder. Jenen nahmen sie Uhren oder sonstige Wertsachen ab, diesen gaben sie etwas; die einen mussten Verhaftung, Erschießung oder Vergewaltigung gewärtigen, die anderen durften die Pferde versorgen, auf Panzer klettern oder ungestört auf Höfen und Straßen herumtollen. Die Älteren sowie die fast erwachsenen Jugendlichen beiderlei Geschlechts bekamen die Schandtaten von Wehrmacht und SS deutlich zu spüren, die Jungen durften sich ihrer Unschuld erfreuen.
Man übertriebe sicher, wollte man aus dieser Ungleichbehandlung auf ein gespaltenes Gedächtnis schließen, auf grundverschiedene Erzählungen und Erzähltraditionen von Alten und Jungen. Es musste die Kinder zutiefst erschrecken, wenn ihre Väter mit dem Tod, ihre Mütter mit Vergewaltigung bedroht wurden. Auch waren bei den letzten Kriegshandlungen viele deutsche Zivilisten durch russischen Beschuss gestorben, was zu gemeinsamer Trauer und wohl auch Hass auf »die Russen« Anlass gab. Wenn darüber hinaus, wie mehrfach erwähnt, keine Unterschiede gemacht, Erwachsene und Kinder vielmehr gleichermaßen zusammengetrieben wurden und erfuhren, dass man sie allesamt exekutieren würde, wenn sie die Verstecke deutscher Soldaten nicht sogleich verrieten, dürften die Generationen in ihrer Angst und Ablehnung solcher Besatzerwillkür einig gewesen sein.
Dennoch, der Unterschied bestand. Während die Angst der Erwachsenen sich nur verwandelte, von den Bomben löste und dafür an die Russen heftete, kamen die Kinder wenigstens phasenweise von Ängsten los. Sie strichen eine Friedensdividende ein, genossen das Gefühl der Befreiung und fassten es in Worte:
»Aber – wer war denn das? Ein Russe? Tatsächlich! Und dort noch einer und auf der anderen Seite auch. Sprachlos und gebannt, wie vom Schlage getroffen, stand ich vor unserem Haus. Mein Blick fiel auf einen Russen, der, von Kindern umringt, deutsche Soldaten entwaffnete. Er strahlte dabei über das ganze Gesicht und jubelte: ›Gitler kaputt, Woina aus, Woina aus.‹ Jetzt ging mir ein Licht auf, ich jubelte mit und rannte in den Keller, um die freudige Botschaft zu verkünden. Der Krieg war zu Ende!«
Leider erfahren wir nichts über die Resonanz, die die Worte des 13jährigen Mädchens bei den im Keller sitzenden Erwachsenen fanden. Man darf eine minder emphatische Reaktion vermuten.
Befreiung oder Zusammenbruch – so einfach liegen die Dinge wohl nicht. Aber dass die Jüngeren eher jenen, die Älteren eher diesen Eindruck gewannen und konservierten, liegt nach dem Bisherigen nahe. Man muss hier weniger in politischen Kategorien denken und mehr in solchen des »Lebens«, also noch einmal daran erinnern, dass das Wort »Befreiung« besonders für Kinder und Jugendliche einen unideologischen, vital-praktischen Sinn besaß – Befreiung des Körpers aus unerträglicher Gefangenschaft, Rückeroberung von Bewegung und Spielräumen, Auflösung der motorischen Blockade und wiederentdeckte Lust am freien Spiel der Kräfte.
»Wir Kinder des Hauses spielten auf dem Hof zwischen Pferden und Wagen und verstanden uns mit den russischen Soldaten sehr gut, wir bekamen oft einen guten Happen, das gefiel uns. Durch die Rote Armee wurden wir endlich von dieser schweren Zeit erlöst.«
Völlig unpathetisch drückt ein 13jähriger aus, was wohl viele seines Alters damals empfanden – die Erlösung von einem Alp.
Auch darf man nicht vergessen, dass er und seine Altersgenossen beinahe ihr ganzes Leben vor sich sahen, ihre Eltern günstigstenfalls noch einmal die nämliche Zahl an Jahren. Neu anzufangen steht in unser aller Kraft; wirklich von vorn beginnen kann nur die Jugend.
Dass aus den doch recht unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven der Generationen keine gespaltene Erzählung der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte hervorging, war dem deutlichen Bewusstsein aller Ostdeutschen geschuldet, einem Volk anzugehören, das Kriegsverbrechen begangen und daher mit Verachtung und Züchtigung zu rechnen hat. Die bloße Existenz sowjetischer Soldaten rief die Erinnerung an diese Verbrechen tagtäglich wach. Die Art, wie sie die Erwachsenen behandelten, verlieh ihr nur stärkere Konturen. Konfiskationen, Plünderungen, Vergewaltigungen kamen nicht von ungefähr; sie hatten einen Grund. Und dieser Grund schimmerte in den allmählich verhaltener und leiser vorgebrachten Klagen der Erwachsenen beständig durch.
Ihre Klage war das Echo anderer Klagen; von Klagen, zu denen ihre kollektiven Söhne reichlich Anlass gegeben hatten. Sie konnten fremde Schuld nicht namhaft machen, ohne von der eigenen zu reden oder doch beredt zu schweigen.
Das entging den Kindern nicht. Das Befreiungsgefühl, das sich gerade in ihnen ausgebreitet hatte, zog sich wieder zusammen. Die Wärme und Sympathie, die ihnen von den russischen Soldaten entgegenschlug, erschien plötzlich in anderem Licht – als eine unverdiente und eigentlich auch unverständliche Gunst.
»Wir können froh sein, dass es uns nach diesem grausamen Krieg nicht noch schlimmer ergangen ist«, schreibt ein 12jähriges Mädchen. Anderswo heißt es: »Ich wundere mich überhaupt, dass die Rote Armee so für uns sorgt, da sie es gar nicht nötig hätte.«
So dachten wohl etliche und fühlten sich dementsprechend in der Pflicht der Befreier. Jung, wie sie waren, konnte erst ihr künftiges Leben den Vertrauensvorschuss rechtfertigen, der ihnen zuteil geworden war:
»Unsere Sorge soll sein, ein neues, einiges Deutschland zu bekommen, damit wir erneut Ansehen in der Welt genießen und wieder aufgenommen werden in die Reihen der friedliebenden Völker.«
Pathetische Selbstbeauftragungen wie diese bleiben in der Minderzahl. Meist geht es sehr viel nüchterner ab. Aber die geistige Haltung ist dieselbe. Indem die Kinder ihr Bestes für ein neues Deutschland geben, begleichen sie die Rechnung, die sie, vorzüglich aber ihre Eltern bei den russischen Soldaten und deren Familien offen haben. Von diesem Rückerstattungsbedürfnis konnte der ostdeutsche Teilstaat lange zehren.
Gleich ihren Jahrgangsgenossen im Westen fühlten sich die ostdeutschen Kinder und Jugendlichen einer Nation von Verlierern zugehörig. Deutlicher als diese empfanden sie die Schmach, einer Nation von Missetätern anzugehören. Diese Schmach galt es zu tilgen. Arbeiten, um auch moralisch zu gesunden, hieß die Devise.
So wies die Arbeit von vornherein über die bloße Verrichtung und ihr Ergebnis hinaus, gewann sie einen übersinnlichen, fast metaphysischen Charakter. Dass sich dieses aus Teilen der Gesellschaft selbst hervorgegangene Arbeitsverständnis machtpolitisch benutzen und auch missbrauchen ließ, beweist allein schon die spätere Praxis, Funktionären, Wissenschaftlern oder Künstlern, die in irgendeiner Hinsicht gefehlt hatten, innere Reinigung durch körperliche Arbeit zu verordnen.
Auch die Kunst der fünfziger und frühen sechziger Jahre, die mit Vorliebe arbeitende Menschen gestaltete, hatte es auf einen Homo faber besonderer Prägung abgesehen. Indem er den Widerstand der Materie und der Umstände brach, schuf er produktive Werke, die freilich in keinem Verhältnis zu dem Werk standen, das er selbst verkörperte als einer, der den größten Widerstand gebrochen, das höchste Hindernis bezwungen hat – sich selbst; der über die eigenen Bedürfnisse, den tiefverwurzelten Egoismus hinaus- und bei der Menschheit angekommen war.
Die Entdramatisierung der körperlichen Arbeit im öffentlichen und künstlerischen Diskurs, als deren Zäsur die Wirtschafts- und Sozialreformen von 1963 gelten können, besiegelte das Ende der Nachkriegszeit und stand insofern für Normalisierung. Da die Rationalisierung der heroisch überspannten Arbeitspraxis jedoch auf Dauer nicht gelang, die Metaphysik der Arbeit andererseits nicht wiederzubeleben war, endete das Unternehmen in der Auszehrung jeglicher Arbeitsmotivation. Der innere Auftrag ging verloren, der äußere besaß keine Sporen, um sich Nachdruck zu verschaffen. Die weder moralisch noch monetär zu beeindruckende Mehrheit ergriff endgültig die Herrschaft über das Wirtschaftsleben und die soziale Zeit.
Das ist ein Vorgriff. 1946 ist die spätere DDR nur eine Möglichkeit unter vielen. Für die Verfasser der Schulaufsätze lag sie jenseits des Vorstellbaren. Die meisten von ihnen fühlten sich vermutlich auf eine besonders intensive Weise mit Deutschland, mit der soeben zu Ende gegangenen Geschichtsperiode verbunden, auch wider Willen. Das Leben in der sowjetischen Besatzungszone erinnerte sie fortgesetzt an die in deutschem Namen begangenen Untaten und Verbrechen. Und irgendwie schienen gerade sie, die jungen Ostdeutschen, vom Schicksal dazu auserkoren, für das Versagen aller Deutschen zu haften. Zwar definierten die Zonengrenzen noch kein Wohlstandsgefälle. Dass sich den allgemeinen Kriegslasten aller Deutschen eigens für den Osten bestimmte hinzugesellten, zeichnete sich jedoch bereits in aller Deutlichkeit ab.
Teile der persönlichen Habe konnten kurzerhand requiriert, Frauen und reifere Mädchen vergewaltigt, Männer verhaftet oder deportiert werden. Hinzu kam die Demontage ganzer Industriekomplexe samt Abkommandierung von Fachleuten. Von den noch produktionsfähigen Betrieben gingen viele in den Hoheitsbereich der sowjetischen Militäradministration über, was der Konsolidierung der Wirtschaft weiteren Abbruch tat.
Andere Belastungen hingen mit dem atemberaubenden Umbruch des sozialen Lebens zusammen, der die Veränderungen in den Westzonen beinahe gemächlich erscheinen ließ. Ländlicher Großgrundbesitz wurde verstaatlicht und eine Bodenreform eingeleitet; auch im industriellen Sektor waren Enteignungen und nachfolgende Verstaatlichungen an der Tagesordnung. Verwaltungen, Schulen, Hochschulen, Gerichte, Verlage und Redaktionsstäbe wurden nach Würdenträgern und höheren Parteigängern des NS-Regimes durchkämmt, und im selben Zuge richtete man Schnell- und Sonderkurse für politisch Unbelastete ein.
Der fragwürdigen Auszeichnung, den größten Teil der Zeche zu bezahlen, assoziierte sich das nicht minder zweifelhafte Privileg, sich auch noch vollständig umkrempeln und für die moralischen Schulden einstehen zu müssen. Auch das gehört zum ostdeutschen Sonderbewusstsein nach dem Krieg.
Beinahe nichts blieb beim alten, und dennoch oder gerade deshalb schienen die Ostdeutschen nicht von ihrer Vorgeschichte loszukommen.
Der doppelte deutsche Staatenbildungsprozess von 1949 gibt ein gutes Exempel für diese Paradoxie. Es war die Bundesrepublik, die formell und förmlich die Rechtsnachfolge des Dritten Reiches antrat, wodurch das Staatsvolk der Westdeutschen zur Wiedergutmachung verpflichtet wurde. Da diese sich in geregelten Bahnen vollzog und kalkulierbar blieb, konnten sowohl das Gewissen als auch die Wirtschaft allmählich aufatmen. Wirtschaft und Wohlstand wuchsen schnell, und damit wuchs auch die Gewissheit, über die Vergangenheit hinaus- und in einer völlig anders gearteten Gegenwart angekommen zu sein.
Nur die Eliten der Naziherrschaft erinnerten noch an die alte Zeit und störten periodisch die Gemütsruhe. Als sich auch deren Reihen zu lichten begannen, schien der Bruch mit der Vergangenheit perfekt. Der Rechtsnachfolger hatte sich sozusagen freigeschwommen.
Anders die DDR. Sie verweigerte die Rechtsnachfolge, ohne dass die Bevölkerung der schon zuvor geübten Tributpflicht entkam. Durch diese »wilde«, schwer kalkulierbare Form der Wiedergutmachung konnten das kollektive Gewissen und auch die Wirtschaft lange nicht entspannen. Wirtschaft und Wohlstand wuchsen nur zögernd, so dass die Gegenwart eher den Anschein einer verlängerten Vergangenheit bekam – Fortsetzung von Mühsal und Entbehrung in anderer sozialer Gestalt. Zudem bemühten jede neue Kampagne, jeder weitere Eingriff in das soziale Gefüge, von den ersten Enteignungen bis hin zum Mauerbau, Nazizeit, Krieg und Verbrechen als letzten Rechtfertigungsgrund. Wo der politische Diskurs verstummte, erklang der stumme der Steine.
Die Hauptverantwortlichen an der Misere verließen das Land, das Bewusstsein von Schuld und Schande nahm dauerhafte Heimstatt. Kurz und gut: Gerade der Staat des ausdrücklichen Bruchs mit der Vergangenheit rekapitulierte sie unaufhörlich.
Seltsam, aber wahr: Je unwiderruflicher sich die Ostdeutschen aus ihrer Einbindung in die gesamtdeutsche Vorgeschichte lösten, desto eindringlicher sahen sie sich mit derselben konfrontiert. Sie arbeiteten sich aus dem Desaster auf eine Weise hervor, die sie unwiderruflich daran kettete. Sie änderten sich in vielem schneller und gründlicher als die Westdeutschen und trugen das Zeichen ihrer Herkunft dennoch deutlicher auf der Stirn geschrieben als diese. Sie konnten nur Ostdeutsche werden, indem sie Deutschland nahe blieben, Deutsche auf eine schwer zu bestimmende Weise nur bleiben, indem sie Ostdeutsche wurden.
Dabei gefiel ihnen das, was unverkennbar ostdeutsch an ihnen war und wurde, mehrheitlich ebensowenig wie ihre deutsche Signatur. Dieses doppelte Missfallen, den alten Adam und den neuen Menschen gleichermaßen betreffend, die fundamentale Unzufriedenheit mit dem, was sie waren, wurden und sein sollten, gehörten zu den formativen Elementen des ostdeutschen »Wesens«.
Man kann dem auch eine positive Wendung geben und sagen: Die Ostdeutschen lebten im Dauerabstand zu sich selbst und begriffen sich auch so; gelernte Skeptiker, widerriefen sie jede Zuschreibung, Fixierung, Benennung im Nu und erfüllten dank dieser Unbestimmtheit und Unbestimmbarkeit das Grundkriterium sozialer Freiheit – kein festes Wesen zu haben, mit mehreren existentiellen Möglichkeiten experimentieren zu können.
Aufbau und Aufstand
Wie die Ostdeutschen in neue Häuser und Städte zogen und über deren richtigen Gebrauch mit ihrer Führung stritten
Der Setzling wird ein Baum.
Der Grundstein wird ein Haus.
Und haben wir erst Haus und Baum
Wird Stadt und Garten draus.
Und weil uns unsere Mütter
Nicht für das Leid geborn
Haben wir alle gemeinsam
Glücklich zu leben geschworn.
Bertolt Brecht
Ziemlich genau zwanzig Jahre, nachdem die Prenzlauer-Berger Schüler ihre Aufsätze geschrieben haben, verlässt eine Ostberliner Lehrerin ihre Arbeitsstelle. Sie durchschreitet in elegantem Kostüm und Absatzschuhen die lichtdurchfluteten Gänge, begibt sich zur freitragenden Treppe und von dort zum Ausgang, einem Portal aus Glas. Draußen besteigt sie den Bus, mit dem sie schließlich, von der Schillingstraße kommend, die Karl-Marx-Allee erreicht. Dort steigt sie aus, wendet sich einem der Neubauten aus den frühen sechziger Jahren zu und verschwindet darin. Das Treppenhaus wiederholt in verkleinertem Maßstab das der Schule, aus der sie kommt, und schlingt sich luftig-filigran nach oben.
In ihrer Wohnung angelangt, betritt die Frau, die kaum älter als dreißig Jahre sein dürfte, zunächst das Wohnzimmer. Das Licht, das durch die großen Fenster dringt, erhellt den weitläufigen Raum und mit ihm die geschmackvolle Einrichtung. Man erkennt einen der Küche zugewandten Essplatz für die Familie, eine freistehende Liege, ein Bücherregal aus dem Baukasten, das sich leicht montieren und verändern lässt, sowie eine Sitzecke mit Kaffeetisch und schlanken Sesseln. Alles ist mit sicherer Hand arrangiert und wirkt dennoch offen, fast provisorisch. Man meint, die Gegenstände könnten jederzeit, wie bei einer Theaterprobe, in Bewegung geraten, die Orte wechseln, um sich der jeweiligen Situation anzupassen.
Gerade weil es in Fluss bleibt, spendet das Leben mit solchen Dingen Freude und Zufriedenheit. Sie dienen nicht der Anschauung oder gar der Repräsentation, sondern dem Gebrauch. Brauchbar zu sein, gebraucht zu werden ist ihre ganze Bedeutung, ihr ganzer Zweck.
Kinderzimmer, Küche, Flur und Bad zeigen denselben funktionalen Zuschnitt. Nichts ist dem Zufall überlassen, und nichts muss so bleiben, wie es ist.
Ihrem Alter nach könnte die Frau, der wir noch einmal begegnen werden, selbst auf den Schulbänken von 1946 gesessen und einen der erwähnten Aufsätze geschrieben haben. Erwachsen und Lehrerin geworden, lebt sie mit ihren Schülern in einer anderen, weitaus erfreulicheren Welt. Sie lebt nicht nur in ihr – sie preist sie auch. Ihre ganze Erscheinung, ihr gesamter Gang vom Schulhaus bis zur eigenen Wohnung verkünden das Ende der alten Zeit und darüber hinaus den Anbruch der Moderne.
Egon Günthers Film Lots Weib aus dem Jahre 1965, dem dieser Auftritt mit lauter Ausrufungszeichen entstammt, ist ein besonders aussagefähiges, jedoch keineswegs isoliertes Dokument des neuen Lebensgefühls. Der Nachkrieg, das zeigen die Bilder, war nun doch zu Ende gegangen, die Vergangenheit zwar nicht vergessen, doch auf Abstand gebracht. Nun, da man sich irgendwie angekommen wähnte, nicht mehr nur unterwegs, überblickte man auch die Stationen, Anläufe, Versuche besser, vom Gestern ins Heute zu gelangen.
Nur ein paar hundert Meter östlich der neuen Karl-Marx-Allee hatte das vormals Neue seine sichtbarsten Spuren hinterlassen – gebautes Unbehagen an der durchgreifenden Modernisierung der Lebensverhältnisse, wie man nun befand; tastender, noch halbblinder Aufbruch; marmorner Stolperstein der städtischen Moderne.
Wer sich selbst auf den Weg macht, vom Frankfurter Tor dem Alexanderplatz entgegen und von dort in Richtung Palast der Republik, wird diese Kritik verstehen, aber auch einordnen können. Er gewinnt darüber hinaus eine geraffte raumzeitliche Vorstellung der einander ablösenden Stadt- und Gesellschaftsvisionen des ostdeutschen Staatswesens.
Am Anfang war die Stalinallee; ein kontroverser Anfang, der Streit für die Zukunft verhieß. Hans Scharoun, der renommierte Werkbundmann, stieg als erster in den Ring. Sein Bebauungsplan aus dem Jahre 1949, »Wohnzelle Friedrichshain«, folgte dem dezentralen, demokratischen Leitbild der klassischen Moderne. Durch niedrige Bebauung, Laubengangfassaden, Abkehr von der Hauptverkehrsachse sollten Stadt und Landschaft miteinander versöhnt und zudem überall derselbe »Wohnreiz« geschaffen werden. Das Projekt stand im Einklang mit den Gedanken zur neuen Gestalt der Stadt, die Scharoun ein Jahr zuvor in der Monatszeitschrift bildende kunst veröffentlicht hatte. »Die der Stadt zukommende Form«, hieß es darin kurz und bündig, »ist die Stadtlandschaft. Die formvollendete Durchdringung natürlicher Gegebenheiten und der Baumittel stellt sich in den schwach und stark besiedelten Stadtteilen gleich überzeugend dar.«
So wie Scharoun dachte auch die Friedrichshainer Bezirksfraktion der SPD und befürwortete in gut sozialdemokratischer Bautradition (für die die Wiener Höfe das noch immer imposanteste Beispiel geben) die Errichtung eines »Stadtdorfes« mit Marktplatz, Gemeinschaftsbauten, Kulturstätten, kommunalen Einrichtungen sowie angegliederten »Gärtnerhöfen und Gärtnerdörfern«, die den notwendigsten Nahrungsbedarf für die Stadtbewohner sichern sollten.
Mitten im Aushub der Baugruben fielen diese Konzepte einem städtebaulichen Paradigmenwechsel zum Opfer, der seinerseits Ergebnis einer sechswöchigen Reise war, die eine Abordnung maßgeblicher ostdeutscher Architekten und Baufunktionäre nach Moskau, Kiew und Stalingrad geführt hatte. Ihre unmittelbare Frucht waren die berühmten Sechzehn Grundsätze des Städtebaus, die der DDR-Ministerrat nebst einem davon inspirierten »Aufbaugesetz« im September 1950 erließ.
Sie hielten dem sozial unbezüglichen Modernismus »das Prinzip des Organischen und die Berücksichtigung der historisch entstandenen Struktur der Stadt« entgegen, der azentrischen Stadt mit überall gleicher Wohnqualität die funktional geordnete Stadt: »Das Zentrum der Stadt ist der politische Mittelpunkt für das Leben seiner Bevölkerung. Im Zentrum der Stadt liegen die wichtigsten politischen, administrativen und kulturellen Stätten. Auf den Plätzen im Stadtzentrum finden die politischen Demonstrationen, die Aufmärsche und die Volksfeiern an Festtagen statt.«
Die Grundsätze dekretierten jedoch auch, dass der Verkehr der Stadt und ihrer Bevölkerung zu dienen haben, jene nicht zerreißen und dieser nicht hinderlich sein dürfe. Die aus Gruppen von Häuservierteln bestehenden »Wohnkomplexe« sollten mit Gärten und reichlich Grün sowie mit Kindergärten, Schulen und dezentralen Versorgungseinrichtungen versehen werden. Insgesamt sollten die städtische Öffentlichkeit nicht vom Kommerz bestimmt, Händler und Touristen nicht ihre Leitgestalten sein.
Im Entscheidenden gab es jedoch keinen Kompromiss:
»Der Grundsatz ist nicht umzustoßen: in der Stadt lebt man städtischer; am Stadtrand oder außerhalb der Stadt lebt man ländlicher.« Und: »Die Architektur muss dem Inhalt nach demokratisch und der Form nach national sein.«
Das war das Ende für Scharoun und seine Pläne. Zwar hatte er sich noch seine eigenen Gedanken über die Grundsätze gemacht und selber welche formuliert. Doch die verschärften den Bruch nur, wie eine kleine Auswahl zeigt:
»Die Stadt gibt Wohnung für den Menschen, für die ihm lieben und nützlichen Tiere und die ihm notwendigen Naturkräfte.
Die Wohngegend steht in einem gewissen Gegensatz zum Erwerbsgebiet, auf dem der Mensch im Kampf steht um seines Wachstums willen, um der Vermehrung der Menschen willen, zum Preise des Guten.
Das Wohngebiet ist exterritorial, ist friedlich, und dort gilt das Wort ›Stadtluft macht frei‹.«
Genau dies wollte der Auftraggeber nicht, nicht mehr. Das Stadtdorf nicht und erst recht nicht die der Konkurrenzgesellschaft innewohnende Polemik von Wohn- und Arbeitswelt, hier Kampf, dort trügerischer Frieden. Scharoun ging und verwirklichte seine Ideen bald darauf im Westberliner Hansaviertel. Der Stalinallee hatte er die beiden Laubenganghäuser zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor vermacht, die als gleichsam erratische Blöcke in den veränderten Kontext hineinragten.
Nun kam die Reihe an den 1905 geborenen Hermann Henselmann. Der hatte sich schon zeitig als Moderner ausgewiesen, war 1934 aus rassischen Gründen aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen worden und bis zu seiner Desertion aus einer der SS unterstellten Bauabteilung im Jahre 1945 als Namenloser im Industrie- und Rüstungsbau untergekommen. In den ersten vier Nachkriegsjahren Direktor der Weimarer Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst und entschiedener Fürsprecher des Formenkanons der modernen Architektur, war er nun höchstamtlich zum Chefarchitekten und damit zum Widerruf bestellt.