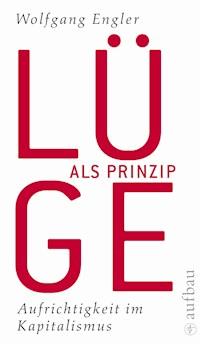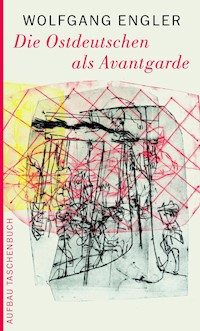
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was der Westen vom Osten lernen kann »Wer immer die Gesellschaft Ost verstehen will, muß Engler lesen.« Süddeutsche Zeitung Englers facettenreiche Studie illustriert den Sprung der Ostdeutschen an die Front der globalisierten Weltgesellschaft. Er lotet die Konsequenzen der damit einhergehenden Risiken und Chancen für die Menschen in ganz Deutschland aus. »Noch niemand hat so offen den Ostdeutschen die Ablösung der Arbeitsgesellschaft nahe gelegt. ... die wichtigste Neuerscheinung zum Thema.« Literaturen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Wolfgang Engler
Die Ostdeutschen als Avantgarde
Impressum
ISBN 978-3-8412-0056-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Die Erstausgabe erschien 2002 bei Aufbau
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Torsten Lemme
unter Verwendung einer Radierung von Andreas Zahlaus
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Vorrede
Das ostdeutsche Idiom
Wie es kam, daß die »Ostdeutschen« aus der DDR als Ostdeutsche hervorgingen
Herausforderung und Antwort
Warum es nach 1989 nicht zum Streit der Generationen kam und wie die Jüngeren den Umbruch verarbeiteten
Vom Kollektiv zum Team
Wie die arbeiterliche Gesellschaft die industrielle Vergangenheit konservierte und die Menschen dennoch für die Zukunft erzog
Downsizing auf ostdeutsch
Wie die arbeiterliche Gesellschaft sich auflöste, was an ihre Stelle trat und worüber man ganz neu nachdenken muß
Schicksal und Geschick
Warum Ostdeutsche ihr Scheitern nicht psychologisieren, sondern unbeirrt in soziale Begriffe fassen
Die kritische Masse
Warum sich die Ostdeutschen von der Arbeitsgesellschaft befreien müssen, um ihr Glück zu finden, und wie das gelingen könnte
Nachbemerkung
Quellenhinweise
Vorrede
Habt Ihr die Lag, in die das Schicksal Euch
Versetzt, bereits erwogen? Wißt Ihr schon,
Wie Euer Herz darin sich fassen wird?
Heinrich von Kleist, Das Käthchen von Heilbronn
Gewöhnlich kristallisiert sich der Titel eines Buches endgültig erst im Schreibprozeß heraus; hier stand er am Anfang, und ich bin dem geschäftsführenden Leiter des Aufbau-Verlags, René Strien, für diesen Vorschlag zu großem Dank verpflichtet.
Indem er das vermeintlich Unvereinbare in eine Formulierung faßte, dem allzu Vertrauten eine überraschende Wendung gab, hat er mir das Schreiben mit ermöglicht.
Am Interesse, den Faden meiner früheren Abhandlung über die Ostdeutschen dort wieder aufzunehmen, wo sie endete, 1989, hat es nicht gefehlt und ebensowenig an Ermutigung durch Kritik und Leserschaft.
Auch mangelte es nicht an Material, im Gegenteil; man hat in bezug auf Ostdeutschland in Analogie zum aggressiv betriebenen Fischfang schon seit längerem von einer »überforschten Landschaft« gesprochen; und wie man diese Forschung im einzelnen auch beurteilen mag – die Entvölkerung der soziologischen Jagdgründe hat sie jedenfalls nicht zu verantworten.
Allenfalls könnte man ihr einen Mangel an Perspektive zum Vorwurf machen.
Viele Untersuchungen verfahren äußerst kleinteilig, und haben sie einen übergeordneten Gesichtspunkt gefaßt, der die Liebe zum Detail begründet, dann verbergen sie ihn oftmals mit derselben Hartnäckigkeit, mit der sie die Einzelheiten vor dem Publikum ausbreiten.
Arbeiten mit größerem Radius verketten die Ereignisse zumeist entlang der Zeitachse, der empirischen Abfolge gemäß, in der sie sich zugetragen haben, und erwecken dadurch den Eindruck, als fälle die Ordnung des Archivars das abschließende Urteil über die Ordnung der Dinge.
Was die beschauliche Ruhe des Archivs zum Schweigen bringt, ist genau das, was die Problemgeschichte interessiert: das Ächzen der Scharniere, wenn sich Ereignis an Ereignis fügt; die Risse in der Ordnung, die sich allein dadurch bilden, daß es in jedem Augenblick mehr als eine Möglichkeit gibt, die Kette der Begebenheiten fortzusetzen; der Kampf der Deutungen um die verbindliche Auslegung des Seins, der in dem simplen, aber nur allzu oft vernachlässigten Umstand gründet, daß die Menschen Geschichte nicht machen können, ohne sie zu interpretieren, ihrem Tun und dem der anderen Sinn beizumessen, und zwar nach Lage und Erwartung je verschiedenen; der beständige Wechsel von vorläufigem Abschluß und erneuter Öffnung der Horizonte, der die Handelnden immer wieder Anker in die Zukunft werfen läßt, an deren Tauen sie sich forthangeln, den Boden unter den Füßen vorsichtig ertastend.
Das Leben einzelner wie umfassenderer Überlebenseinheiten läßt sich chronologisch ordnen, aber um es zu verstehen, muß man die Chronologie verlassen und die einzelnen Episoden nach dem Maß ihrer Erlebnis- und Orientierungsqualität gewichten; erst dadurch entsteht eine Erzählung.
Die Gewichtung bereits abgeschlossener Episoden verändert sich mit jeder wirklich neuen Erfahrung in der Gegenwart, der Erzählimpuls kommt immer aus der vorgestellten Zukunft.
Das Leben ist ein Fortsetzungsroman, und wie bei jedem Roman ist es die Konzeption des Ganzen, die Perspektive, die Kapitel an Kapitel reiht.
Perspektive ist kein Attribut des Intellekts, sondern des Willens; dem Klügsten wird sie verschlossen bleiben, wenn sich nicht Leidenschaft hinzugesellt.
Und so falsch es auch ist anzunehmen, der Wille zur Zukunft sei ein ausreichender Garant für ein gelingendes Leben, so ist es doch vollkommen zutreffend zu sagen, daß er allein Berge zu versetzen und den Blick auf die geschichtliche Landschaft zu öffnen vermag.
Eine soziologische Erzählung muß dieses praktische Wunder nachahmen und ihre Absichten gleichfalls ins Futurum setzen.
Ist das im vorliegenden Fall womöglich allzu phantastisch?
Schließen sich die Worte »Ostdeutschland« und »Zukunft« nicht wechselseitig aus? Klingt »Die Ostdeutschen als Avantgarde« nicht wie eine Parodie auf Verhältnisse, mit denen sich Müdigkeit und Resignation zwangloser verbinden als Zuversicht und Tagtraum?
Für mich eröffnete sich erst durch diesen Zugang die Möglichkeit, über die Ostdeutschen nach 1989 schreiben zu können, und so unsicher ich meiner Sache zu Anfang war, so erstaunt war ich, als die Wirklichkeit, derart zur Rede gestellt, zu antworten begann.
Ob es mir gelungen ist, ihr die Zunge so zu lösen, daß sie vernehmlich genug spricht, darüber steht einzig dem Leser ein Urteil zu.
Noch ein abschließendes Wort zum Umgang mit dem Material.
Vor die Wahl gestellt, meine Gedanken mit brillant formulierten Argumenten aus der gebildeten Welt zu untermauern oder die leibhaftige Rede der Akteure für sie zeugen zu lassen, auch da, wo sie stockte, entschied ich mich in neun von zehn Fällen gegen den akademischen Diskurs und für das Dokument.
Mir schien, ich müßte die Menschen sehen, von denen ich handelte, und um mir Gewißheit über die Ernsthaftigkeit ihrer Ansichten und Überzeugungen zu verschaffen, fand ich keinen besseren Bürgen als ihre Körper und Körperhaltungen, ihre Blicke und ihr Mienenspiel.
Ein Dokumentarfilm, den ich sah, ersetzte mir ein Dutzend Bücher.
Mir ist bewußt, daß ich mich damit dem Vorwurf der Ignoranz aussetze, aber in einer Zeit wie der unseren, in der man die Welt vor lauter Informationen kaum noch sieht, stimuliert die Diät der Fakten direkt den Appetit der Phantasie.
Das ostdeutsche Idiom
Wie es kam,
daß die »Ostdeutschen« aus der DDR
als Ostdeutsche hervorgingen
Andererseits, dieser Personenkreis wäre zu haben gewesen für ein gesellschaftspolitisches Engagement, das dem Selbstverständnis der Bundesrepublik zu mehr Wirklichkeit verhelfen wollte, was Rechtssicherheit, soziale Gerechtigkeit, Verständigung mit den osteuropäischen Nachbarn und Kriegsopfern angeht; und nämlich nicht als fünfte Kolonne im ausländischen Auftrag, sondern aus einer Loyalität zur Bundesrepublik, die sich eine bessere Bundesrepublik wünscht, eine Verwirklichung auch von Erwartungen, die die DDR enttäuscht hat. Es ist leider nicht ausgemacht, ob die Bundesrepublik einer Loyalität bedarf, die über die Umlage kommunaler Kosten hinausginge. Vorläufig ist es möglich, daß ein politisches Engagement verkümmert zur passiven Verarbeitung von Politik.
Uwe Johnson, Versuch, eine Mentalität zu erklären (1970)
Eine soziologische Erzählung über die Ostdeutschen, über ihr kollektives Geschick seit dem 89er Umbruch und über die Aussichten, die sich ihnen im heutigen Deutschland und in der Welt eröffnen, muß sich zuallererst ihres Personals versichern.
Die Ostdeutschen – gibt es die überhaupt? Bilden sie, nachdem sie Mauer und Befestigungsanlagen zum Einsturz brachten, noch eine abgrenzbare Einheit? Weiß die politische Geographie der Gegenwart noch von Ostdeutschen und Ostdeutschland? Stimmt die Himmelsrichtung?
Diese Fragen sind alles andere als rhetorischer Natur; sie führen mitten ins Thema. Sie stellen sich bei dieser Untersuchung auch nicht zum ersten Mal, sondern tauchten bereits im Zusammenhang einer früheren Betrachtung auf, die »Die Ostdeutschen« ebenfalls im Titel führte. Und es hat nicht an Kritiken gefehlt, die darin eine unzulässige Verallgemeinerung erblickten, wenn nicht sogar Schlimmeres, eine abgehobene, dem Denken und Fühlen der Menschen äußerliche Konstruktion.
Zunächst: Kollektive Biographien, gemeinschaftliche Schicksale gibt es so gut wie individuelle, und solange man sich der Vielfalt in der Einheit bewußt bleibt, spricht nichts gegen ein solches Verfahren. »Der Ostdeutsche« wäre eine gehaltlose Abstraktion gewesen, die die schlechtesten Traditionen der alten Völkerkunde heraufbeschworen hätte; »Die Ostdeutschen« schloß die Differenz in sozialer, kultureller, geschlechtlicher und generationsmäßiger Hinsicht von vornherein ein, freilich auch das die Unterschiede Übergreifende, die in der unendlichen Abstufung von Lagen und Charakteren sich manifestierenden Gemeinsamkeiten.
Das simple Mißverständnis einmal ausgeräumt, Identität eigne nur dem Individuum, der Person, höherstufigen Überlebenseinheiten aber nicht, bleibt immer noch der andere Einwand. Die objektiven Gemeinsamkeiten, die die Analyse herauspräpariert, können dem verbreiteten Empfinden der Menschen durchaus widersprechen.
In der Tat bezeichneten die Bewohner der DDR sich selbst kaum als »Ostdeutsche«; ein Problem, mit dem die frühere Abhandlung rang, ohne eine Lösung zu finden, die Objektives und Subjektives befriedigender in Einklang brachte. Natürlich wäre es möglich gewesen, den offiziellen Sprachgebrauch aufzugreifen und von »DDR-Bürgern« zu sprechen. So argumentierte auch ein Kritiker in vorwurfsvollem Ton:
»Ein Buch mit dem Titel ›Die Ostdeutschen – Kunde von einem verlorenen Land‹ wäre vor der Wiedervereinigung in der DDR auf jeden Fall für das Werk eines Revanchisten gehalten worden. Dort gab es keine Ostdeutschen, sondern nur Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die überdies auch kein ›verlorenes Land‹ im Osten kannte, da sie sich für ein neues Deutschland hielt; das alte hatte Hitler verspielt. Nur die westdeutschen Revanchisten sprachen noch von Ostdeutschland und nannten die DDR Mitteldeutschland.«
Was hätte Uwe Johnson dazu wohl gesagt, der schon in den sechziger Jahren in seinen literarischen Werken wie selbstverständlich von »Ostdeutschen« und »Westdeutschen« sprach, um gegenüber ideologischen bzw. revanchistischen Zuschreibungen wie »die Brüder und Schwestern in der Zone« oder »die Mitteldeutschen« ausdrücklich Abstand zu gewinnen? Und so wie mit diesen Etiketten hätte es sich auch mit den »DDR-Bürgern« verhalten. Die Formel suggeriert, gewollt oder ungewollt, eine Identifizierung mit dem Staatswesen, die mehrheitlich gerade nicht vorhanden war. Sich ihrer zu bedienen hätte bedeutet, die bei unterschiedlichen sozialen Gruppen unterschiedlich ausgeprägte Distanz zur DDR stets mitzuformulieren, und das wäre der Darstellung schon sprachlich nicht gut bekommen.
Aus sachlichen Gründen weit näher lag die Rede vom »gelernten DDR-Bürger«, in der die ironische Distanz zu den politischen Gegebenheiten und zu sich selbst vernehmbar mitschwang. Sie stets aufs neue zu bemühen, widerstrebte mir nicht nur aus stilistischen Gründen; irgendwann hatte der gelernte DDR-Bürger die DDR ebenso über wie der ohne weitere Ausschmückung und wünschte sich nur noch eines – Bürger ohne DDR zu sein. Diese Ablösung im einzelnen darzustellen war eine der wesentlichen Absichten des Buches. Ihr kam »Die Ostdeutschen«, geographisch korrekt und gefühlsarm, am besten entgegen.
Eine letzte, dann doch verworfene Möglichkeit bestand darin, die Ostdeutschen zunächst durchgehend in Anführungszeichen zu setzen und erst auf jenem Punkt der Argumentation auf diese zu verzichten, an dem die derart Angesprochenen sich ihren Weg ins Freie bahnten und die DDR geistig und praktisch überwanden. Das allein hätte die Perspektive des Soziologen mit jener der Akteure versöhnt und den massenhaften Abstoßungsprozeß sprachlich korrekt markiert.
Nur, wer hätte das beim Lesen wirklich so verstanden und dabei nicht vielmehr die in Anführungszeichen gesetzte oder als »sogenannt« apostrophierte DDR aus den Zeiten des Kalten Krieges assoziiert?
All diese Schwierigkeiten und Fallstricke ins Kalkül gezogen, erscheinen mir »Die Ostdeutschen« noch heute als die komfortabelste Lösung.
Dies um so mehr, als sich die Bewohner der DDR nach dem Umsturz der politischen Verhältnisse und, je längere Zeiträume seither verstrichen, in desto höherem Maße gerade als Ostdeutsche zu erkennen gaben.
Daß »die Ostdeutschen«, wie der Titel dieses Kapitels es zum Ausdruck bringt, als Ostdeutsche aus der DDR hervorgingen, ist in vieler Hinsicht erstaunlich und einer eigenen Betrachtung wert.
Setzten sie sich doch zunächst auf dem kurzen Weg vom Spätherbst 1989 bis zum Vollzug der deutschen Einheit in ihrer großen Mehrheit unübersehbar gesamtdeutsch in Szene, sprachlich, symbolisch, programmatisch. Sie kannten, scheint es, seit »das Volk« aus dem bestimmten in den unbestimmten Artikel ausgewandert war – »Wir sind ein Volk« –, nur noch Deutsche.
Daß der kollektive Resonanzboden, der den Ruf erschallen ließ, nicht rein, sondern mit Kränkungen und Ressentiments (»Deutsche zweiter Klasse«) durchsetzt war, kräftige Verstrebungen noch älterer Prägungen aufwies, verstörte vor allem die Gebildeten in beiden Teilen Deutschlands. Hier schienen Tabus und Verkapselungen aufzubrechen, die am besten für immer unter Verschluß geblieben wären.
»Die Westdeutschen verwuchsen mit Westeuropa, viele sogar mit Nordamerika; die Ostdeutschen fanden nur wenig Zugang zu ihren Nachbarn«, schrieb der Historiker und Journalist Peter Bender, und: »Die Westdeutschen wurden Europäer, soweit man das werden kann, die Ostdeutschen blieben deutsch.« Mit diesem Urteil offenbar nicht ganz zufrieden, fügte er sogleich hinzu:
»Beide wurden von ihrem politischen und wirtschaftlichen System geprägt, und da es vier Jahrzehnte lang geschah und mehrere Generationen schon in diesen Systemen aufwuchsen, wirkte die Prägung stark und nachhaltig. Aus Deutschen wurden einerseits Ostdeutsche und andererseits Westdeutsche, ein Unterschied, der die Vereinigung mehr als alles andere behindert.«
Wie nun?
Entstiegen die Einwohner der DDR dem von ihnen selbst zum Einsturz gebrachten Staatsgebäude als Deutsche oder als Ostdeutsche? Resultierten die Reibungen zwischen den beiden Großgruppen vornehmlich daraus, daß die Ostler zu viel Nationales, Nationalstaatliches mitbrachten; »altdeutsches« Gepäck, mit dem die Westler nichts mehr anzufangen wußten, oder hatte umgekehrt zwischen Elbe und Neiße doch eine der »Verwestlichung« entsprechende »Veröstlichung« stattgefunden?
Oder gilt vielleicht das von Bender nicht in Betracht gezogene Dritte, daß sich die Ostdeutschen in ihrem Wunsch und Angebot, als Deutsche, möglichst erster Klasse, wahrgenommen und behandelt zu werden, abgewiesen fühlten und deshalb einen Wissens- und Erfahrungsvorrat, der ihnen geläufig war, nach Anknüpfungspunkten für die neue Zeit befragten?
Dafür spricht einiges.
Manchem mag es so ergangen sein wie dem Schweißer aus Wismar, den ein Dokumentarfilm aus der Mitte der neunziger Jahre zu Wort kommen ließ.
Im Unterschied zu vielen seiner einstigen Kollegen von der Matthias-Thesen-Werft war er während der Dreharbeiten noch in dem unterdessen in »Meerestechnik Wismar« umbenannten Unternehmen tätig. Die Belegschaft schrumpfte zu dieser Zeit weiter und ebenso das Betriebsgelände. »Der Zaun kommt immer näher an die Halle heran«, hört man ihn sprechen, »die Werft wird immer kleiner.« Dem aktuellen Eigentümer droht Insolvenz.
Noch weiß er nicht, wie der Nachfolger, die »Bremer Vulkan«, mit ihrem Besitz verfahren wird. Indes bedurfte er dieser Erfahrung auch gar nicht, um den Ostdeutschen in ihm aufzurufen. Sein prägendes Erlebnis lag bereits Jahre zurück. Kurz nach der Grenzöffnung war er im Harz, und da traf es sich, daß der Brocken, bis dahin militärisches Sperrgebiet, wieder für jedermann zugänglich war.
Oben angekommen, begegnete er einem Westdeutschen, der mit ausgestrecktem Arm über die Landschaft fuhr und verkündete: »Da unten, das reißen wir alles ab, wird neu gebaut.«
Das genügte; seine damalige Erregung hat sich mit den Jahren kaum gelegt.
»Das gibt ’n Stich ins Herz. Das war unser, das ham wir uns aufgebaut. Wir könn’ selber Schiffe entwickeln, haben sie auch entwickelt, die fahrn heute und diesen Tach noch, ich wüßte nicht, daß eins untergegangen ist, normalerweise, wir ham Häuser gebaut, wir ham Städte gebaut, gut, wir ham nur zwei Autotypen gebaut, Trabant und Wartburg, nicht ’mal das ham wir richtig hingebracht.«
Kein Lobredner der DDR, wie die abschließende Wendung zeigt, nicht blind für ihre gravierenden Mängel, sieht er sich um seiner Selbstachtung willen zur Verteidigung der eigenen Errungenschaften veranlaßt und benennt, einmal am Zuge, die dazugehörige Verhaltensweise:
»Ich sage, der Ostdeutsche, ich weiß nicht, ob er’s noch is, er war früher aufgeschlossener allem gegenüber, er war persönlicher, geselliger, wir ham schöne Betriebsfeiern gehabt, mit Tanzen mit Ehegatten […] Das gibt’s heute alles nich mehr. Das war wie weggeblasen, obwohl die Menschen dieselben geblieben waren.«
Solche Aussagen findet man viele, und wie man sieht, sind es keineswegs nur die sogenannten Wendeverlierer, die sie formulieren.
Eine Frau, Mitte Vierzig wie der Schweißer auch, die im selben Film erscheint, entzieht dem Vorurteil, das »ostdeutsche Gefühl« sei rückwärtsgewandt und auf Abstiegserlebnisse zurückzuführen, vollends den Boden. In der DDR hatte sie Ökonomie und Technologie der Tierproduktion studiert und die Wende genutzt, um sich selbständig zu machen.
Am Anfang sieht man sie im Mercedes-Benz, später in ihrem Büro im schlichten, modischen Kostüm. Sie hat es, fürs erste jedenfalls, geschafft. Aber neue Erfahrungen, sie mögen beruflicher oder privater Natur sein – das bleibt im Hintergrund –, geben ihr diese Worte ein:
»Auf der Strecke geblieben ist, glaube ich eindeutig, wohl der unkomplizierte Umgang untereinander, weil es war ja eigentlich damals so, daß jeder wußte, was der andere hatte, und im Grunde genommen hatte man genausowenig wie rechts und links der, die wirklich mehr hatten, mit denen hatte man nichts zu tun, und insofern wars unproblematisch, mit Leuten, die man kurz kannte, zusammen Kaffee zu trinken oder irgendwo hinzugehen und sich zu unterhalten. Jetzt ist es doch durch den Verlust der Arbeit bei vielen und durch die materielle Veränderung, vom Lebensstandard eben her, komplizierter, und dieses materielle Denken wächst bei uns eben immer stärker rein. Dieses Zwischenmenschliche ist bei uns doch ziemlich den Bach runtergegangen.«
»Aus uns«, fügt sie abschließend hinzu, »sind auch alles vernünftige Leute eigentlich geworden. Ich glaub’, wer damals zu DDR-Zeiten gut klar gekommen ist, kommt es jetzt auch.«
So einfach und direkt, wie sie vermutet, ist der Zusammenhang zwischen einstiger und heutiger Lebensbewältigung wohl nicht, aber darauf kommt es hier auch gar nicht an.
Ihre Äußerung zeigt nachdrücklich, daß die Wertschätzung ostdeutscher Tugenden nicht nur aus dem Munde derer kommt, die die DDR stützten und repräsentierten, sich nicht nur bei jenen findet, die den neuen Verhältnissen Tribut zollen mußten; sie ist auch Menschen geläufig, die ihre Fähigkeiten erst nach dem Umbruch in vollem Umfang entwickeln konnten, die beruflichen Erfolg und materiellen Wohlstand vorzuweisen haben.
Natürlich spielen auch Bitterkeit und kultureller Korpsgeist eine Rolle, Ausschluß- und Abstiegserfahrungen und nicht zuletzt das Gefühl der Fremdbestimmung.
Das »ostdeutsche Idiom« hat seine sozialen Dialekte; es wird unverkrampft gesprochen und spannungsgeladen, beiläufig und gezielt, defensiv und angriffslustig, im kleinen und im großen Plural.
Daß sich die vielen Klangfetzen immer wieder zur Melodie zusammenfügen, darüber geben noch die blassesten Zeitzeugen, Zahlen, Umfragen und Statistiken genaue Auskunft.
Für den »Sozialreport« seit den frühen neunziger Jahren repräsentativ nach ihrer Identifikation mit den verschiedenen Dimensionen des politischen Raums befragt, hatten die Bürger der »neuen Bundesländer« folgende Wahl:
Daß die Gemeinden, die Städte und Stadtbezirke sowie die Bundesländer in der Gunst der Bürger höher stehen als der ganze Kontinent, mag man angesichts der dem »Aufbau Ost« von der Europäischen Gemeinschaft zufließenden Geldmittel bedauern; erstaunlich ist das Gefälle nicht. Teils erklärt es sich aus dem Radius der einzelmenschlichen Erfahrung, teils aus den diesen Ebenen zugeschriebenen Einflußmöglichkeiten.
In höchstem Maße erstaunlich ist dagegen, daß die emotional intensivsten Bindungen ausgerechnet jener Ebene gelten, die als einzige auf der politischen Landkarte gar nicht verzeichnet ist – Ostdeutschland.
Die Verbundenheit mit Ostdeutschland hat sich im Verlauf der letzten Jahre noch erhöht und übertrifft sogar, faßt man die beiden ersten Spalten zusammen, die erfahrungsnäheren Lebensbezirke, Lokalität und Bundesland. In auffälligem Kontrast dazu kühlten sich die auf die Bundesrepublik als Ganze gerichteten Gefühle seit dem Anfang der neunziger Jahre stetig ab.
Da mangels repräsentativer oder sonstiger, speziell für den Osten Deutschlands konzipierter Institutionen eine eigentümlich politische Identifizierung mit Ostdeutschland ausscheidet, kann es sich nur um eine rein kulturelle handeln.
Zwischen dem Kleinen und dem Großen angesiedelt, als politischer Bezugsrahmen irrelevant, als kultureller desto bedeutsamer, vermittelt »Ostdeutschland« den dort lebenden Menschen zweifellos die stärksten Zusammengehörigkeits- und Identitätsgefühle.
Daß die Bundesrepublik unter jüngeren Menschen höheres Ansehen genießt als unter älteren, trifft zu, vor allem für die unter Fünfundzwangzigjährigen. Aber selbst in diesen Altersgruppen überwiegt die Unentschiedenheit, das Zögern, fühlen sich die weitaus meisten »weder der DDR noch der BRD« verbunden.
Die einzige ostdeutschen Jugendlichen gewidmete Langzeitstudie des Leipziger Jugendforschers Peter Förster gelangt zu demselben Ergebnis und läßt darüber hinaus erkennen, daß der Anteil derer, die sich der Bundesrepublik bereits »vollkommen« zugehörig fühlen, in den neunziger Jahren mit leicht rückläufiger Tendenz bei etwa einem Drittel verharrt.
Unentschieden, zögerlich zeigen sich die Ostdeutschen auch im Bevölkerungsdurchschnitt. Die Mehrheit verspürt weder Sehnsucht nach der DDR noch allzu große Sympathie für das neue Gemeinwesen. Das zieht sich durch sämtliche Alters-, Qualifikations-, Berufs-, Einkommens- und Statusgruppen. In jeder dieser statistischen Kategorien rangiert die Selbstzurechnung als Bundesbürger deutlich hinter der Einordnung in »weder DDR noch BRD«.
Daß Arbeitslose Bundesbürgergefühle seltener entwickeln als die Beschäftigten und daß unter diesen wiederum die Beamten eine überdurchschnittlich hohe Affinität zum neuen Staat bezeugen, überrascht ebensowenig wie die insgesamt positivere Einstellung der Besserverdienenden.
Am Gesamtbild ändern diese Unterschiede wenig.
Nicht länger in fest umrissenen, kaum überwindbaren Grenzen lebend, politisch der Bundesrepublik und Europa, militärisch der NATO, wirtschaftlich dem ganzen Globus inkorporiert, zogen die Ostdeutschen nach 1990 selber Grenzen, fließende zwar und immaterielle, für ihr Selbstwertgefühl, für ihr Leben und Zusammenleben jedoch sehr greifbare.
Schon für die DDR-Zeit keine realitätsfremde Konstruktion, formierten sich die Ostdeutschen nach dem Systemwechsel zu einer wohlunterscheidbaren Überlebenseinheit. Aus den Ostdeutschen an sich wurden die Ostdeutschen für sich.
Wie keine andere Konstante der politischen Geographie vermittelt »Ostdeutschland« zwischen dem einzelnen und der gesamten kulturellen Gruppe, und indem es die emotionalen Valenzen bindet, die durch das Verschwinden der DDR frei wurden, auch zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Anders als manche glauben, wurde die ostdeutsche Identität nicht erst mit und nach der Wende erfunden, schon gar nicht aus freien Stücken; sie wurde vielmehr zugleich erfunden und entdeckt, d. h. geschöpft. Als Material diente eine kollektive Denk- und Verhaltensart, die, solange die DDR bestand, nicht weiter auffiel, wohl eher als willkommene Beigabe des »Systems« betrachtet wurde; das Motiv, ein kulturelles Band zu knüpfen, das die einzelnen umfing und stärkte, fungierte als Fokus.
Der ostdeutsche Gemeinsinn kopiert die DDR-Geschichte nicht; er bedient sich ihrer als Steinbruch für Erzählungen, die der Vergangenheit Bewandtnis, der Gegenwart Rückendeckung und dem Schritt in die Zukunft Orientierung geben, und je größer die Gefahr der Zerstückelung der Biographien, der Regression des Gedächtnisses auf ein bloßes Vorher und Nachher ist, desto wichtiger wird die lebensgeschichtliche Einordnung des historischen Bruchs.
Um die Bedeutung eines in Würde erzählbaren Lebens für die Ostdeutschen der Nachwendezeit zu veranschaulichen, wüßte ich kein besseres Beispiel anzugeben als das von Jürgen Schütze, Hauptakteur in dem Dokumentarfilm »Die Schützes: 1989–1999« von Wolfgang Ettlich.
Als er das erste Mal gemeinsam mit seiner Frau Kathrin und Tochter Sandra vor der Kamera erscheint, ist die Mauer gerade gefallen. Er arbeitet als Leiter eines staatlichen Obst- und Gemüseladens im sächsischen Zschopau, möchte aber so bald wie möglich ein eigenes Geschäftslokal eröffnen, möglichst gleich mehrere. Kurz darauf reist er nach München zu einem großen Früchte- und Gemüsemarkt und knüpft Handelsbeziehungen mit einem Großhändler aus dem Westen an. Als er von dort die erste Lieferung bekommt, bildet sich vor dem Laden eine große Schlange, wie früher, nur gibt es diesmal verführerische Ware und die Geschäfte gehen gut.
Im Sommer 1990 eröffnen die Schützes einen eigenen Stand am Markt. Das Leben des Paares kreist von früh bis spät um Arbeit, immerhin auf eigene Rechnung, und »Herr im Hause« sind sie auch. »Die Menschen müssen sich total ändern«, erzählt er dem Dokumentaristen. »Mit Kollektiv spielt sich nichts mehr ab. Wie gearbeitet wird, bestimme ich.«
Gleich nach der Währungsunion kauft er sich ein Motorrad – ein alter Traum. »Wir sind wer«, freut er sich. »Mit Geld ändert sich die Persönlichkeit.«
Ein Urlaub mit der Frau am bayerischen Tegernsee zeigt ihm die Grenzen auf. Inmitten des wohlhabenden und eleganten Publikums wirken die beiden irgendwie verloren. Sie fühlen sich unsicher und sichtlich gehemmt. »Wir sind immer noch zu schüchtern.«
Zu Hause regt sich die Konkurrenz und die Qualität der gelieferten Ware läßt wiederholt zu wünschen übrig. Manchmal wacht er nachts auf, mit immer demselben Gedanken – »Die Kunden müssen bei mir stehen.«
Im Frühjahr 1991 hat er neue Gewerberäume aufgetan. Auf Kredit und nach Hinterlegung entsprechender Sicherheiten erwerben die Schützes gleich das ganze Haus – etwas fürs Alter und für die Tochter.
Im Herbst eröffnet das Geschäft, das Molkereiprodukte und Käsespezialitäten führt. Schon denkt er an einen Gemüseladen mit Innenstadtlage. Doch unterdessen sterben auch in Zschopau die Fabriken; das dämpft die Konsumtion.
Am geschäftlichen Nerv getroffen, engagiert sich Jürgen Schütze für die Belange der Arbeiter in der Region. Er wird Vorsitzender des örtlichen Gewerbeverbandes und spricht in einer großen Werkhalle vor der Belegschaft des Motorradwerkes »MZ«. Dabei versucht er sich erstmals im ostdeutschen Idiom:
»Vor der Wiedervereinigung warn wir doch gar nicht so schlecht. Unsere erzeugten Produkte wie von MZ, Plaste, Strumpfindustrie, Feinseide, Baumwolle wurden in den alten Bundesländern und in den westlichen Staaten aufgrund der guten Preise uns aus der Hand gerissen, aus der Hand genommen […] Und jetzt soll das alles totgemacht werden, wir begreifen das nicht. Diese Betriebe haben doch einen guten Namen […] Es gibt fast den Verdacht, daß die Treuhand Betriebe schließen läßt, um Produkte aus den alten Bundesländern hier abzusetzen. Wir haben schon vierzig Jahre nicht viel gehabt, aber Arbeit hatten wir immer. Jetzt haben wir ein einig Deutschland, aber keine Arbeit mehr. Wir fühlen uns verraten und verkauft.«
Kurz nach diesem Auftritt schließt »Frucht-Schütze« am Markt endgültig die Läden. Parkplätze mit Parkuhren sind für die Stadt finanziell einträglicher – die erste große Enttäuschung.
Dann geht es wieder ein kleines Stück voran. Für die noch freien Geschäftsräume des erworbenen Hauses findet sich im Sommer 1992 ein zahlungskräftiger Mieter – Mercedes-Benz wird ein Verkaufsbüro eröffnen. Dafür muß das Haus jedoch zuvor mit neuen Krediten repräsentativ hergerichtet werden.
Bei den Umbauarbeiten verletzt sich Kathrin Schütze ernstlich; sie fehlt erst länger im Geschäft, und als sie zurückkehrt, kann sie nicht mehr wie früher mit anpacken. Unglücklicherweise geht der Umsatz gerade zu dieser Zeit merklich zurück. Sie versuchen es mit Personaleinsparungen, können den Laden aber nicht halten. Als nunmehr abhängig Beschäftigte der Handelskette SPAR führen sie ihn noch einige Zeit weiter, dann geben sie notgedrungen auf.
Im Sommer 1993 hat Jürgen Schütze mehrere Kaufmärkte von SPAR gepachtet; man sieht ihn von Laden zu Laden fahren. »Es liegt an jedem selber«, sagt er noch immer, aber er wirkt gehetzt. »Ich kann nicht aufgeben. Ich bin einundfünfzig Jahre.«
Das drohende Scheitern vor Augen, sucht er nach Schuldigen und findet sie in den »alten Genossen«, die ihre Position behauptet haben; »Steinbruch und Straßenarbeiten« wünscht er sich für sie. Wäre es nach ihm gegangen, hätte man Erich Honecker nicht auf Staatskosten nach Chile geflogen, sondern gleich »über der Ostsee abgekippt«.
Zwei Jahre später ist der Traum von der eigenen Ladenkette unwiderruflich geplatzt.
Aber er gibt sich nicht geschlagen und gründet ein Transportunternehmen. Mit einem schon etwas betagten Kleintransporter fährt er, in dieser Branche ein Späteinsteiger, so gut wie alles in so gut wie jeden Ort der Region. Seine tägliche Arbeitszeit beträgt selten weniger als sechzehn Stunden; die unterdessen jugendliche Tochter geht ihre eigenen Wege und die Ehe scheint zerrüttet.
Da bricht das ostdeutsche Idiom zum zweiten Male durch:
»Mein Familienleben war bis zur Wende total in Ordnung, da hab ich Zeit gehabt für die Familie, da hab ich Zeit gehabt, mich in’ Garten zu setzen, da hab ich Zeit gehabt, mich um meine Tochter zu kümmern, mich um meine Frau mehr zu kümmern. Im Moment, mir bleibt nix.«
Ende 1996 kündigt Mercedes den Mietvertrag, überläßt ihm zur Entschädigung aber günstig einen großen LKW. Nun kann er das Fuhrunternehmen auf höherer Stufenleiter betreiben. Allerdings nur, wenn er genügend Aufträge bekommt. Dafür sitzt er selbst Sonntag abends am Telefon.
Inzwischen ist Kathrin Schütze einem dubiosen Geschäftsmann aufgesessen, der in einer Hinterhausfirma Kurier- und Expreßdienste für imaginäre Kunden aus dem Telefonbuch vermittelt und dafür von seinen »Mitarbeitern« Vorabprovisionen erpreßt. »Wir sind genug reingefallen«, sagen sie und rücken dem Betrüger auf den Leib. Nach Einschaltung der Polizei bekommen sie wenigstens einen Teil ihrer Einlagen zurück – »Wahrscheinlich muß man doch skeptischer sein.«