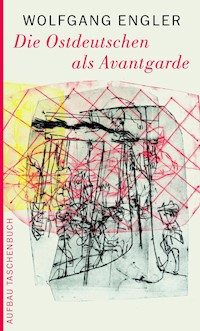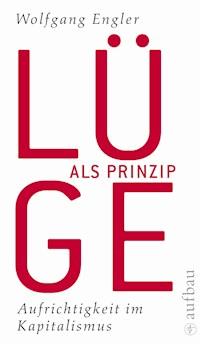
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was der Kapitalismus aus uns macht. Aufrichtigkeit ist ein Schlüsselbegriff zum Verständnis der bürgerlichen Kultur. Durch Aufrichtigkeit und ihre Inszenierungen schuf sich das Bürgertum eine Vertrauensbasis in einer feindlichen Umwelt. Aufrichtigkeit war die Zauberformel für den Umgang unter freien und gleichen Menschen. Das reife Bürgertum entsorgte diese Utopie, setzte auf die unsichtbare Hand, auf Recht und Verträge. Eigennutz und Selbstinteresse, derart gezügelt, schienen hinreichende Garanten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der jüngste Crash des globalen Kapitalismus widerlegt diese Doktrin ultimativ. Gerade moderne Gesellschaften leben von dem Vertrauen, das normale Menschen in die Redlichkeit der maßgeblichen Akteure setzen. Das Fazit von Englers brillanter Analyse der tiefgreifenden Wandlungen der bürgerlichen Lebenskultur: Nur wenn der Kapitalismus an sein sozialmoralisches Erbe anknüpft, bleibt er politisch mehrheitsfähig. Wolfgang Erler überrescht mit einer facettenreichen Darstellung über Aufrichtigkeit und Lüge im sozialen Umgang seit der Aufklärung. Seine Kulturkritische Studie gibt Orientierung bei der Suche nach Konsequenzen angesichts der Verwerfung in unserer Gesellschaft: Aufrichtigkeit ist ein Gebot der praktischen Vernunft. "Ein Denker, der buchstäblich aufs Ganze, an die Wurzel der Dinge geht." Die Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Wolfgang Engler
Lüge als Prinzip
Aufrichtigkeit im Kapitalismus
Impressum
Mit 25 Abbildungen
ISBN 978-3-8412-0046-4
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung heilmann/hißmann, Hamburg
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Impressum
Inhaltsübersicht
In der Wahrheitsfalle. Statt eines Vorworts
Aufrichtigkeit als Gebot der Gegenwart
Regeln für den Hausgebrauch
1. Nicht zu wenig, nicht zu viel
2. Mut zur Schwäche
Die Regeln des Marktes
1. Ehrliches Geschäftsgebaren
2. Die Lüge aus Prinzip
3. Die Lüge als Passion
4. Grenzen des Systemvertrauens
5. Aus dem Rahmen
6. Regeln, Normen und die ausstehende Antwort auf die Frage nach dem Wozu
Das Theater der Aufrichtigkeit. Hommage an Michel Foucault
Philosophisches Geleit: Gorgias
Zeigen und Schweigen
1. Verhexter Verstand oder der »Missbrauch der Worte«
2. Der Schulmeister im »freien Hörsaal der Natur«: sprachlos
3. Der Bündelungseffekt der höfischen Konversation
Aufrichtigkeit im Grundriss
1. Versteckspiele
2. Boten, Vermittler
3. Die Schule der Aufrichtigkeit
4. Alltag der Utopie
Aufrichtigkeit in der Entfaltung
1. Der bedürftige Mensch
2. Der empfindsame Mensch
3. Politik im vorpolitischen Raum
4. Ein Geflecht aus Diskursen
»Aufrichtige« Soziologie
1. Anmut der Armut
2. Symmetrie der Willen
3. Verteidigung der bürgerlichen Gesellschaft
4. Eine Erfindung des achtzehnten Jahrhunderts?
Aufrichtigkeit im Umbruch
1. Die große Inventur
2. Funktionalität und Effizienz
3. Vorläufige Abdankung
Aufrichtig, authentisch, echt
1. Der Weg nach innen
2. Im Spiegelkabinett
3. Authentisch arbeiten?
4. Verantwortung en gros
5. Echt!
Anhang
Verwendete Literatur
Anmerkungen
Bildteil
Bildnachweis
Die Aufrichtigkeit schritt eines Tages durch die Welt und hatte eine echte Freude über sich.
Ich bin doch eine tüchtige Person, dachte sie; ich scheide scharf zwischen gut und schlecht, mit mir gibt’s kein Paktieren; keine Tugend ist denkbar ohne mich. Da begegnete ihr die Lüge in schillernden Gewändern, an der Spitze eines langen Zuges. Mit Ekel und Entrüstung wandte die Aufrichtigkeit sich ab. Die Lüge ging süßlich lächelnd weiter; die letzten ihres Gefolges aber, ein kleines schwächliches Volk mit Kindergesichtchen schlichen demütig und schüchtern vorbei und neigten sich bis zur Erde vor der Aufrichtigkeit.
»Wer seid ihr denn?«, fragte sie.
Eines nach dem anderen antwortete: »Ich bin die Lüge aus Rücksicht.« – »Ich bin die Lüge aus Pietät.« – Ich bin die Lüge aus Barmherzigkeit.« – »Ich bin die Lüge aus Liebe«, sprach die vierte, und diese Kleinsten von uns sind: »das Schweigen aus Höflichkeit, das Schweigen aus Respekt und das Schweigen aus Mitleid«.
Da errötete die Aufrichtigkeit und plötzlich kam sie sich doch etwas plump und brutal vor.
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach (1830–1916)
In der Wahrheitsfalle
Statt eines Vorworts
Das Thema dieses Buches beschäftigt mich mit Unterbrechungen seit nunmehr zwanzig Jahren. Es endlich abzuschließen fehlte mir lange das Zutrauen, und das hat Gründe, persönliche, zeitgeschichtliche, politische; Gründe, die zur Sache gehören und daher hier berichtet werden sollen.
Im Jahr 1987 erhielt ich durch Vermittlung eines befreundeten Kollegen eine Einladung nach Klagenfurt, um an der dortigen Universität einen Vortrag zu halten. Für jemanden, der im Osten Deutschland saß, in Ostberlin, ein reizvolles Angebot – that kind of offer you don’t reject. Seit Monaten mit einer Studie über die geistige Kultur des Bürgertums in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts befasst, griff ich dankbar zu, beschleunigte die Arbeit und gab ihr den Titel: »Die Konstruktion von Aufrichtigkeit. Zur Geschichte einer verschollenen diskursiven Formation«. Ich hatte darüber ein Seminar mit Regiestudenten abgehalten, deren Interesse geweckt und meinte, auch das meiner Gastgeber zu finden. Die Erwartung erfüllte sich, nur anders als vermutet.
Gewiss, sie begriffen den Wink, den der Untertitel gab: eine unmissverständliche Anspielung auf Michel Foucault, den Archäologen der Diskurse, dessen Werke zu jener Zeit in West wie Ost eifrig gelesen und debattiert wurden. Auch ich hatte seine Bücher studiert, die Ordnung der Dinge und das, was folgte, stand, wie man so sagt, im Stoff und fühlte mich für meinen Auftritt gut gerüstet.
Aber nicht darüber entspann sich das Gespräch in Klagenfurt. Der Gast aus der DDR habe sich sicher etwas gedacht, als er gerade dieses Thema wählte, und seine Absichten erschöpften sich mitnichten in seinem Interesse an Foucault. Er spreche im historischen Interieur, gleichsam durch die Blume, von sich, von der Gesellschaft, dem Staat, in dem er lebte, weshalb sonst verbreite er sich ausgerechnet über die Aufrichtigkeit!
Darauf, auf den Grund der Rede, zielten die Kommentare und Nachfragen, wobei sich alle sichtlich um Zurückhaltung bemühten. Später, beim Essen in kleinerem Kreis, wagte sich einer der Älteren etwas weiter aus der Deckung und sagte etwa Folgendes: »Sie haben sehr elegant zu uns gesprochen, allegorisch, und, seien Sie versichert, wir haben, was Sie uns sagen wollten, gut verstanden. Sämtliche Motive Ihres Vortrags, die Skepsis dem öffentlichen Leben gegenüber, das Lob des Schweigens, von Nähe und Vertrauen, die Preisungen einfacher, bescheidner Sitten, der wiederholte Verweis auf Fichtes geschlossenen Handelsstaat – ganz unverfänglich und zugleich ganz klar.«
Ich quittierte die Bemerkung mit einem einverständlichen Lächeln, hinter dem ich meine Verwirrung verbarg. Eine kulturgeschichtlich eingekleidete Kritik ostdeutscher Zustände zu verfassen, das hatte mir nicht vorgeschwebt, als ich den Gegenstand für mich entdeckte. Ich wähnte mich im Dienst der Sache selbst. Aber offensichtlich hatten die Hörer in der Fremde deutlicher als ich vernommen, was zumindest mitgemeint war beim Schreiben und beim Reden. Ein Satz von Heiner Müller fiel mir ein: Der Autor ist klüger als die Parabel, die Metapher ist klüger als der Autor.
Ich hieß diese geflügelte Klugheit, die sich hinterrücks in den Denkprozess einmischte, nachträglich willkommen. Dankte ich doch vornehmlich ihr die Aussicht, mein Manuskript demnächst in Österreich publiziert zu sehen. Schnell wurde eine Abschrift angefertigt. Ich sah sie eilig durch und reiste ab. Dann ruhte der Vorgang. Erst 1989, mitten im gesellschaftlichen Umbruch in der DDR, erschien der Text – die erste »richtige« Publikation.
Oder doch nicht?
Das schmale Buch strotzte vor Fehlern, auch sinnentstellenden; das trübte die Freude. In kleiner Auflage gedruckt und ohne Werbung in die Welt entlassen, fand es ein paar Dutzend Leser, der Restbestand verschwand auf rätselhafte Weise.
Auch unter lauterem Trommelwirbel hätte die Schrift ein besseres Schicksal kaum gefunden. Stürmische Zeiten protegieren Manifeste, Pamphlete, Grußadressen; ein geistesgeschichtlicher Traktat über die Aufrichtigkeit war so ziemlich das Letzte, wonach das Publikum damals verlangte. Ich verschenkte die mir zugesandten Exemplare an Freunde und Bekannte, stellte eines ins Regal und überließ es nach Art berühmter Leute der »nagenden Kritik der Mäuse«.
Nach Jahren fiel mir das Büchlein wieder in die Hände. Was ich, die vielen Fehler, so gut ich konnte, übersehend, las, gefiel mir immer noch. Das Material verstauben lassen hieße, die Arbeit verachten, die nötig war, es zusammenzutragen. Auch die Deutungen hielten dem kritischen Blick im Wesentlichen stand. Der erste Impuls ging dahin, den schon einmal publizierten Text, gründlich durchgesehen und korrigiert, neu herauszubringen.
Dazu kam es nicht. Andere Arbeiten gingen vor, viele Aufsätze und etliche Bücher später lag der Band noch immer »unerledigt« auf dem Schreibtisch.
Ein weiteres Mal aus dem Stapel gezogen und aufgeblättert, begriff ich, Seite für Seite, meinen Langmut: In dieser Form besaß er kein Recht auf einen zweiten Anlauf. Was mehr als alles andere störte, war seine Ausdrucksweise, sein Jargon; Resultat mangelnder Distanz zu intellektuellen Moden.
Mitte der 1980er Jahre, als die Abhandlung entstanden war, litten Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften an Minderwertigkeitskomplexen. Ihre Wissenschaftlichkeit unter Beweis zu stellen, griffen viele Forscher zu Begriffen und Verfahren, die Linguisten und Semiotiker entwickelt hatten. Alles schien Sprache, in Sprache, oder allgemeiner, in Zeichenaustausch und Symbolsysteme auflösbar zu sein. Wer mitreden wollte, sprach, als sei das der Gipfel der Erkenntnis, von »kultureller Semiose«, von »illokutiven Akten« und »kommunikativer Performanz«.
Sofern diese Konzepte die Komplexität der menschlichen Sprache herausstrichen, erfüllten sie eine kritische Funktion gegenüber naiven Abbildtheorien in Wissenschaft und Künsten. Sprechend verändern die Menschen die Wirklichkeit, die sie mit ihren Worten meinen, und sei es noch so minimal; das war der Erkenntnisgewinn des linguistic turn. Auf dem neuen Vokabular triumphierend herumzureiten, so als sei nach langer Irrfahrt des menschlichen Geistes nun endlich Land in Sicht, war die Mode dieser Jahre.
Bei neuerlicher Durchsicht des alten Textes musste ich mir diese Unart eingestehen. Der Wunsch, geistig auf dem neuesten Stand zu sein, hatte seine Spuren hinterlassen. Die galt es, um der Verständlichkeit des Dargestellten willen, nun zu tilgen. Einmal am Zuge, traf ich auch sonst auf manche dunkle Stelle, auf Ungeschicklichkeiten. Wenige Passagen ausgenommen, schrieb ich das Ganze um und fügte, neuere Forschungen aufgreifend, hier und da etwas hinzu.
So entstand das dritte Kapitel dieses Buches, und damit war der Schreibprozess noch nicht beendet. Zu viele Fäden lagen offen.
Die Kultur der Aufrichtigkeit überschritt ihren Zenit am Ende des achtzehnten Jahrhunderts; an dieser einmal gewonnenen Einsicht hielt ich fest. Ebenso an den einst ausgemachten Ursachen für diesen Niedergang. Die Utopie des »wahren« Menschen prallte an der sozialen Welt, seit sie Systemcharakter angenommen hatte, wie an einer Mauer ab und ging »nach Hause«. Gewohnheiten und Praktiken aus der Ära der Aufrichtigkeit lebten, konsequent verhäuslicht, fort und traten in widersprüchliche Beziehung zu der Kultur, die kam, der Kultur des Authentischen.
Diese bezog sich dreifach auf ihre Vorläuferin. Sie übernahm einzelne Elemente unverändert, formte andere um und zerbrach zugleich den Rahmen, der ihnen Platz und Bedeutung angewiesen hatte. Was authentisches Begehren und Verhalten »ist«, versteht nur, wer seine Vorgeschichte kennt. Die Analyse der Aufrichtigkeit, das erfasste ich erst jetzt, ist der Schlüssel zum Verständnis der Authentizität und hilft, des Weiteren, zu begreifen, was Echtheit ist.
Davon handelt das vierte Kapitel dieser Schrift.
Worauf ich »eigentlich« hinauswollte, als ich die Arbeit begann und vortrug, was ich herausgefunden hatte? Auf weiter nichts als auf die Erkenntnis historischer Zusammenhänge, lautet die unveränderte Auskunft. Eine politische Stellvertreterrolle war dem Text so wenig wie der Rede zugedacht, weder bewusst noch unbewusst, da bin ich mir sicher.
Nur konnte ich das meinen damaligen Hörern mit noch so vielen Worten nicht vermitteln. Sie hätten sich dadurch in ihrer Vermutung, ich verberge, verkleide meine wahren Motive, nur bestärkt gefühlt. Mein Thema hatte mich eingeholt. Ich hatte aufrichtig gesprochen, frei von Hintergedanken, aber man glaubte mir nicht. Und ich sah kein Mittel, die Zweifel zu zerstreuen. Ich saß in der Falle.
Natürlich war das Thema für die Gesellschaft, in der ich damals lebte, relevant. Und natürlich hätte man darüber schreiben und diskutieren können.
Das unterblieb, und wie ich noch einmal beteuere, nicht aus übertriebener Vorsicht oder aus verdrängter Angst. Was hier zu sagen war, lag auf der flachen Hand, warf für das Denken keinen Mehrwert ab.
In einer Gesellschaft wie der ostdeutschen, die ein umfängliches Spitzelunwesen ertragen musste, zählte aufrichtiges Sprechen und Handeln zu den Kardinaltugenden des anständigen Bürgers. Es war schwierig, jederzeit aufrecht durch die Welt zu gehen, und deshalb war es wichtig, unverzichtbar. Sollte der Gesellschaft das an sich dem Staat zudiktierte Schicksal, nächstens abzusterben, erspart bleiben, mussten die Menschen Inseln herrschaftsfreier Kommunikation gründen und behaupten. Was zu allen Zeiten, auch den düstersten, gelungen war, gelang auch in der DDR, man weiß es heute und wusste es zuvor; hier gab es kein Geheimnis zu lüften.
Aufrichtigkeit im achtzehnten Jahrhundert – das war ein kultureller Aufstand mit hohem Unterhaltungswert, ein Spektakel; da fochten die besten Köpfe der Zeit mit schillernden Gegnern. Aufrichtigkeit in der DDR – das war die protestantische Reprise, Anstand vor Aufstand, aus guten Gründen, nur: wozu sich darüber eigens verbreiten?
Um aus dem Kontrast zweier Spielarten der Aufrichtigkeit deren Wesen genauer herauszupräparieren, sage ich mir heute. So würde das Klagenfurter Missverständnis doch noch produktiv.
Wohlan.
Die staatssozialistische Herrschaftsordnung glich der absolutistischen insofern, als sie konkurrierende Ansichten öffentlich nicht zuließ und jeden bedrängte, der sich dessen vermaß. Ihren Alleinvertretungsanspruch durchzusetzen, bediente sie sich der Zensur und, bald offen, bald verdeckt, geheimpolizeilicher Methoden; auch dies Gemeinsamkeiten mit wiederum denselben Folgen: Das soziale Handeln hüllte sich in einen Schleier der Ungewissheit. Diesen anzulegen und bei Bedarf zu lüften gehörte zur sozialen Kompetenz.
Jeder, der am öffentlichen Austausch teilnahm, nutzte, seiner Unangreifbarkeit zuliebe, Sprach- und Handlungsmasken. Jeder verstand sich auf Andeutungen, die anderen einen Blick hinter die Masken gewährten. Folglich beherrschten alle die Kunst, dem fremden Minenspiel Hinweise auf das wahre Antlitz abzulesen, dem rituell Dahingesagten Kundgaben der unverfälschten Mundart abzulauschen. Das gesellschaftliche Leben war ein fortgesetztes Abtasten des förmlich dargebotenen Handelns auf das subjektiv gemeinte. Ertastete man Lamellen des »Charakters«, ging der Austausch weiter, tiefer, ansonsten traten Oberflächen in Kontakt.
Aller Anfang ist schwer; besonders wenn, wer anfängt, Sorge tragen muss, bei anderen übel aufzulaufen. Aufrichtigkeitsbekundungen unter herrschaftlicher Aufsicht, auch schüchterne, bergen die Gefahr in sich, erst beim Wort genommen und dann am Kragen gepackt zu werden. Dennoch gibt es keinen anderen Weg, Vertrauen herzustellen, als »unserm Nächsten alles, wodurch sein Nutzen befördert oder sein Schaden abgewendet werden kann, frey heraus (zu) sagen«, wie ein Lexikon von 1731 fordert.
Es hatte damit insoweit seine Tücken, als die Obrigkeit, unendlich wissbegierig, darauf nur wartete – in Gestalt des von ihr in die Gesellschaft abgesandten »Nächsten«, der der Beste nicht war. Die Aufrichtigkeit von unten beherzigte Gebote, die die Aufrichtigkeit von oben selbst erlassen hatte: »Sei offen, aufrichtig, lüge nicht!« Eins griff ins andere, und so blieb kein Entrinnen, keine Wahl außer der unsäglichen, dass jeder jede »sicherheitshalber« belog und betrog. Das Risiko, mit seinem Freimut aufzufliegen, begleitete die menschliche Begegnung wie ein Schatten.
Zur üblichen Last, die die Aufrichtigkeit dem »Sender« aufbürdet, gesellte sich ein Rucksack, prall gefüllt mit Zweifeln und Bedenken.
Ihn gänzlich abzuschütteln, musste man das Land verlassen, ihn zu tragen, ohne einzuknicken, half mentales Muskeltraining, geistige Abhärtung. Der Nächstbeste mochte meine Wege als Freizeitspion kreuzen oder in guter Absicht; wer wollte das schon zuverlässig sagen. War mir an ihm gelegen, an seinem Wissen, seinen Fähigkeiten, zettelte ich, Zug um Zug, Vertrauen an, gab etwas um den Preis von mir preis, dass er dasselbe tat, und lüftete in nämlicher Erwartung einen weiteren Vorhang, er ebenso; nun hatten wir uns beide in der Hand. Aufrichtigkeit unter Bedrängnis sucht Gewissheit am Abgrund: in der Chance, einander verraten zu können.
Aufrichtigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess, in dessen Verlauf innere Hemmungen überwunden, seelische Barrikaden geschliffen werden, und zwar wechselweise; erst wenn man darin fortgeschritten ist, lässt man sich fallen. Und fällt ins Bodenlose, wenn der andere, die andere mit diesem ernsten Spiel ein böses treibt.
Das »Verdienst«, die Gemeinde der Aufrichtigen mitten im Alltag in den Ausnahmezustand versetzt zu haben, gebührt der staatssozialistischen Herrschaft mehr als jeder Herrschaftsweise vor ihr. Spätestens hier überflügelte deren Einzigartigkeit fraglos vorhandene Ähnlichkeiten mit anderen autokratischen Ordnungen.
Wendet man sich der Kultur der Herrschaft zu, tritt diese Singularität noch greifbarer zutage.
Die höfische Aristokratie verfügte über ausgesuchte, dabei unendlich nuancierte Ausdrucksmittel. Sie regulierten die Position des Einzelnen in der Hofgesellschaft ebenso wie Verschiebungen der Machtbalance infolge von Rangordnungskämpfen und sicherten der ganzen Gruppe symbolische Unterscheidungsgewinne.
Der sozialistische Staatsadel bot kulturell ein mehr als kümmerliches Bild. Aufgemacht wie kleine Angestellte im Sonntagsputz, sprachlich unbeholfen, im steifen Gestus eingefroren, ernteten die politisch Auserwählten Häme statt Achtung.
Der dritte Stand rang mit einem symbolisch hochgerüsteten Gegner um kulturelle Vorherrschaft und scharte sich um eine intellektuelle Elite mit ausgeprägtem Spieltrieb.
Die »Werktätigen« im Staatssozialismus trafen auf Herrscher ohne Leitkultur und schätzten »Kulturschaffende« mit Bodenhaftung.
Lügen, schillernd dargeboten, farbenprächtig, suggestiv, kuschen nur vor Wahrheiten, die glänzen. Phrasen, flach wie ein Bürgersteig, mit ungelenker Zunge vorgetragen, widerlegt die einfache Wahrheit, die die Welt in Gut und Böse teilt, in Sie und Wir. Elegante Verführer zu düpieren erfordert geistige Akrobatik, plumpe Rosstäuscher bloßzustellen genügt der gesunde Menschenverstand.
Im ersten Fall greift man zu Paradoxien, errichtet Labyrinthe, im zweiten pocht man auf Fakten und ruft »mehr Licht!«.
Dieselbe Intention, verschiedene Verfahren, verschiedene Arten, aufrichtig zu sein.
Texte als Nichttexte zu inszenieren, vorgetäuschte kulturelle Armut, das passte zu einer sozialen Welt, in der die Herrschenden mal im Talar einherstolzierten und mal im Dress des Schäfers unter Bäumen lungerten. Sie bloßzustellen, zu verspotten, kulturell schachmatt zu setzen, musste man selbst hintergründig sein, gewitzt und mit der simplen Attitüde spielen.1
Verabscheuen der »Kaiser« und sein Gefolge dagegen jeden Prunk und jeden Robenwechsel, verlieren solche Vexierspiele ihren Sinn und ihren Reiz. Die Aufrichtigkeit geht im Hausmantel, der sich nicht wenden lässt, umher und wirkt so wenig hintergründig wie im Wald ein Baum.
Aufrichtigkeit in ihrer Quintessenz als soziale Kameradschaft – das war die Forderung der Zeit, und die verschaffte sich Gehör. Verlässlich sein, sagen, was der Fall ist, ohne Umschweife, gerade heraus, hemdsärmelige Tugenden also standen in einer Gesellschaft wie der ostdeutschen in hohem Ansehen.
Sozial annähernd gleich, dachte und fühlte jede(r) in etwa wie die anderen; sich in sie hineinzuversetzen kostete geringe Anstrengung.2 Von Mauern umzäunt, vollzog sich der gesellschaftliche Verkehr nach innen erstaunlich freizügig und unkompliziert. Menschen unterschiedlichster Professionen kamen sich schnell nah, innerhalb wie außerhalb der Arbeit, und fassten, obgleich sie allen Grund zur Vorsicht hatten, Vertrauen zueinander. Der Wunsch, sich auszutauschen, überwog die mitlaufende Hemmung und gewann der aufgezwungenen Nähe soziale Reibungswärme ab. In funktioneller Hinsicht unterkomplex (wie der Soziologe sagen würde), an internen Differenzierungen vergleichsweise arm, ähnelte die Gesellschaft unterhalb der Herrschaftssphäre einer großen Gemeinschaft.
Einfache Sitten, handfeste Umgangsformen, gerader Sinn, praktischer Lebensstil – darin erkannten sich Regierende wie Regierte gleichermaßen wieder. Exzentriker hatten in beiden Lagern einen schweren Stand. Was die Mehrheit der Bürger an ihrer Obrigkeit auszusetzen fand, war nicht deren »arbeiterlicher« Gestus, sondern ihr heimlicher Hang zu Pracht und Luxus: Herren, die nur so taten, als gehörten sie zum Volk.
Wie sehr dieser Vorwurf sein Ziel verfehlte, zeigte sich, als die Oberen, politisch entmachtet, ihre »Villen« und »Paläste« fluchtartig räumten: Verliese des Komforts, Richtstätten des Stilgefühls, eine wie der andere. Hier verging der Schaulust das Sehen, und dem Neid verschlug es die Sprache.
Eine Abfuhr ohne Verzeihen verdiente die Nomenklatura gleichwohl. Sie hatte den Verrat geradezu geschäftsmäßig in die Gesellschaft getragen und die elementaren mitmenschlichen Regungen an ihrer Wurzel geschädigt. Das wäscht kein Regen ab.
Was mich beim jüngsten Wiederlesen des alten Textes tatsächlich stutzen ließ, war sein enger Zeitrahmen. Meine Untersuchung von Phänomenen der Aufrichtigkeit beschränkte sich in der Hauptsache auf die zweite Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Am Ende folgte ein kurzer Verweis auf die Versachlichung der menschlichen Beziehungen in der Folge von industrieller Revolution und freier Konkurrenz, mehr nicht. Der karge Ausklang suggerierte dem Leser, dass sich die Gemeinde der Aufrichtigen auf dem weitläufigen Feld des modernen Kapitalismus zerstreut habe, dass weitere Spurensuche auf diesen Pfaden sinnlos sei.
Das war ein Irrtum, wie ich unterdessen weiß. Warum wusste ich das damals nicht? Warum übersah ich die Verbindungslinien, die von der Sozialmoral der Aufklärung bis in unsere Zeiten reichen?
Ich schreibe das heute dem Einfluss von Niklas Luhmann zu, in dessen Arbeiten ich mich zu Beginn der 1980er Jahre vertieft hatte, so sehr, dass ich eine Zeitlang als »Luhmannianer« umging. Ich las Luhmann teils mit reinem Vergnügen, teils als Kritiker des »real existierenden Sozialismus« und führte diesbezüglich sogar einen kleinen Briefwechsel mit dem Autor über die deutsch-deutsche Grenze hinweg.
Luhmanns soziologische Systemtheorie legte so ziemlich alle Schwachstellen des staatssozialistischen Gesellschaftsgebäudes bloß. Sie führte den Nachweis, dass es diesem Sozialismus nicht gelungen war, »funktionale Äquivalente« für jene Wettbewerbsformen zu erzeugen, die er abgeschafft hatte, und kam dabei ohne jegliche Moralisierung aus. Das faszinierte mich, war »cool«, wie man mittlerweile sagt.
Dieselbe Coolness beweis Luhmann im Streit mit seinen Widersachen, speziell im Geistesdauerclinch mit Jürgen Habermas. »Herrschaftsfreie Kommunikation«, ja gern, aber bitte unter Vorwegverzicht auf gesellschaftliche Relevanz. Moderne Gesellschaften setzten auf Kommunikation, bedienten sich dabei aber nicht der natürlichen Sprachen, sondern »symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien« wie Macht, Geld, Recht und Wahrheit. »Am Schwall der begründenden Rede lässt sich nichts festmachen«, das war Luhmanns Überzeugung, die ich ebenso teilte wie seine Moralskepsis. Das Erfolgsgeheimnis moderner Gesellschaften sei gerade die »Entmoralisierung« ihrer wichtigsten Funktionssysteme,3 ihre Abkopplung vom »ganzen Menschen« und seinem »Seelenbrei«.
Ganz in den Bann dieser Argumentation gezogen, sah ich meine Aufgabe, die Kultur der Aufrichtigkeit betreffend, an der Schwelle zum neunzehnten Jahrhundert als erledigt an.
Diesen voreiligen Schlussstrich aufzulösen, ohne in Moralisierung zurückzufallen, ist das Hauptinteresse dieser Schrift.
Aufrichtigkeit als Gebot der Gegenwart
Regeln für den Hausgebrauch
1. Nicht zu wenig, nicht zu viel
Die DDR ist passé und liefert wie die höfische und die frühe bürgerliche Gesellschaft nur mehr vergangene Gründe, das Thema aufzugreifen. Hat es mit der Aufrichtigkeit für uns Heutige noch irgendeine Bewandtnis?
Wir leben in funktional differenzierten Gesellschaften mit eigensinnig operierenden Systemen (Ökonomie, Recht, Politik etc.), die einer Kultur der Aufrichtigkeit wenig Anhaltspunkte bieten.
Henry Ford, ein Pionier der Moderne, verbannte die Aufrichtigkeit aus dem wirtschaftlichen Ernst des Lebens, und es ist schwer abzusehen, wie sie da wieder Fuß fassen könnte. Vor Gericht sind wir zu Wahrhaftigkeit verpflichtet – sofern sie uns nicht schadet – und dürfen, dies vor Augen, schweigen. Rechtsanwälte boxen ihre Klienten durch, so gut sie können, mögen dieselben noch so unglaubwürdig sein. Was zählt, ist der Erfolg. Politiker erwecken gern den Anschein grundredlicher Motive, manchmal schwören sie sogar auf ihr Gewissen – und werden ein ums andere Mal der Lüge überführt. Karrierezwänge dulden höchstens Halbwahrheiten, Parteiräson sticht Staatsräson.
Strukturelle Unaufrichtigkeit wohnt selbst der Liebe inne – wenn es in der Beziehung kriselt. Dann wird jede Äußerung des Partners, verbal wie nonverbal, zur (unfreiwilligen) Auskunft über den Stand der intimen Dinge und verliert genau dadurch ihre Unschuld. »Ich liebe dich.« – »Warum sagst du das gerade jetzt?«4
Im Austausch von Mensch zu Mensch besitzt die Aufrichtigkeit fraglos bessere Chancen, mit ihren Forderungen durchzudringen. Widerstände gibt es auch hier, aber sie werden nicht zusätzlich durch Systemzwänge unterstützt, die das Persönliche beiseiteschieben. Im mitmenschlichen Alltag begegnen sich Individuen statt Funktionsträger, und je näher sie sich kommen, desto weniger können, ja wollen sie sich voreinander verstecken. Wer gemeinsam mit anderen auf eine Lebensreise gehen will, sei es auch nur bis zur nächsten Station, der muss zuvor das Ticket dafür lösen: Aufrichtigkeit.
Den Kurs der Reise gibt eine Klugheitsregel an, die älteren Datums als alle Schriftbelege ist: Sei offen, mitteilsam, wo das deinem Nächsten nützlich ist, hüte dich vor Schwatzhaftigkeit und schweige, wo Worte sich zu einem Strick um deinen Hals verknüpfen könnten.
So haben menschenfreundliche Ratgeber immer gedacht, geschrieben, selbst zu Zeiten, in denen Aufrichtigkeit als religiöser Pflichtenkatalog verfasst war, der das rechte Verhältnis zu Gott beschrieb.
Dieser Ursprung ist heute verblasst und mit ihm die originäre Bedeutung des Wortes »Aufrichtigkeit«. »Gottes Wort aber machet das hertz auffrichtig gegen Gott«, so hörte man es von Luther und den Reformierten.5 Aufrichtigkeit, das ist die aufrechte Haltung, ist rectitudo, im Gegensatz zur gekrümmten, zu curvitas – unmöglich ohne vorherige Auf-Richtung des Menschen durch Gottes erlösende Botschaft. Aufrichtig ist der Mensch vermöge dieser Anrufung und nicht aus eigener Kraft.
Aufrichtigkeit hat einen Ursprung – den rechten Glauben – und viele Paten: die Disziplin, Gesetz und Pädagogik. Sie nehmen sich des gebrechlichen, sündhaften Menschenwesens an und trainieren den aufrechten Gang, die statura erecta, durch minutiöse Übungen vom Scheitel bis zur Sohle. Selbst die Tanzmeister, oft beargwöhnt, gehören zum unentbehrlichen Personal dieser Körperschule der Aufrichtigkeit.6 In diesem Kontext wurzelt die protestantische Schulreform, von der bald Näheres zu vermelden ist.
Überhaupt: Je weiter man in der historischen Ordnung zurückgeht, je frühere Zeugen der Aufrichtigkeitskultur man aufspürt, desto häufiger sprechen sie »teutsch«, mit protestantischem Akzent.
Es gibt unnachsichtige und es gibt verständnisvolle Hüter der Gott schuldigen Wahrhaftigkeit. Vor dem HERRN hat man die Brust zu öffnen, die kleinste Sünde gehört einbekannt, sagen jene und rechtfertigen die strenge Buße bis hin zur Selbstkasteiung. Das ist zu viel verlangt, erwidern diese; der Mensch ist unvollkommen, fehlbar, anfechtbar; dagegen ist kein Kraut gewachsen.7 Die »richtig aufrichtige« Andachtshaltung wahrt die Mitte zwischen Bekenntnisroutine und Selbstzerfleischung. Wer sich zeitlebens zerknirscht im Staub wälzt, verhöhnt in Wahrheit Gott, statt ihn zu ehren.8
Was man sagt, das muss man meinen, aber man muss (und kann) nicht alles sagen, was man meint, denkt, fühlt und ahnt. Wer schweigt, wo er sprechen sollte, tätigt eine Handlung und nicht die edelste, doch sind die Untugenden nicht alle von derselben Art. Etwas verschweigen (dissimulatio) ist eine lässlichere Sünde als hartnäckiges Leugnen oder Lügen (simulatio) und im Verkehr von Mensch zu Mensch mitunter geradezu geboten; der jeweils andere besitzt im Zweifelsfall ein Recht auf Schonung.9
Nicht zu viel und nicht zu wenig – mehr können und mehr sollen auch wir Heutigen nicht fordern; die »rechte« Aufrichtigkeit rechnet mit den »Tücken des Subjekts«. Weniger zu verlangen hieße der moralischen Abstumpfung das Wort reden, mehr einzuklagen liefe auf die folgenschwere Verwechslung von Anstand und Selbstauslieferung hinaus.
Die Allgegenwart von Lüge und Verstellung schneidet das Leben von seiner sozialen Wurzel ab, dem mitmenschlichen Grundvertrauen, und gipfelt regelmäßig im Verrat.10 Die Herrschaft von Tugend und Transparenz schneidet das Dasein von seiner vitalen Wurzel ab, dem Zutrauen zu sich selbst als einem Wesen, das auch dunkle Seiten hat, bedrohliche, amoralische, und brütet Verstandesungeheuer aus.
Erfüllt, wer anderen aufrichtig begegnet, nur eine soziale Pflicht, oder schuldet er das letztlich seiner Selbstachtung? Mein Verhältnis zu mir trübt sich ein, wenn ich anderen vorenthalte, worauf sie einen Anspruch haben, sie gar absichtlich täusche; wie könnte ich das je vor mir verheimlichen. Die Verletzung ungeschriebener sozialer Rechtspflichten verstößt gegen elementare Grundsätze der ethischen Selbstsorge, das wusste Thomas von Aquin, das steht bei Kant geschrieben,11 das wissen wir, sofern wir ehrlich zu uns sind. Und dieses Wissen treibt uns um – und oftmals zu Geständnissen.
Liegt eine Vernachlässigung der ethischen Selbstsorge auch dann vor, wenn ich mir die Wahrheit vorenthalte, darauf verzichte, mich genauer zu kennen, zu wissen, wer ich bin, im Innersten meines Wesens?
Diese Frage sprengt den Horizont der Aufrichtigkeitskultur. Zwar bildet, wie angedeutet, die Reinheit der Seele vor Gott (und den rechtgläubigen Mitmenschen) samt der zugehörigen Selbstprüfung einen Teil ihrer Geschichte, jedoch einen durchaus esoterischen. Jene, die dieses Kapitel schrieben, zählten (sich) zu den spirituellen Eliten, führten keine Durchschnittsexistenz. Sein Leben nach dem Leitstern der Selbsterforschung auszurichten, dazu war das normale bürgerliche Publikum (ob Stand, ob Klasse) weder geschaffen noch bestimmt; der Masse der Bauern und Tagelöhner galt ethische Vergeistigung als unerschwinglicher Luxus.
Im achtzehnten Jahrhundert griff die »Analyse des Selbst« auf Bürgerliche über – Benjamin Franklins penible ethische Buchprüfung ist dafür exemplarisch –, eine »Massenbewegung« formierte sich jedoch erst in den letzten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie schuf eine Kultur des Authentischen, die uns Heutigen derart selbstverständlich anmutet, dass wir in rückblickender Betrachtung meinen, sie hätte das individuelle Selbst- und Weltverhältnis seit je bestimmt.
2. Mut zur Schwäche
Tugenden wohnt stets ein Hang zur Übertreibung inne. Sie paaren sich nur allzu gern mit ihrem Gegenteil; das gilt ganz allgemein.
Besonnenheit, überstrapaziert, weicht Trägheit, Tapferkeit in jeglicher, auch aussichtsloser Lage zeugt falschen Heroismus, Sparsamkeit, die jeder Laune auf den Schlips tritt, selbst ohne Not, heißt Geiz.
Das Alter Ego der Aufrichtigkeit ist die Geschwätzigkeit, die Mitteilungssucht; da mutiert sie zur Plaudertasche. Mit Augenmaß betrieben, bewirkt sie fraglos Gutes wie jede andere Tugend auch.
Sich gleichberechtigt im Kreise ihrer Schwestern zu behaupten fällt ihr dennoch schwer.
Besonnenheit, Tapferkeit, Sparsamkeit sprechen eine klare Sprache, weisen sich mühelos anhand der für sie als unverzichtbar erachteten Eigenschaften aus. Der Besonnene wägt alle Eventualitäten gründlich ab, ehe er sich zum Handeln entschließt, der Tapfere bleibt, wenn es ungemütlich wird, länger als andere auf dem Plan, der Sparsame schätzt den Wert der Dinge, ihre Güte, und widersteht in einer Mischung aus Besonnenheit und Tapferkeit dem Sirenengesang der Warenwelt.
Die Aufrichtigkeit kann da nur neidlos applaudieren. Untrügliche Beweise ihres Vorhandenseins zu liefern ist ihr versagt, kein Mittel weit und breit, weder Worte noch Gesten noch Taten. Die scheinbar reinsten Worte, die verbindlichsten Gesten, die brüderlichsten Taten können Teil eines Betrugsmanövers sein, das seine abgrundtiefe Schäbigkeit erst ganz am Schluss enthüllt – wenn es zu spät ist und dem Betrogenen nur Reue über sein leichtfertiges Vertrauen bleibt. Die Einheit von Mund und Herz, von Wort und Tat, Ausweis der Aufrichtigkeit von alters her, gleicht einer Beschwörungsformel mehr als einer belastbaren Prüfliste.
Der Aufrichtige, gebeten, sich allseits bekannt zu machen, errötet und tritt beschämt beiseite. Er stünde, was immer er in eigener Sache äußerte, als hoffnungsloser Prahlhans da. »Ich bin der, der anderen stets die Wahrheit sagt« – wer das von sich behauptet, der ist ein eitler Fratz, ein Tugendbold, dem glaubt kein Mensch.
Was soll uns eine Tugend ohne Steckbrief? Wäre die soziale Welt ohne sie womöglich ärmer an jähen Enttäuschungen? Bejaht man diese Frage, welche andere Konsequenz folgte daraus als die der Ausgliederung der Aufrichtigkeit aus dem Katalog der »ordentlichen« Tugenden. Das Mindeste, wozu wir uns verstehen müssten, wäre ein Moratorium, ein Abschied der Aufrichtigkeit auf Zeit – ins Reich der moralischen Zwitter, bis zum Beweis des Gegenteils.
Die Fanatiker der Aufrichtigkeit werden an diesem Buch wenig Gefallen finden, weil es solche Fragen zulässt, ihre Verächter ebenso wenig, weil es für die berechtigten Anliegen der Aufrichtigkeit ficht.
Ehe wir den Stab über sie brechen, sollten wir unsere Lebenserfahrung konsultieren.
Klarheit und Wahrheit im mitmenschlichen Austausch wie im gesellschaftlichen Verkehr oder aber das Gegenteil davon, Dunkelmännertum auf allen Ebenen – das ist die Frage, und die lässt uns nicht kalt.
Wer ruhigen Bluts für die Verfinsterung der sozialen Welt optiert, der ist für dieses Buch verloren und sei hiermit freundlich aus der Lektüre entlassen. Wer leichter durchschau- und beherrschbare Verhältnisse für möglich hält, für wünschenswert, mag weiter an der Eignung der Aufrichtigkeit für diese Zwecke zweifeln. Ein Werkzeug mit derart verklausulierter Gebrauchsanweisung – wie sollte das zu größerer Klarheit führen?
Abermals ist unsere Lebenserfahrung aufgerufen.
Worte können Aufrichtigkeit nur suggerieren, Gesten, Minenspiel, Handlungen ebenso. Aber gleichen wir nicht stets eins mit dem anderen ab? Die Aussage mit dem Tonfall, das Minenspiel mit der unwillkürlichen Augenbewegung, die produzierte Geste mit der gesamten Körpersprache? Auf diesem Gebiet sind wir unschlagbare Experten, und in wenigstens neun von zehn Fällen demaskieren wir noch den gewieftesten Falschspieler. Um absolute Sicherheit verlegen, gewinnen wir doch hinreichende Wahrscheinlichkeit, und das genügt, muss genügen, solange Menschen Menschen sind, im Letzten unerschöpflich, undurchdringlich, glücklicherweise.
Was wir verlören, erteilten wir der Aufrichtigkeit Platzverbot? Eine wesentliche Quelle unserer bürgerlichen Sicherheit, zunächst.
Schwebt ein Verhängnis über uns, von missgünstigen Personen angezettelt, winkt uns zumeist nur eine Rettung: andere müssen uns darüber aufklären; wir sie, wenn es sich umgekehrt verhält.
Aufrichtigkeit als Aufklärung für den sozialen Hausgebrauch befriedigt ein Bedürfnis, das unauslöschlich in uns allen steckt.
Man mache die Probe, gehe in einen Film, in dem der Held, die Heldin Gegenstand einer undurchschauten Intrige ist. Wir, die Zuschauer, wissen Bescheid, die Bösewichter auf der Leinwand sowieso. Wird das überzeugend in Szene gesetzt, nach Art eines Suspense, bekommen wir Gänsehaut, feuchte Handflächen und rutschen unruhig auf unseren Sitzen hin und her.
Warum?
Weil man eine moralische Zwickmühle um uns herum errichtet. Instinktiv wollen wir dem, der Unglücklichen zur Seite springen, ihm, ihr sagen, worauf sie ein Anrecht besitzt (sonst geht die Unschuld baden), aber als Zuschauer, von der Leinwand, der Bühne getrennt, zum Schauen aufgerufen statt zum Handeln, können, dürfen wir nicht eingreifen.
Unser natürlicher Impuls zu handeln findet keine Abfuhr, kreist in sich, in der Gefühlsbahn und mündet in eine verkrampfte physiologische Reaktion: Schweißausbruch, Nervosität.
Wir könnten dieser Mensch in Bedrängnis sein – deshalb eilen wir anderen zu Hilfe und verhalten uns, wo das nicht angeht, wie Kinder, die der Vorstellung eines Puppentheaters beiwohnen.
Die Spielsituation belehrt uns über unser moralisches Wesen. Damit kommen wir auf die Welt. Aufrichtigkeit ist Teil unserer Grundausstattung. Alles andere ist Faselei.
Unser Wissen mit anderen teilen, an ihrem teilhaben, das ist Aufrichtigkeit als ebenso kostenlose wie effiziente Versicherungsgesellschaft: ein evolutionärer Vorteil des Menschen allen anderen Lebewesen gegenüber, eine Gratisgabe der Aufrichtigkeit.
Sich einem, einer anderen rückhaltlos offenbaren zu können, ohne abgewiesen zu werden – in kritischen Momenten hängt davon unter Umständen das Weiterleben ab. Ein anderer, der zuhört, zu bedenken gibt, widerspricht, ermutigt, rät, vollkommen selbstlos – erst diese zweite Gabe zeigt den ganzen Adel des Menschen. Mut zur eigenen Schwäche fassen im Vertrauen darauf, so angenommen und eben nicht ausgenutzt, überrumpelt zu werden – wer wären und wo stünden wir ohne diese Möglichkeit? Im geistigen Tierreich.
Mehr davon im dritten, historischen Kapitel dieser Studie.
Angeblich gefährden Individuen, die sich solchermaßen öffnen und seelisch entsichert auf andere zugehen, die »Zivilisation«. Die hängt, teilt man uns mit, am seidenen Faden unserer Triebhemmung. Unser Innerstes sorgsam zu beschirmen, von dort aufsteigende Regungen rechtzeitig einzufangen, an ihrem Ausbruch zu hindern – das allein bewahrte uns vor der »Tyrannei der Intimität«