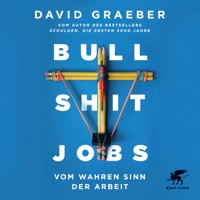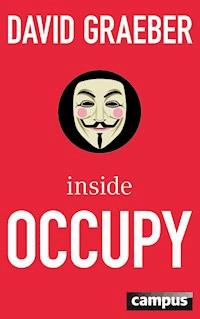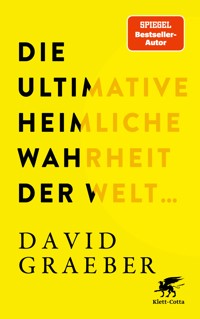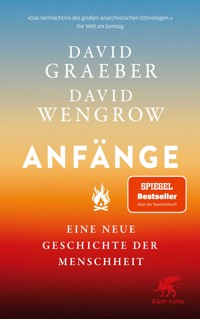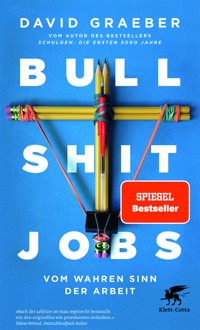
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Bullshit-Job ist eine Beschäftigungsform, die so völlig sinnlos, unnötig oder schädlich ist, dass selbst der Arbeitnehmer ihre Existenz nicht rechtfertigen kann. Es geht also gerade nicht um Jobs, die niemand machen will, sondern um solche, die eigentlich niemand braucht. Im Jahr 1930 prophezeite der britische Ökonom John Maynard Keynes, dass durch den technischen Fortschritt heute niemand mehr als 15 Stunden pro Woche arbeiten müsse. Die Gegenwart sieht anders aus: Immer mehr überflüssige Jobs entstehen, Freizeit und Kreativität haben keinen Raum – und das, obwohl die Wirtschaft immer produktiver wird. Wie konnte es dazu kommen? »Eine Einladung zum Umdenken.« Business Bestseller »Drastische Ideen, spannend zu lesen!« P. M.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
David Graeber
BULLSHIT-JOBS
Vom wahren Sinnder Arbeit
Aus dem Englischen vonSebastian Vogel
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Bullshit Jobs. A Theory«
© 2018 by Simon & Schuster, New York
Für die deutsche Ausgabe
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung eines Fotos von © Simon & Schuster, New York
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98245-7
E-Book: ISBN 978-3-608-11506-2
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Das Phänomen der Bullshit-Jobs
Kapitel 1
Was ist ein Bullshit-Job?
Warum ein Auftragsmörder der Mafia kein gutes Beispiel für einen Bullshit-Job ist
Von der Bedeutung des subjektiven Elements und warum man davon ausgehen kann, dass diejenigen, die ihre Tätigkeit selbst für einen Bullshit-Job halten, im Allgemeinen recht haben
Zu der verbreiteten falschen Vorstellung, Bullshit-Jobs seien im Wesentlichen auf den öffentlichen Dienst beschränkt
Warum Friseure ein schlechtes Beispiel für einen Bullshit-Job sind
Der Unterschied zwischen Teilweise-Bullshit-Jobs, Vorwiegend-Bullshit-Jobs und reinen, ausschließlichen Bullshit-Jobs
Kapitel 2
Was für Typen von Bullshit-Jobs gibt es?
Die fünf Haupttypen von Bullshit-Jobs
1. Die Tätigkeit der Lakaien
2. Die Tätigkeit der Schläger
3. Die Tätigkeit der Flickschuster
4. Die Tätigkeit der Kästchenankreuzer
5. Die Tätigkeit der Aufgabenverteiler
Komplizierte, vielgestaltige Bullshit-Jobs
Ein paar Worte über Bullshit-Jobs zweiter Ordnung
Eine letzte Anmerkung und eine kurze Rückkehr zu der Frage: Ist es möglich, dass jemand einen Bullshit-Job hat und es nicht weiß?
Kapitel 3
Warum bezeichnen sich die Inhaber von Bullshit-Jobs regelmäßig selbst als unglücklich? (Seelische Gewalt, Teil 1)
Von dem jungen Mann, der offensichtlich einen Ruheposten erhielt und nicht in der Lage war, mit der Situation umzugehen
Über das Erlebnis der Falschheit und Sinnlosigkeit, das den Kern der Bullshit-Jobs bildet, und für wie wichtig es heute gilt, der Jugend das Erlebnis der Falschheit und Sinnlosigkeit zu vermitteln
Warum viele Grundannahmen über die Motivation von Menschen anscheinend falsch sind
Exkurs: Eine kurze Geschichte der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und insbesondere der Vorstellung, man könne die Zeit anderer Menschen kaufen
Der Konflikt zwischen der Moral der Zeit und natürlichen Arbeitsrhythmen: Welche Vorbehalte erwachsen daraus?
Kapitel 4
Wie fühlt es sich an, einen Bullshit-Job zu haben? (Seelische Gewalt, Teil 2)
Warum ein Bullshit-Job nicht zwangsläufig so schlimm sein muss
Das Elend von Zweideutigkeit und erzwungener Heuchelei
Das Elend, keine Ursache zu sein
Das Elend, vermeintlich kein Recht auf das Elend zu haben
Das Elend, zu wissen, dass man Schaden anrichtet
Coda: Die Auswirkungen von Bullshit-Jobs auf die Kreativität der Menschen und die Gründe dafür, warum der Versuch, sich kreativ oder politisch gegen sinnlose Tätigkeiten zu wehren, als eine Form der geistigen Kriegsführung gelten kann
Kapitel 5
Warum vermehren sich die Bullshit-Jobs?
Ein kurzer Exkurs über Kausalität und das Wesen soziologischer Erklärungen
Ein paar Anmerkungen über die Rolle des Staates bei der Schaffung und Beibehaltung von Bullshit-Jobs
Einige falsche Erklärungen für den Aufschwung der Bullshit-Jobs
Die Finanzbranche als Musterbeispiel für die Schaffung von Bullshit-Jobs
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der heutigen Form des Manager-Feudalismus und dem klassischen Feudalismus
Die Ausdrucksform des Manager-Feudalismus in der Kreativbranche: eine endlose Vermehrung mittlerer Managerränge
Zusammenfassung mit einer kurzen Rückkehr zu der Frage nach den drei Kausalitätsebenen
Kapitel 6
Warum haben wir als Gesellschaft nichts gegen das Wachstum sinnloser Beschäftigung?
Die Unmöglichkeit, einen absoluten Wertmaßstab zu entwickeln
Die allgemeine Anerkennung eines gesellschaftlichen Wertes, der sich vom wirtschaftlichen Wert unterscheiden lässt, im Einzelnen aber nur sehr schwer zu definieren ist
Die umgekehrte Beziehung zwischen dem gesellschaftlichen Wert der Arbeit und dem Geldbetrag, der meist dafür bezahlt wird
Die theologischen Wurzeln unserer Einstellung zur Arbeit
Der Ursprung der nordeuropäischen Vorstellung, bezahlte Arbeit sei für das Werden eines erwachsenen Menschen unentbehrlich
Wie Arbeit mit dem Aufkommen des Kapitalismus vielerorts entweder als Mittel für gesellschaftliche Reformen oder letztlich als eigenständige Tugend betrachtet wurde und wie Arbeiter dem die Arbeitswerttheorie entgegensetzten
Die entscheidende Schwäche der Arbeitswerttheorie, wie sie im 19. Jahrhundert populär wurde, und die Ausnutzung dieser Schwäche durch das Kapital
Wie Arbeit im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend vor allem als Form von Disziplin und Selbstaufopferung geschätzt wurde
Kapitel 7
Welche politischen Auswirkungen haben die Bullshit-Jobs? Lässt sich an der Situation etwas ändern?
Wie die politische Kultur unter dem Manager-Feudalismus durch ein Gleichgewicht der Ressentiments aufrechterhalten wird
Wie die derzeitige Krise der Automatisierung mit dem größeren Problem der Bullshit-Jobs zusammenhängt
Die politischen Folgen der Bullshitisierung und des nachfolgenden Produktivitätsrückgangs im Betreuungssektor und seine Verbindung zur Möglichkeit eines Aufstands der betreuenden Klassen
Das bedingungslose Grundeinkommen als Beispiel für ein Programm zur Entkopplung von Arbeit und Bezahlung sowie zur Beendigung der in diesem Buch beschriebenen Dilemmata
ANHANG
Danksagung
Anmerkungen
Vorwort
Das Phänomen der Bullshit-Jobs
Kapitel 1
Was ist ein Bullshit-Job?
Kapitel 2
Was für Typen von Bullshit-Jobs gibt es?
Kapitel 3
Warum bezeichnen sich die Inhaber von Bullshit-Jobs regelmäßig selbst als unglücklich?
Kapitel 4
Wie fühlt es sich an, einen Bullshit-Job zu haben?
Kapitel 5
Warum vermehren sich die Bullshit-Jobs?
Kapitel 6
Warum haben wir als Gesellschaft nichts gegen das Wachstum sinnloser Beschäftigung?
Kapitel 7
Welche politischen Auswirkungen haben die Bullshit-Jobs? Lässt sich an der Situation etwas ändern?
Bibliografie
Vorwort
Das Phänomen der Bullshit-Jobs
Im Frühjahr 2013 sorgte ich unabsichtlich für eine kleine internationale Sensation.
Es begann damit, dass ich einen Artikel für eine neue radikale Zeitschrift namens Strike! schreiben sollte. Der Redakteur fragte, ob ich etwas Provokatives hätte, das sonst keiner veröffentlichen wollte. Meist habe ich eine oder zwei Ideen für solche Essays in petto, also schrieb ich einen Entwurf und gab ihm den kurzen Titel »Über das Phänomen der Bullshit-Jobs«.
Ausgangspunkt für den Artikel war eine Vermutung. Jeder von uns kennt berufstätige Menschen, die nach dem Eindruck von Außenstehenden eigentlich nicht viel tun: Personalberater, Kommunikationskoordinatoren, PR-Wissenschaftler, Finanzstrategen, Anwälte für Gesellschaftsrecht oder die (im akademischen Umfeld allgemein bekannten) Leute, die ihre Zeit in Gremiensitzungen zubringen und über das Problem überflüssiger Gremien diskutieren. Die Liste schien endlos zu sein. Wäre es nicht möglich, so fragte ich mich, dass diese Jobs tatsächlich nutzlos sind und dass diejenigen, die sie ausführen, sich dessen auch genau bewusst sind? Jeder trifft doch von Zeit zu Zeit auf Menschen, die den Eindruck haben, dass sie eine witzlose, unnötige Tätigkeit ausführen. Kann irgendetwas stärker demoralisieren, als während seines ganzen Erwachsenenlebens an fünf von sieben Tagen morgens aufzuwachen und dann eine Arbeit zu verrichten, von der man insgeheim glaubt, dass sie nicht verrichtet werden muss – dass sie einfach nur Zeit- und Geldverschwendung ist oder die Welt sogar schlechter macht? Wäre das nicht eine schreckliche seelische Wunde, die sich quer durch unsere Gesellschaft zieht? Wenn ja, dann war es eine Wunde, über die anscheinend niemand sprach. Ob die Menschen in ihrem Beruf glücklich sind, wurde in einer Vielzahl von Umfragen untersucht. Aber soweit ich weiß, gab es keine Untersuchung zu der Frage, ob Menschen den Eindruck haben, dass ihr Beruf eine Daseinsberechtigung hat.
Der Gedanke, unsere Gesellschaft könne von unnützen Tätigkeiten durchsetzt sein, ohne dass jemand darüber reden mag, erscheint nicht von vornherein unplausibel. Das Thema Arbeit ist mit Tabus besetzt. Schon die Tatsache, dass die meisten Menschen ihren Job nicht gern tun und jede Ausrede, nicht zur Arbeit zu gehen, reizvoll finden, kann man im Fernsehen nicht ohne Weiteres ansprechen – jedenfalls nicht in den Fernsehnachrichten; nur in Dokumentarfilmen und Stand-up-Comedys wird gelegentlich darauf angespielt. Solche Tabus habe ich selbst erlebt: Ich war einmal als Medienbeauftragter für eine Aktivistengruppe tätig, die Gerüchten zufolge im Rahmen der Proteste gegen einen Weltwirtschaftsgipfel mit einer Kampagne des zivilen Ungehorsams den Nahverkehr von Washington lahmlegen wollte. In den Tagen davor konnte man, wenn man wie ein Anarchist aussah, fast nirgendwo hingehen, ohne dass man von fröhlichen Staatsdienern angesprochen wurde. Sie erkundigten sich, ob es wirklich stimmte, dass sie am Montag nicht zur Arbeit fahren müssten. Dennoch gelang es Fernsehteams zur gleichen Zeit, städtische Angestellte zu interviewen – und es würde mich nicht wundern, wenn es in manchen Fällen dieselben Angestellten waren –, die sich pflichtschuldig dazu äußerten, wie entsetzlich tragisch es doch wäre, wenn sie nicht zur Arbeit gehen könnten. Schließlich wussten sie, dass sie damit ins Fernsehen kommen würden. Offensichtlich sind die Menschen nicht bereit, freimütig zu sagen, was sie über solche Fragen wirklich denken – jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit.
Es war plausibel, aber eigentlich wusste ich es nicht. Den Artikel zu schreiben, war für mich so etwas wie ein Experiment. Ich war gespannt, welche Reaktionen ich damit auslösen würde.
Für das Augustheft 2013 schrieb ich:
Über das Phänomen der Bullshit-Jobs
Im Jahr 1930 prophezeite John Maynard Keynes, die Technologie werde bis zum Ende des Jahrhunderts so weit fortgeschritten sein, dass Länder wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten bei einer 15-Stunden-Arbeitswoche angekommen wären. Wir haben allen Grund zu glauben, dass er recht hatte. Aus technischer Sicht wären wir dazu durchaus in der Lage. Und doch kam es nicht so. Wenn überhaupt, wurden mithilfe der Technologie neue Wege erschlossen, damit wir alle mehr arbeiten. Um das zu bewerkstelligen, musste man Jobs schaffen, die letztlich nutzlos sind. Insbesondere in Europa und Nordamerika führen Heerscharen von Menschen während ihres ganzen Berufslebens Tätigkeiten aus, von denen sie insgeheim glauben, dass sie nicht ausgeführt werden müssten. Aus dieser Situation erwächst ein weitreichender moralischer und geistiger Schaden. Er ist eine Narbe, die sich quer über unsere kollektive Seele zieht. Und doch spricht praktisch niemand darüber.
Warum wurde das von Keynes versprochene Utopia – das noch in den 1960er Jahren sehnlichst erwartete wurde – niemals Wirklichkeit? Heute lautet die Standardantwort: Er sah die starke Zunahme des Konsumdenkens nicht voraus. Wenn wir die Wahl zwischen weniger Arbeitsstunden und mehr Spielzeug oder Vergnügungen haben, entscheiden wir uns kollektiv für Letzteres. Das gibt ein hübsches moralisches Märchen ab, aber schon bei kurzem Nachdenken wird klar, dass es nicht stimmen kann. Ja, wir sind seit den 1920er Jahren Zeugen geworden, wie eine endlose Vielfalt neuer Berufe und Branchen entstanden ist, aber nur die wenigsten davon haben mit dem Vertrieb von Sushi, I-Phones oder schicken Sneakers zu tun.
Um was für neue Jobs handelt es sich eigentlich im Einzelnen? Ein klares Bild liefert ein kürzlich erschienener Bericht, in dem die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten in den Jahren 1910 und 2000 verglichen wurde (und der, so muss ich feststellen, in Großbritannien seinen genauen Widerhall findet). Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts ist die Zahl derer, die als Hausangestellte, in der Industrie und in der Landwirtschaft arbeiteten, drastisch gesunken. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Arbeitskräfte in den Bereichen von »Gewerbe, Verwaltung, Behörden, Verkauf und Dienstleistungen« verdreifacht und ist »von einem Viertel auf drei Viertel der Gesamtzahl der Beschäftigten« gewachsen. Mit anderen Worten: Jobs in der Produktion wurden gemäß den Vorhersagen im Wesentlichen wegautomatisiert. (Selbst wenn man die Industriearbeiter auf der ganzen Welt einschließlich der schuftenden Massen in Indien und China zählt, machen solche Arbeiter bei Weitem nicht mehr einen so hohen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung aus wie früher.)
Aber statt zuzulassen, dass eine drastische Verkürzung der Arbeitszeiten der Weltbevölkerung die Freiheit verschaffte, ihren eigenen Vorhaben, Vergnügungen, Visionen und Ideen nachzugehen, wurden wir Zeugen einer Aufblähung, von der allerdings weniger der »Dienstleistungssektor« betroffen war als vielmehr der Verwaltungsbereich. Das ging bis hin zur Schaffung ganz neuer Branchen wie Finanzdienstleistungen oder Telefonwerbung und bis zur beispiellosen Ausweitung von Sektoren wie Unternehmensrecht, Hochschul- und Gesundheitsverwaltung, Personalwesen und Public Relations. Und in den Zahlen sind all diejenigen, deren Aufgabe es ist, die genannten Branchen administrativ, technisch oder im Hinblick auf die Sicherheit zu unterstützen, ebenso wenig enthalten wie die vielen ergänzenden Branchen (Hundepfleger, Rund-um-die-Uhr-Pizzaboten), die nur deshalb existieren, weil alle anderen einen so großen Teil ihrer Zeit für die Arbeit in den übrigen Branchen aufwenden.
Das sind die »Bullshit-Jobs«, wie ich sie gern nennen möchte.
Es ist, als würde sich irgendjemand sinnlose Tätigkeiten ausdenken, nur damit wir alle ständig arbeiten. Und genau da liegt das Rätsel. Im Kapitalismus sollte genau das eigentlich nicht eintreten. Natürlich, in den alten, ineffizienten sozialistischen Staaten wie der Sowjetunion, wo Beschäftigung sowohl ein Recht als auch eine heilige Pflicht war, schuf das System so viele Jobs, wie es schaffen musste. (Deshalb waren in den sowjetischen Kaufhäusern drei Verkäufer nötig, um ein Stück Fleisch zu verkaufen.) Aber solche Probleme sollte der marktwirtschaftliche Wettbewerb eigentlich beseitigen. Zumindest in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie wäre es das Letzte, was ein gewinnorientiertes Unternehmen tun würde, Geld an Mitarbeiter auszuzahlen, die eigentlich nicht gebraucht werden. Und doch geschieht genau das.
Konzerne nehmen zwar ständig erbarmungslose Kürzungen vor, aber von Entlassungen und Mehrarbeit sind regelmäßig diejenigen Menschengruppen betroffen, die tatsächlich Dinge herstellen, transportieren, reparieren und instand halten. Durch eine seltsame Alchemie, die niemand erklären kann, wird die Zahl der bezahlten Aktenschieber am Ende immer größer, und immer mehr Angestellte arbeiten – sowjetischen Arbeitern eigentlich nicht unähnlich – auf dem Papier 40 oder sogar 50 Stunden in der Woche, aber effizient arbeiten sie, wie Keynes es vorhergesagt hatte, nur 15 Stunden. Die übrige Zeit dient dazu, zu organisieren, an Motivationsseminaren teilzunehmen, Facebook-Profile zu aktualisieren oder Fernsehserien herunterzuladen.
Die Antwort ist eindeutig nicht wirtschaftlicher, sondern moralischer und politischer Natur: Die herrschende Klasse hat gemerkt, dass eine glückliche, produktive Bevölkerung, der viel Freizeit zur Verfügung steht, eine tödliche Gefahr ist. (Denken wir nur daran, was in den 1960er Jahren geschah, als man dem nur ein wenig näher kam.) Und andererseits ist es für sie ein außerordentlich bequemes Gefühl, Arbeit als solche sei ein moralischer Wert und jeder, der sich nicht während des größten Teils seiner wachen Stunden einer strengen Arbeitsdisziplin unterwirft, habe nichts verdient.
Als ich einmal über das scheinbar endlose Wachstum der administrativen Zuständigkeiten an britischen Hochschulinstituten nachdachte, überfiel mich eine mögliche Vision der Hölle. Die Hölle ist eine Ansammlung von Personen, die den größten Teil ihrer Zeit mit einer Tätigkeit beschäftigt sind, die sie nicht mögen und nicht besonders gut beherrschen. Angenommen, sie wurden eingestellt, weil sie ausgezeichnete Möbeltischler sind, und dann merken sie, dass sie während eines Großteils ihrer Zeit Fische braten sollen. Die Tätigkeit muss auch eigentlich nicht ausgeführt werden – schließlich gibt es nur eine sehr begrenzte Zahl von Fischen, die gebraten werden müssen. Aber irgendwie sind alle besessen von Widerwillen bei dem Gedanken, einige ihrer Kollegen könnten vielleicht mehr Zeit mit dem Bau von Möbeln zubringen und nicht ihren gerechten Anteil an der Zuständigkeit für das Fischebraten übernehmen; dann dauert es nicht lange, bis überall in der Werkstatt riesige Haufen unnützer, schlecht gebratener Fische herumliegen und das Fischebraten das Einzige ist, was alle tatsächlich tun.
Das ist nach meiner Überzeugung eine ziemlich zutreffende Beschreibung für die moralische Dynamik in unserer Wirtschaft.
Nun ist mir klar, dass eine solche Argumentation sofort auf Widerspruch stoßen wird: »Wer sind Sie, dass Sie beurteilen können, welche Tätigkeiten wirklich ›notwendig‹ sind? ›Notwendig‹ – was bedeutet das überhaupt? Sie sind Professor für Anthropologie – welche ›Notwendigkeit‹ gibt es dafür?« (Und tatsächlich würden viele Leser der Boulevardpresse meine Tätigkeit für den Inbegriff der Vergeudung öffentlicher Mittel halten.) Auf einer gewissen Ebene stimmt das natürlich. Ein objektives Maß für gesellschaftlichen Wert kann es nicht geben.
Wenn jemand nach eigener Überzeugung eine sinnvolle Tätigkeit ausübt, würde ich mir nicht anmaßen, ihm zu sagen, dass es nicht stimmt. Aber wie steht es mit denen, die selbst überzeugt sind, dass ihre Arbeit sinnlos ist? Vor nicht allzu langer Zeit nahm ich wieder Kontakt mit einem Schulfreund auf, den ich nicht mehr gesehen hatte, seit ich 15 war. Zu meinem Erstaunen erfuhr ich, dass er zuerst Dichter und dann Frontmann einer Indie-Band geworden war. Ich hatte einige seiner Lieder im Radio gehört, aber ich hatte keine Ahnung gehabt, dass ich den Sänger kannte. Er war offensichtlich geistreich und fantasievoll, und mit seiner Arbeit hatte er zweifellos das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt aufgeheitert und verbessert. Dennoch hatte man ihm nach einigen erfolglosen Alben seinen Vertrag gekündigt, und da er nun mit Schulden und einer neugeborenen Tochter belastet war, traf er am Ende, wie er selbst es formulierte, »die Wahl so vieler orientierungsloser Menschen: ein Jurastudium«. Heute arbeitet er als Firmenanwalt in einer bekannten New Yorker Kanzlei. Er räumte als Erster ein, dass seine Tätigkeit vollkommen sinnlos sei, keinen Beitrag zur Welt leiste und nach seiner eigenen Einschätzung überhaupt nicht existieren sollte.
An dieser Stelle kann man eine Menge Fragen stellen. Die erste lautet: Was sagt es über unsere Gesellschaft aus, dass sie offensichtlich nur einen äußerst begrenzten Bedarf an Dichtern und Musikern hat, während anscheinend eine unbegrenzte Nachfrage nach Spezialisten für Gesellschaftsrecht besteht? (Die Antwort: Wenn ein Prozent der Bevölkerung den größten Teil des gesamten Reichtums kontrolliert, spiegelt der sogenannte Markt wider, was sie – und nicht alle anderen – für nützlich oder wichtig halten.) Vor allem aber zeigt es, dass die meisten Menschen in sinnlosen Berufen sich der Sinnlosigkeit letztlich bewusst sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals einen Firmenanwalt kennengelernt habe, der seinen Job nicht für Bullshit hielt. Das Gleiche gilt für nahezu alle anderen zuvor genannten Branchen. Es gibt eine ganze Klasse hoch bezahlter Spezialisten, die auf einer Party jedes Gespräch über ihre Arbeitsrichtung vermeiden werden, wenn der andere erklärt, er tue etwas, das als interessant gelten könnte (beispielsweise weil er Anthropologe ist). Gibt man ihnen ein paar Drinks, brechen sie in Schimpftiraden über ihren eigentlich sinnlosen, dummen Job aus.
Hier liegt eine tief greifende psychische Gewalt. Wie kann man auch nur ansatzweise von der Würde der Arbeit sprechen, wenn man insgeheim den Eindruck hat, dass es den eigenen Job eigentlich gar nicht geben sollte? Wie soll da nicht ein Gefühl des tiefen Zorns und Widerwillens aufkommen? Und doch ist es die eigenartige Genialität unserer Gesellschaft, dass die Herrschenden wie im Beispiel der Fischbrater einen Weg gefunden haben, um den Zorn genau gegen diejenigen zu richten, die tatsächlich sinnvolle Arbeit tun. Ein Beispiel: Offensichtlich gilt in unserer Gesellschaft die Regel, dass eine Arbeit umso schlechter bezahlt wird, je offensichtlicher sie anderen Menschen nützt. Auch hier ist es schwierig, ein objektives Maß zu finden, aber einen Eindruck kann man sich mit einer einfachen Frage verschaffen: Was würde geschehen, wenn diese ganze Berufsgruppe einfach verschwinden würde? Man kann über Krankenschwestern, die Mitarbeiter der Müllabfuhr oder Automechaniker sagen, was man will, aber eines liegt auf der Hand: Würden sie sich plötzlich in Luft auflösen, die Folgen wären sofort spürbar und katastrophal. Auch eine Welt ohne Lehrer oder Hafenarbeiter würde schnell in Schwierigkeiten geraten, und selbst ohne Science-Fiction-Autoren oder Ska-Musiker wäre sie sicher weniger schön. Dagegen ist nicht ganz klar, wie die Welt leiden würde, wenn alle Private-Equity-Manager, Lobbyisten, Public-Relations-Forscher, Versicherungsfachleute, Telefonverkäufer oder Rechtsberater auf ähnliche Weise verschwinden würden.[1] (Vielfach herrscht der Verdacht, dass sie sich merklich verbessern würde.) Aber abgesehen von einer Handvoll vielfach gepriesener Ausnahmen (Ärzte!) gilt die Regel überraschend gut.
Was noch perverser ist: Anscheinend herrscht allgemein der Eindruck, dass es so sein muss. Das ist eine der geheimen Stärken des Rechtspopulismus. Man erkennt sie, wenn die Boulevardpresse den Zorn gegen die U-Bahn-Mitarbeiter schürt, weil sie London während der Tarifverhandlungen lahmlegen: Schon die Tatsache, dass die U-Bahn-Angestellten London lahmlegen können, ist der Beweis, dass ihre Arbeit tatsächlich notwendig ist, aber genau das, so scheint es, ärgert die Menschen. Noch deutlicher wird das Prinzip in den Vereinigten Staaten: Dort ist es den Republikanern bemerkenswert gut gelungen, Ressentiments gegen Lehrer und die Arbeiter der Autofirmen zu wecken (aber interessanterweise nicht gegen die Schulverwaltungsbeamten oder Automanager, die eigentlich die Probleme verursachen), weil sie angeblich überhöhte Gehälter beziehen und Vorteile genießen. Es ist, als würde man zu ihnen sagen: »Aber ihr unterrichtet ja Kinder! Ihr baut Autos! Ihr habt ja richtige Arbeit! Und obendrein habt ihr noch die Stirn, Mittelklassepensionen und Krankenversicherung zu erwarten?«
Hätte jemand für die Arbeitswelt ein System entwerfen sollen, das sich ideal dazu eignet, die Macht des Finanzkapitals aufrechtzuerhalten, so ist kaum zu erkennen, wie man es hätte besser machen können. Echte, produktive Arbeiter werden erbarmungslos unter Druck gesetzt und ausgebeutet. Der Rest gliedert sich in die terrorisierte Schicht der allgemein geschmähten Arbeitslosen und eine größere Schicht derer, die im Wesentlichen fürs Nichtstun bezahlt werden; ihre Positionen sind so gestaltet, dass sie sich mit den Sichtweisen und Empfindlichkeiten der herrschenden Klasse (Manager, Beamte und so weiter) – und insbesondere ihren finanziellen Inkarnationen – identifizieren können, aber gleichzeitig nähren sie auch einen unterschwelligen Widerwillen gegen alle, deren Arbeit einen eindeutigen, unbezweifelbaren gesellschaftlichen Wert hat. Natürlich wurde dieses System nie bewusst so gestaltet, sondern es erwuchs aus einem Jahrhundert des Ausprobierens. Aber es ist die einzige Erklärung dafür, dass wir trotz unserer technischen Möglichkeiten nicht alle einen Arbeitstag von drei bis vier Stunden haben.
Wenn jemals eine in einem Essay vertretene Hypothese durch das Echo bestätigt wurde, das sie auslöste, dann diese. »Über das Phänomen der Bullshit-Jobs« führte zu einer Explosion.
Ironie des Schicksals: Für die beiden Wochen nach Erscheinen des Artikels hatten meine Partnerin und ich uns vorgenommen, uns mit einer Kiste voller Bücher und miteinander in eine Hütte im ländlichen Québec zurückzuziehen. Wir hatten ausdrücklich darauf geachtet, dass es dort kein WLAN gab. Damit geriet ich in die seltsame Lage, dass ich die Folgen nur auf meinem Handy beobachten konnte. Der Artikel verbreitete sich mit rasender Geschwindigkeit. Schon nach wenigen Wochen war er in mindestens ein Dutzend Sprachen übersetzt worden, darunter Deutsch, Norwegisch, Schwedisch, Französisch, Tschechisch, Rumänisch, Russisch, Lettisch, Polnisch, Griechisch, Estnisch, Katalanisch und Koreanisch. Zeitungen von der Schweiz bis nach Australien druckten ihn nach. Die Website von Strike! erzielte mehr als eine Million Klicks und brach unter der hohen Belastung immer wieder zusammen. Die Blogs schossen aus dem Boden. Leserbriefspalten füllten sich mit Bekenntnissen von Krawattenträgern. Menschen schrieben mir und fragten um Rat oder teilten mir mit, ich sei für sie zum Anlass geworden, ihre Stellungen aufzugeben und sich nach etwas Sinnvollerem umzusehen. Die folgende begeisterte Zuschrift (ich habe Hunderte gesammelt) stammt von der Leserbriefseite der australischen Canberra Times:
Wow! Nagel auf den Kopf! Ich bin Firmenanwalt (Steueranwalt, um genau zu sein). Ich trage nichts zu dieser Welt bei und fühle mich ständig vollkommen elend. Ich mag es nicht, wenn Leute den Nerv haben, mich zu fragen: »Was machst du eigentlich beruflich?«, denn das ist eindeutig nicht so einfach. So kommt es, dass es für mich nur diesen einen Weg gibt, um zu dem einen Prozent auf so bedeutsame Weise beizutragen, dass ich mit einem Haus in Sydney belohnt werde und meine zukünftigen Kinder großziehen kann … Dank der Technik sind wir heute wahrscheinlich in zwei Tagen so produktiv wie früher in fünf. Aber durch Habgier und eine Art Fleißige-Bienen-Produktivitätssyndrom lassen wir uns immer noch bitten, aufgrund unseres eigenen, nicht belohnten Ehrgeizes für den Profit anderer zu schuften. Ob man nun an Intelligent Design oder Evolution glaubt: Der Mensch wurde nicht zum Arbeiten gemacht. Für mich ist das alles nur Habgier, unterstützt durch aufgeblasene Preise für Notwendiges.[2]
Irgendwann erklärte mir ein anonymer Fan in einer Nachricht, er gehöre zu einer spontan entstandenen Gruppe, die den Artikel in der Gemeinde der Finanzdienstleister in Umlauf gebracht hätte. Er habe allein an diesem Tag fünf E-Mails mit dem Artikel erhalten (sicher ein Zeichen, dass viele Mitarbeitende in der Finanzbranche nicht viel zu tun haben). Aber das alles war keine Antwort auf die Frage, wie groß die Zahl derer ist, die wirklich eine solche Einstellung zu ihrem Job haben – im Gegensatz zu denen, die den Aufsatz vielleicht verbreiteten, weil sie anderen einen Wink mit dem Zaunpfahl geben wollten. Aber es dauerte nicht mehr lange, bis auch statistische Indizien ans Licht kamen.
Am 5. Januar 2015, etwas mehr als ein Jahr, nachdem der Artikel erschienen war, und damit am ersten Montag des neuen Jahres – dem Tag, an dem die meisten Londoner aus dem Winterurlaub zurückkehren und wieder zur Arbeit gehen – nahm jemand in der Londoner U-Bahn mehrere Hundert Werbeplakate ab und ersetzte sie durch eine Reihe von Guerilla-Postern, auf denen Zitate aus dem ursprünglichen Artikel standen. Man hatte folgende Sätze ausgewählt:
Heerscharen von Menschen üben während ihres ganzen Berufslebens Tätigkeiten aus, von denen sie insgeheim glauben, dass sie nicht ausgeführt werden müssten.
Es ist, als würde sich irgendjemand sinnlose Tätigkeiten ausdenken, nur damit wir alle ständig arbeiten.
Aus dieser Situation erwächst ein weitreichender moralischer und geistiger Schaden. Er ist eine Narbe, die sich quer über unsere kollektive Seele zieht. Und doch spricht praktisch niemand darüber.
Wie kann man auch nur ansatzweise von der Würde der Arbeit sprechen, wenn man insgeheim den Eindruck hat, dass es den eigenen Job eigentlich gar nicht geben sollte?
Die Reaktion auf die Posterkampagne bestand in einer neuen Welle der Diskussionen in den Medien (ich selbst trat kurz bei Russia Today auf), und in der Folge machte sich das Meinungsforschungsinstitut YouGov daran, die Hypothese zu überprüfen. Es führte unter Briten eine Umfrage durch und bediente sich dazu einiger Formulierungen, die unmittelbar aus dem Aufsatz stammten. Eine Frage lautete beispielsweise: »Leistet Ihre Arbeit einen sinnvollen Beitrag zur Welt?« Erstaunlicherweise antwortete mehr als ein Drittel der Befragten – 37 Prozent –, dies sei nicht der Fall. (50 Prozent hielten ihre Tätigkeit für sinnvoll, und 13 Prozent waren sich nicht sicher.)
Das war fast das Doppelte dessen, was ich erwartet hatte – ich hatte mir vorgestellt, dass der Anteil der Bullshit-Jobs bei rund 20 Prozent liegt. Aber das ist noch nicht alles: Eine spätere Studie gelangte in den Niederlanden beinahe zu dem gleichen Ergebnis. Der Anteil lag hier sogar noch ein wenig höher: 40 Prozent der berufstätigen Niederländer gaben an, es gebe eigentlich keinen stichhaltigen Grund dafür, dass ihr Beruf existierte.
Die Hypothese wurde also nicht nur durch die Reaktion der Öffentlichkeit bestätigt, sondern auch durch handfeste statistische Erhebungen.
Wir haben es hier demnach eindeutig mit einem wichtigen gesellschaftlichen Phänomen zu tun, dem bisher kaum systematische Aufmerksamkeit zuteilgeworden ist.[3] Schon einen Weg zu eröffnen, um darüber zu reden, wurde vielfach zu einer erlösenden Erfahrung. Dass eine umfassendere Untersuchung geboten war, lag auf der Hand.
Was ich hier vorhabe, ist ein wenig systematischer angelegt als der ursprüngliche Essay. Den Artikel von 2013 schrieb ich für ein Magazin über revolutionäre Politik, und dabei lag der Schwerpunkt auf den politischen Folgerungen aus dem Problem. Eigentlich war der Aufsatz nur eine Aneinanderreihung von Argumenten, die ich zu jener Zeit im Zusammenhang mit der neoliberalen Ideologie der »freien Märkte« entwickelte, einer Ideologie, die in der Welt seit der Zeit von Thatcher und Reagan eine beherrschende Rolle spielte und in Wirklichkeit genau das Gegenteil dessen war, was sie zu sein behauptete. Eigentlich war sie ein politisches Projekt in wirtschaftlichem Gewand.
Zu dieser Schlussfolgerung war ich gelangt, weil man das tatsächliche Verhalten der Machthaber anscheinend nur so erklären konnte. Während es in der neoliberalen Rhetorik stets darum ging, die Magie der Märkte zu entfesseln und wirtschaftliche Effizienz über alle anderen Werte zu stellen, hatte die Politik der freien Märkte in Wirklichkeit den Effekt, dass das Wirtschaftswachstum sich praktisch überall mit Ausnahme von Indien und China verlangsamte; der technische und wissenschaftliche Fortschritt stagnierte, und in den meisten wohlhabenden Ländern mussten die jüngeren Generationen zum ersten Mal seit Jahrhunderten damit rechnen, ein weniger begütertes Leben zu führen als ihre Eltern. Aber wenn die Vertreter der Marktideologie solche Effekte beobachten, antworten sie stets mit Forderungen nach noch stärkeren Dosen der gleichen Arznei, und die Politiker setzen sie pflichtschuldig in die Tat um. Das erschien mir seltsam. Wenn ein Privatunternehmen einen Berater engagiert, der einen Geschäftsplan erstellen soll, und wenn dieser Geschäftsplan dann zu einem starken Rückgang der Gewinne führt, wird der Berater entlassen. Oder zumindest fordert man ihn auf, einen anderen Plan vorzulegen. Im Zusammenhang mit den Reformen der freien Märkte geschah so etwas anscheinend nie. Je stärker sie versagten, desto stärker wurden sie gefördert. Daraus konnte man nur eine logische Schlussfolgerung ziehen: Wirtschaftliche Erfordernisse waren nicht die eigentliche Triebkraft des Projekts.
Aber was war es dann? Die Antwort schien mir in der Geisteshaltung der politischen Klasse zu liegen. Fast alle, die wichtige Entscheidungen trafen, waren in den 1960er Jahren aufs College gegangen, als die Hochschulen im Mittelpunkt des politischen Gärens standen, und alle waren überzeugt, dass sich so etwas nie wiederholen durfte. Deshalb machten sie sich zwar vielleicht Sorgen um die sinkenden wirtschaftlichen Indikatoren, gleichzeitig stellten sie aber auch mit Vergnügen fest, welche Folgen die Kombination aus Globalisierung, Beschneidung der Gewerkschaftsmacht und der Schaffung einer verunsicherten, überbelasteten Arbeiterschaft in Verbindung mit aggressiven Lippenbekenntnissen für die Forderung der 1960er Jahre nach hedonistischer persönlicher Befreiung (später sprach man von »liberalem Lebensstil und finanziellem Konservativismus«) hatte: Immer mehr Reichtum und Macht wurden in Richtung der Reichen verschoben, und gleichzeitig wurden die Grundlagen für einen organisierten Widerstand gegen ihre Macht nahezu vollständig zerstört. Wirtschaftlich mochte das nicht besonders gut funktionieren, aber politisch funktionierte es hervorragend. Zumindest bestanden kaum Anreize, eine solche Politik aufzugeben. In meinem Essay ging ich schlicht dieser Erkenntnis weiter nach: Immer, wenn man feststellt, dass jemand im Namen der wirtschaftlichen Effizienz etwas tut, was wirtschaftlich vollkommen irrational zu sein scheint (beispielsweise indem man Menschen gutes Geld dafür bezahlt, dass sie den lieben langen Tag nichts tun), fragt man am besten wie die alten Römer: Cui bono? – Wem nützt es? – Und wie nützt es ihm?
Das ist kein verschwörungstheoretischer Ansatz, sondern er richtet sich eher gegen Verschwörungstheorien. Ich fragte, welche Handlungen nicht ausgeführt wurden. Wirtschaftliche Trends stellen sich aus allen möglichen Gründen ein, aber wenn sie Probleme für die Reichen und Mächtigen schaffen, werden diese Reichen und Mächtigen die Institutionen unter Druck setzen, damit sie eingreifen und etwas unternehmen. Das ist der Grund, warum große Investmentbanken nach der Finanzkrise von 2008/2009 freigekauft wurden, gewöhnliche Hypothekenschuldner aber nicht. Zur Vermehrung der Bullshit-Jobs kam es, wie wir noch genauer erfahren werden, aus verschiedenen Gründen. Eigentlich stellte ich aber die Frage, warum niemand eingegriffen (oder, wenn man so will, »sich verschworen«) hat, um etwas dagegen zu tun.
Mit diesem Buch habe ich beträchtlich mehr vor.
Nach meiner Überzeugung gestattet uns das Phänomen der Bullshit-Beschäftigung einen Blick auf viel tiefer liegende gesellschaftliche Probleme. Wir müssen uns nicht nur fragen, warum ein so großer Anteil unserer Arbeitskräfte sich mit Tätigkeiten herumschlägt, die sie selbst für sinnlos halten, sondern wir müssen auch der Frage nachgehen, warum so viele Menschen diesen Zustand für normal, unvermeidlich oder sogar wünschenswert halten. Und was noch seltsamer ist: Einerseits sind diejenigen, die ihre eigenen Tätigkeiten für sinnlos halten, abstrakt dieser Meinung und glauben sogar, es sei vollkommen angemessen, dass sie besser bezahlt werden und mehr Ehre und Anerkennung erfahren als diejenigen, deren Tätigkeiten sie selbst für nützlich halten, und andererseits fühlen sie sich deprimiert und elend, wenn sie sich am Ende in Stellungen wiederfinden, in denen sie dafür bezahlt werden, nichts zu tun oder zumindest nichts, was anderen in irgendeiner Weise nützt. Hier ist offensichtlich ein Gewirr widersprüchlicher Gedanken und Impulse im Spiel. In diesem Buch möchte ich unter anderem damit beginnen, Klarheit zu schaffen. Dazu werde ich praktische Fragen stellen wie beispielsweise diese: Wie laufen Bullshit-Jobs eigentlich ab? Ich muss dazu aber auch historischen Fragen nachgehen, darunter der, wann und wie wir zu dem Glauben gelangt sind, Kreativität sei etwas Schmerzliches, oder wie sich bei uns die Vorstellung entwickelt hat, dass es möglich ist, die eigene Zeit zu verkaufen. Und schließlich muss ich grundlegende Fragen nach dem Wesen des Menschen stellen.
Indem ich dieses Buch schreibe, verfolge ich auch einen politischen Zweck.
Es wäre mir lieb, wenn mein Buch zu einem Pfeil wird, der ins Herz unserer Zivilisation zielt. An dem, was wir aus uns gemacht haben, ist irgendetwas vollkommen falsch. Wir sind zu einer Zivilisation geworden, die auf Arbeit basiert – und zwar nicht einmal auf »produktiver Arbeit«, sondern auf Arbeit als Selbstzweck und Sinnträger. Männer und Frauen, die in Stellungen, an denen sie keinen besonderen Spaß haben, nicht fleißiger sind, als sie wollen, halten wir mittlerweile für schlechte Menschen, die der Liebe, der Fürsorge oder der Hilfe ihres Umfelds nicht wert sind. Es ist, als hätten wir kollektiv unserer eigenen Versklavung zugestimmt. Die häufigste politische Reaktion auf unser Bewusstsein, dass wir uns während der Hälfte unserer Zeit mit vollkommen sinnlosen oder sogar kontraproduktiven Tätigkeiten beschäftigen – und zwar gewöhnlich unter dem Befehl einer Person, die wir nicht mögen –, besteht darin, Ressentiments gegenüber der Tatsache zu schüren, dass es möglicherweise irgendwo auch andere gibt, die nicht in die gleiche Falle getappt sind. Deshalb sind Hass, Vorbehalte und Misstrauen zu dem Leim geworden, der die Gesellschaft zusammenhält. Das ist ein katastrophaler Zustand. Ich möchte ihn beenden.
Wenn das vorliegende Buch irgendwie zu einem solchen Ziel beitragen kann, hat sich das Schreiben gelohnt.
Kapitel 1
Was ist ein Bullshit-Job?
Beginnen wir mit einem Fall, den man vielleicht als Musterbeispiel für einen Bullshit-Job bezeichnen kann.
Kurt arbeitet für einen Subunternehmer der deutschen Bundeswehr. Das heißt – eigentlich ist er bei einem Subunternehmer eines Subunternehmers eines Subunternehmers der Bundeswehr angestellt. Seine Tätigkeit beschreibt er so:
Die Bundeswehr hat einen Subunternehmer, der für die IT zuständig ist. Die IT-Firma hat einen Subunternehmer, der sich um ihre Logistik kümmert.
Die Logistikfirma hat einen Subunternehmer für die Personalverwaltung, und für dieses Unternehmen arbeite ich.
Angenommen, der Soldat A zieht in ein Büro um, das auf dem Korridor zwei Türen weiter liegt. Statt einfach seinen Computer dorthin zu tragen, muss er ein Formular ausfüllen.
Der IT-Subunternehmer erhält das Formular, Leute lesen und genehmigen es, und es wird an das Logistikunternehmen weitergeleitet.
Anschließend muss das Logistikunternehmen den Umzug entlang des Korridors genehmigen und fordert bei uns Personal an.
Nun tun die Leute im Büro meines Unternehmens irgendetwas, und hier komme ich ins Spiel. Ich erhalte eine E-Mail: »Finden Sie sich zum Zeitpunkt C in der Kaserne B ein.« Die Kaserne ist in der Regel 100 bis 500 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, also erhalte ich einen Mietwagen. Ich hole den Mietwagen ab, fahre zur Kaserne, teile der Verwaltung mit, dass ich angekommen bin, fülle ein Formular aus, ziehe die Stecker des Computers heraus, verpacke den Computer in einer Kiste, verschließe die Kiste, lasse einen Mitarbeiter der Logistikfirma die Kiste in das nächste Zimmer tragen, öffne dort die Kiste wieder, fülle erneut ein Formular aus, schließe den Computer an, rufe bei der Verwaltung an und teile ihnen mit, wie lange ich gebraucht habe, sammle eine Reihe von Unterschriften ein, fahre mit dem Mietwagen wieder nach Hause, schicke der Verwaltung einen Brief mit dem ganzen Papierkram und werde anschließend bezahlt.
Anstatt dass der Soldat also seinen Computer fünf Meter weit trägt, fahren zwei Personen insgesamt sechs bis zehn Stunden lang Auto, füllen ungefähr 15 Blatt Papier aus und vergeuden Steuergelder in Höhe von gut 400 Euro.[1]
Das alles hört sich vielleicht nach einem klassischen Beispiel für den lächerlichen militärischen Amtsschimmel an, wie ihn Joseph Heller im Jahr 1961 mit seinem Roman Catch-22 berühmt machte, aber ein Schlüsselelement ist anders: Fast niemand arbeitet in dieser Geschichte wirklich bei der Bundeswehr. Formal betrachtet, gehören sie alle zur Privatwirtschaft. Natürlich gab es einmal eine Zeit, als jede nationale Armee ihre eigenen Abteilungen für Kommunikation, Logistik und Personalverwaltung hatte, aber heute muss alles über ein mehrstufiges privates Outsourcing erledigt werden.
Dass man Kurts Tätigkeit als Musterbeispiel für einen Bullshit-Job betrachten kann, hat einen einfachen Grund: Würde man seine Stellung beseitigen, hätte es keine erkennbaren Auswirkungen auf die Welt. Höchstwahrscheinlich würden sich die Verhältnisse sogar verbessern, denn dann müssten deutsche Militärstützpunkte vermutlich einen vernünftigeren Weg finden, um ihre Ausrüstung von einer Stelle zur anderen zu bewegen. Und was dabei entscheidend ist: Kurts Tätigkeit ist nicht nur absurd, sondern Kurt selbst ist sich dessen auch vollkommen bewusst. (In dem Blog, in dem er seine Geschichte veröffentlichte, musste er die Behauptung, die Tätigkeit diene keinerlei Zweck, sogar gegen eine Reihe von Fans der freien Märkte verteidigen, die sich sofort zu Wort meldeten – was Fans der freien Märkte in Internetforen immer zu tun pflegen – und behaupteten, da seine Tätigkeit vom privaten Sektor geschaffen worden sei, müsse sie definitionsgemäß einem legitimen Zweck dienen.)
Dies halte ich für das definierende Merkmal eines Bullshit-Jobs: Er ist so vollkommen sinnlos, dass selbst die Person, die ihn tagtäglich ausführen muss, sich nicht einreden kann, es gebe dafür einen stichhaltigen Grund. Den Kollegen gegenüber kann man es unter Umständen nicht zugeben – oft gibt es sehr gute Gründe dafür, dies nicht zu tun. Man selbst ist aber dennoch überzeugt, dass die Tätigkeit sinnlos ist. Formulieren wir also für den Anfang folgende vorläufige Definition:
Vorläufige Definition: Ein Bullshit-Job ist eine Form der Beschäftigung, die so vollkommen sinnlos, unnötig oder schädlich ist, dass selbst der Beschäftigte ihre Existenz nicht rechtfertigen kann.
Manche Tätigkeiten sind so sinnlos, dass es nicht einmal auffällt, wenn die Person, die den Job ausführt, verschwindet. So etwas geschieht meist im öffentlichen Dienst:
Spanischer Beamter lässt die Arbeit sechs Jahre lang liegen, um Spinoza zu studieren
– Jewish Times, 26. Februar 2016
Ein spanischer Beamter, der mindestens sechs Jahre lang Gehalt bezog, ohne zu arbeiten, nutzte spanischen Medienberichten zufolge die Zeit, um zum Experten für die Schriften des jüdischen Philosophen Baruch Spinoza zu werden.
Ein Gericht im südspanischen Cádiz verurteilte den 69-jährigen Joaquín García in jüngster Vergangenheit zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 30 000 Dollar, weil er bei dem Wasserversorger Agua de Cádiz, wo man ihn 1996 als Ingenieur eingestellt hatte, nicht zur Arbeit erschienen war; dies berichtete die Nachrichtenseite euronews.com.
Sein Fehlen fiel erstmals 2010 auf, als García einen Orden für langjährige Dienste erhalten sollte. Der stellvertretende Bürgermeister Jorge Blas Fernández stellte Erkundigungen an und fand heraus, dass man García seit sechs Jahren nicht mehr in seinem Büro gesehen hatte.
Auf Nachfragen der Zeitung El Mundo erklärten nicht genannte, García nahestehende Quellen, er habe sich in den Jahren vor 2010 dem Studium der Schriften von Spinoza gewidmet, eines ketzerischen Juden aus Amsterdam, der im 17. Jahrhundert gelebt hatte. Eine von El Mundo befragte Quelle behauptete, García sei zu einem Spinoza-Experten geworden, stritt aber ab, dass der Beamte nie zur Arbeit erschienen sei; vielmehr habe er zu unregelmäßigen Zeiten gearbeitet.[2]
Der Vorgang machte in Spanien Schlagzeilen. Zu einer Zeit, in der das Land unter strengen Sparmaßnahmen und hoher Arbeitslosigkeit litt, schien es empörend, dass manche Beamte ihre Arbeit jahrelang liegen lassen konnten, ohne dass es irgendjemandem auffiel. Aber auch Garcías Verteidigung hatte durchaus etwas für sich. Er erklärte, er habe jahrelang pflichtschuldig die Wasseraufbereitungsanlagen der Stadt überwacht, aber irgendwann habe es bei den Wasserwerken neue Vorgesetzte gegeben; die hätten ihn wegen seiner sozialistischen politischen Einstellungen nicht leiden können und seien nicht bereit gewesen, ihm irgendwelche Aufgaben zu übertragen. Diese Situation habe ihn so stark demoralisiert, dass er gezwungen gewesen sei, wegen seiner Depressionen medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schließlich sei er mit Zustimmung seines Therapeuten zu der Entscheidung gelangt, er brauche nicht mehr den ganzen Tag nur herumzusitzen und so zu tun, als sei er beschäftigt, sondern er könne genauso gut auch die Wasserwerke davon überzeugen, dass er bei der Gemeindeverwaltung arbeitete, und die Gemeindeverwaltung davon überzeugen, dass er bei den Wasserwerken arbeitete; dann müsse er nur noch auftauchen, wenn es ein Problem gab, ansonsten aber könne er genauso gut nach Hause gehen und mit seinem Leben etwas Nützliches anfangen.[3]
Ähnliche Geschichten über den öffentlichen Dienst liest man in regelmäßigen Abständen. Besonders beliebt ist die von Briefträgern, die sich entschließen, die Post nicht abzuliefern, sondern in Schränken, Schuppen oder Müllcontainern zu entsorgen – mit der Folge, dass Briefe und Päckchen sich jahrelang anhäufen, ohne dass irgendjemand es herausfindet.[4] Noch einen Schritt weiter geht David Foster Wallace in seinem Roman Der bleiche König, der vom Leben in einem Finanzamt in Peoria (Illinois) handelt: Er gipfelt darin, dass ein Steuerprüfer an seinem Schreibtisch stirbt und tagelang auf seinem Stuhl sitzen bleibt, bevor es irgendjemandem auffällt. Das hört sich nach einer vollkommen absurden Karikatur an, aber 2002 spielte sich nahezu genau das Gleiche tatsächlich in Helsinki ab. Ein finnischer Steuerbeamter, der in einem abgeschlossenen Büro arbeitete, saß mehr als 48 Stunden tot an seinem Schreibtisch, während 30 Kollegen rund um ihn herum ganz normal weiterarbeiteten. »Die Leute haben gedacht, er wolle einfach in Ruhe arbeiten, und deshalb hat ihn niemand gestört«, bemerkte sein Vorgesetzter – was bei genauerem Nachdenken eigentlich recht rücksichtsvoll wirkt.[5]
Solche Geschichten dienen natürlich den Politikern auf der ganzen Welt als Anregung, um eine größere Beteiligung der Privatwirtschaft zu fordern – denn dort, so wird stets behauptet, komme solcher Missbrauch nicht vor. Und bisher haben wir zwar tatsächlich nicht davon gehört, dass Mitarbeiter von FedEx oder UPS ihre Pakete in Gartenhäusern stapeln. Aber die Privatisierung schafft ihre eigenen, oftmals viel weniger dezenten Formen der Verrücktheit – das zeigt die Geschichte von Kurt. Ich muss sicher nicht ausdrücklich darauf hinweisen, welche Ironie in der Tatsache liegt, dass Kurt letztlich für die deutsche Bundeswehr arbeitete. Der Bundeswehr wurde im Laufe der Jahre vieles vorgeworfen, aber Ineffizienz war kaum einmal darunter. Dennoch schwappt eine steigende Welle von Bullshit in alle Boote. Im 21. Jahrhundert sind sogar Panzerdivisionen von einem riesigen Halbschatten aus Sub-, Sub-Sub- und Sub-Sub-Subunternehmen umgeben. Panzerkommandanten müssen komplizierte, eigenartige bürokratische Rituale vollziehen, um Ausrüstungsgegenstände von einem Zimmer ins andere zu transportieren, und gleichzeitig veröffentlichen diejenigen, die für den Papierkrieg sorgen, heimlich auf Blogs ausgefeilte Klagen darüber, wie idiotisch das Ganze ist.
Wenn solche Fälle überhaupt etwas aussagen, besteht der Hauptunterschied zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft nicht darin, dass einer von beiden mehr oder weniger sinnlose Tätigkeiten schafft. Und er liegt auch nicht zwangsläufig in der Art sinnloser Tätigkeiten, die jeweils produziert werden. Vielmehr besteht der wichtigste Unterschied darin, dass sinnlose Arbeit in der Privatwirtschaft meist wesentlich genauer überwacht wird. Das ist allerdings nicht immer so. Wie wir noch genauer erfahren werden, verwendet in Banken, Pharmakonzernen und Ingenieurunternehmen eine erstaunlich hohe Zahl von Mitarbeitenden einen großen Teil ihrer Zeit darauf, ihre Facebook-Profile zu aktualisieren. Dennoch gibt es in der Privatwirtschaft gewisse Grenzen. Würde Kurt einfach seinen Arbeitsplatz verlassen, um sich eingehend mit seinem jüdischen Lieblingsphilosophen aus dem 17. Jahrhundert zu befassen, er würde schnell aus seiner Stellung entlassen. Wären die Wasserwerke von Cádiz privatisiert worden, hätten vielleicht ebenfalls Manager, die Joaquín García nicht mochten, ihn seiner Zuständigkeiten beraubt, aber man hätte dennoch erwartet, dass er jeden Tag an seinem Schreibtisch saß und so tat, als ob er arbeitete, oder man hätte ihm eine andere Beschäftigung gegeben.
Zu entscheiden, ob ein solcher Zustand eine Verbesserung darstellt, überlasse ich dem Leser.
Warum ein Auftragsmörder der Mafia kein gutes Beispiel für einen Bullshit-Job ist
Um es noch einmal zu wiederholen: Bei den »Bullshit-Jobs«, wie ich sie nenne, handelt es sich um Tätigkeiten, die in den Augen der Personen, die sie ausführen, zum größten Teil oder vollständig sinnlos, unnötig oder sogar gefährlich sind. Es sind Tätigkeiten, die verschwinden könnten, ohne dass es irgendwelche Folgen hätte. Vor allem aber sind es auch Tätigkeiten, die nach Ansicht derer, die sie ausführen, nicht existieren sollten.
Der zeitgenössische Kapitalismus scheint mit solchen Tätigkeiten durchsetzt zu sein. Wie ich im Vorwort erwähnt habe, stellte sich in einer YouGov-Umfrage heraus, dass in Großbritannien nur 50 Prozent derer, die in Vollzeit arbeiteten, völlig davon überzeugt waren, dass ihre Tätigkeit irgendeinen sinnvollen Beitrag zur Welt leistet; 37 Prozent waren sicher, dass dies nicht der Fall war. Eine Umfrage der Firma Schouten & Nelissen ermittelte in den Niederlanden für die zweite Zahl sogar einen Wert von 40 Prozent.[6] Wenn man genau darüber nachdenkt, sind das verblüffende statistische Werte. Immerhin handelt es sich bei einem sehr großen Prozentsatz aller beruflichen Tätigkeiten um Dinge, die wohl niemand für sinnlos halten würde. Man muss davon ausgehen, dass der Anteil der Krankenschwestern, Busfahrer, Zahnärzte, Straßenreiniger, Bauern, Musiklehrer, Handwerker, Gärtner, Feuerwehrleute, Bühnenbildner, Klempner, Journalisten, Sicherheitsbeauftragten, Musiker, Schneider und Schülerlotsen, die bei der Frage »Leistet Ihre Tätigkeit einen sinnvollen Beitrag zur Welt?« das »Nein«-Kästchen ankreuzten, nahezu bei null lag. Meine eigenen Recherchen legen die Vermutung nahe, dass auch Verkäufer, Restaurantangestellte und andere Dienstleister niedrigen Ranges ihre Tätigkeiten nur selten für Bullshit-Jobs halten. Viele Dienstleister hassen ihre Arbeit; aber selbst sie sind sich bewusst, dass das, was sie tun, irgendeinen sinnvollen Beitrag zur Welt leistet.[7]
Wenn also 37 bis 40 Prozent der Arbeitskräfte in einem Land behaupten, ihre Arbeit habe keinerlei Bedeutung, und ein weiterer beträchtlicher Teil das Gleiche vermutet, kann man nur zu dem Schluss gelangen, dass die meisten Büroangestellten ihre Arbeit für sinnlos halten.
In diesem ersten Kapitel möchte ich vor allem definieren, was ich mit Bullshit-Jobs meine; im nächsten werde ich eine Typeneinteilung der nach meiner Ansicht wichtigsten Formen von Bullshit-Jobs vornehmen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, in späteren Kapiteln der Frage nachzugehen, wie Bullshit-Jobs entstehen, warum sie so häufig geworden sind und welche psychologischen, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen sie haben. Nach meiner Überzeugung handelt es sich dabei um zutiefst heimtückische Effekte. Wir haben Gesellschaften geschaffen, in denen ein großer Teil der Bevölkerung in der Falle nutzloser Beschäftigungen steckt und gleichermaßen Widerwillen oder Verachtung gegenüber denjenigen empfindet, die in der Gesellschaft die nützlichste Arbeit tun oder überhaupt keiner bezahlten Arbeit nachgehen. Aber bevor wir diese Situation analysieren können, müssen wir auf einige potenzielle Einwände eingehen.
Vielleicht ist schon aufgefallen, dass meine ursprüngliche Definition eine gewisse Zweideutigkeit beinhaltet. Nach meiner Beschreibung bestehen Bullshit-Jobs aus Tätigkeiten, die derjenige, der sie ausführt, für »sinnlos, unnötig oder sogar gefährlich« hält. Aber natürlich sind Tätigkeiten, die auf die Welt überhaupt keine nennenswerten Auswirkungen haben, und solche, die gefährliche Auswirkungen auf die Welt haben, wohl kaum das Gleiche. Die meisten von uns wären sicher der Ansicht, dass ein Mafia-Auftragsmörder in der Welt insgesamt mehr Schaden als Nutzen verursacht; aber können wir die Tätigkeit des Mafia-Auftragsmörders wirklich als Bullshit-Job bezeichnen? Irgendwie scheint das nicht richtig zu sein.
Wenn so etwas geschieht, das hat uns schon Sokrates gelehrt – wenn also unsere eigenen Definitionen zu Ergebnissen führen, die uns intuitiv falsch erscheinen –, dann liegt das daran, dass uns nicht bewusst ist, was wir wirklich denken. (Deshalb bestand die wahre Funktion der Philosophen nach seiner Überzeugung darin, den Menschen etwas zu sagen, was sie bereits wissen, ohne dass ihnen aber klar ist, dass sie es wissen. Man könnte die Ansicht vertreten, dass Anthropologen wie ich etwas Ähnliches tun.) Der Ausdruck »Bullshit-Jobs« lässt bei vielen Menschen eindeutig eine Saite anklingen. Er erscheint ihnen irgendwie sinnvoll. Das heißt, sie haben zumindest auf einer unausgesprochenen, intuitiven Ebene bestimmte Kriterien im Kopf, mit deren Hilfe sie sagen können: »das war ein Bullshit-Job« oder »das war schlecht, aber ich würde eigentlich nicht sagen, dass es Bullshit war«. Viele Menschen mit gefährlichen Tätigkeiten haben den Eindruck, dass der Ausdruck zu ihnen passt; andere finden das eindeutig nicht. Am besten legt man die jeweiligen Kriterien offen, indem man Grenzfälle untersucht.
Warum also scheint es falsch zu sein, die Tätigkeit eines Auftragsmörders als Bullshit-Job zu bezeichnen?[8]
Nach meiner Vermutung gibt es dafür mehrere Gründe. Vor allem wird der Mafia-Auftragsmörder (im Gegensatz beispielsweise zu einem Devisenspekulanten oder einem Marken-Marktforscher) wahrscheinlich keine falschen Behauptungen aufstellen. Der Mafioso wird zwar in der Regel behaupten, er sei nur ein »Geschäftsmann«. Aber wenn er überhaupt bereit ist, sich zum Wesen seiner tatsächlichen Beschäftigung zu äußern, wird er im Hinblick auf das, was er tut, recht offen sein. Er wird wahrscheinlich nicht so tun, als sei seine Arbeit in irgendeiner Form nützlich für die Gesellschaft, selbst wenn er darauf besteht, sie trage zum Erfolg einer Mannschaft bei, die irgendein nützliches Produkt oder eine Dienstleistung liefert (Drogen, Prostitution und so weiter). Und wenn er es doch tut, ist der Vorwand in der Regel hauchdünn.
Damit sind wir in der Lage, unsere Definition zu verfeinern. Bullshit-Jobs sind nicht einfach nur nutzlose oder gefährliche Tätigkeiten; in der Regel beinhalten sie auch ein gewisses Maß an Vorwand und Täuschung. Wenn man sie ausführt, muss man sich verpflichtet fühlen, so zu tun, als gebe es in Wirklichkeit einen guten Grund, warum die Tätigkeit existiert, selbst wenn man solche Behauptungen insgeheim lächerlich findet. Es muss eine gewisse Kluft zwischen Vorwand und Realität bestehen. (Das ist auch etymologisch sinnvoll[9]: Das englische Wort »bullshitting« bezeichnet eine Form der Unehrlichkeit.[10]) Also unternehmen wir einen zweiten Versuch:
Vorläufige Definition 2: Ein Bullshit-Job ist eine Beschäftigung, die so vollkommen sinnlos, unnötig oder gefährlich ist, dass selbst die Beschäftigten ihre Existenz nicht rechtfertigen können, wobei sie sich aber gleichzeitig verpflichtet fühlen, so zu tun, als sei dies nicht der Fall.
Natürlich gibt es noch einen anderen Grund, warum man die Tätigkeit des Auftragsmörders nicht als Bullshit-Job bezeichnen sollte. Der Auftragsmörder ist persönlich nicht davon überzeugt, dass es seine Tätigkeit eigentlich nicht geben sollte. Die meisten Mafiosi stehen nach ihrer eigenen Einschätzung in einer alten, ehrbaren Tradition, die schon für sich einen Wert hat, ganz gleich, ob sie insgesamt zum gesellschaftlichen Guten beiträgt. Das ist übrigens auch der Grund, warum »Feudalherr« kein Bullshit-Job ist. Könige, Grafen, Kaiser, Paschas, Emire, Gutsherren, Steuerpächter, Großgrundbesitzer und ihresgleichen können sich durchaus als nützliche Menschen bezeichnen; viele von uns würden zwar behaupten (und ich wäre geneigt, der Behauptung zuzustimmen), dass sie für die Angelegenheiten der Menschen eine gefährliche Rolle spielen. Aber sie selbst glauben das nicht. Solange der König also nicht insgeheim Marxist oder Republikaner ist, kann man mit Fug und Recht sagen, dass »König« kein Bullshit-Job ist.
Diese Überlegung im Kopf zu behalten, ist nützlich, denn die meisten Menschen, die in der Welt viel Schaden anrichten, sind vor dem Wissen, dass sie dies tun, geschützt. Oder sie gestatten es sich selbst, den endlosen Ansammlungen bezahlter Lakaien und Jasager zu glauben, die sie zwangsläufig umgeben und alle möglichen Gründe dafür nennen, warum sie in Wirklichkeit Gutes tun. (Heutzutage werden solche Gruppen manchmal als »Thinktanks« bezeichnet.) Das Prinzip gilt für finanzspekulierende Investmentbank-CEOs ebenso wie für die militärisch starken Männer in Ländern wie Nordkorea oder Aserbaidschan. Mafia-Familien sind in dieser Hinsicht vielleicht ungewöhnlich, weil sie sich kaum solcher Vorwände bedienen – aber letztlich sind sie nur kleine, illegale Formen der gleichen feudalen Tradition: Ursprünglich waren sie in Sizilien die Helfer der örtlichen Großgrundbesitzer, und erst im Laufe der Zeit arbeiteten sie immer stärker auf eigene Rechnung.[11]
Und es gibt noch einen letzten Grund, warum man die Tätigkeit des Auftragsmörders nicht als Bullshit-Job bezeichnen kann: Es ist nicht ganz klar, ob es sich dabei überhaupt um einen »Job« handelt. Der Auftragsmörder mag zwar in dieser oder jener Eigenschaft bei dem örtlichen Verbrecherboss angestellt sein. Vielleicht schafft der Verbrecherboss für ihn in seinem Casino irgendeine vorgeschobene Aufgabe beim Sicherheitsdienst. Dann können wir eindeutig sagen, dass es sich bei dieser Tätigkeit tatsächlich um einen Bullshit-Job handelt. Aber sein Gehalt bezieht er dann nicht in seiner Eigenschaft als Auftragsmörder.
Damit sind wir in der Lage, unsere Definition noch weiter zu verfeinern. Wenn Menschen von Bullshit-Jobs sprechen, meinen sie damit in der Regel eine Beschäftigung, bei der sie entweder in einer Festanstellung oder auf Honorarbasis dafür bezahlt werden, für jemand anderes zu arbeiten (hierzu würde man meist auch bezahlte Beratertätigkeiten zählen). Natürlich gibt es viele Selbstständige, denen es gelingt, Geld von anderen zu beziehen, indem sie fälschlich so tun, als würden sie diese mit einem Nutzen oder einer Dienstleistung versorgen (solche Menschen bezeichnen wir normalerweise als Trickbetrüger, unseriöse Anbieter, Scharlatane oder Fälscher), und ebenso bringen manche Selbstständige andere um ihr Geld, indem sie ihnen Schaden zufügen oder damit drohen (dann sprechen wir meist von Straßenräubern, Einbrechern, Erpressern oder Dieben). Zumindest im ersten Fall können wir eindeutig von Bullshit sprechen, aber nicht unbedingt von Bullshit-Jobs, denn »Jobs« im eigentlichen Sinne sind es nicht. Betrug ist eine Tat, aber kein Beruf. Das Gleiche gilt für den Überfall auf einen Geldtransporter. Manchmal ist von Berufseinbrechern die Rede, aber damit ist eigentlich nur gesagt, dass Diebstahl die wichtigste Einkommensquelle des Einbrechers ist.[12] Niemand bezahlt dem Einbrecher einen regelmäßigen Lohn oder ein Honorar dafür, dass er in die Wohnungen anderer Menschen einsteigt. Aus diesem Grund kann man nicht behaupten, »Einbrecher« sei im eigentlichen Sinne ein Job.[13]
Aufgrund solcher Überlegungen können wir eine nach meiner Überzeugung funktionierende endgültige Arbeitsdefinition formulieren:
Endgültige Arbeitsdefinition: Ein Bullshit-Job ist eine Form der bezahlten Anstellung, die so vollkommen sinnlos, unnötig oder gefährlich ist, dass selbst derjenige, der sie ausführt, ihre Existenz nicht rechtfertigen kann, obwohl er sich im Rahmen der Beschäftigungsbedingungen verpflichtet fühlt, so zu tun, als sei dies nicht der Fall.
Von der Bedeutung des subjektiven Elements und warum man davon ausgehen kann, dass diejenigen, die ihre Tätigkeit selbst für einen Bullshit-Job halten, im Allgemeinen recht haben
Das ist in meinen Augen eine nützliche Definition; in jedem Fall ist sie für die Zwecke des vorliegenden Buches gut genug.
Dem aufmerksamen Leser ist vielleicht eine noch verbliebene Zweideutigkeit aufgefallen. Die Definition ist vorwiegend subjektiv: Ich definiere einen Bullshit-Job als Tätigkeit, die der Beschäftigte selbst für sinnlos, unnötig oder gefährlich hält, gleichzeitig behaupte ich aber auch, dass der Beschäftigte recht hat.[14] Ich gehe also davon aus, dass dahinter eine Realität steckt. Diese Annahme muss man machen, denn sonst müssten wir uns damit zufriedengeben, dass genau die gleiche Tätigkeit am einen Tag Bullshit ist und am anderen nicht, je nachdem, in welcher unberechenbaren Stimmung sich ein launischer Angestellter gerade befindet. Damit will ich nur sagen, dass es neben dem reinen Marktwert so etwas wie einen gesellschaftlichen Wert gibt, aber da bisher niemand einen angemessenen Weg gefunden hat, um diesen Wert zu messen, ist das Urteil des Beschäftigten selbst einer zutreffenden Einschätzung der Situation so nahe, wie man ihr überhaupt kommen kann.[15]
Warum das so ist, liegt häufig auf der Hand: Wenn eine Büroangestellte tatsächlich 80 Prozent ihrer Zeit darauf verwendet, Katzenbilder zu zeichnen, wissen ihre Kolleginnen im angrenzenden Büro, was da abläuft, oder sie wissen es auch nicht, aber sie selbst kann sich über das, was sie tut, keine Illusionen machen. Und selbst in komplizierteren Fällen, in denen es fraglich ist, wie viel der Angestellte tatsächlich für seine Firma leistet, kann man nach meiner Überzeugung davon ausgehen, dass der Angestellte es selbst am besten weiß. Mir ist bewusst, dass diese Haltung in manchen Kreisen infrage gestellt werden wird. Manager und andere hohe Tiere behaupten häufig steif und fest, die meisten Mitarbeitenden in einem Großunternehmen würden ihren eigenen Beitrag nicht in vollem Umfang verstehen, weil man das große Bild nur von der Spitze aus erkennen könne. Ich behaupte nicht, dies sei völlig falsch. Häufig gibt es im größeren Zusammenhang einige Teile, mit denen Mitarbeitende auf den unteren Ebenen nicht vertraut sind oder von denen man ihnen einfach nichts sagt. Das gilt insbesondere, wenn das Unternehmen illegale Geschäfte betreibt.[16] Aber nach meiner Erfahrung wird man normalerweise jeden Untergebenen, der eine gewisse Zeit lang – vielleicht ein oder zwei Jahre – in dem selben Unternehmen arbeitet, beiseitenehmen und in die Firmengeheimnisse einweihen.
Ausnahmen gibt es allerdings, das stimmt. Manchmal teilen Manager bestimmte Aufgaben absichtlich so auf, dass die Beschäftigten eigentlich nicht verstehen, wie ihre Tätigkeit zum Gesamtunternehmen beiträgt. Banken tun so etwas sehr häufig. Ich habe sogar von Fabriken in Amerika gehört, in denen viele Fließbandarbeiter nicht wussten, was in dem Werk eigentlich hergestellt wird; in solchen Fällen stellte sich allerdings fast immer heraus, dass die Eigentümer absichtlich Menschen eingestellt hatten, die kein Englisch sprachen. Aber selbst dann nehmen die Arbeiter in der Regel an, dass ihre Tätigkeit nützlich ist, sie wissen nur nicht, warum. Im Allgemeinen kann man nach meiner Überzeugung davon ausgehen, dass die Mitarbeitenden wissen, was in einem Büro oder in einer Werkstattetage abläuft, und dass sie genau begreifen, wie ihre Arbeit zum Unternehmen beiträgt oder auch nicht – jedenfalls begreifen sie es besser als jeder andere.[17] In den höheren Rängen ist das nicht immer so klar. Häufig traf ich während meiner Recherchen auf Untergebene, die sich letztlich fragten: »Weiß mein Vorgesetzter eigentlich, dass ich 80 Prozent meiner Zeit mit dem Zeichnen von Katzen verbringe? Tun sie nur so, als würden sie es nicht bemerken, oder bemerken sie es tatsächlich nicht?« Und je mehr Gründe die Mitarbeitenden haben, vor denen auf den höheren Ebenen der Befehlskette etwas zu verbergen, desto schlimmer wird die Situation.
Das eigentlich heikle Problem stellt sich erst, wenn es darum geht, ob bestimmte Formen der Arbeit (beispielsweise Telefonwerbung, Marktforschung oder Beratung) Bullshit sind – das heißt, ob man von ihnen behaupten kann, dass sie irgendeinen positiven gesellschaftlichen Wert produzieren. Hier sage ich nur: Am besten überlässt man das Urteil denjenigen, die solche Tätigkeiten ausüben. Schließlich ist gesellschaftlicher Wert vor allem das, was die Menschen dafür halten. Und wer wäre dann besser in der Lage, ein Urteil zu fällen? In diesem Fall würde ich sagen: Wenn die Mehrzahl derer, die einen bestimmten Beruf ausüben, insgeheim der Ansicht sind, dass ihre Arbeit keinen gesellschaftlichen Wert hat, sollte man im weiteren Verlauf davon ausgehen, dass sie recht haben.[18]
Pedanten werden zweifellos auch an dieser Stelle Einwände erheben. Sie fragen vielleicht: Wie kann jemand eine sichere Aussage darüber machen, was die Mehrzahl derer, die in einer Branche arbeiten, insgeheim denkt? Darauf lautet die Antwort: Das kann niemand. Selbst wenn es möglich wäre, eine Umfrage unter Lobbyisten oder Finanzberatern durchzuführen, ist nicht klar, wie viele von ihnen ehrliche Antworten geben würden. Als ich in dem ursprünglichen Artikel in groben Zügen auf unnütze Branchen zu sprechen kam, ging ich von der Annahme aus, dass Lobbyisten und Finanzberater sich ihrer Nutzlosigkeit im Wesentlichen bewusst sind – und dass sogar viele oder die meisten von ihnen unter dem Wissen leiden, dass der Welt nichts Wertvolles verloren gehen würde, wenn es ihre Tätigkeiten nicht mehr gäbe.
Damit könnte ich unrecht haben. Möglicherweise sind Unternehmenslobbyisten oder Finanzberater tatsächlich Anhänger einer Theorie der gesellschaftlichen Werte, nach der ihre Arbeit für die Gesundheit und das Wohlergehen der Nation unentbehrlich sind. Möglicherweise schlafen sie deshalb nachts gut – sie sind fest überzeugt, dass ihre Tätigkeit für alle in ihrer Umgebung ein Segen ist. Ich weiß es nicht, aber ich habe die Vermutung, dass dies umso stärker gilt, je weiter man in der Nahrungskette nach oben steigt, denn eines scheint eine allgemeine Wahrheit zu sein: Je mehr Schaden eine Gruppe mächtiger Menschen in der Welt anrichtet, desto mehr Jasager und Propagandisten sammeln sich in ihrem Umfeld und bringen immer neue Gründe vor, warum sie in Wirklichkeit etwas Gutes tun – und entsprechend wahrscheinlicher ist es, dass zumindest einige der Mächtigen ihnen Glauben schenken.[19] Unternehmenslobbyisten und Finanzberater sind anscheinend tatsächlich für einen unverhältnismäßig großen Anteil des in der Welt angerichteten Schadens verantwortlich (zumindest des Schadens, der im Rahmen beruflicher Tätigkeiten angerichtet wird). Vielleicht müssen sie sich wirklich zwingen, an ihre eigene Tätigkeit zu glauben.
Wenn es so ist, sind Finanzwesen und Lobbyarbeit eigentlich keine Bullshit-Jobs, sondern sie ähneln eher der Tätigkeit des Auftragsmörders. Am allerobersten Ende der Nahrungskette scheint es tatsächlich so zu sein. In dem ursprünglichen, 2013 erschienenen Artikel wies ich beispielsweise darauf hin, dass ich nie einen Anwalt für Unternehmensrecht getroffen habe, der seine Arbeit nicht für Bullshit hielt. Aber natürlich spiegelt sich darin nur wider, welchen Typ von Unternehmensanwälten ich in der Regel kennenlerne: Es sind diejenigen, die auch Dichter und Musiker waren. Was aber von noch größerer Bedeutung ist: Sie bekleiden keinen besonders hohen Rang. Nach meinem Eindruck halten wirklich mächtige Unternehmensanwälte ihre Funktion für vollkommen legitim. Oder vielleicht kümmern sie sich auch einfach nicht darum, ob sie Gutes tun oder Schaden anrichten.
Am obersten Ende der Nahrungskette im Finanzwesen ist es sicher so. Im April 2013 war ich durch einen seltsamen Zufall zugegen, als in der Federal Reserve in Philadelphia eine Tagung zum Thema »Festigung des Bankensystems zum guten Zweck« abgehalten wurde. Dort trat der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs, der vor allem durch die Planung der »Schocktherapie«-Reformen in der früheren Sowjetunion berühmt wurde, in einer Video-Liveschaltung auf und verblüffte alle Anwesenden, indem er eine »ungewöhnlich freimütige«, wie vorsichtige Journalisten es vielleicht nennen würden, Beurteilung der Verantwortlichen in den amerikanischen Finanzinstitutionen präsentierte. Wertvoll ist Sachs’ Urteil insbesondere deshalb, weil viele dieser Personen ihm gegenüber, wie er immer wieder betonte, in der (nicht ganz unbegründeten) Annahme, er stehe auf ihrer Seite, sehr offenherzig waren: