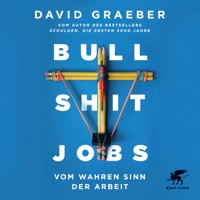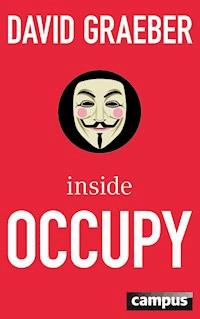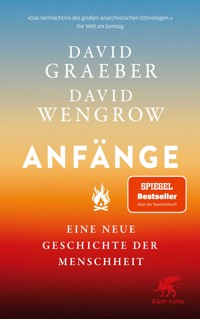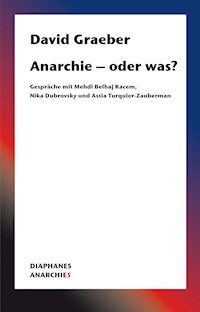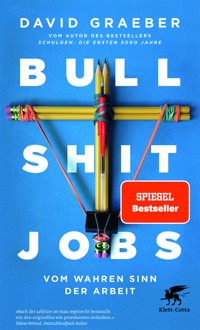Fragmente einer anarchistischen Anthropologie & Einen Westen hat es nie gegeben E-Book
David Graeber
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In seinen »Fragmenten« lädt David Graeber dazu ein, sich eine intellektuelle Praxis vorzustellen, die bisher nur als Möglichkeit existierte: eine anarchistische Anthropologie. Wenn wir die Geschichte der Menschheit in ihrer Gänze erkundeten, würden wir feststellen, dass es unzählige Möglichkeiten gab und gibt, alles anders zu machen. Die Anthropologie birgt einen noch ungehobenen Schatz an Wissen, mit dem sich zeigen ließe, dass Selbstbestimmung und soziale Kreativität weitaus üblicher sind und waren, als wir mithin meinen. Graeber verstand es, gelebte radikale alltägliche politische Praxis greifbar zu machen und in der Form seiner Theorie als Geschenk zurückzugeben. Was wäre weiterhin, wenn diese Forschung ergäbe, dass Konzepte wie ›der Westen‹ oder ›unsere Tradition‹ der Demokratie, derer wir uns zur Selbstvergewisserung bedienen, nicht so einmalig sind, wie die gelehrte Vorstellung behauptet? In »Einen Westen hat es nie gegeben« schaut Graeber auf die Demokratie und die Demokratie schaut zurück, um ›unsere‹ gedanklichen Horizonte zu dezentrieren und dekolonialisieren. Was nach mehr als zehn Jahren mit Erscheinen seines Bestsellers »Anfänge« (2022) für Furore sorgte, können wir hier in den ersten, vor ansteckender Kreativität strotzenden Vorschlägen nachlesen – und werden en passant durch diese kleine Einführung für den Anarchismus begeistert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Ähnliche
David Graeber
Fragmente einer anarchistischen Anthropologie & Einen Westen hat es nie gegeben
aus dem Amerikanischen übersetzt von Werner Petermann
mit einem Vorwortvon Ayça Çubukçu
aus dem Englischen übersetztvon Felix Schüring
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
David Graeber:
Fragmente einer anarchistischen Anthropologie
&Einen Westen hat es nie gegeben
mit einem Vorwort von Ayça Çubukçu
1. Auflage, Oktober 2022
eBook UNRAST Verlag, Februar 2023
ISBN 978-3-95405-140-3
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Originalausgabe:
© David Graeber 2005
Für Fragments of an Anarchist Anthropology:
© Prickly Paradigm Press LLC 2004. All rights reserved.
Für There Never Was a West:
© AK Press, Oakland 2007
© Peter Hammer Verlag GmbH, Wuppertal 2008
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: cuore, Berlin; Typographie von Clive Russel
Satz: Unrast Verlag, Münster
Inhalt
Vorwort zu Fragmente einer anarchistischen Anthropologie (Ayça Çubukçu)
Fragmente einer anarchistischen Anthropologie
Graves, Brown, Mauss, Sorel
Die anarchistische Anthropologie, die beinahe schon existiert
Mauern in die Luft sprengen
Grundsätze einer nichtexistierenden Wissenschaft
ANTHROPOLOGIE (worin der Autor etwas unwillig die Hand beißt, die ihn füttert)
Einen Westen hat es nie gegeben oder Die Demokratie erwächst aus den Zwischenräumen
Teil I: Über die Ungereimtheit des Begriffs der »westlichen Tradition«
Teil II: Die Demokratie wurde nicht erfunden
Teil III: Über die Entstehung des »demokratischen Ideals«
Teil IV: Rekuperation
Teil V: Die Krise des Staats
Anmerkungen
* Im deutschsprachigen Raum existieren unterschiedliche Fachbezeichnungen. Historisch als Völkerkunde bezeichnet, tragen die meisten Studiengänge und Institute an deutschsprachigen Universitäten das Wort Ethnologie oder ethnologisch im Titel (die Bezeichnung Völkerkunde ist nahezu vollständig verschwunden und findet sich nur noch in seltenen Fällen im Namen von Museen, wobei die meisten ebenfalls umbenannt wurden). In den USA ist das Fach als cultural anthropology und in Großbritannien als social anthropology bekannt. In den letzten Jahren gab es teilweise eine Übernahme dieser Bezeichnungen ins Deutsche und die Bezeichnungen Kulturanthropologie und/oder Sozialanthropologie existieren mittlerweile relativ gleichberechtigt neben der Bezeichnung Ethnologie (der zentrale deutsche Fachverband wurde beispielsweise 2017 in Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie umbenannt). Der Übersetzer der hier vorliegenden Texte von David Graeber hat sich für die kurze und direkte Form Anthropologie entschieden (im Englischen ist die Kurzbezeichnung anthropology nicht unüblich). Es sei hier jedoch angemerkt, dass historisch unter dieser Bezeichnung ohne Zusatz im deutschsprachigen Raum vornehmlich die biologische Anthropologie verstanden wurde, die ein eigenes naturwissenschaftliches Fach darstellt und auf die sich Graeber hier nicht bezieht. (A.d.Ü.)
Vorwort zu Fragmente einer anarchistischen Anthropologie
Ayça Çubukçu
Zum Zeitpunkt eines weltweit wahrhaft explosionsartig angestiegenen Interesses am Anarchismus erschien 2004 David Graebers Fragmente einer anarchistischen Anthropologie* (im Folgenden als Fragmente bezeichnet), ein kurzer aber einflussreicher Text, der sich einer festen Genrezuschreibung zu entziehen scheint. Graeber bezeichnet ihn als Pamphlet, »eine Reihe von Gedanken, Skizzen zu möglichen Theorien und Kleinstmanifesten« (S. 17). Dieses Pamphlet in seiner Gänze zusammenzufassen und zu besprechen ist auf diesen wenigen Seiten unmöglich, nicht nur aufgrund seiner fragmentarischen Beschaffenheit, sondern insbesondere, weil es – retrospektiv betrachtet – die Samen vieler der zentralen Argumente enthält, die Graeber im weiteren Verlauf seines Lebens entwickeln sollte. Ich werde mich daher darauf beschränken, einige der grundlegenden Elemente für die Art von Sozialtheorie nachzuzeichnen, die Graeber uns in diesem mitreißenden Text vorschlägt. Allgemein formuliert versucht er in Fragmente, die Umrisse einer radikalen Sozialtheorie zu zeichen, die, in Graebers Worten, »im Sinne derjenigen ist, die eine Welt zu gestalten versuchen, in der die Menschen die Freiheit haben, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen« (S. 26). Das ist charakteristisch für Graeber: der Wunsch, die Sozialtheorie – insbesondere die anthropologische – für radikale Bewegungen auf nützliche Weise interessant zu machen und radikale Bewegungen – insbesondere anarchistische – nützlich und interessant für die Sozialtheorie zu machen.
In Fragmente geht er der von ihm so bezeichneten »seltsamen Affinität« zwischen Anarchismus und Anthropologie nach (S. 28). Er stellt fest, »dass im anthropologischen Denken etwas war – ein scharfes Bewusstsein von der enormen Spannbreite menschlicher Möglichkeiten –, das es gleich von Anfang an in die Nähe des Anarchismus rückte« (S. 29). Graeber selbst war von dieser Spannbreite menschlicher Möglichkeiten in Vergangenheit und Gegenwart fasziniert, die der scheinbaren Unvermeidbarkeit unserer aktuellen gesellschaftlichen und politischen Institutionen etwas entgegensetzen und gleichzeitig die Hoffnung auf eine kollektivere Lebensweise nähren könnte, mit größeren Freiheiten in egalitäreren Verhältnissen.
Graeber kann dieser seltsamen Affinität zwischen Anthropologie und Anarchismus in Fragmente deshalb nachgehen, weil der Anarchismus für ihn kein Theoriegebäude ist, das im 19. Jahrhundert von ›Gründungsvätern‹ wie Bakunin, Kropotkin und Proudhon hinterlassen wurde und das man daher vollumfänglich übernehmen müsste. Stattdessen ist er für ihn mehr eine bestimmte Einstellung oder gar ein Glaube, der unter Anarchist*innen geteilt wird (S. 20). Der Anarchismus, so Graeber, kann als Glaube gedacht werden, der »die Zurückweisung bestimmter Formen gesellschaftlicher Beziehungen, die Zuversicht, dass gewisse andere Formen sich sehr viel besser eigneten, um eine lebenswerte Gesellschaft darauf zu gründen, den Glauben, dass eine solche Gesellschaft tatsächlich bestehen könnte«, beinhaltet (ebd.). Aber auch die ›Gründungsväter‹ des Anarchismus dachten nicht, dass sie irgendetwas Neues erfinden würden. Sie vertrauten einfach auf die Annahme, dass, in Graebers Worten, die »grundlegenden Prinzipien des Anarchismus – Selbstorganisation, freiwilliger Zusammenschluss, gegenseitige Hilfe – auf Formen menschlichen Verhaltens [verwiesen], von denen sie annahmen, dass sie existierten, seit es Menschen gibt. Gleiches gilt für die Ablehnung des Staates und aller Formen struktureller Gewalt, Ungleichheit oder Herrschaft« (S. 19). Es scheint diese Annahme über die Geschichte der Menschheit zu sein, die Anfänge (2022) siebzehn Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung von Fragmente als wahr zu beweisen versucht.
In Graebers Vision jedenfalls könnte die Anthropologie als Disziplin den Glauben an die Möglichkeit einer anderen Welt stärken, indem sie uns ein Archiv alternativer Formen der Organisierung sozialer Beziehungen, ihrer bewussten Umgestaltung oder aber der völligen Abkehr von einigen von ihnen bietet. Doch um dazu in der Lage zu sein, den Glauben an eine andere Welt frei von »Staat, Kapitalismus, Rassismus und [der] Vormachtstellung der Männer« (S. 26) zu stärken, müsste eine Sozialtheorie zunächst selbst annehmen, dass sie möglich ist. Graeber bezeichnet dies als die erste Annahme, die eine jede radikale Sozialtheorie voraussetzt. »Sich für ein solches Prinzip einzusetzen, kommt fast einem Glaubensakt gleich«, folgert er, »denn lässt sich von solchen Dingen sichere Kenntnis erlangen? Unter Umständen könnte sich herausstellen, dass eine solche Welt nicht möglich ist« (ebd.). Ähnlich einer raffinierten theologischen Argumentation mit dem Ziel eines Gottesbeweises erklärt er weiter: »[Es] ließe sich argumentieren, dass es gerade die Unverfügbarkeit absoluten Wissens ist, die eine Parteinahme für den Optimismus zu einer moralischen Verpflichtung macht« (ebd.). Ich frage mich dennoch, ob Anthropolog*innen und andere zu solch einem an einen Glauben geknüpften Optimismus allein mittels rationaler Beweisführung gebracht werden können. Möglicherweise kann man zum Glauben an die Möglichkeit einer anderen Welt inspiriert werden und das ist es sicherlich, was David Graeber und die radikalen Bewegungen getan haben, die er so sehr schätzte.
Graebers zweite Annahme ist, dass jede radikale – und insbesondere anarchistische – Sozialtheorie sich bewusst jeder Form von Avantgardismus widersetzen müsste (S. 27). Seiner Meinung nach bietet die Ethnografie als anthropologische Methode ein besonders relevantes, wenn auch noch grobes und im Entstehen begriffenes Modell dafür an, wie eine »nicht-avantgardistische, revolutionäre intellektuelle Praxis funktionieren könnte« (S. 28). Das Ziel einer solchen Methode wäre es nicht, »die richtigen strategischen Analysen aus- und dann die folgsamen Massen [anzuführen]« (S. 27), sondern die impliziten Logiken – symbolische, moralische oder pragmatische – offen zu legen, die den Handlungen der Menschen bereits zugrunde liegen, selbst wenn sie sich ihrer selbst nicht völlig bewusst sind (S. 28). »Eine offenkundige Rolle für radikale Intellektuelle besteht genau darin«, schreibt Graeber in Fragmente, »auf jene zu achten, die gangbare Alternativen schaffen, die möglichen größeren Implikationen ihrer (bisherigen, schon gelebten) Tätigkeit herauszufinden und diese Ideen später zurückzugeben, nicht als Vorschriften, sondern als Beiträge, Möglichkeiten – Geschenke« (ebd.). Keine Vorschriften, sondern Beiträge, Möglichkeiten, Geschenke. Das ist es, was Graeber in seinen Texten angeboten hat – insbesondere in Fragmente einer anarchistischen Anthropologie (2004/2022), Direkte Aktion (2009/2013) und Inside Occupy (Dt. 2012)/The Democracy Project (Engl. 2013) – unabhängig davon, ob seine Geschenke von all denen, über die er geschrieben, gedacht und mit denen er zusammengearbeitet hat oder von denen er gelesen wurde, angenommen wurden oder nicht. Letzten Endes können Geschenke auch abgelehnt werden und Graeber erkannte selbst, dass nicht viel von dem, was er vorschlug und praktizierte, »viel Ähnlichkeit mit dem [hat], wie sich die Anthropologie, auch keine radikale Anthropologie, in den letzten circa hundert Jahren wirklich dargestellt hat« (ebd.).
Trotzdem wendet er sich den Anthropolog*innen zu, insbesondere Marcel Mauss, dessen Einfluss auf die Anarchist*innen er auslotet – und das trotz der Tatsache, dass Mauss über sie kein gutes Wort zu verlieren hatte. »Auf Anarchist*innen dürfte Marcel Mauss letzten Endes«, schreibt Graeber als würde er dabei auch sich selbst meinen, »gleichwohl mehr Einfluss gehabt haben als alle anderen Anthropolog*innen zusammengenommen. Und zwar deshalb, weil er sich für alternative Ethiken interessierte, die den Weg zu einem Denken freimachten, demzufolge Gesellschaften ohne Staatlichkeit und Märkte so waren, wie sie waren, weil sie ganz bewusst so zu leben wünschten. Was nach unseren Vorstellungen bedeutet: weil sie Anarchist*innen waren. Insofern eine anarchistische Anthropologie bereits in Fragmenten existiert, stammen diese weitgehend von ihm.« (S. 37) Meines Erachtens war auch Graebers eigenes Interesse an der Entwicklung einer anarchistischen Anthropologie von der Wertschätzung und Faszination für »alternative Ethiken« getrieben, die der bewussten Entscheidung von Menschen zugrunde liegen, anders zu leben – im anarchistischen Fall frei von Kapitalismus und Patriarchat, frei von Staat, struktureller Gewalt, Ungleichheit und Herrschaft.
»Das also meine ich mit alternativer Ethik«, schreibt Graeber in einem zentralen Abschnitt der Fragmente, in dem er über revolutionäre Gegenmacht nachdenkt und dabei bereits ein späteres Kernargument in Anfänge erahnen lässt: »Anarchistische Gesellschaften sind sich nicht weniger der menschlichen Befähigung zu Gier oder Eitelkeit bewusst als moderne Amerikaner*innen ihrer Befähigung zu Neid, Gefräßigkeit oder Trägheit; sie würden sie als Grundlage ihrer Zivilisation gleichermaßen unattraktiv finden. In der Tat sehen sie in diesen Phänomenen eine so furchtbare moralische Gefahr, dass sie ihr gesellschaftliches Leben weitgehend danach ausrichten, sie fernzuhalten« (S. 40). Das ist eine bemerkenswerte These. Erstens werden damit Ethik und Moral als die konstitutive und bewusst wahrgenommene Grundlage sozialer Organisation betrachtet. Zweitens wird dadurch deutlich gemacht, dass dies in der gesamten Menschheitsgeschichte der Fall ist, ob ›modern‹ oder ›vormodern‹.
Tatsächlich argumentiert Graeber, dass »jede wirklich politisch engagierte Anthropologie damit anfangen muss, sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, was, wenn überhaupt etwas, die von uns gern ›modern‹ genannte Welt vom Rest der menschlichen Geschichte … unterscheidet« (36). In Fragmente ebenso wie in Anfänge weist er vertraute Periodisierungen der Geschichte und evolutionäre Entwicklungsstufen leidenschaftlich zurück, sodass die Gesamtheit der Menschheitsgeschichte – mitsamt aller über Raum und Zeit verteilten Gesellschaften, Völker und Zivilisationen – von Beispielen menschlicher Möglichkeiten bevölkert wird, umgesetzt von dezidiert schöpferischen, intelligenten, spielerischen, experimentierfreudigen, aufmerksamen, kreativen und sich politisch ihrer selbst bewussten Wesen.
Für Graeber besteht die Geschichte der Menschheit nicht aus einer Abfolge von Revolutionen (S. 49) – sei es nun die Neolithische Revolution, die Französische Revolution oder die Industrielle Revolution – mit der eindeutige gesellschaftliche, moralische oder politische Brüche in der Struktur der sozialen Realität einhergegangen wären – beziehungsweise in den ›Bedingungen des Menschseins‹ [human condition], wie er es zu bezeichnen vorzieht. Wenn dies der Fall ist und wenn der Anarchismus vorrangig eine Ethik der Praxis (S. 113) ist, wie er behauptet, dann wird eine solche Ethik sowohl zum möglichen Gegenstand anthropologischer Untersuchung als auch – durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch – zur Quelle politischer Inspiration.
Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass Graeber den primitivistischen Anarchist*innen vehement widerspricht, die von dem einflussreichen Essay The Original Affluent Society (1968) seines Mentors Marshall Sahlins inspiriert wurden und die behaupten, »dass es einst eine Zeit gab, als Entfremdung und Ungleichheit nicht existierten, als alle jagende und sammelnde Anarchist*innen waren, und dass es daher nur dann zu einer wirklichen Befreiung kommen kann, wenn wir die ›Zivilisation‹ aufgeben« (S. 68f.). In Fragmente, wie auch in Anfänge, zeigt er stattdessen eine weitaus komplexere Geschichte von endloser Variation auf, in der es beispielsweise »Jäger-Sammler-Gesellschaften [gibt] mit Adeligen und Versklavten, es gibt Ackerbaugesellschaften, die ausgesprochen egalitär sind« (S. 69). Graeber betont mit Nachdruck, zunächst in Fragmente und dann erneut in Anfänge, dass »Menschen niemals wirklich im Garten Eden lebten« (ebd.). Die Bedeutung dieser Erkenntnis ist vielschichtig. Unter anderem bedeutet es, dass die Geschichte für uns »auf viel interessantere Weise … nutzbar« gemacht werden kann und dass »radikale Theoretiker*innen nicht mehr endlos über den immergleichen, unzulänglichen Jahren revolutionärer Geschichte brüten müssen« (ebd.).
In Fragmente weist Graeber die gewohnte Definition von Revolution zurück, die »stets etwas in der Art eines Paradigmenwechsels zur Voraussetzung hat: einen klaren Bruch, einen entscheidenden Riss in der Beschaffenheit der gesellschaftlichen Realität, wonach alles anders läuft und frühere Kategorien nicht mehr anwendbar sind« (S. 57). Stattdessen drängt er uns dazu, aufzuhören, »die Revolution als eine Sache zu begreifen – ›die‹ Revolution, die große kataklysmische Wende –, und stattdessen die Frage [zu] stellen: ›Was ist revolutionäres Handeln?‹« (S. 60). Er betont: »Revolutionäres Handeln ist jede kollektive Aktion, die eine bestimmte Form der Macht oder Herrschaft ablehnt, sich ihr deshalb entgegenstellt und so gesehen durch dieses Tun gesellschaftliche Beziehungen – selbst innerhalb des Kollektivs – neu einrichtet« (ebd.) und dass damit nicht unbedingt der Sturz einer Regierung oder – wo wir gerade dabei sind – des Leiters eines anthropologischen Instituts beabsichtigt werden muss.
Die letzte Möglichkeit erwähne ich mit Blick auf Graebers humorvolle Art, um uns wieder in das Hier und Jetzt zurückzuholen und damit zum abschließenden Teil der Fragmente mit dem Titel »Anthropologie«, »worin der Autor etwas unwillig die Hand beißt, die ihn füttert« (S. 113). Graeber beobachtet, wie Anthropolog*innen, anstatt irgendeine Art von radikaler Politik zu entwickeln, »riskierten, bloß zu einem weiteren Rädchen im Getriebe einer globalen ›Identitätsmaschinerie‹ zu werden«, einem »den ganzen Planeten umfassende System von festen Gewohnheiten und Anmaßungen«, wodurch alle Diskussionen über das Wesen politischer und wirtschaftlicher Alternativen vorüber zu sein scheinen und »die einzige Möglichkeit, jetzt noch politische Forderungen geltend machen zu können, darin bestehe, eine bestimmte Gruppenidentität einzufordern, wobei, was Identität ist, im Voraus festgelegt ist« (S. 119). Und er konstatiert scharfzüngig, dass die »Blickwinkel der Anthropolog*innen und der globalen Marketingmanager*innen fast ununterscheidbar« geworden sind (S. 118).
Doch was schlägt Graeber stattdessen für die Anthropologie vor? Er beobachtet, dass Anthropolog*innen »tatsächlich auf einem riesigen Archiv an menschlicher Erfahrung, von sozialen und politischen Experimenten, über die niemand sonst wirklich Bescheid weiß«, sitzen und bedauert, dass dieses Archiv der menschlichen Erfahrung von ihnen als »unser kleines schmutziges Geheimnis« (S. 114) behandelt wird. Natürlich erkennt Graeber ohne zu zögern an, dass es koloniale Gewalt war, die ein solches Archiv überhaupt erst möglich gemacht hat: »Das Fach, so wie es uns heute bekannt ist, wurde durch entsetzliche Systeme der Eroberung, der Kolonisierung und des Massenmordes ermöglicht – wie eigentlich die meisten modernen akademischen Disziplinen« (ebd.). Nichtsdestotrotz macht Graeber den kühnen Vorschlag, dass »[d]ie Ergebnisse der Ethnografie – und die ethnografischen Methoden – eine enorme Hilfe sein« könnten für radikale Bewegungen auf der ganzen Welt, wenn die Anthropolog*innen »ihr – wenngleich verständliches – Zögern aufgäben, das sich ihrer eigenen, oft schmutzigen Kolonialgeschichte verdankt, und sich darauf verstünden, das, worauf sie sitzen, nicht als schuldhaftes Geheimnis zu betrachten (das nichtsdestotrotz ihr schuldhaftes Geheimnis ist und niemandes sonst), sondern als gemeinsamen Besitz der Menschheit« (S. 112).
Zum Ende hin möchte ich anmerken, dass der Anarchismus und das anthropologische Wissen über anarchistische Ethik, Praxis und Imagination im Lauf der Menschheitsgeschichte Teil eines »gemeinsamen Besitz[es] der Menschheit« (ebd.) sind, zu dem sich nun auch Graebers eigene Beiträge zur anarchistischen Theorie und Praxis gesellen, gemeinsam mit seiner beeindruckenden Vision ihrer möglichen Vergangenheiten und Zukünfte. Ich schließe mit einer besonders inspirierenden Passage der Fragmente, die wir als Aufruf verstehen könnten, uns gedanklich und praktisch für die Möglichkeit einer anarchistischen Zukunft einzusetzen:
»[A]narchistische Organisationsformen [würden] keinerlei Staatsähnlichkeit aufweisen …. [Es käme] eine unendliche Vielfalt von Gemeinschaften, Vereinen, Netzwerken, Projekten in jeder denkbaren Größenordnung ins Spiel, die sich auf jede uns vorstellbare Art und Weise – und womöglich auf viele unvorstellbare – überlappten und überschnitten. Manche wären ziemlich lokal, andere global. Von niemandem würde verlangt, bewaffnet zu erscheinen und anderen den Mund zu verbieten und sie herumzukommandieren. Vielleicht wäre dies ihre einzige Gemeinsamkeit – und dass, weil Anarchist*innen wirklich auf keinem nationalen Territorium versuchen würden, die Macht zu ergreifen, der Prozess der Ablösung eines Systems durch ein anderes nicht die Form einer plötzlichen revolutionären Katastrophe – der Erstürmung einer Bastille, des Sturms auf ein Winterpalast – annähme, sondern notgedrungen allmählich verlaufen müsste, durch die Schaffung alternativer Organisationsformen im Weltmaßstab, neuer Formen der Kommunikation, neuer, weniger entfremdeter Formen der Lebensgestaltung, die gegenwärtig existierende Formen der Macht letztendlich als dumm und nebensächlich erscheinen lassen würden. Was wiederum hieße, dass es zahllose Beispiele eines machbaren Anarchismus gibt.« (S. 55)
In Fragmente einer anarchistischen Anthropologie schreibt Graeber über Madagaskar, dass »niemandem volle Autorität zukommt, bevor die oder der Betreffende nicht tot« ist (S. 74). Ich denke, wir stehen nun vor der Aufgabe, mit Graebers ›voller Autorität‹ auf anarchistische Weise umzugehen. Wir sollten ihn daher nicht durch Vergötterung oder Kanonisierung versteinern, sondern stattdessen seine Beiträge zu Anthropologie und Anarchismus gleichermaßen als Einladungen zum Denken, Spielen und Experimentieren verstehen.
Fragmente einer anarchistischen Anthropologie
(2004)
Anarchismus: Name für ein Lebens- und Verhaltensprinzip oder die entsprechende Theorie, wonach eine Gesellschaft ohne Regierung denkbar ist – die Eintracht in einer solchen Gesellschaft käme nicht durch Unterwerfung unter ein Gesetz oder Gehorsam gegenüber irgendeiner Autorität zustande, sondern durch freie Übereinkunft zwischen den verschiedenen Gebiets- und Berufsgruppen, die sich zum Zwecke von Produktion und Konsumtion sowie für die Befriedigung der unendlich vielfältigen Bedürfnisse und Bestrebungen eines zivilisierten Lebewesens frei zusammengeschlossen haben.
Pjotr Kropotkin (Encyclopedia Britannica)
Wenn du kein Utopist bist, dann bist du im Grunde ein Schwachkopf.
Jonothon Feldman (Indigenous Planning Times)
Was folgt, ist eine Reihe von Gedanken, Skizzen zu möglichen Theorien und Kleinstmanifesten – sie alle sollen einen flüchtigen Blick gestatten auf ein Korpus radikaler Theorie in Umrissen, wie es so in Wirklichkeit nicht existiert, obgleich es möglicherweise irgendwann in Zukunft existieren wird.
Weil es sehr gute Gründe dafür gibt, warum eine anarchistische Anthropologie wirklich existieren sollte, könnten wir mit der Frage anfangen, warum es sie nicht gibt – oder, was das angeht, warum es keine anarchistische Soziologie und keine anarchistischen Wirtschaftswissenschaften gibt, warum anarchistische Literaturtheorie oder anarchistische Politikwissenschaften nicht existieren.
Warum gibt es so wenige Anarchist*innen an den Universitäten?
Die Frage ist durchaus relevant, da der Anarchismus als politische Philosophie gerade jetzt eine wahre Explosion erlebt. Anarchistische oder vom Anarchismus angeregte Gruppen haben überall Zuwachs; längst nicht mehr finden sich traditionelle anarchistische Grundsätze – Autonomie, freiwillige Vereinigungen, Selbstorganisation, gegenseitige Hilfe, direkte Demokratie – in der Globalisierungsbewegung nur auf der Basis der Organisation, schon spielen sie in radikalen Bewegungen jeglicher Couleur weltweit die gleiche Rolle. Revolutionär*innen in Mexiko, Argentinien, Indien reden immer weniger von Machtergreifung und beginnen stattdessen radikal andere Ideen darüber zu formulieren, was Revolution überhaupt bedeuten könnte. Zugegeben: Die meisten scheuen letzten Endes davor zurück, das Wort »anarchistisch« tatsächlich zu verwenden. aber der Anarchismus hat, worauf Barbara Epstein jüngst hingewiesen hat, inzwischen weitgehend den Platz besetzt, den der Marxismus in den sozialen Bewegungen der Sechzigerjahre einnahm: selbst jene, die sich selbst nicht als Anarchist*innen begreifen, glauben, sich in Bezug auf ihn definieren zu müssen, und bedienen sich seiner Ideen.
Im akademischen Bereich hat das alles jedoch kaum seine Widerspiegelung gefunden. Die meisten Akademiker*innen scheinen nur die verschwommenste Vorstellung davon zu haben, worum es beim Anarchismus überhaupt geht; oder sie tun ihn mit den gröbsten Klischees ab. (»Anarchistische Organisation! Ist das nicht ein Widerspruch in sich?«) In den Vereinigten Staaten gibt es Tausende von akademischen Marxist*innen der einen oder anderen Art, aber kaum ein Dutzend Professor*innen, die bereit sind, sich offen als Anarchist*innen zu bezeichnen.
Sind die Akademiker*innen einfach noch nicht so weit? Möglich ist es. Vielleicht werden die Universitäten in den nächsten Jahren von Anarchist*innen überrannt. Aber ich mache mir keine großen Hoffnungen. Es hat den Anschein, als verspürte der Marxismus eine Neigung zum Akademischen, wie sie der Anarchismus nie haben wird. Schließlich war Ersterer die einzige große soziale Bewegung, die von einem Doktor der Philosophie ausging, auch wenn daraus später eine Bewegung zur Mobilisierung der Arbeiterklasse wurde. Die meisten geschichtlichen Darstellungen des Anarchismus sind der Ansicht, dass es mit ihm im Grunde genommen ähnlich war: Der Anarchismus wird als das geistige Produkt bestimmter Denker des 19. Jahrhunderts – Proudhon, Bakunin, Kropotkin u.a. – vorgestellt. Dann ließen sich Organisationen der Arbeiterklasse von ihm inspirieren, er verstrickte sich in politische Auseinandersetzungen, spaltete sich in Sekten auf … in den üblichen Beschreibungen erscheint der Anarchismus gewöhnlich als der ärmere Vetter des Marxismus, in theoretischer Hinsicht etwas unbeholfen, aber was ihm im Kopf fehle, mache er durch Leidenschaft und Ernsthaftigkeit vielleicht wieder wett. Doch tatsächlich ist die Analogie bestenfalls bemüht … Die »Gründerfiguren« des 19. Jahrhunderts sahen sich selbst nicht als Erfinder*innen von etwas, das besonders neu gewesen wäre. Die grundlegenden Prinzipien des Anarchismus – Selbstorganisation, freiwilliger Zusammenschluss, gegenseitige Hilfe – verwiesen auf Formen menschlichen Verhaltens, von denen sie annahmen, dass sie existierten, seit es Menschen gibt. Gleiches gilt für die Ablehnung des Staates und aller Formen struktureller Gewalt, Ungleichheit oder Herrschaft (wörtlich bedeutet Anarchismus »ohne Herrscher«), es gilt sogar für die Annahme, dass alle diese Formen irgendwie miteinander verwandt seien und sich gegenseitig verstärkten. Nichts davon wurde als aufregende neue Lehre präsentiert. Und es war ja auch nicht so: Zu allen Zeiten finden sich in der Geschichte Berichte über Menschen, die ähnlich argumentiert haben, auch wenn alles dafür spricht, dass solche Ansichten die meiste Zeit und an den meisten Orten kaum eine Chance hatten, schriftlich festgehalten zu werden. Wir sprechen nämlich weniger über ein Theoriegebäude als über eine Haltung oder vielleicht könnte man sogar sagen über einen Glauben: die Zurückweisung bestimmter Formen gesellschaftlicher Beziehungen, die Zuversicht, dass gewisse andere Formen sich sehr viel besser eigneten, um eine lebenswerte Gesellschaft darauf zu gründen, den Glauben, dass eine solche Gesellschaft tatsächlich bestehen könnte.
Auch im Vergleich der historischen Schulen des Marxismus mit dem Anarchismus wird ersichtlich, dass wir es mit grundsätzlich verschiedenen Projekten zu tun haben. Marxistische Schulen haben ihre Urheber. So wie der Marxismus dem Marx’schen Denken entsprang, so haben wir auch Leninismus, Maoismus, Trotzkismus, Gramscianer*innen, Althusserianer*innen … (Man beachte, wie die Liste mit Staatsoberhäuptern beginnt und fast nahtlos zu französischen Professoren übergeht.) Wenn das wissenschaftliche Feld ein Spiel ist, so hat Pierre Bourdieu einmal angemerkt, in dem Forscher*innen um die Vormacht ringen, dann weißt du, dass du gewonnen hast, sobald andere Professoren*innen anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich aus deinem Namen ein Adjektiv machen lässt. Vermutlich um sich die Chance zu erhalten, das Spiel zu gewinnen, bestehen Intellektuelle bei der gegenseitigen Diskussion ihrer Arbeiten darauf, eben die Sorte von historischen Großmannstheorien weiter zu verwenden, über die sie sich in fast jedem anderen Zusammenhang lustig machen würden: Foucaults Ideen werden wie diejenigen Trotzkis nie in erster Linie als Produkte eines intellektuellen Milieus behandelt, als etwas, das aus endlosen Gesprächen und Auseinandersetzungen erwuchs, an denen Hunderte von Menschen beteiligt waren, sondern stets, als ob sie sich dem Genie eines einzelnen Mannes (oder, ganz selten, einer Frau) verdankten. Es stimmt auch nicht ganz, dass die marxistische Politik sich wie eine akademische Disziplin organisiert hat; noch ist sie zum Modell dafür geworden, wie radikale (oder zunehmend alle) Intellektuelle einander behandeln; vielmehr entwickelten sich die beiden Trends irgendwie gemeinsam. In Hinsicht auf die Universität ergaben sich daraus viele heilsame Konsequenzen – etwa das Gefühl, dass es eine gewisse moralische Orientierung braucht oder dass akademische Anliegen für das Leben der restlichen Menschen von Bedeutung sein sollten –, aber auch viele desaströse: wenn nämlich ein Großteil der intellektuellen Debatte zur Parodie sektiererischer Politik wird, wobei jede*r versucht, Gegenargumente ins Lächerliche zu ziehen, um sie nicht nur für falsch zu erklären, sondern auch für böse und gefährlich – auch wenn für gewöhnlich in einer so geheimnisvollen Sprache debattiert wird, dass niemand, der oder die sich keine siebenjährige Graduiertenausbildung leisten kann, auch nur die leiseste Ahnung davon hätte, dass hier überhaupt eine Diskussion im Gange ist.
Schauen wir uns nun die verschiedenen Schulen des Anarchismus einmal an. Da gibt es Anarchosyndikalismus, Anarchokommunismus, Insurrektionalist*innen, Kooperativist*innen bzw. Genossenschaftler*innen, Individualismus, Plattformismus … Keine ist nach einem Großen Denker benannt; sie sind ausnahmslos nach einer Form der Praxis oder – in ihrer Mehrzahl – nach einem Organisationsprinzip benannt. (Bemerkenswerterweise stehen diejenigen marxistischen Richtungen, die wie der Autonomism[1] oder der Rätekommunismus nicht nach Individuen benannt sind, dem Anarchismus auch am nächsten.) Anarchist*innen unterscheiden sich gerne darin, was sie tun und wie sie organisatorisch an ihr Vorhaben herangehen. Und tatsächlich haben Anarchist*innen darüber die meiste Zeit nachgedacht und gestritten. Sie haben sich nie so sehr für die Art allgemeiner strategischer oder philosophischer Fragen interessiert, über die sich, historisch gesehen, die Marxist*innen den Kopf zerbrochen haben – also Fragen wie: Sind die Bauern eine potenziell revolutionäre Klasse? (Nach Ansicht der Anarchist*innen sollten das die Bäuer*innen selbst entscheiden.) Worin besteht das Wesen der Warenform? Lieber streiten sie sich darüber, was der wahrhaftig demokratischste Weg zur Abhaltung einer Versammlung sei, wo eine Organisation ihre bestärkende, ermächtigende Wirkung verliert und individuelle Freiheit zu ersticken droht. Oder es geht andersherum um die ethische Rechtfertigung des Widerstands gegen die Macht: Was ist direkte Aktion? Ist es notwendig (oder richtig), jemand öffentlich zu verurteilen, der ein Staatsoberhaupt ermordet? Oder kann ein Attentat, insbesondere wenn es etwas Schreckliches wie einen Krieg verhindert, eine moralische Tat sein? Wann ist es okay, eine Fensterscheibe einzuschlagen?
Um also zusammenzufassen:
Der Marxismus neigte dazu, ein theoretischer oder analytischer Diskurs über revolutionäre Strategie zu sein.
Der Anarchismus neigte dazu, ein ethischer Diskurs über revolutionäre Praxis zu sein.
Augenscheinlich hat alles, was ich gesagt habe, etwas Karikaturhaftes (es hat extrem sektiererische anarchistische Gruppen gegeben und viele libertäre, praxisorientierte Marxist*innen, mich, könnte man sagen, eingeschlossen). Selbst so formuliert, weist dies auf ein umfangreiches Potenzial von Ergänzungsmöglichkeiten zwischen beiden hin. Und so war es ja auch: Selbst Michail Bakunin hat, ungeachtet seiner endlosen Auseinandersetzungen mit Marx über Fragen der Praxis, doch eigenhändig Marx’ Kapital ins Russische übersetzt. Damit wird aber auch verständlicher, warum es so wenige akademische Anarchist*innen gibt. Es liegt nicht bloß daran, dass der Anarchismus mit hochgestochenen Theorien bekanntlich wenig anzufangen weiß. Es hat damit zu tun, dass er sich in erster Linie mit Formen der Praxis befasst; er besteht darauf, dass Zweck und Mittel übereinstimmen müssen; mit autoritären Methoden keine Freiheit zu gewinnen ist; tatsächlich, so weit wie möglich, in den eigenen persönlichen Beziehungen zu Freund*innen und Gleichgesinnten die Gesellschaft, die man schaffen möchte, verkörpert werden muss. Dies verträgt sich nicht sehr gut mit der Tätigkeit an einer Universität, vielleicht der einzigen westlichen Institution, mit Ausnahme der katholischen Kirche und der britischen Monarchie, die ziemlich unverändert seit dem Mittelalter Bestand hat, ihre intellektuellen Schlachten auf Tagungen in teuren Hotels schlägt und vorzugeben versucht, all dies fördere irgendwie die Revolution. Offen als anarchistische*r Professor*in aufzutreten, würde mindestens bedeuten, den gängigen Universitätsbetrieb infrage zu stellen – und ich meine damit keineswegs die Forderung, eine Fakultät für Anarchismusstudien einzurichten –, und das bringt natürlich weitaus mehr Ärger mit sich als alles, was jemals geschrieben werden könnte.
Das heißt nicht, dass eine anarchistische Theorie nicht möglich ist.
Das heißt nicht, dass Anarchist*innen zwangsläufig gegen alle Theorie eingestellt sind. Schließlich ist der Anarchismus selbst eine Idee, wenn auch eine sehr alte. Auch ist er ein Projekt, das sich vornimmt, mit der Schaffung von Institutionen einer neuen Gesellschaft »im Gehäuse der alten« zu beginnen, Herrschaftsstrukturen offenzulegen, zu erschüttern und zu unterminieren, aber dabei stets auf demokratische Weise vorzugehen, in einer Art, die beweist, dass solche Strukturen unnötig sind. Zweifellos braucht ein derartiges Projekt Werkzeuge zur intellektuellen Analyse und Einsicht. Es braucht vielleicht keine Höhere Theorie [High Theory], oder was heute allgemein darunter verstanden wird. Ganz gewiss wird der Anarchismus nicht die eine Große Anarchistische Theorie nötig haben. Das wäre dem Geist des Projekts völlig gegensätzlich. Viel besser, glaube ich, wäre etwas, das mehr vom Geist anarchistischer Entscheidungsfindungsprozesse geprägt ist, wie sie überall zur Anwendung kommen, in kleinsten autonomen Bezugsgruppen bis zu gigantischen Delegiertenplena mit Tausenden Menschen. Die meisten anarchistischen Gruppen halten sich bei ihrem Vorgehen an das Konsensprinzip, das in vieler Hinsicht als das genaue Gegenteil des selbstherrlichen, spalterischen, sektiererischen Stils entwickelt wurde, der bei vielen anderen radikalen Gruppen so beliebt ist. Auf Theorie angewandt hieße das, die Notwendigkeit einer Vielfalt hochtheoretischer Perspektiven zu akzeptieren, die nur durch ein gewisses gemeinsames Engagement und Einvernehmen miteinander verbunden wären. Jede*r stimmt in einem solchen Konsensfindungsprozess gewissen weitgefassten Vorgaben (Prinzipien der Einheit sowie Gründen, wofür es die Gruppe braucht) zu; selbstredend akzeptieren auch alle, dass niemals jemand von anderen gänzlich zu deren Sicht der Dinge bekehrt wird und dass wohl niemand das überhaupt erst versuchen sollte, und dass sich daher die Diskussion auf konkrete Fragen des Handelns konzentrieren sollte, damit ein Plan gefasst wird, mit dem alle leben können und bei dem niemand das Gefühl hat, auf fundamentale Weise die Prinzipien anderer Menschen zu verletzen. Hier ließe sich eine Parallele erkennen: eine Reihe unterschiedlicher Perspektiven, verbunden durch den gemeinsamen Wunsch, die conditio humana zu verstehen und sie in Richtung einer größeren Freiheit zu bewegen. So eine Theorie basiert nicht auf dem Bedürfnis, die Grundannahmen anderer als falsch zu beweisen, sondern versucht lieber bestimmte Projekte zu finden, bei denen die Perspektiven sich gegenseitig bestärken. Dass Theorien in mancher Hinsicht inkommensurabel sind, bedeutet nicht, dass sie nicht existieren können oder einander nicht sogar stützen können – nicht mehr als die Tatsache, dass Individuen einzigartige und unvergleichbare Weltanschauungen haben, bedeutet, dass sie nicht Freunde oder Liebhaber werden oder an gemeinsamen Projekten arbeiten können.
Nötiger als eine Gehobene Theorie hat der Anarchismus, was Niedere Theorie [Low Theory] genannt werden könnte: eine Methode, sich mit den wirklichen, unmittelbaren Problemen auseinanderzusetzen, die aus einem transformativen Projekt erwachsen. Der sozialwissenschaftliche Mainstream ist hier nicht sehr hilfreich, denn er klassifiziert derlei normalerweise als »Thema für die Politik« [policy[2]issue], und damit möchten Anarchist*innen, die etwas Selbstachtung besitzen, nichts zu tun haben.
gegen Policy (ein ganz kleines Manifest)
Der Begriff der Policy setzt einen Staat oder Regierungsapparat voraus, der seinen Willen anderen aufzwingt. Policy ist die Negation von Politik; Policy wird per definitionem von einer Art Elite zusammengebastelt, die glaubt, sie wisse besser als andere, wie deren Angelegenheiten zu erledigen seien. Mit der Teilnahme an sogenannten politischen Debatten lässt sich allerhöchstens eine Schadensbegrenzung erreichen, da bereits die bloße Prämisse dem Gedanken abträglich ist, Menschen könnten ihre Angelegenheiten selber regeln.