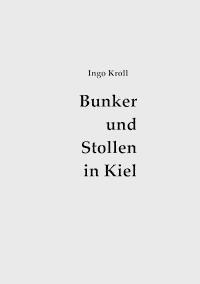
Bunker und Stollen in Kiel E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gefährdung Deutschlands durch feindliche Luftangriffe im Falle eines Krieges war vielen Verantwortlichen bereits lange vor dem Krieg bewußt. Aus diesem Grund erhielt der Luftschutz im Rahmen der Aufrüstung des Dritten Reiches eine besondere Bedeutung. Schon vor dem 2. Weltkrieg begann man, die Zivilbevölkerung über den Luftschutz zu informieren und entsprechend zu schulen. Der Bau von Bunkern begann allerdings erst während des Krieges, als klar wurde, daß mit den bislang getroffenen Vorkehrungen ein wirksamer Schutz nicht möglich war. Am Beispiel der Stadt Kiel zeichnet der Autor die organisatorischen und baulichen Luftschutzmaßnahmen der Jahre 1933 bis 1945 nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Fragestellung
Quellen und Darstellungen
Der Luftschutz in Kiel
Die Organisation des Luftschutzes
Allgemeines
Die Spitzengliederung der Luftschutzorganisation
Der Luftschutzort
Die Fachbereiche
Verdunkelung und Tarnung
Luftschutz und die NSDAP
Der bauliche Luftschutz
Allgemeines
Planung
Luftschutzbauten in Kiel
Bauwirtschaft und Handwerk
Der Schutz von Kulturgut
Zusammenfassung
Anhang
Quellen und Darstellungen
Ungedruckte Quellen
Gedruckte Quellen
Darstellungen
Anlagen
Texte
Abzug der Arbeitskräfte aus dem Führerprogramm bei Katastrophen
Lagebericht über die Lage der Bauwirtschaft für die MonateOktober bis Dezember 1942
Anleitung zur Aufstellung eines Betriebsluftschutzplanes
Tabellen
Kieler Luftschutzbauten in der Übersicht
Hochbunker
Tiefbunker
Stollen
Sonstige LS- Einrichtungen
Abbildungen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Zeittafel zur Organisation des Luftschutzes 1930 - 1945
Tabelle 2 Ausstattung einer Luftschutzgemeinschaft mit Selbstschutzgerät
Tabelle 3 Ausrüstung einer Einsatzgruppe im Erweiterten Selbstschutz
Tabelle 4 Selbstschutzgerät der Stalleigentümer für Großtiere
Tabelle 5 Bevölkerungsentwicklung in Kiel 1939 - 1946
Tabelle 6 Bevölkerungsentwicklung in Kiel 1939 und 1947 nach Stadtteilen
Tabelle 7 Stärkenachweis der Kieler Feuerwehr
Tabelle 8 Luftalarme und Luftangriffe in/ gegen Kiel 1939 – 1945
Tabelle 9 Bombenopfer in Kiel 1939 - 1945
Tabelle 10 Bombenopfer in Kiel 1939 – 1945, Todesursachen
Tabelle 11 Bombenopfer in Kiel 1939 – 1945 nach Alter und Geschlecht
Tabelle 12 Bombenopfer in Kiel 1939 – 1945 nach Stadtteilen
Tabelle 13 Luftkriegsopfer der deutschen Zivilbevölkerung 1939 - 1945
Tabelle 14 Verlust/Verbleib von Kulturgut in Kiel 1939 - 1945
Tabelle 15 Die Städte im „Führer-Sofortprogramm“ vom September 1940
Tabelle 16 Verhältnis der Schutzplätze zur Einwohnerzahl.
7 norddeutsche Großstädte im Vergleich
Tabelle 17 Das Bunkerbauprogramm im Luftgaukommando XI
Tabelle 18 Kieler Straßennamen 1940/1949
Tabelle 19 Kosten eines Arbeiterwohnhauses 1936
Tabelle 20 Durchschnittlicher Bruttoverdienst 1938 (Beispiele)
Tabelle 21 Baupreise für 1 cbm umbauten Raum. Stand 1935
Tabelle 22 Sonstige Kieler LS-Einrichtungen: 5-Mann-Bunker(Pilze)
Tabelle 23 Sonstige Kieler LS-Einrichtungen: Öffentliche Luftschutzräume
Tabelle 24 Sonstige Kieler LS-Einrichtungen: Deckungsgräben
Tabelle 25 Sonstige Kieler LS-Einrichtungen: Feuerlöschteiche
Tabelle 26 Luftschutzplätze Kieler Firmen, Stand Mai 1941
Tabelle 27 Liste der Kieler LS- Bunker, erstellt von der Stadt Kiel 1959
Liste der Kieler LS- Bunker, erstellt von der Stadt Kiel 1959 (Fortsetzung)
Tabelle 28 Liste der Kieler LS- Bunker, erstellt durch die englische Besatzungsmacht, Mai 1945
(Teil des Betriebsluftschutzplanes des Polizeireviers)
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Organisation des Reichsluftschutzbundes
Abb. 2 Organisation der Fachtrupps „Versorgungsnetze“ 1939
Abb. 3 Organisation des Luftschutz-Warndienstes 1939
Abb. 4 LS-Einrichtungen im 3. Polizeirevier Kiel
Abb. 5 Formblatt –Heranziehung zur Luftschutzpflicht
Abb. 6 Merkblatt für den Luftschutzwart
Abb. 7 Luftschutz-Merkblatt für die Familie.
Abb. 8 Luftschutz-Merkblatt für die Hausfeuerwehr.
Abb. 9 Luftschutz-Merkblatt für die Bevölkerung
Abb. 10 Behelfsmäßige Herrichtung von Schutzräumen: Abstützen der Decke
Abb. 11 Behelfsmäßige Herrichtung von Schutzräumen: Fensterabdichtung.
Abb. 12 LS-Raum (Luftschutzkeller) Äußere Kennzeichnung
Abb. 13 Bauantrag für LS-Bunker Hummelwiese
Abb. 14 Baubeschreibung für LS-Bunker Hummelwiese (Seite 1)
Abb. 15 Lohnabrechnungsblatt LS- Bunker. Hummelwiese
Abb. 16 Skizze eines Hochbunkers 1940
Abb. 17 LS- Bunker. Hochbunker Gablenzbunker
Abb. 18 LS- Bunker. Hochbunker Germania I
Abb. 19 LS-Turm Bauart Winkel
Abb. 20 Skizze eines 2/3- erdversenkten LS-Bunkers
Abb. 21 LS- Bunker. Tiefbunker Rathaus (Eingangsbauwerk)
Abb. 22 LS- Stollen Friedhof Elmschenhagen (Eingang)
Abb. 23 LS- Stollen Werftstraße (Eingangsbereich)
Abb. 24 Befehl zur Durchführung des „Führer-Sofort-Programms"
Abb. 25 Bunkerordnung 1943
Abb. 26 Einflugzeiten für Feindflugzeuge
Abb. 27 US-Stadtplan von Kiel mit Bombenzielen
Abb. 28 Zerstörungen in Kiel 1942
Abb. 29 Bombenangriff auf Kiel vom 26./27.8.1944
Abb. 30 Zerstörungen in Kiel bis Kriegsende 1945
Abb. 31 Organisation der Marineflak in und um Kiel
Verzeichnis der Abkürzungen
Einleitung
Fragestellung
Am 04. Mai 1945 um 01:05 Uhr verkündeten die Sirenen das Ende jenes Luftalarms, der die Bürger der Stadt Kiel zum letzten Male in die Bunker und Luftschutzkeller getrieben hatte. Nun endlich endeten nach fast 5 Jahren die Luftangriffe englischer und amerikanischer Bomber, die in ständig steigendem Maße der Stadt und ihren Bewohnern Tod und Zerstörung gebracht hatten. In Kiel, das aufgrund seiner militärischen und wirtschaftlichen Bedeutung seit Kriegsbeginn im Zielkreuz der Angriffe gelegen hatte, waren über 2.000 Bombenopfer zu beklagen, Gebäude und Infrastruktur der Stadt waren weitgehend zerstört.
Die Gefährdung Deutschlands durch feindliche Luftangriffe im Falle eines Krieges war allen Verantwortlichen bereits lange vor dem Krieg bewußt gewesen. Aus diesem Bewußtsein heraus erhielt der Luftschutz im Rahmen der Aufrüstung des Dritten Reiches eine besondere Bedeutung. Neben den Einrichtungen des Militärs und den Industrieanlagen mußten insbesondere die Städte mit ihrer Bevölkerung und ihren Kultureinrichtungen gegen feindliche Luftangriffe geschützt werden. Welche Maßnahmen trafen nun die Behörden, um diese Aufgaben zu bewältigen?
Dazu soll in dieser Arbeit versucht werden, am Beispiel der Stadt Kiel darzustellen, in welchem Umfang in den Jahren 1933 bis 1945 organisatorische und bauliche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bewohner einer Stadt vor den Folgen feindlicher Luftangriffe zu schützen.
Die Luftschutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung lassen sich am Beispiel der Stadt Kiel besonders beispielhaft darstellen. Denn diese Stadt verkörperte ein Ziel ersten Ranges für feindliche Luftangriffe, weil
sie Kriegshafen und, neben Wilhelmshaven, größter Marinestützpunkt des Reiches war,
sie keine „offene Stadt“, sondern eine Festung war,
auf ihren Werften vorwiegend Kriegsschiffe, vom U-Boot bis zum Schlachtschiff, gebaut wurden, und
viele Industriebetriebe im Stadtbereich, als Zulieferer für die Werften, Rüstungsgüter herstellten.
Zunächst werden dazu in der Arbeit die organisatorischen Luftschutzmaßnahmen dargestellt. Daran anschließend soll untersucht werden, in welchem Umfang bauliche Luftschutzanlagen für die Zivilbevölkerung errichtet wurden. Es werden jedoch nur diejenigen Luftschutzbauten berücksichtigt, die innerhalb des Stadtgebietes von Kiel errichtet wurden bzw. errichtet werden sollten. Als Stadtgebiet gilt dabei der Gebietsstand des Jahres 1945. Alle baulichen Luftschutzeinrichtungen in Nachbarorten, die erst nach 1945 eingemeindet wurden (z.B. Russee, Wellsee, Schilksee) bleiben unbeachtet. Aufgrund der Quellenlage werden in dieser Arbeit der Bunkerbau der Wehrmacht, der Werften und der Industrie nur sehr kursorisch behandelt.
Zur Wahrung einer einheitlichen Terminologie werden in dieser Arbeit die Begriffe Luftschutzbauten, Luftschutzbunker (LS- Bunker) und Luftschutzstollen (LS- Stollen) durchgehend für all diejenigen Bauwerke angewandt, die dem Schutz vor feindlichen Luftangriffen dienten. Der Ausdruck „Luftschutzbauten“ bezeichnet als übergreifender Terminus sowohl Öffentliche Luftschutzräume und Luftschutzräume („Luftschutzkeller“) als auch LS- Bunker und LS- Stollen. „LS- Bunker“ bedeutet dabei ein oberirdisch, unterirdisch oder teilweise in die Erde eingelassenes splitter- und/oder bombensicheres Bauwerk in Form eines Hauses aus Beton, und als „LS- Stollen“ werden diejenigen Einrichtungen bezeichnet, die als fest ausgekleidete, splitter- und/oder bombensichere tunnelartige Systeme unter der Erde angelegt sind. Die Klarstellung ist notwendig, da in der Literatur eine durchgehend einheitliche Terminologie fehlt. So galten bis 1945 nur diejenigen Bauten als „Luftschutzbunker“, die bombensicher erbaut und mit Gasschleusen versehen waren. In Akten, in Büchern und Zeitschriftenartikeln aus der Zeit vor 1945 findet man jedoch neben dem Terminus „Bunker“ auch noch die Bezeichnungen „Luftschutzunterkunft“ (L.U. bzw. Lu) und/oder „Luftschutzhaus“. Die volkstümlich als „Luftschutzkeller“ bezeichneten Luftschutzeinrichtungen sind in dieser Arbeit durchweg als „Luftschutzräume“ bezeichnet. Dabei wird, wenn notwendig, zwischen „Öffentlichen Luftschutzräumen“ und denjenigen „Luftschutzräumen“ unterschieden, die, im Haus eingerichtet, normalerweise nur den Bewohnern des Hauses zur Nutzung vorbehalten waren.
Im letzten Abschnitt wird noch auf die Maßnahmen eingegangen, die zum Schutz hochwertiger Kulturgüter in Museen und Kirchen, in Bibliotheken und sonstigen Einrichtungen getroffen wurden. Denn der Luftschutz sollte ja nicht allein die Menschen schützen, sondern auch Kulturgut vor Schaden bewahren.
Auf die Darstellung der Bunkerbautechnik wird verzichtet, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Gleiches gilt für die städtebaulichen Maßnahmen und die Vorbereitungen zur Stadtsanierung im Sinne des Luftschutzes. Auch auf die umfangreichen Evakuierungen und Bevölkerungsverschiebungen 1 innerhalb der Stadt, die ja auch in gewissem Umfang dem Schutz der Zivilbevölkerung vor Luftangriffen dienten, wird insgesamt nicht eingegangen. Denn diese Thematik ist ebenfalls so komplex und umfangreich, daß sie einer gesonderten Untersuchung vorbehalten bleiben muß.
Unberücksichtigt bleibt gleichfalls der aktive Luftschutz (LS), 2 d.h. die gesamte militärische Organisation zum Schutz der Festung Kiel mit ihren Flakbatterien, Sperrballonen und Nebelanlagen. Nur als Ergänzung/Randnote ist dazu im Anhang eine Übersicht über die Gliederung und Dislozierung des Marine- Flak- Regiments beigefügt. 3
Quellen und Darstellungen
Der Forschungsstand zum Thema ist wenig umfangreich. Der Bunkerbau in Kiel während des Zweiten Weltkrieges wurde bisher kaum untersucht. Allein Foedrowitz und Neitzel haben sich im Rahmen anderer Arbeiten mit dem Bunkerbau in Kiel befaßt. Umfangreichere Dokumentationen und Darstellungen liegen nur über den Luftkrieg bzw. über die Auswirkungen des Bombenkrieges in Kiel vor, in denen jedoch über den Bau von Luftschutzanlagen nicht berichtet wird.
Das offensichtlich geringe Interesse an einer Aufarbeitung der Thematik „Bunkerbau in Kiel“ hat dazu geführt, daß mögliche Aussagen von Zeitzeugen kaum mehr verfügbar sind. Das Geschehen ist folglich fast ausschließlich aus Aktenbeständen rekonstruierbar. Dieses Quellenmaterial ist bedauerlicherweise wenig umfangreich und zudem lückenhaft. In den Archiven sind nur Restbestände zu finden. Die Masse der Akten ist verloren. Da die Bauleitung für den Bunkerbau während des Krieges beim Reichsministerium der Luftfahrt in Berlin lag, hatte man die Bauunterlagen in sog. „Pendelakten“ zusammengefaßt. Die Akten „pendelten“ (im Wortsinne!) zwischen der Kieler Außenstelle der Bauleitung des Luftfahrtministeriums, den beteiligten städtischen Behörden, der schleswig- holsteinischen Provinzialregierung und den Fachabteilungen des Ministeriums in Berlin. So wurden sie entweder bei Bombenangriffen zerstört, gingen verloren oder wurden kurz vor Kriegsende im Luftfahrtministerium vernichtet. 4
Die Aktenbestände im Stadtarchiv Kiel zum Bunkerbau ermöglichen es immerhin, den Planungsprozeß der Jahre 1939 bis Anfang 1943 einigermaßen befriedigend zu erschließen. Die Baugeschichte einzelner Bunker läßt sich nicht mehr nachvollziehen. Für die Zeit nach 1943 sind so gut wie keine Dokumente vorhanden. Der geringe Bestand an Unterlagen aus den Jahren 1943 – 1945 besteht fast ausschließlich aus Korrespondenz zwischen den städtischen Ämtern und den Behörden der Provinz bzw. des Reiches, die keinen erschöpfenden Einblick in die Bautätigkeit dieser Jahre ermöglicht. Bauunterlagen, die im Tiefbauamt vorhanden gewesen sein mögen, sind mit Sicherheit bei dem Luftangriff vom Mai 1945 vernichtet worden, bei dem das Rathaus schwere Schäden erlitt. Über die Luftschutzorganisation in Kiel lassen die Akten des Stadtarchivs gleichfalls nur einen oberflächlichen Überblick zu, weil dazu die Bestände genauso gering sind.
Im Landesarchiv Schleswig ist die Quellenlage zum Bunkerbau nicht wesentlich günstiger. Das Archiv besitzt aber immerhin einen umfangreichen Bestand an Unterlagen zur Baustoffversorgung und Baustoffzuteilung. Sehr interessant ist außerdem eine umfangreiche Akte mit den Unterlagen zu einem Enteignungsfall.
Der Aktenbestand der Oberfinanzdirektion beschränkt sich auf Unterlagen über diejenigen Kieler Luftschutzbauten, die nach dem Kriege entweder wieder für den Zivilschutz hergerichtet wurden oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen ständig überprüft werden müssen. Das bedeutet, daß keinerlei Vorgänge zu denjenigen LS- Bauten vorhanden sind, die kurz nach Kriegsende völlig beseitigt wurden. Das vorhandene Material besteht zudem überwiegend aus Vorgängen, die 1945 oder später zu den Akten verfügt wurden. Aus der Zeit des 2. Weltkrieges ist nur eine geringe Zahl an Schriftstücken vorhanden.
Von den an der Planung und am Bunkerbau beteiligten Firmen existieren die meisten nicht mehr oder haben, wie z.B. die Firma Frank Heimbau, 5 ihr gesamtes Material bereits vor Jahren vernichtet. Einzig die Kieler Baufirma Max Giese verfügt noch über einige wenige Vorgänge aus der Zeit von vor 1945. 6
Eine wichtige Quellengruppe mit allgemeine Informationen zur LS-Organisation und zum Bunkerbau vor und während des 2. Weltkrieges sind Zeitschriften und Gesetzestexte. Sie sind noch reichlich in verschiedenen Bibliotheken verfügbar. Erwähnenswert sind die Zeitschrift des Reichsluftschutzbundes und Fachzeitschriften des Bauwesens, wie z. B. „Baulicher Luftschutz“ und „Bauwelt“. Besonders die während des Krieges erschienenen Hefte enthalten eine Fülle von Informationen. Die Texte des Luftschutzgesetzes mit seinen Ausführungsbestimmungen und die Erlasse des Reichsluftfahrtministeriums zum Bunkerbau sind ebenfalls in vielen Bibliotheken und Archiven vorhanden.
Dokumentationen der Stadt Kiel und des „United States Strategic Bombing Survey – Munition Division“ enthalten brauchbare Angaben. Von den Dokumentationen des „United States Strategic Bombing Survey – Munition Division“ konnten leider nur die Berichte über die „Deutsche Werke AG Kiel“ und die „Krupp Germania Werft Kiel“ ausgewertet werden. Diese Hefte sind informativ, weil darin die exakte Lage aller Gebäude im Werftgelände, und damit auch diejenige der Bunker und Luftschutzräume, eingetragen ist. Angaben zum Bunkerbau enthalten die Berichte nicht. Die Dokumentation des „US Strategic Bombing Survey” über die deutschen Luftschutzbunker war hingegen in keiner Bibliothek und keinem Archiv zu bekommen. Von den Dokumentationen der Stadt Kiel über den Luftschutz und den Bombenkrieg ist die „Mitteilung des Statistischen Amtes der Stadt Kiel, Nr.24“ die wichtigste. Sie enthält Aufstellungen über die Auswirkungen des Luftkrieges auf die Stadt, die baulichen Luftschutzmaßnahmen (Bunker, Stollen, Dekkungsgräben usw., ohne Luftschutzräume (LS- Keller)), die Luftalarme und die Bombenopfer. In der Liste der LS- Bunker und LS- Stollen fehlen allerdings die meisten Standortangaben. Außerdem ist nicht nachvollziehbar, auf welche Weise die einzelnen Bunker den verschiedenen Kategorien, z. B. „Zivilluftschutz“ oder „Werkluftschutz“, zugeordnet wurden. Es fehlt eine Aussage darüber, nach welchem Prinzip die Zuordnung erfolgte, so z. B., ob man die Krankenhausbunker in die Kategorie „Zivilluftschutz“ oder „Werkluftschutz“ einreihte. 7
An Darstellungen über den Bunkerbau in Kiel gibt es nur 3 Arbeiten, die sich mit der Baugeschichte befassen. Von diesen ist Foedrowitz „Bunkerwelten“ der interessanteste Band. Foedrowitz behandelt darin den Bunkerbau der norddeutschen Großstädte im Wehrkreis XI. 8 Obwohl der Stadt Kiel, verständlicherweise, nur ein kurzer Abschnitt gewidmet ist, ist das Buch dennoch die bislang gründlichste Untersuchung zum Thema. Der Autor geht in seinem Werk zudem eingehend auf die Hintergründe ein, die zum Bau der Luftschutzeinrichtungen geführt haben. In einem zweiten Buch beschreibt der gleiche Autor eine sehr spezielle Form von Bunkern, die „Luftschutztürme“. Der Kiel betreffende Abschnitt in diesem Band ist umfassend, da es nur 2 Bunker dieser Bauart in der Stadt gab. Beachtenswert sind besonders die Abschnitte über diejenigen Firmen, die sich schon vor dem Kriege mit der Konstruktion von Luftschutzbauten beschäftigten. 9 Die dritte Arbeit ist das Buch von Neitzel. Er stellt darin Ubootbunker und Bunkerwerften vor und beschreibt u. a. den Bau der beiden Kieler Ubootbunker KILIAN und KONRAD.
Andere Darstellungen über Kieler Bunker enthalten zur Baugeschichte nichts. Rönnau setzt sich in seinem Werk über den Ubootbunker KILIAN mehr mit dem Thema „Krieg“ im allgemeinen auseinander. Die Arbeit von Randau „Kieler Bunker“ beschränkt sich auf Fotos der Bunker im Stadtbereich mit einem sehr(!) kurzen Textbeitrag. Die Fotos waren Thema einer gleichnamigen Ausstellung in der Kunsthalle. Allgemeine Darstellungen zum Thema „Bunkerbau“, wie z. B. die Arbeit von Virillo, sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit ebenfalls unergiebig.
Den „Luftschutz im Dritten Reich“ in seiner Gesamtheit behandelt Hampe in seinem Buch „Der zivile Luftschutz im Zweiten Weltkrieg“. Es ist DAS Standardwerk zum Thema. Bereits 1963 veröffentlicht, ist es heute noch uneingeschränkt gültig. Hampe beschreibt das Thema umfassend und sachgerecht. Der Autor ist besonders kompetent, da er bereits vor dem 2. Weltkrieg als Referent für Luftschutzangelegenheiten im Reichsluftfahrtministerium tätig war und schon 1937 Mitherausgeber eines Buches über den zivilen Luftschutz war.
Zwischen Dokumentation und Darstellung sind die „Dokumente deutscher Kriegsschäden. Evakuierte, Kriegssachgeschädigte, Währungsgeschädigte“ einzuordnen. Sie veranschaulichen in fünf Bänden im wesentlichen die Situation der Betroffenen nach dem Kriege und die staatlichen Hilfsmaßnahmen für diese Bevölkerungsgruppe. Einige Kapitel behandeln aber auch allgemeine Aspekte des Luftschutzes und des Luftkrieges. So ist ein Abschnitt der Organisation des Luftschutzes vor und während des Krieges gewidmet. Zeitgenössischen Originalunterlagen aus Hamburg, dem rheinisch/westfälischen Industriegebiet und Bayern ergänzen diese Schilderungen und veranschaulichen das Gesagte. In je einem weiteren Kapitel wird der Verlauf des Luftkrieges dargestellt, und über die Anstrengungen zum Schutz des Kulturgutes berichtet. Im Anhang sind die Verluste an Kulturgut in Deutschland, geordnet nach Regionen und Städten, aufgelistet.
Darstellungen zum Luftkrieg in und über Deutschland während des zweiten Weltkrieges sind in großer Zahl erschienen. Die Masse dieser Werke behandelt den Luftschutz nicht. Eine Ausnahme ist das Buch von Groehler. Er schreibt auch über den Bunkerbau im Dritten Reich und urteilt dabei äußerst kritisch über die politischen, sozialen sowie wirtschaftlichen Gründe und Auswirkungen des Bunkerbaues.
Darstellungen über die Luftschutzorganisation und über das Alarmwesen in Kiel fehlen völlig. Nur einige wenige Informationen sind in Arbeiten über die Feuerwehr, die Kieler Stadtgeschichte und den Kieler Kreisverband des Roten Kreuzes zu finden. Kettenbeil schildert in seinem Werk die Organisation der Kieler Feuerwehr und ihre Einsätze in der Zeit von 1933 bis 1945 recht ausführlich. Doch fehlen bei ihm einige wichtige Details. So verschweigt er z. B. die Tatsache, daß 1944 mehrere Feuerwehrregimenter aus Berlin nach Kiel verlegt wurden und hier zum Einsatz kamen. Talanow berichtet in seinem Buch über das alte Kiel in einigen wenigen Sätzen über organisatorische LS- Maßnahmen aus der Zeit vor Beginn des Krieges und über Maßnahmen zur Sicherung und Bergung von Kulturgütern. Duggen berichtet in zwei Abschnitten ihrer Arbeit über das Kieler Rote Kreuz von Ereignissen aus der Zeit zwischen 1933 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Schwerpunkt ihrer Darstellung sind Berichte von Zeitzeugen über ihre Tätigkeit im Roten Kreuz und ihrem Einsatz während des Krieges. Über die Organisation des Roten Kreuzes im Luftschutz sind in den entsprechenden Kapiteln nur wenige Einzelheiten enthalten.
Die Behandlung und der Verlust von Kulturgütern in Kiel während des Krieges sind aus einer Reihe von Quellen und Dokumentationen zu erschließen. Über die Verluste der Kieler Kirchen besitzt das Nordelbische Kirchenarchiv reichhaltiges Quellenmaterial. In den Akten sind die zerstörten Gebäude, die vernichteten Bibliotheken, die Verluste an Glokken und anderem Kirchenmaterial dokumentiert. Die „Dokumente deutscher Kriegsschäden. Evakuierte, Kriegssachgeschädigte, Währungsgeschädigte“ und die beiden Bände „Kriegsschicksale deutscher Architektur“ enthalten umfangreiche Angaben über die Verluste von Kulturgut, wie z. B. Büchereien, sowie über die Zerstörung wertvoller Gebäude in Kiel.
Der Luftschutz in Kiel
Die Organisation des Luftschutzes
Allgemeines
Die Notwendigkeit, die deutschen Städte vor Luftangriffen zu schützen, war bereits im Ersten Weltkrieg erkannt worden. Doch nach 1918 konnte man in der neuen Republik das Problem nicht anpacken. Aktiver Luftschutz war durch den Versailler Vertrag untersagt, und über Maßnahmen des passiven Luftschutzes machte man sich vorerst keine Gedanken. Denn die innen- und außenpolitische Situation des Reiches bereitete genügend Probleme, die vorrangig gelöst werden mußten. So blieb es bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten bei sachlichen und rechtlichen Behelfsmaßnahmen. 10
Danach änderte sich die Situation allerdings rasch und gründlich. Bereits am 05. Mai 1933 ging die Zuständigkeit für alle Belange des Luftschutzes auf das „Reichsministerium für die Luftfahrt“ über. Damit war eine zentrale Steuerung zur Bewältigung der künftigen Aufgaben gewährleistet. Am 05. Juli 1935 11 trat das Reichsluftschutzgesetz (LSchG) in Kraft. Den Auftrag zur Durchführung erhielt gem. § 1 Abs. 2 LSchG der „Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe (RdLuObdL)“. 12 Das Gesetz schaffte die notwendige organisatorische Grundlage, um von nun an alle natürlichen und juristischen Personen 13 des Deutschen Reiches für die Belange des Luftschutzes in die Pflicht zu nehmen. Sie alle waren von nun an „luftschutzpflichtig“. 14 Das Gesetz zwang damit alle Deutschen „ … zu Dienst- und Sachleistungen sowie zu sonstigen Handlungen, Duldungen und Unterlassungen [ … ], die zur Durchführung des Gesetzes erforderlich … “ 15 waren.
Die Spitzengliederung der Luftschutzorganisation
Der Luftschutz (LS) hatte gemäß § 1 der I. Durchführungsverordnung (DVO) des LSchG die Aufgabe, die Bewohner des Reiches und das Reichsgebiet vor feindlichen Luftangriffen zu schützen. Die dafür notwendigen Maßnahmen waren in der DVO grundsätzlich geregelt. Der § 2 der I. DVO definierte Fachgebiete 16 und ordnete die ihnen adäquaten Institutionen zu, welche mit den Durchführungsmaßnahmen betraut wurden. Die Institutionen selbst blieben fachlich selbständig, sachlich jedoch waren sie eng verzahnt, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.
Grundsätzlich bestand die gesamte Luftschutzorganisation aus 2 Teilen: dem hoheitlichen Luftschutz und dem Selbstschutz. Der hoheitliche LS war Aufgabe des Staates. Dazu gehörten der Luftwarndienst sowie der Sicherheits- und Hilfsdienst (SHD.). Die Aufgaben im Selbstschutz hatten die Behörden, Betriebe und Bürger selbst zu regeln und zu erfüllen. Der Selbstschutz gliederte sich in den Werkluftschutz, den Erweiterten Selbstschutz und den Selbstschutz. Der „Trennstrich“ zwischen dem Hoheitlichen LS und dem Selbstschutz waren das Werktor bzw. die Haustür. 17 Der LS der Wehrmacht und der „Besonderen Verwaltungen“ bildete einen eigenen Bereich. 18 Zu den „besonderen Verwaltungen“ gehörten die Reichsbahn, die Reichspost, die Reichswasserstraßenverwaltung, die Reichsautobahn, der Reichsarbeitsdienst, die SS-Verfügungstruppe und die SS-Junkerschulen. 19 Die Wehrmacht und die „Besonderen Verwaltungen“ regelten ihre LS-Maßnahmen in eigener Verantwortung, jedoch in Abstimmung mit dem RdLuObdL und nach Maßgabe der Erlasse seines Hauses.
Zur Bearbeitung der Angelegenheiten des zivilen Luftschutzes entstand im Reichsluftfahrtministerium eine besondere Abteilung, die „Luftwaffeninspektion 13 (L In 13)“. Sie war die zentrale Dienststelle für alle Belange des zivilen Luftschutzes im Reich. Die Inspektion war in 3 Abteilungen gegliedert. Abteilung 1 bearbeitete Führung und Einsatz sowie den LS- Warndienst. Abteilung 2 war zuständig für Organisation, Ausbildung des Sicherheits- und Hilfsdienstes (SHD.), Verwaltung, LS-Recht und Presse, und die Abteilung 3 befaßte sich mit Luftschutztechnik. Die wichtigste Aufgabe der Inspektion war die Beschaffung von Geldmitteln und Rohstoffen für den zivilen Luftschutz. Aber gerade die sachliche Ausstattung des zivilen Luftschutzes blieb weit hinter den Erfordernissen zurück. 20 L In 13 gab im Rahmen der Mobilmachungsvorbereitungen im Frieden, und später dann im Kriege sowieso, Dienstvorschriften und Weisungen für die Durchführung aller Belange des Luftschutzes heraus. 21 Ihre Weisungen waren für den Luftschutz in sämtlichen zivilen Institutionen, in den Dienststellen der „Besonderen Verwaltungen“ und in den Teilstreitkräften der Wehrmacht bindend. 22
Als weitere Spitzenorganisation entstand die „Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz“. Hier erfolgte die Ausbildung der Führungskräfte, die Erstellung von Schulungsmaterial, die Prüfung, Begutachtung und Entwicklung von neuen technischen Mitteln, sowie die Erteilung von Betriebsgenehmigungen für technisches Gerät zum Gebrauch im zivilen Luftschutz. 23
Die organisatorischen Grundlagen für den Luftschutz in Deutschland waren im großen und ganzen durch die Gesetze und Erlasse geschaffen worden. Doch der Wille, die Aufgaben anzupacken und die Gesetzestexte in die Praxis umzusetzen, der war offenbar bei niemandem so richtig vorhanden. Bis in die ersten Kriegsjahre hinein vernachlässigte man den passiven Luftschutz. Vielen Behörden und Dienststellen außerhalb der Fachinspektion im Luftfahrtministerium galt Luftschutz als störend, überflüssig und viel zu teuer. Bezeichnend dafür ist ein Vorgang im Kieler Rathaus im Jahre 1939. In einer Dezernentenbesprechung trug der Oberbaudirektor vor, daß die Stadt für die vordringlichsten Luftschutzmaßnahmen 1 Mio. RM aufbringen müsse. Der Oberbürgermeister (OB) stellte diesbezüglich fest, daß „ … die Stadt weder Geld noch Arbeitskräfte habe … “ und im übrigen „ … die Frage geklärt werden [muß], was wichtiger ist, Wohnungsbau oder Luftschutz … “. 24 Zu dieser offensichtlich weit verbreitenden Einstellung trugen vermutlich auch Görings Worte bei, nach denen „kein feindliches Flugzeug deutschen Boden überfliegen werde“. 25
Aus all dem resultierte, daß man nach dem Kriege über den Zustand des Luftschutzes zu Kriegsbeginn zu folgendem Urteil kam: „ … Schlechter Stand der Luftschutzvorbereitung. Mangelhafter Luftschutzraumbau. Nicht ausreichende Einsatzmittel … “. 26 Die Einstellung der Verantwortlichen zum Luftschutz änderte sich erst grundlegend, nachdem sich ab 1941 die Luftangriffe der Alliierten auf deutsche Städte häuften.
Der Luftschutzort
Die knappen Mittel für den zivilen Luftschutz zwangen schon frühzeitig zur Schwerpunktbildung. Dies erforderte, die Städte des Reiches nach dem Grad ihrer Luftgefährdung zu bewerten und entsprechend zu klassifizieren. Am 15. August 1934 erfolgte die geheime Festschreibung der Einteilung aller deutschen Städte in „Luftschutzorte“. Die Luftschutzorte stufte man wiederum nach dem Grad ihrer Luftgefährdung in Kategorien von I – III ein. 27
Kiel erhielt aufgrund seiner Bedeutung die Einteilung zum Luftschutzort der Kategorie I. 28 Kategorie I bedeutete, daß der Selbstschutz, der Erweiterte Selbstschutz, der Werkluftschutz und der Sicherheits- und Hilfsdienst (SHD.) auf- und ausgebaut wurden. Die Organe des SHD. erhielten eine zusätzliche Ausstattung durch den RdLuObdL. 29
Gemäß § 4 der I. DVO LSchG war der „Luftschutzort“ der Ortspolizeibezirk. 30 Dies war somit die unterste Ebene, auf der die Vorschriften des Gesetzes durchzuführen waren. Da das Gebiet der Ortspolizeibehörde Kiel jedoch nur eine geringe Ausdehnung hatte, versuchte 1937 der Kieler Polizeipräsident, in seiner Eigenschaft als Örtlicher Luftschutzleiter, alle Nachbargemeinden Kiels und die an der Förde gelegenen Orte in den „Luftschutzort Kiel“ einzubinden. Es sollte ein „Luftschutzort Groß Kiel“ geschaffen werden. Nach Ansicht des Polizeipräsidenten war es notwendig, die zivile Luftverteidigung des gesamten Raumes um die Förde herum unter einheitliche Kontrolle zu bringen, weil nur dadurch die Luftschutzmaßnahmen im gesamten Gebiet zu koordinieren seien. Das Gebiet sollte die Orte Laboe, Möltenort, Alt- und Neu-Heikendorf, Kitzeberg, Mönkeberg, Klausdorf/Schwentine, Elmschenhagen, Russee, Kronshagen, Suchsdorf, Schilksee, Strande und Bülk einschließen. 31 Die maßgebenden Institutionen in Kiel, der Oberpräsident in Schleswig sowie die zuständigen Kommandos der Luftwaffe und Marine unterstützten das Vorhaben. Doch der Vorstoß scheiterte. Am 14. Dez. 1937 wandte sich der Kieler Polizeipräsident daher erneut mit seinem Wunsch an den OB. 32 In seinem Schreiben stellte er zunächst fest, daß das Luftfahrtministerium den Antrag mit der Begründung abgelehnt habe, daß „ … zur Zeit genügendes Luftschutzmaterial für Kiel nur bei seinem bisherigen und nicht bei einem erweiterten Umfange der Stadt zur Verfügung stände … “. 33 Der Polizeipräsident bat den OB trotzdem, bei den laufenden Verhandlungen der Stadt mit dem Gauleiter über die Frage der Eingemeindungen, nochmals alle Aspekte des Luftschutzes, die für eine Ausdehnung des Stadtgebietes sprächen, mit in die Verhandlungen einzubringen. Er fügte eine Denkschrift bei, in der er sämtliche Argumente anführte, welche, aus seiner Sicht, diese Erweiterung zwingend machten. Letztlich war auch diesem Vorstoß kein Erfolg beschieden. Ein „Luftschutzort Groß- Kiel“ kam nicht zustande, und Eingemeindungen unterblieben weitgehend. Nur Elmschenhagen 34 wurde 1939 eingemeindet, alle anderen genannten Orte blieben selbständig.
Die Fachbereiche
Der Luftschutzwarndienst
Im Zentrum der Luftschutzorganisation, sozusagen als ihr Herzstück, stand der Luftschutzwarndienst (LS- Warndienst). Seine Meldungen bildeten die Grundlage für die Durchführung aller Luftschutzmaßnahmen.
Zunächst, seit dem Aufbau der Luftschutzorganisation im Reich ab 1933, gehörten der LS- Warndienst und der Flugmeldedienst zusammen. 1937 erfolgte die Trennung der Dienste, und die Luftwaffe übernahm den Flugmeldedienst als eigene Aufgabe. Der LS- Warndienst blieb eine eigenständige Organisation. Fachlich war er allerdings der L In 13 im Reichsluftfahrtministerium zugeordnet und unterstand damit faktisch dem RdLuObdL.





























