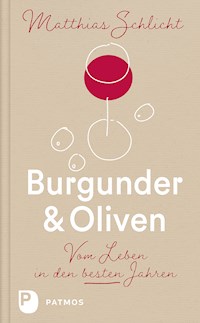
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was tun, wenn einem aufgeht, dass weniger Jahre vor einem als hinter einem liegen? Weitermachen, als wäre nichts? Von früher träumen und nicht begangene Sünden bedauern? Keine Lösung für einen reflektierten Genussmenschen mit großer Lust am Leben wie Matthias Schlicht! Nachdenklich und launig schaut er auf die Zeit, die vergeht und zugleich entsteht; denkt an Omas Küche auf dem Land, an Begegnungen und Abschiede, an ernüchternde Klassentreffen. Dabei sind seine pointierten Miniaturen voll hintergründiger Lebensweisheit eine Liebeserklärung an die Zeit, die uns geschenkt ist. >> Geschichten für Best-Ager >> hintergründige Lebensweisheit >> lesefreundliche Gestaltung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Schlicht
Burgunder und Oliven
Vom Leben in den besten Jahren
Patmos Verlag
Inhalt
Vorwort
oder Zum Wohle
Rumglas
oder Das letzte Hemd
Hurtigruten
oder Die Reise am Ende
C’est la vie
oder Der Fußballschuss des Lebens
Tantalus
oder Ganz nah dran
Kornbauer
oder Ein moderner Typ
Die Mörderin
oder Am Abgrund
Unglaublich
oder Demenz hat Bewusstsein
Fährmänner
oder Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise
Gartentaube
oder Unverhofft kommt doch
Sternenstaub
oder Ein Blick in die Unendlichkeit
Der Konfirmand
oder Was die Zukunft bringt
Dagobert
oder Lebensart
Früher
oder Blick in den Spiegel
Burgunder und Oliven
oder Lieber etwas Schmissiges
Hingefallen
oder Auferstanden
Zufrieden
oder Hier und jetzt
Kürzertreten
oder Nach vorn gehen
Freudenstadt
oder Eine Odyssee
Klassentreffen
oder The times they are a changin’
Der Kalender
oder Der nächste Tag ist auch noch da
Heil des Alltags
oder Rituale der Sicherheit
Fünfundzwanzig
oder Der Wein im Keller
Oma an der Gartenpforte
oder Die Macht von Gebeten
Rauer Stein
oder Erkenne dich selbst
Mustafa
oder Die Stimme des Herzens
Lothar
oder Champagner, Kreuz und Lächeln
Tod und Taufe
oder Wir wissen weder Zeit noch Stunde
Der letzte Tag
oder Tschüs
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Vorwort
oder Zum Wohle
Ich bin ein Genussmensch. Essen und Trinken sind für mich nicht Notwendigkeiten, um den Körper am Leben zu erhalten. Sie sind für mich die Perlen des Lebens. Der Kaffee am Morgen, das Croissant mit Himbeermarmelade, das gebratene Hühnchen zum Mittag mit warmem Kartoffelsalat, Petits fours zum Nachmittag, Brie de Meaux mit Oliven und Baguette sowie einem Glas Burgunder zum Abendessen: Das Leben kann so schön sein, auch ohne Managergehalt.
Meine Großmutter sehe ich immer nur kochend vor mir. Vor einem alten Kohleherd, der so richtig Hitze machen konnte. Ohne dass ich es wusste, hat sie mir in meiner Kindheit einen Impuls gegeben, den ich nie vergessen habe. Essen ist wichtig, Essen ist Gemeinschaft. Denn in der großen niedersächsischen Küche spielte sich das ganze Leben ab. Neben Herd und Kohlenkiste standen zwei Tische: einer für Großvater und seine Zeitung (neben Beck’s Bier und Köm) und ein riesiger Esstisch in der Mitte. Dort machte ich später als Grundschüler meine Hausaufgaben, während Oma neben mir in einer großen Plastikschüssel den Abwasch machte.
Unser Leben als Familie war einfach, schlicht. Urlaube gab es nicht. Aber dafür gab es einen großen Gemüsegarten. Er belebte das Essen jeden Tag aufs Neue. Man mag es heute kaum glauben: Um Champignons für den Salat zu bekommen, ging Oma auf die benachbarte Wiese. Alles andere steckte im Boden und musste nur ausgegraben werden: Kartoffeln, Möhren, Radieschen, Zwiebeln, Lauch. Ab dem ersten Frost gab es Grünkohl, eine Abwechslung von den Bohnen, die Oma mit Birnen und Speck machte. Eine genussvolle Kindheit für mich (von den Steckrüben einmal abgesehen), die mich geprägt hat.
Als Student mit eigener Küche in der kleinen Hamburger Studentenbude habe ich immer noch in den Küchenkinderschuhen gelebt. Selbst mit schmalem Bafög-Bezug konnte ich stets eine gute Tomatensauce zur Pasta machen oder beim Türken um die Ecke kleine Leckereien kaufen. Es muss nicht immer Kaviar sein. Einen Wein konnte ich mir meistens nur zum Wochenende leisten. Den billigsten Chianti in der Fiasco-Flasche vom Discounter, wobei ich immer überlegte, warum keine Kopfschmerztabletten mitgeliefert wurden. Aber alles hat seine Zeit. Die Lust am Leben samt Essen und Trinken ist geblieben.
Die Geschichten in diesem Buch sind voller sinnlicher Eindrücke. Einige sind tränen-salzig, andere prosecco-spritzig, daneben finden sich muskat-herbe und zuckersüße Abschnitte. Geschichten vom Leben in den besten Jahren. Diese Jahre können schon in der Kindheit beginnen, manche Menschen lernen sie erst später kennen. Für einige bedarf es schwerer Schicksalsschläge, um sich darauf zu besinnen. Für andere reicht schon ein schöner Sonnenuntergang am Meer. Oder ein Burgunder mit Oliven.
Rumglas
oder Das letzte Hemd
Eine wunderbare Erzählung von Siegfried Lenz trägt den Titel Leute von Hamburg. Als Erzähler sitzt der Autor in einer Kneipe und beobachtet die Menschen, die vorübergehen. „Hamburger sind Leute, die sich selbst für Hamburger halten“, weiß er. Er sieht eine langbeinige Reederstochter, einen jungen Kaufmann, einen ABC-Schützen, einen Umzugsunternehmer, einen Künstler, einen Hafenarbeiter, einen Senator und noch viele mehr. Doch der erste Blick auf die Vorbeigehenden reicht ihm nicht. Er will tiefer blicken. Hinter dem äußeren Schein möchte der beobachtende Erzähler das Innere der Menschen erkennen: ihre Geschichte, ihre Freude, ihre Angst, das Glück und das Heil. Um diese Tiefensicht zu erlangen, benutzt er ein „geschliffenes, altmodisches, langstieliges Rumglas“, das er sich – nach mehrmaligem Genuss des Inhalts – vor die Augen hält. Wie in einem Brennglas verdichten sich die äußerlichen Sinneseindrücke. Wie mit einem Fernglas kann er nun weiter schauen. Wie durch ein Prisma erkennt er die Brechungen des Lebens an den vorbeieilenden Passanten.
Ich habe kein altes Glas. Ich habe einen alten Satz. Den habe ich zuerst von meiner Großmutter gehört, als ich noch ganz klein war und neben ihrem Kochherd auf der Kohlenkiste saß. „Das letzte Hemd hat keine Taschen!“ Sie lehrte mich damit eine tiefe Weisheit, die ich als Kind natürlich noch nicht so ganz begreifen konnte. Ich wusste damals auch noch nicht, dass Oma mit diesem Satz einen Schlager von Hans Albers zitierte. Ein populäres Lied, das Albers 1957 im Film Das Herz von St.Pauli gesungen hat.
Erst sehr viel später – in meinem Beruf als Pastor und mit den Erfahrungen meiner längeren Lebensgeschichte – begann ich, Omas Satz wie das Glas von Siegfried Lenz vor die Augen zu halten. Wenn ich Begegnungen und Geschichten meines Lebens und Wirkens damit betrachte, erhalten die Erlebnisse eine andere Dimension. Eine neue Tiefenschärfe.
Wer weiß? Können auch die Lebensgeschichten meiner Leserinnen und Leser mehrdeutig werden? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Betrachten wir das Leben im Rückblick und zugleich im Ausblick auf diese Weise einmal neu.
Hurtigruten
oder Die Reise am Ende
Hinter der Adresse verbarg sich kein Haus, sondern eine noble Stadtvilla im Umland von Lüneburg. Der Vorgarten war eher ein Park, was sogar ich als Gartenarbeitsmuffel erkennen konnte. Ich klingelte an der großen Tür. Eine elegante Frau Anfang60 öffnete mir. Sie war die Witwe, die ihren Mann im Alter von 66Jahren „plötzlich und unerwartet“ verloren hatte. Ich war mit ihr zum Trauergespräch verabredet. Das Innere der Villa entsprach dem äußeren Eindruck: exquisit und elegant, mit viel Geschmack und Geld ausgewählt. Wir nahmen Platz. Die Frau bot mir Cream Tea und Scones an. Sehr geschmackvoll. Als Pastor auf dem plattdeutschen Land hatte ich so eine Atmosphäre noch nicht erlebt. Dann fing die Frau an zu erzählen. Mit ruhiger Stimme.
Sie hatte ihren Mann einst im Studium kennengelernt. Er war erfolgreicher Jurastudent, der gleich nach dem Examen eine Promotion anschloss. Ebenfalls erfolgreich. Sie heirateten; sie bekam eine Tochter und beendete ihr Studium. Er eröffnete eine Anwaltskanzlei und baute sie so geschickt auf, dass sie zu einer der erfolgreichsten juristischen Adressen in Hamburgs Süden geworden ist. 16 Mitarbeiter sind dort angestellt. Und ihr Ehemann war der Chef, der treibende Pol, die motivierende Unruhe, fleißig und zielstrebig. Es verging kein Tag, an dem er nicht mit Akten nach Hause kam. Sein Engagement zahlte sich aus. Auch finanziell. Die Villa ließen sie vor zehn Jahren bauen. Urlaub hat er mit seiner Frau nie gemacht. Im Sommer fuhren sie höchstens für einen Tag zum Eisessen an die Alster oder in Hagenbecks Tierpark. Manchmal gingen sie abends schick essen, meistens in Verbindung mit einem Geburtstag. Ansonsten: nur Arbeit. Wenn sie ihn nach Urlaub fragte, so lautete seine Standardantwort: „Mein Schatz, das machen wir, wenn ich mit65 in den Ruhestand gehe. Dann machen wir die große Reise.“
Er hat sein Wort gehalten, soweit er es konnte. Mit 65 ging er in den Ruhestand und keine Akten waren mehr im Haus zu finden. Stattdessen, wie versprochen, holte er Reiseprospekte. Das Ehepaar war sich noch nicht sicher: Machen wir eine Kreuzfahrt in der Karibik oder fahren wir zum Nordkap mit Hurtigruten? Eine Suite mit Außenbalkon, First Class, Wellness, mit allen Ausflügen, die man dazubuchen kann. Die Traumreise schlechthin. Fast zwei Wochen waren sie am Planen. Dann ging sie am letzten Freitagvormittag zum Frisör. Als sie wieder nach Hause kam, saß er auf dem Sofa. In sich zusammengesackt, beinahe so, als wäre er eingeschlafen, mit dem Prospekt der Hurtigruten in der Hand. Sie wusste sofort: Er ist tot. Der Arzt bestätigt es: ein plötzlicher Herzanfall, unvorhersehbar, sofort tödlich.
„Ja“, sagte die Witwe, „und nun sitzen wir hier.“ Von einem Moment auf den anderen strömten die teuren Möbel und Bilder und Teppiche ein Gefühl von Traurigkeit aus.
Die Haustür wurde geöffnet. „Das ist unsere Tochter“, sagte die Witwe. Elegant gekleidet und frisiert kam die junge Frau festen Schrittes auf mich zu und reichte mir die Hand. Als sie ihre Kostümjacke auszog, sagte die Witwe: „Sie hat es auch weit gebracht. Sie ist Personalleiterin bei einer großen Hamburger Firma.“ Ich bemerkte ihren Stolz. Die Tochter setzte sich und fragte, wie weit wir mit der Planung der Trauerfeier gekommen seien. „Noch gar nicht“, sagte ich, „Ihre Mutter sprach über Ihren Vater.“ „Oh“, sagte sie, „ich habe aber nicht viel Zeit. Heute Abend ist noch Vorstandssitzung. Wegen mir haben sie die etwas nach hinten gelegt, aber viel Zeit habe ich nicht.“ „Gut“, meinte die Mutter, „der Pastor und ich kriegen das auch allein hin.“ Und – schwupps – stand die Tochter auf und ging wieder, die Jacke über den Arm gelegt. Keine drei Minuten hatte das gedauert. Die Mutter nickte mir zu und meinte: „Sie hat viel von ihrem Vater.“ „Ja, ja“, sagte ich, aber gedacht habe ich nur: „O Gott!“
Die Trauerfeier wurde unter großer Anteilnahme der Familie, der Freunde, der Mitarbeiter und Arbeitskollegen abgehalten. Der Schrecken über diesen jähen Tod war manchen direkt ins Gesicht geschrieben. Wohl mancher wird gedacht haben: „Das hätte auch mich derart treffen können.“ So viele Dinge schieben wir immer wieder gern in die Zukunft, als hätten wir unsere Lebenszeit in Händen. Doch der Todestag steht nicht im Voraus in unseren Terminkalendern. Ich bin mir sicher, dass viele in der Trauergemeinde solche Gedanken hatten. Genauso bin ich mir sicher, dass wohl alle am nächsten Tag wieder so weitermachten wie vorher.
Ein paar Wochen später finde ich in meiner Post eine Ansichtskarte vom Nordkap. Die Witwe hat sie mir geschickt mit freundlichen Grüßen. Sie hat kurz nach der Trauerfeier ihre Tochter darauf angesprochen. Und die Tochter ist mit an Bord! „Es ist sehr schön hier“, steht auf der Karte, „und wir haben sogar das Nordlicht am sternklaren Himmel gesehen.“
C’est la vie
oder Der Fußballschuss des Lebens
Er war der Schrecken aller Schrecken. Alle Bösewichte in den James-Bond-Filmen hätten gegen ihn verloren. Er war arrogant. Er war gemein. Er war Südfranzose. Er war Choleriker. Er war mein Klassenlehrer. Französischunterricht mit ihm in der siebten Klasse. Mein Untergang stand nahe bevor, das war mir nach der ersten Woche vollkommen klar. Seine Pädagogik kam aus Zeiten, als der Film Die Feuerzangenbowle noch nicht gedreht war. Er ließ uns Schüler auswendiglernen; er saß auf(!) dem Pult und fragte uns dann ab. Jeder kam dran, und bei jedem Fehler wurde der Delinquent angeschrien. Ich verdanke diesem Lehrer, dass ich vor schreienden Menschen Angst habe. Zumindest für 30Sekunden, dann atme ich tief durch und kann ruhig reagieren. Aber Anbrüllen gehört für mich nicht zu den Grundformen der menschlichen Kommunikation. Im Französischunterricht war das nun aber die Regel. Ich fühlte mich wie im Film Spiel mir das Lied vom Tod, nur dass ich keine Mundharmonika dabei hatte. Dafür hatte ich Angst. Pädagogische Motivation pur.
So kam es, wie es kommen musste. Für die erste Klassenarbeit bekam ich ein „mangelhaft“. Die zweite Arbeit endete mit einem „ungenügend“. „Eine Sechs!“, blaffte mich der Lehrer an. Da er außerdem noch Klassenlehrer war, fügte er hinzu: „Zum Halbjahr kannst du ja zur Realschule wechseln. Kinder von Arbeitern passen da besser hin!“ Nur zur Vergewisserung: Wir waren im Jahr 1974! Kurz zuvor hatte Bundeskanzler Willy Brandt verkündet: „Auch Arbeiterkinder dürfen auf das Gymnasium.“ Meine Eltern haben ihm geglaubt.
Dieses Jahr hatte wenigstens ein Highlight. Es war das Jahr der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Abgesehen vom verlorenen Spiel gegen die DDR in Hamburg war ja auch alles in Ordnung. Nachmittags spielte ich allein im elterlichen Garten und versuchte, mein Dribbeln zu verbessern. Mein Berufswunsch stand fest: Ich werde Fußballnationalspieler! Gerd Müller konnte bestimmt auch kein Französisch. Das Ende meiner Karriere auf dem Gymnasium stand mir deutlich vor Augen. Ich schämte mich, weil ich wusste, dass meine Eltern (Arbeiter!) auf Urlaub verzichteten, damit ich die Buskarte und die Schulbücher bekommen konnte.
An einem Nachmittag übte ich Weitschüsse und Flanken. Ein Schuss hatte die perfekte Flugbahn. Leider landete der Ball in Nachbars Garten. Auf dem Grundstück war ein Mehrfamilienhaus, in das gerade ein junges Ehepaar eingezogen war. Meine Mutter hatte sie schon kurz gesehen und begrüßt. Mama meinte, einen österreichischen Dialekt vernommen zu haben. Nun lag mein Fußball drüben hinterm Zaun. Die neue Nachbarin war im Garten und reichte ihn mir lachend zurück. Ich bedankte mich höflich und sie fragte mich nach meinem Namen und wo ich denn zur Schule ginge. Geflissentlich antwortete ich. Sie fragte nach meinem Lieblingsfach. Ich sagte, dass ich eigentlich alles ganz interessant finde. „Nur nicht dieses doofe, blöde, bescheuerte Französisch. Das finde ich voll daneben!“ „Oh, là, là“, antwortete die Nachbarin, „ich bin Französin!“ So viel zum Thema „österreichischer Dialekt“.
„Komm doch mal rüber und bring dein Französischbuch mit; wir können ja mal gucken. Ich bin auch Lehrerin, aber nicht an deiner Schule.“ Schamrot wie eine Tomate holte ich mein Übungsbuch und ging zu ihr. Ich sollte ihr etwas vorlesen. Wir gingen eine Übungsaufgabe durch. „Seltsam“, sagte sie, „du kannst das ja!“ Ich war verblüfft. Wie konnte das sein bei Zensuren von „mangelhaft“ bis „ungenügend“? Die Nachbarin bot mir an, dass ich zweimal die Woche zur Nachhilfe rüberkommen könnte. Als ich das meiner Mutter berichtete, ging sie sofort zu ihr und kam erstaunt zurück. Die Nachhilfe sollte fünf Mark kosten. Nicht pro Stunde, sondern für beide Stunden in der Woche. Meine Mutter war erleichtert und ich auch. So wurde aus dem doofen Französisch im Laufe von wenigen Wochen ein interessantes Fach. Die dritte Klassenarbeit stand an. Ich bekam ein „gut“! Und kurz vor den Zeugniskonferenzen noch eine Arbeit. Wieder ein „gut“! Mein Lehrer war sichtlich erstaunt. Ich wurde also mit Bravour versetzt. Ich blieb weiter auf dem Gymnasium und machte schließlich mein Abitur. Fußballnationalspieler bin ich nicht geworden, sondern Pastor. C’est la vie.
Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, dann ist das Erlebte keine kleine lustige Lebensanekdote. Hätte ich damals den Fußball nicht über den Zaun verschossen, wäre die ganze Nachhilfe nicht in Gang gekommen. Mit Sicherheit wäre ich nicht versetzt worden, hätte die Schule gewechselt. Ich hätte andere Menschen kennengelernt, einen anderen Beruf gewählt. Meine Frau, die ich auf dem Gymnasium kennenlernte, wäre eine andere, ebenso wären andere Kinder aus der Ehe hervorgegangen. Wäre, wäre, hätte, hätte! Die Konjunktive häufen sich. Durch den Fußballschuss ist alles so gekommen, wie es nun ist. Wie ich nun bin.
Gern benutzen Menschen das Wort „Zufall“. Sie beschreiben damit das Gefühl, dass ihnen etwas zu-fällt, quasi vor die Füße fällt, ohne dass sie damit gerechnet haben. Der „Zufall“ ist eine so einschneidende Erfahrung, dass sich nicht nur Philosophen, sondern auch Physiker damit beschäftigen. Als Pastor stehe ich in der Gefahr, hinter dem Zufall den lieben Gott zu entdecken. Doch ich bin vorsichtig. Aus „Zufall“ sterben täglich Menschen, nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Wenn Gott das unerwartete Gute wirkt oder fügt, dann muss er auch das schreckliche Schicksal bestimmen. Aber wo bleibt dann noch unser freier Wille, wenn alles vorbestimmt ist? Fragen über Fragen.





























