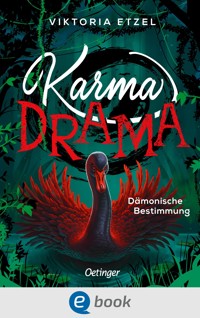8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein magischer Drache. Der 12-jährige Toby zieht mit seinem Vater Josh in das Haus seines verstorbenen Großvaters. In dem Tierheim, in dem der Großvater gearbeitet hat, lernt er die eigenwillige Ellie kennen. Ellie ist immer mit ihrem sprechenden Papagei Mango unterwegs. Als er sich ein eigenes Haustier aussuchen soll, entscheidet er sich für die langweilige Schildkröte Lou. Zu Hause kommt es zu ungewöhnlichen Vorkommnissen. Toby beobachtet ein mysteriöses Wesen im Garten, das Feuer spucken kann – es ist Lou. Denn Lou ist gar keine Schildkröte, sondern ein kleiner Drache. Toby erfährt, dass Lou ein Calidragos ist, ein magisches Haustier. Calidragos leben getarnt als normale Tiere mit Menschen zusammen, mit denen sie eine besondere Verbindung eingehen. Und Toby ist nicht der Einzige, der ein magisches Tier besitzt. Der Papagei von Ellie ist in Wirklichkeit ein Greif. Als dieser entführt wird, machen sich die beiden auf, ihn zu befreien. Bei ihrer Rettungsmission stoßen die Freunde auf zwielichtige Personen und ein dunkles Geheimnis. Wer entführt die Calidragos? Und warum? Eine spannende Jagd nach dem Bösewicht beginnt … Willkommen in der Welt der Calidragos! - Neue Reihe für Tierfans: magische Tierabenteuer für Kinder ab 10 Jahren. - Spannender Lesespaß: actionreiche Geschichte mit Tierwandlern, wichtiger Tierschutz-Botschaft und einer Prise Magie. - Magische Tiere: wenn normale Schildkröten zu echten Drachen und prächtige Papageien zu mächtigen Greifen werden. - Starke Themen: Freundschaft, Magie und Tierschutz. "Calidragos" – die Kinderbuch-Reihe für Tier- und Abenteuer-Fans macht tierisch Spaß. Eine actionreiche Geschichte kombiniert mit den Themen Magie, Freundschaft und Tierschutz. Ein tierisch spannendes Leseabenteuer für Kinder ab 10 Jahren. Eine magische Abenteuergeschichte für Fans von "Animox" und "Die Schule der magischen Tiere".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Magische Kreaturen. Ein Verbrecher, der Jagd auf sie macht.
Toby kann es kaum glauben: Seine langweilige Schildkröte ist in Wirklichkeit ein echter Drache! Und er ist nicht der Einzige, der ein Calidragos besitzt. Als der Greif seiner Freundin Ellie entführt wird, finden sie heraus: In den Schatten der Stadt lauert ein Verbrecher, der es auf die magischen Tiere von Bonfire Bay abgesehen hat! Toby und Ellie lassen sich auf eine gefährliche Rettungsmission ein und kommen dabei einem dunklen Geheimnis auf die Spur …
Für Mama und Papa – ihr seid der Wind unter meinen Flügeln
Kapitel 1
Bonfire Bay, 19. Juli
Schock am Hafen von Bonfire Bay: Seeungeheuer hat wieder zugeschlagen
Es klingt nach der Handlung eines abgedrehten Fantasy-Romans, aber was sich gestern Abend um 21:10 Uhr am Hafen von Bonfire Bay zugetragen hat, ist harte Realität. Augenzeugen berichten, wie das Ungeheuer von Bonfire Bay ein weiteres wehrloses Haustier angegriffen hat.
Helene L. (56 Jahre) geht nun seit acht Jahren jeden Abend mit ihrem kleinen Schnauzer Winnie am Ufer des Whisper River spazieren. Sie ahnt nicht, dass am Abend des 19. Juli diese Tradition für immer enden wird. Unter Tränen berichtet Frau L. völlig aufgelöst, was sich zugetragen hat: »Wir waren ein bisschen später als sonst unterwegs. Wissen Sie, mein armer Winnie verträgt die Hitze nicht mehr so gut. Er war so nervös, hat den Schwanz eingeklemmt und gewinselt. Er wusste es, wissen Sie. Hat die ganze Zeit zum Wasser runtergestarrt. Er war sonst so ein fröhlicher und ausgelassener Hund.« Frau L. räuspert sich und fährt mit zitternder Stimme fort: »Wir waren auf der Promenade, auf Höhe der Eisdiele, da passierte es. Ein … eine Art Fischschwanz oder so was tauchte plötzlich aus dem Wasser. Es schnappte sich meinen armen Winnie, und dann hörte ich nur noch ein Platschen.« An dieser Stelle schafft es Frau L. nicht, weiterzusprechen. Der Kummer über den Verlust ihres geliebten Hundes ist ihr deutlich anzusehen.
Lukas E. (30 Jahre) joggte zum Zeitpunkt des Angriffs einige Meter hinter Frau L. und Winnie. Er bestätigt die Aussage der aufgelösten Frau, dass ein fischartiges Wesen sich den Hund geschnappt hat: »Das ging alles so schnell! Ich bin mir nicht mal sicher, was genau ich gesehen habe«, sagt der junge Mann mit verstörtem Unterton in der Stimme. »Es sah aus wie ein Oktopusarm. Blau und grau geschuppt, wenn mich nicht alles täuscht, mindestens drei Meter lang.«
Doch nicht nur Herr E. hat den Vorfall beobachtet. Frau L.s panische Rufe hatten einige Passanten auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Die Ersthelfer berichten, dass man noch wenige Minuten nach dem Ereignis ein seltsames Blubbern auf der Wasseroberfläche beobachten konnte.
Diese Szene ist leider kein Einzelfall. Seit einem Jahr häufen sich die Berichte von fassungslosen Haustierbesitzern, die mit ansehen mussten, wie ihre geliebten Tiere in die kalten Tiefen des Whisper River gezogen wurden. Am häufigsten sind Hunde und Katzen betroffen, aber erstaunlicherweise waren auch zahme Hausratten, Papageien und, während des letzten Hafenfestes, sogar ein Esel unter den Opfern. Schon lange werden die Stimmen der Haustierbesitzer immer lauter. Sie fordern, dass etwas gegen das Ungeheuer von Bonfire Bay unternommen wird.
»Heute sind es unsere Tiere, aber was, wenn dieses Ding eines Tages beschließt, einen Menschen anzugreifen?«, sagt Bonnie Rippert, die Sprecherin des örtlichen Tierschutzvereins. »Es ist die Aufgabe des Bürgermeisters und der Polizei herauszufinden, was das für ein Tier ist, und sicherzustellen, dass es an einen geeigneten Ort gebracht wird. Zu seiner Sicherheit und unserer.«
Ricarda Sperling, Leiterin der berühmten Haustierklinik Goldene Schuppe, stimmt Frau Rippert zu. »Wir müssen für unsere Haustiere – unsere besten Freunde – da sein. Ich bitte Sie darum, das Ufer des Whisper River mit Ihren Haustieren zu meiden, bis wir neue Anhaltspunkte haben.«
Der Oberbürgermeister weigert sich, zu dem Thema Stellung zu beziehen. Einzig der Polizeichef war zu einer Aussage bereit: »Der Whisper River wurde bereits von einem Sondertrupp der Polizei untersucht, und man hat keine Spur eines großen Raubfisches oder etwas Ähnlichem finden können.« Sowohl für die Polizei als auch für den Bürgermeister scheint das Thema damit erledigt zu sein. Und ebenso für viele Einwohner von Bonfire Bay.
Nicht alle Einheimischen glauben an den kleinen Bruder des Monsters von Loch Ness, wie es auf Social-Media-Plattformen inzwischen genannt wird (siehe #nessieskleinerbruder). Obwohl sich die Augenzeugenberichte häufen, hat es bisher niemand geschafft, ein Foto oder ein Video des Monsters aufzunehmen. Und solange das niemandem gelungen ist, wird das skurrile Geheimnis um das Ungeheuer von Bonfire Bay weiterhin bestehen.
Kapitel 2
Vorsichtig setzte ich die wacklige Schraube auf die Befestigung und drehte sie mit geübten Handgriffen fest. Jetzt noch die Gummidichtung drum und fertig. Zufrieden betrachtete ich das fertiggestellte Teil. Mein neuer Modellbausatz nahm langsam Gestalt an. Wo war der Schraubenzieher? Suchend wühlte ich in der nächstbesten Kiste. In diesem Chaos war es ein Wunder, dass ich überhaupt etwas wiederfand.
»Toby?« Die Stimme meines Vaters klang von draußen herein. Ich seufzte. Damit war die Ruhe vorbei. Schon knarrte die alte Holztür, und Paps streckte seinen Kopf hindurch.
»Na? Alles klar?«, fragte er mit diesem besorgten Blick, den er hatte, seit wir vor zwei Wochen eingezogen waren.
»Alles bestens«, erwiderte ich und winkte mit dem gerade gefundenen Schraubenzieher. Paps schlenderte zur Werkbank und besah sich mein neuestes Werk: ein halb aufgebautes Modell des Space Shuttle Discovery.
»Cool«, brummelte er und stupste gegen den fertigen linken Flügel. Paps hatte auch ein ruhiges Händchen, aber er benutzte es fürs Zusammennähen von Wunden und nicht zum Handwerkeln.
Wachsam beobachtete ich ihn. Paps ließ sich in letzter Zeit immer öfter in meiner Werkstatt blicken, und meistens bedeutete das nichts Gutes.
»Also …«, begann er und wippte nervös auf den Fußballen auf und ab. Mein Magen verknotete sich. Das letzte Mal, als er sich so komisch aufgeführt hatte, hatten er und Mam verkündet, dass sie sich trennen wollten. Paps fuhr sich mit den Fingern durch seine langsam ergrauenden Haare.
»Was gibt’s?«, fragte ich, gespielt gelassen. Nur meine Hände verrieten mich. Mit zittrigen Fingern zog ich mir meine Brille von der Nase und putzte mit der Ecke meines T-Shirts ein paar Staubkörnchen von den Gläsern.
»Setz dich doch«, sagte Paps und deutete auf die einzige Sitzgelegenheit: den windschiefen alten Hocker, auf dem schon mein Opa Henry gesessen und gearbeitet hatte.
»Paps, was ist los?«, hakte ich nach. Ich hatte keine Lust auf seine Spielchen. Ich setzte mir meine Brille auf die Nase und konnte sein Gesicht wieder deutlich erkennen. Er vermied es, mir in die Augen zu schauen.
»Also schön …«, setzte er an. »Ich hab mir ein paar Gedanken über unsere neue Situation gemacht. Ich weiß, du liebst die Werkstatt«, sagte er und ließ den Blick über die vollgestopften Regale wandern. »Aber ich möchte nicht, dass du dich die ganzen Sommerferien hier verkriechst. Der Umzug nach Bonfire Bay war nicht leicht, das weiß ich. Du vermisst deine Freunde in Foxglove Valley und … na ja, du weißt schon«, brach er den Satz ab.
Ja, mir fehlte Foxglove Valley, aber nicht halb so sehr, wie Paps dachte. Klar, der Abschied von Mam war schwer, aber das war er schon immer gewesen. Ich war es gewohnt, dass sie monatelang an irgendwelchen Ausgrabungen im Ausland teilnahm. Sie würde mich am Ende des Sommers besuchen, mir irgendwas Cooles von ihrer Reise mitbringen, und dann war alles wie immer. Und meine Freunde waren nur einen Videoanruf entfernt. Es hätte mich um einiges schlimmer treffen können.
Ich war sogar irgendwie froh, dass wir den Sommer hier verbringen würden, wo ich den ganzen Tag in meiner neuen Werkstatt arbeiten konnte. Mein bester Kumpel Anton würde mir eine Kopfnuss verpassen, wenn er das hören würde. Er hatte immer versucht, mich mehr für Sport und so einen Kram zu begeistern, aber ich hatte zwei linke Füße, daran ließ sich nichts ändern. Jedes Mal, wenn ein Ball auch nur in meine Nähe kam, ging irgendwas kaputt. Das letzte Mal waren es die heiß geliebten Rosenbüsche unseres Nachbarn gewesen. Und dabei hatten wir nicht mal mit einem richtigen Ball gespielt. Anton meinte, beim Federballspielen könne nichts schiefgehen. Dass ich den Federball tatsächlich traf, er gegen den Kopf der schlafenden Nachbarskatze dotzte, die sich erschreckte und die Blumentöpfe von der Fensterbank fegte, die dann das Blumenbeet zermalmten, konnte ja keiner ahnen. Nach dieser Katastrophe hatte ich den Sport endgültig aufgegeben. Mir war egal, dass ich zwei linke Füße hatte, dafür hatte ich zwei rechte Hände … also im übertragenen Sinn. Basteln und Tüfteln waren total mein Ding.
»Toby?«
»Hm?« Mist, da waren meine Gedanken etwas zu weit gewandert. Paps sah mich erwartungsvoll an.
»Mir geht’s gut, ehrlich. Opas alte Werkstatt ist klasse. Hier kann ich richtig loslegen!« Mein Opa war ein leidenschaftlicher Erfinder gewesen. Alles, was ich konnte, hatte ich von ihm gelernt. Bevor Opa gestorben war, hatte ich fast jeden Sommer hier bei ihm verbracht, obwohl Paps nicht immer begeistert davon gewesen war. Er hatte es nie laut gesagt, aber ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass er mich von Bonfire Bay fernhalten wollte. Umso überraschter war ich gewesen, als Paps nach der Scheidung in Opas altes Haus nach Bonfire Bay ziehen wollte. Für mich war das der Jackpot schlechthin gewesen. Aber irgendwie glaubte Paps mir das nicht. Er war der festen Überzeugung, dass ich todunglücklich war und dass ich hier allein in der Werkstatt eingehen würde, wie eine Primel in der Wüste. Vielleicht fühlte er sich aber auch selbst einfach nicht wohl – oder er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er Opa die letzten Jahre so selten besucht hatte.
Na ja, egal, was der Grund war, seit dem Umzug hatten wir kaum ein anderes Thema als meine unaufhaltsame Vereinsamung und »Besessenheit« von Opas Werkstatt (so nannte Paps es jedenfalls). Wie üblich würde die Diskussion in einem stummen Blickduell enden, bei dem Paps irgendwann nachgeben würde, weil er zur Arbeit musste. Das dachte ich zumindest, aber diesmal schien Paps ein Ass im Ärmel zu haben, denn er grinste auf eine Art und Weise, die mir überhaupt nicht gefiel.
»Okay, okay, du hast gewonnen. Ich hab eingesehen, dass ich dich nicht so schnell aus dieser Werkstatt rausbekomme«, sagte er. Oje, Alarmstufe Rot! Er gab mir recht? Da war etwas faul, aber ganz gewaltig. Misstrauisch kniff ich die Augen zusammen. Was hatte er vor?
»Aber …« Aha, jetzt kam der Haken! »Aber wenn du dich hier schon einigelst, dann solltest du dabei wenigstens Gesellschaft haben.« Ich starrte ihn mit großen Augen an. Wollte er etwa jede freie Minute mit mir hier in der stickigen Werkstatt verbringen? Paps schien meinen Gesichtsausdruck richtig gedeutet zu haben, denn er schüttelte lachend den Kopf.
»Oh nein!«, grunzte er. »An mich hatte ich nicht gedacht.«
»Und an wen dann?«
Eine halbe Stunde später saßen wir im Auto und brausten Richtung Innenstadt davon. Paps war nicht mit der Sprache rausgerückt, aber er hatte mich so neugierig gemacht, dass ich, ohne zu maulen, ins Auto gestiegen war. Vielleicht wollte er mich mit den Kindern seiner neuen Kollegen verkuppeln? Ich schielte Paps von der Seite an. Nee, das passte nicht zu ihm. Er wusste sicher, dass ich mir meine neuen Freunde lieber selbst aussuchen wollte. Um mich abzulenken, drehte ich das Radio auf. Es lief der neueste Sommerhit.
Ich wühlte mein Smartphone aus der Tasche und schickte eine Nachricht an Anton. Das schlechte Gewissen nagte an mir. Ich hatte mich seit Tagen nicht gemeldet. Bestimmt dachte er, dass ich bereits mit meiner Werkstatt verwachsen war.
Ich
Paps hat ne Überraschung für mich
Ich trau dem Braten nicht
Anton
Mies
Irgend ne Ahnung, was es ist?
Ich
Kein Plan
Kann aber nichts Gutes sein
Als Antwort kamen fünf Lach-Emojis, ein Link und ein Foto von seinen dreckverschmierten Fußballschuhen. In Foxglove Valley hatte es die letzten Tage nur geregnet, und der Fußballplatz schien regelrecht unter Wasser zu stehen. Ich grinste. Gut, dass ich nicht dabei gewesen war. Ich hätte mich mit Sicherheit voll auf die Nase gelegt und wäre künftig von Schnappschüssen von meinem Schlammbad verfolgt worden.
Der Link gehörte zum Bonfire Chronicle. Ich klickte drauf, und sofort öffnete sich ein Artikel. Die reißerische Überschrift lautete: Schock am Hafen von Bonfire Bay: Seeungeheuer hat wieder zugeschlagen. Schnell überflog ich den Artikel.
»Die haben hier voll das Rad ab«, teilte ich Paps mit, nachdem ich Anton ein GIF von einem schockierten Gesicht geschickt hatte.
»Hm?«, machte Paps geistesabwesend.
»Hier am Hafen lebt angeblich ein Monster. Genau wie im See Loch Ness in Schottland. Gab’s das damals auch schon, als du klein warst?« Paps war in Bonfire Bay aufgewachsen, hatte es damals aber nicht erwarten können, die Stadt für sein Studium zu verlassen. Nachdem er und Mam sich kennengelernt hatten, stand es nie zur Debatte, dass er zurückkommen würde. Die beiden waren gemeinsam nach Foxglove Valley gezogen … aber na ja, das war ja nicht so gut ausgegangen, und nun hatte es ihn doch zurückverschlagen. Ob er mir jemals den Grund verraten würde, wieso er jetzt zurückgegangen war? Oder würde er mir weiterhin, bei jedem Versuch, eine Antwort von ihm zu bekommen, ausweichen?
»Nein. Da gab es immer nur Möwen, die dir die Pommes aus den Fingern geklaut haben, wenn du nicht gut genug aufgepasst hast«, sagte Paps achselzuckend.
Wer war bitte so blöd und ließ sich von einem Vogel das Essen klauen? Vermutlich dieselben Leute, die glaubten, dass ein Seeungeheuer im Whisper River lebte. Was für Trottel. Ich schloss den Browser und lehnte mich in meinem Sitz nach hinten.
»Mist! Hier hätten wir reingemusst!«, fluchte Paps auf einmal laut und riss das Lenkrad herum. Mit quietschenden Reifen bretterten wir um die Kurve und nahmen einem wild hupenden Postauto die Vorfahrt.
»’tschuldigung!«, brüllte Paps durchs offene Autofenster und erntete eine Reihe wüster Beschimpfungen. Während mein Herzschlag sich beruhigte, bog Paps erneut ab. Diesmal ohne einem anderen Auto die Motorhaube abzufahren. Der Asphalt verwandelte sich in holpriges Kopfsteinpflaster, und wir kamen nur noch mit Schrittgeschwindigkeit voran. Wir wurden so heftig durchgeschüttelt, dass meine Zähne aufeinanderschlugen. Paps’ Auto war eindeutig nicht für solche Straßen gebaut worden.
»Hier muss es doch irgendwo sein«, brummelte er vor sich hin und starrte suchend aus dem Fenster. Auch ich schaute neugierig nach draußen, aber viel gab es nicht zu sehen. Wir hatten die Innenstadt durchfahren und befanden uns inzwischen wieder am Stadtrand. Hier gab es nur noch vereinzelte kleine Läden: eine Eisdiele, eine Bäckerei, ein Schuhgeschäft und mehrere Klamottenläden … Wir erreichten das Ende der Straße, eine Sackgasse, und ich rechnete damit, das Paps wenden würde. Aber das tat er nicht.
»Wir sind da!«, rief er fröhlich und trat so heftig auf die Bremse, dass ich nach vorne ruckte und mir der Sicherheitsgurt schmerzhaft in die Brust schnitt. Meine Augen wanderten von einem Antiquitätengeschäft, das allen möglich Krimskrams im Schaufenster stehen hatte, weiter nach rechts und … oh nein … das konnte nicht sein Ernst sein!
Kapitel 3
»Komm schon! Es wird dir gefallen«, sagte Paps und riss vergnügt die Autotür auf. Da kannte er mich aber schlecht, wenn er glaubte, dass mir DAS gefallen würde. Alles in mir sträubte sich dagegen, aus dem Auto zu steigen. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und starrte blind nach vorne, aber Paps hatte kein Erbarmen mit mir.
Er öffnete meine Tür und winkte mich nach draußen. Zähneknirschend folgte ich seiner Aufforderung, und sofort traf mich eine Wand aus Hitze. Noch ein Grund mehr, wieder einzusteigen. Es waren mindestens 34 Grad heute, und Paps’ Auto hatte eine Klimaanlage. Mit noch immer vor der Brust verschränkten Armen blieb ich auf dem Gehweg vor dem Gartentor stehen.
»Dein Opa hat hier fast sein ganzes Leben lang gearbeitet«, sagte Paps mit stolzer Stimme. »Mich konnte er nicht überreden einzusteigen. Mir liegt mehr die Arbeit mit Menschen. Aber du warst ihm schon immer viel ähnlicher als ich. Vielleicht ist es ja was für dich?« Er legte mir einen Arm um die Schultern und schielte zu mir herunter. Ich erwiderte seinen Blick nicht. Blindlings starrte ich nach vorne. Mein Opa Henry hatte hier gearbeitet? Unmöglich! Er hatte nie auch nur ein Wort darüber verloren. Ich hatte immer angenommen, dass er Handwerker oder so was gewesen war. Aber wenn ich so darüber nachdachte, hatte Opa nie über seinen Beruf gesprochen.
»Toby?«
Ich seufzte. Paps und Opa zuliebe würde ich dem Ganzen eine Chance geben müssen. Ich konnte Paps’ hoffnungsvollen Hundeblick jetzt schon nicht mehr ertragen.
»Jaa, mal schauen«, presste ich mühsam hervor. Zwar war mir jeder andere Ort auf der Welt lieber als dieser, aber was sollte ich tun? Ich konnte mich dem nur stellen. Ich würde tatsächlich ein Tierheim betreten!
Schon klar, die meisten Kinder würden alles für ein Haustier tun, und der Besuch eines Tierheims ist für viele gleichzusetzen mit einem Vergnügungspark, aber für mich war es die schlimmstmögliche Katastrophe. Nicht nur, dass ich fast schon ein Teenager war, und jeder wusste doch, dass Teenager keine Zeit für Haustiere hatten (Haustiere waren echt uncool!). Nein, es gab noch einen Grund, warum ich kein Haustier wollte – Tiere konnten mich nicht leiden. Jede Katze fauchte mich an. Jeder Hund bleckte in meiner Gegenwart die Zähne, und erst die Tauben, die mich mit ihren mordlüsternen Augen anstarrten … Anton hatte früher ein Zwergkaninchen gehabt. Jedes Mal, wenn ich es auf dem Arm hatte, pinkelte es mich voll. Anton meinte, damit würde es zeigen, dass es sich bei mir wohlfühlte. Ich war da anderer Meinung. Die Katze unseres Nachbarn griff regelmäßig meine Beine an, fast zehn Jeans waren ihr zum Opfer gefallen. Okay, ich hatte sie öfters aus Versehen mit irgendwelchen Bällen getroffen, aber deswegen musste sie nicht gleich so ausrasten.
Hatte Opa mir deswegen nie von seiner Arbeit in diesem Tierheim erzählt? Weil er wusste, dass ich mit Tieren nichts anfangen konnte? Aber andererseits hatte Opa nicht mal ein eigenes Tier gehabt. Wieso sollte er dann sein Leben den Tieren widmen? Ob es ihm überhaupt Spaß gemacht hatte, sechsjährigen kleinen Mädchen Hamster anzudrehen? (Gab es in Tierheimen überhaupt Hamster?) Was hatte er bloß daran gefunden? Und wenn er es so toll gefunden hatte, warum hatte er nicht wenigstens versucht, mich daran teilhaben lassen? Wir waren immer nur zusammen in der Werkstatt gewesen. Ich hatte einen Schraubenzieher in der Hand gehalten, bevor ich laufen konnte, aber hiervon hatte ich keine Ahnung gehabt. Hätte er nicht in einer Schreinerei arbeiten können? Dann würde ich jetzt eine neue Säge als Freund bekommen und keinen Pudel oder so einen Blödsinn.
Ich betrachtete das Tierheim genauer. Es befand sich am Ende der Sackgasse und war viel größer als die Geschäfte. An der rechten Seite grenzte das Antiquitätengeschäft an das Grundstück und auf der linken Seite ein Klamottengeschäft für Frauen über fünfzig. Das Gebäude sah überhaupt nicht so traurig aus, wie ich mir ein Tierheim immer vorgestellt hatte. Hinter der hüfthohen Backsteinmauer blühten alle möglichen bunten Blumen im Vorgarten, und die Fassade strahlte in einem hellen Himmelblau, ebenso wie die alte Holztür. Über der Tür stand in goldener Glitzerschrift Zum Zaubernapf. Oh, wow. Kitschiger ging’s nicht mehr. Dann wanderte mein Blick weiter und blieb an der grellpinken Markise mit den dunkelblauen Blüten kleben. Au Backe. Dieser Laden sah wirklich nicht aus wie ein klassisches Tierheim, nur die Bilder von freundlich hechelnden Hunden und grimmig dreinblickenden Katzen im großen Schaufenster ließen vermuten, was einen hinter der Tür erwartete.
In diesem Moment schob sich das Gesicht eines Mädchens in meinem Alter über eins der Plakate. Es drückte sich die Nase an der Scheibe platt und winkte mir hektisch zu. Für einen Moment dachte ich ernsthaft darüber nach, hinter der Mauer in Deckung zu gehen. Das Mädchen sah noch wilder aus als die Fassade des Zaubernapfes. Es hatte lange blonde Haare, die es in zwei unordentlich geflochtenen Zöpfen trug. An ein paar Stellen hatte es sich blaue Blüten in seine Zöpfe gesteckt, und auf seinem Kopf thronte ein Cowboyhut. Aber das Merkwürdigste an seinem Outfit waren die braunen Lederhandschuhe. Es waren verdammte 34 Grad! Mein T-Shirt bestand schon zu neunzig Prozent aus Schweiß und war auf dem besten Weg dahin, mit meinem Körper zu verschmelzen. Hatten die da drin Temperaturen wie in der Tiefkühltruhe, oder warum trug dieses Mädchen im Hochsommer Handschuhe?
Es glotzte mich mit großen Augen an und grinste. Ihm fehlte ein Schneidezahn – auch das noch. Es winkte erneut und deutete auf die Tür.
»Komm rein!«, brüllte es durch das dicke Glas. Energisch schüttelte ich den Kopf. Schnell wandte ich mich um, um zu schauen, ob uns jemand beobachtete. Eine Gruppe von Kindern, alle in unserem Alter, etwa elf oder zwölf Jahre alt, stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor der Eisdiele. Ein Mädchen mit dunklen Haaren kicherte. Mist. Wenn die auf meine neue Schule gingen, vielleicht sogar in meine Klasse, durften die auf keinen Fall denken, dass ich das Cowgirl da drinnen kannte. Oder noch schlimmer: mit ihm befreundet war.
Nein, ich hatte es mir anders überlegt, in diesen komischen Laden würden mich keine zehn Pferde kriegen. Dachte ich zumindest, bis Paps die Tür öffnete und das kleine Glöckchen, das über der Tür hing, die ganze Nachbarschaft zusammenbimmelte. Die Gruppe vor der Eisdiele drehte sich wieder in unsere Richtung.
»Paps«, zischte ich verzweifelt. Aber Paps ignorierte mich. Vergnügt pfeifend marschierte er durch die Tür. Ich hatte nun zwei Möglichkeiten: 1. weglaufen, und zwar weit; 2. reingehen und mich von dem Mädchen bequatschen und mir einen Wellensittich oder so was aufschwatzen lassen. Möglichkeit 1 kam mir deutlich verlockender vor, aber da erschien Paps’ Kopf schon wieder in der Tür, und sein Blick verriet mir, welche Option er bevorzugte. Außerdem schaute das dunkelhaarige Mädchen vor der Eisdiele erneut zu uns herüber. Besser, ich verschwand von der Bildfläche, bevor es sich mein Gesicht merken konnte. Also, auf in den Kampf. Ich schluckte und hastete durch den Vorgarten auf die Tür zu.
Drinnen erwartete mich der Geruch von vielen Tieren, die auf engem Raum miteinander leben – wie soll ich sagen: sehr würzig. Es roch nach nassem Hund (warum auch immer, es hatte hier seit zwei Wochen nicht ein Mal geregnet), nach Katzenfutter (war das Fisch? Würg!), nach Heu (okay, das ging noch) und nach etwas Blumigem, das ich nicht benennen konnte. Es erinnerte mich ein bisschen an das Chili con Carne von meinem Paps. Irgendwie feurig scharf und auch süßlich – ein bisschen wie Eukalyptus, aber doch anders.
Ich schüttelte leicht den Kopf und blinzelte. Das Tierheim war von innen noch viel größer, als es von außen vermuten ließ. Die Wände waren in einem freundlichen Gelb gestrichen, aber man sah nicht viel von ihnen, weil sie von Aquarien, Terrarien, Käfigen und Regalen mit Tierzubehör bedeckt waren. Außerdem war es laut. Es gurrte, schnurrte und fiepte aus jeder Ecke.
»Hallo!«, brüllte mir auf einmal eine hohe Stimme direkt ins Gesicht. Das Mädchen mit dem Cowboyhut war vor mir aufgetaucht. Entsetzt machte ich einen Satz nach hinten. Das Mädchen war nicht allein. Auf seiner rechten Schulter saß ein grün-gelb-orange gefiederter Papagei, mit einem gefährlich aussehenden Schnabel, mit dem er leise klackerte, als würde er sich über mich lustig machen. In welchen Albtraum war ich hier nur hineingeraten? Das Mädchen starrte mich mit einem breiten Grinsen an. Ich wusste nicht, was mir unangenehmer war: sein Dauergrinsen oder der durchdringende Blick des Papageis. Verlegen schaute ich zur Seite und schob meine Brille auf meiner schweißnassen Nase ein Stück nach oben. Hier drin war es natürlich nicht kühl. Keine Ahnung, wie das Mädchen das mit den dicken Handschuhen aushielt. Es sah mich erwartungsvoll an.
»Hallöchen!«, mischte Paps sich ein. Er warf mir einen belustigten Seitenblick zu. »Toller Vogel! Ich habe vorhin angerufen. Mein Name ist Josh Decreas, und das ist mein Sohn Toby. Er ist ein wenig schüchtern.« Väterlich legte er mir die Hand auf die Schulter, aber ich schüttelte sie ab. Oh Mann. Nur mein Vater schaffte es, mich vor dem merkwürdigsten Mädchen der ganzen Stadt zu blamieren. Ihn schien das jedoch gar nicht zu interessieren.
»Ich heiße Ellie«, strahlte sie Paps an. »Und das ist Mango. Er … ist ein Sonnensittich«, fügte sie zögernd hinzu. Ich stutzte, irgendwas daran, wie sie das sagte, klang merkwürdig. »Mein Großvater hat mir gesagt, dass wir Besuch erwarten«, redete sie schnell weiter. Ich konnte nicht anders, als die ganze Zeit auf ihre Zahnlücke zu starren. Wie sie den Zahn wohl verloren hatte?
»Komm, ich führe dich rum!«, riss sie mich aus meinen Überlegungen und packte mich am Arm, als würden wir uns schon ewig kennen. Ich warf Paps einen Hilfe suchenden Blick zu, aber er grinste inzwischen genauso breit wie Ellie.
»Hier vorne sind die Kleintiere«, plapperte sie drauflos. »Also, Fische, Seesterne, Hamster, Meerschweinchen, Wellensittiche und so was.« Während sie sprach, deutete sie in alle möglichen Richtungen. Ich versuchte, mich umzuschauen, aber da zerrte sie mich schon weiter. Sie bewegte sich genauso hektisch, wie sie sprach. Mango begann, bedenklich zu schwanken. Er grub seine Krallen in ihre Schulter, um nicht herunterzurutschen.
»Langsam! Langsam!«, krächzte er. Vor Staunen klappte mir fast der Mund auf. Nicht zu fassen, der konnte ja sprechen! Während ich Mango neugierig musterte, dirigierte Ellie mich zu einem blank polierten Holztresen, auf dem eine altertümliche Kasse stand. Direkt hinter dem Tresen hing ein bunt geblümter Vorhang vor einem Durchgang. Ellie schob mich hindurch, und erneut verblüffte mich der Zaubernapf. Hier hinten war ein gewaltiger Raum mit einer offenen Glasfront, die zu einem grün bewachsenen Hinterhof führte. Na ja, Hinterhof war stark untertrieben, die Fläche war größer als unser Garten. Ein paar bunt gestrichene Schuppen und Ställe befanden sich dort. Außerdem konnte ich eingezäunte Bereiche mit Spielzeug und sogar eine Rasenfläche erkennen. Und überall wuselten Katzen und Hunde in jeder Größe, Farbe und Form herum. Am liebsten hätte ich mich hinter Ellie versteckt. Warum war keins dieser Tiere in einem Zwinger? Wenn diese Viecher sich gleich alle auf mich stürzen würden, hätte ich sicher schlechte Karten. Vielleicht würden sich die Katzen ja Mango vornehmen, und das wäre meine Chance, unbemerkt zu verschwinden. Doch komischerweise beachteten die Tiere weder Mango noch mich. Nur ein paar von ihnen warfen mir einen interessierten Blick zu, aber dann machten sie weiter mit Schlafen, Fressen, Spielen und was Tiere sonst noch so tun.
»Ich glaub, hier hinten finden wir nichts für dich«, sagte Ellie. Überrascht schaute ich sie von der Seite an. Ich hätte schwören können, dass sie mir gleich drei Welpen auf den Arm packen und mich so lange zutexten würde, bis alle ein neues Zuhause bei mir hatten.
»Komm, ich weiß genau, was du brauchst.« Sie zog mich zurück in den vorderen Raum. Dort war Paps inzwischen in ein Gespräch mit einem älteren Mann vertieft. Er hatte lange weiße Haare, die er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Seine Füße steckten in schweren Stiefeln, und er trug einen gemütlich aussehenden Overall. Das musste Ellies Großvater, der Inhaber des Zaubernapfs, sein. Die beiden Männer drehten sich zu uns um, und Paps machte eine enttäuschte Miene. Er hatte offenbar ebenfalls damit gerechnet, dass ich mit drei Welpen auf dem Arm zurückkommen würde. Ellies Großvater hingegen lächelte mich freundlich an. Sein braun gebranntes Gesicht erinnerte mich an meinen Opa, und ich fühlte einen kleinen Stich in der Magengrube. Ich vermisste ihn schrecklich. Verunsichert schaute ich zur Seite und rückte meine ohnehin schon perfekt sitzende Brille zurecht.
»Amadeus Prince«, stellte Ellies Großvater sich mit seiner tiefen Bassstimme vor und brach damit die peinliche Stille. Er streckte mir seine große Hand entgegen, in der meine förmlich verschwand.
»Toby«, sagte ich und kam zum ersten Mal, seit wir den Laden betreten hatten, zu Wort.
»Und habt ihr schon etwas gefunden?« Amadeus sah zwar mich an, ich wurde aber das Gefühl nicht los, dass er eigentlich mit Ellie gesprochen hatte.
»Nein, das Beste hab ich ihm ja noch gar nicht gezeigt«, sagte sie mit verschwörerischer Stimme. Oje. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, was dieses Mädchen unter dem Besten verstand. Wahrscheinlich würde sie mir gleich eine Giftschlange um den Hals hängen oder ein Chinchilla auf den Kopf setzen. Ich rechnete sogar mit einem zahmen Waschbären oder einer Tarantel. Ich hatte das eigenartige Gefühl, dass im Zaubernapf alles möglich war.
»Ich denke, wir sollten uns erst einmal in Ruhe die Hunde anschauen. Katzen sind ja eher nicht so dein Ding. Aber ich denke, mit einem Hund könntest du dich gut anfreunden. Wir haben jetzt auch viel mehr Platz und den großen Garten«, mischte Paps sich ein.
Ellie öffnete den Mund, als wollte sie widersprechen, aber Amadeus knuffte sie in die Seite.
»Da geht es lang, oder?«, fragte Paps, der davon nichts mitbekommen hatte. Er stiefelte los, und wir drei hatten keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Ellie hatte einen sauren Gesichtsausdruck aufgesetzt, und zum ersten Mal war sie mir sympathisch.
Kapitel 4
Es war hoffnungslos. Der Zaubernapf beherbergte laut Amadeus zurzeit 24 Hunde. Das waren echt verdammt viele, und jeder von ihnen war einzigartig. Von der riesigen Dänischen Dogge bis zum kleinen Dackel war alles dabei: faule, alte, aktive, sabbernde, verschmuste … Hunde! Paps bestand darauf, dass ich mir alle genau ansah, sie streichelte und ihnen Leckerlis gab. Trotzdem wollte der Funke nicht überspringen. Okay, diese Hunde waren definitiv netter zu mir, als es jemals ein anderer Hund gewesen war (immerhin hatte ich noch alle meine Finger), aber irgendetwas stimmte nicht. Es fühlte sich an, als würden die Hunde und ich uns magnetisch abstoßen. Nach über einer Stunde waren wir alle frustriert.
»Wollen wir nicht noch einmal rübergehen?«, fragte Ellie in einem angespannten Ton, als ich zum fünften Mal versuchte, einem Beagle den Kopf zu kraulen, und er sich vor mir wegduckte.
»Eine gute Idee«, stimmte Amadeus ihr zu. »In der Kleintierabteilung bist du wahrscheinlich besser aufgehoben.« Andere Leute hätten das vermutlich als Beleidigung empfunden, aber ich musste Amadeus zustimmen. Je kleiner das Tier, desto kleiner die Gefahr, dass wir uns gegenseitig abmurksten. Vielleicht war Paps jetzt bereit, zu einem Goldfisch Ja zu sagen.
»Ich glaub auch, das wäre das Beste«, sagte ich zu Paps und versuchte, nicht allzu erfreut darüber zu klingen, dass ich um das Thema Hund herumgekommen war. Grummelnd stimmte er zu. Selbst er musste einsehen, dass der Versuch, mich mit einem Hund anzufreunden, zwecklos war.
»Und eine Katze wäre nicht vielleicht …?«
»Nein, Paps! Keine Katze!« Mit einem Hund hätte ich mich gerade noch abfinden können, aber eine Katze schaute einen immer so an, als wüsste sie genau, was man gerade dachte. Unheimliche Viecher. Besonders die eine, die da in der Ecke saß. Diese Katze war um einiges größer als die anderen und hatte ein cremefarbenes Tigermuster. Seit wir hier waren, hatte sie sich keinen Zentimeter von der Stelle gerührt. Sie saß nur da, den Schwanz um die Pfoten gekringelt, und beobachtete uns mit ihren hellen gelben Augen. Ein Schauder überlief mich bei dem Gedanken daran, sie mit nach Hause zu nehmen.
»Lasst uns nach vorne gehen«, sagte ich bestimmt und schob Paps, der leise protestierte, zum Durchgang.
»Also, was h-hast du dir v-vor-vor…«, stammelte Ellie.
»Vorgestellt!«, half Mango ihr weiter.
»Genau.« Ellies Wangen liefen dunkelrot an, aber mir war ihr Stottern egal. Ich war viel zu fasziniert von Mango. Wie hatte sie ihm das beigebracht?
»Was Ruhiges«, sagte ich und betrachtete dabei weiter den Vogel.
»Da hab ich …«, setzte Ellie an.
»Guck dir mal die hübschen Meerschweinchen an!«, unterbrach Paps sie. Er zerrte mich zur linken Seite und deutete auf die Meerschweinchen und Hamster, die sich ins Heu eingebuddelt hatten oder aufgeregt in ihren kleinen Ställen herumwuselten.
»Kein Meerschweinchen«, krächzte Mango. Und wieder erntete der Vogel einen überraschten Blick von mir.
»Was Mango sagt«, stimmte ich ihm achselzuckend zu. Was sollte ich mit einem Meerschweinchen anfangen? Die machten nur Lärm und Dreck. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Vogel auf meiner Seite sein würde? Anscheinend war er der Vernünftigste hier. Sehnsüchtig schielte ich hinüber zu den Aquarien. Mit ein paar Fischen würde ich mich anfreunden können. Alle paar Tage füttern, kaum was zum Saubermachen, und sie gaben keine nervigen Geräusche von sich. Das Fiepen der Meerschweinchen tat mir jetzt schon in den Ohren weh. Bevor Paps widersprechen konnte, zog Ellie mich in die andere Ecke. Allerdings nicht zu den Fischen, sondern zu den Terrarien.
»Ich will keine Schlange … oder einen Gecko oder so was!«, protestierte ich und stemmte die Beine in den Boden.
»Kein Gecko!«, meldete sich erneut Mango zu Wort.
»Sei still«, zischte Ellie, als ob der Vogel sie verstehen könnte.
»Hör auf den Vogel!«, bellte ich, wirbelte auf dem Absatz herum und steuerte die Aquarien an. »Wie wär’s mit Fischen, Paps?«
»Aber die sind doch so langweilig!«, rief er.
»Genau! Ich wüsste da was viel Besseres!«, blökte Ellie dazwischen.
»Kein Gecko!«, riefen Paps, Mango und ich wie aus einem Mund, äh, Schnabel. Paps packte mich am rechten Arm, Ellie am linken, und Mango schnappte nach meinem Ärmel.
»Ich will einen verdammten Fisch!«, verlangte ich und riss mich los. Ich machte einen Schritt zurück … und übersah die Katze. Die cremefarbene Katze aus dem Hinterzimmer war uns nach vorne gefolgt und hatte es sich unbemerkt zwischen meinen Füßen gemütlich gemacht. Ich trat auf ihren Schwanz, sie stieß ein markerschütterndes Fauchen aus und schlug mir ihre Krallen in die Wade.
»Ahhhh!«, schrie ich laut auf und stolperte gegen Ellie.
»Krahhhh!«, machte Mango auf ihrer Schulter. Erschrocken flatterte er mit den Flügeln und erwischte mich im Gesicht. Panisch duckte ich mich nach rechts weg und krachte mit dem Kopf gegen die Scheibe eines Terrariums. Paps brüllte, Ellie schrie, und Mango gab auch noch seinen Senf dazu.
»Beruhigt euch!«, ertönte da auf einmal die tiefe Stimme von Amadeus. Während ich mir die pochende Stelle an meinem Schädel rieb, hob Amadeus die fauchende Katze hoch und strich ihr beruhigend über den Kopf.
»Ist ja gut, Bastet«, brummte Amadeus. Sofort fing die Katze an zu schnurren und kuschelte sich in seinen breiten Armen zu einem Fellknäuel zusammen. Ellie versuchte, den aufgeregten Mango zu besänftigen. Und Paps sah aus, als hätte er schon genug mit sich selbst zu tun. Also rappelte ich mich allein wieder auf. Mit der einen Hand betastete ich die beachtliche Beule an meinem Kopf. Immerhin war meine Brille nicht zu Bruch gegangen. Ich zog mich am Rand des Terrariums nach oben. Dabei fiel mein Blick auf den Bewohner des Glaskastens. Überrascht stellte ich fest, dass weder eine gemeingefährliche Tarantel noch eine Schlange oder ein Gecko darin lebten.
»Kein Gecko«, krächzte Mango leise.
Ich musste schmunzeln. Er hatte recht. In dem feinen weißen Sand neben einem winzigen Teich saß eine tellergroße Schildkröte. Sie hob ihren faltigen Hals und sah mich aus ihren schwarzen Knopfaugen interessiert an. Ich hatte noch nie eine Schildkröte aus der Nähe gesehen und keine Ahnung gehabt, dass sie so hübsch aussehen konnten. Ihr Panzer leuchtete in dunklen Blautönen, und an manchen Stellen überzog ihn ein fast schon goldener Schimmer.
»Wow …«, murmelte ich ehrfürchtig und beugte mich tiefer hinab. Die Schildkröte reckte mir ebenfalls ihren kleinen Kopf entgegen. Ihr Blick hatte etwas seltsam Hypnotisches. Die Luft um das Tier schien regelrecht zu flimmern. Obwohl der Glaskasten geschlossen war, meinte ich, eine Hitze auf der Haut zu spüren, die die Schildkröte verströmte. Oh Mann, ich musste echt einen heftigen Schlag abbekommen haben.
»Das ist Loubarian«, hörte ich Ellie wie aus weiter Ferne sagen. Das war ein mächtiger Name für eine Schildkröte … »Er ist schon ein paar Jahre bei uns. Wir haben bisher kein passendes Zuhause für ihn finden können.« Ellies Stimme verschwamm zu einem Hintergrundrauschen. Mein Blick klebte an den schwarzen Knopfaugen der Schildkröte, sie öffnete ihr Maul, und dann … packten mich auf einmal Paps’ Hände an den Schultern und zogen mich ein Stück nach hinten.
»Toby? Alles in Ordnung mit deinem Kopf?« Besorgt sah Paps mich an. Er versuchte, meine Haare zur Seite zu schieben und sich die Beule anzuschauen.
»Mir geht’s gut!«, sagte ich und wimmelte seine Hände ab. »Was hast du gerade gesagt?«, wandte ich mich an Ellie. »Zu der da.« Ich deutete auf die Schildkröte.