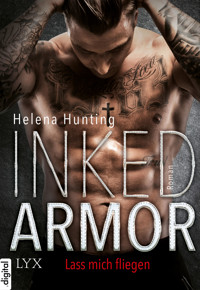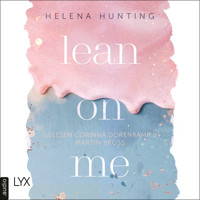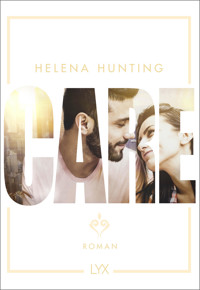
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mills Brothers
- Sprache: Deutsch
Nanny wider Willen
Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters muss Lincoln Moorehead nach New York zurückkehren, um von jetzt an - zähneknirschend - das Familienunternehmen zu führen. Mit dieser Aufgabe sollen auch der wilde Lebenswandel und das ungehobelte Auftreten Lincolns ein Ende finden - und um das sicherzustellen, wird ihm eine Aufpasserin zur Seite gestellt. Lincoln ist frustriert und verärgert darüber, zumal Wren Sterling nicht nur ziemlich streng, sondern auch verflucht sexy ist ...
"Helena Hunting ist auf dem allerbesten Weg, eine der großartigsten Stimmen der Romance zu werden!" Romantic Times
Band 5 der MILLS-BROTHERS-Reihe von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Helena Hunting
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Helena Hunting bei LYX
Impressum
HELENA HUNTING
CARE
Roman
Ins Deutsche übertragen von Beate Bauer
Zu diesem Buch
In den letzten Jahren hat Lincoln Moorehead für Non-Profit-Organisationen rund um die Welt gearbeitet. Für ihn ist es erfüllend, Menschen, die nur wenig haben, zu helfen. Dass das dann auch noch auf einem anderen Kontinent stattfindet, ist für Lincoln ein ziemlich großes Plus: Denn er ist am liebsten so weit wie nur möglich von seiner unliebsamen Familie entfernt. Doch als sein Vater überraschend stirbt, muss er nach Hause zurückkehren. Allerdings hat Lincolns persönliches Höllenkarussell noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht: Denn damit sein cholerischer Bruder das Familienunter nehmen nicht im Handumdrehen an die Wand fährt, wird Lincoln von seiner Großmutter dazu verdonnert, als CEO einzuspringen. Wohl oder übel muss er sich mit dieser Rolle abfinden, auch wenn sie überhaupt nicht zu ihm passt. Lincoln ist eigentlich der Typ, der lieber selbst anpackt, viel zu enge Shirts über zerschlissenen Jeans trägt und – vor allem – kein Blatt vor den Mund nimmt. Um aus diesem ungehobelten Klotz einen Vorzeige-CEO zu machen, bekommt Lincoln die PR-Beraterin Wren Sterling an die Seite gestellt. Sie soll als Anstandsdame seine Eskapaden zügeln, sein Erscheinungsbild aufpeppen und achtgeben, dass er Interviews höflich bestreitet. Für Lincoln ist das Ganze nicht nur lästig, sondern auch frustrierend, denn Wren ist äußerst streng und leider auch verflucht sexy …
1
WORAUF HABE ICH MICH DA NUR EINGELASSEN?
Wren
Ich gleite auf den Barhocker neben dem Holzfällerburschen, der aussieht, als hätte er sich in einen Anzug zu quetschen versucht, der ihm zwei Nummern zu klein ist. Er ist geradezu einschüchternd breit und kräftig gebaut, mit langen dunklen Haaren, die er unordentlich zu einer Art Man Bun hochgebunden hat. Sein Bart ist der feuchte Traum eines Hipsters. Seine finstere Miene lässt ihn allerdings so unnahbar wirken wie ein tollwütiges Stachelschwein. Trotzdem bin ich hier und lasse mich neben ihm nieder.
Mit trübem und irgendwie unstetem Blick schaut er zu mir herüber. Dann richtet er seinen Blick rasch wieder auf sein halbleeres Glas. So, wie er die Schultern hängen lässt, unkoordiniert nach seinem Glas greift und es an seine Lippen hält, muss er ziemlich betrunken sein. Ich bestelle ein Wasser mit Kohlensäure, einem Schuss Cranberrysaft und einer Limette.
Was ich wirklich gebrauchen könnte, ist eine Tasse Lavendel-Pfefferminz-Tee und mein Bett, aber stattdessen sitze ich neben einem betrunkenen Mann in seinen Dreißigern. Mein Leben ist offenkundig echt glamourös. Und nein, ich bin keine Hostess, obwohl ich in diesem Moment das Gefühl habe, dass meine Sittlichkeit ähnlich gefährdet ist.
»Harter Tag?«, frage ich und nicke zu der Flasche hin, die mehr als halbleer ist. Als er sich vor einer Stunde an die Bar gesetzt hat, war sie noch voll. Ja, ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet und auf den richtigen Moment gewartet, etwas zu unternehmen. Seit er hier sitzt, hat er zwei Frauen abgewiesen, die eine in einem Kleid, das auch als Discokugel hätte durchgehen können, und die andere mit einem so tief ausgeschnittenen Oberteil, dass ich beinahe ihren Bauchnabel gesehen hätte.
»Könnte man so sagen«, nuschelt er. Er hat die Wange auf die Faust gestürzt, und seine Augen sind nur noch Schlitze. Ich kann noch immer das leuchtende Blau erkennen, obwohl sie beinahe geschlossen sind. Er lässt sie prüfend über mich gleiten. Ich trage ein schlichtes schwarzes Kleid, das hochgeschlossen und knielang ist. Nicht im Ansatz so provozierend wie Discokugel oder Madame Nabelschau.
»Löst das Ihre Probleme?« Ich schenke ihm ein ironisches Lächeln und zeige mit dem Kinn in Richtung seiner Flasche Johnnie Walker.
Er lässt den Blick langsam zur Flasche gleiten. Das gibt mir die Gelegenheit, ihn mir genauer anzusehen. Zumindest das, was man von seinem Gesicht unter dem Bart erkennen kann.
»Nö, aber es hilft, den ganzen Aufruhr hier drin zu dämpfen.« Er tippt sich an die Schläfe und sagt ganz unvermittelt: »Mein Vater ist gestorben.«
Ich lege ihm eine Hand auf den Unterarm. Es fühlt sich komisch und irgendwie unheimlich an, weil es halb aufrichtiges, halb gespieltes Mitgefühl ist. »Das tut mir wirklich leid.«
Er blickt auf meine Hand, die ich rasch wegziehe, und konzentriert sich wieder auf seinen Drink. »Mir sollte es auch leidtun, aber ich denke, er war ein ziemliches Arschloch, weshalb der Rest der Welt ohne ihn vielleicht besser dran ist.« Er versucht, sein Glas erneut zu füllen, aber er zielt daneben und kippt den Whiskey stattdessen auf den Tresen. Ich hebe eilig meine Handtasche hoch und schnappe mir eine Handvoll Servietten, um die Sauerei wegzuwischen.
»Ich bin betrunken«, nuschelt er.
»Das war wohl der Plan, wenn man bedenkt, wie Sie das Zeug in der Flasche inhaliert haben. Ich bin echt überrascht, dass Sie nicht gleich nach einem Strohhalm gefragt haben. Wäre vielleicht eine gute Idee, zwischendurch was anderes zu trinken, damit es sich morgen früh nicht ganz so schlimm anfühlt.« Ich schiebe ihm meinen Drink hin und hoffe, dass er mich nicht wie die anderen Frauen in die Wüste schickt.
Er betrachtet mit zusammengekniffenen Augen mein Glas, eine Spur misstrauisch vielleicht. »Was ist das?«
»Cranberry und Soda.«
»Kein Alkohol?«
»Kein Alkohol. Bedienen Sie sich. Sie werden es mir morgen früh danken.«
Er nimmt das Glas und hält inne, als es zwei Zentimeter von seinem Mund entfernt ist. Um seine Augen bilden sich Fältchen, die mir verraten, dass er unter seinem Bart lächelt. »Soll das heißen, dass ich mit Ihnen an meiner Seite aufwachen werde?«
Ich ziehe eine Braue hoch. »Wollen Sie mich anmachen?«
»Scheiße, tut mir leid.« Er kippt den Inhalt meines Glases hinunter. »Ich habe nur Spaß gemacht. Außerdem bin ich so besoffen, dass ich kaum noch weiß, wie ich heiße. Wahrscheinlich wäre ich im Bett heute Nacht eh nicht zu gebrauchen. Ich sollte aufhören zu reden.« Er reibt sich mit der Hand das Gesicht und zeigt dann auf mich. »Ich würde Sie nicht anmachen.«
Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ich versuche es mit einer leicht angesäuerten Miene, weil es irgendwie wie eine Beleidigung klingt. »Gut zu wissen.«
»Verdammt. Ich will sagen, ich denke, Sie sind wahrscheinlich heiß. Sie sehen heiß aus. Ich will sagen attraktiv. Ich denke, Sie sind hübsch.« Er legt den Kopf schräg und blinzelt ein paarmal. »Sie haben hübsche Augen, sie sind alle vier wirklich bezaubernd.«
Diesmal lache ich – echt – und zeige auf die Flasche. »Ich denke, Sie sollten Ihrem Date hier für heute Abend Lebwohl sagen.«
Er stößt einen Seufzer aus und nickt. »Da könnten Sie recht haben.«
Er versucht, aufzustehen, doch sobald er mit den Füßen den Boden berührt, gerät er ins Taumeln und packt mich an den Schultern, um sein Gleichgewicht wiederzugewinnen. »Oha. Sorry. Jawohl, ich bin definitiv betrunken.« Sein Gesicht ist nur Zentimeter von meinem entfernt, und sein Atem riecht stark nach Alkohol. Daneben rieche ich einen Hauch frischer Seife und eine Spur Aftershave. Er lässt meine Schultern los und macht unsicher einen Schritt zurück. »So was mache ich eigentlich nicht.« Er zeigt unbeholfen auf die Flasche. »Ich gehöre eigentlich zu denen mit drei Drinks maximal.«
»Das ist wohl entschuldbar, wenn man den Vater verliert.« Ich gleite von meinem Hocker herunter. Obwohl ich für eine Frau groß bin und High Heels trage, ist er noch immer fast einen Kopf größer als ich.
»Kann schon sein, aber ich werde es morgen vielleicht trotzdem bereuen.« Er ist ziemlich wacklig auf den Beinen und schwankt auf der Stelle. Ich packe die Gelegenheit beim Schopf, hake mich bei ihm unter und führe ihn aus der Bar. »Kommen Sie, bringen wir Sie zum Aufzug, bevor Sie aus den Latschen kippen.«
Er nickt und gerät schon wieder leicht ins Wanken, so als hätte ihn die Kopfbewegung aus dem Gleichgewicht gebracht. »Ist wahrscheinlich das Beste.«
Er lehnt sich gegen mich, während wir uns durch die Bar schlängeln und er die zwei Stufen hinaufstolpert, die ins Foyer führen. Ich werde ihn nicht festhalten können, falls er zu Boden geht, aber ich lege trotzdem einen seiner riesigen Arme über meine Schultern und meinen um seine Taille, während ich ihn fast schnurgerade zu den Aufzügen führe.
»In welchem Stockwerk sind Sie?«, frage ich ihn.
»Penthouse.« Er lässt seinen Arm von meiner Schulter gleiten und streckt ihn ruckartig in Richtung der schwarzen Türen am Ende des Gangs aus. »Herrje, ich fühle mich wie auf einem Schiff.«
»Ist wahrscheinlich der viele Alkohol, der in Ihrem Gehirn herumschwappt.« Ich packe ihn am Ellbogen und helfe ihm, die letzten sieben Meter zum Penthouse-Aufzug zu torkeln.
Er starrt sekundenlang auf das Keypad und runzelt dabei die Stirn. »Ich kann mich nicht an den Code erinnern. Aber er wird auch per Daumenabdruck aktiviert.« Er stolpert vorwärts, lehnt seine Stirn an die Wand und versucht, seinen Daumen auf den Sensor zu legen, verfehlt ihn aber jedes Mal ein gutes Stück.
Ich lege eine Hand auf seinen unglaublich festen Unterarm. Dieser Mann ist gebaut wie ein Panzer. Oder ein Superheld. Einen Moment lang überdenke ich, was ich da vorhabe, aber er scheint ziemlich harmlos und stockbesoffen zu sein, weshalb er bestimmt keine Bedrohung darstellt. Außerdem bin ich geübt in Selbstverteidigung, was unter die Kategorie »mit allen Mitteln« fällt. »Kann ich helfen?«
Er rollt den Kopf, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt, während sein Blick über mein Gesicht huscht. »Bitte.«
Ich nehme seine Hand zwischen meine. Als Erstes bemerke ich, wie feucht sie ist. Abgesehen davon sind seine Fingerknöchel rau, mit winzigen Narben übersät und an ein paar Stellen mit Schorf bedeckt und seine Fingernägel ungleichmäßig lang.
»Ihre Hände sind so klein«, stellt er fest, als ich seinen Daumen auf das Sensor-Pad lege und draufdrücke.
»Ihre sind ungewöhnlich groß«, erwidere ich. Sie sind wirklich groß. Wie die Hände von Basketballspielern.
»Sie wissen, was man über große Hände sagt.«
Ich versuche, nicht mit den Augen zu rollen, aber für einen kurzen Moment frage ich mich, ob das, was er in seiner Hose hat, dem Rest von ihm entspricht. Und ob er vielleicht nicht nur im Gesicht so struppig ist. Ich verdränge die Vorstellung rasch, weil ich dabei würgen könnte. »Und das wäre?«
Um seine Augen bilden sich wieder Fältchen, und er schlägt sich vor die Brust. »Irgendwas mit große Hände, großes Herz.«
Ich verkneife mir ein Lächeln. »Bestimmt bringen Sie das mit kalte Hände, warmes Herz durcheinander.«
Er runzelt die Stirn. »Schon möglich.«
Die Aufzugtüren öffnen sich. Er stößt sich mühsam von der Wand ab und taumelt praktisch hinein. Er hält sich an der Aufzugstange fest und sinkt gegen die Wand, als ich folge. Ich fasse nicht, was ich da tue.
Er braucht keinen Knopf zu drücken, weil der Aufzug allein zum Penthouse hinauffährt. Sobald er losfährt, stöhnt er. »Ich fühl mich nicht gut.«
Hoffentlich wird ihm nicht schlecht hier drin. Wenn es etwas gibt, womit ich nicht klarkomme, dann ist es Erbrochenes. »Sie sollten sich hinsetzen.«
Er lässt sich an der Wand hinabgleiten, und seine massigen Schultern sinken nach vorn, als er den Kopf auf die Knie legt. »Der morgige Tag wird furchtbar.«
Ich bleibe auf der anderen Seite des Aufzugs, falls er sich übergeben muss. »Wahrscheinlich.«
Es ist die längste Aufzugfahrt der Welt. Oder wenigstens fühlt es sich so an, vor allem weil ich Angst davor habe, dass er kotzt. Zum Glück erreichen wir das Penthouse-Geschoss ohne Zwischenfall. Doch es ist eine Herausforderung, ihm wieder auf die Beine zu helfen. Ich muss den Tür-auf-Knopf dreimal drücken, bevor er mit gutem Zureden wieder hochkommt.
Seit Verlassen der Bar scheint sich die Wirkung des Alkohols verstärkt zu haben. Er ist mehr als schlaff und stützt sich an der Wand und an mir ab, als wir auf seine Tür zusteuern. Es gibt zwei Penthouse-Apartments. Eins auf jeder Seite des Foyers.
Er lehnt sich gegen den Türrahmen und ringt erneut um ausreichend Koordination, um seinen Daumen auf das Sensor-Pad zu legen. Ich frage diesmal gar nicht, ob er meine Hilfe braucht, denn es ist nicht zu übersehen. Wieder umfasse ich seine feuchte Hand mit meiner.
»Ihre Hände sind wirklich weich«, murmelt er.
»Danke.«
Das Pad leuchtet grün auf, und ich drücke die Klinke herunter. »Okay, alles klar. Home, sweet home.«
»Das ist nicht mein Zuhause«, nuschelt er. »Das Gebäude gehört der Familie meines Cousins. Ich penne hier nur, bis ich endlich wieder aus New York verschwinden kann.«
Ich sehe mich in der Wohnung um. Es ist eine bunte Mischung aus seltsamer Kunst und modernen Möbeln, als wären zwei unterschiedliche Geschmäcker aufeinandergeprallt, und das hier ist das Ergebnis. Ansonsten ist es so sauber, dass es beinahe wie ein Showroom wirkt.
Einziges Anzeichen dafür, dass hier jemand wohnt, ist eine einsame Kaffeetasse auf dem Wohnzimmertisch und eine Decke, die wie eine Zunge über der Sofalehne hängt. Ich stehe noch immer im Türrahmen, während er leicht wankt.
Er versucht seine Hand in die Hosentasche zu stecken, aber dadurch bringt er sich lediglich aus dem Gleichgewicht. Er fällt beinahe gegen die Wand.
»Danke für Ihre Hilfe«, sagt er.
Er ist wieder in seinem Penthouse, was im Grunde bedeutet, dass meine Aufgabe erledigt ist. Trotzdem habe ich Angst, dass er sich verletzt oder, schlimmer noch, mitten in der Nacht an seinem Erbrochenen erstickt und ich deswegen in Schwierigkeiten komme. Ich würde mich auch mies fühlen, wenn ihm was passieren würde. Ich stoße einen Seufzer aus, frustriert darüber, dass mein Abend so endet.
Ich hieve seinen Arm auf meine Schulter, lege meinen wieder um seine Taille und führe ihn durch das Wohnzimmer in Richtung Küche, wie es scheint. Auf der Kücheninsel liegt ein Blatt Papier, ansonsten ist alles makellos.
»Was tun Sie da?«, fragt er.
Wir bleiben im Türrahmen stehen. »Wo geht’s zu Ihrem Schlafzimmer?«
Er blickt langsam von links nach rechts. »Nicht hier entlang.« Er zeigt auf die Küche. Sie ist hochmodern.
Ich führe ihn in die entgegengesetzte Richtung den Flur entlang, bis er durch eine Türöffnung in ein großes, aber schlicht möbliertes Schlafzimmer stolpert. Sobald er neben dem Bett steht, lässt er den Arm herunterrutschen, dreht sich – auf betrunkene Weise elegant – herum und lässt sich auf das Bett fallen, Arme weit von sich gestreckt, als wollte er einen Schneeengel machen. »Das Zimmer dreht sich.«
»Soll ich Ihnen ein Glas Wasser und vielleicht eine Tablette gegen die Kopfschmerzen bringen, die Sie morgen früh wahrscheinlich haben werden?« Ich bin schon auf dem Weg zum Badezimmer.
»Ist wahrscheinlich ’ne gute Idee«, nuschelt er.
Ich bemerke ein Glas auf dem Rand des Waschtischs – der bis auf eine nagelneue Zahnbürste und eine Tube Zahnpasta leer ist. Ich öffne den Wasserhahn und wünschte mir, ich hätte einen Plastikbecher, weil ich mir nicht sicher bin, ob er mit zerbrechlichen Gegenständen umgehen kann. Ich schaue in den Medizinschrank, finde die Tabletten, die ich brauche, nehme zwei davon heraus und kehre ins Schlafzimmer zurück.
Er liegt noch genauso da wie zuvor; auf dem Rücken ausgestreckt auf einem King-Size-Bett, Beine über der Kante, ein Schuh auf dem Boden neben ihm. Ich gehe hinüber, stelle das Wasser auf den Nachttisch und lege die Tabletten daneben.
Ich kehre rasch ins Bad zurück und hole den leeren Mülleimer neben der Toilette für den Fall, dass seine Nacht heftiger wird, als er erwartet.
Ich tippe auf sein Knie und hoffe, dass er leicht zu wecken ist. »He, ich habe Schmerztabletten für Sie.«
Er gibt ein Geräusch von sich, bewegt sich ansonsten aber nicht.
Ich tippe ihm noch einmal aufs Knie. »Lincoln, Sie müssen aufwachen, um die hier zu nehmen.« Ich winde mich. Ich habe ihn beim Namen genannt, obwohl er sich nicht vorgestellt hat, während wir unten in der Bar waren. Bleibt zu hoffen, dass er zu betrunken ist, um es zu merken oder sich daran zu erinnern. Sein Name ist Lincoln Moorehead, Erbe des Moorehead-Media-Vermögens und von allem, was dazugehört. Und das ist eine Menge.
Ein Auge wird zu einem Schlitz. »Jedes Mal, wenn ich die Augen aufmache, fängt der Raum wieder an sich zu drehen.«
»Wenn Sie das trinken und die hier nehmen, hilft es vielleicht.« Ich halte das Glas Wasser und die Tabletten hoch.
»Okay.« Es braucht drei Anläufe, bis er sich aufgesetzt hat. Er versucht, die Tabletten von meiner Handfläche zu nehmen, verfehlt meine Hand jedoch mehrfach.
»Machen Sie den Mund auf.«
Er hebt den Kopf. »Woher soll ich wissen, dass Sie mich nicht ausknocken wollen?«
Ich halte die Tablette vor sein Gesicht. »Ausknocken steht nicht drauf, Sie sind also sicher.«
Er versucht, die Tablette zu fixieren und anschließend mein Gesicht. Ich bezweifle, dass ihm das gelingt.
Seine Zunge lugt hervor, um sich damit über die Lippen zu fahren. »Die Kameras im Flur nehmen Sie auf, falls Sie versuchen sollten, meine Brieftasche zu klauen.«
Ich lache darüber. »Ich habe nicht vor, Ihre Brieftasche zu stehlen, ich werde Sie ins Bett bringen.«
»Hmm.« Er nickt langsam und öffnet den Mund.
Ich lasse die Tabletten auf seine Zunge fallen und reiche ihm das Glas, das er mit drei großen Schlucken leert. »Soll ich das noch mal vollmachen?«
»Das wäre nett.« Er streckt mir das Glas hin, doch als ich es nehmen will, legt er seine Hand auf meine. Seine unglaublich blauen Augen begegnen meinen, und einen Moment lang sind sie klar und unwiderstehlich. Obwohl er dermaßen weggetreten ist und einem Rübezahl ähnelt, oder vielleicht gerade deswegen, habe ich Mühe, den Blick abzuwenden. »Ich wünschte, ich wäre nicht so derangiert. Sie riechen gut. Ich wette, Ihr Haar sieht schön aus, wenn es nicht hochgesteckt ist.« Er wedelt mit der Hand in Richtung meines Haarknotens. »Nicht, dass es so nicht schön aussehen würde, aber wenn Sie’s aufmachen, wär’s bestimmt wellig und weich. Die Sorte Haar, in dem man sein Gesicht vergraben und durch das man mit seinen Fingern fahren möchte.« Er stößt einen tiefen Seufzer aus. »Ich hatte echt schon lange keinen Sex mehr, aber ich wäre wahrscheinlich ziemlich unbeholfen, wenn ich’s jetzt versuchen würde.«
Ich lächle und wende mich ab. In der Zeit, die ich brauche, um das Glas aufzufüllen, ist es ihm gelungen, einen Arm aus dem Ärmel der Anzugjacke zu ziehen. Er ist auf dem Bett hochgerutscht, nur noch die Füße hängen über die Bettkante, aber er liegt auf dem Rücken, was nicht ideal ist.
Ich stelle das Glas auf den Nachttisch, zusammen mit zwei weiteren Tabletten, die er wahrscheinlich am nächsten Morgen brauchen wird, und stupse ihn erneut an. »Hey.«
Diesmal bekomme ich überhaupt keine Reaktion. Ich stoße ihn noch zweimal an, aber immer noch nichts. So betrunken, wie er ist, darf er nicht auf dem Rücken schlafen. Er muss auf der Seite oder auf dem Bauch liegen, mit einem Mülleimer neben dem Bett.
Ich kann ihn guten Gewissens nicht so liegenlassen. Meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ich schüttle den Kopf, als ich aus meinen Schuhen schlüpfe und zu ihm aufs Bett klettere. Das hatte ich wirklich nicht vor, als ich ihn hier heraufgebracht habe.
Ich blicke hinunter auf seine schlafende Gestalt. Seine Lippen sind geöffnet, es sind hübsche Lippen, voll und üppig, obwohl sie größtenteils von seinem wuchernden Bart bedeckt sind. Sein Haar hat sich teilweise aus seinem Man Bun gelöst, und er hat Strähnen im Gesicht. Er hat lange Wimpern, richtig lang, und sie sind dicht und dunkel, von der Sorte, für die Frauen viel Geld bezahlen. Seine Nase ist gerade, und seine Wangenknochen – nach dem, was ich von ihnen erkennen kann – sind hoch. Mit einem Haarschnitt, einem gestutzten oder abrasierten Bart und einem neuen Anzug, der gut sitzt, würde er bestimmt gepflegt aussehen. Mehr wie ein Moorehead und nicht so sehr wie ein Holzfäller. Ich schüttle den Kopf. »Sie müssen sich auf die Seite drehen, bitte«, sage ich laut.
Nichts. Nicht einmal ein Grunzen.
Ich rüttle ihn an der Schulter, aber er rührt sich nicht. Ich beuge mich über ihn, balle die Hand zur Faust und gebe ihm einen leichten Schlag ungefähr da, wo seine Nieren sind. »Lincoln, auf die Seite drehen.«
Was er tut, wobei er mich allerdings schubst und auf den Rücken wirft und sich direkt auf mich legt. Wir liegen von Angesicht zu Angesicht da. Du meine Güte, er ist schwer. Seine Knochen müssen aus Blei sein. Er bewegt sich und schiebt ein Bein über meine Beine. Ich drücke gegen sein Knie, aber sein Arm schwingt herum, und er umfasst mich mit einem leisen Stöhnen, wobei er meinen Arm an meiner Seite einklemmt. Er ist wie eine riesige menschliche Decke.
»Wie konnte es nur so weit kommen?«, sage ich zur Zimmerdecke, weil der Mann, der auf mir liegt, anscheinend bewusstlos ist.
Ich versuche, mich freizustrampeln, sogar seinen Namen rufe ich ein paarmal, bevor ich aufgebe und darauf warte, dass er herunterrollt. Und während ich darauf warte, lasse ich das Gespräch mit seiner Mutter Gwendolyn Moorehead Revue passieren, das vor achtundvierzig Stunden stattgefunden und mich in diese unangenehme Situation unter ihrem betrunkenen Sohn gebracht hat.
Ich stand in Fredricks Büro und versuchte noch immer die Tatsache zu verdauen, dass er tot war. Es war ein Schock, als ihn ein schwerer Herzinfarkt dahinraffte, weil er immer so voller Leben und gesund gewesen war.
Gwendolyn, seine Frau – jetzt Witwe –, stand stoisch hinter seinem Schreibtisch, Unterlagen ordentlich in der Mitte übereinander gestapelt.
»Mein tiefstes Beileid für Ihren Verlust, Gwendolyn. Sagen Sie mir, falls ich irgendetwas tun kann. Was immer es auch sei.« Die Worte strömten aus meinem Mund, typische Beileidssätze, aber aufrichtig gemeint, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie meine Mutter und ich uns fühlen würden, wenn wir meinen Vater verlören.
Gwendolyn spielte mit den Fingern an ihrem Hals, als sie sich räusperte. »Danke«, flüsterte sie heiser und tupfte sich die Augen ab. »Ich weiß Ihre Freundlichkeit zu schätzen, Wren.«
»Sagen Sie mir, was es ist, und ich kümmere mich darum.«
Sie holte tief Luft und sammelte sich, bevor sie ihren Blick auf mich richtete. »Ich brauche Ihre Hilfe.«
»Natürlich, was kann ich tun?«
»Mein ältester Sohn, Lincoln, wird zum Begräbnis nach New York kommen, und er wird bleiben, um die Firma am Laufen zu halten.«
Ich spürte ein Prickeln auf dem Rücken. Ich hatte wenig über Lincoln gehört. Alles aus Armstrongs Mund über ihn war beleidigend, Fredricks flüchtige Bemerkungen hingegen waren voller Zuneigung gewesen, und mein Kontakt mit Gwendolyn hatte sich auf ein Minimum beschränkt, weil Fredrick mich persönlich eingestellt hatte, weshalb ich sie zum ersten Mal von Lincoln sprechen hörte. »Verstehe. Und wie kann ich dabei behilflich sein?« Kaum auszumalen, wie schwierig Armstrong wäre, wenn er die Aufmerksamkeit mit jemandem teilen müsste, speziell mit seinem Bruder.
»Indem Sie Lincoln ummodeln.« Gwendolyn kam um den Schreibtisch herum. »In der Zeit, die Sie hier sind, ist es Ihnen gelungen, Armstrongs Ruf in den Medien wiederherzustellen. Ich weiß, das war nicht einfach, und Armstrong kann ziemlich schwierig sein.«
Schwierig ist die Untertreibung des Jahrhunderts, was Armstrong betrifft. Er ist ein Riesenarschloch. Außerdem ist er ein frauenfeindlicher, narzisstischer Mistkerl, mit dem ich während der letzten acht Monate beinahe täglich zu tun hatte – manchmal sogar an den Wochenenden.
Mein Job als seine »Betreuerin« ist es, seinen miserablen Ruf wiederherzustellen, nachdem seine Verstrickung in diverse Skandale allzu viel öffentliche Aufmerksamkeit erlangt hatte. Ein Job, den ich mir nicht unbedingt gewünscht hätte und den abzulehnen ich gewillt war, aber meine Mutter bat mich, die Stelle ihr zuliebe anzunehmen, weil sie eine Freundin von Gwendolyn ist.
Darüber hinaus ist mein Verhältnis zu meiner Mutter in den vergangenen zehn Jahren ziemlich angespannt gewesen. Als Teenager habe ich Dinge herausgefunden, die unsere Beziehung für immer verändert haben. Den Job bei Moorehead anzunehmen, war in gewisser Weise meine Art, unser brüchiges Band wieder zu kitten. Und die exorbitante Bezahlung war nicht zu verachten. Außerdem ist Gwendolyn in dieser Stadt im Komitee fast jeder Wohltätigkeitsstiftung, und weil dort mein eigentliches Interesse liegt, schien es ein kluger Karriereschritt zu sein.
»Weil Sie bereits mit Armstrong zusammenarbeiten und sich die Dinge dort größtenteils eingerenkt haben, dachte ich, es wäre sinnvoll, Sie hier bei Moorehead auch mit Lincoln zusammenzubringen. Er ist schon seit ein paar Jahren aus der zivilisierten Welt verschwunden. Er ist ganz anders als sein Bruder, sehr selbstlos und mehr auf den Job als auf Freizeitvergnügen konzentriert, also sollte er einfacher zu handeln sein.«
Im letzten Moment verkniff ich mir ein Schnauben, denn »Freizeitvergnügen« war eine Anspielung darauf, dass Armstrong seine Hosen nicht anbehalten konnte, wenn es um Frauen ging.
Gwendolyn schob einen Stapel Unterlagen in meine Richtung. »Es wäre nur für weitere sechs Monate. Und natürlich würde sich die doppelte Arbeitsbelastung in Ihrem Lohn widerspiegeln, weil Sie Armstrong weiterhin auf Spur halten müssen, während Sie Lincoln dabei helfen, in seine Rolle hier hineinzuwachsen.«
»Tut mir leid, was …«
Gwendolyn zog mich in eine unbeholfene Umarmung und hielt mich an den Schultern fest, als sie zurücktrat. Ihre Augen waren mit Tränen gefüllt und rot gerändert. »Sie wissen gar nicht, wie sehr ich Ihre Bereitschaft zu schätzen weiß, sich der Sache anzunehmen. Sobald Ihr Auftrag erfüllt ist, werde ich Ihnen eine glühende Empfehlung für jede Organisation schreiben, bei der Sie sich bewerben wollen. Ihre Mutter hat mir gesagt, dass Sie gern Ihre eigene Stiftung gründen würden. Ich werde Ihnen dabei natürlich auf jede nur erdenkliche Weise helfen, wenn Sie noch ein wenig länger bleiben.« Sie betupfte sich die Augenwinkel und schnüffelte, bevor sie auf die Unterlagen auf dem Schreibtisch tippte. »Ich habe bereits einen Vertrag und natürlich eine Vertraulichkeitserklärung vorbereitet. Alles liegt zum Unterzeichnen bereit.«
Ich werde wieder in die Gegenwart geholt, als sich Lincoln bewegt und eine seiner riesigen Hände an meiner Seite hinaufgleiten lässt und sie auf meine Brust legt. Gleichzeitig drückt er seine Nase an meinen Hals, wodurch mich sein Bart am Schlüsselbein kitzelt. Er murmelt etwas Unverständliches an meiner Haut.
Ich verfalle kurzzeitig in Schockstarre. In jeder anderen Situation hätte ich ihm das Knie in die Eier gerammt. Allerdings ist er nicht ganz bei sich oder sich nur halb bewusst, dass er mich betatscht. Zum Glück habe ich jetzt, nachdem er sich bewegt hat, ein wenig Bewegungsspielraum.
Ich stoße ihn in die Rippen, was mir wahrscheinlich mehr wehtut als ihm. Wenigstens bringt es ihn dazu, sich so weit zu lösen, dass ich unter ihm hervorschlüpfen kann. Ich rolle vom Bett herunter, springe auf und streiche mein zerknittertes Kleid glatt. Meine blöden Nippel stehen hervor, dank der Aufmerksamkeit, die der rechte gerade erhalten hat. Wahrscheinlich weil ich so viel Action nicht mehr erlebt habe, seit ich vor acht Monaten bei Moorehead angefangen habe.
Ich schalte das Licht aus auf dem Weg nach draußen, mache in der Küche Halt, um mir ein Glas Wasser zu nehmen, und lese, was auf dem Blatt auf dem Tresen steht. Es ist eine Liste mit wichtigen Dingen, was das Penthouse betrifft, den Zugangscode eingeschlossen. Ich schnappe meine Tasche, mache ein Foto davon und gehe zu den Aufzügen.
Mein Gefühl sagt mir, dass das lange sechs Monate werden.
2
BETROGEN WERDEN, SOGAR AUS DEM GRAB HERAUS
Lincoln
Es fühlt sich an, als würden eine Million winziger Elfen versuchen, sich mit einem Hammer ihren Weg aus meinem Schädel zu bahnen. Verdammte Scotch-Whiskey-Mixturen. Verdammtes Begräbnis. Was für ein Umstand.
Das klingt nach Arschloch, sogar in meinem Kopf.
Das passiert, wenn ich bei meiner Familie bin; es verwandelt mich in einen von ihnen.
Mein Wecker klingelt zum hundertsten Mal. Und mein Telefon klingelt ebenfalls. Schon wieder.
Seit sieben Uhr drücke ich fortwährend auf Snooze und ignoriere die Anrufe.
Ich spähe unter dem Kissen hervor, um die Uhrzeit zu checken. Der Lichtstreifen, der zwischen den Vorhängen hereinfällt, fühlt sich an, als wollte mir jemand mit Sonnenstrahlen die Augäpfel ausstechen. Ich habe wirklich einen Mordskater.
Es ist gleich halb neun. Um die Zeit sollte ich bei Moorehead Media zu einem Pflichttermin sein. Wir wollten das Testament meines Vaters und einen Haufen anderen Krempel, mit dem ich nichts zu tun haben will, besprechen.
Seit ich in Harvard meinen Abschluss gemacht habe, habe ich keinen Fuß mehr in dieses Büro gesetzt. Mein Vater wollte, dass ich für ihn arbeite. Doch weil das Einzige, was er für mich getan hatte, war, mich durch die Uni zu bringen, fühlte ich keinerlei Verpflichtung, in seine Fußstapfen zu treten. Vor allem weil seine Fußstapfen in erster Linie Untreue und Abwesenheit als Vater bedeuteten.
Da es während der Rushhour bis zu Moorehead gut dreißig Minuten mit dem Taxi sind, werde ich auf jeden Fall eine halbe Stunde zu spät kommen, und das auch nur, wenn ich direkt vom Bett in ein Taxi rolle. Und so, wie mir der Schädel brummt, wird es eine Weile dauern, in die Gänge zu kommen.
Ich stöhne, als mein Telefon erneut klingelt. Das ist das einzige Mal, dass ich die stumpfsinnigen Arbeitstiere bei Moorehead mit meiner Anwesenheit beehren werde. Ich verstehe nicht, weshalb ich nicht einfach stiller Teilhaber sein kann. Ich würde meine Anteile sogar verkaufen, wenn ich so von meiner nutzlosen, bescheuerten Familie wegkäme.
Ich hoffe, dass wir den nötigen Papierkram rasch hinter uns bringen, damit ich gegen Ende der Woche in ein Flugzeug steigen und New York wieder verlassen kann. Ich bin erst seit achtundvierzig Stunden hier und würde jetzt schon am liebsten sieben verschiedene Morde begehen.
Während ich das Stechen in meinen Augen wegzublinzeln versuche, bemerke ich das Wasserglas und die beiden Tabletten auf dem Nachttisch. Ich muss irgendwie auf Draht gewesen sein, als ich mich von der Bar hier herauf geschleppt habe. Obwohl ich mich an nichts erinnern kann.
Es ist nicht einmal meine Wohnung. Das Gebäude gehört der Familie meines Cousins, und der ist während der nächsten Monate nicht hier, weshalb er mir sein Penthouse überlassen hat. Er ist gestern Morgen wegen des Begräbnisses hergeflogen und am Abend gleich wieder abgereist. Ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit gehabt, ihn zu begleiten. Es wäre so viel besser, als hier zu sein.
Ich setze mich auf, schwinge die Beine über die Bettkante und stelle die Füße auf den Boden. Ich trage noch immer einen Schuh.
Das Zimmer dreht sich, und mein Magen krampft sich zusammen. Es dauert einen Moment, bis die Übelkeit vorüber ist. Als es soweit ist, spüle ich eine Tablette mit Wasser herunter.
Mein Telefon klingelt zum tausendsten Mal. Ich berühre den Screen und stelle es auf Lautsprecher. »Was ist?«
Stille folgt – eine lange Stille –, bevor eine Frau schließlich reagiert. »Ihr Wagen wartet, Mr Moorehead, und das schon seit fünfundvierzig Minuten.«
»Na schön, er wird noch ein bisschen länger warten müssen.« Ich beende das Gespräch und reibe mir mit der Hand übers Gesicht. Ich fühle mich wie ausgekotzt. Mein Mund schmeckt, als hätte ich aus einem Abwasserkanal getrunken, und mein Kopf fühlt sich wattig an. Außerdem muss ich pinkeln. Und mich wahrscheinlich übergeben. Hoffentlich nicht alles zur selben Zeit.
Ich schleppe mich ins Bad und erhasche einen Blick auf mein Spiegelbild – jawohl, ich habe schon besser ausgesehen. Ich habe wohl in meinen Sachen geschlafen. Ich bin wirklich durch den Wind. Ich ziehe meinen zerknitterten Anzug aus und gehe unter die Dusche, wo ich mich übergebe. Mehr als einmal. Ich schaffe es irgendwie, mich abzuseifen und abzutrocknen.
Ich finde ein paar ausrangierte Jeans und ein T-Shirt, das über dem Liegesessel in der Ecke des Schlafzimmers hängt, und schlüpfe mühsam hinein. Ich muss mich fünf Minuten hinlegen, als sich der Raum zu drehen beginnt und die Nachwirkungen des Alkohols einsetzen.
Schließlich setze ich mich auf, doch es dauert weitere fünf Minuten mit Wellen von Übelkeit, bis ich endlich aufstehen kann. Ich binde meine Haare zu einem dilettantischen Man Bun hoch – ich hatte einfach keine Lust, mir für das Begräbnis die Haare zu schneiden oder den Bart abzurasieren –, putze mir die Zähne und muss mich wegen des starken Minzgeschmacks beinahe übergeben.
Ich stecke mein Telefon ein und überprüfe im Hinausgehen, ob ich meine Brieftasche bei mir habe. Dann gehe ich noch einmal zurück, um den Abfalleimer zu holen, den ich in weiser Voraussicht neben das Bett gestellt hatte, und mache mich auf den Weg zum Aufzug. Auf dem Weg nach unten muss ich mich beinahe noch einmal übergeben.
Es ist neun Uhr, als ich in den Wagen steige. Angesichts meines rebellierenden Magens kommt die U-Bahn nicht in Frage. Wir stehen, wie vorhergesagt, eine halbe Stunde im Stau, in der ununterbrochen mein Telefon klingelt. Aber ich gehe nicht ran. Ich bin spät dran. Die Welt geht davon nicht unter.
Ich versuche den gestrigen Abend zu rekonstruieren. Das Begräbnis war am Nachmittag. Was für ein jämmerliches Schauspiel. Hunderte von Leuten sind erschienen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Nach dem, was ich davon mitbekommen habe, war es mehr eine Gelegenheit zum Networking und um festzustellen, wie es mit Moorehead Media weitergehen würde. Überraschenderweise waren seine Liebhaberinnen nicht anwesend.
Meine Mutter saß in der ersten Bank und betupfte sich ihre trockenen Augen, wahrscheinlich, damit es wenigstens so aussah, als würde sie weinen. Seit meiner Kindheit hat sie nicht mehr im selben Zimmer mit meinem Vater geschlafen, weshalb sie wahrscheinlich höchstens Tränen darüber vergießt, dass nicht das ganze Geld an sie geht. Mein bescheuerter jüngerer Bruder Armstrong saß neben ihr, während er wahrscheinlich nach seiner nächsten Eroberung Ausschau hielt.
Er hat vor einer Weile sogar geheiratet. Was ganze zwölf Stunden gehalten hat. Er wurde auf seiner eigenen Hochzeitsfeier dabei erwischt, wie er sich von einem der weiblichen Gäste einen blasen ließ, was in den Ballsaal übertragen wurde. Idiot. Zum Glück war ich nicht da, und seine Ex-Frau, wenn zwölf Stunden Ehe diese Bezeichnung überhaupt verdienen, ist jetzt mit meinem Cousin Lexington verlobt. Hat ein bisschen was von einer Seifenoper, aber sie scheinen glücklich zu sein, und Armstrong scheint unglücklich und verpeilt zu sein wie immer, also ist in dieser Welt alles in Ordnung.
Was nicht für mich gilt, weil ich das dritte Mal in drei Tagen mit meinem Bruder zu tun haben werde. Zum Begräbnis eines Vaters gehen zu müssen, dessen einzige wichtige Rolle in meinem Leben war, die Rechnung für meine Elitehochschule zu bezahlen, und jetzt an diesem blöden Meeting wegen einer Firma teilzunehmen, an der ich nicht interessiert bin, hat mich gestern Abend in die Bar geführt.
Ich erinnere mich an die Flasche Johnny Walker, daran, zwei aufgestylte Tussis ignoriert zu haben und dann möglicherweise von einer Frau abgeschleppt worden zu sein, die vielleicht heiß war oder die ich mir schön getrunken habe. Wer weiß? Ich umklammere den Abfalleimer, schließe die Augen und atme tief ein und aus, um die Übelkeit zu vertreiben.
Erinnerungen kehren bruchstückhaft zurück. Wie ich von meinem Barhocker aufgestanden und beinahe hingefallen bin. Ein Paar schwarze Highheels, wenn auch keine Louboutins, weil sie die rote Sohle nicht hatten, die Frauen normalerweise bevorzugen. Lange Beine. Ein schwarzes Kleid. Schlicht, aber trotzdem feminin und sexy.
Habe ich eine Frau ins Penthouse mitgenommen? Meine Hose war offen heute Morgen, also ist es möglich. Es muss allerdings ein katastrophales Erlebnis gewesen sein. Ich bezweifle, dass ich in der Lage war, einen geraden Satz herauszubringen, geschweige denn, das mit dem Sex zu koordinieren. Ich überprüfe meine Brieftasche, alle meine Karten sind noch da und das Bargeld ebenfalls, also bin ich nicht ausgenommen worden.
Ich stelle das Telefon stumm und schließe die Augen. Die restliche Fahrt verbringe ich im Halbschlaf. Die schlimmste Übelkeit scheint vorbei zu sein. Jedenfalls bis mich der Gestank von New Yorks Auspuffgasen und aus Gullys erreicht, als der Fahrer meine Tür öffnet.
Mein Abfalleimer, den ich wie zum Schutz noch immer umklammere, rutscht mir beim Betreten des Gebäudes aus der Hand und fällt scheppernd zu Boden. Ein lautes Klong hallt vom Marmor wider und erweckt das Pochen in meinem Schädel erneut zum Leben. Es scheucht außerdem die Dame am Empfang und den Wachmann auf.
»Das war laut«, sage ich zu niemand Bestimmtem.
Der Wachmann macht bedächtig einen Schritt auf mich zu. »Ich müsste einen Ausweis sehen, Sir.« Er ist schon älter, wahrscheinlich in seinen Siebzigern, ein gutes Stück über dem Pensionsalter. Auf seinem Namensschild steht Bob. Ich frage mich, wie viele Jahre er hier vergeudet hat, mit einem undankbaren Job im persönlichen Höllenkarussell meiner Familie. Bob kommt mir bekannt vor, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass alle, die ihr gesamtes Leben an einem Ort wie diesem verbringen, das gleiche blasse, verbrauchte Aussehen und das sich lichtende graue Haar haben.
»Was?«
»Ihren Ausweis, Sir.« Er nimmt mich in Augenschein, als würde ich nicht hierher gehören. Was ich nicht tue. Ich trage ein Paar zerknitterte, abgewetzte Jeans und ein ebenso zerknittertes T-Shirt. Meine Laufschuhe haben Löcher, aus denen meine Zehen in Socken hervorlugen.
Ich zeige auf mein Gesicht. »Stellen Sie sich mich ohne Bart und dreißig Jahre älter vor.« Abgesehen von meiner Augen- und Haarfarbe sehe ich wie mein Vater aus, was die größte genetische Beleidigung der Welt ist. Mein Vater hat das Gesicht eines Betrügers und Lügners, weil er einer ist. Einer war.
Er runzelt die Stirn, woraufhin ich seufze. »Ich bin der Sohn von dem Mistkerl, der diesen Laden bis vor kurzem geführt hat, und der Bruder von dem, der ihn jetzt führt.«
Er zieht die Brauen noch enger zusammen, bis sie auf einmal in die Höhe schießen. »Lincoln?«
»Ja. Ich komme zu spät zu einem Meeting, das furchtbar dringend sein muss, wenn man bedenkt, wie oft mein Telefon heute Morgen geklingelt hat.« Ich wünschte, ich würde eine Baseballkappe tragen. Das Licht hier drin verursacht mir einen pochenden Kopfschmerz, und mein Magen grummelt schon wieder.
»Ich habe Sie über ein Jahrzehnt nicht gesehen. Das mit Ihrem Vater tut mir wirklich leid.«
»Mir nicht. Er war ein schrecklicher Mensch. Die Welt ist ein besserer Ort ohne ihn.«
Er wirkt schockiert, und sein Blick schnellt hin und her, wie um sich zu vergewissern, dass niemand zugehört hat, doch jeder in Hörweite schaut auf einmal weg, was darauf hindeutet, dass alle meinen völlig unangemessenen Kommentar über den Tod meines Vaters gehört haben.
Egal. Es ist wahr, und sie alle wissen es. »Ich muss jedenfalls in den siebten Kreis der Hölle, auf welchem Stockwerk der auch sein mag.«
»Ich besorge Ihnen einen Ausweis, Mr Moorehead.«
»Sagen Sie Linc, und danke.«
Wie aus Zauberhand taucht ein Ausweis auf, und Bob drückt den Knopf, weil ich natürlich nicht in der Lage bin, die einfachsten Dinge zu tun, entweder das, oder er behandelt mich so, weil er das für notwendig hält, um seinen Job zu behalten. Jedenfalls ärgert es mich.
Der Aufzug kommt, und ich steige ein und starre auf die Knöpfe, nicht sicher, wo sich der siebte Kreis der Hölle genau befindet. Zum Glück greift Bob herein und drückt den Knopf zum siebenundzwanzigsten Stockwerk, dann schenkt er mir ein düsteres Lächeln und zieht sich zurück.
Die Türen gleiten zu, und sobald sich der Aufzug bewegt, wünschte ich, ich hätte noch immer meinen Abfalleimer. Zum Glück steigt niemand ein, und die Fahrt geht schnell, auch wenn mir etwas mulmig dabei wird. Das siebenundzwanzigste Stockwerk von Moorehead Media ist ein langweiliger, steriler Bürotrakt. Eine blonde Frau mit Lippenstift in der Farbe des Todes trägt ein gekünsteltes Lächeln auf den Lippen, als ich den Aufzug verlasse und an ihren Empfangstresen trete.
Sie lässt ihren Blick über mich gleiten, und auch wenn ihr Lächeln unsicher wirkt, gelingt es ihr, es aufrechtzuerhalten. »Wie kann ich Ihnen helfen, Mr …« Sie lässt die Frage so stehen.
»Ich komme zu spät zu einem Meeting.«
Sie blinzelt ein paarmal. Sie muss falsche Wimpern tragen. Niemand hat so dicke oder lange Wimpern. »Und mit wem haben Sie ein Meeting, Mr …« Wieder wartet sie darauf, dass ich mich vorstelle.
»Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich mit irgendwelchen aufgeblasenen Trotteln, die um einen Konferenztisch sitzen und sich gegenseitig einen runterholen.«
Ihr rechtes Auge zuckt, und sie blinzelt ungefähr fünfzigmal hintereinander.
Das ist witzig, witziger als das Meeting, das ich durchstehen muss. Hoffentlich haben sie schon ohne mich angefangen. So spät, wie ich dran bin, besteht die Chance, dass es bei meinem Erscheinen bereits vorbei ist und ich nur noch ein paar Papiere unterschreiben muss. Dann kann ich vielleicht einen Flug buchen, um aus dieser Betonhölle herauszukommen.
Ihre rechte Hand wandert langsam über den Schreibtisch. Ich wette, sie hält mich für einen Spinner, dem es gelungen ist, an der Security vorbeizukommen.
»An Ihrer Stelle würde ich das nicht tun.« Ich nicke zu ihrer Hand hin, die langsam wie eine fünfbeinige Spinne auf das Telefon zukriecht.
Sie hält sie hoch. »Bitte tun Sie mir nichts. Sie können alles Geld aus meiner Handtasche haben.«
Ich stoße ein Lachen aus, das mich verstört klingen lässt, obwohl ein solches Gebäude das mit Menschen macht. »Ich bin Lincoln Moorehead, der Sohn des Kerls, der diesen Albtraum geleitet hat. Wenn Sie so freundlich wären, mir zu zeigen, wo sich der Vollpfosten von meinem Bruder und das Team von Lemmingen befinden, wäre das toll.«
»Oh mein Gott. Mr Moorehead. Ich wusste nicht, dass Sie auf dem Weg herauf waren. Die Security ruft normalerweise an.« Das Telefon auf Ihrem Schreibtisch klingelt.
»Das ist vielleicht die Security. Gehen Sie ruhig dran. Ich kann warten.«
Ich lehne mich gegen den Tresen, während sie den Hörer mit zitternder Hand abnimmt; ihre Fingernägel sind perfekt manikürt. Beinahe tut es mir leid, aber sie ist schließlich eine von Vaters Arbeitsbienen, also ist das rasch wieder vergessen.
»Moorehead Media, Lulu hier, wie kann ich Ihnen helfen?« Sie schweigt einen Moment lang. »Ja. Er ist hier. Danke, Bob.« Sie legt auf und schenkt mir mit großen Augen ein verängstigtes Lächeln. »Tut mir leid, Mr Moorehead.«
Ich winke ab. »Schon okay. Je länger das hier dauert, desto weniger Zeit muss ich mit meinem Bruder verbringen, was bedeutet, dass ich ihn vielleicht doch nicht zusammenschlage. Nicht noch einmal.«
Sie scheint unsicher zu sein, ob ich scherze. Tu ich nicht.
Schließlich steht sie auf und kommt hinter dem schützenden Empfangstresen hervor. »Dann bringe ich Sie zum Konferenzraum.«
»Wenn es sein muss.« Ich betrachte das Kunstwerk an der Wand hinter ihrem Schreibtisch. Es ist ein Bild von einem Baum ohne irgendein Blatt. Irgendwie deprimierend dieses Büro. Sie geht rasch den Flur entlang, und ich gehe mehr neben ihr her, als ihr zu folgen. Wir passieren verglaste Büros mit makellosen Schreibtischen auf unserem Weg zum Konferenzraum. Ich frage mich, ob hier zu arbeiten sich anfühlt wie eine vornehme Version von Gefängnis.
Ich entdecke das blonde Haar und den maßgeschneiderten Anzug meines Bruders. Er geht hin und her, während eine Frau mit verschränkten Armen vor der Brust drei Meter von ihm entfernt dasteht und steif gestikuliert.
Das Klappern von Lulus Absätzen auf dem Holzfußboden lenkt ihre Aufmerksamkeit auf sie. Mein Bruder wirbelt herum, wirft die Hände in die Luft und ruft: »Das wird auch langsam Zeit! Wo zum Henker hast du gesteckt?«
»Einen Kater ausschlafen und dir aus dem Weg gehen.«
»Muss angenehm sein, keine Verantwortung zu tragen und auf niemanden reagieren zu müssen. Ein Raum voller Menschen wartet darauf, dass deine jämmerliche Gestalt hier auftaucht.« Armstrong wedelt dramatisch mit den Armen und verzieht das Gesicht. »Was trägst du denn da?«
»Klamotten. Soll ich etwa nach Hause gehen und mir was anziehen, das mehr kostet, als die meisten Leute an Miete zahlen, um besser hier reinzupassen?«
Ich blicke zu der Frau neben ihm. Ihre linke Wange zuckt ganz leicht, doch ansonsten bleibt ihre Miene ruhig.
Armstrong ignoriert den Kommentar, streicht sich mit der Hand über seine Krawatte und richtet seine Aufmerksamkeit auf Lulu. Er lässt seinen Blick über sie gleiten. »Lulu, Sie lie…«
Die Frau hinter ihm räuspert sich, und Armstrong zuckt zusammen, als wäre er getasert worden.
Ich schenke Lulu ein, wie ich hoffe, höfliches und wohlgesonnenes Lächeln. »Danke für Ihre Hilfe, Lulu.«
»Gern geschehen, Mr Moorehead.« Sie nickt zuerst mir und dann Armstrong zu und wiederholt: »Mr Moorehead.« Dann macht sie kehrt und geht den Flur entlang, als stünden ihre Schuhe in Flammen.
Armstrong blickt ihr hinterher, als wäre sie ein Steak, in das er gern seine Gabel stecken würde. Oder seinen winzigen Schwanz.
»Du bist ein perverses Arschloch, weißt du?«, sage ich zu ihm.
Er runzelt die Stirn. Angesichts der schwachen Mimik bin ich mir sicher, dass er sich Botox spritzen lässt. Muss mit seiner Mutter-Sohn-Erfahrung zu tun haben. »Du siehst aus, als wärst du obdachlos.«
»Ist das alles, was dir einfällt?« Sich über ihn lustig zu machen, macht es nicht besser.
Er macht den Mund auf, um etwas zu sagen, wird jedoch von der Frau, die noch immer hinter ihm steht, daran gehindert. »Wäre es möglich, den Geschwisterzank bis nach dem Meeting aufzuschieben? Wir warten schon mehr als anderthalb Stunden auf Sie, Mr Moorehead.«
Ich richte meine Aufmerksamkeit auf sie, weil sie mich eindeutig anspricht. Ihre Stimme klingt irgendwie vertraut – sanft und ein wenig rau, aber fest und bestimmt. Meine freche Antwort bleibt irgendwo zwischen Gehirn und Mund stecken, als ich sie in Augenschein nehme.
Ihre Haut ist zart und für Mitte Juli in New York blass, wahrscheinlich weil sie jede Sekunde in diesem menschlichen Fischglas verbringt. Ihre Augen sind von einem auffallenden Grau mit einem dunkelblauen Ring, die einen schönen Kontrast zu ihrem haselnussbraunen Haar bilden, das ein wenig dunkel für ihren Hauttyp zu sein scheint. Ihr graues Kleid ist eigentlich langweilig, aber so wie es ihre Augen ergänzt und sich an sämtliche ihrer üppigen Kurven schmiegt, hat es etwas Exquisites. Ihre Highheels sind knallblau und so spitz, dass sie damit jemandem ein Auge ausstechen könnte, und nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, scheint sie durchaus dazu geneigt zu sein.
»Sie müssen …«
Ich werde mitten im Satz von meiner Großmutter unterbrochen, was wahrscheinlich gut so ist, bevor ich noch etwas sage, was ich hinterher bedauere. »Lincoln! Wo um Himmels willen hast du gesteckt? Und was hast du da nur an?«
»Ich habe meinen Rausch ausgeschlafen. Und das hier nennt man Bluejeans und T-Shirt, G-Mom.« Ich zeige auf mein Outfit.
Penelope Moorehead verengt die Augen, packt mich am Ohr und zerrt mich über den Flur in ein leeres Büro, wo sie hinter mir die Tür zuschlägt.
Sobald sie mich loslässt, reibe ich mir das Ohr. »Du weißt, dass man das Mobbing am Arbeitsplatz nennt.«
Sie verschränkt die Arme. »Sei nicht so frech, Lincoln Alexander Moorehead. Und nenn mich nicht G-Mom vor den verdammten Angestellten. Wie soll ich meinen Ruf als Schreckschraube aufrechterhalten, wenn du mich mit Spitznamen anredest, die klingen, als wäre ich ein zweitklassiger Rockstar?«
»Erinnerst du dich noch, wie du mir zum zehnten Geburtstag einen Kreuzstich-Hoodie geschenkt hast?« Ich verkneife mir ein Grinsen, denn G-Mom aufzustacheln war schon immer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Daran hat sich auch nichts geändert, wenngleich viele andere Dinge schon.
»Das ist nicht der richtige Augenblick für Scherze, Lincoln. Und es ist ganz bestimmt nicht der richtige Augenblick, um allen zu zeigen, wie wenig interessiert du an der Firma bist. Dein Vater ist gestorben, zeige etwas Anstand. Trotz deiner turbulenten Beziehung zu deinen Eltern musst du heute deinen Groll beiseite lassen und dich wie der Harvard-MBA-Absolvent benehmen, der du bist. Und nicht wie ein Besserwisser, der allen anderen ein mieses Gefühl gibt, weil du glaubst, dass das, was du tust, besser ist.«
Mir nichts, dir nichts hat mir meine G-Mom einen Dämpfer verpasst. Sie hat ihren Sohn verloren. Nur weil ich keine Beziehung zu ihm oder meiner Mutter hatte, heißt das nicht, dass es für die anderen auch so war. G-Mom war immer eine stärkere Bezugsperson für mich als die beiden, die mich in diese Welt gesetzt haben. Deshalb ist sie eine der wenigen Personen in meiner Familie, die ich aufrichtig liebe und respektiere. Also höre ich auf, mich wie ein Idiot zu benehmen.
Ich senke den Kopf, wobei der Schmerz hinter meinen Schläfen wieder aufflammt, und reibe mir den Nacken. »Tut mir leid. Ich weiß, dass das schwer für dich ist.«
»Niemand rechnet damit, dass die eigenen Kinder vor einem gehen.« Sie seufzt und geht hin und her, bleibt dann vor mir stehen, Rücken gerade, Schultern gestrafft, Ausdruck stoisch.
Sie ist nur knapp einen Meter fünfzig groß, aber sie ist eine Naturgewalt. Sie ist der Kopf hinter dem gesamten Netzwerk. Mein Großvater hatte vielleicht den Namen, aber diese Frau vor mir hat die Strippen gezogen. Und ich liebe sie dafür.
»Hör mal, Linc, ich weiß, dass das hier der letzte Ort ist, an dem du sein möchtest. Ich verstehe, dass du gern Leuten hilfst und dass Projektmanager zu sein, um Häuser zu bauen und Gemeinden in Entwicklungsländern zu helfen, eine ehrbare Sache ist, wenn auch nicht besonders gut für dein finanzielles Wohlergehen. Mir ist ebenfalls bewusst, dass es ein Ihr-könnt-mich-mal an deine Eltern und das ganze Geld ist, das sie für deine Ausbildung geblecht haben, und mir gefällt deine moralische Stärke.« Sie tippt sich auf die Lippen und schüttelt den Kopf. »Ich kann mir kaum vorstellen, wie du dich hier fühlen musst. Mir ist klar, dass deine Beziehung zu deinem Vater angespannt war, aber er war kein schlechter Mensch. Ich weiß allerdings nicht, was für eine karmische Bombe deine Eltern mit deinem Bruder geschaffen haben.« Sie geht wieder hin und her und bleibt erneut vor mir stehen. »Aber Armstrong kann diese Firma nicht allein führen. Er wird sie innerhalb eines halben Jahrs in den Bankrott reiten.«
Sie hat recht. Armstrong war nie gut darin, Anweisungen zu befolgen, ich allerdings auch nicht. Der Unterschied ist, Armstrong ist ein narzisstischer Egomane, der jedes Fitzelchen Macht, das er hat, missbraucht. Ich will mich für den Kerl nicht verbiegen. »Was soll das heißen?«
»Ich brauche deine Hilfe.«
Als sich mir jetzt der Magen umdreht, liegt es nicht an der Übelkeit. »Wie helfen? Wie lautet der Plan, wenn du Armstrong nicht zum Chef machen willst?«
»Du sollst eine Weile in New York bleiben und dabei helfen, die Dinge zu regeln.« Es ist weniger eine Bitte als ein Befehl.
»Ich kenne mich mit der Firma nicht aus.«
Sie lehnt sich an die Schreibtischkante und trommelt unruhig mit den Fingern dagegen. »Du hast einen Master in Business Administration von der besten Universität des Landes. Du verstehst was von Wirtschaft und Gewinnmarge. Den Rest kann man lernen.«
»Ich will nicht hier sein. Ich kann nicht bleiben. Ich würde durchdrehen.«
Panik befällt mich. Es fühlt sich an, als würden die Wände näher rücken.
»Ich hatte nicht erwartet, dass uns dein Vater so früh verlässt. Ich dachte, ich hätte Zeit, das hier vorzubereiten. Jahre, um jemand anders auf die Übernahme vorzubereiten. Ich hatte gehofft, Armstrong würde sich irgendwann ändern, aber ihm fehlt jede moralische Richtschnur und Führungsqualität. Er schafft es nicht einmal, eine Einkaufsliste zu schreiben, vom Management der Firma ganz zu schweigen. Es ist vorübergehend, Lincoln.«
Ich fahre mir durchs Haar, bis mir einfällt, dass es ja ein Bun ist. »Davon wird mein Kater auch nicht besser, G-Mom.«
Sie reibt sich die Schläfen. »Meiner auch nicht. Ich brauche deine Hilfe, Lincoln. Wir dürfen nicht zulassen, dass der frauenfeindliche, selbstbezogene Arschkriecher, der dein Bruder ist, die Firma leitet, ohne dass ihm jemand dabei auf die Finger klopft, wenn nötig. Er darf nicht so viel Macht haben.« Sie durchquert das Zimmer, greift nach einer Flasche Scotch und schenkt zwei Gläser ein. »Gib mir ein halbes Jahr.«
Sie reicht mir das Glas. Entweder hört davon das Zittern auf, oder ich muss kotzen. Mir ist sowohl schwindlig als auch übel. Wahrscheinlich weil mich meine Großmutter, die ich sehr liebe und zu der ich nicht Nein sagen kann, um die eine Sache bittet, die ich auf keinen Fall tun möchte. Außerdem hat sie gerade ihren Sohn verloren, und ich wäre ein schrecklicher Enkel, wenn ich ablehnen würde.
»Drei Monate.«
»Das genügt nicht.«