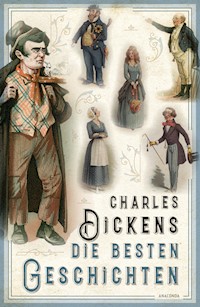
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beim großen englischen Schriftsteller Charles Dickens denkt man zunächst an seine Romane. Doch wie David Copperfield oder Oliver Twist begeistern auch seine Erzählungen durch die einprägsamen Charaktere und pointierten Figurenzeichnungen. Besonders deutlich wird in ihnen aber die Vielseitigkeit des Autors: Denn neben gesellschaftskritischen Skizzen und Portraits stehen in dieser Ausgabe auch Kriminalerzählungen und einige seiner besten Geistergeschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Charles Dickens
Die besten Geschichten
Aus dem Englischen vonHeike Holtsch und Bernd Samland
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthälttechnische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugteVerarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlicheZugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagtund kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, soübernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diesenicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zumZeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Coverzeichnungen von Charles Dickens‘»The Pickwick Papers«; Zeichnungen aus Charles Dickens‘»Dombey and Son«: Mr Toots, Florence Dombey, CaptainCuttle, Susan Nipper; Joseph Clayton Clark »The Artful Dodger«, illustration from »Character Sketches from Charles Dickens«.© Bridgeman Images / Lebrecht Authors, Look and Learn /Barbara Loe Collection
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-29845-6V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Auf den Straßen Londons – morgens
Läden und ihre Betreiber
Der Fluss
Jahrmarkt in Greenwich
Omnibusse
Stätten der Gerichtsbarkeit
Ein Kind sehnt sich nach einem Stern
Lektüre für die Dämmerung
Überführt
Der Bahnwärter
George Silvermans Bekenntnis
Die lange Reise
Editorische Notiz
Auf den Straßen Londons – morgens
Eine Stunde vor Sonnenaufgang an einem Sommermorgen geben die Straßen von London ein bemerkenswertes Bild ab, auch für die Wenigen, denen diese Szenerie längst vertraut ist, weil sie vergeblich auf Vergnügen oder nahezu ebenso vergeblich auf Geschäfte aus sind. Die sonst so überfüllten Straßen, von denen wir dichtes Gedränge gewohnt sind, scheinen wie leer gefegt; und über die verlassenen, verbarrikadierten Gebäude, in denen bei Tag reges Treiben herrscht, legt sich eine triste, kalte Trostlosigkeit, die etwas äußerst Eindringliches an sich hat.
Der letzte Betrunkene, der vor Sonnenaufgang den Weg nach Hause findet, ist mit schweren Schritten vorbeigewankt, und das Trinklied vom Abend zuvor, das er dabei grölt, gerade erst verhallt. Der letzte obdachlose Vagabund, den Armut und Ordnungshüter der Straße überließen, hat sich frierend in einer Ecke auf dem Bürgersteig zusammengerollt und träumt von einer warmen Mahlzeit und einem Dach über dem Kopf. Volltrunkene, Nachtschwärmer und Verarmte sind nirgends mehr zu sehen. Der nüchternere Teil der Bevölkerung, der ein geordnetes Leben führt, ist noch nicht auf den Beinen, um den Weg zur Arbeit anzutreten; eine Totenstille senkt sich über die Straßen und scheint ihnen ihre Farbe zu verleihen – so kalt und leblos wie sie im grauen, düsteren Licht bei Tagesanbruch daliegen. Die Kutschenstationen an den zugänglicheren Straßen sind verlassen, die Nachtlokale geschlossen und die einschlägigen Meilen, wo man nachts dem lasterhaften Elend frönt, verwaist.
Ab und zu sieht man einen vereinzelten Polizisten, dessen gleichgültiger Blick sich in der verlassenen Umgebung verliert. Hier und da schleicht eine verwegen anmutende Katze verstohlen über die Straße und verlässt gleichermaßen vorsichtig wie listig das eigene Terrain – indem sie zunächst auf eine Regentonne, von dort aus auf einen Abfalleimer und schließlich auf den Bordstein springt –, als sei ihr bewusst, dass ihr guter Ruf davon abhängt, ihr wagemutiges Unterfangen zu dieser vorgerückten Stunde vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Das eine oder andere halb geöffnete Fenster zeugt von der Sommerhitze in einem Schlafzimmer und dem unruhigen Schlaf seines Bewohners; das spärliche, unruhige Flackern von Kerzenlicht durch einen Fensterladen lässt ein Krankenzimmer oder eine Totenwache vermuten. Doch bis auf solche wenigen Ausnahmen regt sich in den Straßen ebenso wenig wie in den Behausungen.
Eine Stunde ist schnell vorüber. Die Kirchturmspitzen und die Dächer der imposanten Gebäude schimmern bereits im schwachen Licht der aufgehenden Sonne, und kaum merklich füllen sich die Straßen mehr und mehr mit Leben und Betriebsamkeit. Marktkarren rollen gemächlich vorbei, während der schläfrige Fuhrmann voller Ungeduld die noch trägen Pferde antreibt oder vergebens versucht, den jungen Gehilfen wachzurütteln, der es sich auf den Gemüsekörben bequem gemacht hat und in seligem Schlummer die Attraktionen Londons verpasst, denen er schon so lange voller Neugier entgegengesehen hatte.
Raue, schlaftrunkene Gestalten von befremdlichem Erscheinen, die nach Stallburschen oder Droschkenkutschern aussehen, nehmen die Läden vor den Schankwirtschaften herunter, und an den gewohnten Orten werden kleine Tischchen aufgestellt, um die üblichen Vorbereitungen für ein Frühstück auf der Straße zu treffen. Scharenweise balancieren Männer und Frauen (zumeist Letztere) schwere Gemüsekörbe ab auf ihren Köpfen, um sie mit Mühe entlang des Parks von Piccadilly nach Covent Garden und von dort aus reihenweise hastig weiter zum Abzweig der Straße nach Knightsbridge zu schleppen.
Ab und zu trifft man auf einen Bauarbeiter, der auf dem Weg zur Arbeit schnellen Schritts sein täglich Brot in einem Taschentuch verschnürt vor sich herträgt; manchmal auch auf ein Grüppchen von drei oder vier Schuljungen, die unterwegs zu einem heimlichen Badeausflug munter über den Bürgersteig laufen und verständlicherweise um einiges fröhlicher erscheinen als der ebenso junge Kaminkehrer, der, nachdem er an die Tür klopfen musste, bis ihm der Arm schmerzt – dank eines gnädigen Gesetzes ist es ihm verboten, durch lautes Rufen seine ohnehin schon geschundenen Lungen überzustrapazieren – nun geduldig wartend auf der Treppe sitzt, bis das Hausmädchen aufzuwachen geruht.
Der Markt von Covent Garden und die breiten Straßen, die dorthin führen, wimmeln von Gefährten jeglicher Bauart, Größe und Bestimmung – von den schweren Fuhrwerken der Holzfäller mit vier stämmigen Gäulen bis zu den scheppernden Karren der Straßenhändler, vor die ein ausgezehrter Esel gespannt ist. Längst sind die Bürgersteige übersät mit welken Kohlblättern, aufgerissenen Heuballen und all dem unbeschreiblichen Abfall eines Gemüsemarkts. Männer rufen, Fuhrwerke setzen zurück, Pferde wiehern, Jungen raufen, Frauen mit Einkaufskörben schwatzen, Bäcker preisen ihre köstlichen Pasteten an und die Esel schreien. All diese und hundert andere Geräusche verschmelzen zu einer Kakophonie, die schon für Londoner Ohren zu viel und für die Gentlemen vom Land, die zum ersten Mal im nahe gelegenen Hummums Hotel nächtigen, kaum auszuhalten sein muss.
So vergeht eine weitere Stunde und dann fängt der Tag erst richtig an. Das Mädchen für alles, das tief und fest zu schlafen vorgab, um »Missis’« Läuten eine halbe Stunde lang geflissentlich zu überhören, wird vom Master persönlich (der, noch im Morgenrock, von Missis eigens zu diesem Zweck zum Dachgeschoss hinaufgeschickt wurde) ermahnt, es sei schon halb sieben, woraufhin es mit geübt vorgetäuschtem Erstaunen aufschreckt, mürrisch die Treppe hinuntersteigt und, während es mit dem Funkeneisen hantiert, wünscht, das Prinzip der Selbstentzündung würde auch für Kohle und Kochherde gelten. Sobald das Feuer entfacht ist, öffnet es die Tür zur Straße, um die Milch hereinzuholen, und stellt fest, dass durch den erstaunlichsten Zufall der Welt das Dienstmädchen von nebenan auch gerade die Milch hereinholt und durch einen mindestens ebenso großen Zufall der junge Geselle aus Mr Todds Bäckerei gegenüber gerade dabei ist, die Läden herunterzunehmen. Daraus folgt unausweichlich, dass unser Dienstmädchen schnell nach nebenan huscht, um Betsy Clark »Guten Morgen« zu sagen, und Mr Todds junger Geselle rasch die Straße überquert, um den beiden Mädchen ebenfalls einen »Guten Morgen« zu wünschen; und da besagter Geselle fast genauso gutaussehend und anziehend ist wie Bäckermeister Todd höchstpersönlich, wird die Unterhaltung sogleich interessant und wäre es sicher noch umso mehr geworden, hätte nicht Betsy Clarks Missis, die ihr ständig auf den Fersen ist, verärgert gegen ihr Schlafzimmerfenster geklopft, woraufhin Mr Todds Geselle lässig vor sich hin pfeifend schneller zur Bäckerei seines Dienstherrn zurückgeht als er von dort gekommen ist. Die beiden Dienstmädchen eilen zurück in ihre jeweiligen Häuser und schließen überraschend lautlos die Türen hinter sich, um kaum eine Minute später unter dem Vorwand, nach dem Postboten sehen zu wollen – der natürlich genau in diesem Moment vorbeikommt –, die Köpfe aus den zur Straßenseite gelegenen Wohnzimmerfenstern zu stecken und noch einen Blick auf Mr Todds jungen Gesellen zu erhaschen, der sich vordergründig zwar auch für den Briefträger interessiert, weit mehr allerdings für die Rockträgerinnen, sodass er der Post bloß einen flüchtigen, den beiden Dienstmädchen jedoch einen umso längeren Blick schenkt, was schließlich alle Beteiligten überaus zufriedenstellt.
Der Postbote selbst fährt pünktlich weiter zur Kutschenstation, und die Fahrgäste, die dort in die frühmorgendliche Kutsche einsteigen, schauen verwundert auf die Reisenden, die aus der frühmorgendlichen Kutsche aussteigen. Denn Letztere geben ein klägliches Bild ab, ganz offenbar ergriffen von jenem befremdlichen Gefühl des Reisens, das die Ereignisse des gestrigen Morgens erscheinen lässt, als wären sie bereits vor sechs Monaten geschehen – sodass sich den Rückkehrern nun die gewichtige Frage aufdrängt, ob bei den Verwandten und Bekannten, von denen sie sich zwei Wochen zuvor verabschiedet haben, noch weitgehend alles beim Alten ist. An der Kutschenstation herrscht gehöriger Trubel, denn um die Kutschen, die im Begriff sind loszufahren, drängen sich wie üblich die Straßenhändler, die – weiß der Himmel warum – die Ansicht vertreten, als Reisender könne man keinesfalls eine Kutsche besteigen, ohne nicht zumindest ein günstiges Netz Orangen, ein Taschenmesser, ein Notizbuch, das letzte Jahresmagazin, ein Federmäppchen, einen Schwamm und eine kleine Karikaturen-Sammlung bei sich zu haben.
Eine halbe Stunde später strahlt die Sonne schon auf die noch halb leeren Straßen, und sie scheint mit solcher Kraft, dass der Lehrling immer träger wird und beim Ausfegen des Ladens und Schrubben des Bürgersteigs vor dem Eingang ein um die andere Minute Pause macht, um dem Lehrling von nebenan, der mit der gleichen Aufgabe betraut worden ist, zu sagen, wie heiß dieser Tag noch werden wird; oder mit einer Hand zum Schutz gegen die Sonne über die Augen gelegt und der anderen auf den Besen gestützt der »Wunderwelt« oder der »Hallali« oder der »Nimrod« oder sonst einer schnellen Kutsche hinterherstarrt, bis sie außer Sicht ist; und während er in den Laden zurückgeht, denkt er, wie gut es doch die Reisenden in diesen schnellen Kutschen auf dem Weg aus der Stadt hinaus haben – wobei er sogleich das alte Backsteingebäude auf dem Land vor Augen hat, in dem er einst zur Schule ging: Die bittere Armut mit Milch und Wasser und dicker Brotsuppe gerät in Vergessenheit beim Gedanken an die grüne Wiese, auf der er mit den anderen Kindern herumtollte, an den grünen Teich, der ihm eine Tracht Prügel einbrachte, weil er sich angemaßt hatte hineinzufallen, und an all die anderen Schuljungen-Erinnerungen.
Droschken, mit Koffern und Hutschachteln zwischen den Beinen der Kutscher und auf den Abstellflächen, rattern flott in Richtung der Kutschenstationen oder Dampfschiff-Anlegestellen die Straßen hinauf und hinunter, und die wartenden Kutscher sowohl der öffentlichen als auch der zu mietenden Droschken wischen den Staub von den Verzierungen ihrer Vehikel – wobei sich Erstere fragen, wie man denn bloß auf die Idee kommen kann, eine »dieser Karren mit den lahmen Gäulen einer richtigen Droschke mit einem schnellen Traber« vorzuziehen, und Letztere darüber staunen, dass manche Leute riskieren, sich den Hals zu brechen, weil sie lieber in einer »dieser überfüllten Kaleschen mitfahren als eine schicke Kutsche mit einem anständigen Paar Pferde zu nehmen, die niemandem durchgehen«. Ein durchaus berechtigter tröstlicher Gedanke, weil Mietdroschken-Pferde gar nicht schnell genug laufen können, um durchzugehen, wie der pfiffige Kutscher ganz vorn in der Reihe bemerkt und hinzufügt: »bis auf eins, aber das läuft rückwärts.«
Die Geschäfte sind nun alle geöffnet, und Lehrlinge wie Ladenbesitzer sind emsig damit beschäftigt, die Schaufenster zu putzen und mit den Tagesauslagen zu bestücken. In der Innenstadt stehen Dienstmädchen und Kinder in den Bäckereien Schlange und warten darauf, dass die erste Ladung frischer Brötchen aus dem Ofen kommt – was in den Vorstädten schon vor einer Stunde geschehen ist, denn die in Somers oder Camden Town, Islington oder Fentonville wohnenden Büroangestellten müssen früh aus dem Haus und strömen bereits ins Zentrum oder sind auf dem Weg zur Chancery Lane oder in die Inns of Court. Männer mittleren Alters, deren Gehälter bei Weitem nicht so schnell wachsen wie ihre Familien, sehen stur geradeaus und trotten zielstrebig auf die Kontore zu, obwohl sie fast jeden, der ihnen entgegenkommt oder den sie überholen, vom Sehen kennen, da es immer dieselben Leute sind, die ihnen seit zwanzig Jahren jeden Morgen (außer sonntags) begegnen, ohne dass sie jemals ein Wort miteinander gewechselt hätten. Und wenn sie doch einmal an jemandem vorbeigehen, den sie persönlich kennen, tauscht man hastig eine Grußformel aus und geht weiter, je nach Schritttempo entweder neben- oder hintereinander. Stehen zu bleiben um sich mit Handschlag zu begrüßen oder einen Bekannten am Arm zu nehmen, ist in ihren Gehältern wohl nicht inbegriffen und scheint ihnen daher auch nicht angebracht. Kleine Bürogehilfen mit großen Hüten, die zu Erwachsenen erklärt werden, bevor sie den Kinderschuhen entwachsen sind, hasten in ihren ersten sorgfältig abgebürsteten Mänteln und tintenbefleckten, angestaubten, weißen Sonntagshosen zu zweit nebeneinander her. Offenkundig ringen sie mit sich, nicht einen Teil des Geldes für die tägliche Essensration in eine der zwar nicht mehr ganz frischen, aber dennoch verlockenden Pasteten zu investieren, die auf den staubigen Blechen vor den Türen der Pastetenbäcker liegen. Aber schließlich siegt der Gedanke, dass man sich dafür dann doch zu fein ist, zumal man sieben Schilling die Woche verdient, mit der baldigen Aussicht auf acht; und so ziehen sie sich die Hüte ein wenig schräg und richten den Blick lieber auf die Gesichter unter den Hauben all der Lehrmädchen von Hut- und Korsettmachern, die ihnen über den Weg laufen – die Ärmsten ! – sind sie doch diejenigen, die am härtesten arbeiten, am schlechtesten bezahlt und von der Allgemeinheit am geringsten geschätzt werden.
Es ist elf Uhr, und schon bevölkert ein vollkommen anderer Menschenschlag die Straßen. Die Auslagen in den Schaufenstern sind einladend arrangiert; die Ladenbesitzer mit ihren weißen Halstüchern und adretten Kitteln erwecken den Eindruck, als hätten sie im Leben noch nie ein Fenster geputzt; die Gemüsekarren sind aus Covent Garden verschwunden, die Fuhrmänner wieder dort, wo sie herkamen, und die Straßenhändler unterwegs auf ihrer üblichen »Runde« durch die Vorstädte. Büroangestellte sitzen in ihren Kontoren, und Einspänner, öffentliche Droschken, Mietdroschken und Reitpferde steuern auf dasselbe Ziel zu. Die Straßen wimmeln von Menschen – schick oder schäbig, reich oder arm, untätig oder geschäftig, und wir nähern uns der Hitze, dem Gedränge und der Geschäftigkeit der Mittagszeit.
Läden und ihre Betreiber
Welch immerwährenden Anlass zum Staunen die Straßen von London doch bieten ! Ebenso wenig wie wir Laurence Sternes Mitgefühl mit jemandem teilen können, der einfach von Dan nach Beersheba reisen kann und behauptet, auf dem Weg gäbe es nichts zu sehen, können wir für jemanden Verständnis aufbringen, der nur in Hut und Mantel zu schlüpfen braucht, um von Covent Garden zum St. Paul’s Churchyard zu laufen, und dabei nicht zu schätzen weiß, wie viel Sehenswertes – um nicht zu sagen, Lehrreiches – ihn auf dem Weg erwartet. Und dennoch gibt es solche Zeitgenossen – sie begegnen uns sogar Tag für Tag. Breite schwarze Halsbinden und helle Westen, schwarze Spazierstöcke und missmutige Mienen sind die Markenzeichen dieser Spezies. Andere schieben sich hastig an einem vorbei, um eifrig ihren Geschäften nachzugehen oder munter irgendwelchen Vergnügungen nachzujagen. Diese Leute jedoch schlendern so ungerührt durch die Straßen wie Polizisten im Streifendienst. Nichts scheint sie zu beeindrucken, jedenfalls nichts Geringeres, als von einem Gepäckträger umgerannt oder einer Droschke überrollt zu werden. Ansonsten lassen sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Bei schönem Wetter findet man sie auf den großen Geschäftsstraßen: Schaut man abends durch das Schaufenster eines Zigarrenladens im Westend – vorausgesetzt, es gelingt einem, durch den Spalt zwischen den blauen Vorhängen zu spähen, die neugierige Blicke eigentlich abhalten sollen –, sieht man sie bei der einzigen Freude ihrer Existenz. Dort, vor Tabakdosen und Pfeifenkästen, lungern sie herum und scheinen mit ihren Backenbärten und goldenen Uhrketten über alles erhaben, wenn sie der jungen Dame mit den großen Ohrringen – die im gedämpften, warmen Licht hinter der Ladentheke sitzt und im Umkreis von zwei Meilen von sämtlichen weiblichen Bediensteten bewundert, von den Lehrmädchen der Hutmacher gar beneidet wird –, Belanglosigkeiten zuraunen.
Einer unserer bevorzugten Zeitvertreibe ist, den stetigen Wandel – den Aufstieg und Fall – mancher Läden zu beobachten. In den verschiedenen Stadtvierteln sind uns einige von ihnen bereits bestens vertraut, und somit auch ihre Geschichte. Aus dem Stegreif könnten wir mindestens zwanzig nennen, bei denen wir ziemlich sicher sind, dass in den vergangenen sechs Jahren dort von niemandem Steuern entrichtet wurden. Nie halten sich die Läden länger als zwei aufeinanderfolgende Monate, sodass wir wohl mit Fug und Recht annehmen können, sie waren schon unter jedweder Sparte im Londoner Branchenverzeichnis aufgeführt.
Die Geschichte eines dieser Ladenlokale, dessen Schicksal wir mit Interesse verfolgt haben, da wir es glücklicherweise noch vor der ersten Geschäftseröffnung kennenlernten, steht beispielhaft für alle anderen. Es befindet sich auf der Südseite des Flusses, in der Nähe von Marsh Gate. Ursprünglich war es ein solides, gepflegtes Wohnhaus. Der Eigentümer geriet in Schwierigkeiten, das Haus wurde zwangsversteigert, der Mieter zog aus, und das Gebäude verkam. In dieser Zeit wurden wir zum ersten Mal darauf aufmerksam. Der Anstrich war abgeblättert, die Fenster eingeschlagen und das Grundstück grün vor lauter Unkraut und der überlaufenden Regentonne. Die Regentonne selbst hatte keinen Deckel mehr, und die Tür zur Straße hin bot einen beklagenswerten Anblick. Sich auf der Treppe zu versammeln und der Reihe nach ein paar Mal laut an die Tür zu klopfen war zum bevorzugten Zeitvertreib der Nachbarskinder geworden – zur Freude der übrigen Nachbarn, insbesondere der schreckhaften, älteren Dame, die zwei Häuser weiter wohnte. Unzählige Beschwerden waren bereits eingegangen und ebenso viele Wassereimer über den Köpfen der Störenfriede ausgeleert worden – jedoch ohne Wirkung. Angesichts dieser untragbaren Situation montierte der Inhaber des Schiffsbedarf-Ladens an der nächsten Straßenecke kurzerhand den Türklopfer ab und verkaufte ihn. Und das unselige Haus sah erbärmlicher aus denn je.
Es dauerte ein paar Wochen, bis wir unserer neuen Bekanntschaft einen weiteren Besuch abstatteten: Welch eine Überraschung ! Das alte Haus war nicht mehr wiederzuerkennen. Statt seiner stand dort ein schmucker Laden, der schon so gut wie vollends ausgestattet war und an dessen Fensterläden große Plakate hingen, die verkündeten, dass er bald »mit einer breiten Auswahl an Stoffen und Kurzwaren« eröffnen würde. Das tat er dann auch, unter dem Namen des Besitzers »und Co« in vergoldeten Buchstaben, die so blendend glänzten, dass man kaum hinschauen konnte. Was für Bänder und Tücher ! Und dazu passend zwei elegante junge Männer hinter der Ladentheke, ein jeder mit blütenweißem Kragen und Halstuch, wie Liebhaber aus einem Lustspiel. Der Inhaber selbst tat nichts weiter als in seinem Laden auf und ab zu schreiten, den Damen Stühle zurechtzurücken und bedeutungsvoll Konversation mit dem attraktiveren der jungen Männer zu treiben, von dem die Nachbarn scharfsinnig mutmaßten, dass es sich bei ihm um das »Co« handelte. Wir hingegen sahen all das mit Sorge. Hatten wir doch die dunkle Vorahnung, dass der Laden zum Scheitern verurteilt sein würde. Und so kam es auch. Langsam zwar, aber stetig. Erst wurde mit Aushängen im Fenster auf Rabatte hingewiesen, dann standen Flanellballen mit Preisnachlass vor dem Laden; als Nächstes hing ein Plakat an der Tür, aus dem hervorging, dass in der oberen Etage keine Ware mehr ausgestellt werde. Bald darauf verschwand einer der jungen Männer, der andere verlegte sich auf schwarze Halstücher – und der Inhaber verlegte sich aufs Trinken. Der Laden kam immer weiter herunter, zerbrochene Glasscheiben wurden nicht mehr ersetzt, und nach und nach verschwand die Ware. Schließlich stellte der Mann vom Versorgungswerk das Wasser ab und der Tuchhändler sein Geschäft ein, und hinterließ dem Vermieter seine freundliche Empfehlung und den Schlüssel.
Als Nächstes folgte ein einfallsreich gestalteter Schreibwarenladen. Ein wenig schlichter gestrichen als zuvor, aber immer noch schmuck anzusehen. Doch irgendwie beschlich uns beim Vorbeigehen immer der Gedanke, es könne sich auch hierbei um ein sinnloses, mühseliges Unterfangen handeln. Wir wünschten dem neuen Inhaber gutes Gelingen, doch wir bangten um seinen Erfolg. Wie sich herausstellte, war er Witwer, und offenbar hatte er noch anderweitig eine Anstellung, denn jeden Morgen kam er uns auf dem Weg in Richtung Stadt entgegen. Der Laden wurde von seiner ältesten Tochter betrieben. Das arme Mädchen ! Sie brauchte nicht einmal Verkäufer. Manchmal sahen wir sie morgens mit zwei oder drei Geschwistern, ebenso wie sie selbst in Trauerkleidung, im kleinen Hinterzimmer des Ladens sitzen; und immer, wenn wir abends am Laden vorbeikamen, sahen wir sie bei der Arbeit, entweder um für die Geschwister zu sorgen oder um eine hübsche Kleinigkeit für den Verkauf zu fertigen. Als wir ihr blasses Gesicht im schwachen Kerzenschein immer betrübter und grüblerischer werden sahen, dachten wir oft: Wenn all die gedankenlosen Weibsbilder, die durch ihr Zutun solch bedauernswerten Gewerbetreibenden ihr ohnehin schon schwieriges Leben noch schwerer machen, auch nur halb so viel von dem Elend und den Entbehrungen erlebt hätten, das diese Menschen bei ihren aufrichtigen Bemühungen, sich ihren kläglichen Lebensunterhalt zu verdienen, erdulden müssen, würden sie vielleicht nicht mehr jede Gelegenheit zur Befriedigung der eigenen Eitelkeit und übertriebenen Selbstdarstellung nutzen und solche Mädchen nicht mehr so weit treiben, dass sie sich letzten Endes in einem ganz anderen, abscheulichen Gewerbe wiederfinden, dessen Nennung das zarte Empfinden eben dieser wohltätigen Damen zutiefst erschüttern würde.
Aber zurück zu dem Laden: Wir behielten ihn weiterhin im Auge, und die zunehmende Not seiner Betreiber wurde mit jedem Tag offensichtlicher. Die Kinder waren sauber, so weit, so gut, aber ihre Kleidung war abgetragen und schäbig. Für das obere Stockwerk des Hauses, durch dessen Vermietung man einen Teil der Pacht hätte bestreiten können, hatte sich kein Mieter gefunden, und die fortschreitende Erschöpfung hinderte die älteste Tochter daran, weitere Bemühungen zu unternehmen. Schließlich kam der Zahltag. Der Vermieter, der schon unter der Extravaganz seines vorherigen Pächters gelitten hatte, war bei dessen Nachfolgern zu keinerlei Entgegenkommen bereit; er leitete die Zwangsvollstreckung ein. Als wir eines Morgens am Laden vorbeikamen, trugen die Pfandleiher das Wenige an Einrichtung aus dem Haus, und wie wir einem neuen Plakat entnahmen, war der Laden abermals »zu verpachten«. Was aus den letzten Pächtern geworden war, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Wir glauben, für das Mädchen haben alles Leid und alle Sorgen nun ein Ende. Gott stehe ihr bei ! Hoffentlich ist es so.
Irgendwie waren wir gespannt, was nun aus dem Laden werden würde – denn dass er so, wie er war, nicht sogleich wieder bezogen werden konnte, war vollkommen klar. Bald wurde das Plakat draußen abgenommen und drinnen einige Veränderungen vorgenommen. Wir brannten vor Neugier, stellten allerlei Mutmaßungen über das künftige Gewerbe an – wovon aber keine mit unserer Vorstellung vom allmählichen Verfall des Ladenlokals vereinbar war. Nach der Wiedereröffnung fragten wir uns, warum wir angesichts der Situation vor Ort nicht selbst darauf gekommen waren. Der Laden – schon in seinen besten Zeiten nicht sonderlich groß – war in zwei Läden geteilt worden: Einer war von einem Mützenmacher bezogen worden, der andere von einem Tabakhändler, der auch Spazierstöcke und Sonntagszeitungen im Angebot hatte, und zwischen den beiden Läden gab es eine dünne Trennwand, die mit kitschig gestreiftem Wandpapier tapeziert war.
Der Tabakhändler hielt länger durch als jeder andere Mieter. Er war ein rotgesichtiger, unverfrorener, nichtsnutziger Halunke, offenbar daran gewöhnt, die Dinge so zu nehmen, wie sie kamen, und aus schlechten Voraussetzungen das Beste zu machen. Er verkaufte so viele Zigarren, wie er konnte, und was übrig blieb, rauchte er selbst. Er blieb so lange in dem Laden, wie er es schaffte, den Vermieter bei Laune zu halten, und als er doch Ärger mit ihm bekam, schloss er einfach die Tür ab und machte sich davon. Von da an gaben sich die immer wieder neuen Inhaber der beiden kleinen Lädchen die Klinken in die Hand: Auf den Tabakhändler folgte ein theatralischer Friseur, der das Schaufenster mit allerlei »Charakterköpfen« und fantastischen Schlachtfeldern dekorierte. Der Mützenmacher wich einem Gemüsehändler, und auf den bühnenversessenen Friseur wiederum folgte ein Schneider. So zahlreich waren die Wechsel, dass uns letzthin nichts anderes übrig blieb, als die zwar unterschiedlichen, doch stets eindeutigen Zeichen für ein im Niedergang begriffenes Haus zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Niedergang vollzog sich in kaum merklichen Schritten. Nach und nach gaben die Inhaber der jeweiligen Läden einen Raum nach dem anderen auf, bis ihnen nur noch das kleine Hinterzimmer blieb. An der hinteren Tür wurde bald ein Messingschild angebracht, auf dem gut leserlich stand: »Damenschule«. Kurz darauf entdeckten wir ein zweites Messingschild, dann eine Klingel und dann noch eine Klingel.
Als wir vor unserer alten Bekanntschaft stehen blieben und diese unmissverständlichen Anzeichen von Armut sahen, wandten wir uns ab und dachten, nun habe das Haus seinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Doch wir wurden eines Besseren belehrt. Denn als wir letztens dort vorbeikamen, beherbergte es eine »Milchwirtschaft«, und eine Schar trübsinnig dreinblickenden Federviehs verlustierte sich damit, durch die vordere Tür hinein- und durch die hintere hinauszulaufen.
Der Fluss
»Lieben Sie das Wasser ?«, wird man bei heißem Sommerwetter oftmals von jungen Männern gefragt, die selbst schon aussehen wie Amphibien. »Sogar sehr«, lautet die Antwort üblicherweise. »Und Sie ?« »Will gar nicht mehr raus«, lautet die Replik auf die Gegenfrage, ausgeschmückt mit allerlei Adjektiven, die die anhaltende Begeisterung des Gegenübers für dieses Element bekräftigen. Doch bei allem Respekt für die Auffassung der Gesellschaft im Allgemeinen und der Mitglieder von Ruder-Clubs im Besonderen möchten wir vorsichtig darauf hinweisen, dass einige der schmerzhaftesten Erfahrungen eines jeden, der sich schon einmal derart auf der Themse vergnügen wollte, wohl mit eben diesem Freizeitspaß verbunden waren. Wer hat denn auch jemals von einer vergnüglichen Ruderpartie gehört ? Oder um die Frage deutlicher zu formulieren: Wer hat jemals eine solche erlebt ? Wir haben unzählige solcher Ausflüge auf dem Fluss unternommen, können aber nur nach bestem Wissen und Gewissen erklären, dass uns nicht eine einzige dieser Veranstaltungen im Gedächtnis geblieben ist, die nicht von deutlich mehr Miseren geprägt war, als man innerhalb einer Zeitspanne von acht bis neun Stunden überhaupt für möglich halten sollte. Irgendetwas geht immer schief. Entweder geht der Korken des Salatdressings über Bord, oder der am sehnlichsten erwartete Gast kommt nicht an Bord, dafür aber der am wenigsten erwünschte; oder ein bis zwei Kinder fallen ins Wasser, oder der Gentleman an der Steuerleine setzt unentwegt das Leben aller Beteiligten aufs Spiel, oder die Gentlemen an den Rudern sind ein wenig »aus der Übung geraten« und bringen das Boot auf einen furchterregenden Schlingerkurs, indem sie die Ruder so tief ins Wasser tauchen, dass sie sie nicht mehr herausbekommen, oder sich kräftig in die Hacken stemmen, ohne die Ruder überhaupt ins Wasser getaucht zu haben – was in beiden Fällen dazu führt, dass die Ruder mit erstaunlicher Wucht bis über ihre Köpfen hochschnellen und die Ruderer denjenigen, die mit ihnen »im selben Boot sitzen«, einen geradezu demütigenden Blick auf die Sohlen ihrer Sportschuhe gewähren.
Zugegeben, die Ufer der Themse bei Richmond oder Twickenham sind absolut malerisch, ebenso wie in anderen entlegeneren Häfen, die oft ersehnt, aber nur selten erreicht werden. Doch zwischen dem »Roten Klotz« und der Blackfriars Bridge ändert sich die Kulisse auf wundersame Weise. Zweifellos ist das Nationale Zuchthaus ein eindrucksvolles Bauwerk, und die Sportskanonen, die an einem Sommerabend an dieser Stelle des Flusses »baden gehen«, bieten von Weitem einen erbaulichen Anblick. Doch wenn man dazu gezwungen ist, sich in Ufernähe zurück zum Ausgangshafen zu bewegen, und die jungen Damen errötend beharrlich in die andere Richtung sehen, während ihre verheirateten Geschlechtsgenossinnen mit dezentem Hüsteln auf die Wasseroberfläche starren, scheint einem dies doch ein wenig peinlich – insbesondere, wenn man sich in den vergangenen ein bis zwei Stunden alle Mühe gegeben hat, möglichst ungerührt zu erscheinen.
Wenngleich unsere leidvollen Erfahrungen zu eben der Ansicht führten, die wir gerade kundgetan haben, können wir uns doch lebhaft vorstellen, welchen Unterhaltungswert Amateur-Ruderer für einen unbeteiligten Beobachter haben. Was könnte erquicklicher sein als Searle’s Yard an einem Sonntagvormittag bei schönem Wetter ? Die Richmond-Flut strömt herein und auf einigen Dutzend Booten werden die letzten Vorkehrungen für die Ruderer getroffen, die sie gemietet haben. Zwei oder drei Bootsleute in weiten, groben Hosen und Seemannshemden machen die Boote mit ein paar einfachen Handgriffen bereit, bringen Ruder und Kissen und halten erst mal ein Schwätzchen mit dem »Jack«, der ebenso wie alle anderen seiner Zunft zu nichts weiter in der Lage zu sein scheint als tatenlos herumzustehen. Die Bootsleute verschwinden wieder und kommen mit einem Ruderseil und einer Trage zurück, woraufhin sie zunächst bei einem weiteren Schwätzchen Zerstreuung suchen und sich dann, mit den Händen in den geräumigen Hosentaschen, fragen, wo nur die Gentlemen bleiben, »die die Sechs gemietet haben«. Einer der Bootsleute, offenbar der Hauptverantwortliche, der sich bereits vorsorglich die Hosenbeine hochgekrempelt hat, vermutlich um ins Wasser zu steigen – das ja das Element ist, in dem er sich heimischer fühlt als an Land –, ist eine Nummer für sich. Er hört auf den Namen »Dando«, genau wie der berühmte verblichene Austernschlürfer. Unseren Dando muss man einfach gesehen haben, wie er, um sich von den Strapazen ein paar Minuten auszuruhen, lässig auf der Bootskante hockt und sich vor seiner breiten, pelzigen Brust mit einer nicht halb so pelzigen Kappe Luft zufächelt. Man beachte auch den imposanten, obwohl rötlichen Backenbart und den einheimischen Humor, mit dem er die Jungs und die Lehrlinge aufzieht oder den »Gennelmen« ein Gläschen Gin aufschwatzt – wobei wir die vage Vermutung hegen, dass er allein davon an einem Tag so viel schluckt wie sechs normale Männer zusammen, ohne auch nur die leisesten Anzeichen von Trunkenheit zu zeigen.
Endlich kommt auch die Rudergesellschaft, und Dando, von jeglichen Zweifeln an deren Erscheinen erlöst, setzt sich in Bewegung. Alle Ruderer tragen wassertaugliche Kleidung: weite blaue Jacken und gestreifte Hemden, dazu Kopfbedeckungen aller Formen und Farben, von samtenen Käppchen französischen Stils bis zu jenen Hauben einfacherer Machart, die man aus alten Schulbüchern kennt, da deren Autor Reverend Mr Thomas Dilworth mit einer ebensolchen Kopfbedeckung darin abgebildet war.





























