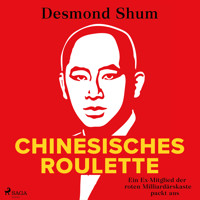9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der SPIEGEL-Bestseller, von dem die chinesische Regierung nicht will, dass wir ihn lesen: Money, Macht und Willkür in China »Von der Gier nach Geld, Sex und Macht und einem Imperium, das zurückschlägt.« Süddeutsche Zeitung Wann ist man wirklich mächtig? Wenn auf dem Konto eine Milliarde liegt? Wenn die Ehefrau mit der Frau des Premiers beim Shoppen große Geschäfte macht? Desmond Shum wächst in Shanghai und Hongkong auf. Nach dem Studium in den USA stürzt er sich ins Beijinger Businessleben mit dem Blickwinkel eines Outsiders und den richtigen Connections. Er scheffelt mit Immobilientransaktionen Geld. Ehefrau Whitney pflegt Beziehungen zu Ehefrauen wichtiger politischer Akteure. Und doch sind Desmond Shum die Hände gebunden, als Whitney, Multimilliardärin wie er, spurlos verschwindet. Wem aber konnte Whitney Duan gefährlich werden? Was wusste sie über Staatspräsident Xi Jinping - oder was außer Ärger mit der Staatsführung könnte hinter ihrem plötzlichen Verschwinden sonst stecken? »Das Buch hat viele Leser verdient.« Kai Strittmatter, Autor von Die Neuerfindung der Diktatur Jetzt mit exklusivem Nachwort für die deutsche TB-Ausgabe: »In China ist Politik der Schlüssel zum Reichtum.« Desmond Shum Ein brisanter Augenzeugenbericht aus der neureichen Wirtschaftselite Chinas: Die Hintergründe der "Explosion" des chinesischen Kapitalismus in den 2000er Jahren, erzählt von einem, der mit verstrickt war und mitverdient hat. Selten hat es jemand gewagt, so offen über das zu schreiben, was in China Macht bedeutet. Ein aufsehenerregender Blick auf die chinesische Elite, exzessive Bereicherung und den Widerstreit von Kapitalismus und kommunistischer Partei. »Shum zeichnet ein Sittengemälde der hedonistischen politischen Elite zu Beginn des Jahrtausends.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »Ein eindrückliches Buch.« Schweizer Monat »Shum deckt die Machenschaften der Kommunistischen Partei Chinas auf und die der Milliardäre, die sie hervorgebracht hat.« Barbara Demick »Desmond Shum gibt in seinem Enthüllungs- und Bekenntnisbuch "Chinesisches Roulette" mannigfache Einblicke in die Gesetzmäßigkeiten des chinesischen Sozialgefüges.« Der Tagesspiegel »Shums Geschichte ist ein Thriller und ein politisches Lehrstück. Er zeichnet darin ein Sittengemälde der hedonistischen politischen Elite zu Beginn des Jahrtausends.« ORF
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Desmond Shum
Chinesisches Roulette
Ein Ex-Mitglied der roten Milliardärskaste packt aus
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein brisanter Augenzeugenbericht aus der neureichen Wirtschaftselite Chinas: Die Hintergründe der »Explosion« des chinesischen Kapitalismus in den 2000er Jahren, erzählt von einem, der mit verstrickt war und mitverdient hat.
Desmond Shum wächst in Shanghai und Hongkong auf. Nach dem Studium in den USA stürzt er sich ins Beijinger Businessleben mit dem Blickwinkel eines Outsiders und den richtigen Connections. Er scheffelt mit Immobilientransaktionen Geld. Ehefrau Whitney pflegt Beziehungen zu Ehefrauen wichtiger politischer Akteure. Und doch sind Desmond Shum die Hände gebunden, als Whitney, Multimilliardärin wie er, spurlos verschwindet. Wem aber konnte Whitney Duan gefährlich werden? Was wusste sie über Staatspräsident Xi Jinping - oder was außer Ärger mit der Staatsführung könnte hinter ihrem plötzlichen Verschwinden sonst stecken?
Selten hat es jemand gewagt, so offen über das zu schreiben, was in China Macht bedeutet. Ein aufsehenerregender Blick auf die chinesische Elite, exzessive Bereicherung und den Widerstreit von Kapitalismus und kommunistischer Partei.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Einleitung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Nachwort
Nachwort zur Taschenbuchausgabe: Ein Jahr später
Bildteil
Danksagungen
Für Hongkong und Whitney Duan.
Ich wünschte, ich fände die richtigen Worte; du sollst wissen: Ich mache mir Sorgen.
寧鳴而死,不默而生
Besser die Stimme erheben und sterben, als schweigen und leben.
Fan Zhongyan (989–1052)
Einleitung
Am 5. September 2017 verschwand die fünfzigjährige Whitney Duan in Beijing. Zum letzten Mal gesehen worden war sie am Vortag in ihrem weitläufigen Büro im Genesis Beijing, einem Gebäudekomplex im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Dollar, den sie gemeinsam mit mir gebaut hatte. Dort hatte sich Whitney in einem Arbeitsbereich, den Besucher erst erreichen, nachdem sie eine Reihe von Sicherheitskontrollen passiert und sich in einem Labyrinth aus gepflegten Gärten und zahlreichen Varianten von italienischem Marmor zurechtgefunden haben, Immobilienprojekte im Wert von Milliarden Dollar ausgedacht. Und jetzt war sie plötzlich fort.
Was war geschehen? Und wer ist Whitney Duan?
Whitney Duan war mehr als ein Jahrzehnt lang meine Frau und Geschäftspartnerin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens waren wir geschieden, aber wir hatten viele Jahre eng zusammengearbeitet, wir waren Vertraute, und gemeinsam hatten wir eine atemberaubende Zeit erlebt. Wir hatten unseren Traum verwirklicht, in China große Dinge für China zu leisten. Wir waren beide aus der Armut aufgestiegen und wurden von der Sehnsucht angetrieben, etwas aus unserem Leben zu machen. Unser Erfolg erfüllte uns mit Ehrfurcht.
Wir hatten am Beijing Capital International Airport eine der größten Logistikdrehscheiben der Welt errichtet. Wir hatten das spektakulärste Hotel- und Geschäftszentrum in der chinesischen Hauptstadt entworfen und gebaut, das sich in erstklassiger Lage unweit des geschäftigen Stadtzentrums erhob. Wir hatten Hunderte Millionen Dollar mit Aktiengeschäften verdient. Wir hatten im Machtzentrum des Landes gearbeitet und gute Beziehungen zu Ministerpräsidenten, hochrangigen Funktionären der Kommunistischen Partei und ihren Familien geknüpft. Wir hatten aufstrebende Parteikader beraten, die sich anschickten, die Kontrolle über ganz China zu übernehmen. Wir hatten auf soziale und politische Veränderungen gedrängt, um China zu einem besseren Land zu machen. Wir waren überzeugt, dass wir Gutes tun konnten, indem wir unsere Arbeit gut machten. Wir hatten es uns durchgerechnet: Wir hatten ein Nettovermögen von mehreren Milliarden angehäuft.
Und jetzt war Whitney verschwunden. Von meinem Wohnort in England aus kontaktierte ich ihre Haushälterin, die mir erklärte, dass Whitney an jenem Septembertag im Jahr 2017 nicht nach Hause gekommen war und dass sie seitdem nichts von ihr gehört hatte. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst.
Ich rief Mitarbeiter des Unternehmens an, das wir gemeinsam gegründet hatten, und erfuhr, dass Whitney nicht die Einzige war, die plötzlich vom Erdboden verschwunden war. Zwei Spitzenmanager ihrer Firma – sowie eine junge Assistentin, die außerdem als Haushälterin aushalf – wurden ebenfalls vermisst. Keine dieser Personen hatte seither ein Lebenszeichen von sich gegeben. Ich war erst Ende Juni aus Beijing abgereist, nachdem ich unseren Sohn bei seiner Mutter abgeliefert hatte, damit er den Sommer mit ihr verbringen konnte.
Ich fragte mich, ob mich vielleicht das gleiche Schicksal ereilt hätte, wenn ich noch ein paar Wochen länger in China geblieben wäre.
In China verschwinden regelmäßig Menschen ohne jede Erklärung. Die Kommunistische Partei hat das absolute Machtmonopol. In der chinesischen Verfassung sind theoretisch bestimmte Grundrechte garantiert, aber die von der Partei eingesetzten Ermittler ignorieren das Gesetz und ziehen nach Belieben missliebige Personen unter fadenscheinigen Vorwänden aus dem Verkehr, um sie für unbegrenzte Zeit festzuhalten. Mittlerweile entführen von der chinesischen Regierung entsandte Einsatzkräfte sogar im Ausland Journalisten, Geschäftsleute, Buchhändler und Dissidenten, die der KPCh ein Dorn im Auge sind. Von der außerordentlichen Auslieferung von Terrorverdächtigen an die Vereinigten Staaten hat man gehört. Dies hier ist die chinesische Version.
Ich rief Whitneys Eltern an, aber sie wussten ebenfalls nichts. Ich fragte befreundete Parteifunktionäre, die Whitney ihre Position verdankten. Keiner von ihnen war bereit, etwas für sie zu tun. Jeder wollte unbedingt vermeiden, mit Whitney in Verbindung gebracht zu werden. Sie alle fürchteten sich vor der Zentralen Disziplinarkommission der Partei, in deren Händen sich Whitney meiner Meinung nach befand.
Je mehr ich herumfragte, desto klarer wurde mir, dass die Personen, die im System der Partei arbeiten, in ihren Beziehungen unablässig Gewinn- und Verlustrechnungen anstellen. Whitney war überaus nützlich für ihre Freunde gewesen. Sie hatte die Beförderung ungezählter Kader in der Kommunistischen Partei und im Staatsapparat arrangiert. Sie hatte die Karriere dieser Leute gefördert und viele Stunden damit verbracht, gemeinsam mit ihnen Strategien für ihr weiteres Vorankommen zu entwerfen. Doch jetzt, da Whitney in Gefahr war, ließen diese Leute sie fallen wie eine heiße Kartoffel.
Während ich mir den Kopf darüber zerbrach, was ich tun konnte, um meinem Sohn die verlorene Mutter zurückzugeben und die Ex-Frau zu retten, die mein Leben so grundlegend verändert hatte, dachte ich über die unglaublichen Geschehnisse in all den Jahren nach, die uns in diese Situation gebracht hatten.
Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte Whitney ein Vermögen angehäuft, das zu Beginn unserer Beziehung unvorstellbar für uns gewesen wäre.
Diese unglaublich talentierte Frau setzte sich in einer patriarchalischen Gesellschaft durch, bewegte sich mit unvergleichlichem Geschick in der an ein Spielcasino erinnernden politischen Umgebung des »neuen China« und nutzte ihr Bündnis mit der Familie eines mächtigen Mannes für einen fast unvorstellbaren Erfolg. Bis es eines Tages vorbei war. Sie verstand, wie China wirklich funktionierte – bis sie es von einem Tag auf den anderen nicht mehr verstand.
Ich war ihr Geschäftspartner und Ehemann. Wir erklommen die Gipfel gemeinsam. Dies ist meine Geschichte, und es ist ihre Geschichte.
1
Nichts an meiner Herkunft deutete darauf hin, dass ich mich eines Tages im wirtschaftlichen und politischen Machtzentrum Chinas wiederfinden würde. Ich wurde nicht in den roten Adel hineingeboren, also in die Gruppe der Nachkommen der elitären kommunistischen Führer, die im Jahr 1949 die Macht in China errungen hatten. Ich war weit davon entfernt, dieser Elite anzugehören. Und meine Persönlichkeit machte mich ebenfalls nicht zu einem geeigneten Kandidaten für eine Machtposition.
Ich wurde im November 1968 in Shanghai in eine Familie hineingeboren, die gespalten war. Da gab es die einen, die nach der chinesischen Machtergreifung verfolgt worden waren, und andere, denen dieses Schicksal erspart geblieben war. Nach kommunistischer Doktrin gehörte mein Vater einer der »fünf schwarzen Kategorien« an. Diese Kategorien waren »Grundbesitzer«, »reicher Bauer«, »Konterrevolutionär«, »schlechtes Element« und »rechtes Element«. Bis zur Revolution von 1949 waren meine Vorfahren Grundbesitzer. Sie waren doppelt belastet, wenn man das Verbrechen hinzuzählt, dass sie Verwandte im Ausland hatten. An jedem anderen Ort der Welt wäre dies ein Vorzug gewesen, aber im China der Fünfziger- und Sechzigerjahre bedeuteten wirtschaftlicher Erfolg und noch dazu internationale Verbindungen, dass man von den Kommunisten als »geborenen Ratte« geschmäht wurde. Die Geringschätzung, die unsere Familie in den Augen der Regierung verdiente, hinderte meinen Vater daran, eine gute Schule zu besuchen. Er hegte sein Leben lang einen tiefen Groll gegen die Welt.
Die Familie meines Vaters besaß Grundstücke in Suzhou, einer Kleinstadt im Mündungsdelta des Yangzi, die wegen ihrer malerischen Gärten und Kanäle auch als »chinesisches Venedig« bezeichnet wird. In unserer Familie erzählte man sich, dass der Shum-Clan im Jahr 1949, als sich die Kommunisten im Bürgerkrieg mit der von Chiang Kai-shek geführten Guomintang durchsetzen konnten, alle Wertgegenstände auf dem Anwesen der Familie vergraben hatte. Auf diesem Grundstück, das von der kommunistischen Regierung konfisziert wurde, steht heute ein staatliches Krankenhaus. Vor einigen Jahren beschrieb mir ein älterer Verwandter genau, wo die Wertgegenstände der Familie vergraben liegen, und versuchte, mich dazu zu bewegen, den Schatz auszugraben. Doch da der chinesische Staat alles, was unter der Erde ist, als sein Eigentum betrachtet, schien mir dieses Vorhaben wenig verlockend.
Mein Großvater väterlicherseits war vor der Revolution ein angesehener Rechtsanwalt in Shanghai gewesen. Als die Kommunisten das Land in einen immer engeren Würgegriff nahmen, hätte er wie viele andere wohlhabende Chinesen fliehen können, aber er konnte sich nicht mit der Aussicht anfreunden, sich in einen verarmten Flüchtling zu verwandeln. In seinen Augen konnte sich Hongkong, der bevorzugte Bestimmungsort für Auswanderer aus Shanghai, nicht mit seiner Heimatstadt messen, die damals als das »Paris des Ostens« galt. Er glaubte dem Versprechen der Kommunisten, sie würden gemeinsam mit den Kapitalisten das »neue China« errichten, und entschloss sich zu bleiben.
Mein Vater verzieh meinem Großvater diese schicksalhafte Entscheidung nie und machte das naive Vertrauen seines Vaters in die Kommunistische Partei dafür verantwortlich, dass ihm seine Jugend gestohlen wurde. Im Jahr 1952 schlossen die Behörden die Anwaltskanzlei meines Großvaters und vertrieben die ganze Familie, darunter meinen Vater, seine zwei Brüder und seine Schwester, aus ihrem dreistöckigen Reihenhaus in Shanghai, das mein Großvater vor der Revolution mit Goldbarren gekauft hatte. Daraufhin kehrte er mit der gesamten Familie nach Suzhou zurück. Nur mein Vater, der zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt war, blieb in Shanghai, um die Schule abzuschließen.
Es war eine schwere Zeit für ihn. Er kam bei wechselnden Verwandten unter und war, wenn es ums Essen und einen Platz zum Schlafen ging, auf deren Gnade angewiesen. Oft ging er mit leerem Magen zu Bett. Ein Onkel, der vor der kommunistischen Machtergreifung ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen war, behandelte ihn sehr gütig, obwohl die Revolution ihm übel mitgespielt hatte. Die neue Regierung beschlagnahmte sein Unternehmen und degradierte ihn zum Rikschafahrer in einer der Fabriken, die sein Eigentum gewesen waren. Die Kommunisten verstanden sich meisterhaft auf derartige Strafmaßnahmen, die dazu dienten, den kostbarsten Besitz eines Mannes zu zerstören: seine Würde und Selbstachtung.
Als Spross einer kapitalistischen Juristenfamilie in einem kommunistischen Land lernte mein Vater, sich unauffällig zu verhalten. Auf sich allein gestellt zu sein, machte ihn widerstandsfähig und lehrte ihn, sich unter widrigen Bedingungen zu behaupten. Aber seine Notlage vertiefte nur seinen Groll gegenüber seinem Vater, der sich die Chance hatte entgehen lassen, mit seiner Familie aus China zu fliehen.
Die Erfahrung, allein und hungrig in Shanghai aufzuwachsen, weckte bei meinem Vater eine tiefe Angst vor engen Beziehungen zu den Menschen in seiner Umgebung. Er hasste es, jemandem etwas schuldig zu sein, und verließ sich nur auf sich selbst – eine Haltung, die auch ich mir aneignen sollte.
Noch heute fühle ich mich nicht wohl, wenn ich jemandem etwas schulde. Erst als ich die Frau kennenlernte, die meine Ehefrau werden sollte, lernte ich, wie sehr man sich auf diese Art isolieren kann. Wenn du im Gezeitenwechsel des Lebens nie jemandem verpflichtet bist, erklärte mir Whitney, wird dir ebenfalls nie jemand verpflichtet sein, und es wird dir nie gelingen, tiefer gehende Beziehungen zu knüpfen.
Ich lebte jahrelang in Furcht vor meinem Vater, aber mittlerweile habe ich verstanden, dass er ein einsamer Mensch war, der allein gegen die Welt kämpfte.
Aufgrund seines für die Partei inakzeptablen Klassenhintergrundes konnte mein Vater keine der besseren Hochschulen besuchen. Stattdessen wurde er einer pädagogischen Hochschule in Shanghai zugewiesen, wo er zum Chinesischlehrer ausgebildet wurde. Mit mehr als 1,80 Metern war er für einen Mann seiner Generation sehr groß und wurde zum Star der Volleyballmannschaft seiner Hochschule. Sein ungeheurer Fleiß und seine Sportlichkeit weckten vermutlich die Aufmerksamkeit meiner Mutter. Die beiden lernten sich im Jahr 1962 an der pädagogischen Hochschule kennen. Meine Mutter war ebenfalls attraktiv, mit gut 1,75 Metern sehr groß für eine Chinesin und ebenfalls eine Sportlerin – sie war Leichtathletin. Obwohl sie die tristen Mao-Uniformen trugen und ihre Gesichter auf den briefmarkengroßen Schwarz-Weiß-Fotos jener Zeit völlig ausdruckslos sind, waren die beiden ein gut aussehendes Paar.
Die Familie meiner Mutter hatte ebenfalls Verwandtschaft im Ausland, entging jedoch der Verfolgung. Mein Großvater mütterlicherseits stammte aus der Provinz Guangdong unweit von Hongkong. Wie viele chinesische Großfamilien aus dem Süden hatte auch die meiner Mutter Verwandte in aller Welt. Sieben Brüder und Schwestern meines Großvaters waren nach Indonesien, Hongkong und in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Vor der kommunistischen Machtergreifung im Jahr 1949 hatte der Vater meiner Mutter Firmen in Hongkong und Shanghai geleitet. Ende der Vierzigerjahre vertrat er die Eigentümer in Verhandlungen mit einem Arbeitnehmervertreter namens Jiang Zemin aus der Zahnpastafabrik Shanghai. Jiang sollte im Jahr 1989 zum Vorsitzenden der KPCh aufsteigen und wurde 1993 Staatspräsident. Als die Kommunisten 1949 Shanghai einnahmen, zog die Familie meiner Mutter nach Hongkong um, aber nach einem Zerwürfnis mit meinem Großvater kehrte meine Großmutter mit den drei Kindern nach Shanghai zurück. Das Paar ließ sich jedoch nie scheiden, und mein Großvater unterstützte meine Großmutter bis zu seinem Tod mit Geldsendungen.
Die Familie meiner Mutter litt nicht unter der kommunistischen Herrschaft. Nach der Revolution von 1949 nutzte die Kommunistische Partei Familien wie die ihre als Einnahmequellen, da die Verwandten aus dem Ausland Devisen schickten. Das half China, im Kalten Krieg das von den Vereinigten Staaten verhängte Handelsembargo zu überstehen. Die Partei bezeichnete die Verwandten, die aus dem Ausland Geld überwiesen, als »patriotische Auslandschinesen«, womit dem Apparat signalisiert wurde, die in China zurückgebliebenen Familien nicht zu drangsalieren. Schließlich boten die Kommunisten meinem Großvater an, die Leitung der Hongkonger Niederlassung des staatlichen Erdölkonzerns China National Petroleum Corporation zu übernehmen.
Meine Großmutter mütterlicherseits war eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Als junge Frau war sie eine Schönheit. Sie stammte aus einer wohlhabenden Familie in der Küstenstadt Tianjin, die vor der kommunistischen Machtergreifung das Geschäfts- und Handelszentrum Nordchinas war. Sie lebte in einem Reihenhaus in Shanghai, das die Familie behalten durfte. Jeden Tag stand sie um vier Uhr morgens auf, um Gymnastik in einem nahe gelegenen Park zu machen. Anschließend kaufte sie sich zum Frühstück eine Tasse Sojamilch und ein youtiao, einen in Öl ausgebackenen Teigkringel, und zog sich ins Haus zurück, wo sie rauchte (was zu jener Zeit kaum eine chinesische Frau tat) und Patiencen legte. Sie lebte von den Geldsendungen meines Großvaters aus Hongkong und arbeitete nicht einen einzigen Tag ihres Lebens. Selbst in den finstersten Momenten der Kulturrevolution, als Tausende im Westen ausgebildete Menschen ermordet wurden, nur weil sie mit westlichen Vorstellungen von Wissenschaft, Demokratie und Freiheit sympathisierten, hatte meine Großmutter Hausbedienstete. Dank ihrer Verbindung zu einem »patriotischen Auslandschinesen« blieb sie unbehelligt.
Bis ins hohe Alter blieb sie gesellig und hatte einen großen Bekanntenkreis. Ich liebte es, sie an Wochenenden in ihrem Haus zu besuchen. Sie mahlte Sesamkörner zu einer schmackhaften Paste und setzte mir gedämpfte baozi vor, mit Fleisch und Gemüse gefüllte faustgroße Teigtaschen, die eine Spezialität ihrer Heimatstadt Tianjin waren.
Meine Mutter hatte eine sehr viel glücklichere Kindheit als mein Vater. Sie hatte das zugängliche Wesen ihrer Mutter geerbt, war bei ihren Schulkameraden beliebt und hatte eine heitere Lebenseinstellung. Meine Eltern waren gegensätzliche Charaktere, was sich vor allem zeigte, wenn es darum ging, ein Risiko einzugehen: Meine Mutter ließ sich mit Freuden auf Wagnisse ein, während mein Vater ihnen aus dem Weg ging. Meine Mutter nutzte später ihr verblüffendes Gespür für Investitionsmöglichkeiten, was es meinen Eltern erlaubte, vom Immobilienboom in Hongkong und Shanghai zu profitieren.
Im Jahr 1965 heirateten meine Eltern mit Erlaubnis der Partei. Die Parteibürokratie wies den beiden Posten als Lehrer in verschiedenen Sekundarschulen zu. So funktionierte das damals: Die Partei kontrollierte einfach jeden Aspekt des Lebens. Man konnte sich weder den Arbeitsplatz noch den Hochzeitstag selbst aussuchen. Mein Vater unterrichtete Chinesisch und Englisch an der Xiangming-Sekundarschule in Shanghai; Englisch hatte er aus dem Radio gelernt. Er trainierte die Mädchenvolleyballmannschaft der Schule, die regelmäßig um die Stadtmeisterschaft von Shanghai kämpfte. Seine jahrelange gewissenhafte Vorbereitung machte sich schließlich bezahlt, als ihm das Parteikomitee der Schule den Ehrentitel »Modelllehrer« verlieh.
Die Schule, an der meine Mutter unterrichtete, war mit dem Fahrrad eine Stunde von unserem Haus entfernt. Sie war Mathematiklehrerin und bei ihren Schülern sehr beliebt. Neben ihrer Gewissenhaftigkeit zeichnete sie aus, dass sie in der Lage war, die Dinge auch mit den Augen eines anderen zu betrachten. Vater hingegen war ein Mensch, der die Dinge entweder auf seine Art oder gar nicht machte. Meine Mutter war flexibler. Diese Eigenschaft kam ihr im Mathematikunterricht sehr zugute, vor allem in einer chinesischen Sekundarschule, wo der Lehrplan sehr anspruchsvoll ist. Da sie imstande war, sich in ihre Schützlinge hineinzuversetzen, konnte sie ihnen leichter einen Weg zur Lösung des Problems aufzeigen. Sie machte ihren mäßigenden Einfluss geltend, als die Schule von politischen Kampagnen erfasst wurde und Schüler und Lehrer übereinander herfielen und einander Verstöße gegen das ideologische Dogma unterstellten. Wenn in den »Kritikversammlungen« ein Schüler in die Ecke getrieben wurde, schritt meine Mutter ein und beendete die Konfrontation, bevor sie zu gehässig wurde. Sie war die einzige Lehrerin an der Schule, die das wagte. Ihr Status als Tochter eines »patriotischen Auslandschinesen« gewährte ihr einen gewissen Schutz, was es ihr erlaubte, bedrängten Schülern zur Seite zu stehen. Es war, als werfe sie einem Ertrinkenden ein Seil zu und ziehe ihn an Land. Die Schüler vergaßen nie, was meine Mutter für sie tat. Sie halten noch heute Ehemaligentreffen ab, bei denen sie sich an diese Erlebnisse erinnern.
Meine Mutter war das zweite von drei Kindern. Sie hatte zwei Brüder. Nach der Heirat meiner Eltern machten sich meine Onkel über ihre Schwester lustig, weil sie sich einen Mann ausgesucht hatte, der einer der minderwertigen »fünf schwarzen Kategorien« angehörte. Sie ließen meinen Vater bei jeder Gelegenheit spüren, dass sie einen höheren Status genossen und mehr Geld besaßen, obwohl sie dieses Geld nur der monatlichen Sendung meines Großvaters aus Hongkong verdankten. Einer meiner Onkel kaufte sich von diesem Geld das erste Motorrad in der Nachbarschaft und rieb meinem Vater den neuen Besitz unter die Nase.
Ich wurde in der Kulturrevolution geboren. Die Partei schickte meine Eltern aufs Land, damit sie von den Bauern lernten. Dieses vom Vorsitzenden Mao erfundene Programm zerstörte Millionen Menschenleben und stürzte die chinesische Wirtschaft in eine tiefe Krise. Anders als Hunderttausende Einwohner Shanghais, die in abgelegene arme Regionen verbannt wurden, hatten meine Eltern und ich das Glück, nie die Aufenthaltsgenehmigung für die Stadt zu verlieren. So konnten meine Eltern abwechselnd unter den chinesischen Bauern leben, weshalb ich nie allein war.
Ich war ein kräftiges Baby und wuchs schnell, weshalb ich meinem chinesischen Namen alle Ehre machte, denn Dong bedeutet in dieser Schreibung »Säule«. Aufgrund meiner Größe – ich bin gut 1,90 Meter groß – und meiner Sportlichkeit fiel mir unter Gleichaltrigen häufig die Führung zu. Meine Eltern förderten meine Liebe zum Lesen. Von klein auf gaben sie mir Comics über die Figuren der chinesischen Mythologie, die Helden der kommunistischen Revolution und des Befreiungskriegs gegen Japan zu lesen, daran erinnere ich mich noch gut. Ich wuchs mit den Geschichten über Xiao Gazi auf, ein Kind, das im Zweiten Weltkrieg zur Waffe greift und japanische Invasoren tötet. Diesen Patriotismus verinnerlichte ich – und ich liebte das Erzählen. Meine Spielkameraden versammelten sich um mich, damit ich ihnen die Geschichten erzählte, die ich las und die ich durch selbst erfundene ergänzte. Ich erinnere mich noch an ein verrücktes Abenteuer über eine Höhle, die sich auftat und die Fahrzeugkolonne eines chinesischen Generals verschlang.
Die Comics, in denen es von Helden wimmelte, die sich opferten, um das Vaterland und die kommunistische Revolution zu verteidigen, weckten in mir eine tiefe Liebe zu China. Sie gaben die Richtung für mein späteres Leben vor und nährten bei mir die Überzeugung, dass ich mich ebenfalls in den Dienst des Aufbaus meines Landes stellen musste. Mir wurde beigebracht, China als großartiges Land zu betrachten und an seine Versprechen zu glauben.
In Shanghai lebten wir in dem Haus, das die Kommunisten im Jahr 1952 meinem Großvater väterlicherseits weggenommen hatten. Es war ein Reihenhaus im englischen Stil in einer Seitenstraße des Huaihai-Boulevards, einer wichtigen Verkehrsader in der ehemaligen Französischen Konzession, einem begrünten Viertel, das vor der Revolution von 1949 Teil des französischen Kolonialreichs gewesen und von den Franzosen verwaltet worden war. Die Kommunisten wiesen den früheren Hauseigentümern oft einen kleinen Winkel ihres alten Heims zu, um die gewaltige Macht des Staates zu demonstrieren. Uns wurden zwei Zimmer im ersten Stock zugeteilt. In das alte Wohnzimmer meines Großvaters im Erdgeschoss zog ein Arzt mit seiner Familie ein. Er hatte vor der Revolution in England studiert, und in seiner Wohnung türmten sich ausländische medizinische Fachzeitschriften. Über uns im zweiten Stock wohnten entfernte Verwandte. Wir insgesamt zehn Bewohner teilten uns ein Bad und eine Küche. Um die Ecke befand sich eine der besten Bäckereien Shanghais, und den ganzen Tag hing der verlockende Duft frisch gebackenen Brots über der Straße.
Meine Eltern schliefen in einem Doppelbett in einem Winkel des Zimmers. Mein Bett stand in einer anderen Ecke. Die Betten waren durch eine Kommode voneinander getrennt. Neben meinem Schlafplatz stand ein kleiner Tisch und darauf unser kostbarster Besitz, ein Radio. Mein Vater saß stundenlang auf einem Stuhl vor dem Gerät, um Englisch zu lernen. Und wenn meine Eltern zum Kochen in die Küche hinuntergingen, legte ich meine Hausaufgaben weg und schaltete das Radio ein, um mir Geschichten über die chinesischen Helden der Vergangenheit anzuhören, wobei ich mit dem einen Ohr dem Erzähler lauschte und mit dem anderen auf die Schritte meiner Eltern auf der Treppe horchte. Sie wollten, dass ich mich aufs Lernen beschränkte. Wie viele chinesische Kinder war ich ein Schlüsselkind. Ich kam mittags allein nach Hause und kochte mir mein Essen selbst. Schon in jungen Jahren machte ich mir auch mein Frühstück selbst.
Mein Vater konnte sich nicht mit seinem Schicksal abfinden und hegte ungebrochen seinen Groll. Doch er ließ seine Unzufriedenheit an mir aus. Er zerrte mich häufig in die Mitte des Raums, wo er mich im schummrigen fluoreszierenden Licht einer Glühbirne, die an zwei Drähten von der Decke herabhing, unbarmherzig verprügelte. Er schlug mit einem Gürtel, mit dem Handrücken oder einem steinharten hölzernen Lineal auf mich ein. Dabei war ich ein Vorzeigekind. Ich gehörte zu den Ersten in meiner Klasse, die in die Kleine Rote Garde aufgenommen wurden, eine Jugendorganisation der Kommunistischen Partei. Ich war zum Klassensprecher ernannt worden und galt als geborene Führungspersönlichkeit. Aber meinem Vater war all dies gleichgültig. Er schlug mich trotzdem.
Eines Tages vergaß ich eine Hausaufgabe. Chinesische Lehrer sind sehr beflissen, wenn es darum geht, die Eltern über Fehltritte ihrer Kinder zu informieren. An jenem Abend verprügelte mich mein Vater so brutal, als gäbe es kein Morgen. Die Frau des Arztes im Erdgeschoss hörte mich wimmern, kam die Treppe herauf, klopfte an die Tür und forderte meinen Vater in ruhigem Ton auf, endlich aufzuhören. Er gehorchte. Meine Eltern hatten Respekt vor dieser Familie, was vor allem daran lag, dass der Arzt im Westen studiert hatte. Seine Frau wurde meine Retterin. Wann immer mein Vater über mich herfiel, flehte ich zum Himmel, dass meine Schreie die Nachbarin dazu bewegen würden, heraufzukommen.
Meine Eltern waren der Meinung, ich hätte es sehr gut. Sie sagten, andere Eltern bestraften ihre Kinder, indem sie sie zwängen, stundenlang auf einem gezahnten Waschbrett zu knien, das ihnen die Haut von den Knien schälte. Aber dieses Argument überzeugte mich nicht. Ich träume immer noch von diesen Schlägen. Ich wache schweißgebadet und mit rasendem Herz auf. Mein Vater und ich haben uns nie über die Vergangenheit ausgesprochen. Er deutete nicht ein einziges Mal an, dass er es im Nachhinein bereute, mich so brutal misshandelt zu haben.
Meine Mutter verteidigte ihre Schüler, aber mir stand sie nie bei. Stattdessen strafte sie mich mit Unzufriedenheit, die sie jedoch nicht mit Schlägen, sondern mit Worten ausdrückte. Ich war schon über dreißig, als sie immer noch regelmäßig erklärte, ich sei »dümmer als eine Viehherde und blöder als ein Korb voll Gemüse«.
»Dumme Vögel müssen früh fliegen lernen«, sagte sie zu mir, womit sie mir sagen wollte, dass ich sehr viel härter als andere Kinder arbeiten müsse, wenn ich etwas aus mir machen wolle.
Ich wuchs also in einem von Erniedrigung und Strafe geprägten Elternhaus auf. Komplimente gab es bei uns so selten wie Eier. Meine Eltern hielten mir meine Fehler vor. »Bilde dir bloß nichts ein«, pflegte meine Mutter jedes Mal zu sagen, wenn ich über einen kleinen Erfolg berichtete. Schließlich beschränkte ich mich meinen Eltern gegenüber im Wesentlichen darauf, Kritik zu vermeiden, anstatt Lob zu ernten. Es ging nicht darum, Erfolge anzustreben, sondern darum, Fehlschläge zu vermeiden. Ich lebte in der ständigen Angst, nicht gut genug zu sein. Gleichzeitig machte ich früh die Erfahrung, dass zwischen der Welt außerhalb meines Elternhauses, wo ich Anerkennung als Führungspersönlichkeit, als Geschichtenerzähler, als Sportler und sogar als liebenswerter Mensch fand, und der Welt unserer winzigen Wohnung, in der ich mit meinen Eltern lebte, für die ich eine große Enttäuschung war, ein tiefer Graben klaffte. Diese Erfahrung dürften viele chinesische Kinder machen, denn in diesem Land sind die Erwartungen hoch und die Kritik allgegenwärtig. Chinesische Eltern glauben, dass Kinder nicht aus Erfolgen, sondern aus Fehlschlägen lernen. Und zeit meines Lebens nahm die Spannung zwischen den beiden Welten nur immer weiter zu.
Dennoch werde ich meinen Eltern stets dafür dankbar sein, dass sie mir halfen, früh lesen zu lernen, und dass sie mich darin bestärkten, viel zu lesen. Sie beide wussten genau, welche Lektüre mich fesseln würde. Zunächst machten sie mich mit den Comics bekannt. Bald ging ich zu wuxia xiaoshuo über, den Kampfkunstromanen, die später Filme wie den Kassenschlager Tiger and Dragon des Regisseurs Ang Lee inspirierten.
Da ich als Einzelkind in einer Gesellschaft aufwuchs, in der zu jener Zeit noch jedermann Geschwister hatte, war ich oft allein. Also las ich. Die Kampfkunstbücher entführten mich wie die jungen Leser heutiger Harry-Potter-Romane schon damals in eine Fantasiewelt. Diese Romane waren voll von komplexen Beziehungen an königlichen Höfen, Kämpfen auf Leben und Tod, Liebe und Hass, Rivalität, Rache und Verschwörungen. Meine Lieblingsgeschichten entwickelten sich alle ähnlich: Ein Junge muss mit ansehen, wie seine Eltern ermordet werden. Er lebt im Elend, muss um Nahrung betteln und im Winter gegen das Erfrieren kämpfen. Er wird vom Mörder seiner Eltern gejagt, der die ganze Familie auszulöschen versucht. Er verirrt sich in der Wildnis und gerät in eine Höhle, in der er einem Wandermönch begegnet, der ihn in die Geheimnisse der Kampfkunst Wushu einweist. Nach Jahren der Bedrängnis kehrt er als erwachsener Mann heim, nimmt Rache und eint die Meister der Kampfkünste, um allen Menschen unter dem Himmel Frieden zu bringen. Ich sah mich selbst in dieser Geschichte, ich bekämpfte und besiegte meine eigenen Dämonen.
Meine Grundschule war nicht weit vom Jinjiang-Hotel entfernt, das bis 1949 eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Shanghais gewesen war. Zu meiner Schulzeit war es eines von nur noch zwei Hotels in der Stadt, in denen ausländische Reisende abstiegen. Da unsere Schule so nahe beim Jinjiang lag, brachte die Propagandaabteilung der Stadtverwaltung oft ausländische Reisegruppen zu uns, um ihnen die Errungenschaften des chinesischen Bildungswesens vorzuführen. Die Kommunistische Partei unterteilte die Welt in Feinde und Verbündete, und im Bemühen um internationale Unterstützung bemühte sich das Regime sehr um die »ausländischen Freunde«, darunter linke Intellektuelle, Journalisten und Politiker. Jedes Mal, wenn eine Gruppe »ausländischer Freunde« in der Schule auftauchte, führten die besten Mathematikschüler an der Tafel ihre Rechenkünste vor, und die besten Sportler wurden in eine Sportstunde geschickt. All das war Teil der großen kommunistischen Tradition, verblüffte Besucher hinters Licht zu führen und von der Überlegenheit des Sozialismus chinesischer Prägung zu überzeugen.
Eines Tages erschien ein Vertreter der riesigen, nach sowjetischem Vorbild organisierten Sportbürokratie in unserer Schule, und die sportlichsten Schüler wurden angewiesen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen. Der Bürokrat untersuchte meine Hände und Füße und entschied, dass ich Schwimmer werden sollte. Mein Vater ging mit mir in ein städtisches Hallenbad in der Nähe meiner Grundschule und brachte mir das Schwimmen auf die traditionelle chinesische Art bei: Er warf mich ins Becken. Ich kämpfte mich an die Oberfläche und schluckte eine große Menge Wasser. Wenige Wochen später war ich bereit für ein Probetraining bei einem örtlichen Schwimmteam. Im Alter von sechs Jahren sicherte ich mir einen Platz in der Mannschaft.
An sieben Tagen in der Woche lief ich von da an zu Fuß zum Training in einem vierzig Minuten von meinem Elternhaus entfernten Schwimmbad. Ich stand jeden Morgen um halb sechs Uhr auf, machte mir das Frühstück und marschierte durch die verwinkelten Gassen Shanghais zum Schwimmbad. Ich fand es spannend, immer neue Abkürzungen zu finden. Wenn ich in eine mir unbekannte Gasse einbog, wusste ich nie, wo ich wieder herauskommen würde. Ich lernte rasch, dass es viele Wege gab, um denselben Ort zu erreichen. Wir schwammen von sieben bis acht Uhr, und anschließend machte ich mich zu Fuß auf den Weg zur Schule. Oft fand am Nachmittag ein weiteres Training statt. An Wochenenden nahmen wir an Wettkämpfen teil. Ich wurde rasch der Jahrgangsbeste im Rückenschwimmen; im Kraul war ich der Zweite in der Rangliste. Mein stärkster Rivale war ein Junge aus der Nachbarschaft, der es schließlich bis ins chinesische Nationalteam schaffte. Wir gingen normalerweise zusammen zum Schwimmbad. Wenn mich mein Vater am Vorabend geschlagen hatte, versuchte ich in der Umkleidekabine die Spuren auf Armen, Beinen und Rücken zu verbergen. Aber der andere Junge bemerkte die Verletzungen. Also sagte ich ihm, er könne sich glücklich schätzen, weil sein Vater ihn nicht verprügelte. Er lächelte traurig.
Unser Betreuer, Coach Shi, war ein typischer chinesischer Trainer: klein, gedrungen, übellaunig. Die Winter in Shanghai sind kalt, aber da die Stadt südlich des Yangzi liegt, wurde entsprechend den von der Zentralregierung vorgegebenen Richtlinien nirgendwo geheizt. An Wintermorgen ließ uns Coach Shi zu Beginn des Trainings einige Bahnen delfinschwimmen, um die dünne Eisschicht zu zerschlagen, die sich in der Nacht an der Oberfläche des Beckens gebildet hatte. Manchmal schütteten die Trainer aus großen Thermosflaschen heißes Wasser ins Becken und sahen uns dabei zu, wie wir uns wie Fische, die um Futter kämpfen, im vergeblichen Bemühen, der eisigen Kälte zu entkommen, in den wärmeren Bereichen abstrampelten. Die Trainer amüsierten sich köstlich.
Es hatte Vorteile, dem Team anzugehören. Nach dem Nachmittagstraining bekamen wir ein ordentliches Essen. Reis und Fleisch waren zu jener Zeit noch rationiert, aber in der Mannschaftskantine verwöhnten sie uns mit Fleisch – nicht nur mit Fett –, mit gutem Gemüse und vor allem mit etwas, was wir alle liebten: Hin und wieder bekamen wir ein Ei. Einmal im Jahr schenkten sie uns ein Hühnchen, das wir mit nach Hause nehmen konnten. Ich lernte, mir Extrarationen zu sichern, die ich unter meinen Mannschaftskameraden verteilte, um mir ihre Loyalität zu erkaufen. Nahrung war in jenen Tagen kostbar; man konnte sie einsetzen, um sich in den Leitwolf des Rudels zu verwandeln.
Das Schwimmtraining trug wesentlich dazu bei, mich zu der Person zu machen, die ich heute bin. Es lehrte mich Selbstvertrauen und Beharrungsvermögen. Ich erkannte, wie beglückend es sein kann, ein Ziel zu verfolgen. Durch das Schwimmen begegnete ich Menschen, die nichts mit meinem normalen Umfeld zu tun hatten. Noch heute spüre ich die Wirkung dieser Erfahrungen.
Als Junge hatte ich nur sehr nebulöse Vorstellungen von der Politik. Ich erinnere mich noch, wie ich in den Jahren, als die Kulturrevolution das Land ins Chaos stürzte, an Propagandaplakaten vorbeiging, auf denen zur erbarmungslosen Vernichtung der Klassenfeinde aufgerufen wurde. Ich hörte die Soldaten in einer Kaserne unweit der Schule Parolen gegen ideologische »Abweichler« skandieren und den »Großen Vorsitzenden Mao« preisen. Ich sah politische Häftlinge mit Spotthüten, die auf offenen Lastern quer durch die Stadt zur Hinrichtung gefahren wurden.
Dann starb am 9. September 1976 Mao. Ich verstand genauso wenig wie die übrigen Achtjährigen in meiner Klasse, was das für das Land bedeutete. Als die Schulleitung die Nachricht verkündete, begannen unsere Lehrer zu weinen, und wir brachen ebenfalls in Tränen aus. Es wurde uns verboten, zu spielen oder zu lächeln. Einige Schüler handelten sich eine Rüge ein, weil sie zu viel Lärm machten.
Etwa ein Jahr später kehrte der altgediente Revolutionär Deng Xiaoping nach jahrelangem Rückzug ins innere Exil an die Macht zurück. Deng zog die Fäden bei der Verhaftung der »Viererbande«, des radikalen inneren Kreises von Mao. Im Jahr 1979 leitete er jene historischen Reformen ein, die China schließlich in die Wirtschaftsmacht verwandelten, die es heute ist. Aber meine Familie sollte diese Zeitenwende nicht in China erleben. Meine Eltern hatten andere Pläne.
2
Im Sommer 1978 brach ich nach dem Ende des Schuljahres mit meiner Mutter nach Hongkong auf. Sie sagte mir, wir würden einen kurzen Ausflug unternehmen; also verabschiedete ich mich nicht einmal von meinen Freunden. Es sollte eine Reise werden, auf der ich vieles zum ersten Mal tat: Unter anderem reiste ich zum ersten Mal im Flugzeug und trank meine erste Coca-Cola. Beides beeindruckte mich nicht allzu sehr.
Wir warteten in einer schläfrigen Grenzstadt namens Shenzhen auf die Erlaubnis, nach Hongkong auszureisen. Der Ort hatte zu jener Zeit 36000 Einwohner. (Heute leben dort fast 13 Millionen Menschen, und Shenzhen ist der Sitz der Technologieriesen Tencent und Huawei.) Wir brauchten eine behördliche Genehmigung, um das Land verlassen zu können. Jeden Tag flehte meine Mutter die grimmig dreinblickenden Grenzpolizisten, die den Menschenstrom aus China kontrollierten, um Erlaubnis an, die Grenze überqueren zu dürfen. Nach zwei Wochen ließen sie uns endlich durch. Erst später begriff ich, dass meine Mutter nicht einfach nur Verwandte besuchen wollte. Sie wartete auf eine »befristete Ausreisegenehmigung«, die uns in Wahrheit die dauerhafte Auswanderung ermöglichen sollte.
Das Vorhaben, Shanghai zu verlassen, war ein spontaner Entschluss. Nach dem Ende der Kulturrevolution im Jahr 1976 versuchte die Regierung erneut, sich bei den Auslandschinesen das Kapital zu beschaffen, das gebraucht wurde, um die chinesische Wirtschaft zu retten. Vertreter des Amts für auslandschinesische Angelegenheiten in Shanghai forderten meine Mutter auf, ihrem Vater nahezulegen, er solle einige unserer wohlhabenderen Verwandten in Indonesien und anderswo dazu bewegen, in Shanghai zu investieren. Dies war der Beginn eines Gesprächs mit den Behörden über ein Ausreisevisum, das es meiner Mutter erlauben würde, ihren Vater in Hongkong zu besuchen. Meine Eltern wollten kein Kapital nach Shanghai locken, sondern sahen eine Chance, aus China hinauszukommen. Mein Vater hatte es meinem Großvater sein Leben lang nachgetragen, dass dieser nicht ins Ausland geflohen war, als er im Jahr 1949 die Chance dazu gehabt hatte. Jetzt, da sich eine weitere Chance bot, wollte er nicht denselben Fehler begehen wie sein Vater.
Wir kamen mit zehn Hongkong-Dollar in der britischen Kronkolonie an, was etwas mehr als zwei US-Dollar entsprach. Mein Großvater gewährte uns Zuflucht in seiner 70-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Schlafzimmern. In einem Zimmer schlief mein Großvater. Das andere bewohnte der ältere Bruder meiner Mutter, der sieben Jahre früher ausgewandert war, mit seiner vierköpfigen Familie. Meine Mutter und ich quetschten uns in das winzige Wohnzimmer. Ich schlief auf einer ausklappbaren Couch. Ich vermisste unsere Zweizimmerwohnung in Shanghai. Trotz der Enge war sie doch ein Heim gewesen. In Hongkong hatte ich lediglich eine Schlafstelle.
Meine Mutter stürzte sich in das Hongkonger Leben. Da ihr Vater in ihrer Kindheit Kantonesisch mit ihr gesprochen hatte, hielten die Leute sie für eine Einheimische. Und dank ihres Mathematikstudiums fand sie einen Job als Buchhalterin in einer Textilfabrik. Nach Feierabend besuchte sie einen Buchhaltungskurs, um ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Meine Mutter kehrte mehrfach nach Shanghai zurück, um die Behörden dazu zu bewegen, meinen Vater ebenfalls ausreisen zu lassen. Die Ausgaben für diese Reisen hätten sie beinahe ruiniert. Unter der Herrschaft Deng Xiaopings stellten die Behörden in Shanghai die Verfolgung von Menschen ein, die Verwandte im Ausland hatten. Doch der chinesische Staat sträubte sich weiterhin dagegen, ganze Familien ausreisen zu lassen. Die Regierung erschwerte die Familienzusammenführung, es war das Druckmittel der Wahl gegenüber den Auslandschinesen. Nachdem meine Mutter die zuständigen Beamten zwei Jahre lang hartnäckig bearbeitet hatte, gaben sie schließlich nach. Sie erinnert sich noch heute an den Namen des Beamten, der schließlich die Ausreise meines Vaters bewilligte.
Die Aussicht auf das Wiedersehen mit meinem Vater beunruhigte mich. Aber er hörte immerhin auf, mich zu schlagen. Die Gegenwart all der Verwandten, die sich in der Wohnung meines Großvaters drängten, gewährte mir ein gewisses Maß an Schutz. Abgesehen davon, waren meine Eltern derart damit beschäftigt, sich über Wasser zu halten, dass wir voneinander kaum mehr sahen als etwa die Besatzungen von zwei Schiffen, die in der Nacht aneinander vorübergleiten. Nicht dass unsere Beziehung sich dadurch irgendwie verbesserte. Mein Vater bewies mir gegenüber stets große Härte; er behandelte mich nie liebevoll. Nach seiner Ankunft in Hongkong blieb ich auf der ausziehbaren Couch, und meine Eltern schliefen in einem Bett hinter einem behelfsmäßig aufgehängten Vorhang.
Meinem Vater fiel die Eingewöhnung in der Kronkolonie schwerer als meiner Mutter. Er war 37 Jahre alt und beherrschte den kantonesischen Dialekt nicht. In Shanghai hatte er als Lehrer an einer Oberschule Auszeichnungen gewonnen, aber Hongkong erkannte Lehramtsbefähigungen aus Festlandchina nicht an. Mein Großvater war freundlich zu ihm, aber mein Onkel und dessen Frau schauten auf ihn herab und ließen ihn unentwegt spüren, dass er unfähig war, eine angemessene Arbeit zu finden – irgendetwas Besseres, als im größten Tiefkühllager Hongkongs gefrorenes Fleisch herumzukarren.
Es sollte gerade diese Halsstarrigkeit meines Vaters sein, die ihm die Kraft gab, sich zu behaupten. Auch er besuchte nach der Arbeit die Abendschule und machte schließlich einen MBA-Abschluss in Betriebswirtschaft. Er arbeitete auch am Wochenende und wenn er krank war, und oft verließ er das Büro erst spätabends. In einem Unternehmen, in dem es normal war, dass »Dinge vom Lastwagen fielen«, erwarb sich mein Vater den Ruf unerschütterlicher Redlichkeit. Er stieg in der Hierarchie auf und wurde nach sieben Jahren zum Geschäftsführer der Firma ernannt. Ich erinnere mich noch an den Abend, an dem uns sein Chef einlud, um die Beförderung zu feiern. Damals fuhr ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Rolls-Royce. Ich war hingerissen von den schimmernden Walnussarmaturen.
Ich brauchte Jahre, um mir dessen bewusst zu werden, aber mitzuerleben, wie sich meine Eltern in Hongkong anstrengten, um unsere Familie aus der Armut zu befreien, hatte eine nachhaltige Wirkung. Wir waren in einer verzweifelten Lage. Drei Jahre lang hausten wir im Wohnzimmer meines Großvaters. Wir hatten kein eigenes Bad. Es fiel uns schwer, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber meine Eltern wussten beide aus Erfahrung, wie das Leben am anderen Ende der Fahnenstange aussah und was zu tun war, um sich aus der misslichen Lage zu befreien. Also machten sie sich an die Arbeit. Ich lernte diese Lektion von ihnen.
Mein Großvater wohnte in Mei Foo Sun Chuen, einer aus 99 Hochhaustürmen bestehenden Wohnanlage für die Mittelschicht im Bezirk Kowloon. Irgendwann konnte mein Vater das Leben mit Schwager und Schwägerin nicht mehr ertragen, und wir zogen in eine eigene Wohnung in einem heruntergekommenen Viertel namens Yau Mai Tei um, wo es von Gangstern, Drogenhändlern und Prostituierten wimmelte. Auch dieser Stadtteil gehörte zu Kowloon. Der Chef meines Vaters ließ uns kostenlos im zweiten Stock eines schäbigen Hauses in einem kahlen Einzimmerstudio wohnen, das mit Spanplatten in mehrere Sektionen unterteilt war. In einem Winkel befanden sich eine Dusche und eine defekte Toilette, aber wir mussten sie zumindest nicht mit zwei weiteren Familien teilen.
Nachts übernahmen die Ratten die Herrschaft über die Wohnung und kletterten über uns hinweg, während wir schliefen. Wenn ich aus der Schule heimkehrte, schlich ich durch das dunkle Treppenhaus und einen schummrigen Flur, ohne zu wissen, wer oder was mich hinter der nächsten Ecke erwartete. In der Wohnung angekommen, verriegelte ich sie oft doppelt. Manchmal schlief ich ein, und meine Eltern mussten gegen die Tür hämmern, um mich aufzuwecken, damit ich ihnen öffnete.
Der Umzug nach Hongkong war ein Schock für mich. Das hatte auch damit zu tun, wie meine Eltern damit umgingen. Sie hatten mich über ihre Absichten im Unklaren gelassen. Ich glaubte, es sei einfach ein verlängerter Urlaub, in dem ich auch ein bisschen zur Schule ging. Erst als ich das erste Halbjahr in der neuen Schule hinter mir hatte, verriet mir meine Mutter, dass wir in Hongkong bleiben würden.
Das Leben in der Kronkolonie unterschied sich vollkommen von der in China. In Shanghai umarmten meine Freunde und ich einander ständig und mischten uns gegenseitig in unsere Angelegenheiten ein. Das Konzept der Privatsphäre gab es auf dem Festland eigentlich nicht. In den Siebziger- und Achtzigerjahren war es vollkommen normal, dass Jungen und sogar Männer Hand in Hand die Straße entlanggingen.
Hongkong war eine andere Welt. Ich erinnere mich noch daran, wie ich zum ersten Mal versuchte, einen Gleichaltrigen zu umarmen, einen Schulkameraden, der im selben Block wohnte. Da wir oft zusammen spielten, schien es mir vollkommen natürlich, den Arm um ihn zu legen. Er machte einen Satz zurück, als hätte ihn der Schlag getroffen. »Was soll das?!«,rief er. Ich war fassungslos. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass die Menschen in Hongkong anders miteinander umgingen. Sie brauchten mehr persönlichen Freiraum und suchten in Freundschaften weniger Nähe. Auf dem Festland hingen Freunde wie Kletten aneinander. Jeder nahm am Leben des anderen Anteil. Wenn sie den Eindruck hatten, dass du zugenommen hattest, sagten sie es dir geradeheraus. Hattest du Geldprobleme, wollten sie den genauen Betrag wissen. Sie wären füreinander ins Gefängnis gegangen. In Hongkong drängten sich die Leute einander nicht so auf. Sie gaben einander Raum.
Abgesehen davon, dass ich ein anderes Sozialverhalten erlernen musste, hatte ich erst einmal eine neue Sprache zu erlernen. Als ich in Hongkong in die Schule kam, verstand ich keine der beiden Unterrichtssprachen. In der Grundschule wurde auf Kantonesisch unterrichtet. Obwohl es technisch ein chinesischer Dialekt ist, war es für jemanden wie mich, der mit dem in Shanghai gesprochenen Dialekt und mit Mandarin, also dem Hochchinesischen, aufgewachsen war, praktisch unverständlich. Und dazu kam das Englische. Es fiel mir sogar schwer, das Alphabet zu erlernen. Meine Eltern baten eine Cousine, mir Englischnachhilfe zu geben. Sie kam in unsere Wohnung und half mir bei der Aussprache: »Apple … bee … orange.« Es schien mir unmöglich, mir irgendetwas einzuprägen. Mit ihrer Unterstützung kämpfte ich lange Zeit, um mir die Grundlagen anzueignen. Ich war im Grunde stumm.
In der Grundschule hüpfte ich von einer Klasse zur anderen. In Shanghai hatten in dem Jahr nach Maos Tod alle Grundschüler die Klasse wiederholen müssen, weil die Schulen durch die Gedenkfeiern ein Schuljahr an Lehrzeit verloren hatten. In Hongkong verbrachte ich das erste Halbjahr in der dritten Klasse in der St. Clement’s Elementary School, einer Episkopalschule. Aber im folgenden Halbjahr brachten mich meine Eltern in eine Schule für Angehörige von Polizisten, weil dort das Niveau niedriger war, sodass ich ein Schuljahr überspringen konnte. Außerdem waren meine Eltern der Meinung, eine Schule für Polizeiangehörige wäre gut für meine Disziplin.
Das Gegenteil war der Fall: An dieser Schule herrschten raue Sitten. Ich war an Raufereien zwischen Jungen gewöhnt. Aber dort prügelten sich auch Mädchen mit Jungen. Ich erinnere mich daran, dass ein Junge einem Mädchen einen Schlag versetzen wollte. Sie wich aus und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Was für ein Treffer!, dachte ich. Mehrere Jungen aus meiner Klasse landeten wegen Autodiebstahls in einer Jugendstrafanstalt. Wenige Jahre zuvor hatte Hongkong sogar eine Korruptionsbekämpfungskommission eingerichtet, um die ausufernde Gesetzlosigkeit bei den Strafverfolgungsbehörden unter Kontrolle zu bringen. Wie es schien, waren in Hongkong Ordnungshüter und Kriminelle aus dem gleichen Holz geschnitzt.
Ich wurde schikaniert, weil ich ein leichtes Ziel bot und nicht dazugehörte. Besonders aggressiv waren die älteren Jungen, und ich verbrachte die Pausen damit, mich irgendwo zu verstecken. Ich war kein harter Junge und wusste nicht, wie man kämpft. Selbst wenn ich einen Kopf größer als die Schläger war, lief ich vor ihnen davon. Es kam mir auch nicht zugute, dass ich aus Festlandchina kam. Kurze Zeit nach unserem Umzug nach Hongkong lief im Lokalfernsehen eine Comedy-Serie an, deren Hauptfigur ein Einwanderer aus Festlandchina namens Ah Chan war, ein ungehobelter Hinterwäldler, zu dumm und zu faul, um sich an die rasante Geschwindigkeit des Lebens in der Kronkolonie anzupassen. Nun wurde ich in der Schule zu »Ah Chan«. Auch daheim verspotteten mich meine Vettern, weil ich nicht schnell genug war, um mit dem Rhythmus Hongkongs mitzuhalten. Im Lauf der Zeit wurde ich flinker und ließ mich von anderen formen, wieder und wieder. Offenbar weckte irgendetwas an mir bei anderen den Wunsch, mich zu verändern. Oft ließ ich es bereitwillig geschehen, wenn auch nur bis zu einem bestimmten Punkt.
In Hongkong musste ich mich zudem der Realität stellen, dass wir ein Leben in Armut führten. In Shanghai hatten wir gelebt wie alle anderen, aber in Hongkong drehten meine Eltern jeden Cent um, allein um die Familie durchzubringen, während meinen Schulkameraden das Geld locker in der Tasche saß. Anstatt den Bus zur Schule zu nehmen, legte ich den drei Kilometer langen Weg jeden Tag zu Fuß zurück. So konnte ich das Geld für die Fahrkarte behalten und mir einen Imbiss leisten. Ich orientierte mich unbewusst am Vorbild meiner Eltern und lernte schon in jungen Jahren, was ich zu tun hatte, um mich im Leben zu behaupten. Ich schwor mir, dass niemand auf mich herabschauen sollte, wenn ich erwachsen wäre.
Der Umzug nach Hongkong war der erste von vielen für mich, und so wie das Schwimmen wurde die Wanderschaft zu einer Konstante in meinem Leben. In den folgenden Jahrzehnten sollte ich von Asien nach Amerika, dann wieder zurück nach Asien und von dort nach Europa umziehen. Diese andauernden Wechsel lehrten mich, auch dramatische Veränderungen zu akzeptieren und mit Menschen aus aller Welt zurechtzukommen. Überall, wo ich landete, lernte ich, ein Stück Heimat zu finden und mich den Umständen und unterschiedlichen Kulturen anzupassen. Wie ein Chamäleon wechselte ich gleichsam die Hautfarbe abhängig vom Ort, an dem ich mich gerade aufhielt. Eine Gewissheit gab mir dieses Wanderleben: Neues würde mich nicht umbringen; was auch immer geschehen mochte, ich würde mich behaupten.
Dank meines Beharrungsvermögens gelang es mir, Kantonesisch und Englisch zu lernen. Ich kehrte in die St. Clement’s Elementary School zurück. In der ganzen Zeit las ich weiter eifrig. In St. Clement’s wurden die Schüler in zwei Schichten unterrichtet. Ich fing um 12:30 Uhr an und ging um 18:00 Uhr nach Hause. Die Vormittage verbrachte ich in einer Bibliothek in der Nachbarschaft, wo ich Romane und Sachbücher verschlang.
Im Alter von zwölf Jahren bestand ich die Aufnahmeprüfung am Queen’s College, der ältesten und angesehensten öffentlichen Sekundarschule der Kronkolonie. Unter den namhaften Absolventen dieser reinen Jungenschule war Sun Yat-sen gewesen, der Vater des modernen China. Mit einer Körpergröße von mittlerweile 1,60 Metern war ich im siebten Schuljahr der größte Junge in meiner Klasse.
Zu Beginn des Schuljahres kam ein Sportlehrer in die Klasse und fragte, wer von uns schwimmen könne. Ein paar von uns hoben die Hand. Ich war seit unserer Ankunft in Hongkong nicht mehr geschwommen. Der Lehrer brachte uns in ein öffentliches Schwimmbad, das gegenüber der Schule im Victoria Park lag. »Zeig mir, was du kannst«, sagte er. Ich sprang ins Wasser und schwamm ein paar Bahnen. Er nahm mich in die Schulmannschaft auf.
Ich gewann Wettkämpfe und brach die Schulrekorde auf den Kurzstrecken (50 und 100 Meter). Im Alter von fünfzehn Jahren gehörte ich einem wettkampforientierten Schwimmverein an. Eines Tages saß bei einem Training in einem öffentlichen Becken zufällig ein Mitglied des Trainerstabs des Nationalteams von Hongkong auf der Tribüne. Er trat an mich heran und sagte: »Sieht gut aus, was du da machst.« Er lud mich zu einem Probetraining ein, und ich wurde in die Nachwuchsmannschaft der Kronkolonie aufgenommen.
Wie schon in meiner Kindheit in China schulte das Schwimmen meine Entschlossenheit und meine Ausdauer. In Hongkong waren die Winter nie wirklich kalt; dort musste ich also keine Eisschicht zerschlagen, um schwimmen zu können. Aber wir schwammen bei Regen und Sonnenschein, Kälte und Hitze, und zwar immer unter freiem Himmel. Es gab Tage, an denen ich mich gut fühlte, und Tage, an denen ich in schlechter Verfassung war. Und an den Tagen, an denen ich mich nicht gut fühlte und der Mannschaftskamerad, der hinter mir schwamm, mit seinen Fingern meine Füße berührte, musste ich mich zwingen, alles aus mir herauszuholen, um nicht derjenige zu sein, der die Bahn blockierte. Und am Ende des Trainings kletterte ich mit dem Gefühl aus dem Becken, etwas geleistet zu haben. Wie bei meinem Vater wurde Hartnäckigkeit eine meiner größten Stärken. Egal, wie groß die Herausforderung, sagte ich mir, du wirst es immer aus dem Becken schaffen.
Die Zugehörigkeit zu der Mannschaft vergrößerte meinen Bewegungsradius. Wir trainierten überall in der Kronkolonie und nahmen an ganz unterschiedlichen Orten an Wettkämpfen teil. Die Jungen aus reichen Familien wurden von einem Chauffeur im BMW zum Training gebracht; die ärmsten Teammitglieder wuchsen in Sozialbauten auf. Ich nahm sogar in Japan und in Guangzhou am Perlfluss an Jugendmeisterschaften teil. Der Besuch in Japan war meine erste Reise in ein Land außerhalb des chinesischen Kulturkreises.
Im ersten Schuljahr am Queen’s College brachte ich miserable Noten nach Hause: Ich war der 34. unter den 40 Schülern meiner Klasse. Ich hatte fleißig gelernt, um in die Schule aufgenommen zu werden, aber als ich einmal dazugehörte, ließ die Anspannung abrupt nach, und ich wollte nur noch Spaß haben. Anstatt meine Hausaufgaben zu machen, spielte ich stundenlang Fußball und Basketball im nahe gelegenen Victoria Park. Meine Eltern waren zu sehr mit der Arbeit beschäftigt, um sich um meine schulischen Probleme kümmern zu können. Sie beschränkten sich darauf, mich für meine schlechten Noten zu rügen. Aber im Lauf der Zeit wurden meine Leistungen besser, und am Ende des dritten Schuljahres war ich ein durchschnittlicher Schüler.
Zu der Zeit, als ich ans Queen’s College kam, verwandelte ich mich von einem Zuwanderer aus Shanghai in einen echten Hongkong-Chinesen. Ich verbrachte sehr viel mehr Zeit mit Altersgenossen als mit meinen Eltern. Sobald ich unsere winzige Wohnung verließ, lösten sich meine Selbstzweifel auf, und ich strotzte vor Selbstvertrauen: Ich war ein guter Schwimmer, ich war groß, ich war beliebt. Mittlerweile sprach ich Kantonesisch wie ein Einheimischer und fühlte mich an der neuen Schule wohl.
Ich wusste, ich hatte einen Hang zur Eitelkeit. Schon in jungen Jahren starrten mich die Leute an. Kein Wunder, denn in China und Hongkong sind Männer durchschnittlich 1,65 Meter groß, und ich war immer einen Kopf größer als meine Altersgenossen und die meisten Erwachsenen. In China spricht man ganz unverhohlen über das Aussehen anderer. Wenn man starke Akne hat, sagen die Leute: »Meine Güte, so viele Pickel.« In meinem Fall sagten sie: »Meine Güte, so groß und gut aussehend.« In der Folge war ich mir meines Aussehens sehr bewusst. Und ich entwickelte das ausgeprägte Bedürfnis, nicht nur ihrer Vorstellung von einer »großen und gut aussehenden« Person zu entsprechen, sondern auch sicherzustellen, dass sie keinen Grund hatten, auf mich herabzuschauen.
An den meisten Tagen ging ich nach der Schule gemeinsam mit einer Gruppe von Klassenkameraden heim, die wie ich in Kowloon lebten. Wir fuhren im Bus von der Schule in den schicken Central District und nahmen von dort eine Fähre nach Kowloon. Normalerweise blödelten wir auf der Überfahrt herum, aber an einem Tag fiel mir etwas Ungewöhnliches auf. Ich sah einen Mann aus dem Westen, der in einem chinesischen Bautrupp arbeitete. Mit dem bleichen Gesicht unter dem Schutzhelm fiel er unter den chinesischen Kollegen, deren Haut von der subtropischen Sonne Hongkongs gebräunt war, auf wie ein bunter Hund. Ich dachte: Das könnte ich in zehn Jahren sein, und jeder, an dem ich vorbeigehe, sieht mich komisch an. Und ich beschloss, dass mir das nie passieren sollte, ich wollte nie als unpassend auffallen. Bis Mitte vierzig litt ich unter der Sorge, einen schlechten Eindruck zu machen. Das meinen die Chinesen, wenn sie von dem Bedürfnis sprechen, »das Gesicht zu wahren«. Ich wollte um jeden Preis vermeiden, meine Umgebung zu enttäuschen, und sehnte mich danach, dazuzugehören. Dennoch hatte ich immer das Gefühl, dass mich die Leute anstarrten.
Dabei war es nie mein Ziel, eines Tages viel Geld zu verdienen. Meine Mutter pflegte zu sagen, Geld sei kein Allheilmittel, und ich glaubte ihr. Aber das Gesicht zu wahren, war in meinen Augen sehr wohl ein Allheilmittel. Ich war darauf geeicht, um jeden Preis zu vermeiden, mich selbst und damit auch meine Familie zu blamieren.
Ich war ein durchschnittlicher Schüler, aber ich war überzeugt, dass das nicht an mangelnden Fähigkeiten lag, sondern weil ich nicht an herausragenden Leistungen interessiert war. In der Schule hatten wir ein Debattierteam. Da meine Noten durchwachsen waren, wurde ich nie aufgefordert, mich diesem Team anzuschließen. Aber ich ging zu den Debatten und versuchte im Geist, die Argumente beider Seiten zu entkräften. Natürlich hielt ich meine Argumente für besser als die der Teilnehmer.
Im vierten Jahr am Queen’s College, ich war mittlerweile sechzehn Jahre alt, wurde mir klar, dass ich bei der Prüfung für das Hong Kong Certificate of Education, die am Ende des fünften Jahres abzulegen war, gut abschneiden musste, wenn ich nicht an einer der schlechteren Schulen landen wollte. Ich wusste, dass meine Eltern nicht genug Geld hatten, um mir ein Studium zu finanzieren. Also entschloss ich mich dazu, mich in meine Studien zu vertiefen und mich um gute Noten zu bemühen.