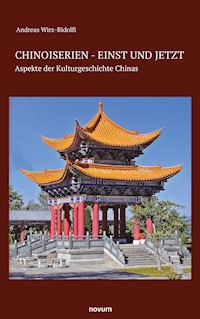
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum premium Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
51 prägnante Essays gewähren Blicke hinter die Chinesische Mauer oder durch den Bambusvorhang. In einer Reise durch den chinesischen Zodiak finden wir Informationen über die zwölf Tiere des Horoskops, aber auch über diverse Facetten der chinesischen Kultur und Geschichte. Alle Kapitel waren ursprünglich in einer Kurzfassung als Editorial für die Zeitschrift "Akupunktur und Aurikulomedizin" im Springer-Verlag erschienen. Es handelt sich bewusst nicht um ein medizinisches Lehrbuch oder um einen kulturhistorischen Reiseführer vom Typus "China für Anfänger", sondern soll interessierten Laien auf lockere Art und Weise verbunden mit persönlichen Reminiszenzen populärwissenschaftliche Informationen bieten und den Horizont erweitern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-224-7
ISBN e-book: 978-3-99130-225-4
Lektorat: Dr. Annette Debold
Umschlagfoto: A. Wirz-Ridolfi, D. Schweizer
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Kalligrafie: Hu Tairan; 12 Zodiaktiere: Li Xiaojun (Malerin); Werner Lüthy hat die gemalten Tiere hochauflösend fotografiert.
www.novumverlag.com
Prolog
Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, lautet: „Wie kommen Sie als Chirurg und Schulmediziner dazu, Akupunktur zu betreiben?“
Die verblüffende Antwort lautet: „Weil ich in Afrika war.“
Während meines zweijährigen Aufenthaltes in Tansania stellte ich fest, dass praktisch alle Patienten vor, während oder nach ihrem Spitalaufenthalt bei einem Buschdoktor, bei einem „Traditional Healer“ in Behandlung waren. Ich suchte den Kontakt mit den Kollegen von der „einheimischen Fakultät“ und habe Erstaunliches über ihre Behandlungserfolge mit pflanzlicher Medizin, aber auch mit Parapsychologie erfahren. Dabei kam ich zur Erkenntnis, dass unsere westliche Schulmedizin nicht die einzige Methode ist, welche Patienten helfen kann. So dachte ich mir, wenn die traditionelle afrikanische Medizin, welche ja ausschließlich auf oraler Tradition beruht, so offensichtlich wirksam ist, wie viel wirksamer muss die traditionelle chinesische Medizin sein, welche seit Jahrtausenden aufgeschrieben und gelehrt wird? Nach meiner Rückkehr in die sogenannte Zivilisation eröffnete ich eine Praxis für ambulante Chirurgie und absolvierte sämtliche Stufen der Ausbildung in Aurikulomedizin und Chinesischer Medizin bis zum Dozenten-Diplom. Meine Vortragstätigkeit auf allen fünf Kontinenten gipfelte schließlich in einem Gastlehrauftrag an der Universität Beijing. Mir wurde die Aufgabe übertragen, das Editorial für die Schweiz in der Zeitschrift für Akupunktur und Aurikulomedizin des Springer-Verlags zu verfassen. Da mir die konventionellen Vorworte in derArt von: „In dieser Ausgabe finden Sie folgende Beiträge. Lesen Sie sie!“, zu langweilig waren, nahm ich mir die Freiheit, in jeder Ausgabe zwei Seiten über einen interessanten Aspekt der chinesischen Kultur und der chinesischen Geschichte zu schreiben. Das Echo aus der Leserschaft war durchwegs positiv. Das Grundgerüst des Buches ist der chinesische Zodiak mit seinen 12 Tieren jeweils am Jahresanfang, dazwischen je drei Essays über Themen aus der chinesischen Kultur und der chinesischen Geschichte, „Chinoiserien“ eben. Es ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, es ist kein Reiseführer China für Anfänger, es ist kein Geschichtsbuch – und doch von allem ein bisschen. Offenbar ist mein Schreibstil, oft mit einem Augenzwinkern und persönlichen Reminiszenzen, gut angekommen, sodass ein informatives populärwissenschaftliches Buch mit 51 Kapiteln entstanden ist, das nicht nur für Interessenten der Chinesischen Medizin lesenswert ist.
Wie sagte doch der italienische Jesuit Matteo Ricci (1552–1610): „China ist nicht nur ein Land, es ist eine ganze Welt.“
Der Kalligraf Hu Tairan malte für dieses Buch die Schriftzeichen auf dem Frontispiz. Sie bedeuten: „Hao shi – duo mo“ = Gute Dinge – viel Mühe, oder zu Deutsch: Gut Ding will Weile haben.
Kalligrafie Hao shi duo mo (Gut Ding will Weile haben) Künstler: Hu Tairan, Beijing
1 Die Chinesischen Feiertage – Sitten und Gebräuche
Im chinesischen Kalender fällt das Neujahrsfest auf den zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende, dies entspricht in Nichtschaltjahren dem Neumond vor der Frühlings-Tagundnachtgleiche. Somit kann das chinesische Neujahrsfest zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar stattfinden. Wie funktioniert eigentlich der chinesische Kalender? Im Prinzip ist der chinesische Kalender ein lunisolarer (Mond-Sonnen-)Kalender, was bedeutet, dass er vom Mond regiert und nach der Sonne korrigiert wird. Die Zeit zwischen zwei Neumonden beträgt 29,53 Tage, was 354 Tage pro Jahr ergibt. Es fehlen somit 11 Tage gegenüber dem Sonnenjahr, und die Jahreszeiten würden sich verschieben. Um dies zu vermeiden, wird alle zwei oder drei Jahre ein 13. Monat eingeschoben. Das chinesische Jahr beginnt mit dem Frühlingsfest (chun jie), das bis zum Laternenfest dauert. Seit der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) gilt der chinesische Lunisolar-Kalender, nach welchem das Laternenfest (deng jie) am 15. Tag des 1. Mondmonats gefeiert wird. Kunstvolle, farbenfrohe Laternen aus Holz, Papier, Perlmutt und Horn zeigen Tierkreiszeichen, Szenen aus klassischen Romanen und Kampfszenen. Kinder spielen mit selbst gebastelten Laternen. Gegessen werden Klebreiskugeln mit süßer Füllung (chinesisch tangyuan, was ähnlich klingt wie tuanyuan = Familientreffen), sie symbolisieren die Eintracht in der Familie. Sowohl in Festlandchina als auch in Taiwan finden große Freiluftausstellungen mit den Laternen statt. Die Reihenfolge der 12 Tiere im Horoskop geht auf folgende Legende zurück: Der mythische Jadekaiser lud alle Tiere zu einem großen Fest und ordnete an, dass die Reihenfolge ihres Eintreffens auch die Reihenfolge der Tierkreiszeichen bestimmen soll. Mit dem Überbringen der Einladungen an die Tiere war die Ratte betraut. Auch die Katze hätte eine Einladung bekommen sollen, doch der schlauen Ratte war dies zu gefährlich, weshalb sie die Katze ausließ. Um als Erster einzutreffen, brach der Ochse schon am Vortag auf. Der Weg zum Fest führte über einen reißenden Fluss, ein Problem für die Ratte. Deshalb sprang sie behände auf den Rücken des Ochsen und ließ sich hinübertragen. Sobald sie in Sichtweite des Jadekaisers waren, sprang die Ratte herunter und war deshalb das erste Tier auf dem Fest und im Zodiak. Die Grundlage des chinesischen Kalenders ist ein Zyklus von 60 Jahren. Es gibt einerseits die bekannten 12 Tierkreiszeichen (Zodiac) von Ratte bis Schwein, welche alle 12 Jahre wiederkehren und Erdzweige genannt werden. Dazu gibt es die 10 Himmelsstämme, welche aus den fünf Elementen Holz – Feuer – Erde – Metall – Wasser bestehen, jeweils in ihren Yin- oder Yang-Manifestationen. Diese werden als die 10 Himmelsstämme bezeichnet. Jahre mit einer geraden Endziffer gelten als Yin, Jahre mit einer ungeraden Endziffer sind Yang. Somit ergibt die Verbindung der zehn himmlischen Stämme (die fünfElemente, jeweils Yin und Yang) mit den zwölf Erdstämmen die Zahl 60. Jedes himmlische Yin (5) mit jedem irdischen Yin (6)ergibt 30, analog jedes himmlische Yang (5) mit jedem irdischen Yang (6) nochmals 30, was also insgesamt einen Zyklus von 60 Jahren ergibt, die Grundeinheit des chinesischen Kalenders seit 1900 v. Chr. Wer das nicht alles auf Anhieb begriffen hat, soll bitte nicht verzweifeln – mir ging es genauso, und man kann ja alles nachschauen! Wegen des traditionellen Mondkalenders (Lunisolar-Kalender) fällt daschinesische Neujahr, auch Frühlingsfest genannt, jeweils auf den zweiten Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. In einer wahren Völkerwanderung begeben sich Jahr für Jahr über 250 Millionen Chinesen auf Verwandtenbesuch, die weltweit größte Migrationsbewegung. Sämtliche Flüge und Züge sind ausgebucht und die Autobahnen verstopft. Gegessen wird an Neujahrvor allem Fisch, der auf Chinesisch Yu heißt, was gleichlautet wie das Wort für „Ersparnisse“. Deshalb darf der Fisch auf keinen Fall vollständig aufgegessen werden, damit auch im neuen Jahr noch Geld übrig bleibt. Die chinesischen Tischsitten verlangen ohnehin, dass man immer noch Reste liegen lässt, damit der Gastgeber nicht als Geizhals das Gesicht verliert. Eine andere traditionelle Speise sind auch gefüllte Teigtaschen, Jiaozi. Der 3. Tag des Neujahrsfestes wird auch Chi Kougenannt, was „freier Mund“ oder Streit bedeutet, ein Phänomen, das auch· bei uns an Weihnachten bestens bekannt ist, wenn sich die Verwandtschaft trifft. Offiziell gibt es an Neujahr drei freie Tage für die Bevölkerung, die Feierlichkeiten dauern bis zum 15. Tag des neuen Jahres und enden mit dem Laternenfest. Am Vorabend des Neujahrstages wird zuerst ein Spaziergang unternommen, um die Spuren des alten Jahres aus dem Haus zu locken, anschließend werden Fenster und Türen geöffnet, um das Glück des neuen Jahres hereinzulassen. Von 23 Uhr bis in die Morgenstunden wird mit Feuerwerk geballert, was das Zeug hält, um das menschenfressende Jahresmonster Nianshou zu verscheuchen. Die in der Song-Dynastie (960 bis 1289 n. Chr.) entwickelte Pyrotechnik zeichnete sich ursprünglich mehr durch den Knalleffekt als durch die optische Freude aus, erst später kam die poetische Bezeichnung „Hua huo“, Blumen aus Feuer, auf. Am chinesischen Neujahr dominiert die Farbe Rot, weil Rot einerseits für Glück, Freude und Wohlstand steht – und wiederum das Jahresmonster durch Lärm und rote Farbe vertrieben wird. Traditionell werden deshalb an Kinder und unverheiratete Verwandte rote Umschläge, die sogenannten „hong bao“ mit Geldbeträgen verschenkt. Das Neujahr gilt als wichtigster Anlass im Jahresbrauchtum in China. Nach dem traditionellen Lunisolar-(Mond-Sonne)-Kalender fällt der Beginn des Neujahrsfestes auf den ersten Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Obwohl gesetzlich drei Feiertage vorgesehen sind, dauern die Festlichkeiten meist 15 Tage, bis sie mit dem Laternenfest enden. Rote Laternen gelten als Symbol für Glück (im umfassenden Sinne – nicht wie hierzulande im Rotlichtbezirk, wo sie den Weg zu relativ kurzfristigem „Glück“ weisen). Da die chinesische Zeitrechnung offiziell im Jahr 2637 v. Chr. beginnt, fängt zum Beispiel im Jahr 2012 in China das Jahr 4649 an. Das Neujahrsfest wird mit viel Feuerwerk eröffnet, welches allerdings in Beijing innerhalb der 4. Ringstraße wegen Brandgefahr und Luftverschmutzung verboten ist. Im Kreis der Familie wird viel gegessen, man opfert aber auch den Ahnen, die als Teil der Familie angesehen werden. Wenn es den Ahnen nicht gut geht, kann es der Familie nicht gut gehen. Ohne Herkunft keine Zukunft. Zahlreiche Neujahrsbräuche sollen Glück bringen und Unglück fernhalten: Man soll Fenster und Türen öffnen, um das Glück hereinzulassen, deshalb lässt man auch das Licht brennen, damit das Glück den Weg findet. Das Haus wird fein säuberlich geputzt, damit sich das Glück auch niederlassen kann. Man isst Süßigkeiten, um das neue Jahr zu versüßen. Umgekehrt bringt es Unglück, sich während der Festtage die Haare schneiden zu lassen, da das Wort „fa“ – nur anders betont, aber mit gleichem Schriftzeichen – sowohl Haare wie auch Wohlstand bedeutet – und den will man ja nicht wegschneiden. Sogar Bücher zu kaufen in dieser Zeit ist nicht empfehlenswert, da das Wort für Buch „shu“ (gleiche Betonung, anders geschrieben) auch Verlust bedeutet.Weitere wichtige Festtage in China sind: Nach dem Neujahrs- oder Frühlingsfest im Februar kommt 15 Tage später das oben beschriebene Laternenfest. 15 Tage nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche wird das Qingming-Fest begangen, an welchem die Chinesen der verstorbenen Vorfahren gedenken und deren Gräber besuchen. Diese werden gereinigt, man legt dort Essen und Getränke, Früchte und Blumen nieder. Es wird Papiergeld verbrannt und Gegenstände aus Papier, die den Verstorbenen nützlich sein können: Kleider, Schuhe, sogar Autos – alles aus Papier. Natürlich dürfen bündelweise Räucherstäbchen nicht fehlen, welche die Besucher über den Kopf halten und sich damit verneigen. Am Qingming-Fest (Bedeutung: helles Licht) lässt man auch zahlreiche Drachen und Lampions in den Himmel steigen. Als Nächstes folgt im traditionellen chinesischen Kalender das Drachenbootfest, genauer am 5. Tag des 5. Monats, weshalb es auch Duanwujie (Doppelfünf-Fest) genannt wird. Es gehört mit dem Neujahrsfest und dem Mondfest zu den drei wichtigsten Anlässen Chinas. Zu seinem Ursprung gibt es folgende Geschichte: Zur Zeit der Streitenden Reiche (445 bis 221 v. Chr. lebte der erste historisch fassbare Dichter Chinas, Qu Yuan. Er bekleidete ein hohes Amt am Hofe des Königs Huai, wurde aber aufgrund seiner politischen Meinung entlassen. Aus Gram ob des erlittenen Unrechts ertränkte er sich im Fluss Miluo, die mit Booten herbeigeeilten Fischer kamen zu spät. Damit der Leichnam des ertrunkenen Dichters nicht von Fischen gefressen wurde, warfen die Anwohner mit Schweinefleisch und Bohnen Klebreistaschen ins Wasser, welche traditionell heute noch am Drachenbootfest verzehrt werden. Der Name kommt von den traditionellen Drachenbootrennen, die zu diesem Anlass auf der ganzen Welt ausgetragen werden. Ein solches Boot ist mehr als 30 Meter lang, aus Holz geschnitzt, vorne ein bunt geschmückter Drachenkopf und hinten der entsprechende Schweif. An Bord geben 70–80 Ruderer ihr Bestes, angefeuert von einem Trommler als Taktgeber und dem Steuermann im Heck. In jüngerer Zeit entwickelte sich das Drachenbootrennen zu einem internationalen Wettkampfsport, der in Australien, Europa, Kanada, Malaysia, Neuseeland und Südafrika ausgetragen wird. Der suizidale Dichter Qu Yuan hätte vielleicht seine Freude daran. Eher in Vergessenheit geraten ist das Geisterfest (guijie), das am 15. Tag des siebten Monats gefeiert wird. Sein Ursprung liegt in der taoistischen und der buddhistischen Tradition Chinas, nach welcher im siebten Monat die Seelen der Toten aus der Unterwelt auf die Erde kommen, um ihre verbliebenen Familien zu besuchen. Bei den Buddhisten heißt es Ullambana-Fest. Der siebte Monat wird deshalb auch „Geistermonat“ genannt. Parallelen zu Halloween oder zum Dia de los Muertos in Mexiko sind offensichtlich. Höhepunkt ist das Geisterfestival (Zhongyuan jie) oder Fest der hungrigen Geister. Der Legende nach haben diese einen derart riesigen Hunger entwickelt, dass die Lebenden ihnen nicht nur Gebete bieten, sondern auch vor den Häusern Speisen aufstellen und sogenanntes Höllengeld als Opfergabe für die Seelen der Verstorbenen verbrennen müssen. Inzwischen ist dieses Fest bei den Jungen in den chinesischen Metropolen zu einer gruseligen Variante von Halloween mutiert mit Kostümpartys und dergleichen. Umherirrende Geisterkönnen aber recht böswillig sein, weshalb man im Geistermonat lieber nicht alleine in der Nacht spazieren oder schwimmen gehen soll. Auch rote Kleider können Geister anziehen. Heiraten oder Wohnungsumzüge sollten zu einem anderen Termin stattfinden. Als Abschluss des Geistermonates lässt man beleuchtete Papierboote auf dem Wasser schwimmen, die den Geistern den Weg zurück insJenseits zeigen sollen. Mitte August folgt dann Qixi, das Fest der Liebenden, welches dem Valentinstag im Westen entspricht. Es fällt auf den Abend des siebten Tages des siebten Monats, deshalb die Bezeichnung „Nacht der doppelten Sieben“, und wird vor allem von den Jugendlichen gefeiert. DieLegende dahinter geht so: Es waren einmal ein Kuhhirte (niulang) und ein Webermädchen (zhinü), die sich so sehr liebten, dass sie ihre Arbeit vernachlässigten. Das erzürnte den Himmelskaiser dermaßen, dass er die beiden durch den Himmelsfluss trennen ließ. Die Elstern, gerührt von so viel Liebe, kamen geflogen und bildeten eine Brücke mit ihren Flügeln, sodass sie sich einmal im Jahr auf der Elsternbrücke treffen konnten, am 7. Tag des 7. Monats. Am Himmel ist das Liebespaar als die Sterne Altair (Niulang) und Wega (Zhinü) verewigt, getrennt durch die Milchstraße. Am 15. Tag des achten Monats findet das Mondfest oder Mittherbstfest (zhongqiujie) statt. Seit der Tang-Dynastie (618–907 n. Chr.) gilt es als eines der wichtigsten Feste Chinas, wo sich Familien aus der ganzen Welt treffen, miteinander opulente Abendessen genießen und den Vollmond betrachten. Laternenausstellungen, öffentliche Akrobatikvorführungen und Drachentanz sind ebenfalls Tradition. Nicht fehlen dürfen Mondkuchen, welche an Verwandte und Freunde verschenkt werden. Sie messen rund 10 Zentimeter im Durchmesser und können mit süßem oder salzigem Inhalt gefüllt sein. Im Inneren befindet sich oft ein Eidotter als Symbol des Vollmondes. Im Mond wohnt nach der chinesischen Legende eine Frau, Chang’e, mit einem Kaninchen, die aufgrund ihrer Neugierde dorthin strafversetzt wurde. Und das kam so: Einst gab es 10 Sonnen, welche die Erde versengten. Der meisterhafte Bogenschütze Houyi erhielt vom Kaiser den Auftrag, neun Sonnen herunterzuschießen, was ihm auch gelang.Als Dank erhielt er ein Kästchen mit zwei Pillen der Unsterblichkeit. Seine Frau Chang’e öffnete das Kästchen und schluckte aus Versehen beide Pillen, worauf sie zum Mond strafversetzt wurde. Der chinesische Nationalfeiertag ist der 1.Oktober, weil Mao Zedong am 1.10.1949 die Volksrepublik China (Zhonghua Renmin Gongheguo) ausgerufen hat. Anschließend folgt jeweils die Goldene Woche, eine ganze Woche frei für jedermann, welche 1999 eingeführt wurde, um den Binnentourismus zu beleben und entfernte Verwandtenbesuche zu ermöglichen. Als letzter großer Festtag im chinesischen Jahr wird das Chong-Yang-Fest gefeiert, am 9.Tag des 9.Monats, wenn die Chrysanthemen blühen. Die Doppelneun ist ein besonders glückverheißendes Datum, das klanglich im Chinesischen gleich lautet wie das Wort „für immer, ewig“: yong yuan. Deshalb ist es auch der Festtag der Chrysanthemen, den Senioren gewidmet, welchen man seine Dankbarkeit und seinen Respekt erweist. Die Tradition will es, dass an diesem Tag ein Berg bestiegen wird, weshalb der Tag auch „Auf die Höhen steigen“-Festtag genannt wird. Dies waren nur die wichtigsten chinesischen Feiertage, welche staatlich anerkannt und in der ganzen Volksrepublik China begangen werden. Natürlich gibt es noch zahlreiche lokale Bräuche, die von den zahlreichen Minderheiten zelebriert werden.
2 Die Ratten und der Schwarze Tod
Zum Jahr der Ratte
Ratten symbolisieren in chinesischen Mythen Yin und Yang: Die Vorderpfoten sind das Yang der Gegenwart und die Hinterpfoten das Yin der Vergangenheit. Menschen, die im Zeichen der Ratte geboren sind, besitzen die Fähigkeit, mit ihrem scharfen Intellekt schnell zu reagieren. Sie sind sympathisch und verständnisvoll, fröhlich und liebenswert. Mit ihrer Kombination von Witz und Weisheit sind sie kreativ und unternehmerisch. Sie sind gut darin, Gelegenheiten zu nutzen. Negativ zu Buche schlagen ihr Mangel an Ehrgeiz, Mut und Einsicht. Menschen, die im Jahr der Ratte geboren sind, neigen dazu, keine eigene Meinung zu haben und manchmal stur zu sein. Sie können aber auch unhöflich sein und kritisieren andere häufig. Außerdem sind sie oft übertrieben profitsüchtig, es wird ihnen eine außerordentliche finanzielle Begabung zugeschrieben.
Bei der chinesischen Bezeichnung „Shu“ für das erste Tierkreiszeichen zeigt sich einmal mehr die quantenphysikalische Unbestimmtheit in der chinesischen Sprache (man muss sich erst festlegen, wenn man das vieldeutige chinesische Wort in eine andere Sprache übersetzen will: reine Quantenphysik). Wie schon bei Schaf oder Ziege, Hase oder Kaninchen, Ochse oder Büffel ist nicht völlig klar, welches Tier mit „Shu“ gemeint ist: Die Ratte oder die Maus? Beide werden mit dem gleichen Schriftzeichen bezeichnet. In Übersetzungen wird meist vom Jahr der Ratte gesprochen, auf den zahlreichen Darstellungen zum neuen Jahr ist jedoch fast durchgehend ein niedliches Mäuschen dargestellt. Auch die Zusatzbezeichnung „Lao Shu“ wird sowohl für die Maus als auch für die Ratte verwendet – warum jedoch das Epitheton „alt“ verwendet wird, ist nicht klar. Lao ist auch eine Respektbezeugung, im Sinne von ehrwürdig. Eher hilfreich ist der ZusatzDa-laoshu (groß) für die Ratte undXiao-laoshu (klein) für die Maus.
Zoologisch gehört die Ratte (lateinisch: Rattus) in die Ordnung der Rodentia (Nagetiere) und dort zur Familie der Mäuseartigen (Muridae).
Laut Wikipedia ist die Grenzziehung zwischen „Maus“ und Ratte“ künstlich und ohne zoologische Bedeutung. Im engsten Sinne wird unter Maus die Hausmaus verstanden und unter Ratte die Hausratte oder die Wanderratte. Bis zu 140 Millimeter Kopf-Rumpf-Länge gelten Mäuseartige als Maus, was größer ist als Ratte. Und da gibt es am einen Ende des Spektrums die Zwergspringmaus (Salpingotus), die gerade mal 4 cm lang ist und 6 g wiegt, und oben an der Skala befindet sich die afrikanische Riesenhamsterratte (Cricetomys), die 45 cm ohne Schwanz misst und 2,5 kg auf die Waage bringt.
Die Wanderratte (Rattus norvegicus) stammt nicht – wie man aufgrund ihres Namens annehmen könnte – aus Skandinavien, sondern ursprünglich aus dem nördlichen Ostasien und wurde erst im 16. Jahrhundert mit Schiffen oder über die Seidenstraße nach Europa gebracht. Mit bis 350 g und 26 cm Kopf-Rumpf-Länge ist die Wanderratte ziemlich größer als die Hausratte. Laut Schätzungen leben weltweit bis zu 350 Millionen Ratten, was vier Ratten pro Erdenbewohner ergibt. Die als Haustiere gehaltenen sogenannten Farbratten (Rattus norvegicus forma domestica) stammen, wie auch die Laborratten, von der Wanderratte und nicht etwa von der Hausratte ab. 1906 begann das „Wistar Institute for Anatomy and Biology“ der University of Pennsylvania in Philadelphia standardisierte Albino-Laborratten zu züchten. Seither werden die sogenannten Wistarratten weltweit in wissenschaftlichen Versuchen verwendet, so auch in der Dissertation des Schreibenden, welche die „Ultrastrukturelle Morphometrie der perinatalen Rattenleber-parenchymzelle“ zum Thema hatte. Darin wurden erstmals anhand von Hunderten von elektronen-mikroskopischen Aufnahmen die quantitativen Veränderungen von Mikroorganellen (Mitochondrien, Ribosomen, endoplasmatisches Reticulum usw.) in Rattenleberzellen vor und nach der Geburt ausgezählt.
Durch die Domestizierung wurden die Farbratten zutraulicher, weniger aggressiv und zeigten weniger Bewegungsdrang. Durch ihre gesteigerte Fertilität sind sie auch prädestiniert für genetische und epigenetische Untersuchungen. Sie werden im Alter von fünf bis sechs Wochen geschlechtsreif, nach einer Tragzeit von knapp 22 Tagen werden durchschnittlich 12–14 Jungtiere geworfen, es können auch 20 oder mehr sein. Ein Rattenpärchen kann theoretisch pro Jahr 1000 Nachkommen haben. Bei den Farbratten werden außer den meist in Laboratorien verwendeten Albinoformen mehr als 18 verschiedene Farb- und Fleckvarianten beschrieben. Auch praktisch felllose Nacktformen werden gezüchtet, die allerdings sehr empfindlich sind gegen Zugluft und Sonnenbrand. Sogar schwanzlose (tailless) Exemplare gehören eher zu den Qualzuchten, denn der von manchen Leuten als eklig betrachtete Schwanz erfüllt bei der Temperaturregelung und beim Klettern als Balancierstange oder als fünfte Extremität eine wichtige Rolle.
Ab den 1980er-Jahren wurden Farbratten häufig von Punks gehalten, um Normalbürger zu erschrecken, wenn dies mit grüngefärbten Haaren oder Sicherheitsnadeln in den Lippen nicht mehr gelang.
Die Hausratte (Rattus rattus) ist mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 17–22 cm und einem Gewicht von bis 200 g deutlich kleiner als die Wanderratte. Sie stammt ursprünglich aus dem Himalayagebiet und gelangte als Kulturfolger bereits zur Bronzezeit via Persien nach Ägypten ins Mittelmeergebiet. Als Beweis für die Anwesenheit von Ratten wird die Attische Seuche angeführt, die von 430–426 v. Chr. im von den Spartanern belagerten Athen wütete. Sie ging als Pest des Thukydides in die Geschichte ein. Ob es sich dabei effektiv um eine Pest-Epidemie handelte oder eine andere Infektionskrankheit, kann trotz der detaillierten Symptombeschreibung des Historikers Thukydides nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Im 2. Jahrhundert n. Chr. wird in Londinium (London) eine Pest-Epidemie beschrieben, was als Beweis gilt, dass die Ratten mit den Römern nach Großbritannien gelangt sind. Erste Nachweise der Hausratte in Deutschland stammen aus der Wikingerstadt Haithabu in Schleswig-Holstein aus dem 11. Jahrhundert. So konnten sich Ratten mit den Schiffen der Wikinger und später der Hanse in die ganze Welt verbreiten. In Europa ist die Zahl der Hausratten mittlerweile stark rückgängig, weil sie von den stärkeren Wanderratten verdrängt werden. Deshalb steht die Hausratte in Deutschland auf der roten Liste der gefährdeten Arten und gilt als vom Aussterben bedroht.
Problematischer sind Ratten als Neozoen, als ursprünglich nicht heimische, eingeschleppte Tierart auf zahlreichen tropischen und subtropischen Inseln, wo sie praktisch alle bodenbrütenden Vogelarten und andere Kleintiere ausgerottet haben.
Ratten können bis zu 120 verschiedene Krankheiten übertragen. Die Leptospirose wird durch Spirochäten verursacht, welche durch den Urin infizierter Ratten übertragen werden. Über kleine Hautverletzungen oder die Schleimhaut können sich Menschen anstecken. In Deutschland erkranken höchstens 100 Menschen pro Jahr. 90 % haben grippeähnliche Symptome, bei der schwersten Verlaufsform, dem Morbus Weil, können aber Leber- und Nierenversagen zum Tod führen. Hantavirus-Infektionen werden durch die Ausscheidungen infizierter Nagetiere übertragen, vor allem wenn kontaminierter Staub (zum Beispiel beim Fegen von Gartenhäusern) eingeatmet wird. Das Virus verursacht grippeähnliche Symptome mit Fieber, Kopf-, Bauch- und Gliederschmerzen, kann aber die Nieren angreifen und zu tödlichem Versagen führen. 2017 wurden laut Landesgesundheitsamt immerhin 832 Erkrankungen in Deutschland registriert. Als Inbegriff einer Seuche apokalyptischen Ausmaßes gilt die Pest. Das lateinische Wort „Pestis“ bedeutet Unheil, Verderben, Seuche. Von der Bronzezeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden immer wieder ganze Landstriche von der Pest heimgesucht und entvölkert.
Als Ursachen wurden angenommen: Strafe des Himmels, ungünstige Konstellation von Mars, Jupiter und Saturn, üble Ausdünstungen, sogenannte Miasmen oder von Juden vergiftete Brunnen, was als Vorwand zu Pogromen genommen wurde, um die Schulden bei den Geldverleihern loszuwerden.
Dass Ratten die Pest übertragen stimmt nur mittelbar: Der Schweizer Arzt Alexandre Emile Jean Yersin (1863–1943) aus Lausanne wurde vom Pariser Institut Pasteur im Jahr 1894 nach Hongkong geschickt, wo eine Pest-Epidemie herrschte. Er sollte die Ursache der Seuche finden. Gleichzeitig arbeitete dort eine japanische Forschergruppe unter Kitasato mit dem gleichen Ziel. Obwohl Yersin von den englischen Kolonialbehörden in seiner Arbeit behindert wurde, gelang es ihm am 20. Juni 1894, den Erreger aus Lymphknoten von Pesttoten zu isolieren und auf Mäuse zu übertragen. Yersin erhielt keinen Zutritt zu Pesttoten, die alleine den Japanern zur Verfügung gestellt wurden. Durch die Vermittlung eines Missionars machte er die Bekanntschaft eines Matrosen, der als Bestatter arbeitete. Diesen konnte er bestechen und so heimlich Pestbeulen untersuchen. Die Japaner verfügten über ein Labor mit Brutschrank im Kennedy-Tower-Krankenhaus, während Yersin seine Bakterienkulturen in einer Bambushütte bei normalen Umgebungs-temperaturen züchten musste. Dabei erwies es sich als Glücksfall, dass die Pest-Bakterien bei Temperaturen niedriger als die menschliche Körpertemperatur besser gedeihen als im Brutschrank. Der Erreger wurde erst Pasteurella pestis genannt und 1970 zu Ehren des Entdeckers Yersinia pestis. Bescheiden wie er war, machte er sich nichts aus öffentlichen Ehrungen und lebte zurückgezogen in Indochina in Nha Trang, wo er Kautschuk- und Chinarindenbäume ansiedelte. In Hanoi gründete er die Medizinische Hochschule und in Nha Trang das Pasteur-Institut, das heute ein Yersin Museum ist. Den Platz für sein Grab wählte Yersin selbst, seine Grabplatte wird heute noch von der lokalen Bevölkerung täglich gefegt. Im Tempel von Suoi Cat hat Yersin gleich neben Buddha einen eigenen Altar. Als die französischen Kolonialherren sein Grab aufheben und seine Überreste nach Frankreich transferieren wollten, legten die Einheimischen einen Brief Yersins vor, in welchem er verfügte, dass er nach seinem Tod in Vietnam bleiben wolle und dass niemand seinen Körper wegschaffen dürfe. 71 Jahre nach seinem Tod wurde er Ehrenbürger von Vietnam.
Bei der Pest handelt es sich also primär um eine extrem ansteckende Erkrankung von Nagetieren, verursacht durch das Bakterium Yersinia pestis. Flöhe wie der Rattenfloh Xenopsylla cheopis, aber auch Pulex irritans, der Menschenfloh, übertragen durch ihre Stiche den Erreger auf den Menschen. So gelangen die Bakterien ins Blut der Patienten, welche zu 90 % in den regionären Lymphknoten nekrotisierende Abszesse entwickeln, die sogenannten Pestbeulen oder Bubonen. Die Inkubationszeit beträgt wenige Stunden, bis hohes Fieber und Schüttelfrost auftreten. Noch gefährlicher ist die Lungenpest, die von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen übertragen wird und innert zwei bis fünf Tagen zum Tode führt. Husten und Niesen sind erste Symptome der Pest, daher der Wunsch „Gesundheit!“, wenn jemand niest. Bei rascher Behandlung mit Antibiotika (Doxycyclin, Ciprofloxacin, Chloramphenicol und Trimethoprim/Sulfonamid) sind die Heilungsaussichten gut. Ein zuverlässiger Impfstoff ist nicht vorhanden, bei Verdachtsfällen besteht Quarantäne-Pflicht.
Als natürliche Reservoirs dienen heute noch Nagerpopulationen in der zentralasiatischen Hochebene. 2019 starben zwei russische Touristen an der Beulenpest, weil sie rohe Murmeltierleber aßen. In China meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua im November 2019 den vierten Fall einer Pestinfektion innerhalb weniger Wochen. In Indien und Vietnam, aber auch in Afrika (Kongo, Tansania, Madagaskar) und im Südwesten der USA kommt es selbst heute noch zu begrenzten, endemischen Pestausbrüchen. Die Pest fegte in drei großen Pandemien über die ganze Welt: Die Justinianische Pest wurde nach dem oströmischen Kaiser Justinian benannt und trat erstmals im Jahr 541 n. Chr. in Ägypten auf. Sie breitete sich im ganzen Römischen Reich aus, dessen Bevölkerung um die Hälfte (nach anderen Quellen um 20–30 %) reduziert wurde. Aber auch Hispanien, Gallien, Germanien und sogar Skandinavien waren betroffen. Die Justinianische Pest war maßgeblich am Untergang der Antike und am Aufkommen des Islam beteiligt. Erneut kam der Schwarze Tod um 1347 mit einem genuesischen Schiff nach Europa, mit wertvollen Pelzen (und Flöhen) an Bord, die sie auf der Krim geladen hatten. Die genuesische Kolonie Kaffa, das heutige Feodossija, wurde von den Mongolen belagert. Im Belagerungsheer brach die Pest aus, da schleuderten die Angreifer mehrere Pestleichen mit Katapulten über die Mauern der uneinnehmbaren Festung. Worauf die entsetzten Verteidiger ihre Schiffe bemannten und nach Italien segelten. Die große Pest wütete als „schwarzer Tod“ mehrere Jahrzehnte in ganz Europa und mindestens ein Drittel der Bevölkerung (25 Millionen Menschen) fiel ihr zum Opfer. Die Bezeichnung Schwarzer Tod ist zurückzuführen auf die hämorrhagische und nekrotische Schwarzverfärbung der Pestbeulen, der Bubonen genannten geschwollenen Lymphknoten. Wie eindrückliche Totentanz-Bilder des Basler Malers Hans Holbein illustrieren, verschonte die Pest weder Arm noch Reich. Auch der Maler selbst wurde im Jahr 1543 in London ein Opfer der Pest. Weitere prominente Pest-Tote waren der römische Kaiser Marc Aurel, der im Jahr 180 in Vindobona (Wien?) auf dem Feldzug gegen die Parther vermutlich an der Pest verstarb. Er soll gesagt haben: „Was weint ihr um mich? Weint um die Pest und das Sterbenmüssen aller!“ Gottfried von Bouillon, der den ersten Kreuzzug anführte, soll wie zahlreiche andere Kreuzritter im Jahr 1100 in Jerusalem an der Pest gestorben sein. Zahlreiche gekrönte Häupter wie Johanna von Burgund (1349), Margarethe I. von Dänemark, Norwegen und Schweden (1412) oder der erste preußische Herzog Albrecht von Brandenburg (1568) wurden vom Schwarzen Tod geholt. 1576 starb der berühmte italienische Maler der Hochrenaissance Tizian im stolzen Alter von 88 Jahren in Venedig an der Pest. Die dritte Pest-Pandemie nahm in Zentralasien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang, breitete sich aus von der Mandschurei über Yunnan bis nach Indien, Hawaii und die USA. Sie forderte während der nächsten 50 Jahre 12 Millionen Menschenleben. Während dieser Epidemie konnte Alexandre Yersin 1894 den Pesterreger in Hongkong identifizieren und den Übertragungsweg klären. Durch die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse, durch die Registrierung sämtlicher Pestfälle und die Einführung strikter Quarantäne-Maßnahmen konnten in Europa größere Epidemien verhindert werden. Noch unter dem Eindruck der letzten großen Pest-Epidemie gründeten Ärzte im Jahr 1907 in Genf das „Office International d’Hygiène Publique“, welches zur Weltgesundheitsorganisation WHO wurde. Doch noch 2017 brach auf Madagaskar eine Pest-Epidemie aus, bei welcher 2348 Menschen erkrankten und etwa 10 % daran starben. Dass Ratten etwas mit der Pest zu tun haben, war schon den alten Chinesen bewusst, heißt doch die Pest auf Chinesisch „Shu Yi“, Rattenkrankheit. Es gibt zwei frühe Texte aus der Jin- und der Sui-Dynastie, welche die Beulenpest erwähnen: „Xiao pin fang“ (Brief Pieces on Prescriptions), die von Chen Yanzhi zwischen 454 und 473 geschrieben wurden, und „Zhu bing yuan hou lun“ (Abhandlung über Ursprung und Symptome aller Krankheiten), die Chao Yuanfang zwischen 605 und 610 verfasst hat.
Ernteschäden durch Nager an Reiskulturen in Asien betragen 30–60 Millionen Tonnen pro Jahr (Singleton 2003), was einem finanziellen Verlust von 18–36 Milliarden US$ entspricht. In Malaysia werden bis zu 10 Prozent der Palmöl-Ernte jährlich von Ratten gefressen. Eine neue Studie im „Journal of Current Biology“ berichtet, dass die Plantagenbesitzer beim Kampf gegen die Ratten von einer bestimmten Makaken-Art, den Südlichen Schweinsaffen (Macaca nemestrina) unterstützt werden. Diese machen Jagd auf die Ratten, welche sie auf den Palmen aufstöbern und packen oder runterschmeißen. Unten sitzen die ranghohen Tiere, die zu bequem sind, hochzuklettern, und warten, dass die Beute vom Himmel fällt. Makaken sind zwar primär Vegetarier, aber diese Population hat sich offenbar auf die Jagd und den Verzehr von Ratten spezialisiert. In Thailand, Kambodscha und Vietnam gilt Rattenfleisch als Delikatesse und wird in Restaurants oder auf den Straßen direkt vom Grill angeboten. In Südvietnam ist Rattenfleisch traditioneller Bestandteil eines Hochzeitsmahls. Auf den Philippinen wird Rattenfleisch in Dosen unter dem Namen „Star“ vermarktet, was „Rats“ umgekehrt geschrieben darstellt. In Europa hingegen ist der Verzehr von Rattenfleisch tabu, was auf das kulturelle Gedächtnis im Zusammenhang mit dem Schwarzen Tod zurückgeführt wird.
Ausnahmen waren Hungersnöte, wie diejenige von Paris im Herbst 1870; die Stadt war von der preußischen Armee umzingelt und sollte ausgehungert werden. Die Fleischvorräte gingen bald zur Neige und so kam alles, was da kreuchte und fleuchte in den Kochtopf: Die Krähen aus den Parks wurden für sehr gut genießbar befunden, auch die beiden Elefanten „Castor und Pollux“ aus dem Jardin d’Acclimatation wurden verspeist. Als besonders vorzüglich erwies sich die Wanderratte (Rattus norvegicus), deren 130 Gramm Fleisch (ohne Kopf) ein ausgezeichnetes Frikassee (Rats en gibelone) ergab. Ratten sind sehr reinliche, soziale Tiere, die sich und andere gerne putzen. Sie sind kooperativ und helfen mit Vorliebe denjenigen, die ihnen selbst auch geholfen haben. Wird eine verdächtige Futterquelle entdeckt, schickt die Gruppe ein junges Männchen als Testfresser, als Vorkoster vor. Dieser wird eine Zeit lang beobachtet, und wenn er gesund bleibt, fressen auch die anderen von diesem Futter. Der Intelligenzgrad der Ratten entspricht ungefähr demjenigen eines Hundes, sie lernen schnell und haben ein gutes Gedächtnis für Aufgaben. Interessant ist, dass sie das Gelernte, zum Beispiel den Weg durch ein Labyrinth, auf ihren Nachwuchs vererben. Ein Beispiel für das Phänomen der Epigenetik, dass Wissen und Erfahrungen vererbt werden können. Durch ihre rasche Generationenfolge sind sie für Erbversuche geradezu prädestiniert. Im Jahr 2005 wurden europaweit 6,42 Millionen Mäuse, 2,34 Millionen Ratten und 260’000 Meerschweinchen zu wissenschaftlichen Tierversuchen verwendet (inklusive Kosmetika). Dank strengerer Bewilligungsverfahren und vermehrtem Tierschutzbewusstsein der Öffentlichkeit sind die Zahlen der verwendeten Versuchstiere rückläufig. Der ausgezeichnete Geruchsinn der Ratten kann auch für Menschen dienstbar gemacht werden: In Morogoro in Tansania werden die katzengroßen Riesenhamsterratten ausgebildet, um Tuberkulose zu erschnüffeln. Sie können 100 Speichelproben von möglichen TB-Patienten in wenigen Minuten zuverlässig überprüfen. Ein anderes Tätigkeitsfeld der Hamsterratten ist die Landminensuche. Sie werden auch Hero-Rats genannt, Heldenratten. Sie laufen angeleint über Minenfelder und riechen den Sprengstoff. Gegenüber Metalldetektoren haben die Tiere eine 50-mal höhere Treffsicherheit, und durch ihr geringes Körpergewicht lösen sie keine Detonationen aus. Der erste Einsatz in Mosambik war so erfolgreich, dass im September 2015 Mosambik als minenfrei deklariert wurde. Die Riesenhamsterratte „Magawa“ hat den höchsten britischen Tierorden für Tapferkeit erhalten, nachdem sie in Kambodscha ein 225 000 Quadratmeter großes Gebiet von Landminen gesäubert hat. Nun hat Magawa ihren verdienten Ruhestand angetreten (und befindet sich mittlerweile im Ratten-himmel). Für alle Leseratten folgen ein paar Literaturangaben über die zahlreichen Werke, die von Ratten oder der Pest handeln: 1370 erschien die sinnenfrohe Novellensammlung „Il Decamerone“, die sich 10 junge Adlige, die aus Florenz vor der Pest auf einen Landsitz geflohen waren, zum Zeitvertreib erzählt haben. Der englische Schriftsteller Daniel Defoe verfasste 1772 den bemerkenswerten Bericht „Die Pest in London“, wo er die verheerende Epidemie von 1665 beschreibt, bei welcher mehr als 100 000 Menschen den Tod fanden. 1911 wurde die Berliner Tragikomödie „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann uraufgeführt, die in einer heruntergekommenen Mietskaserne spielt. Von Albert Camus erschien 1947 der Roman „Die Pest“, in dem er beschreibt wie Ratten in der Stadt Oran in Algerien aus ihren Schlupflöchern kommen und eine Pest-Epidemie ankündigen. Wolfgang Borchert schrieb 1946 die Erzählung „Nachts schlafen die Ratten doch“, die am Ende des Zweiten Weltkrieges in den Trümmern einer deutschen Großstadt spielt. In dem 1986 veröffentlichten apokalyptischen Roman „Die Rättin“ nimmt Günter Grass auf die Problematik der Gentechnik Bezug, indem er genmanipulierte Rattenmenschen einführt, die er „Watsoncricks“ nennt. (Watson und Crick erhielten den Nobelpreis für die Entschlüsselung der Molekularstruktur der DNA). Am Schluss sagt die Rättin: „Uns wird das Menschengeschlecht niemals los.“
Eine kleine Ratte namens Rémy gelangte sogar zu Filmruhm: 2007 erschien der Computeranimationsfilm „Ratatouille“, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Klein Rémy arbeitet mit dem eigentlich unfähigen, tollpatschigen Küchenjungen Linguini zusammen. Unter dessen Kochmütze versteckt leitet er ihn durch Ziehen an seinen Haaren und macht ihn so zu einem renommierten Spitzenkoch, der in Paris ein Gourmet-Restaurant führt.
Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgangen sein, dass der elefantenköpfige Hindugott Ganesha meist auf seinem Reittier (vahana), einer Ratte, sitzend dargestellt wird. Wie wird diese unverhältnismäßige Belastung gedeutet? Die Ratte gilt als Symbol für Intelligenz und beseitigt Hindernisse. Philosophisch gesehen bedeutet sie die Kontrolle über das menschliche Ego und illustriert die Fähigkeit, dass selbst kleinste Wesen Göttliches tragen können. Nach einer Legende fraß einst eine Ratte, welche eigentlich ein Dämon war, der von den Göttern als Strafe für seine Respektlosigkeit verwandelt worden war, sämtliche Lebensmittel eines Ashrams (Meditationszentrum). Von den Bewohnern zu Hilfe gerufen, erschien Ganesha, der Überwinder von Hindernissen, und fing die Ratte. Er zähmte sie, indem er sie zu seinem Reittier machte.
Berühmt ist der Karni-Mata-Tempel in der kleinen Ortschaft Deshnok in Rajastan, wo 20 000 Ratten ein komfortables Leben führen. Sie sind der Göttin Durga geweiht und werden wie Heilige verehrt und mit den erlesensten Speisen verwöhnt. Wie in Hindu-Tempeln üblich muss man vor dem Betreten die Schuhe ausziehen, was angesichts der Rattenexkremente doch etwas Überwindung kostet. Die Tierchen krabbeln den Gläubigen über den ganzen Körper, welche ihnen Essen zuerst anbieten, um es dann selbst in den Mund zu schieben. Auch Milch zu trinken, von der die Ratten zuvor geschlabbert haben, gilt als heilbringend. Nach einer Legende sind die Ratten wiedergeborene Seelen verstorbener Fürsten oder – nach einer anderen Geschichte – soll einst eine Armee von 20 000 Soldaten vor einer Schlacht nach Deshnok desertiert sein. Eigentlich hätten sie mit dem Tod bestraft werden müssen, doch die Herrscherin Karni Mata, eine Reinkarnation der Göttin Durga, ließ Gnade walten, verwandelte die Männer in Ratten und ließ für sie einen Tempel bauen. Auch in Europa handeln zahlreiche Sagen von Ratten. Am bekanntesten ist wohl der „Rattenfänger von Hameln“. Die Gebrüder Grimm erzählen folgende Geschichte: Im Jahre 1284 erschien zu Hameln im Weserbergland ein bunt gekleideter Mann und versprach die Stadt von ihrer Rattenplage zu befreien. Der Lohn wurde vereinbart, der Rattenfänger spielte auf seiner Flöte, und alle Ratten und Mäuse der Stadt kamen hervorgekrochen. Er zog mit ihnen an die Weser, stieg ins Wasser, und sämtliche Tiere ertranken. Aber die Bürger verweigerten ihm seinen Lohn, sodass er zornig von dannen zog. Im Sommer kehrte der Rattenfänger zurück, spielte wiederum auf seiner Flöte, und dieses Mal folgten ihm sämtliche Kinder aus der Stadt hinaus und verschwanden mit ihm in einem Berg. Der wahre Kern der Sage ist nicht etwa der Kinderkreuzzug, der bereits 1212 stattgefunden hat, sondern eher die Auswanderung einer ganzen Generation im Rahmen der deutschen Ostkolonisation der Mark Brandenburg, wo heute noch zahlreiche Ortsnamen aus der Gegend von Hameln existieren.
Und dann gab es noch „The Rat Pack“, eine legendäre Gruppe von Entertainern, welche in den 1960er-Jahren zusammen auftraten. Sie bestand hauptsächlich aus Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin und könnte eigentlich als erste Boygroup bezeichnet werden. Die gemeinsamen Bühnenshows im Sands-Hotel gehörten zu den begehrtesten Events von Las Vegas.
Woher stammt eigentlich der Ausdruck: „Die Ratten verlassen das sinkende Schiff?“ Dass die schlauen Tiere geschlossen ins Meer springen, weil sie eine Katstrophe vorausahnen, gehört wohl eher ins Reich der Legende. Tatsache ist jedoch, dass die Ratten in früheren Zeiten praktisch in jedem Schiff in der Bilge, dem untersten Kielraum, mitreisten. Begann das Schiff zu sinken, füllte das eindringende Wasser zuerst die Bilge, und die Ratten bekamen als Erste nasse Füße. Deshalb flüchteten sie an Deck und wenn möglich auch von Bord. Voilà.
Im Internet fand sich ein interessanter Beitrag (doi:10.1530/JOE-12-0404) mit folgender Einleitung: „Die Wirkung der Akupunktur ist umstritten und ihre Wirkmechanismen weitgehend unbekannt.“ Im Journal of Endocrinology berichten Ladan Eshkevari und Kollegen von der Georgetown-Universität in Washington D. C. über einen Versuch mit Ratten: Eine Gruppe erhielt 2 Wochen lang täglich eine Elektroakupunktur am Punkt Zu San Li, Magen 36, der auch „Punkt der drei Dörfer“ oder „Göttliche Gleichmut“ genannt wird. Eine zweite Versuchsgruppe erhielt ebenfalls 2 Wochen lang täglich 20 Minuten eine Elektroakupunktur – aber an einem Placebopunkt nahe der Schwanzwurzel. 2 weitere Kollektive wurden nicht akupunktiert. Vom 4. Tag an wurden beide akupunktierten und eine nicht akupunktierte Rattengruppe täglich eine Stunde in ein 2 cm tiefes Eisbad gesetzt. Vor, während und nach dieser 10-tägigen Stressphase wurden bei allen Ratten Blutproben entnommen und der Gehalt zweier Stresshormone und eines Neuropeptides bestimmt. Das Ergebnis war, dass alle Ratten ohne Akupunktur oder mit Sham-Akupunktur typische Stressanzeichen aufwiesen: Beide Stresshormone (ACTH und Cortison) und die Neuropeptide stiegen rapide an und verblieben während der Versuchszeit erhöht. Nicht so bei der Gruppe, die jeweils vor dem Eisbad mit Elektroakupunktur am Punkt Zu San Li behandelt wurde. Bei ihr blieben Hormon- und Neuropeptidwerte genauso niedrig wie bei der Kontrollgruppe, die keinem Kältestress ausgesetzt war. Schlussfolgerung der Autoren: „Wir beginnen zumindest zu verstehen, was bei der Akupunktur auf molekularer Ebene passiert.“ Folglich ist die Akupunktur-Wirkung vielleicht doch nicht so umstritten und der Mechanismus nicht völlig unbekannt! Googeln lohnt sich! Im Englischen gibt es den Begriff „rat race“, der das zwanghafte Streben nach Erfolg und Anerkennung im täglichen Konkurrenzkampf bezeichnet. Wie Laborratten im Hamsterrad, in der Tretmühle. Ein guter Vorsatz zum Jahr der Ratte wäre, seine Zielsetzungen zu überdenken und die Work-Life-Balance zu optimieren. Wenn der Punkt der göttlichen Gleichmut Ratten vor Stress bewahren kann, sollten wir ihn auch bei uns vermehrt einsetzen! In diesem Sinne wünschen wir allen Leserinnen und Lesern ein möglichst stressfreies Jahr der Ratte.
3 Warum Buddha so lange Ohrläppchen hat
Eine Redewendung sagt: Der Chinese ist Konfuzianer, wenn es ihm gut geht, Daoist, wenn es ihm schlecht geht, und er ist Buddhist im Angesicht des Todes. So wird für die Hochzeit ein daoistischer Priester (sic!) engagiert, während für ein Begräbnis eher buddhistische Mönche gerufen werden.
Haben Sie sich auch schon gefragt, warum Buddha so lange Ohrläppchen hat? Die Begründung liegt nicht in der Aurikulomedizin, damit man seine psychischen Punkte besser finden kann, sondern darin, dass lange Ohren traditionellerweise eines der 32 Erkennungsmerkmale Buddhas sind. Die Kennzeichen eines großen Mannes (Sanskrit: Mahaprusa Laksana) sind folgende: Die Fußsohlen eines Buddha sind flach und eben wie der Brustpanzer einer Schildkröte. Auf den Handflächen und Füßen zeichnet sich ein Rad mit tausend Speichen ab. Seine Fersen sind lang und schmal, lang und schlank sind die Finger, sanft und zart sind Hände und Füße, die Bindehaut zwischen Zehen und Fingern ist fein wie ein Netz, gewölbt ist der Spann, die Beine sind schlank wie bei einer Gazelle, stehend kann er, ohne sich zu beugen, mit beiden Handflächen die Knie befühlen und berühren, in der Vorhaut verborgen ist das Schamglied, gülden leuchtet der Körper, wie Gold erglänzt seine Haut, die Haut ist so geschmeidig, dass kein Staub und Schmutz daran haften bleibt, aus jeder Pore wächst nur ein Haar, die Körperbehaarung ist flaumartig, die Haltung ist erhaben und aufrecht, Fußsohlen, Handflächen, Schultern und Kopf sind wohlgeformt, der Bereich unter den Achseln ist gut gefüllt, der Oberkörper ist löwenhaft mit breitem Brustkorb, ein Klafter ist sein Wuchs, seine Proportionen sind die des Banyan-Baumes: seine Körperlänge entspricht seiner Armlänge, seine Armlänge entspricht seiner Körperlänge, gleichförmig sind die Schultern, mächtig sind die Ohrmuscheln (!), das Kinn ist löwenartig, die Zähne sind vollständig, die Zähne sind gleichmäßig gefügt, nicht auseinanderstehend, glänzend weiß ist das Gebiss, strahlend weiß sind die vier Eckzähne, lang und breit ist die Zunge, tief und klangvoll ist die Stimme, die Augen sind tiefblau, die Wimpern sind wie bei einem königlichen Stier, er hat eine weiße leuchtendeurnazwischen den Augenbrauen (der weiße Punkt entspricht dem dritten Auge), er hat eine Erhebung auf der Mitte des Kopfes. So weit die im Pali-Kanon beschriebenen 32 Merkmale eines großen Mannes, wie sie in der Lehrrede der Brahmayu Sutra Majjhjima-Nikaya beschrieben werden (zitiert nach Alexander Berzin, „Study on Buddhism“).
Große Ohrläppchen können nicht nur ein Zeichen von Alter und Weisheit sein, sondern auch ein Symptom von Akromegalie. Diese endokrinologische Erkrankung mit einer Überproduktion des Wachstumshormons Somatotropin führt zu einer Vergrößerung der Akren (Hände, Füße, Nase, Ohren, Kinn, Genitalien). Da Buddhas Gestalt aber, wie oben beschrieben, anderweitig von harmonischen Proportionen war, dürfte die Akromegalie als Ursache seiner großen Ohrläppchen wohl entfallen. Eine andere mögliche Erklärung könnte seine königliche Abstammung sein: Als reicher Prinz trug er schwere Ohrringe, welche die Ohrläppchen, der Schwerkraft folgend, nach unten zogen.
Aber wer war denn der historische Buddha eigentlich? Im Jahre 563 v. Chr. am 8. Tag des vierten Mondmonats wurde in Nordindien in der Herrscherfamilie Shakya ein Prinz namens Siddharta Gautama geboren. Buddhisten auf der ganzen Welt feiern heute noch an diesem Tag das Vesakh-Fest, den Geburtstag Buddhas mit einer Prozession. Der Vater von Siddharta hieß Shuddhodana, er war ein regierender Fürst im Staat Kapilavastu an der Grenze zwischen Indien und Nepal. Seine Mutter war Mahamaya (große Maya), einer Legende nach erschien ihr die Seele Buddhas in Gestalt eines weißen Elefanten, der ihre rechte Seite berührte. Von dort soll er auch den Körper der Mutter verlassen haben. Neun Monate später geschah es in der Ortschaft Lumbini im heutigen Nepal in einer Vollmondnacht, dass Königin Mahamaya ihren Sohn ohne Schmerzen im Stehen gebar. Das Kind kam völlig rein aus ihr hervor und konnte bereits gehen und sprechen. Es machte sieben Schritte in jede Himmelsrichtung, unter jedem Schritt wuchs eine Lotusblüte aus dem Boden, dabei sprach er: „Dies ist meine letzte Geburt, ich werde nie mehr in einem Mutterleib weilen.“ Er wurde Siddharta genannt, was auf Sanskrit so viel heißt wie „der erfüllte Wunsch“ oder „der das Ziel erreicht hat“. Vorher war die Ehe seiner Eltern 20 Jahre kinderlos geblieben. Der Familienname „Gautama“ bedeutet „der größte Stier“ oder „Anführer der Herde“. Sieben Tage nach der Geburt starb seine Mutter, und der Vater heiratete deren Schwester Pajapati, so wurde die Tante zu seiner Stiefmutter. Der Prophet Asita soll geweissagt haben, dass der Knabe einmal ein großer König werden würde – oder ein großer heiliger Mann, wenn er das Leid der Welt erkennen würde. Da sein Vater für ihn eher eine königliche Laufbahn vorgesehen hatte, verbot er jegliche religiöse Unterweisung, auch durfte er den Palast nicht verlassen, um nicht mit menschlichem Leid konfrontiert zu werden. Im Alter von 16 Jahren wurde er mit seiner gleichaltrigen Cousine, Prinzessin Yasodhara, verheiratet, welche ihm den gemeinsamen Sohn Rahula gebar. Als ihm das Leben im Luxus des Königspalastes zu langweilig wurde, unternahm er die berühmten vier Ausfahrten. Bei der ersten Ausfahrt durch das östliche Stadttor begegnete er einem alten Greis mit gebückter Haltung, schütterem Haar und ohne Zähne, dessen Anblick ihn erschreckte. Siddharta erkannte, dass die Jugend vergänglich ist und niemand dem Zerfall des Alters entgehen kann. Bei der zweiten Ausfahrt durch das Südtor traf er einen Kranken, der ihm vor Augen führte, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist und Arm und Reich gleichermaßen treffen kann. Bei der dritten Ausfahrt durch das westliche Stadttor begegnete er einem großen Leichenzug mit zahlreichen wehklagenden Angehörigen. Dabei wurde ihm zum ersten Mal bewusst, dass alles Leben vergänglich ist, sogar sein eigenes. Am Ende steht immer ein großer Verlust und Abschiedsschmerz. Bei der vierten Ausfahrt durch das nördliche Tor kreuzte ein Bettelmönch seinen Weg. Dieser besaß rein gar nichts, aber sein Blick strahlte eine große Ruhe und Zufriedenheit aus, seine Haltung war voll Würde. Dies war der erste Ausflug, auf dem ihm kein Leid begegnete, so beschloss er, von nun an wie ein Mönch zu leben – ohne Besitz und Macht, aber auch ohne Neid, Gier oder Hass. Deshalb beschloss Siddharta im Alter von 29 Jahren, seine Familie der Obhut des luxuriösen Elternhauses zu überlassen und seinen Sohn Rahula den Großeltern zur Erziehung zum künftigen Thronfolger zu übergeben. Der Name seines Sohnes bedeutet übrigens „Fessel“, was kaum auf ein besonders herzliches Vater-Sohn-Verhältnis schließen lässt, sondern eher als Ausdruck der sogenannten „Hauslosigkeit“, dem Verzicht auf Besitz und Familie der buddhistischen Mönche, zu verstehen ist. Immerhin wurde Rahula später in die Ordensgemeinschaft aufgenommen. Siddharta selber wollte als Bodhisattva (als nach höchster Erkenntnis strebendes Wesen), als wandernder Asket die befreiende Einsicht in die Grundgesetze des Lebens und die Überwindung des leidbehafteten Daseins suchen. Rudolf Steiner bezeichnete Bodhisattvas als große geistige Führer und Lehrer der Menschheit. Mit fünf weiteren Asketen zog er sich ganz aus dem alltäglichen Leben zurück, er magerte bis auf die Knochen ab und meditierte nachts unter wilden Tieren und auf Friedhöfen. Im Alter von 35 Jahren saß Siddharta unter einem Banyan-Baum, einer Pappel-Feige (Ficus religiosa), war offenbar beim Meditieren eingeschlafen und erlebte das „Erwachen“ (sanskrit: Bodhi, was oft ungenau mit „Erleuchtung“ übersetzt wird). Damit wurde er zum Buddha, zum „Erwachten“; nach seiner Erleuchtung unter dem Feigenbaum wurde er auch „Shakyamuni“ (Weiser aus dem Hause Shakya) genannt. Im Anschluss an sein Erwachen hielt Gautama im Wildpark von Sarnath in der Nähe von Benares seine erste Lehrrede vor seinen 5 ehemaligen Gefährten. 45 Jahre lang lehrte er im Nordosten Indiens den mittleren Pfad zwischen Askese und Luxus vor Menschen aller Gesellschaftsschichten. Vor Königen und Bettlern, vor Brahmanen und Ausgestoßenen, vor Angehörigen aller Kasten, vor Männern und Frauen. Auch seine frühere Gemahlin Yasodhara und seine Stiefmutter Pajapati traten als Nonnen in den Orden des Buddha ein. Im Alter von 80 Jahren verschied Siddharta Gautama im Jahr 483 v. Chr. in der Ortschaft Kushinagar in Uttar Pradesh, nachdem er eine verdorbene Pilzsuppe gegessen haben soll, und ging ins Nirwana über. In diesem Jahr beginnt die buddhistische Zeitrechnung, unser Jahr 2000 wäre also das Jahr 2517. Ein buddhistischer Wandermönch namens Bodhidharma, der von 440–528 n. Chr. lebte, brachte die Lehre des Meditations-Buddhismus Mahayana (großes Fahrzeug) entlang der Seidenstraße nach China, wo er der Sage nach im Shaolinkloster Kampfkunst unterrichtet haben soll. Auch die Erfindung des Tees soll auf ihn zurückgehen (siehe Kapitel „Vom Ursprung des Tees“). Durch den Einfluss des Daoismus entstand während der Tang-Dynastie (618–907 n. Chr.) der Chan-Buddhismus, der dann im 12. und 13. Jahrhundert als Zen-Buddhismus nach Japan exportiert wurde. Grosso modo können im Buddhismus drei grundlegende Schulen oder Fahrzeuge unterschieden werden: Hinayana oder Theravada, Mahayana und Vajrayana. Hinayana bedeutet auf Sanskrit „minderes Fahrzeug“ und bezeichnet alle nicht zum Mahayana gehörenden Strömungen des Buddhismus. Theravada (Pali: „Schule der Ältesten“) geht als älteste Tradition auf die erste Mönchsgemeinde zurück, die Buddha zu Lebzeiten umgab, und ist heute noch vor allem in Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam und in der chinesischen Provinz Yunnan verbreitet.
Der Vajrayana-Buddhismus (Diamantfahrzeug) ist eine im 4. Jahrhundert entstandene Strömung des Mahayana-Buddhismus, welche vor allem die Traditionen des tibetischen Hochlandes und der Mongolei prägte, er ist in Bhutan Staatsreligion. Im Mahayana-Buddhismus gibt es fünf große transzendente Buddhas (Adibuddha genannt), sie verkörpern die absolute Weisheit und entsprechen auch den fünf Wandlungsphasen in der chinesischen Medizin mit all ihren Aspekten. In der Mitte, im Zentrum des Universums, sitzt Vairocana, der Sonnengleiche, der Herr der Buddhafamilie, der kosmische Buddha, der Herr der Weisheit. Mit seiner Handstellung (Mudra) umfasst die linke Hand den rechten Zeigefinger und symbolisiert Lehren und Lernen. Deshallb heißt diese Haltung auch „two-way mudra“. Im Osten sitzt Akshobya, der Unerschütterliche. Er hält in der linken Hand eine Schale und berührt mit der rechten Hand die Erde, die er als Zeugin seiner Erleuchtung anruft. Dem Westen zugeordnet wird Amithaba, der Buddha des grenzenlosen Lichtes und Herr der Lotusfamilie. Er hält meditierend die Hände im Schoß gefaltet. Es folgt Ratnasambhava, der zur südlichen Himmelsrichtung gehört. Er symbolisiert großzügige Freigiebigkeit sowohl mit Liebe als auch mit Ratschlägen, was durch seine offenen Hände dargestellt wird. Und schließlich Amoghasiddhi, „der die Weisheit vollendet“. Seine Himmelsrichtung ist der Norden, er verwandelt Eifersucht in Weisheit. Im Volksglauben gilt er als Erfolgsbringer. Er zeigt das Mudra der Furchtlosigkeit, die erhobene offene Handfläche bedeutet: „Fürchtet euch nicht, euch den Problemen zu stellen!“ So kann man bei jeder Buddha-Figur an der Haltung der Hände, den Mudras, feststellen, welche Inkarnation Buddhas gemeint ist.
Ein weiterer bekannter Vertreter der Buddha-Zunft ist Maitreya, der Buddha der Zukunft. Sein Sanskrit-Name ist wahrscheinlich von „maitri“, universale Güte, Liebe, Freundschaft abgeleitet. Auf Chinesisch heißt er Mile Fo. Manche Gelehrte nehmen an, dass Maitreya ursprünglich mit der iranischen Gottheit Mithra identisch sei. In China wird er auch in der Gestalt des Budai oder in Japan als Hotei verehrt. Dieser war der wohlgenährte, fröhliche Bettelmönch halb legendären Ursprungs mit Namen Qici. Er trug den Spitznamen Budai (Jutesack), da er in einem solchen seine Habseligkeiten trug. Er lebte im 10. Jahrhundert und stammte aus der chinesischen Provinz Zhejiang. Vor allem im Chan-Buddhismus galt er als Inkarnation des Buddhas der Zukunft, von Maitreya. Er verkörpert die Tugend der Selbstgenügsamkeit, trotzdem sind sein Bauch und sein Sack prall gefüllt. Es soll Glück bringen, seinen Bauch zu streicheln, und da er oft im Kreis von Kindern abgebildet wird, gilt er als eine Art asiatischer Weihnachtsmann. Häufig wird er auch als Happy Buddha oder Laughing Buddha bezeichnet.
Weltweit gibt es heute über 400 Millionen Buddhisten, davon 102 Millionen in China. Bereits im Altertum sind östliche Einflüsse über die Handelswege der Seidenstraße und die Eroberungszüge Alexanders des Großen in den Mittelmeerraum gelangt. Hervorzuheben ist besonders der indische Kaiser Ashoka, der von 268–232 v. Chr. regierte. Unter seiner Herrschaft erreichte Hindustan, das Reich der Maurya-Dynastie, seine größte Ausdehnung und umfasste vom Hindukusch im Nordwesten bis zum Ganges-Delta im Osten, vom Himalaya im Norden bis Mysore im Süden praktisch den gesamten indischen Subkontinent. Nach der blutigen Unterwerfung von Kalinga (heutiges Orissa) wurde Ashoka von Mitleid und einer psychischen Krise erfasst und konvertierte zum Buddhismus. Er sandte buddhistische Mönche auf religiöse Missionen in die hellenistischen Königreiche in Syrien, Ägypten, Griechenland und Makedonien und begründete so den Graeco-Buddhismus. Der kulturelle Kontakt zwischen der klassisch-griechischen Philosophie beeinflusste dabei die Entwicklung des Mahayana-Buddhismus, welcher sich ab dem 5. Jahrhundert in das Kaiserreich, nach Korea und Japan verbreitete. Nach dem Tod Alexanders des Großen im Jahre 323 v. Chr. gründeten seine Generäle eigene Königreiche, die Diadochenreiche, darunter Ptolemaios in Ägypten und Seleukos I. das Seleukidenreich, aus dem später das graeco-baktrische und das indo-griechische Königreich entstanden. In Gandara, dem heutigen Peschawar, entwickelte sich als Nachwirkung der Verschmelzung indischer und hellenistischer Kunst der typische Gandara-Stil buddhistischer Skulpturen, bei welchen die stehenden Buddha-Figuren in kunstvoll drapierte Gewänder im Stil einer römischen Toga gehüllt sind. Im ganzen indischen Großreich von Ashoka wurden auf Säulen, Felsen und Höhlenwänden 33 Edikte in der alt-indischen Volkssprache Prakrit (einer Schwestersprache von Sanskrit) und sogar auf Griechisch und Aramäisch eingemeißelt. Diese sogenannten Ashoka-Edikte verkündeten, dass die buddhistische Lehre als Grundlage seiner Herrschaft gelten soll. Die ethischen Grundsätze des Dharma sollen das rechte Handeln und den Respekt für alle Lebewesen leiten. Wörtlich heißt es: „Hier in meinem Reich dürfen keine Lebewesen getötet oder als Opfer dargebracht werden.“ Religiöse Toleranz und soziale Maßnahmen wurden gefördert und Vorkehrungen für zwei Arten der medizinischen Behandlung im Gesundheitswesen getroffen: medizinische Versorgung von Menschen und medizinische Versorgung von Tieren. Ashoka sagte: „Wo medizinische Kräuter zur Behandlung von Menschen oder Tieren nicht vorhanden waren, habe ich sie eingeführt und pflanzen lassen.“
Im Mittelalter existierte die Heiligenlegende vom Eremiten Baarlam und dem Prinzen Josaphat, welche eigentlich eine christliche Umarbeitung der Buddha-Legende ist. Hinter dem Namen Josaphat verbirgt sich nämlich Bodhisattva Siddharta Gautama. Die zwei legendären Figuren wurden 1583 sogar heiliggesprochen, somit wurde Buddha in den Kanon der katholischen Heiligen aufgenommen. Erst durch die Berichte von Marco Polo, der am Hof des buddhistischen Mongolenkaisers Kublai Khan lebte, gelangten wieder Berichte über den Buddhismus in den Westen. Als erste westliche Philosophen der Neuzeit befassten sich Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) und vor allem Arthur Schopenhauer (1788–1860) eingehend mit dem östlichen Denken. Schopenhauer bezeichnete sich selbst als den „ersten europäischen Buddhisten“. Die bekanntesten westlichen Vertreter des Buddhismus in der Gegenwart sind: Richard Gere, Tina Turner, Steve Jobs, Orlando Bloom und Allen Ginsberg.
Nach der Gründung der Volksrepublik China wurde unter Mao Zedong die öffentliche Religionsausübung verboten, während der Kulturrevolution haben die Roten Garden zahlreiche Klöster zerstört und Nonnen und Mönche verhaftet oder getötet. Seit den 90er-Jahren wurden unter Deng Xiaoping viele Klosteranlagen neu aufgebaut und als Touristenattraktionen wieder entdeckt. Heute gibt es in China über 20 000 buddhistische Klöster mit ca. 200 000 Nonnen und Mönchen. Allein in Beijing gibt es offiziell 27 buddhistische Tempel, der bekannteste ist der Yong-He-Tempel, Palast des Friedens und der Harmonie. Diese ehemalige Residenz des Prinzen Yinzhen wurde 1694 erbaut und 1744 unter Kaiser Qianlong in einen lamaistischen Tempel umgebaut. Daher der Name Lama-Tempel, welcher auch die größte lamaistische Tempelanlage außerhalb Tibets darstellt und zu der Gelbmützen-Sekte des tibetischen Buddhismus, den Gelugpas gehört. Die Anlage hat 5 Gebetshallen, in der Haupthalle, in der Halle des Unendlichen Glücks, dem Wanfu-Pavillon, steht eine 18 Meter hohe Statue des Buddhas Maitreya, des Buddhas der Zukunft, die aus einem einzigen Sandelholz-Stamm geschnitzt wurde. Dieser war ursprünglich 28 Meter lang, 8 Meter sind im Boden versenkt, wie im Guinnessbuch der Rekorde verzeichnet ist. Der Sandelholzbaum wurde 1744 vom 7. Dalai Lama Kelso Gyatsho dem Kaiser Qianlong geschenkt und wurde während vieler Monate von Sichuan, wo er gefällt wurde, nach Beijing transportiert. Im Winter wurden die Straßen vereist und für die frostfreie Zeit hat man extra Kanäle gegraben. Angeblich soll der Yong He Lama-Tempel, sowie auch der Kaiserpalast, die Kulturrevolution nur dank der persönlichen Intervention von Premierminister Zhou Enlai unbeschadet überstanden haben, weil er diese durch Einheiten der Volksbefreiungsarmee schützen ließ. Heute ist der Lamatempel neben der verbotenen Stadt, dem ehemaligen Kaiserpalast, die meistbesuchte Attraktion Beijings.
Die Quintessenz des Buddhismus kann in zwei Wörtern zusammengefasst werden: Dharma und Karma. Dharma (chinesisch fa) ist der zentrale Begriff in vielen asiatischen Religionen und bedeutet: Gesetz, Recht, Ethik, Moral und wird durch das Rad der Lehre symbolisiert. Von der Erfüllung des Dharma hängt das Karma ab, das sich aus den Konsequenzen der Taten eines Individuums manifestiert. Das spirituelle Konzept von Ursache und Wirkung heißt letztendlich, dass jede Handlung – physisch oder geistig – Folgen hat. Jetzt oder später.
Nach den Worten des Dalai Lama ist der Buddhismus weder eine Religion noch ein Dogma, sondern eher eine Kunst zu leben, eine Quelle des inneren Friedens und der Weisheit. Er erweckt in uns Herzensgüte und Liebe und lehrt uns, alles Leben auf dieser Erde zu schützen. Fähigkeiten, die wir so gut wie nie zuvor gebrauchen können.
4Die Auferstehung des Konfuzius





























