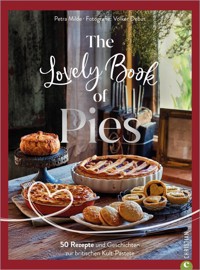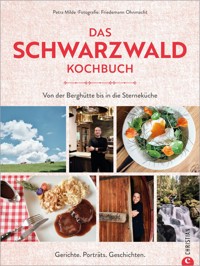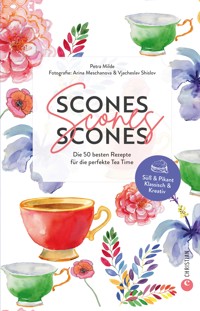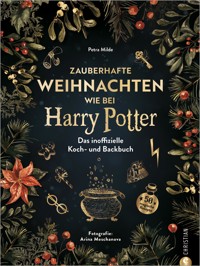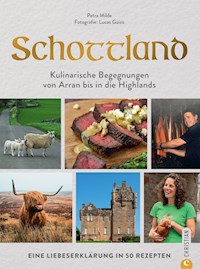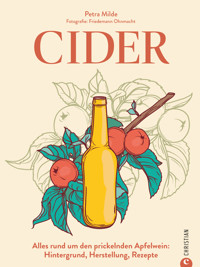
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Christian Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Prickelnder Apfelperlwein hat sich in den vergangenen Jahren als »Cider« zum neuesten It-Getränk gemausert. Wie beim Wein ist geschmacklich von fruchtig-mild bis vollmundig und rauchig, von purem Apfel bis zu Blends alles möglich. Eine spannende Aromenwelt, die Petra Milde allen Fans und denen, die es werden wollen, nahebringt. Dieses Buch macht Spaß und öffnete Horizonte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
ALLES CIDER?
WIE ALLES BEGANN – EINE KLEINE GESCHICHTE DES CIDERS
DIE HERSTELLUNG: VON A(PFEL) BIS F(LASCHE)
ZUM BEISPIEL: OBSTHOF AM BERG IN KRIFTEL
CIDER, CIDRE, ÄPPELWOI – ÜBER LANDESTYPISCHE AUSPRÄGUNGEN
TASTE UND TASTING–DIE GESCHMACKSVIELFALT VON CIDER
ZUM BEISPIEL: MANUFAKTUR JÖRG GEIGER IN SCHLAT
CIDER IM EINZELNEN: VON KLASSIKERN BIS ZU GEHEIMTIPPS
CRAFT-CIDER
DRINKS MIT CIDER – GERÜHRT UND GESCHÜTTELT
WAS KOCHEN WIR HEUTE? – FÜNF REZEPTE FÜR CIDERFANS
MEET AND DRINK CIDER! – VON MESSE BIS ACADEMY
REGISTER
GLOSSAR
ÜBER DIE AUTORIN/ÜBER DEN FOTOGRAFEN
DANK
Alles Cider?
Wenn wir von Cider reden, worum geht es da eigentlich? Wer eine feste Definition erwartet, den muss ich enttäuschen: Es gibt keine einheitliche Regelung, was einen Cider zum Cider macht, nicht in der EU, die ja sonst immer sehr fleißig ist, wenn es um Regularien geht, und schon gar nicht weltweit. Klassische Cider-Länder wie Großbritannien oder Frankreich haben zumindest einige Kriterien aufgestellt, die ein Getränk ihres Landes erfüllen muss, um als Cider gehandelt werden zu können (Ach, übrigens: Ich werde den Terminus »Cider« verwenden, wenn es nicht um länderspezifische Produkte geht. Ständig »Cider/Cidre/Sidra« zu schreiben, wäre doch sehr lästig beim Lesen.)
Versuchen wir doch, uns einfach einmal über ein paar Stichworte heranzutasten: Am Anfang war der Apfel – darauf können wir uns vielleicht einigen. Klassischer Apfelcider wird im Mittelpunkt dieses Buches stehen, wohl wissend, dass sehr oft auch Birne mit im Spiel ist – zumindest anteilig.
»Cider ist zu Apfelwein vergorener Apfelsaft, der durch enthaltene Kohlensäure spritzig und erfrischend schmeckt.«
Das klingt doch eigentlich recht gut, solange wir nicht versuchen, die Ausgangsbasis auf »frischen Apfelsaft« zu beschränken. Industriell hergestellter Cider wird oft zumindest zu einem Teil aus Apfelsaftkonzentrat hergestellt, manchmal unter Zuckerzugabe, manchmal mit Farbstoffen, häufig mit Konservierungsmitteln.
Und wie kommt die Kohlensäure hinein? Ganz klassisch nur durch die alkoholische Gärung? Durch eine zweite Gärung in einem Drucktank? Durch Gärung in der Flasche? Alles ist möglich – im Kapitel zur Herstellung gehe ich darauf ein.
Cider ist eigentlich ein Klassiker der Getränkegeschichte. Ein Klassiker, der von seinem eigenen Erfolg verändert und in der industriellen Herstellung zu einem Everybody’s-Darling-Getränk wurde – und mit der Craft-Bewegung zurück zu seinen Wurzeln gelangt ist. Das Magazin Forbes formulierte es vor drei Jahren im Artikel »How Craft Beer Paved The Way For Cider’s Continued Resurgence« sehr treffend: »Alle Getränketrends zeigen auf den Cider. Glutenfrei, natürlich, von regionaler Herkunft; das sind alles langfristige Veränderungen, nicht nur Trends.« Auf diese Wurzeln und darauf, welche Seitentriebe sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, schauen wir in den folgenden Kapiteln.
Und das wird Sie sicher auch interessieren: Wie wird Cider eigentlich hergestellt? Auch darum soll es gehen – ganz allgemein. Die chemischen Feinheiten möchte ich hier ausklammern, denn die entsprechende wissenschaftliche Tiefe ist mehr etwas für erfahrenes Fachpublikum und weniger etwas für den Einstieg.
Um zu zeigen, wie sich Ciderproduktion in Deutschland heute darstellt, habe ich zwei Hersteller besucht, einen in Hessen und einen in Schwaben. Ich hoffe, meine Berichte darüber finden Sie genauso interessant wie ich die Besuche.
Was tut sich in der Ciderszene sonst noch? Wussten Sie, dass es alljährlich eine internationale Cidermesse in Deutschland gibt, auf der Awards verliehen werden? Dass eine deutsche Hochschule Lehrgänge über Cider anbietet, die jeder belegen kann? Dass es einen World Cider Day gibt? Spätestens nach der Lektüre dieses Buches wissen Sie es!
Damit es bei all der Theorie über Cider nicht allzu trocken bleibt, gibt es noch ein paar Anregungen für leckere Drinks mit Cider und für Kochrezepte mit oder zum Cider.
In diesem Sinne: Zum Wohl!
Wie alles begann – eine kleine Geschichte des Ciders
Auf der Spurensuche nach den Anfängen des Ciders stößt man in vielen Quellen immer wieder auf die Jahreszahl 55 v. Chr. Bei historisch bewanderten Lesern klingelt es dabei vermutlich irgendwo im Hinterkopf: War da nicht etwas mit Julius Cäsar? Richtig, in diesem Jahr startete das römische Heer die erste Invasion Britanniens.
Bei seinem Zug durch die neuen Gebiete, so erzählt man sich, lernte der römische Heerführer Julius Cäsar ein Getränk kennen, das die keltische Bevölkerung aus Wildäpfeln herstellte. Mit unserem heutigen Cider war diese fermentierte Flüssigkeit mit Sicherheit nicht zu vergleichen. Aber die Römer fanden sie auf jeden Fall so bemerkenswert, dass sie das Wissen darum bei ihrem Rückzug mit auf den Kontinent nahmen. Die Sache mit Britannien lief für sie nämlich zunächst nicht sehr erfolgreich. Anders die mit dem Cider, die begannen die Römer erfolgreich voranzutreiben.
Schon vor Jahrhunderten hatte der Apfel seinen Siegeszug aus dem Gebiet des heutigen Kasachstan über Griechenland nach Italien und den Rest Europas angetreten und war kultiviert worden. Er wurde in Plantagen angebaut und hatte in der griechischen und römischen Kultur einen hohen Stellenwert. Das aus Britannien importierte Fermentationsverfahren nun auf den Saft des Kulturapfels anzuwenden, brachte ungleich bessere und wohlschmeckendere Ergebnisse hervor als die Verarbeitung der harten und kaum Saft spendenden wilden Äpfel Britanniens.
Vor allem in den nördlichen Gebieten des heutigen Frankreichs, in der Normandie und der Bretagne, waren große Apfelplantagen entstanden. Wen wundert es also, dass genau dort die Kunst der Herstellung des Ciders – pardon, des Cidres – perfektioniert wurde? Noch dazu, wenn man bedenkt, dass hier oben an der normannischen Küste etliche Nachkommen von Wikinger siedelten, die dem Apfelwein schon immer sehr zugetan waren.
Als dann die Normannen – die Nachkommen der Wikinger – 1066 erfolgreich in Britannien einfielen und das Land in Besitz nahmen, kam das Wissen um den vergorenen Apfelsaft wieder dorthin zurück, von wo es gekommen war, nur eben deutlich verbessert. Bessere Äpfel, bessere Presstechniken, bessere Führung der Gärung – zusammen mit den Normannen startete auch der Cider seinen Eroberungszug über die britische Insel.
DIE SACHE MIT DER ROYAL NAVY
Die politischen Querelen auf und mit dem Kontinent im Laufe der kommenden Jahrhunderte, die französischen, spanischen und holländischen Streitigkeiten und Kriege verschafften dem britischen Cider immer wieder Pluspunkte: Der Weinimport vom Festland auf die britische Insel wurde in Kriegszeiten gedrosselt und man musste sich stärker auf eigene Produkte besinnen.
Als John Evelyn 1662 der Royal Society sein Werk »Sylva; or, A discourse of forest-trees, and the propagation of timber in His Majesties dominions« vorstellte, ging es darum, Landbesitzer zu ermutigen, mehr Bäume anzubauen und Holzwirtschaft zu betreiben. Der Bau von Schiffen für die Royal Navy und deren viele Seeschlachten hatte überall zu großen Rodungen geführt und Holz wurde Mangelware.
1664 wurde Evelyns Ausarbeitung veröffentlicht und es fand sich ein Anhang daran, der als wichtiger Meilenstein der Cidergeschichte gilt: »Pomona; or, An appendix concerning fruit-trees in relation to cider, the making and several ways of ordering it.« Es finden sich Aufsätze von ihm, aber auch von verschiedenen anderen Autoren wie John Beale und Sir Paul Neile darin, in denen es um den Anbau und die Pflege von Apfelbäumen zum Erhalt von hochwertigem Cider geht. Die Royal Navy war also indirekt (und unfreiwillig) Förderer des Ciders. Wer hätte das gedacht.
EIN KLIMAWANDEL HILFT DEM CIDER
Maßgeblich beteiligt an der zunehmend größeren Bedeutung des Ciders sowohl auf der britischen Insel als auch auf dem europäischen Festland waren nicht nur politische Verhältnisse, sondern auch ein klimatisches Ereignis, das als »Kleine Eiszeit« bekannt ist: Ende des 15. Jahrhunderts lösten deutlich kühlere Temperaturen die der mittelalterlichen Warmzeit ab. Bis ins 19. Jahrhundert hinein litten viele Menschen unter den harten Wintern und unter Hungersnöten, denn das geänderte Klima hatte natürlich starke Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
Der Agrarwissenschaftler John Worlidge machte sich im 17. Jahrhundert in seinem Werk »Vinetum britannicum or Treatise of Cider« für die Produktion von Cider anstelle von Wein stark. So könne man sich den geänderten Klimaverhältnissen, die für den Weinbau ungünstig waren, anpassen. Auch in Frankreich und Deutschland wurde der Anbau von Wein zunehmend schwieriger und in vielen klassischen Weingegenden orientierte sich die Landwirtschaft um. Besonders auffällig wird es, wenn man sich die Gegend um Frankfurt herum anschaut: Noch im Mittelalter blühendes Weinland, entwickelte sich Hessen vom 16. Jahrhundert an zum Äppelwoi-Country.
ERSATZWÄHRUNG CIDER
Die Bedeutung des Ciders ließ sich einst auch an seinem Einsatz als Ersatzwährung ablesen: Erstmals erwähnt wurde eine solche Bezahlung bereits im Jahr 1204 in den Papieren eines Anwesens in Runham, Norfolk. Vom 18. Jahrhundert an war die Bezahlung von Landarbeitern in Cider sogar eine durchaus gängige Praxis – und ein für beide Seiten vorteilhaftes Arrangement.
Ein erfahrener, gut bezahlter Arbeiter brachte es da schon einmal auf bis zu acht Pints am Tag, rund 4,5 Liter. Gut, man sollte nicht vergessen, dass damit die gesamte Familie versorgt und Cider – wie auch Bier – wegen der schlechten Wasserqualität von Jung bis Alt getrunken wurde. Dass 1887 im Truck Act die Praxis der Entlohnung in Cider untersagt wurde, lässt auf eine nicht unerhebliche Auswirkung des Alkoholkonsums schließen. Indes: Die Anweisung hatte es schwer, sich durchzusetzen, und noch bis ins 20. Jahrhundert hinein hielt sich mancherorts die Cider-Währung.
DIE SACHE MIT DEM NAMEN
In Großbritannien heißt er Cider, in Frankreich Cidre, in Spanien Sidra – die Ähnlichkeit des Namens ist so augenfällig, dass sie auf gemeinsame sprachliche Wurzeln hindeutet. Doch woher kommt das Wort?
In einigen Artikeln über Cider liest man von Berichten des antiken griechischen Geschichtsschreibers Herodot 400 v. Chr. über einen Stamm in Side in Kleinasien, der Saft aus Äpfeln herstellte. Nach dieser Stadt habe man dann das Getränk benannt, das sich später in ganz Europa ausbreitete. Die Stadt wiederum wurde nach einer Fruchtbarkeitsgöttin benannt, einer Tochter des Taurus, die sich in einen Granatapfelbaum verwandelte, einen »Side«. Handelte es sich also nicht um Apfelsaft, sondern um Saft des Granatapfelbaumes? Der Granatapfel ist allerdings trotz des ähnlichen Namens botanisch gar nicht mit unserem Apfel, der aus Wildäpfeln/Holzäpfeln hervorging, verwandt.
Es ist eine schöne Erzählung, aber die Herleitung der Ethymologen, die vom hebräischen Wort Shekhar (8.–6. Jh. v. Chr.) ausgehen, das »starkes Getränk« bedeutet, erscheint mir ein wenig wissenschaftlicher. Im Griechischen des 3.–2. Jahrhunderts v. Chr. wurde daraus Sikera, im 3.–6. Jahrhundert n. Chr. im Lateinischen Sicera. Die Franzosen machten daraus zunächst Cisdre, dann Cidre und Sidre, was man auch im Mittelenglischen bis ins 15. Jahrhundert verwendete. Dann wechselte der englische Sprachgebrauch zu Cider.
Zur Frage, ob das britische Wort Cider dem französischen Einfluss zu verdanken ist (für einen Briten ein fast ehrrühriger Gedanke) oder direkt aus dem Lateinischen entstand, nahm der Forscher Sir George Birdwood 1895 in einer Veröffentlichung im »Journal of the Society of Arts« Stellung. Nach einigen Ausführungen zog er den Schluss: »These clearly proved that the word cyder, syder, or cider came, not only through the French cidre, but direct from the sicera.« Die Ehre der Briten war gerettet.
Die Herstellung: Von A(pfel) bis F(lasche)
AM ANFANG STEHT DER APFEL
Jedenfalls überwiegend. Cider ausschließlich auf die Grundzutat »Apfel« festzulegen, würde ihm aber weder im Hinblick auf traditionelle Cider- und Apfelweinherstellung noch auf moderne Trends gerecht werden. Je nach länderspezifischen Verordnungen und Kennzeichnungen bzw. Klassifizierungen ist eine anteilige Beigabe anderer Fruchtsäfte möglich. Meist ist es die Birne, die dabei einen aromatischen Anteil leistet. Von traditionellen Obstwiesen ist die Kombination von Apfel- und Birnbäumen kaum wegzudenken und die gemeinsame Verwendung der Früchte beim Mosten naheliegend.
In letzter Zeit gesellten sich zur Birne als Saftpartner des Apfels auch andere Früchte wie Quitte, Johannisbeere, Rhabarber. Doch es ist ganz klar der Apfel, der Cider prägte und prägt. Dementsprechend steht er in diesem Buch eindeutig im Fokus, genauso eindeutig wie wir ihn in Deutschland in den Fokus unseres Obstverbrauches im Allgemeinen rücken: Die Bundeszentrale für Ernährung (BZfE) berichtet, dass jeder Bundesbürger 2020/21 im Schnitt rund 24,4 kg Äpfel verbrauchte. Drei Viertel davon werden direkt als Tafelobst vermarktet, der Rest wird zu Apfelmus, Apfelkraut, Dörrobst, Apfelsaft oder anderen Produkten verarbeitet. Cider zum Beispiel.