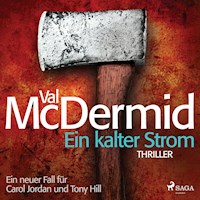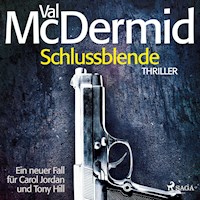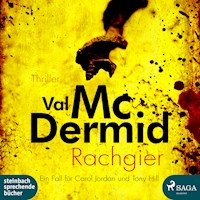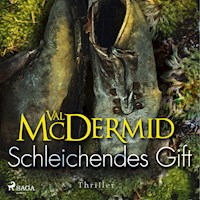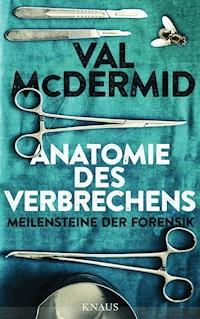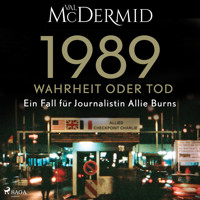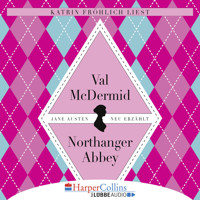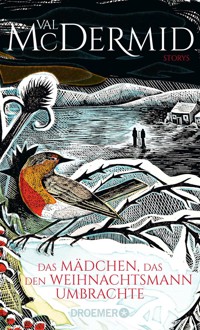6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kate-Brannigan-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kate Brannigan muss sich alleine um die Fälle der Detektei Mortensen & Brannigan kümmern. Gleich von mehreren Seiten gerät sie unter Druck. Bis nach Italien jagt sie einem gestohlenen Monet nach. Unterdessen sterben im heimatlichen Manchester zwei Kunden eines Putzmittelherstellers an einer mysteriösen Zyanidvergiftung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Val McDermid
Clean Break
Ein Fall für Kate Brannigan
Aus dem Englischen von Brigitta Merschmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kate Brannigan muss sich alleine um die Fälle der Detektei Mortensen & Brannigan kümmern. Dabei gerät sie gleich von mehreren Seiten unter Druck. Bis nach Italien jagt sie einem gestohlenen Monet nach. Derweil sterben im heimatlichen Manchester zwei Kunden eines Putzmittelherstellers auf mysteriöse Weise an einer Zyanidvergiftung.
Inhaltsübersicht
Widmung
Dank
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Allen Chelsea-Fans in tiefstem Mitgefühl.
Ihr könnt, weiß Gott, Aufmunterung gebrauchen.
Dank
allen aus der vertrauten Runde, die mir wieder erlaubt haben, ihr Wissen anzuzapfen, damit dieses Buch so gut und genau wie möglich wird – Coop, Onkel Lee, BB, Paula, Jai, Bruder Brian, Lisanna, Jane und Julia. Um Hilfe geschnorrt habe ich außerdem bei Frankie Hegarty, Fairy Baillie und Diana Muir. Sollten sich dennoch Fehler eingeschlichen haben, ist dies allein meine Schuld. Mein innigstes Mitgefühl jedem, der wiedererkennt, wo wir unsere Ferien verbracht haben.
1. Kapitel
Ich verstehe nicht viel von Kunst, aber zumindest weiß ich, was mir nicht gefällt. Gemälde, die auf Wanderschaft gehen, nachdem ich die Sicherheitsanlage installiert habe, mag ich nicht. Vor allem dann nicht, wenn ich gerade meinen Partner für zwei Monate zu den Antipoden geschickt habe, mit der seelenruhigen Versicherung, dass ich während seiner Abwesenheit schon klarkomme.
Besagtes Gemälde war ein kleiner Monet. Wenn ich klein sage, meine ich die Maße, nicht den Wert. Es würde kaum das Loch bedecken, das mein Liebster Richard im Zustand volltrunkener Ekstase in die Wand seines Wohnzimmers geschlagen hat, als Eric Cantona den Doppelsieg von Manchester United besiegelte. Dafür war es gut zehnmal so viel wert wie unsere beiden aneinandergebauten Bungalows zusammengelegt. Was übrigens nie geschehen wird. Das Bild stellte einen blühenden Apfelbaum dar, viel mehr nicht. Man merkte gleich, dass es ein Apfelbaum war, weil es – so Shelley, unsere Büromanagerin – in einem recht frühen Stadium von Monets Laufbahn entstanden war, bevor sein Sehvermögen allmählich dahinschwand und die ganze Welt für ihn wie ein impressionistisches Gemälde auszusehen begann. Man stelle sich vor – eine ganze Kunstrichtung aus den schlechten Augen eines einzigen Typs hervorgegangen. Erstaunlich, was man an der Fernuniversität so alles lernt. Shelley studiert seit letztem Jahr, und was sie über Kunstgeschichte nicht weiß, werde ich mit Sicherheit niemals ergründen. Im Kurs Wie werde ich Privatschnüffler für Autodidakten lernt man so was nicht.
Besagter Monet mit dem sehr einfallsreichen Namen Blühender Apfelbaum gehörte Henry Naismith, dem Herrn über das Schloss Birchfield with Polver. Henry für seine Freunde und – John Majors klassenloser Gesellschaft sei Dank – auch für kleine Geschäftsleute wie mich. Henry kannte eben keine Allüren, was mitnichten hieß, dass er seine Gedanken und Gefühle nicht hinter charmantem Geplauder zu verbergen wusste. Daher merkte ich schnell, dass etwas im Busch war, als ich eines schönen Morgens im September den Hörer abnahm und seine gepflegte Stimme hörte. »Kate? Henry Naismith«, begann er. Ich lehnte mich zurück und stellte mich auf das gewohnt muntere Einleitungsgeplänkel über seine neuesten Heldentaten ein. Fehlanzeige. »Könnten Sie herkommen?«, fragte er.
Ich schnellte hoch. Das klang verdächtig nach dem Auftakt zu einem Montag, an dem ich mir noch wünschen würde, im Bett geblieben zu sein. »An welche Zeit hatten Sie gedacht, Henry?«
»So schnell wie möglich. Wir … hatten in der Nacht Einbrecher hier, und jemand von der Polizei kommt vorbei, um noch ein paar Einzelheiten zu klären. Er wird sicherlich Fragen zum Sicherheitssystem stellen, die ich allein nicht beantworten kann, deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie gleich losfahren könnten.« Er stieß den ganzen Wortschwall hervor, fast ohne Luft zu holen und mir die Gelegenheit zu Zwischenfragen zu geben.
Ich brauchte nicht erst im Terminkalender nachzusehen, um zu wissen, dass ich kein dringendes Alternativprogramm hatte. Nur Routinenachforschungen zum Verbleib eines Firmenpräsidenten, dessen Verwaltungsräte ihm unbedingt ein paar Fragen zum Zustand der Bilanzen stellen wollten. »Kein Problem«, sagte ich. »Was vermissen Sie?« Ich hoffte inständig, dass es der Fernseher und der Videorecorder waren.
Schön wär’s. Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. Ich glaubte zu hören, wie Henry tief Luft holte. »Den Monet«, antwortete er dann kurz und bündig.
In meinem Magen fing es an zu brodeln. Birchfield Place war die erste Sicherheitsanlage, die ich allein erdacht und deren Installierung ich überwacht hatte. Eigentlich ist mein Partner Bill Mortensen der Sicherheitsexperte, und er hatte meine Arbeit auch begutachtet, dennoch fiel es auf mich zurück. »Ich komme sofort«, versprach ich.
Wie ferngesteuert fuhr ich durch die Vororte zur Autobahn. Selbst die unvermeidlichen, allgegenwärtigen Straßenarbeiten registrierte ich nur am Rande. In Gedanken rekapitulierte ich den bisherigen Verlauf der geschäftlichen Beziehungen zwischen Mortensen & Brannigan und Henry Naismith. Als ich damals im Bürokalender auf seinen ersten Termin gestoßen war, hatte ich vermutet, Shelley hätte sich einen Scherz mit mir erlaubt, zumal ich erst am Tag zuvor eine meiner regelmäßig wiederkehrenden antimonarchistischen Schimpftiraden vom Stapel gelassen hatte; ausgelöst von der Behauptung des Thronerben, die Nation müsse zwei Traditionen wiederbeleben: ihren Shakespeare lesen und ihre Kinder verprügeln. Dann, als ich begriff, dass der Termin echt war, stellte ich mir einen Knaben mit fliehendem Kinn und der Sorte angeborenen Schwachsinns vor, den man nur beim Hochadel und der Einwohnerschaft abgelegener Bergdörfer antrifft. Ich lag völlig daneben.
Henry Naismith war Ende zwanzig, gebaut wie ein australischer Rettungsschwimmer mit den dazugehörigen blonden Haaren und kräftigem Kinn, das einem Boxer als lohnende Zielscheibe dienen könnte. Dem Who’s Who zufolge hatte er zwei Hobbys, Segeln und Meeresregatten, was ich mir auch selbst hätte denken können, schon als ich ihm das erste Mal begegnete. Er hatte den Blick eines Seglers, schaute stets an dir vorbei zu einem fernen, nur für ihn sichtbaren Horizont. Abgesehen von den weißen Fältchen rings um seine tiefblauen Augen, war sein Gesicht von Wind und Sonne zu einem frischen Braun poliert. Seine Bildung hatte er im Marlborough und im New College, Oxford, erhalten. Obgleich ich in Oxford aufgewachsen war, glaubte ich nicht, dass seine Stadt der träumenden Türme und meine der Autofabriken sich so weit deckten, dass wir uns in gemeinsamen Erinnerungen ergehen konnten. Hinzu kam die gleiche vornehme Aussprache wie bei Prinz Charles, aber dennoch, trotz allem, mochte ich ihn. Ich mag jeden, der den Hintern hochkriegt und zupacken kann. Und Henry konnte zupacken, daran gab’s keinen Zweifel. Jeder, der dir sagt, eine Meeresregatta sei der reine Spaß, kann einen Anker nicht von Schanker unterscheiden.
Unsere Zeitungsdatenbank hatte die groben Umrisse des Bildes ausgefüllt: Henry hatte vor zwei Jahren seinen Titel, ein schwarzweißes Tudorschloss in Cheshire, eine Handvoll wertvoller Gemälde sowie eine eher bescheidene Barschaft geerbt, als seine Eltern in einem schicken alpinen Ferienort einer Lawine zum Opfer fielen. Henry machte damals gerade einen Segeltörn in der Karibik. Das Leben ist ein Miststück, und dann heiratest du auch noch eins. Das hatte Henry allerdings nicht. Geheiratet, meine ich. Er stand in den Klatschspalten immer noch auf der Liste der begehrtesten Junggesellen. Vielleicht reichte es nicht ganz für die Top Twenty, wegen der fehlenden Knete; aber dank seines guten Aussehens und seiner geschickten Handhabung der Segelstange lag er nach wie vor im Rennen.
Henry hatte sich wegen erwähnter dramatischer Ebbe in seiner Kasse an uns gewandt. Da sein Vater nicht vorausgesehen hatte, dass er mit siebenundvierzig sterben würde, hatte er keine Vorkehrungen getroffen, wie beim Landadel sonst üblich, um zu verhindern, dass das Schatzamt das Scherflein der Witwen und Waisen dezimiert. Nachdem er alles addiert und subtrahiert hatte, stellte Henry fest, dass er nur dann Haus und Kunstsammlung behalten und trotzdem die Hälfte des Jahres am Ruder seiner Hochseejacht stehen konnte, wenn er in den sauren Apfel biss und Birchfield Place Tagesausflüglern zugänglich machte.
Im Zirkus der Tagestouren zu alten Schlössern ist die britische Öffentlichkeit für ihre langen Finger berühmt-berüchtigt. Wenn man die Busladungen kleiner alter Damen sieht, die an Feiertagen herangekarrt werden, sollte man es nicht meinen, aber sie nehmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist, und sogar auch einiges, was niet- und nagelfest ist. Das macht die Versicherungen bei Vertragsabschlüssen noch nervöser als sonst, und als Ergebnis wirft das Geschäft rund um die Sicherheit einen hübschen kleinen Batzen Geld für Privatagenturen wie die unsere ab. In letzter Zeit machten Sicherheitsanlagen ein Viertel unseres jährlichen Umsatzes aus, und daher hatten Bill und ich beschlossen, dass ich mich auch in diesen Teil des Geschäfts einarbeiten sollte.
Es ist unmöglich, irgendein Gebäude zu einer völlig uneinnehmbaren Festung zu machen, es sei denn, man mauert Türen und Fenster zu, und dann kommt man in Schwierigkeiten, wenn man anständiges Licht für seine Petitpoint-Stickerei braucht. Man kann bestenfalls signalisieren, dass man alles nur Menschenmögliche getan hat, um sein Haus einbruchssicher zu machen, und hoffen, dass der eventuelle Einbrecher entmutigt weiterzieht, um sich das nächste Schloss die Straße weiter runter vorzuknöpfen. Um zu garantieren, dass ich alles richtig machte, hatte ich nicht nur Bills Know-how angezapft, ich hatte auch meinen alten Freund Dennis konsultiert, selbst Einbrecher im Halbruhestand. »Weißt du, was das einzig sichere Abschreckungsmittel ist, Brannigan?«, hatte Dennis gefragt.
»Wärmesensorische thermonukleare Raketen?«, riet ich.
»Ein Hund. Du holst dir einen großen Schäferhund, lässt ihn frei rumlaufen, und schon will dein professioneller Dieb nichts mehr von dir wissen. Als ich noch in der Branche war, gab es keine Alarmanlage der Welt, an der ich mich nicht versucht hätte. Aber Hunde? Vergiss es.«
Leider sind die Klienten nicht besonders scharf darauf, Rottweiler auf ihren unschätzbaren Orientteppichen patrouillieren zu lassen. Sie machen sich zu große Sorgen, hinterher Hundehaare – oder noch Schlimmeres – auf dem Hepplewhite zu finden. Daher hatte sich Birchfield Place, wie die meisten Schlösser, auf eine allermodernste Mischung aus verdrahteten Detektoren an Türen und Fenstern, Passiv-Infrarotmeldern an allen zentralen Punkten und Drucksensoren vor allen wichtigen Gegenständen verlassen. Bei der Masse von Sicherheitsfallen, die ich aufgestellt hatte, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie jemand unentdeckt durch meine Anlage hatte schlüpfen können, ohne so viele Alarmglocken auszulösen, dass Quasimodo vollends den Verstand verloren hätte.
Ich fuhr von der Autobahn ab und drang in das Herz des Cheshire-Grüngürtels der Börsenmakler, Serienstars und Fußballspieler vor. Wie gewöhnlich fuhr ich fast an der Lücke in der großen Hecke vorbei, die die Zufahrt zu Birchfield Place markierte. Der Besuchereingang befand sich auf der Rückseite, aber ich hatte nicht die Absicht, auf einem Feld in einem Kilometer Entfernung zum Haus zu parken. Gerade noch rechtzeitig riss ich das Lenkrad herum und bog auf eine schmale Straße ein, die sich zwischen Feldern mit beschaulich weidenden Schafen hindurchschlängelte. Die Schafe schenkten mir keinen Blick, sie fraßen seelenruhig weiter, als ich an ihnen vorbeifuhr. Auf dem Land bin ich stets ein wenig nervös; ich weiß nicht, wie alles heißt, und entwickle im Nu Phobien, weil ich keine Ahnung habe, wo ich meine nächste Mahlzeit herbekommen soll. Da ist mir jede urbane Landschaft, die kein vernünftiges Schaf auf die Idee kommen lässt, sich dort heil und sicher verköstigen zu können, allemal lieber. Das Feld wich einem dichten Wäldchen aus verschiedenen Baumarten. Die Bäume sahen aus, als weilten sie schon länger auf diesem Planeten als meine Granny Brannigan. Dann, urplötzlich, beschrieb die Zufahrt eine scharfe Rechtskurve, ich schoss unter den Bäumen hervor, und die Front von Birchfield Place lag unmittelbar vor mir.
Von einem Naismith in ferner Vergangenheit erbaut, der seinem Monarchen irgendeinen unbekannten Dienst erwiesen hatte, sah das Haus aus, als gehöre es auf eine Postkarte oder ein Puzzle. Die Zeit hatte seine schwarzen Balken und weißen Felder stark verwittern lassen, und keine Bausparkasse, die auf sich hielt, hätte eine Hypothek auf das Gebäude gewährt. Mir kam es immer irgendwie unwirklich vor.
Ich hielt neben einem anonymen Ford mit einem Funkgerät; vermutlich gehörte er der Polizei. In der Ferne schrie ein Pfau, was meiner Fassung abträglicher war als jedes nächtliche Sirenengeheul. Ich wusste nur deshalb, dass es ein Pfau war, weil Henry es mir beim ersten Mal, als der Vogel mir Todesangst einjagte, gesagt hatte. Noch ehe ich die Hand nach dem antiken Klingelzug ausstrecken konnte, sprang die Tür auf, und Henry lächelte mich entschuldigend an. »Das finde ich wirklich sehr nett von Ihnen, Kate«, sagte er.
»Gehört alles zum Service«, beteuerte ich. »Die Polizei ist schon da?«
»Ein Inspector Mellor vom Kunstraubdezernat«, antwortete Henry, während er über den Innenhof zum Großen Saal voranging, in dem – ein Stilbruch – die Impressionisten hingen. »Er hat nicht viel gesagt.«
Wir durchquerten die Vorhalle. Ihre massive Eichentür sah aus, als hätte sie einige Schläge mit einem schweren Vorschlaghammer abbekommen. An der Tür zum Großen Saal hielt ich Henry zurück. »Was ist denn genau passiert?«
Henry rieb sich das Kinn. »Der Alarm hat mich geweckt. Kurz vor drei, nach meiner Uhr. Ich habe gleich die Hauptschalttafel überprüft. Sie signalisierte Vorhalle, Tür zum Großen Saal, Großer Saal und Drucksensoren. Ich rief schnell die Polizei an, um Bescheid zu geben, dass es kein Fehlalarm war, und lief nach unten. Als ich in den Saal kam, war niemand mehr zu sehen, und der Monet war verschwunden. Sie müssen in knapp fünf Minuten drin und wieder draußen gewesen sein.« Er seufzte. »Anscheinend wussten sie genau, was sie wollten.«
»Der Piepser der Beleuchtungsanlage im Hof hat Sie also nicht geweckt?«, fragte ich verblüfft.
Henry machte ein verlegenes Gesicht. »Ich hatte den Piepser ausgeschaltet. Wir hatten Füchse hier, und ich war es leid, Nacht für Nacht aus dem Schlaf zu schrecken.« Ich sagte nichts. Ich hoffte, dass meine Miene für sich sprach. »Ich weiß, ich weiß«, seufzte Henry. »Inspector Mellor ist wohl auch nicht sonderlich begeistert. Sollen wir?«
Ich folgte ihm in den Saal, einen für seine Epoche überraschend hellen Raum. Zwei Stockwerke hoch, mit weißgetünchter, gewölbter Decke und einer Galerie wie geschaffen für Minnesänger Blondel unplugged. Die Wand zum Innenhof war einen halben Meter hoch über dem Fußboden holzgetäfelt, dann kamen Hunderte winziger Bleiglasfenster bis zu einer Höhe von etwa zwei Meter fünfzig. Die Täfelung der Außenwand war etwa einen Meter zwanzig hoch, bevor weitere Fenster folgten. Den Fensterputzer konnte man nur bedauern. Am anderen Ende des Raums befand sich ein erhöhtes Podest, von dem aus Henrys einstige Vorfahren das Zepter über den Plebs geschwungen und über die Ungeheuerlichkeit der Fenstersteuer gewettert hatten. Rings um dieses Podest hingen die Gemälde. Ein hochgewachsener, dünner Mann stand mit gerecktem Hals wie ein Kranich vor der Stelle, an der der Monet gehangen hatte. Als wir eintraten, wandte er sich uns zu und fixierte mich mit trübem Blick.
Henry stellte uns vor, während Inspector Mellor und ich einander musterten. Mit seiner hohen Stirn über der Raubvogelnase und seinem kleinen herzförmigen Mund hatte er mehr von einem Patrizier als Henry. Auf seine Bitte hin beschrieb ich ihm das Sicherheitssystem. Er hörte zu, nickte unverbindlich, dann meinte er: »Viel mehr hätten Sie nicht tun können, außer Videoüberwachung.«
»Die Arbeit von Profis, oder?«, fragte ich.
»Zweifellos. Sie haben ihr Ziel ausgewählt, das Haus gründlich inspiziert, dann sind sie blitzschnell rein und wieder raus. Keine kriminaltechnisch verwertbaren Spuren, sagen meine Kollegen, die nach dem Vorfall hier waren.« Mellor sah deprimiert aus, und mir ging’s ähnlich.
»Kennen Sie die Handschrift der Täter?«, wollte ich wissen.
Mellor zuckte mit den Achseln. »Ich habe schon ähnliche Arbeit gesehen, aber es ist uns noch in keinem der Fälle gelungen, eine Verhaftung zu erreichen.«
Henry schloss die Augen und seufzte. »Besteht irgendeine Aussicht, dass ich meinen Monet zurückbekomme?«, fragte er müde.
»Wenn ich ehrlich sein soll, Sir, keine sehr große. Diebe dieses Schlages nehmen nur mit, wofür sie bereits einen Käufer haben«, erläuterte Mellor.»Früher oder später werden wir Glück haben und sie erwischen. Vielleicht ja sogar dieses Mal. Ich würde übrigens gern noch zwei von meinen Leuten vorbeischicken, wenn Ihr Personal kommt. Die Diebe werden sich mehr als einmal im Haus umgesehen haben. Durchaus möglich, dass einer Ihrer Aufseher einen Wiederholungsbesucher bemerkt hat.«
»Das Personal kommt um halb zehn am Donnerstag«, erklärte Henry. »Montags, dienstags und mittwochs ist das Haus für Besucher geschlossen, ausgenommen an Feiertagen.«
Mellor wandte sich ab und studierte eine Zeitlang den Boudin, den Renoir und die beiden Pissarros, die noch vor kurzem den Monet umrahmt hatten. »Ich persönlich«, sagte er leise, »hätte den Boudin ausgewählt.«
Ich nicht. Der Monet hätte viel besser zu meinem Farbspektrum gepasst. Aber vielleicht war Inspector Mellors Wohnzimmer ja eher in Blautönen gehalten als in Grün, Creme und Pfirsich. Während Henry ihn hinausbegleitete, strich ich durch den Saal und überlegte, was ich als Nächstes unternehmen sollte. Mellors Plan, das Personal vernehmen zu lassen, hatte mich der einzigen Idee beraubt, die mir bezüglich weiterer Ermittlungen gekommen war. Ich sank auf den Stuhl des Aufsehers an der Tür und starrte quer durch den Saal auf die Drähte in der alten Täfelung, die bis gestern den Monet mit der Alarmanlage und der Wand verbunden hatten. Meine Inspiration streikte; aber wenn das in diesem Land sonst schon keiner mehr tut …
Als Henry zurückkam, richtete ich mich auf und bemerkte munter: »Tja, Henry, Mellor klang nicht sehr optimistisch, dass die Hüter von Recht and Ordnung viel ausrichten können. Sieht so aus, als bliebe es mir überlassen, Ihnen den Monet wiederzubeschaffen.«
Henry zupfte mit sichtlichem Unbehagen an seinem Ohrläppchen. »Hat das denn Sinn, Kate?«, fragte er. »Ich meine, wenn die Spezialisten schon nicht wissen, wo sie ansetzen sollen, wie können Sie da auf Erfolg hoffen?«
»Manche Leute neigen dazu, mir Dinge zu erzählen, die sie der Polizei nicht unbedingt anvertrauen würden. Einschließlich Versicherungen. Außerdem verfüge ich über unorthodoxe Methoden der Informationsbeschaffung. Ich bin überzeugt, dass ich Hinweise finden kann, auf die die Polizei nie im Leben stoßen würde.« Das war die reine Wahrheit. Nun ja, bis auf den letzten Satz.
Er blieb skeptisch. »Ich weiß nicht, Kate. Das waren knallharte Profis. So, wie die Tür zur Vorhalle aussieht, haben sie nicht die geringsten Skrupel, Gewalt anzuwenden. Ich weiß nicht recht, ob ich glücklich darüber sein soll, dass Sie sich auf ihre Fährte setzen.«
»Henry, ich mag ja nur eins siebenundfünfzig groß sein, aber ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen«, erwiderte ich und versuchte nicht an das letzte Mal zu denken, als ich den Männern in meinem Leben diesen blöden Spruch aufgetischt hatte. Die Narbe an meinem Kopf reagierte inzwischen nur noch mit einem leisen Ziehen, wenn ich mir die Haare bürstete, die inneren Narben allerdings gingen tiefer. Ich war nicht direkt ängstlich geworden; ich hatte mir nur eine kräftige Portion Vorsicht zugelegt.
»Außerdem«, fuhr ich fort, als ich seinen offen ungläubigen Blick sah, »haben Sie laut Vertrag noch Anspruch auf dreißig unentgeltliche Stunden meiner Dienste.«
»Aha. Ja. Natürlich.« Er war wieder reserviert, sein Blick ging in mittlere Distanz.
»Und abgesehen davon wird meine Schnüffelei Ihre Versicherung davon überzeugen, dass nicht Sie das schwarze Schaf sind.«
Seine Augen wurden schmal, wie bei einem Mann, der sieht, dass eine riesengroße Flutwelle direkt auf seinen Bug zurollt. »Wieso sollte die Versicherung so etwas denken?«, fragte er scharf.
»Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand wegen des Schadenersatzes seinen eigenen Einbruch inszeniert hat«, erklärte ich. »Wo ich wohne, passiert das andauernd.« Ein Schatten huschte über Henrys Gesicht. »Sie haben mir nichts zu sagen, Henry, oder?«, erkundigte ich mich vorsichtig.
»Es gibt nicht den geringsten Grund, warum ich das arrangiert haben sollte«, entgegnete er steif. »Die Polizei und die Versicherung können jederzeit die Bücher überprüfen. Wir machen Gewinn. Die Einnahmen an Eintrittsgeldern haben bereits den Umsatz des letzten Jahres erreicht, der Umsatz des Geschenkshops hat sich um fünfundzwanzig Prozent gesteigert, und der Große Saal ist fast jeden Samstag von heute bis Februar für Feste ausgebucht. Mir macht nur Kopfzerbrechen, dass ich in drei Wochen nach Australien abreisen soll und bis dahin die Sache gern vom Tisch hätte.«
»In diesem Fall lege ich mal lieber gleich los«, erwiderte ich sanft.
Auf der Heimfahrt nach Manchester ging mir vieles durch den Kopf. Ich mag keine Geheimnisse. Das ist einer der Gründe, warum ich Privatdetektivin geworden bin. Ich mag sie vor allem dann nicht, wenn es Geheimnisse sind, die meine Klienten vor mir haben.
2. Kapitel
Das Vestibül der Fortissimus Insurance führte mir leibhaft vor Augen, wo Henrys dicke Prämien versickerten. Die Versicherungsgesellschaft war von London wieder nach Manchester umgesiedelt, zweifellos angelockt von dem Geldsegen, der von verschiedenen Programmen zur Innenstadtsanierung ausgeschüttet wurde. Man hatte sich für einen Standort in der Oxford Road entschieden, fünf Minuten zu Fuß von den weit weniger feudalen Büroräumen von Mortensen & Brannigan entfernt. Ganz praktisch, so hatten wir anfangs gedacht, sollte die Versicherung irgendwann die Dienste freier Ermittler benötigen; aber man hatte noch nie an unsere Tür geklopft. Wahrscheinlich zog die Gesellschaft Firmen mit vergleichbarem Einrichtungsstil in Stahl und Glas und dementsprechenden Honoraren vor.
Wie bei so vielen neuen Bürokomplexen in Manchester hatte Fortissimus ein nagelneues, modernes Gebäude hinter einer prunkvollen viktorianischen Fassade hochgezogen. In diesem speziellen Fall hatte man die Front eines früher recht vornehmen Hotels erworben und Marmor und Granit zu funkelndem Glanz aufpoliert, wie man es sich im Jahrhundert seiner Entstehung nicht hätte vorstellen können. Die Eingangshalle hatte etwas von ihrem Originalcharakter bewahrt, das verglaste Vestibül hinter der Sicherheitskontrolle jedoch war hundertprozentig fin eines anderen siècle. Die beiden Empfangsdamen hatten sich den Kurs in Kundenbetreuung offenbar sehr zu Herzen genommen. Ihre Aufmachung war tadellos, ihr Lächeln hätte jedes Krokodil mit Stolz erfüllt, und der näselnde Tonfall ihres »Guten Morgen, wie kann ich Ihnen behilflich sein?« verursachte mir um ein Haar Ohrensausen. Natürlich waren sie ebenso irreführend wie die Fassade des Gebäudes. Nachdem ich meine Karte überreicht, nach Michael Haroun gefragt und ihnen seine Abteilung genannt hatte, musste ich trotzdem geschlagene zehn Minuten lang Däumchen drehen, während sie sich über ihre romantischen Abenteuer vom Wochenende Bericht erstatteten, Mr. Haroun anriefen, einen Besucherpass ausfüllten und mir sagten, Mr. Haroun werde am Aufzug auf mich warten.
Ich stieg im fünften Stock aus und stellte fest, dass sie mit der Wahrheit äußerst sparsam umgegangen waren. Da war kein Mr. Haroun, und es saß auch niemand hinter dem Tresen mit der Aufschrift »Information Schadenersatz«. Ehe ich mir schlüssig werden konnte, in welche Richtung ich mich wenden sollte, ging eine Tür im Korridor auf, jemand kam rückwärts heraus und sagte: »Und ich möchte die anderen Fälle damit vergleichen, Karen. Graben Sie also die Akten aus, seien Sie so lieb.«
Er drehte sich auf den Fußballen um, und mich überwältigte das Gefühl, das alles schon einmal erlebt zu haben. Ich stand nur da und machte große Augen, als er auf mich zukam. Er streckte die Hand aus. »Miss Brannigan? Michael Haroun.«
Ich war sprachlos und konnte mich nicht rühren. Und ich hatte wohl Glotzaugen wie ein hungriger Goldfisch, denn er runzelte die Stirn und fragte: »Sie sind doch Miss Brannigan?« Dann trat ein argwöhnischer Blick in seine glänzenden dunklen Augen. »Was ist los? Entspreche ich nicht dem Bild, das Sie sich gemacht haben? Ich kann Ihnen versichern, ich bin der Leiter der Schadenersatzabteilung.«
Mein Aussetzer war vorüber, und ich schüttelte ihm hastig die Hand. »Entschuldigen Sie. Ja, ich … Tut mir leid, Sie sind das wandelnde Abbild von … jemandem«, haspelte ich. »Mir hat’s nur vor Überraschung die Sprache verschlagen.«
Er warf mir einen Blick zu, der klar und deutlich besagte, dass ich in seinen Augen entweder ein Rassistenschwein war oder nicht alle Tassen im Schrank hatte. Sein Lächeln war bemüht, als er erwiderte: »Ich wusste gar nicht, dass ich einen Doppelgänger habe. Wollen wir in mein Büro gehen und uns dort unterhalten?«
Ich nickte stumm und ging immer seinen breiten Schultern nach. Er bewegte sich wie ein Mensch, der viel Sport treibt. Daher fiel es nicht schwer, sich ihn bei der gleichen Betätigung vorzustellen, bei der ich seinem Ebenbild begegnet war.
Als ich etwa vierzehn Jahre zählte, hatten wir einen Schulausflug ins Britische Museum gemacht. Ich hatte mich derart in den Stein von Rosetta vertieft, dass ich von der übrigen Gruppe getrennt wurde und eine Ewigkeit auf der Suche nach den anderen umherirrte. So war ich auf die assyrischen Basreliefs gestoßen. Bei ihrem Anblick begriff ich auf Anhieb, dass es kein völliger Unsinn ist, wenn Kritiker schreiben, große Kunst spreche unmittelbar zu unserem Herzen. Die riesenhaften gemeißelten Szenen einer Löwenjagd erreichten nicht nur mein Herz, sie dröhnten in meiner Brust wie der Basston einer Orgel. Ich verliebte mich in die Bogenschützen und Rosslenker mit den Profilen von Sperlingshabichten und dem schulterlangen Haar, das sich kräuselte wie das Fell von Pudeln. An jenem Tag stand ich wohl eine Stunde vor ihnen. Wenn ich seither zum Shopping nach London fuhr, fand ich jedes Mal einen Vorwand, um mich von meinen Freunden abzusetzen und mich, während sie über die Oxford Street zogen, auf ein kurzes Stelldichein mit König Assurbanipal ins Museum zu stehlen. Hätte Aslan der Skulptur des assyrischen Königs Leben eingehaucht, dann wäre dieser mit dem Aussehen von Michael Haroun von der Wand gestiegen – mit schimmernder Haut von der Farbe meisterhaft zubereiteter Röstkartoffeln. Auch wenn er den Chiton gegen ein Hemd von Paul Smith, eine italienische Seidenkrawatte und Hose eingetauscht hatte – im Minirock macht man eben keine großen Sprünge auf der Firmenleiter, es sei denn, man ist eine Frau. Ein Blick auf Michael Haroun, und ich erlitt einen Rückfall in meine pubertäre Schwärmerei. Richard war eine ferne Erinnerung.
Ich folgte Haroun lammfromm in sein Büro. Bis hier oben hatte die Pracht des Vestibüls es nicht geschafft. Das Mobiliar war eher zweckmäßig, es sollte keinen Eindruck schinden. Wenigstens hatte er die Aussicht auf den kürzlich (mit EU-Geldern) restaurierten Rochdale Canal, wenngleich der Blick auf das Canal Café ein deprimierender Hinweis darauf sein musste, dass der Rest der Welt sich amüsierte, während er arbeitete. Wir setzten uns im rechten Winkel zueinander auf das L-förmige Sofa, und mein pubertärer Drang, mich auf ihn zu stürzen, wurde durch den niedrigen Couchtisch zwischen uns gebremst. Haroun warf die Akte, die er in der Hand gehalten hatte, auf den Tisch. »Ich höre viel Gutes über Ihre Agentur, Miss Brannigan«, begann er. Seinem Tonfall durfte ich entnehmen, dass er das Gehörte nicht recht mit meinem Mondkalbblick in Einklang zu bringen wusste.
Ich riss mich notgedrungen zusammen und rief mir ins Gedächtnis, dass ich doppelt so alt war wie jener romantisch gesinnte Teenager. »Sie haben anscheinend mit den Klienten gesprochen, bei denen nicht eingebrochen wurde«, erwiderte ich mit annähernd normaler Stimme.
»Keine Sicherheitsanlage der Welt bietet hundertprozentigen Schutz vor Einbrüchen«, beklagte er sich.
»Aber manche sind besser als andere. Und unsere ist besser als die meisten.«
»So sah es jedenfalls aus, als wir damals die Prämie vereinbarten. Einer der Faktoren, die wir in Betracht ziehen, wenn wir die Höhe der Tarife festsetzen. Neben dem Gesichtspunkt, wie hoch das Risiko in der betreffenden Gegend ist.«
»Mir brauchen Sie das nicht zu sagen. Meine Postleitzahl ist M13«, sagte ich.
Er schnitt eine Grimasse und zog die Luft durch die Zähne ein, ungefähr so wie ein Installateur, wenn er sich eine Zentralheizung ansieht. Das lernen sie schon in der Ausbildung. »Und ich dachte, ihr Sicherheitsberater verdient euch eine goldene Nase.«
»So ein Rattenloch ist es auch wieder nicht«, versetzte ich gereizt.
Er hob abwehrend die Hände und grinste. Ich merkte wieder, wie die Jahre von mir abfielen, und gab mir alle Mühe, mich an der Gegenwart festzuhalten. »Henry Naismith hat angerufen und Sie angekündigt. Er hat mir eine vorläufige Schadensrechnung gefaxt«, berichtete er.
»Ich ermittle in Henrys Auftrag zu dem Diebstahl, und er meinte, es könnte nützlich sein, wenn wir uns unterhalten.«
»Ist mir ein Vergnügen. Selbstverständlich wird sich auch einer unserer Hausermittler damit befassen, aber ich wüsste nicht, was dagegen spräche, auch mit Ihnen zu reden. Könnten Sie mir kurz den Stand der Ermittlungen darlegen?«
Ich erzählte ihm alles, was ich von Henry und Inspector Mellor erfahren hatte. Haroun machte sich Notizen. »Rein interessehalber«, setzte ich nach. »Inspector Mellor erwähnte, es hätte andere Einbrüche in ähnlichem Stil gegeben. Hatten Sie damit zu tun?«
Haroun nickte. »Ja, leider. So über den Daumen gepeilt würde ich sagen, mit drei weiteren Fällen in den letzten neun Monaten. Und genau da liegt unser Problem.«
»Unser wie Sie und ich, oder unser wie Fortissimus?«
»Wie Mr. Naismith und Fortissimus.«
»Heißt das, Sie wollen mit mir nicht darüber sprechen?«
Haroun starrte auf die Akte. »Gesetzliche Schweigepflicht. Dafür sollten gerade Sie Verständnis haben.«
»Ich wäre nicht hier, wenn Henry mir nicht vertrauen würde. Warum rufen Sie ihn nicht an und lassen sich bestätigen, dass Sie mir alles sagen können, was Sie ihm sagen würden? Auf diese Weise erfahre ich es direkt von der Quelle und nicht à la Stille Post.«
Seine geraden Brauen zuckten. »Selbst, wenn er seine Einwilligung geben würde, wäre es nicht fair, mit Ihnen darüber zu sprechen, bevor ich mit ihm gesprochen habe.«
»Dann holen Sie Henry her. Mir macht es nichts aus zu warten.« Solange ich Sie dabei betrachten kann, fügte ich im Geiste hinzu.
Haroun nickte zustimmend. »Ich rufe ihn an«, sagte er.
Er war fast zehn Minuten weg. Anstatt eine Computerzeitschrift aus meiner Schultertasche zu ziehen oder einen Bericht in meinen Minirecorder zu diktieren, hing ich Tagträumen nach. Worüber, geht keinen außer mir etwas an.
Als Haroun zurückkam, wirkte er ernst. »Ich habe Mr. Naismith die Situation geschildert, und er bestand darauf, ich solle die Angelegenheit in allen Einzelheiten mit Ihnen erörtern.«
Ich war zu wohlerzogen, um zu erwidern: »Na, was hab ich gesagt?«, aber laut Richard bin ich ein Genie in süffisantem Grinsen. Ich hoffte, dass ich es mir jetzt verkneifen konnte. »Dann schießen Sie mal los«, forderte ich ihn auf und sah ihm in die Augen.
Haroun erwiderte meinen Blick einige Sekunden lang, bevor er sich wieder seiner Akte zuwandte. »Wie ich bereits sagte, gab es andere, diesem sehr ähnliche Vorfälle. Sämtliche Diebstähle fanden in ähnlichen Häusern statt – mittelgroßen Schlössern, die der Öffentlichkeit zugänglich waren. Jedes Mal sind die Diebe so nah wie möglich an ihrem Zielobjekt eingedrungen. In zwei Fällen haben sie ein Fenster eingeschlagen, aber auf Birchfield Place war das nicht möglich. Sie ignorieren den Alarm, steuern direkt auf das anvisierte Objekt zu, reißen es von der Wand oder entfernen es aus seiner Vitrine und verschwinden. Wir schätzen, dass sie sich längstens fünf Minuten in einem Haus aufhalten. In den meisten Fällen reicht das kaum aus, um die Polizei oder den Wachdienst zu verständigen, geschweige denn zum Tatort kommen zu lassen.«
»Überaus professionell«, bemerkte ich. »Und weiter?«
»Wir sind sehr unglücklich darüber. Es kostet uns eine Menge Geld. Normalerweise würden wir einfach in den sauren Apfel beißen und die Prämien entsprechend erhöhen.«
»Ich kann ein ›aber‹ an der Kette zerren hören.«
»Sie haben ein sehr feines Gehör, Miss Brannigan.«
»Kate.« Ich lächelte.
»Also gut, Kate«, sagte er und erwiderte das Lächeln, »hier kommt das ›aber‹. Unser erster Klient, der auf diese Weise bestohlen wurde, war drei Monate später erneut Zielscheibe der Diebe. Daraufhin fällten meine Vorgesetzten die Grundsatzentscheidung, dass wir in Zukunft, wenn ein Schloss einmal ausgeraubt wurde, die Weiterversicherung verweigern – es sei denn, die Sicherheitsvorkehrungen werden nachgebessert, um einen akzeptablen Sicherheitsstandard zu erreichen.«
Er mochte ja wie ein alter Assyrer aussehen, doch Michael Haroun klang aufs Haar wie ein Versicherungsmensch des zwanzigsten Jahrhunderts. Wir wollen kein Drama aus dieser Krise machen; o nein, wir machen eine ausgewachsene tragische Oper daraus. Bezahle du nur kreuzbrav zehn Jahre lang deine progressiven Prämien, und wenn du uns dann brauchst, verschwinden wir wie die Diebe in der Nacht. Nichts macht pubertären Phantasien schneller den Garaus. »Und wie genau lautet Ihre Definition vom ›akzeptablen Sicherheitsstandard‹?«, fragte ich und hoffte, dass er den kalten Sarkasmus aus meinen Worten heraushörte.
»Das variiert von Fall zu Fall.«
»In Henrys Fall?«
Haroun zuckte mit den Achseln. »Ich müsste einen unserer Prüfer zu ihm schicken, um Genaueres sagen zu können.«
»Na los, riskieren Sie mal was, springen Sie ins kalte Wasser. Ich weiß, das fällt einem Versicherungsangestellten ungefähr so leicht wie einer Katze, aber geben Sie sich einen Ruck.« Es kostete mich Mühe, meine Gereiztheit zu unterdrücken. Es war mein Sicherheitssystem, über das er da den Stab brach.
Er machte ein finsteres Gesicht, anscheinend hatte ich ihn geärgert. »Aufgrund der bisherigen Erfahrungen würde ich einen Rund-um-die-Uhr-Wachdienst in den Räumen vorschlagen, in denen die wertvollsten Gegenstände aufbewahrt werden.«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf. »Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie von Klienten verschont bleiben können, die die Kühnheit besitzen, sich bestehlen zu lassen?«
»Nein, nein, wir wollen nur garantieren, dass weder uns noch unseren Klienten untragbare Verluste entstehen«, verteidigte er sich.
»Die Kosten für diese Art der Sicherheitsvorsorge können bei einem Unternehmen von der Größe des Betriebs von Henry existenzbedrohend sein. Das müssen Sie doch wissen.«
Haroun breitete die Arme aus und zuckte mit den Achseln. »Er kann jederzeit die Eintrittsgebühr anheben, wenn die Wirtschaftlichkeit des Betriebs davon abhängt.«
»Also wollen Sie damit sagen, dass Birchfield Place gegenwärtig unzureichend geschützt ist?«
»Nein, nein, Sie missverstehen mich. Wir werden nur einen Teil der Zahlung auf das gestohlene Eigentum zurückhalten, bis ein akzeptabler Sicherheitsstandard gegeben ist. Kate, unsere Klienten liegen uns am Herzen, aber wir sind auch Geschäftsleute, das müssen Sie verstehen.« Er sah mich bittend an, und meine Wut schmolz dahin. Tja, das war für mein Geschäft schlecht, daher stand ich widerstrebend auf.
»Wir bleiben in Kontakt«, sagte ich.
»Ich würde mich freuen.« Er stand ebenfalls auf, und die Ehrlichkeit, mit der er das äußerte, ging mir durch und durch.
Als er mich zum Aufzug begleitete, kam mein Gehirn wieder auf Touren. »Noch eines«, sagte ich. »Wie kommt es eigentlich, dass ich in den Zeitungen nichts von den Einbrüchen gelesen habe?«
Haroun lächelte verschlagen wie eine Eidechse. »Wir halten solche Dinge gern so weit wie möglich unter Verschluss«, erklärte er. »Es nützt dem Geschäft unserer Klienten wenig, wenn man in der Öffentlichkeit den Eindruck gewinnt, dass die erlesensten Ausstellungsstücke ihrer Sammlungen nicht mehr da sind. Die Diebstähle waren ziemlich weit gestreut, und es war daher unsere Politik, die Informationen nur an die Lokalpresse weiterzugeben, und das auch nur in sehr abgeschwächter Form. Ungefähr nach dem Muster: ›Gestern Nacht drangen Diebe in Bloggs Manor ein, wurden jedoch gestört, bevor sie die unschätzbare Korkensammlung des Schlosses mitgehen lassen konnten.‹«
»Das heißt, Sie lassen lediglich unerwähnt, dass die Diebe sie anschließend gemeinsam mit dem befreundeten Wachmann wegschafften«, sagte ich zynisch.
»So in etwa«, bestätigte er. Der Aufzug bimmelte, und ich trat ein, als die Türen aufgingen. »Es war nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Kate.«
»Müssen wir irgendwann mal wiederholen«, erwiderte ich, bevor die Türen uns trennten. Es ging aufwärts mit dem Tag. Ich war nicht nur Michael Haroun begegnet, ich wusste auch, was ich als Nächstes tun sollte.
Ich bin überzeugt, das Sicherheitspersonal des Manchester Evening Chronicle hält mich für eine Mitarbeiterin der Zeitung. Entweder weil ich die Türschlosskombination kenne. Oder weil ich mehrmals in der Woche mit selbstsicherem Winken im Gebäude ein und aus gehe. Wie dem auch sei, es ist praktisch, nach Belieben dort auftauchen und wieder verschwinden zu können. Die Kantine ist preiswert und freundlich gestaltet, der ideale Ort, um Energie zu tanken, wenn ich mich zufällig an diesem Ende der Stadt aufhalte. Heute jedoch hatte ich es nicht auf ein Schinkensandwich und einen Becher Tee abgesehen. Mein Ziel war Alexis Lee, die Kriminalreporterin des Chronicle und meine beste Freundin.
Ich ging flott durch die Nachrichtenredaktion, wo niemand auf mich achtete. Vermutlich könnte ich mit dem gesamten Computerequipment verschwinden, ohne dass jemand es bemerken oder versuchen würde, mich aufzuhalten. Sollte ich mich allerdings an dem Fernseher auf dem Newsdesk vergreifen, dann würde man mich lynchen, bevor ich fünf Schritte tun konnte.
Ich wusste gleich, dass Alexis an ihrem Platz saß. Zwar konnte ich sie durch die Wand aus üppigem Blattwerk rings um ihren Winkel des Großraumbüros nicht sehen; dafür jedoch war die Rauchspirale, die zum Lüftungsschlitz der Klimaanlage emporkletterte, ein bombensicherer Hinweis auf ihre Anwesenheit. Als die Computerterminals im Chronicle installiert wurden, hatte die Geschäftsführung den Versuch gestartet, die Nachrichtenredaktion zur rauchfreien Zone zu erklären. Dieser Politik waren nicht einmal fünf Minuten Lebensdauer beschieden. Journalisten zum Nikotinverzicht zu bewegen ist in etwa so leicht, wie einen Minister mit außerehelichen Affären zum Rücktritt zu zwingen.
Ich streckte den Kopf um die Trennwand aus buntgemischtem Grünzeug. Alexis kippelte auf ihrem Stuhl, die Füße auf dem Rand des Papierkorbs abgestützt, tippte sich geistesabwesend mit der Zigarette an die Lippen und blickte finster auf ihr Terminal. Ich sondierte ihre anarchische schwarze Haarmähne. Der Grad ihres chaotischen Zustands ist ein verlässliches Barometer für ihre Stressbelastung. Je größer der Druck, um so häufiger fährt sie mit den Händen hindurch. Heute sah es so aus, als könne ich es riskieren, sie zu stören, ohne einen Schwall deftiger echt Liverpooler Schimpfwörter zu ernten.
»Ich dachte, du wirst fürs Arbeiten bezahlt«, sagte ich und zwängte mich durch die Lücke in den Blättern in ihr Dschungelkabuff.
Sie fuhr herum und grinste. »Alles klar, KB?«, fragte sie mit ihrer rauhen Whisky-und-Zigaretten-Stimme.
»Ich glaube, ich bin verliebt, aber abgesehen davon geht es mir bestens.« Ich zog mir den anderen Stuhl heran.
Alexis prustete los, dann säuselte sie wie Marlene Dietrich: »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt … Das ist, was soll ich machen, mei-ei-ne Natur, bin zweiundneunzig nur, und sonst gar nichts. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, es ist höchste Zeit, dass du das Weichei loswirst.« Sie und Richard tun noch immer so, als könnten sie einander nicht riechen. Er ärgert sie andauernd damit, sie sei ein Sirenenjunkie, und sie tut so, als verachte sie ihn, weil er sein Leben den Niederungen des Rockjournalismus widmet. Doch dahinter, so weiß ich, stecken Zuneigung und Respekt.
»Wer hat etwas von Richard gesagt?«, fragte ich unschuldsvoll.
»Und ich hab schon gedacht, ihr zwei kriegt euer Zusammenleben endlich auf die Reihe.« Sie seufzte. »Also wer ist der Glückliche? Ich meine, ich setze mal voraus, dass dir nicht die Augen geöffnet wurden und es wieder ein Kerl ist.«
»Sein Name ist Michael Haroun. Aber keine Angst, es ist rein fleischlich. Nach einer kalten Dusche ist alles vorbei.«
»Und was treibt dieses Sexobjekt beruflich?«
Ich verzog das Gesicht. »Du wirst lachen.«
»Bestimmt«, pflichtete Alexis mir bei. »Also bring’s hinter dich.«
»Er ist in der Versicherungsbranche.«
Ich hatte recht gehabt. Sie lachte tatsächlich – tiefe, rauhe Lachsalven, die die Blätter erzittern ließen. Ich dachte schon, gleich käme ein Papagei vom Amazonas aus dem Dickicht geflogen, um einzustimmen. »Du hast wirklich ein Händchen für die Kerle«, keuchte Alexis.
»Man sucht sich seine Sexobjekte nicht aus, sie sind einfach da«, versetzte ich eisig. »Im Übrigen wird nichts daraus, deshalb ist das alles ohnehin blasse Theorie. Die Beziehung zwischen Richard und mir mag bessere Tage gesehen haben, aber das bekommen wir wieder hin.«
»Also soll ich nicht Chris anrufen und ihr auftragen, eine Ziegelmauer im Wintergarten hochzuziehen?«
Alexis’ Liebste Chris ist Architektin und hat den Wintergarten entworfen, der sich an den Rückseiten der beiden von Richard und mir bewohnten Bungalows entlangzieht. Er verbindet sie miteinander und verschafft uns gleichzeitig den nötigen Freiraum – die ideale Lösung für zwei Menschen, so schien es uns, die zusammensein wollten, deren Lebensstil jedoch in etwa so verträglich war wie der von Burton und Taylor. »Beherrsch dich, Alexis. Ich werde nicht zulassen, dass meine Hormone meinen Verstand überwältigen.«
»Das war’s dann also schon? Du kommst hier rein, unterbrichst den kreativen Prozess, nur um mir zu sagen, dass nichts passieren wird?«
»Nein, ich habe dich mit dem neuesten Klatsch versorgt, damit du dich nicht beschwerst, dass ich nur komme, um dich auszubeuten«, konterte ich.
Alexis stieß eine Rauchwolke und gleichzeitig einen Seufzer aus. »Na schön, was willst du wissen?«
»Ist das eine Art, mit einem wertvollen Kontakt umzugehen, der dir eine Story als Geschenk mitgebracht hat?«, fragte ich, als könnte ich kein Wässerchen trüben.
Alexis ließ ihren Stuhl nach vorn kippen und drückte ihre Zigarette in dem bereits überquellenden Aschenbecher aus. »Warum ist mir nur, als handelte es sich um die Sorte Geschenk, die schweißtreibender ist als ein Modellflugzeugbaukasten Marke höchster Schwierigkeitsgrad?«
3. Kapitel
Ich ließ Alexis allein, damit sie der Polizei von sechs Grafschaften auf den Wecker fallen konnte, auf der Suche nach der Story, die sich, wie wir beide wussten, irgendwo verbarg, und fuhr zurück zu Mortensen & Brannigan. Shelley telefonierte, daher ging ich gleich weiter in mein Büro. Auf der Türschwelle blieb ich wie angewurzelt stehen. Ich hörte, wie Shelley ihr Telefongespräch beendete, fuhr herum und sah sie böse an. »Was soll das sein?«, stellte ich sie zur Rede.
Sie blickte nicht von der Notiz auf, die sie sich gerade machte. »Wonach sieht’s denn aus? Es ist eine Trauerfeige.«
»Es ist Plastik«, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen.
»Seide«, berichtigte sie mich zerstreut.
»Und das soll besser sein?«
Endlich sah Shelley mich an. »Alle sechs Wochen kaufst du dir eine gesunde, gedeihende, quicklebendige Pflanze. Fünf Wochen später sieht sie aus wie ein Heuschreckenparadies. Demnach wird sich die Trauerfeige in sechs Monaten amortisiert haben, und selbst du kannst keine Seidenpflanze killen«, schloss sie in einem nüchternen Ton, bei dem es mir in den Fingern juckte, ihr diese um den Hals zu legen.
»Wenn ich eine Kunstpflanze wollte, dann hätte ich mir selbst eine mitgebracht«, knurrte ich.
»Du hörst dich an …«
»›… wie eines meiner Kinder‹«, ergänzte ich und ahmte dabei ihre seelenruhige Stimme nach. »Du begreifst es wohl nicht, wie? Es geht mir um die Herausforderung. Eines Tages werde ich eine Pflanze finden, die für mich all ihre Pracht entfaltet.«
»Und bis dahin wird der Planet eine Wüste sein.« Shelley warf den Kopf zurück, und die Perlen, die sie sich ins Haar geflochten hatte, klimperten wie ein Sack voll Murmeln.
Ich würdigte sie keiner Antwort und marschierte in mein Büro, schnappte mir die Trauerfeige und deponierte sie neben ihrem Schreibtisch. »Wenn du sie so magst, dann lebe mit ihr«, verkündete ich und stapfte umgehend zurück in mein Büro. Wenn sie mich wie eines ihrer Teenie-Kids behandeln wollte, dann durfte ich mir auch einen saftigen Wutanfall erlauben. Ich fischte die bräunlichen Überreste des Spargelkrauts aus dem Mülleimer und stellte es trotzig auf die Fensterbank.
Ehe ich zu weiteren Taten schreiten konnte, läutete mein Telefon. »Was denn noch?«, fuhr ich Shelley an.
»Ein Anruf für dich. Ein Herr, der sich weigert, seinen Namen zu nennen.«
»Hast du ihm gesagt, dass wir keine Ehesachen übernehmen?«
»Natürlich. Ich bin ja nicht diejenige mit dem prämenstruellen Syndrom.«
Ich unterdrückte ein Knurren, als Shelley den Anruf durchstellte. »Kate Brannigan«, meldete ich mich. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich brauche Ihre Hilfe, Miss Brannigan. Es handelt sich um eine streng vertrauliche Angelegenheit. Brian Chalmers von PharmAce hat Sie mir empfohlen.«
»Wir sind bekannt für unsere Verschwiegenheit in Angelegenheiten unserer Klienten«, leierte ich herunter. »Wie Sie zweifellos schon wissen, wenn Sie mit Brian gesprochen haben. Ich müsste trotzdem wissen, mit wem ich es zu tun habe.«
Ein kurzes Zögern, jedoch lang genug, dass ich Lärm im Hintergrund hören konnte. Mein Anrufer sprach von einer Kneipe aus. »Mein Name ist Trevor Kerr. Ich glaube, die Firma, die ich leite, wird erpresst. Darüber muss ich mit Ihnen sprechen.«
»Gut. Wie wär’s, wenn ich heute Nachmittag in Ihr Büro komme und wir uns dort unterhalten?«
»Um Gottes willen, nein«, entgegnete Kerr offenkundig erschrocken. »Die Erpresser dürfen auf gar keinen Fall erfahren, dass ich mit einer Privatdetektivin Kontakt aufgenommen habe.«
Einer von der Sorte, die sich zu viele Filme angucken. Das hatte mir gerade noch gefehlt. »Na schön. Dann kommen Sie zu mir.«
»Das halte ich für keine gute Idee. Wissen Sie, ich glaube, man beobachtet mich.«
Wenn man schon denkt, es sei ungefährlich, ans Telefon zu gehen … Neuer Anlauf. »Ich weiß, wie beunruhigend Drohungen sein können, wenn man es nicht gewohnt ist, damit zu tun zu haben. Vielleicht könnten wir uns an einem neutralen Ort treffen. Sagen wir, in der Lounge des Midland?«
Der beschwichtigende Ton hatte sein Ziel verfehlt. »Nein«, erwiderte Kerr eindringlich. »Nicht in der Öffentlichkeit. Es muss völlig unverdächtig aussehen. Haben Sie einen Freund, Ms. Brannigan?«
An diesem Punkt hätte ich auflegen sollen, das wurde mir vier Stunden später klar, als ich Richard begreiflich zu machen suchte, dass ein zerknitterter cremefarbener Leinenanzug ja vielleicht das Richtige sein mochte, um mit Mick Hucknall auf die Piste zu gehen, ihm jedoch keinesfalls dazu verhelfen würde, Furore zu machen als Gast eines karitativen Essens höherer Kreise.
»Himmel, Arsch und Zwirn, Brannigan«, grummelte er. »Ich bin alt genug, um mich alleine anzuziehen.«
Ich ging nicht darauf ein, stöberte in seinem Kleiderschrank und tat einen recht dezenten italienischen Zweireiher in Dunkelblau auf. »Der hier passt schon eher«, verkündete ich.
Richard machte ein finsteres Gesicht. »Den ziehe ich nur zu Beerdigungen an.«
Ich warf ihn aufs Bett. »Stimmt nicht. Du hast ihn zur Hochzeit deiner Cousine getragen.«
»Hast du ihren Mann schon vergessen? Egal, ich sehe nicht ein, warum ich mich aufmotzen sollte wie eine Schaufensterpuppe. Als ich dir das letzte Mal ausgeholfen habe, hast du geschworen, du würdest mich nie wieder auch nur in die Nähe deiner Arbeit kommen lassen«, beschwerte er sich, während er sein Leinenjackett abstreifte.
»Glaub mir, wenn Bill da wäre, würde ich dich nicht im Traum darum bitten«, konterte ich gereizt. »Außerdem kannst selbst du ein Wohltätigkeitsdinner mit Schatzsuche und buntem Buffet nicht in eine lebensbedrohliche Situation verwandeln.«
Richard erstarrte. »Das ging unter die Gürtellinie, Brannigan«, sagte er bitter.
»Tja, ich verziehe mich dann mal nach nebenan, um in meinem eigenen Schrank etwas angemessen Geschmackloses aufzutun. Komm rüber, wenn du fertig bist.«
Ich ging durch Richards Flur und durch sein Wohnzimmer zum Wintergarten. In meinem Haus angelangt, atmete ich erst mal tief durch und versuchte mich zu beruhigen. Vor ein paar Monaten hatte ich Richard für eine Ermittlung angeworben, die eigentlich nach einem unkomplizierten Fall von Autoschwindel aussah. Nur war dann alles, wie es in den schlechten Polizeiserien so schön heißt, ganz anders gekommen. Und wie. Richard landete hinter Gittern, sein Leben war in Gefahr, und ich wurde fast umgebracht, als ich die wahren Täter aufspürte. Als hätte das nicht schon gereicht, war mir auch noch die Aufgabe zugefallen, auf seinen acht Jahre alten Sohn Davy aufzupassen. Und das mir, die den Mutterinstinkt einer Tüte Lakritz hat.
Die physischen Narben waren ziemlich schnell verheilt, unsere Beziehung jedoch hatte einen üblen Knacks davongetragen. Man sollte meinen, Richard hätte sich dankbar gezeigt, weil ich alles aufgeklärt hatte. Stattdessen war er distanziert und sarkastisch, und er war häufig unterwegs. Natürlich war es nicht ununterbrochen schlimm. Sonst hätte ich schon vor Wochen gestreikt. Wir hatten nach wie vor Spaß miteinander, manchmal war fast eine Woche lang alles genauso wie früher: viel Lachen, gemeinsam verbrachte Abende, Essen vom Außerhausverkauf des Chinesen und herrlicher Sex. Dann zogen wieder Wolken auf, gewöhnlich wenn ich bis zum Hals in einem stressigen Auftrag steckte.
Dies war das erste Mal seit unserem Kräftemessen mit den Drogenbossen, dass ich Richard in Zusammenhang mit meiner Arbeit um etwas bat. Ich hatte Trevor Kerr gesagt, es müsse doch einen weniger komplizierten Weg geben, uns zu treffen, doch der clevere Trevor war überzeugt, dass er seine Vorsichtsmaßnahmen zu Recht ergriff. Ich fragte ihn beinahe, warum er einen Wachhund engagierte, wo er das Bellen doch selbst besorgte, biss mir jedoch auf die Zunge. Die Geschäfte liefen in letzter Zeit so toll wieder nicht, dass ich es mir erlauben konnte, neue Klienten zu verprellen, noch bevor sie uns einen Auftrag erteilt hatten.
Seufzend ging ich in mein Schlafzimmer und dachte über die modischen Alternativen nach. Richard sagt, ich hätte keine echte Garderobe, sondern bloß eine Kollektion von Verkleidungen. Als ich das Aufgebot an Kleidungsstücken vor mir betrachtete, war ich versucht, ihm beizupflichten. Ich holte ein schlicht geschnittenes Kleid aus rotbrauner Waschseide mit passendem Bolerojäckchen heraus. Dieses Ensemble hatte ich erstanden, als ich Bodyguard für eine Hollywood-Schauspielerin spielte, die eine Woche in England war, um eine Folge einer Serie fürs Regionalfernsehen abzudrehen. Nach nur einem Blick auf das kleine Schwarze, in dem ich am ersten Abend aufgetaucht war, hatte sie prompt einen Scheck über fünfhundert Pfund ausgeschrieben – damit ich mir »etwas mit ein wenig mehr Schick, Schätzchen« besorgen konnte. Ich bin nicht stolz; ich nahm das Geld und ging shoppen. Alexis und ich hatten uns seit Jahren nicht mehr so amüsiert.
Ich stieg in das Kleid und griff nach hinten, um den Reißverschluss hochzuziehen. Richard kam mir zuvor. Er küsste mich hinters Ohr. Ich bekam Gänsehaut und fröstelte. »Entschuldige«, bat er. »War ’n mieser Tag heute. Dann sehen wir uns jetzt mal an, wie die andere Hälfte lebt.«
Die Adresse, die Trevor Kerr mir genannt hatte, war in Whitefield, einem Vorort überwiegend aus Doppelhäusern, gleich hinter den immerwährenden Straßenbauarbeiten auf der M 62. Eine Gegend, in der zum großen Teil sozial aufsteigende, nicht streng orthodoxe Juden leben, die einen wesentlichen Anteil der Bevölkerung von Manchester stellen. Unser Ziel lag hinter den Straßenzügen mit identischen Doppelhäusern aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen – eine von Architekten individuell entworfene Siedlung; eine von einer Handvoll, in denen sich das dicke Geld konzentrierte. Mein Installateur hatte in einer der Siedlungen den Zuschlag bekommen und mir von einem Gespräch mit einem seiner Kunden berichtet. Er dachte, der Architekt habe sich geirrt, da auf den Plänen Installationen für vier Spülmaschinen eingezeichnet waren – zwei in der Küche und zwei im Allzweckraum. Als er das reklamierte, sah der Kunde ihn an, als sei er von allen guten Geistern verlassen, und erklärte: »Wir leben koscher, und wir haben oft Gäste.« Darauf kann man nichts mehr erwidern.
Das Haus, in das man mich geladen hatte, sah eher nach Frankenstein als nach Frank Lloyd Wright aus. Es hatte mehr Türme und Zinnen als Schloss Windsor, alles in knallroten Accrington-Ziegeln. »Manchmal hat es nur Nachteile, nicht bekifft zu sein«, bemerkte Richard, als wir parkten. Es gab eine Dreiergarage und asphaltierte Einstellplätze für ein halbes Dutzend Autos, und heute Abend war Partytime der Staatskarossen angesagt. Richards Käfer Cabrio in knalligem Pink wirkte so fehl am Platz wie Aschenputtel eine Minute nach Mitternacht. Als die Gastgeberin die Tür aufmachte, lächelte ich. »Guten Abend. Wir sind wegen Trevor Kerr hier.«
Der kalte Glanz ihrer makellosen Coiffure färbte auf ihr Lächeln ab. »Kommen Sie doch herein«, erwiderte sie.
Der Mann, der sich hinter ihr in der Diele herumgedrückt hatte, trat vor. »Ich bin Trevor Kerr.« Er wies mit den Augenbrauen zur Treppe, und wir folgten ihm nach oben in ein Arbeitszimmer, das aussah wie im Paket einem Landhaus entnommen. Der einzige Stilbruch waren der Computer und das Faxgerät auf dem Schreibtisch. »Hier sind wir ungestört«, sagte er. »Es wird mindestens noch eine halbe Stunde dauern, bis der Gastgeber die Hinweise zur Schatzsuche verteilt und das Startsignal gibt. Vielleicht würde Ihr Freund gern schon mal nach unten gehen und sich etwas vom Buffet holen?«