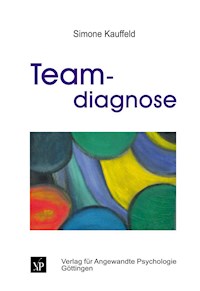Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Coaching-Angebote für alle Lebens- und Arbeitsbereiche schießen noch immer wie Pilze aus dem Boden. Trotzdem - oder gerade deshalb - besteht eine große Unsicherheit über die Seriosität dieser Angebote. Wer sich mit Coaching ernsthaft beschäftigen möchte, sieht sich mit einem unübersichtlichen Dschungel aus Praxis- und Forschungsliteratur konfrontiert. Demgegenüber bietet dieses Buch eine effiziente Kombination aus verständlicher Forschungssicht und Praxisnähe: Es enthält neben Einblicken in die Entstehung von Coaching, in die wissenschaftlichen Grundlagen und die aktuelle Coaching-Praxis auch praxisnah aufbereitete Forschungsergebnisse sowie Informationen zu Coaching-Ausbildungen und Berufsverbänden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorinnen
Prof. Dr. Simone Kauffeld hat den Lehrstuhl für Arbeit-, Organisations- und Sozialpsychologie an der TU Braunschweig inne. In Forschung und Praxis leistet sie Beiträge zu den Themen Kompetenz, Teams und Führung, Karriere und Coaching sowie der Gestaltung von Veränderungsprozessen in Organisationen.
Dr. Sina Gessnitzer leitet bei der 4 A-SIDE GmbH ein Team aus sieben Psychologen im Bereich HR, arbeitet als Coach und Trainerin und hat am Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie an der TU Braunschweig zum Thema Coaching promoviert.
Simone Kauffeld & Sina Gessnitzer
Coaching
Wissenschaftliche Grundlagen und praktische Anwendung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-030179-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-030180-1
epub: ISBN 978-3-17-030181-8
mobi: ISBN 978-3-17-030182-5
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Danksagung
Wir danken Ben Langhans, Maria Schneider, Sarah Brandl und Philine Kortenkamps für Ihre Unterstützung bei der wissenschaftlichen Recherche für dieses Buch. Darüber hinaus danken wir Stefanie Jordan, Theresa Will und Patrizia Ianiro für ihren Einsatz bei der Zusammenstellung von praxisnahen Exkursen.
Vorwort zur Buchreihe
Ökonomische, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen tragen dazu bei, dass unsere Arbeitswelt sich in einem stetigen Veränderungsprozess befindet. Dies hat Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten des einzelnen arbeitenden Menschen genauso wie auf gesamte Organisationen und größere wirtschaftliche Zusammenhänge.
Die vorliegende Buchreihe soll einen fundierten Einblick in verschiedene Forschungs- und Anwendungsfelder innerhalb der Arbeits-, Organisations-, Personal- und Wirtschaftspsychologie geben – einem der wichtigsten Bereiche der angewandten Psychologie. Aktuelle, praxisrelevante und an wichtigen Trends orientierten Themen werden vorgestellt und die Reihe dabei sukzessive um neue Bände erweitert.
Die Reihe richtet sich vor allem an Studierende der (Wirtschafts-)Psychologie und sich weiterbildende Personen. Durch die fachübergreifende Bedeutung sind die Inhalte der Bücher jedoch auch für Studierende angrenzender Bereiche, wie z. B. der Wirtschaft, Soziologie und Pädagogik von hoher Relevanz. Als besonders interessierte Zielgruppe können bereits erwerbstätige Personen aus dem Personalbereich (z. B. Coaches, Beraterinnen und Berater, Personalentwicklerinnen und Personalentwickler) identifiziert werden, die sich z.B in einem Aufbaustudium weiterbilden. Die konsequente Verbindung von Theorie und Praxis bietet darüber hinaus Führungskräften die Möglichkeit, sich wissenschaftlich fundiert mit praxisrelevanten Themen wie z. B. Kompetenzmanagement in Unternehmen, Coaching, Change Management oder Gesundheit im Arbeitskontext auseinanderzusetzen.
Simone Kauffeld
Braunschweig, Oktober 2017
Vorwort
Coaching ist in den letzten Jahren zu einem komplexen Sammelbegriff geworden, der viele verschiedene Interventionen, Zielgruppen und Themenschwerpunkte unter einem Namen vereint. Mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Coaching stiegen auch die Publikationen zu diesem Thema. Derzeit gibt es allein im deutschsprachigen Raum über 6000 Bücher, die sich, mehr oder weniger detailliert, einzelnen Aspekten, Techniken, Tools oder Modellen im Coaching widmen. Die meisten Bücher, die aus der Sicht von Praktizierenden geschrieben sind, weisen eine Präferenz bestimmter theoretischer Schulen und Ansätze auf. Das vorliegende Buch möchte einen wissenschaftlich fundierten, kritischen aber auch praxisnahen Blick auf die Coaching-Thematik ermöglichen.
Das Buch richtet sich primär an Personen, die einen objektiven und umfassenden Überblick über das Thema Coaching aus der Sicht praxisorientierter Wissenschaft erhalten wollen. Demnach ist das Buch als Einstiegs- oder auch als Grundlagenlektüre geeignet, die keiner einzelnen theoretischen Schule oder Anwendungsform folgt, sondern die Vielseitigkeit von Coaching aufzeigt. Darüber hinaus wird der Leserschaft ermöglicht, wissenschaftlich fundierte Methoden und Ansätze zu erkennen: Sowohl dem Thema der Diagnostik als auch dem Thema Evaluation und wissenschaftliche Forschung zu Coaching werden Abschnitte gewidmet. Neben Beispielen für standardisierte und wissenschaftlich validierte Coaching-Tools, wird der Lesende diesen Kapiteln mit dem immer wichtiger werdenden Gegenstand der Qualitätssicherung vertraut gemacht.
Neben der Theorie wird jedoch auch die praktische Anwendung thematisiert: Nach der Lektüre dieses Buches wissen die Lesenden, wie Coaching-Prozesse in der Regel gestaltet sind und in welche Phasen sich Coaching-Sitzungen gliedern lassen. Elementare Fähigkeiten und Verhaltensweisen von Coaches werden vorgestellt und es wird ein Einblick in die beruflichen Realitäten von Coaches gegeben. Darüber hinaus erfahren sie, warum sich die Beliebtheit von Coaching in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gesteigert hat und welche Ziele mit Coaching verfolgt werden können.
Die Kapitel sollen sowohl grundlegendes als auch weiterführendes Wissen vermitteln. Es werden anhand aktueller Forschungsergebnisse Implikationen für die Praxis abgeleitet und weiterführende Forschungs- und Praxisfelder aufgezeigt. Auch aktuelle Entwicklungen wie E-Coaching und Selbstcoaching oder auch zielgruppenspezialisierte Coaching-Programme werden vorgestellt. Zu jedem inhaltlichen Thema werden weiterführende Literaturtipps gegeben, Exkurse vertiefen das theoretische Wissen und Fallbeispiele zeigen die praktische Relevanz auf. Damit bietet sich das Buch sowohl als Begleitwerk zu einer Coaching-Weiterbildung wie auch als Überblicksliteratur zum aktuellen Stand von Coaching-Forschung und -Praxis an.
Sina Gessnitzer, Braunschweig, Oktober 2017
Inhalt
Danksagung
Vorwort zur Buchreihe
Vorwort
1 Relevanz und Entwicklung von Coaching
1.1 Der Coaching-Boom
1.2 Abgrenzung von anderen Professionen
1.2.1 Beratung
1.2.2 Supervision
1.2.3 Mentoring
1.2.4 Psychotherapie
1.2.5 Mediation
1.2.6 Training
1.2.7 Überblick
1.3 Zusammenfassende Definition von Coaching
1.4 Ziele von Coaching
1.5 Fazit
2 Theoretische Fundierung von Coaching
2.1 Klientenzentrierter Ansatz
2.2 Systemischer Ansatz
2.3 Lösungs- und ressourcenorientierter Ansatz
2.4 Kognitiv-Behavioraler Ansatz
2.5 Weitere Ansätze
2.5.1 Positive Psychologie
2.5.2 Motivational Interviewing (MI)
2.6 Integration verschiedener Ansätze
2.7 Fazit
3 Formen des Coachings
3.1 Auftraggeber von Coaching
3.2 Das Setting im Coaching
3.2.1 Selbst-Coaching
3.2.2 Peer-Coaching
3.2.3 Team-Coaching
3.2.4 Gruppen-Coaching
3.3 Inhaltlicher Fokus von Coaching
3.4 Medieneinsatz im Coaching
3.5 Fazit
4 Struktur von Coaching
4.1 Phasen im Coaching-Prozess
4.2 Phasen in der Coaching-Sitzung
4.3 Fazit
5 Diagnostik im Coaching
5.1 Grundlagen und Anwendung von diagnostischen Verfahren
5.2 Psychometrische Diagnostikverfahren im Coaching
5.3 Nicht-psychometrische Diagnostikverfahren im Coaching
5.4 Fazit
6 Methoden im Coaching
6.1 Allgemeine Techniken
6.1.1 Fragetechniken
6.1.2 Aktives Zuhören und Schweigen
6.1.3 Paraphrasieren und Zusammenfassen
6.2 Spezifische Coaching-Übungen
6.3 Fazit
7 Qualitätssicherung und Forschung im Coaching
7.1 Praxis-Forschungs-Lücke
7.2 Wirksamkeitsstudien (struktur- und ergebnisbezogene Evaluation)
7.3 Prozessbezogene Forschung
7.3.1 Act4consulting: Analyse von verbalem Verhalten von Coach und Coachee
7.3.2 Analyse von nonverbalem Verhalten von Coach und Coachee
7.4 Fazit
8 Professionalisierung von Coaching
8.1 Beruflicher Hintergrund von Coaches
8.2 Coaching-Qualifizierungen
8.3 Verdienstmöglichkeiten im Coaching
8.4 Coaching-Verbände
8.5 Fazit
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
1 Relevanz und Entwicklung von Coaching
Das folgende Kapitel soll einen verständlichen und umfassenden Einstieg in das Thema Coaching ermöglichen. Hierzu sollen im ersten Schritt die gesellschaftlichen Veränderungen zusammengefasst werden, die maßgeblich zur Entstehung von Coaching und seinem anhaltenden Erfolg beigetragen haben. Nachdem die Entstehungsgeschichte von Coaching nachvollzogen wurde, werden im Anschluss verwandte Professionen von Coaching beleuchtet. Als eine relativ neue Unterstützungsform hat sich Coaching aus verschiedenen anderen Bereichen entwickelt und aus diesen auch Methoden adaptiert: Beispielsweise aus Psychotherapie, Supervision, Beratung und Mediation. Durch eine detaillierte Abgrenzung sollen die Besonderheiten von Coaching als autonome Unterstützungsform herausgestellt werden, um eine Definition zu ermöglichen. Zum Abschluss des Kapitels wird eine Gliederung von Zielen im Coaching vorgestellt, die eine Einordnung von Schwerpunkten dieser Intervention erleichtern soll.
1.1 Der Coaching-Boom
Der Begriff »Coaching« wurde das erste Mal Mitte der 1980er/Anfang der 1990er Jahre einer breiteren Öffentlichkeit bekannt (Böning, 2005; Feldman & Lankau, 2005). Zu dieser Zeit wurde Coaching insbesondere in den USA als Maßnahme angewendet, um Probleme in der Leistung »schlechter« Manager zu beseitigen (Joo, 2005). Aus diesem Grund hatte Coaching damals einen eher schlechten Ruf: »Gecoacht« zu werden war das Zeichen, dass man als Führungskraft nicht die Leistung lieferte, die das Unternehmen sich wünschte. Coaching war oftmals die letzte Chance auf »Rettung« für Manager-Karrieren (Joo, 2005). Eine solche Sichtweise entstand auch aus dem damaligen Führungsbild: In den 1990er Jahren war der Druck auf das obere Management insbesondere in den USA sehr hoch. Manche Verfassende berichten davon, dass bis zu 50% der Karrieren im oberen Management scheiterten (DeVries, 1992). Diese Zahlen bedeuteten nicht nur großen Druck für das Individuum, sondern auch einen großen ökonomischen Druck für Unternehmen. Auf der Suche nach Gründen für den Misserfolg von Managern wurde meist das Führungsverhalten verantwortlich gemacht: Coaching sah man als Möglichkeit, dieses Problem zu »beseitigen« (Feldman & Lankau, 2005).
Spätestens zu Beginn des neuen Jahrtausends änderte sich jedoch die Wahrnehmung von Coaching für Führungskräfte: Auf Grund des Erfolgs und der Verbreitung von Coaching in den ständig komplexer werdenden Organisationsabläufen (Böning, 2005; Höpfner, 2006), entwickelte es sich mehr und mehr von einer »Bestrafung« bzw. einem Stigma für schlechte Leistungen hin zu einer Möglichkeit der gezielten Potenzialentwicklung (Joo, 2005). Unternehmen erkannten, dass Coaching einen Weg bietet, Lernprozesse bei ihren Führungskräften zu unterstützen und es damit guten Führungskräften ermöglicht, sich zu exzellenten Führungskräften entwickeln zu können (Feldman & Lankau, 2005). Diese Entwicklung wurde auch durch ein neues Führungsverständnis unterstützt, welches eine Abkehr von der hierarchischen Macht einer Führungskraft propagierte und damit stärker auf Kooperation, Selbstreflexion und sozial-interaktive Kompetenzen der Führungskraft setzte (Böning, 2005). Coaching wurde in diesem Zuge die »neue« Intervention für diese neuerlichen Anforderungen. Auf Grund der Kosten für Coaching (Kap. 8), setzten es Unternehmen verstärkt bei »High Potentials« ein, wodurch sich Coaching mehr und mehr zu einer begehrten Bonusleistung entwickelte (Joo, 2005).
Wenn man jedoch heute auf den Coaching-Markt schaut, wird deutlich, dass Coaching nicht mehr nur für Führungskräfte zur Anwendung kommt. Seit den 1980er Jahren erfreute sich der Begriff immer stärkerer Beliebtheit und findet sich schließlich heute in jedem Lebensbereich: Sowohl in dem ursprünglichen Bereich der Personalentwicklung als auch im Privaten gibt es Coaching für jeden Anlass und jede Gelegenheit (Böning, 2005). Bei der Betrachtung dieser inflationären Nutzung des Begriffes wird klar, dass Coaching ein »Modewort« geworden ist, welches nicht zwangsläufig für seriöse und qualitativ-hochwertige Interventionen steht. Die grundsätzliche Tatsache, dass es mittlerweile eine breitere Anwendung findet, beruht jedoch auf denselben Entwicklungen, die in den 1980ern zu einem Anstieg von Coaching in Unternehmen beigetragen haben: Zunächst einmal ist der Wunsch nach idealer Performance und Optimierung nicht mehr nur in den Chefetagen zu finden. Der Druck innerhalb der Gesellschaft, ein »erfolgreiches« Leben zu führen, erstreckt sich über einen sicheren Job hinaus: Sowohl die berufliche Karriere als auch das Privatleben, Freunde, die Beziehung oder der Lebensstil müssen einen weit höheren Standard erfüllen (Ebner & Kauffeld, 2015; Tractenberg, Streumer & Zolingen, 2002). Eine steigende Individualisierung der Gesellschaft führt dazu, dass sich jeder auf der Suche nach »Besonderheit« und »Abgrenzung« befindet. Diese Anforderungen an die eigene Person, absolut einzigartig und individuell, gut gelaunt, glücklich, erfolgreich und schön zu sein, haben seit den 1980er Jahren dazu beigetragen, die Beratungs- und Selbsthilfebranche zu einem großen Wachstumsmarkt zu machen (vgl. Ebner & Kauffeld, 2015; Tractenberg, Streumer & Zolingen, 2002).
Als weiterer Punkt hatten die Veränderungen im Arbeitsumfeld auch Auswirkungen auf andere Hierarchieebenen als nur die obersten Führungsebenen. Auch wenn die zunehmende Globalisierung und der technische Fortschritt ihre Wirkungen zuerst im Management entfalteten: Bald waren auch Beschäftigte und Führungskräfte aus dem mittleren und unteren Management mit ständigen Veränderungen und immer komplexeren Organisationsabläufen konfrontiert (Böning, 2005). Seien es neue Technologien, neue Führungskonzepte oder immer dezentralere Arbeitsbedingungen (vgl. Höpfer, 2006; Tractenberg, Streumer & Zolingen, 2002): Veränderungsprozesse waren nicht mehr die Ausnahme, sondern entwickelten sich zu einer ständigen Notwendigkeit für Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben (vgl. Kauffeld & Endrejat, 2016). Der Druck, den der gestiegene internationale Wettbewerb ausübte, manifestierte sich daher auch immer stärker im Stresslevel jedes einzelnen Beschäftigten, was zu Burn-Out-Erscheinungen führen konnte (Tractenberg, Streumer & Zolingen, 2002).
Für das Individuum stiegen somit die Anforderungen im organisationalen Kontext, aber auch darüber hinaus: Mit den veränderten Arbeitsbedingungen entstanden ebenfalls eine größere Unsicherheit und die Notwendigkeit zur Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Während Beschäftigte früher den Großteil ihres Arbeitslebens in einer Firma gearbeitet hatten, gehörten nun temporäre Arbeitsverträge und häufigere Jobwechsel zur Normalität (Tractenberg, Streumer & Zolingen, 2002; Gruber, 2015). Für die Beschäftigten bedeuteten diese Veränderungen eine größere Flexibilisierung in ihren Karrieren: Es wird zu einer Notwendigkeit, sich regelmäßig umzuorientieren und hierbei auch eine Veränderung des Wohnorts in Kauf zu nehmen. Durch diese Abkehr von klassischen »Normalbiographien« (d. h. einem Verbleib in einem Beruf- oder Tätigkeitsfeld während der gesamten Erwerbsbiographie) ergeben sich zirkuläre und damit wiederkehrende Prozesse der Berufsfindung. Für diese ist es notwendig, dass Personen immer wieder eine Exploration ihrer beruflichen Möglichkeiten vornehmen. Dazu gehört unter anderem das Einholen von Informationen zu Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die Einschätzung der Passung zwischen individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen, Berufsinteressen und Werthaltungen. Anlässe für dieses berufliche Explorationsverhalten können sein: Einschnitte oder Übergänge in der beruflichen Laufbahn beim Übergang von der Schul- oder Berufsausbildung in die Berufslaufbahn, bewusste oder erzwungene Neuorientierungen (bspw. durch organisationale Veränderungen oder Verlust des Arbeitsplatzes) oder auch Exploration von Aktivitäten für die Zeit nach Ausscheiden aus dem Berufsleben (vgl. Lent & Brown, 2013). Diese höhere Instabilität in beruflichen Lebensläufen stellt jedoch häufig eine Belastung dar, da Angestellte sich immer wieder einer solchen Exploration stellen müssen. Damit verbunden, müssen sie auch immer wieder ihre individuelle Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt unter Beweis stellen und stehen damit in der Verantwortung, dass diese Attraktivität erhalten bleibt (Ebner & Kauffeld, 2015; Hall & Moss, 1998; Tractenberg, Streumer & Zolingen, 2002). Diese Aufrechterhaltung der eigenen Arbeitsfähigkeit wird auch als »Employability« bezeichnet. Diese Fähigkeit, die eigene Karriere bewusst voranzutreiben und immer wieder strategisch auszurichten, muss dabei von einigen Personen erst entwickelt und erlernt werden (Tractenberg, Streumer & Zolingen, 2002).
Immer mehr Lebensbereiche erforderten daher eine individuelle Unterstützung: Sei es bei der Planung der eigenen Karriere, dem Verwirklichen persönlicher Ziele, der Optimierung des eigenen Lebens, dem Finden von Sinn oder der Steigerung von Erfüllung, Zufriedenheit und Gesundheit. Coaching etablierte sich immer mehr im beruflichen Kontext als individuelle Unterstützungsmaßnahme, so dass nach und nach Führungskräfte, aber auch Personen aus anderen Zielgruppen begannen, Coaching auch für Probleme und Anliegen außerhalb ihres organisationalen Umfeldes zu nutzen (vgl. Böning, 2005).
1.2 Abgrenzung von anderen Professionen
Auch wenn Coaching in der Führungskräfteentwicklung eine Innovation darstellte (Böning, 2005), als Intervention hat es sich nicht aus dem »Nichts« entwickelt. Als der Bedarf für die gezielte Unterstützung von Führungskräften in den 1980er Jahren immer weiter anstieg, formierte sich eine kleine Riege aus Expert/inne/n, die aus ihrem eigenen Erfahrungswissen und Methoden aus verschiedenen Bereichen wie Beratung, Training und Therapie eine erste Coaching-Methodik entwickelte. Der Coaching-Begriff wurde hierbei aus dem Bereich des Sports entlehnt: Der Sport-Coach als professioneller und individueller Trainer, der als Experte auf seinem Gebiet nur an der Leistungssteigerung seines Schützlings Interesse hat, schien hierbei das richtige Bild für die neue Intervention zu liefern. Im Folgenden werden wir auf relevante und verwandte Professionen eingehen, die Methoden oder Rollenbilder für das heutige Verständnis von Coaching geliefert haben. Die Abgrenzung von diesen Interventionen ermöglicht ein differenziertes Verständnis von Coaching, welches im Anschluss in einer Definition zusammengefasst wird.
1.2.1 Beratung
Beratung wird häufig als übergeordnete Begrifflichkeit zu Coaching angesehen (vgl. Mohe, 2015). Dabei besitzt der Beratungsbegriff eine sehr große Reichweite und umfasst zu viele verschiedene theoretische und praktische Modelle sowie inhaltliche Schwerpunkte, um sie in der Kürze dieses Abschnittes zu umschreiben (zur vertieften Lektüre siehe bspw. Hörmann & Nestmann, 1988; Mohe, 2015). Auch im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff »Beratung« in vielfältiger Weise benutzt: So nehmen viele die Expertise eines Steuerberaters in Anspruch, lassen sich im Fachhandel beraten oder greifen im Unternehmenskontext auf sogenannte Unternehmensberater zurück. Als eine grobe Unterteilung hat sich in der Beratungsforschung die Unterscheidung zwischen Inhalts- und Prozessberatung etabliert (Jonas, Kauffeld & Frey, 2007; König & Volmer, 2012). In der Inhaltsberatung wird dabei von einem Expertenstatus des Beraters ausgegangen: Dieser verfügt über Wissen und Fähigkeiten, die dem Ratsuchenden zur Verfügung gestellt werden. Das Eigeninteresse des Beraters besteht dabei in einem monetären Ausgleich (bspw. durch eine Vergütung beim Steuerberater oder eine Provision bei einem Verkäufer). In der Prozessberatung bleibt der Ratsuchende (im Folgenden »Coachee« genannt) in der Rolle des Experten: Prozessberatung wird häufig nicht bei dem Fehlen von konkretem Wissen, sondern zur Unterstützung eines Prozesses eingefordert (Hoppe, 2013). Der Berater unterstützt hierbei durch gezielte Fragen und Eingaben den Problemlöseprozess. Zur Prozessberatung sind beispielsweise die Psychosoziale Beratung oder das Coaching zu zählen (Hoppe, 2013). Zwischen diesen beiden Formaten gibt es jedoch Abstufungen, was eher für ein Kontinuum zwischen Inhaltsberatung auf der einen und Prozessberatung auf der anderen Seite spricht: Wo manche Beratungsformate klar dem einen oder anderen Typus zuzuordnen sind, befinden sich andere zwischen diesen beiden Formaten und sind höchstens eher dem einen als dem anderen Format zuzuordnen (Hoppe, 2013). Der Begriff des Beraters impliziert jedoch im normalen Sprachgebrauch noch immer primär einen Inhalts- oder auch Fachberater: Von einer Beratung wird eine sachorientierte Situationsanalyse und passgenaues Expertenwissen erwartet (vgl. Rauen, 2014). Dies bedeutet für die Rolle des Beraters, dass Spezialwissen in einem bestimmten Themenbereich eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit darstellt (Hörmann & Nestmann, 1988). Dabei ist der Bereich des Spezialwissens genauso breit gefächert wie die unzähligen Zielgruppen für Beratung: Für jeden klar umrissenen Bereich, in dem Wissen oder Expertise einen Vorteil darstellen, kann mittlerweile Beratung in Anspruch genommen werden (Hörmann & Nestmann, 1988; Jonas, Kauffeld & Frey, 2007). Dabei variiert das Entgelt hierfür stark zwischen den Beratungsthemen, je nachdem wie »wertvoll« und »selten« Expertenwissen jedoch ist, sind bisweilen horrende Preise zu zahlen (Rauen, 2003, 2014). In diesem Zusammenhang von Interesse ist die Tatsache, dass der Begriff des Beraters in der Regel nicht geschützt ist: Jeder kann sich selbst als einen solchen bezeichnen (Nissen, 2007). In den meisten Fällen sind Berater dabei für subjektiv schlechte Ratschläge rechtlich nicht haftbar zu machen: Eine Ausnahme hiervon stellen in Teilen die Dienstleistungen von Steuerberatern und Juristen dar (Bales, 2010). Oftmals bleibt der Coachee verantwortlich, inwiefern er die Ratschläge oder das Expertenwissen des Beraters einsetzt oder nutzt (Hörmann & Nestmann, 1988).
Im Vergleich zu Coaching liegt der Unterschied insbesondere in der Kompetenz der beratenden Person verglichen mit der des Coaches: Während von einer beratenden Person implizit Expertenwissen erwartet wird (auch wenn es bei einer Prozessberatung nicht zwangsläufig erforderlich ist), muss ein Coach nicht zwingend über umfassende Expertise in dem Gebiet des konkreten Coacheeanliegens verfügen (Jones et al., 2015; Moen & Skaalvik, 2009; Schreyögg, 2008). Zwar benötigt der Coach eine gewisse inhaltliche Erfahrung oder Feldkompetenz (Kap. 8; Schreyögg, 2012), eine umfassende Expertise, die der des Coachees überlegen ist, ist bei individuellen Coaching-Anliegen wie einer Berufs- und Lebensplanung jedoch vermutlich gar nicht möglich: Der Coachee muss die individuelle Expertise für seine persönliche Situation einbringen, der Coach kann nur eine unterstützende Rolle in dem Prozess einnehmen. Vorläufig kann demnach festgehalten werden, dass es sich bei Coaching um eine Prozessberatung handelt, in welcher der Coach den Coachee bei der persönlichen Zielerreichung und Entwicklung unterstützt (Bono et al., 2009; Jones et al., 2015; Kilburg, 1996; Smither, 2011). Demzufolge ist es korrekt, Beratung als Überbegriff zu Coaching zu verwenden, da es sich beim Coaching um eine Form der Prozessberatung handelt (Hoppe, 2013; Jonas, Mühlberger, Böhm & Esser, 2018). In der umgangssprachlichen Verwendung des Beratungsbegriffes kann es jedoch zu Missverständnissen und Problemen führen Coaching als Beratungsform zu bezeichnen, da an eine beratende Person Erwartungen gestellt werden, die dem klassischen Coaching-Begriff widersprechen.
1.2.2 Supervision
Gegenüber der Beratung nimmt Supervision eine grundsätzlich prozessorientierte Haltung ein: Während die Entstehung von Coaching aus der US-amerikanischen Unternehmenskultur schon kurz dargestellt wurde, hat sich die Supervision aus der US-amerikanischen Sozialarbeit entwickelt (Schreyögg, 2015). Eine ,,Supervisorin« oder ein »Supervisor« hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in US-amerikanischen Sozialorganisationen die Aufgabe, die Arbeit von Helferinnen und Helfern zu koordinieren, aber auch fachlich anzuleiten und zu unterstützen (Schreyögg, 2015). Heute versteht sich Supervision nicht mehr als administrative Aufgabe, sondern vielmehr als eine Unterstützung bei der anspruchsvollen Arbeit in sozialen Dienstleistungsberufen. Im Vergleich zu Coaching widmet sich Supervision daher der unterstützenden Beratung von Therapeutinnen und Therapeuten und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die ihre Arbeit mit den Coachees überprüfen, verbessern oder reflektieren wollen (Schreyögg, 2015). Bezogen auf das Beispiel aus der US-amerikanischen Sozialhilfe geht es daher bei Supervision zum einen darum, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter als Individuen zu stärken, damit sie ihrer Arbeit, der teilweise schwierigen sozialen Interaktion mit Hilfesuchenden, psychisch gewachsen sind. Dies geschah insbesondere in der Vergangenheit auch mit klassischen therapeutischen Methoden (Schreyögg, 2015). Zum anderen geht es jedoch auch darum, das berufliche System des Beschäftigten als Ganzes einzubeziehen: Gegenüber Coaching findet Supervision in der ursprünglichen Form in der Gruppe statt und greift daher auch auf die Gruppe als unterstützendes System zurück. So ist es möglich, auch von Erfahrungen aus dem Kollegium zu profitieren oder eigene Lösungsvorschläge einzubringen. Aus diesem Setting entwickelte sich Supervision von einer Intervention, die sich ausschließlich auf die Verbesserung von Interaktionen zwischen organisationsinternen mit organisationsexternen Personen beschränkte, zu einer Möglichkeit auch interne Probleme/Anliegen/Beziehungen zu bearbeiten (Schreyögg, 2015). Durch den Fokus auf Reflektion (gegenüber Instruktion) ist Supervision daher auch zu einem Mittel der Teamentwicklung geworden (Bamberg et al., 2006).
Als Supervisoren werden verschiedene Personen eingesetzt: Häufig wird hierbei auf externe Supervisorinnen und Supervisoren zurückgegriffen oder es werden organisationsintern ein Vorgesetzter oder ein Aus-/Fortbilder als Supervisor eingesetzt (Schreyögg, 2004). Wichtig aus Sicht eines Vorgesetzten (und in dieser häufig schwierig umzusetzen) ist eine Kombination aus Unabhängigkeit und vertrauensvoller Beziehung gegenüber der Supervisionsgruppe (Rauen, 2003). Eine Supervisorin oder ein Supervisor sollte darüber hinaus über entsprechende Kompetenz in den erforderlichen klinisch-psychologischen Bereichen verfügen (Schreyögg, 2015) und im besten Fall an einer fachverbandlich anerkannten Aus- oder Weiterbildung in Supervision teilgenommen haben (Bamberg et al., 2006). Insbesondere der Aspekt der erforderlichen psychologischen Fachkompetenz unterscheidet Supervision von Coaching: Auch wenn psychologisches Wissen immer wieder als besondere Kompetenz bei Coaches gefordert wird (Berglas, 2002), gehört es bei diesen doch nicht zu einem erwiesenen Erfolgsfaktor (Bono, Purpanova, Towler & Peterson, 2009). Im Gegensatz dazu stellt psychologisches Fachwissen einen grundlegenden Bestandteil von Supervision dar (vgl. Schreyögg, 2015). Jedoch handelt es sich bei Supervision, genauso wie bei Coaching, nicht um einen geschützten Begriff. Trotzdem sind viele Coaching-Weiterbildungen noch weit von dem Professionalisierungsgrad von Supervisions-Weiterbildungen entfernt.
Zusammengefasst handelt es sich bei Supervision heute um ein Beratungsformat, in dem Supervisorinnen und Supervisoren Personen bei der Selbstreflexion im Beruf unterstützen. Dabei werden Anliegen im Zusammenhang mit professionellen Beziehungen reflektiert (vgl, Jonas, Mühlberger, Böhm & Esser, im Druck).
1.2.3 Mentoring
Mentoring ist ein Konzept, welches in der Begrifflichkeit bereits auf Homers »Odyssee« zurückgeht: Hierin nimmt die Göttin Athena die Gestalt eines alten Mannes namens Mentor an, um auf diese Weise den jungen Telemachus anzuleiten und ihm durch weise Ratschläge durch eine schwierige Phase zu helfen (Schmeh, 2007). Dieses Bild beschreibt auch noch heute gut die wichtigsten Elemente von Mentoring: Die Anleitung eines unerfahreneren Beschäftigten durch einen erfahreneren und meist älteren Beschäftigten (Rauen, 2003). Der Begriff »Mentoring« erlangte größere Beliebtheit im Zuge der Veränderungen im Management in den USA der 1990er Jahre: Eine Zeit, in der auch Coaching immer beliebter wurde. Grundsätzlich sind sich Mentoring und Coaching in einigen Bereichen ähnlich: Unter beiden versteht man eine vor allem dyadische und auf persönliche Weiterentwicklung ausgerichtete Interaktion (Jones et al., 2015). Jedoch besteht die Rolle eines Mentors vor allem darin, den sogenannten »Mentee« von den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Wissen profitieren zu lassen. Ähnlich wie bereits in der dargestellten Fachberatung, weckt die Rolle des Mentors demnach die Erwartung, in den Bereichen Erfahrung und spezifischer Expertise überlegen zu sein, was für einen Coach nicht zutrifft (Jones et al., 2015). Daher verfügt ein Mentor über eine sehr hohe berufliche Expertise, insbesondere in der jeweiligen Organisation: In den meisten Fällen wird Mentoring als unternehmensinterne Intervention durchgeführt, d. h., Mentee und Mentor entstammen der gleichen Organisation. Anlass für die Bildung einer Mentoring-Beziehung ist hierbei z. B. der Eintritt des Mentees in die Organisation, ein Wechsel der Abteilung oder der Übertritt auf eine neue Hierarchieebene (vgl. Lippmann, 2013a). Zusammengefasst soll der Mentor den Eintritt/Übergang eines Mentees erleichtern, jedoch ohne dass der Mentor klassischerweise ein direkter Vorgesetzter ist. Das Beziehungsgefälle zwischen Mentor und Mentee ist dabei trotzdem sehr klar und meist auch durch eine klare Hierarchie gekennzeichnet: Der Mentor befindet sich in der Regel mindestens eine Ebene über dem Mentee, kann aber die Rolle eines vertrauten »Paten« einnehmen, da er keine direkte Weisungsbefugnis hat (Rauen, 2003). Auf diese Weise werden durch Mentoring Unterstützungsbeziehungen gebildet, die über verschiedene Hierarchieebenen funktionieren. Das Ziel von Mentoring liegt insbesondere in der Vermittlung von Normen und Regeln der Organisationskultur (Rauen, 2003): Der Mentor nimmt den Mentee »unter seine Fittiche«, führt ihn hierbei in Abläufe und Prozesse ein und macht ihn mit implizitem Wissen über die Organisation vertraut. Durch eine solche vertrauensvolle Beziehung zwischen Mentor und Mentee, soll die Integration des Mentees in die Organisation besser gelingen und eine langfristige Bindung an diese hergestellt werden (Rauen, 2003). Eine weitere Aufgabe, die teilweise von Mentoren im Rahmen ihrer Beziehungen mit den Mentees wahrgenommen wird, ist eine karrierebezogene Beratungsfunktion (Rauen, 2003) und Unterstützung bei dem Aufbau eines eigenen Netzwerkes (Lippmann, 2013a). Manche Mentoring-Beziehungen sind sogar stark davon gekennzeichnet, dass der Mentor eine steuernde Rolle in der Karriereplanung des Mentees einnimmt und versucht, seinen »Schützling« zu fördern. Dabei handelt es sich jedoch meist um Mentoring-Beziehungen, die durch eigenes Engagement des Mentors aufgenommen oder in diese Richtung entwickelt wurden. Bezüglich einer Befähigung oder Weiterbildung verfügt ein Mentor in der Regel nur über Erfahrungswissen (Lippmann, 2013a). Lediglich in manchen Mentoring-Programmen werden die Mentoren auf ihre Rolle im Rahmen von kleinen Schulungen vorbereitet. Für Unternehmen, die Mentoring einsetzen wollen, entstehen daher lediglich organisationsinterne Kosten durch die Arbeitszeit, die von den Mentoren und Mentees investiert wird (Rauen, 2003).
1.2.4 Psychotherapie
Im Gegensatz zu den bisher dargestellten Ansätzen, liegt bei der Psychotherapie der Fokus auf Personen mit schwerwiegenden persönlichen Problemen, Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Suchterkrankungen, psychisch bedingten Störungen oder anderen psychischen Erkrankungen (Greif, 2008; Schmidt-Lellek, 2015). Eine Therapie ist in diesen Fällen immer indiziert, wenn es zu subjektiven oder objektiven Beeinträchtigungen aufgrund der psychischen Störung kommt (Greif, 2008). Bezogen auf die Zielgruppe ergeben sich keine Einschränkungen: Sowohl Kinder und Jugendliche als auch Personen im hohen Alter können von psychischen Erkrankungen betroffen sein und daher spezielle Therapie in Anspruch nehmen (Lippmann, 2013a). Ziele der Psychotherapie sind im ersten Schritt die Feststellung einer Erkrankung (Diagnose) und anschließend die Heilung oder zumindest Linderung dieser Erkrankung oder derer Symptome (Lippmann, 2013a; Rauen, 2003). Da es sich bei Psychotherapie in den meisten Fällen um eine medizinisch indizierte Therapie handelt, übernehmen die Krankenkassen in der Regel zumindest einen Teil der Behandlungskosten, sofern es sich um Therapieformen und Therapeuten handelt, die unter das »Psychotherapeutengesetz« fallen und somit abrechenbar sind (vgl. PsychThG, 1998, § 12). Als Kostenträger nehmen die Krankenkassen daher oftmals indirekt Einfluss auf die Dauer der Therapie (Lippmann, 2013a). Auf Grund der gesetzlichen Regelung für Psychotherapeuten ist der Professionalisierungsgrad von Psychotherapie sehr hoch: Die Rahmenbedingungen der beruflichen Ausbildung sowie der Berufsausübung sind gesetzlich detailliert geregelt (Greif, 2008). Als Psychotherapeuten dürfen sich demnach nur approbierte psychologische Psychotherapeutinnen und psychologische Psychotherapeuten oder ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bezeichnen (vgl. PsychThG, 1998, § 1). »Psychotherapie« dürfen jedoch auch Psychologen oder Heilpraktiker im Rahmen des »Heilpraktikergesetzes« ausüben (vgl. PsychThG, 1998, § 1). Diese Form der Therapie ist nicht ganz so streng geregelt, wird jedoch auch von vielen gesetzlichen Krankenkassen nicht erstattet. Die Beziehung zwischen Patient und Therapeut steht ganz im Zeichen des Vertrauens: der Patient soll sich verstanden fühlen und offen über seine Erkrankung sprechen können (Schnoor, 2006). Diese vermittelte Sicherheit ist extrem wichtig, da oftmals eine psychische Erkrankung als Stigma wahrgenommen wird (vgl. Holm-Hadulla, 2000). Dementsprechend ist Psychotherapie in den meisten Fällen freiwillig (Schnoor, 2006) und die »Therapiebereitschaft« eines Patienten wird als Vorrausetzung für langfristigen Therapieerfolg angesehen (vgl. Schnoor, 2006).
An diesem Punkt ist eine Parallele zum Coaching erkennbar: Auch beim Coaching wird die Bereitschaft des Coachees, an dem Coaching teilzunehmen und an sich zu arbeiten, als Voraussetzung für einen erfolgreichen Prozess verstanden (vgl. Rauen, 2003; Schmidt-Lellek, 2015). Auch wenn es sowohl bei Therapie als auch bei Coaching zu »Verordnungen« kommen kann (im ersten Fall von einem Arzt, im zweiten Fall von einem Vorgesetzten), sind solche »erzwungenen« Prozesse sehr viel schwieriger und versprechen geringere Aussichten auf Erfolg.
Psychotherapie blickt auf eine lange Tradition zurück: Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich Therapieformen, die noch heute in der täglichen Praxis angewendet werden (Schmidbauer, 2012). Auf Grund des starken öffentlichen Drucks von Krankenkassen und Gesetzgebern werden diese Therapieformen jedoch auch eingehend beforscht: Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Interventionen (Coaching, Beratung, Supervision, Mediation) gelten Methoden im Bereich der Psychotherapie als sehr gut evaluiert und Theorien als empirisch überprüft (Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie, 2014). Aus diesem Grund haben viele Theorien die Entwicklung neuer Interventionen beeinflusst (zu Coaching Kap. 2) oder konkrete Methoden wurden für andere Bereiche adaptiert (beispielsweise im Bereich der Supervision: siehe Schreyögg, 2015). Als ein Beispiel kann hierbei auf die Gesprächspsychotherapie nach Rogers (1972) verwiesen werden: Diese Form der Therapie hat eine Therapeutenhaltung (bspw. Wertschätzung gegenüber dem Coachee) und verschiedene Gesprächstechniken (bspw. empathisches Verhalten) geprägt, die heute in verschiedenen Interventionen zu finden sind (Kap. 2.1). Heute wird diese gegenseitige Beeinflussung auch von Coaches weitergeführt, die sowohl als Coach arbeiten, als auch über eine Ausbildung zum Psychotherapeuten verfügen (vgl. Bono et al., 2009).
1.2.5 Mediation
Eine Mediation kann grundsätzlich zur Anwendung kommen, um Konflikte zwischen Konfliktparteien zu schlichten (Steinebach, 2006). Bei diesen Konfliktparteien kann es sich sowohl um Personen als auch um Gruppen oder Organisationen handeln. Mediationen finden immer wieder den Weg in das öffentliche Bewusstsein, wenn sie bei Konflikten öffentlicher Interessen als letzte Möglichkeit zu einer gütlichen Einigung genutzt werden. Ein Beispiel, welches großes öffentliches Interesse ausgelöst hat, ist beispielsweise das Mediationsverfahren zum Ausbau des Frankfurter Flughafens (Meister & Gohl, 2004).
Eine Mediation kommt insbesondere bei festgefahrenen Konfliktsituationen zum Einsatz, wenn bisherige Lösungsversuche gescheitert sind (Steinebach, 2006). Wie in dem Beispiel bereits deutlich wurde, können die Themen eines solchen Konfliktes stark variieren: Häufig eingesetzt werden Mediatoren bei Familien-, Ehe- oder Mietstreitigkeiten, aber auch im wirtschaftlichen oder beruflichen Zusammenhang (Steinebach, 2006) oder bei Auseinandersetzungen zwischen politischen Konfliktparteien (bspw. Kommunen). Ziel soll hierbei immer sein, die außergerichtliche Beilegung eines Konflikts zu erreichen (Heyse et al., 2012; Steinebach, 2006). Daher ist es nicht verwunderlich, dass Mediationen häufig von Gerichten vorgeschlagen werden, um ein langwieriges Verfahren zu vermeiden und eine Lösung zu generieren, die von allen Konfliktparteien getragen wird (Heyse et al., 2012). Jedoch basiert eine Mediation immer auf der Freiwilligkeit aller Beteiligten, die sich bereit erklären müssen, die Mediation zu durchlaufen und das Ergebnis anzuerkennen (Heyse et al., 2012). Die Stärken der Mediation liegen hierbei auch darin, dass die Lösungen von den Parteien in der Regel mit entwickelt werden: Die Mediatoren sind unbeteiligte Personen, die jedoch von allen Parteien respektiert und in ihrer Rolle anerkannt wurden und den Konfliktlöseprozess steuern (Steinebach, 2006). Die Rolle eines Mediators umfasst im engeren Sinne vor allem strukturierende und moderierende Tätigkeiten im Mediationsprozess. Da die Konfliktparteien in einer Mediation gemeinsam »an einem Tisch sitzen«, kann diese auch stark belastete Beziehungen zwischen Konfliktparteien wieder entspannen. Daher wird eine Mediation insbesondere bei Familienstreitigkeiten oftmals einer gerichtlichen Entscheidung vorgezogen. Der Mediator hat in dem Verfahren der Mediation nur begrenzte Macht (Steinebach, 2006): In seiner Rolle verfügt er über keine Entscheidungsbefugnis, sondern lediglich über die Befugnis zur Verfahrenssteuerung (Heyse, Kreuser & Robrecht, 2012). Um eine Lösung zu ermöglichen, muss der Mediator während des gesamten Verfahrens seine Neutralität bewahren, um die Anerkennung der Konfliktparteien nicht zu verlieren (Steinebach, 2006). Ein Mediator wird nicht nur keine Entscheidungen treffen, er wird auch keine Empfehlungen und keine Kompromissvorschläge unterbreiten (im Gegensatz zu einer Schlichtung). Ohne die Mitarbeit und Zustimmung beider Konfliktparteien werden demnach keine verbindlichen Entscheidungen gefällt.
Seit der Entstehung von Mediation in den 1980er Jahren in den USA haben sich zahlreiche Berufs- und Interessensverbände für Mediation gebildet (Robrecht, 2012). Auch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind in diesem Zuge entstanden (vgl. Robrecht, 2012). Grundsätzlich ist die Bezeichnung »Mediator« jedoch nicht geschützt (Steinebach, 2006): Da die Anerkennung durch alle Konfliktparteien gegeben sein muss, handelt es sich daher –insbesondere bei öffentlichkeitswirksamen Mediationen – oftmals um Juristen, Gewerkschafter oder ehemalige Politiker. Von allen vorgestellten Interventionen sind die Zusammenhänge zwischen Mediation und Coaching wahrscheinlich am geringsten: Außer der Freiwilligkeit der Teilnehmenden, der ungeschützten Berufsbezeichnung und der aktuellen Ausbildungssituation gibt es wenig Gemeinsamkeiten. Mediation ist ausschließlich für den Bereich der Konfliktschlichtung gedacht, während sich Coaching im weitesten Sinne auf die individuelle Weiterentwicklung fokussiert. Die Begrifflichkeit »Konflikt-Coaching« ist demnach auch nicht mit einer Mediation zu verwechseln, da im Konflikt-Coaching nur mit einer einzelnen Konfliktpartei gearbeitet wird, um diese optimal durch den Konfliktprozess zu führen und individuell zu unterstützen. Für beide Interventionen gilt jedoch oftmals der Grundsatz »je früher, desto besser« aber auch »lieber spät als nie«, wenn die Entscheidung zu treffen ist, wann ein Einsatz sinnvoll ist.
1.2.6 Training
Training ist eine der meistgenutzten Interventionen im organisationalen Kontext, um einen gezielten Auf- und Ausbau fachspezifischer Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu erreichen (Lippmann, 2013a). Es wird im Gruppenkontext durchgeführt und ist daher sehr kosteneffizient. Trainings werden zu verschiedensten Themengebieten durchgeführt, weshalb es keine vordefinierte Zielgruppe gibt (Rauen, 2003): Fast jede berufstätige Person hat bereits an einer Trainingsmaßnahme teilgenommen. Im organisationalen Kontext kann in diesem Zusammenhang zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Trainingsmaßnahmen unterschieden werden: Zum einen können Trainings genutzt werden, um neues Wissen (beispielsweise die Benutzung einer neuen Software) an alle Beschäftigten weiterzugeben. Darüber hinaus kann jedoch auch ein individueller Trainingsbedarf durch die Führungskraft erkannt und daher »verordnet« werden. Als letzte Möglichkeit gibt es auch im organisationalen Kontext freie Trainingsangebote, die nach Bedarf und daher freiwillig belegt werden können (Curado, Henriques & Ribeiro, 2015). Unterschiede in der Freiwilligkeit können sich dementsprechend stark auf die Motivation der Teilnehmenden und damit auch auf den Erfolg des Trainings auswirken (Curado, Henriques & Ribeiro, 2015). Erfolg wird in diesem Zusammenhang meist mit »Trainingstransfer« übersetzt: Das Ausmaß, in dem eine Trainingsteilnehme Person im Anschluss an ein Training die gelernten Inhalte umsetzt. Auf Grund der Häufigkeit von Trainings und der damit verbundenen hohen Kosten, hat sich in den letzten Jahren ein großer Forschungsstrang entwickelt, der sich ausschließlich mit Transferfaktoren im Trainingskontext auseinandersetzt (für eine Übersicht siehe Kauffeld, 2016). Der Erfolg von Trainingsmaßnahmen hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, von denen der Trainer einen darstellt. Obwohl es zahlreiche Traineraus- und -weiterbildungen gibt (vgl. Kauffeld, 2016), ist der Begriff »Trainer« als solcher nicht geschützt. Zwar gibt es in verschiedenen Bereichen (insbesondere im Sportbereich) verstärkt Bemühungen Ausbildungsstandards festzuschreiben, jedoch können die meisten »Trainerbezeichnungen« von jedem getragen werden. Da das grundsätzliche Ziel von Trainings ist, Verhaltens- oder Wissensdefizite abzubauen (Rauen, 2003), hat der Trainer (ähnlich wie der Fachberater) eine Rolle als Expert/in/e: Als Anleiter und Moderator führt ein/e Trainer/in durch eine – zeitlich immer begrenzte – Trainingsmaßnahme und gibt hierbei Input, leitet Übungssequenzen an (Rauen, 2003) und gibt ggf. Feedback (Lippmann, 2013a). Trotz seiner Expertenrolle, sollte hierbei das Beziehungsgefälle zwischen Teilnehmendem und Trainer möglichst gering gehalten werden (Lippmann, 2013a).