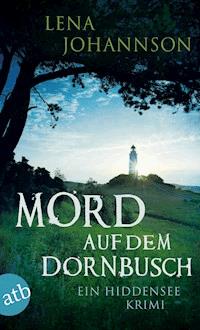3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe
- Sprache: Deutsch
»Mode ist vergänglich. Stil niemals.« Coco Chanel.
Die junge Gabrielle Chanel hat große Träume. Sie probiert sich aus, wird zu Coco, der Durchbruch bleibt jedoch zunächst aus. Dann lernt sie Boy Capel kennen und mit ihm die Liebe. Mit seiner Hilfe eröffnet sie ein Modehaus und besinnt sich schließlich auf ihr größtes Talent – ihren ganz eigenen Stil. Schon bald begeistern ihre Entwürfe die Frauen von Paris. Doch erweist Boy sich tatsächlich als der Mann, der sie darin unterstützt, die Modewelt zu revolutionieren?
Der große Roman von Bestsellerautorin Lena Johannson über die Gründung des Modeimperiums von Coco Chanel und die Liebe ihres Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Chanel Modes« so lautet der verheißungsvolle Name auf dem Schild neben Gabrielles erstem eigenen Ladengeschäft in Paris. Die junge Frau, die als Waisenkind aufgewachsen ist, hat hart dafür gearbeitet und sich mit ihren exklusiven Hutmodellen einen Namen gemacht. Doch um es mit ihrer einzigartigen Modekollektion nach ganz oben zu schaffen, muss sie kämpfen. Und sie träumt von einer Zukunft an der Seite ihres Geliebten Boy Capel. Aber ist er der Mann, der sie darin unterstützen wird, die Welt der Couture zu erobern?
Über Lena Johannson
Lena Johannson, 1967 in Reinbek bei Hamburg geboren, war Buchhändlerin, bevor sie als Reisejournalistin ihre beiden Leidenschaften Schreiben und Reisen verbinden konnte. Sie lebt als freie Autorin an der Ostsee.Im Aufbau Taschenbuch sind u. a. die Bände ihrer Nord-Ostsee-Saga: »Zwischen den Meeren«, »Nach den Gezeiten«, »Im Jahr der Flut« und der Roman »Die Malerin des Nordlichts« lieferbar.
Mehr zur Autorin unter lena-johannson.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lena Johannson
Coco und die Revolution der Mode
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Februar 1895, Brive-la-Gaillarde
Vier Jahre später: Aubazine und Moulins, Sommer 1900
Moulins 1901
Moulins 1903
Moulins 1904
Moulins 1905
Vichy 1905
Moulins 1906
Royallieu in Compiègne, Sommer 1906
Royallieu 1907
Royallieu 1908
Paris 1909
Paris Ende 1910
Deauville 1913
Deauville 1914
Paris 1915
Anhang
Dankeschön!
Quellen
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Februar 1895, Brive-la-Gaillarde
Gabrielle zog die Strickjacke fest um den schmalen Körper. Viel zu große Maschen, mehr Löcher als wärmende Wolle. Sie sollte für die Mutter Kernseife besorgen. Eine Aufgabe, die Gabrielle aus zwei Gründen gern übernommen hatte. Zum einen war ihr alles recht, um an die frische Luft zu kommen und durch die Straßen von Brive-la-Gaillarde zu streifen. Noch wichtiger war ihr alles, womit sie ihrer Mutter das Leben ein bisschen leichter machen konnte. Maman sah schlimm aus, wie ein Gespenst. Von Tag zu Tag keuchte sie schrecklicher, in letzter Zeit fiel sie sogar immer öfter einfach um.
»Weil sie keine Luft kriegt, wird sie ohnmächtig«, hatte eine Nachbarin gesagt, eine Blumenverkäuferin, die Gabrielle um ihre Mütze und das dicke Schultertuch beneidete. »Sie ist aber auch ein mageres Rippgestell. Wird Zeit, dass sie mal was auf die Hüften kriegt, nicht immer nur einen dicken Bauch.«
Gabrielle passierte das riesige Gebäude aus großen hellen Steinen, die von Weitem rau wie Bimsstein aussahen. Keiner hatte die gleiche Größe wie ein anderer, trotzdem wirkten die Mauern akkurat. Um die Fenster herum waren dunklere Quader verbaut. Gabrielle gefiel dieses Haus sehr gut, es wirkte schlicht und doch gleichermaßen elegant. Sie kam nicht oft hier vorbei, aber jedes Mal fragte sie sich, wer hier wohl wohnen mochte. Das musste ein sehr reicher Mann sein. Das Gebäude war riesig und hatte in der Mitte sogar einen dreistöckigen Turm.
»Wie ein Schloss«, flüsterte sie und riss sich schweren Herzens von dem Anblick los. Sie musste weiter, den in Papier gewickelten Block Seife abliefern, doch sie wollte noch nicht zurück in das stinkende düstere Armenviertel. Sobald sie zur Tür hereinkäme, würde ihre Mutter ihr das Päckchen abnehmen und sich daran machen, den Holzboden im Gastraum zu scheuern und die Wäsche zu waschen. Gabrielle beschloss, ihren Freunden einen Besuch abzustatten, ehe sie nach Hause ging. So lange konnte sich ihre Mutter noch ein wenig beim Sockenstopfen oder ähnlich leichten Tätigkeiten ausruhen. Der Weg zum Friedhof war nicht weit. Am liebsten war Gabrielle im Frühjahr dort, weil es dann überall blühte und nach Rosen und Jasmin duftete. Allerdings waren im Winter weniger Menschen da, und Gabrielle hatte ihre Freunde für sich. So war es auch an diesem frostig-windigen Februartag.
»Bonjour!« Sie hatte das namenlose Grab erreicht, das ihr das liebste unter allen Gräbern war. Kaum zu sehen war es zwischen den knorrigen Zweigen zweier Rotdornsträucher. »Es ist niemand gekommen, sie zu schneiden.« Sie lächelte fröhlich. »Natürlich nicht, würde ich auch nicht machen, da reißt man sich nur die Haut auf.« Sie schob mit dem Schuh gelbes Laub von der verwitterten Steinplatte, das leise knisterte. »Denk nur nicht, ich hätte Angst vor ein paar Kratzern.« Gabrielle richtete sich auf und streckte den Rücken durch. »Aber eine feine Dame hat eben auch eine feine Haut. Und ich werde einmal eine feine Dame sein.« Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. Beinahe wäre ihr die Seife aus der Zeitung gerutscht. »Du lachst doch nicht etwa?« Sie setzte eine strenge Miene auf, kicherte und schlenderte über den hart gefrorenen Sandweg zwischen steinernen Kreuzen, niedrigen Büschen und Grabmälern hindurch. »Ich drehe meine Runde«, erklärte sie, als erwartete einer der Toten eine Erklärung für ihr seltsames Tun. Ein Mädchen von elf Jahren, das über einen Friedhof spazierte, würde man wohl als seltsam bezeichnen, das war ihr bewusst. Obendrein, weil sie hier niemanden kannte. Gabrielle genoss es. Sie fühlte sich nicht allein und war es doch auf angenehme Weise. Welchen Namen sie auch immer mühsam entzifferte, nie wurde ihr das Herz schwer, niemanden musste sie beweinen. Sie konnte sich in aller Ruhe ihren Träumen hingeben, die sie sonst niemandem anvertrauen konnte, wenn sie nicht ausgelacht werden wollte. In jeder freien Minute malte sie sich aus, wie ihr Leben als Erwachsene aussehen würde. Eigene Entscheidungen treffen, dahin gehen, wo es ihr gefiel, ein Ehemann, der nicht ständig fort war. Feine Damen fanden auch feine Herren. Sie würde später einmal reich sein. Reich und berühmt. Davon war sie zutiefst überzeugt, obgleich ihr natürlich bewusst war, dass sie die Einzige war, die daran glaubte. Gabrielle blieb an einem steinernen Häuschen mit einer eisernen Pforte stehen, dem Eingang zu einer Familiengruft.
»Wozu soll die Tür gut sein? Ihr bekommt doch niemals Besuch.« Sie zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf. Wer sich eine solche Grabstätte mit einem verschnörkelten Tor leisten konnte, das niemand brauchte, wie viel Geld musste er besessen haben! Ihr Magen knurrte. Wenn sie endlich erwachsen und stinkreich war, dann hätten alle immer reichlich zu essen, sogar Schokolade im Überfluss. Sie würde ihrer Mutter die schönsten Kleider kaufen, die in der Stadt zu finden waren. Mutter bräuchte nie wieder einen Finger zu krümmen.
»Ein eigenes Pferd werde ich auch haben. Reiten kann ich lernen«, murmelte sie leise vor sich hin. »Das habe ich gesehen, als ich noch klein war. Sah nicht schwer aus. Und überhaupt, es gibt nichts, was man nicht lernen kann.«
Ihre Runde näherte sich dem Ende, Gabrielle war zurück in dem Teil des Friedhofs, auf dem die Parzellen klein waren und dicht nebeneinanderlagen. Im Tod wie im Leben, ging ihr durch den Kopf. Der Mann, dem das große Haus mit dem dreistöckigen Turm gehörte, würde auch ein prunkvolles Grab haben. Der, dessen Überreste unter der von Flechten überzogenen Steinplatte zu ihren Füßen vermoderten, dürfte auch zu Lebzeiten nur das Nötigste gehabt haben. Wenn sie einmal tot war, würde eine sehr große Granitplatte an Gabrielle erinnern. Und eine Bank wünschte sie sich, damit Menschen, die gern ein wenig mit den Toten plauderten, sich bei ihr ausruhen konnten. Aber davor lag ja noch ihr Leben! Und das sollte prachtvoll sein, nicht so erbärmlich wie das ihrer Mutter. Ständig musste sie hinter den Körben voller Leibchen, Küchenschürzen, Arbeitszeug und Kurzwaren auf dem Boden hocken, weil es nicht einmal für einen hübschen Marktstand reichte. Gabrielle kannte ihre Mutter eigentlich nur schwer arbeitend. Wenn sie mal nicht auf allen vieren schuftete oder die Waren ihres Mannes feilbot, lag sie im Kindbett. Zuletzt war Augustin auf die Welt gekommen. Es schien ihm nicht sonderlich gefallen zu haben, denn er war gleich wieder gestorben.
»Ich muss gehen.« Sie umklammerte die Seife. »Bis zum nächsten Mal!« Sie winkte dem eingewachsenen Grab flüchtig zu, ehe sie den Friedhof hinter sich ließ.
Auf dem Heimweg begleiteten sie das Klacken der Sohlen vorübergehender Soldaten, das Klingeln der Sporen der Herren Offiziere und das hohle Klopfen der Hufe auf Kopfsteinpflaster. Dunkle Wolken jagten über den grauen Himmel. Eine Gänsehaut ließ Gabrielle schaudern. Sie beschleunigte ihre Schritte immer mehr und sehnte sich mit einem Schlag nach der Geborgenheit bei Onkel Augustin in Courpière. Dort, inmitten der weitläufigen Natur, war alles hell und warm und leicht gewesen. Und die Vögel hatten immer gezwitschert. Obwohl sie wusste, dass im Gasthaus in der Avenue d’Alsace-Lorraine, wo sie mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern in einer muffigen Kammer lebte, weder Leichtigkeit noch Wärme auf sie warteten, war sie froh, als sie den Hintereingang erreichte. Sie betrat die Kaschemme und lief die ausgetretene Stiege nach oben.
»Ich bin wieder da!«, rief sie schon, ehe sie die Tür zur Kammer öffnete. Keine Antwort. »Maman? Julia? Antoinette?« Wieder nichts. Allmählich gewöhnten sich ihre Augen an das wenige Licht. Über den zwei schmalen Betten, die sie sich zu viert teilten, lagen glatt gestrichen die vergilbten Überdecken, Schuhe standen in Reih und Glied darunter. In allen Ecken des Zimmers tummelten sich Gegenstände, Koffer, Töpfe, eine Vase, der ein Henkel fehlte, Geschirr, Bettwäsche zum Wechseln und weitere Habseligkeiten, trotzdem wirkte der Raum aufgeräumt.
»Wer wenig Platz hat, muss ordentlich sein«, predigte Mutter ihnen stets.
Es war so kalt, dass Gabrielle rasch prüfte, ob das Fenster hinter den dicken Vorhängen geschlossen war. Sie seufzte. Wenn der Kerl, dem die Wirtschaft gehörte, doch endlich etwas gegen den schrecklichen Durchzug unternehmen würde. Sie packte sich kurzerhand einen Ersatzbettbezug und stopfte ihn in die Ritzen, ehe sie sich sonst noch den Tod holten. Wo mochten nur alle sein? Für eine Sekunde leuchtete in ihrer Phantasie ein Bild auf: Ihr Vater war zurück, hatte endlich gute Geschäfte machen können, so dass sein Geldbeutel prall gefüllt war. Gabrielle sah ihn vor sich, mit Mutter und ihren Schwestern an einem Tisch unten im Gastraum, vor ihnen große Teller mit Bergen aus dampfendem Fleisch und Gemüse. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Eilig ließ sie die Kammer hinter sich und lief wieder hinunter, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Doch auch in dem kleinen Lokal war niemand, die Stühle standen verkehrt herum auf den Tischen.
»Als ob ich mich gefreut hätte, Papa zu sehen«, flüsterte sie. »Als ob er jemals Geld nach Hause bringen würde.« Wenn sie schon mal hier unten war, konnte sie nachschauen, ob der Wirt auf dem Tresen oder in der Küche etwas vergessen hatte, das sie rasch zwischen ihren Lippen verschwinden lassen konnte. Nichts, nicht einmal ein vertrockneter Kanten Brot lag im Schankraum herum. Gabrielle prüfte die Tür zur Küche. Sie hatte Glück, es war nicht abgeschlossen. Sie öffnete. Der schwache Lichtschein, der in den fensterlosen Raum fiel, traf auf zwei Schuhe, die Sohlen zu Gabrielle gerichtet, aus denen bleiche Knöchel ragten, darüber ein Rocksaum. Gabrielle schrie auf.
»Maman!« In drei Schritten war sie neben dem leblosen Körper ihrer Mutter und ließ sich auf die Knie fallen. Scharfe Kanten der rauen Ziegelsteine bohrten sich durch den Stoff ihres Kleides. »Ich habe die Seife besorgt, um die du mich gebeten hast. Hörst du?« Es war nicht richtig, dass ihre Mutter auf dem kalten harten Boden lag. Bestimmt war sie wieder ohnmächtig geworden, weil ihr die Luft ausgegangen war. Vielleicht schlief sie auch einfach nur vor lauter Erschöpfung, weil sie immer viel zu viel arbeitete. »Bitte, kannst du nicht wenigstens kurz zwinkern?« Gabrielles Stimme wurde dünn. Sie hatte einmal gesehen, wie jemand prüfend eine Hand an den Hals eines alten Mannes gelegt hatte, der mitten auf dem Markt zusammengebrochen war. Dummerweise hatte sie keinen Schimmer, wofür das gut gewesen war. Trotzdem berührte sie behutsam die Haut ihrer Mutter und erschrak. Wie kalt sie sich anfühlte. Viel zu kalt.
»Du musst unbedingt aufstehen, sonst hustest du am Ende nur noch mehr. Bitte, Maman, sag doch, was ich tun soll!« Ihre Mutter regte sich noch immer nicht. Plötzlich fiel Gabrielle auf, dass das von unzähligen Stunden auf dem Markt sonnengebräunte Gesicht ihrer Mutter blass war. Es sah ihr zwar noch ähnlich, hatte sich aber verändert. Wo war das sanfte Lächeln hin, wo die Lebendigkeit? »Du musst aufstehen«, erklärte sie bestimmt, wischte sich mit dem Ärmel über ihre nassen Wangen und kam selbst wieder auf die Füße. »Los, du stehst jetzt auf! Ich helfe dir.« Sie packte einen Arm, unterdrückte das Grauen, das in ihr aufstieg und zog mit aller Kraft. Der Oberkörper ihrer Mutter hob sich ein wenig vom Steinboden. Mehr brachte Gabrielle nicht zustande. Ihre Mutter gab sich aber auch gar keine Mühe, ihr zu helfen. Sie rührte sich kein bisschen.
»Allein schaffe ich das nicht«, schluchzte Gabrielle und ließ den Körper behutsam zurücksinken. Eine Weile stand sie nur so da, den Arm noch immer in ihren Händen. Mit einem Mal stieß sie auch ihn zurück zu Boden. »Wenn du mir nicht hilfst, kann ich dir auch nicht helfen«, schrie sie.
»Gabrielle?« Julias Stimme ließ sie herumfahren. Ihre Schwestern standen an der Küchentür und starrten auf die Füße ihrer Mutter.
»Sie ist tot«, flüsterte Gabrielle.
»So hat es irgendwann kommen müssen«, sagte der Gastwirt mit belegter Stimme, den das Weinen und Klagen der Mädchen in die Küche gerufen hatte. »Es ist ein Jammer.« Er tätschelte ihnen ein wenig unbeholfen die Schultern. »Ich werde eurem Vater Bescheid geben, damit er euch holt.«
»Wohin dieses Mal?«, wollte Julia leise wissen und wischte sich einen Tropfen von der Nase. Antoinette, die Jüngste von ihnen, sagte kein Wort.
»Zurück nach Courpière?« Gabrielle spürte einen Funken Hoffnung. Ihr Lieblingsbruder Alphonse und Lucien, der Kleinste, waren dort bei Onkel Augustin. Es wäre schön, wenn sie wieder alle zusammen sein könnten.
»Vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist Sache eures Vaters.« Er räusperte sich. »Hier könnt ihr jedenfalls nicht bleiben.« Gabrielle bekam es mit der Angst zu tun, und auch Julia riss entsetzt die Augen auf. »Für heute Nacht schon noch«, beschwichtigte er sie, »aber ihr müsst so schnell wie möglich verschwinden. Tut mir leid. Ich habe eurem Vater das Zimmer gegeben, weil er als Kellner für mich arbeiten wollte. Und wo ist er? Ständig unterwegs. Wäre eure Mutter nicht für ihn eingesprungen und hätte klaglos alle Aufgaben übernommen, die ich ihr gegeben habe, wärt ihr schon lange nicht mehr hier.« Er legte einen großen Putzlappen über ihr bleiches Gesicht. »So eine fleißige Frau, es ist wirklich ein Jammer!«
Nachdem er ihnen versichert hatte, sich um die Formalitäten und den Leichnam zu kümmern, waren die drei Schwestern die Treppen hinaufgeschlichen und hatten sich zusammen in ein Bett gelegt. Sie schmiegten sich dicht aneinander, um sich zu wärmen und zu trösten.
»Was nun wohl aus uns wird?«, fragte Julia in die Dunkelheit. »Glaubst du, Papa bleibt jetzt bei uns?«
»Nein!« Gabrielle schluckte. Weder konnte sie sich das vorstellen, noch wollte sie es. »Wir werden alle bei Onkel Augustin leben, denke ich. Das hoffe ich«, setzte sie leise hinzu.
»Ist mir egal, wo wir wohnen«, brummte Antoinette, »Hauptsache, es ist besser als hier.«
Gabrielle lag lange wach. Immer, wenn der Schlaf sich ihrer endlich annehmen wollte, schüttelte ein heftiges Schluchzen Julia, und Gabrielle streichelte ihr tröstend über das Haar. Oder Antoinette wälzte sich im Traum herum und verpasste Gabrielle einen Tritt. Während sie so dalag, kam ihr plötzlich in den Sinn, was der Wirt zu ihnen gesagt hatte. Er wollte Vater Bescheid geben. Dann wusste er also, was ihrer Mutter stets verborgen geblieben war, er wusste, wo sich ihr Vater herumtrieb.
Albert Chanel ließ nicht lange auf sich warten. Von Traurigkeit oder Bestürzung keine Spur. Im Gegenteil, er schien Gabrielle seltsam erleichtert zu sein, als er sie aufforderte, die Kammer auszuräumen und sauber zu hinterlassen.
»Ich habe auf dem Markt zu tun. Kann es mir nicht leisten, auf die Einnahmen zu verzichten. Heute Abend bin ich zurück, dann geht’s los.«
»Bringst du uns nach Courpière?« Gabrielle sah ihn an.
»Nein, ihr kommt nach Aubazine.« Das war alles. Kein Wort der Erklärung. Als wüsste sie, was das zu bedeuten hatte.
»Vielleicht lebt dort ein anderer Onkel«, meinte Julia, als Gabrielle ihr davon erzählte, und machte sich daran, ihr Hab und Gut in die paar Säcke und zwei Kisten zu packen, die ihr Vater ihnen hingestellt hatte. »Oder eine freundliche Tante.«
»Wer’s glaubt …«, meinte Antoinette missmutig.
In Aubazine wartete kein weiterer Verwandter der unüberschaubar großen Familie Chanel auf sie, den sie bisher noch nicht kennengelernt hatten. Gabrielle begriff, was ihr Vater vorhatte, als sie sich Besen, Feudel und Eimer vom Wirt holte und beiläufig erwähnte, wohin sie aufbrechen würden.
»Da gibt es ein altes Kloster«, verriet er ihr. »Darin ist das größte Waisenhaus der Umgebung untergebracht.« Auf seinen Lippen erschien ein Lächeln. »Ein guter Ort, da gibt es viele Rotznasen in eurem Alter. Da seid ihr nicht allein.«
Waisenkinder. Das Wort heftete sich an ihre Fersen. Es folgte ihr die Stiege hinauf, wich ihr nicht von der Seite, während sie die Kammer ausfegte und putzte und stieg mit ihr in den einfachen Karren, der sich in den Abendstunden quietschend in Bewegung setzte. Raus aus der Avenue d’Alsace-Lorraine, fort von Brive-la-Gaillarde. Sie rumpelten über Kopfsteinpflaster immer tiefer in den Wald hinein. Anfangs kamen sie noch einigermaßen schnell voran, doch die beiden Gäule waren rasch erschöpft. Da konnte Vater noch so sehr fluchen und auf sie eindreschen, es half alles nichts. Er musste hinnehmen, dass sie sich behäbig die Hügel hinaufquälten. Julia und Antoinette sagten kein Wort, und auch Gabrielle schwieg. Drei Waisenkinder, die ihrem Schicksal entgegenholperten.
»Nein«, schrie es in Gabrielle, »wir sind keine Waisen. Wir haben Papa!« Was hatte es zu bedeuten, wenn der eigene Vater einen ins Waisenhaus brachte? Sobald sich die Antwort anschlich, schossen Gabrielle Tränen in die Augen, ein Kloß machte ihr die Kehle eng.
Da hörte sie mit einem Mal die Stimme ihrer Mutter, so deutlich, dass sie sich erschrocken umblickte: »Ich wollte unbedingt, dass du Gabrielle heißt. Weißt du, was dein Name bedeutet?«
»Bedeutet? Es ist nur ein Name.« Sie zuckte hilflos mit den Schultern.
»Was hast du gesagt?« Julia runzelte die Stirn.
»Nichts. Ich habe nur an etwas gedacht.«
»Sie führt mal wieder Selbstgespräche.« Antoinettes Ton ließ keinen Zweifel daran zu, wie seltsam sie Gabrielles Angewohnheit fand.
Gabrielle ging nicht darauf ein. Die Erinnerung stand ihr allzu lebhaft vor Augen. Es war lange her, dass Maman sanft den Kopf geschüttelt und erklärt hatte: »Es ist viel mehr, mein Kind. Dein Name steht für Stärke und Kraft.«
Gabrielle musste also stark sein, sie musste beweisen, dass ihre Mutter sich nicht getäuscht, sondern ihr den passenden Namen ausgesucht hatte.
Nach etwa drei Stunden schälte sich auf der Bergspitze vor ihnen die Silhouette des Klosters aus dem fahlen Mondlicht. Der Anblick hatte nichts mit dem hellen strahlenden Märchenschloss aus Brive-la-Gaillarde gemeinsam. Der Bau wirkte bedrohlich und ließ Gabrielle an einen Kerker denken. Sie stellte sich vor, er wäre ein Ungeheuer, das sie mit Haut und Haar verschlucken würde. Sie würde sich darin auflösen und aus nichts mehr bestehen als aus lauter Schwarz. Vielleicht landete sie aber auch in einer Gruft oder unter einer moosbewachsenen verwitterten Steinplatte, oder sie sah dort sogar ihre Mutter wieder. Nur noch eine Kurve, dann brachte Vater die Pferde mit ruppigem Ziehen an den Zügeln zum Stehen. Er sprang vom Wagen, schnappte sich den alten Lederkoffer, der notdürftig von einem Gürtel zusammengehalten wurde, und ging ohne ein Wort vorweg auf das Portal zu. Die Mädchen folgten ihm Schulter an Schulter. Er zog an einem Seil, irgendwo über ihren Köpfen läutete eine Glocke. Gabrielle wusste nicht, was sie sich wünschen sollte. Dass niemand da war? Aber wohin dann? Dass jemand sie hereinließ? Die Geduld ihres Vaters war sehr begrenzt. Er griff bereits erneut nach der Klingelschnur, als sich mit einem kratzenden Geräusch die Abdeckung eines quadratischen Fensterchens im Holz zur Seite schob und gleich wieder schloss. Kurz darauf öffnete sich die schwere Holztür und fiel, nachdem alle vier eingetreten waren, krachend hinter ihnen ins Schloss. Im Schein der Laterne, die die Nonne vor sich hielt, erkannte Gabrielle deren schwarzes Gewand, einen schwarzen Schleier und den Streifen einer weißen Haube, die ihre Haare verbarg. Um sie herum nur nackte Steinwände. Die Ordensschwester blickte missmutig auf die späten Gäste.
»Mein Name ist Albert Chanel. Ich habe Ihnen eine Nachricht geschickt«, erklärte Vater.
»Sie bringen Ihre Kinder mitten in der Nacht her?« Der Ton sagte mehr als jedes ihrer Worte. »Haben sie wenigstens schon zu Abend gegessen?«
Sie hatte ihren Satz kaum beendet, als Gabrielles Magen laut knurrte. Julia kicherte kurz, wurde aber sofort wieder stumm. Sie war völlig durcheinander und übermüdet. Die Nonne schüttelte den Kopf und seufzte.
Vater stellte den Koffer ab.
»Tja, ich muss dann auch … Macht keinen Ärger!«, sagte er, drehte sich um und ging. Die schwere Eingangstür schlug ein zweites Mal mit dröhnendem Hall ins Schloss. Für ein paar Atemzüge blieb es vollkommen still.
»Na, dann kommt mal mit! Ich koche euch ein paar Eier«, verkündete die Ordensfrau, eine der Schwestern vom Heiligen Herzen Mariens. Gabrielles Herz hüpfte, sie aß für ihr Leben gern gekochte Eier.
»Nein, danke, ich habe keinen Hunger«, log sie trotzdem. Die Nonne empfand die Mädchen als Last, das war nicht zu übersehen. Gabrielle wollte kein Abendessen von jemandem haben, der sie als lästig empfand. Sie wollte von dieser Frau und diesem Kloster überhaupt nichts haben.
Ein Tag im Waisenhaus war wie der andere. Die Chanel-Schwestern lernten etwas über verschiedene Heilige, vor allem über den Mönch, der einst das Kloster gegründet hatte. Selbst während der Mahlzeiten und der regelmäßigen Ausflüge ins Grüne wurde ihnen über ihn vorgelesen. Drinnen war alles düster, freudlos und kalt. Und doch … Die Nonnen waren freundlich. Sie kümmerten sich mit einiger Hingabe um die ihnen anvertrauten Kinder. Nach einer Weile empfand Gabrielle die Struktur, die ihr Leben plötzlich hatte, als angenehm. Sie gab ihr eine Sicherheit, die sie vorher nicht gekannt hatte. Wenn Julia, Antoinette und sie abends zu Bett gingen, wussten sie, was sie am nächsten Morgen erwartete. Und noch etwas mochte sie sehr: die einfachen Formen, symmetrischen Reihen aus Tischen oder Betten, gleichmäßig ausgerichteten Rechtecke aus Holz oder Leinen in den schmucklosen Schlaf- und Essräumen, den sauberen Geruch der stets gewaschenen weißen Blusen und schwarzen Röcke der Mädchen, die Wäscheschränke, in denen alles ordentlich seinen Platz hatte. Außerdem brachten die Nonnen Gabrielle den Umgang mit Nadel und Faden bei. Es ging zwar nicht darum, etwas Hübsches zustande zu bringen, sondern etwas Praktisches zu schaffen, das lange halten würde, trotzdem schätzte Gabrielle diese Beschäftigung sehr. Wann immer ein Kleid, ein Bettlaken oder sonst etwas kaputtgegangen und nicht mehr zu reparieren war, fragte Gabrielle, ob sie den Stoff haben könnte.
»Ich möchte besser nähen lernen und könnte damit üben«, sagte sie den Nonnen. »Sonst wird er doch nur weggeworfen.«
»Warum nicht? Behalte ihn nur, mein Kind.«
Im Sommer machte sie sich über ihre Schätze her, dann waren Ferien, und die Mädchen hatten Zeit für sich. Gabrielle nutzte sie, um zu nähen! Sie schneiderte Röcke und Blusen, die nahezu die gleiche Form hatten wie jene, die die Waisenmädchen trugen. Auch waren sie meistens schwarz und weiß, denn farbige Stoffe gab es in dem alten Kloster kaum. Und doch fühlte sich Gabrielle wie im Himmel! Hier sorgte sie mit einem Abnäher für eine raffinierte Passform, dort zauberte sie mit einer dezenten Rüsche aus einem einfachen Stück etwas Besonderes. Sie dachte nicht lange nach, in ihrer Phantasie tauchten von allein Varianten einfacher Kleidung auf, die ihrer Trägerin mehr schmeichelten. Und sie hatte ein Gefühl für das Material, konnte sich leicht vorstellen, wie sie es anstellen musste, die Taille zu betonen oder eine Schleife zu raffen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Alle Kinder freuten sich auf die Sommerferien, weil sie nach Hause geholt wurden. Gabrielle, Julia und Antoinette blieben in Aubazine. Sie suchten sich ein windgeschütztes Plätzchen zwischen Querhaus und Dormitorium, Gabrielle fädelte Garn in eine Nadel, während Julia mit einem Buch neben ihr saß und Antoinette einfach nur die Wolken betrachtete. Sie waren frei von dem engen Korsett eines festen Stundenplans und doch umgeben von einer Sicherheit, die aus drei Mahlzeiten am Tag und zuverlässigen freundlichen Menschen bestand.
Als die nächsten Sommerferien vor der Tür standen, rief die Mutter Oberin die drei Schwestern zu sich.
»Gute Nachrichten«, verkündete sie und lächelte fröhlich. »Ihr werdet die Ferien bei Louise Costier in Varennes-sur-Allier verbringen.« Weil keine der drei etwas mit dem Namen anfangen konnte, ergänzte sie: »Es ist die Schwester eures Vaters, eure Tante Louise. Die gute Seele ist mit einem Eisenbahner verheiratet. Sie holen euch morgen nach dem Frühstück ab.«
»Ich bleibe hier!«, sagte Gabrielle und dachte, damit wäre der Fall erledigt. Wäre ja noch schöner! Sie hatte sich seit dem Winter auf die Stunden gefreut, in denen sie die Schnittform mit Schneiderkreide aufmalen, die einzelnen Stücke zunächst mit Stecknadeln fixieren und schließlich mit akkuraten Nähten aus Stoffstücken eine Bluse oder ein Kleid entstehen lassen würde. In den letzten Wochen waren exakte Modelle in ihrem Kopf entstanden, die sie in Gedanken immer mehr verfeinert hatte. Sie würde sich dieses Vergnügen auf keinen Fall nehmen lassen. Doch sie hatte sich getäuscht.
»Wir können Madame Costier nicht mehr erreichen«, erklärte die Mutter Oberin sanft. Ihr gütiges Gesicht bekam einen mitleidigen Ausdruck. »Stell dir nur vor, wie sie sich fühlen wird, wenn sie voller schöner Pläne für die nächsten Wochen hier eintrifft, und enttäuscht ohne euch wieder fahren muss. Das möchtest du ihr gewiss nicht antun, mein Kind.« Es war keine Frage.
»Aber was ist mit meiner Enttäuschung?«, wollte Gabrielle wissen.
»Also wirklich, Gabsi«, raunte Julia, »was willst du denn? Wir kommen hier endlich mal heraus. Eine Abwechslung ist bestimmt nett.« Antoinette zuckte nur mit den Schultern, ihr war es gleich, wo sie sich langweilte.
»Es ist ausgemacht«, ließ die Mutter Oberin sie wissen. »Ihr könnt gehen.«
Gabrielle hatte kaum geschlafen, als am nächsten Morgen ein Wagen vor dem Kloster hielt und die Frau ausstieg, die ihr die Ferien verdorben hatte, ehe sie überhaupt anfingen. Julia dagegen war ausgeruht und bereit, sich den Regeln des Hauses zu unterwerfen, in das man sie bringen würde. Sie hatten bereits viele Tanten kennengelernt, manche waren im Rahmen ihrer Möglichkeiten großzügig und lustig, andere waren böse alte Schachteln. Julias Hoffnung war, Louise in die erste Kategorie einordnen zu können, sie freute sich sogar ein wenig auf den Tapetenwechsel. Antoinette wirkte völlig unbeteiligt. Gabrielle hatte sich daran gewöhnt, die Stimmung ihrer kleinen Schwester nicht einschätzen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlechte Laune hatte, war meistens hoch.
»Sieh sie dir nur an! Sind sie nicht hübsch?« Tante Louise erwartete von ihrem Mann anscheinend keine Antwort. Sie sah ihn nicht einmal an, sondern blickte entzückt von einer zur anderen. »Bestimmt erinnert ihr euch nicht mehr an mich, was? Ihr wart noch so klein, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.« Ihre Hand deutete etwa auf die Höhe einer Tischplatte. »Du konntest noch nicht einmal laufen«, ergänzte sie, an Antoinette gewandt. »Seitdem ist viel geschehen.« Sie seufzte. »Es tut mir so leid, dass ihr eure Mutter verloren habt.«
Gabrielle presste die Lippen aufeinander. Konnte sie nicht mit diesem leeren Geplapper aufhören? Gabrielle hasste diese Frau jetzt schon.
»Das ist mein Mann Paul Costier. Ihr dürft ihn Onkel Paul nennen.«
»Salut.« Er lächelte breit.
»Guten Tag, Onkel Paul«, antworteten Julia und Antoinette.
»Guten Tag, Monsieur«, sagte Gabrielle, hob das Kinn und sah ihm direkt in die Augen, ohne eine Miene zu verziehen.
»Na, dann wollen wir mal«, murmelte er und hielt seiner Frau und den Mädchen den Wagen auf.
Gabrielle hatte einen winzigen Funken Hoffnung in sich gehabt, die Costiers würden es sich anders überlegen, wenn ihnen die Chanel-Schwestern nicht vor lauter Dankbarkeit um den Hals fielen. Dummerweise schien Louise fest entschlossen zu sein, ihren Nichten etwas Gutes zu tun, daran änderte auch die geringe Begeisterung nichts, die die drei ihr entgegenbrachten. Die Fahrt über Sand und Kopfsteinpflaster erschien Gabrielle wie eine Ewigkeit. Mal sahen sie nichts als Wiesen, ein wogendes grünes Meer, in das jemand rote Mohnblüten getupft hatte, dann gab es links und rechts des Weges große Herden Schafe, die in der Sonne vor sich hin grasten. Sandfarbene Häuschen schmiegten sich an Hügel, von denen es mehr gab, je näher der Wagen seinem Ziel kam. Einmal legten sie eine Rast ein. Tante Louise breitete eine rot-weiß karierte Decke auf einem Baumstumpf aus. Paul reichte ihr einen Korb, aus dem sie ein Holzbrett und ein Messer, Brot, Käse und Schinken hervorholte. Auch ein Krug war darin gewesen, mit dem sie sich auf den Weg zu einem Bach machte.
»Das sind alles Vulkane«, erklärte Paul unvermittelt und deutete auf die Gipfel, die sich aneinanderreihten, als seien sie mit einem Lineal ausgerichtet worden. »Vielleicht unternehmen wir am Sonntag mal eine Wanderung. Dann könnt ihr einen Krater von oben ansehen.«
»Das ist mir zu anstrengend«, maulte Antoinette.
»Ist das nicht gefährlich?« Julia sah ihn erschrocken an.
Ehe er mehr dazu sagen konnte, war Tante Louise zurück.
»Ich hoffe, du erzählst den Kindern keine Schauermärchen«, mahnte sie ihn. »Das Wasser hier ist gut, das könnt ihr trinken«, erklärte sie dann und reichte zuerst Gabrielle den Krug.
Nach der Stärkung packte Tante Louise alles wieder ein und schüttelte die Decke so lange aus, bis auch wirklich keine Faser Moos und kein noch so kleiner Holzsplitter mehr daran haftete.
Gabrielle verbrachte auch den zweiten Teil der Reise schweigend. Der Himmel färbte sich bereits rot, als sie den Fluss Allier überquerten und endlich am Ziel waren. Antoinette verschlief die Fahrt, auch Julia war irgendwann eingenickt, Gabrielle dagegen reckte den Hals, um die Ankunft nur nicht zu verpassen. Vielleicht gab es in Varennes ja doch irgendetwas Erfreuliches zu entdecken. Aber nein. Eine Haltestelle der Eisenbahn, ein stattliches Rathaus mit Turmuhr. Gabrielle fragte sich, ob jemand das Gebäude aus Versehen an dieser Stelle errichtet hatte, obwohl es in Wahrheit für eine große Stadt gedacht war. Es passte weder zu dem Güterbahnhof noch zu dem Holzhaus, in dem die örtliche Wirtschaft untergebracht war, und schon gar nicht zu den Wiesen ringsherum, die an Eintönigkeit nicht zu überbieten waren.
»Hübsch«, stellte Julia verschlafen fest.
»Ja.« Gabrielle nickte. »Sofern man keine Abwechslung mag.«
Wenn das Heim der Costiers wenigstens ein herrschaftliches Anwesen wäre, aber nein, ein bescheidenes Haus aus Stein mit roten Ziegeln darauf erwartete sie. Links und rechts davor Blumenbeete in den exakt gleichen Maßen, beide abwechselnd mit Rosen und Lavendel bepflanzt, als wäre die eine Seite das Spiegelbild der anderen. Und Tante Louise war auch noch stolz darauf! Ihre Brust schwoll geradezu an, als sie die Arme ausbreitete, als wolle sie alldas an ihr Herz drücken.
»Herzlich willkommen, Mädchen, das ist nun euer Zuhause. Für die Ferien jedenfalls«, ergänzte sie rasch. Paul schloss die Tür auf.
»Schuhe aus!«, kommandierte die Tante. »Ihr könnt sie hier hinstellen.« Sie deutete auf eine Stelle im Flur, wo ihr Mann gerade seine Straßenschuhe gegen Pantoffeln tauschte. »Ich mache uns rasch etwas zu essen«, kündigte sie dann an. In Wirklichkeit stellte sie nur die Reste des mittäglichen Picknicks auf den Holztisch, die sie um ein paar Trauben und Feigen ergänzte. »Guten Appetit!«
Während des Essens wurde nicht gesprochen. So kannte Gabrielle es vom Kloster, nur dass es sich dort natürlich und richtig anfühlte. Hier lag die Stille wie eine hässliche Blase zwischen ihnen und wuchs unaufhörlich. Wäre sie nur so groß geworden, dass sie der Tante die Luft genommen hätte, ging Gabrielle durch den Kopf, als Tante Louise das Schweigen brach.
»Ihr habt in den letzten Monaten viel durchgemacht. Trotzdem dürft ihr nicht wütend auf euren Vater sein.« Sie lächelte schmal und seufzte. »Mein Bruder kann nicht heraus aus seiner Haut.«
»Was soll das heißen?«, fuhr Gabrielle sie an. »Warum sollten wir böse auf ihn sein? Denkst du, er hat uns zum Vergnügen ins Waisenhaus gebracht?« Julia stupste sie unter dem Tisch an, doch Gabrielle war nicht zu bremsen. »Wenn er könnte, würde er sich selbst um uns kümmern, aber er muss seinen Geschäften nachgehen.« Der mitleidige Blick ihrer Tante stachelte sie weiter an. »Er besitzt schließlich einen Weinberg. Meinst du, die Reben schneiden sich von allein?« Hatte Louise die drei etwa zu sich geholt, um ihnen zu zeigen, dass sie es weiter gebracht hatte als ihr Bruder?
»Was redest du denn da?«, wisperte Julia.
»Das ist nicht wahr, und das weißt du«, entgegnete Tante Louise ruhig. Natürlich wusste Gabrielle das. Doch warum sollte sie sich mit der Realität abgeben, wenn ihre Phantasie ein viel hübscheres Bild zeichnen konnte?
»Außerdem ist er ein Händler«, fauchte sie. »Er zieht von Markt zu Markt. Das ist sicher anstrengender, als gemütlich in der Eisenbahn zu sitzen.« Jetzt stieß Julia sie heftig mit dem Fuß an. Paul ließ sich nichts anmerken, und auch die Tante regte sich nicht auf.
»Ich kann deinen Zorn verstehen, Gabrielle«, sagte sie sanft.
»Ich bin nicht zornig, sondern müde. Wo ist mein Bett?«
Gabrielle empfand jeden Tag wie eine Qual. Je mehr sich die Tante bemühte, desto schlimmer wurde es. Warum hatte sie ihre Nichten hierhergeholt? Die Antwort hinderte Gabrielle daran, den Aufenthalt in dem Häuschen mit seinen hellen Zimmern und seinem hübschen Garten zu genießen: Tante Louise fühlte sich verpflichtet. Sie sah es als ein Opfer an, das sie bringen musste. Und es war ein großes Opfer, denn drei Kinder im Haus bedeuteten Gefahr. Wie schnell konnte Geschirr zu Bruch gehen oder sogar ein Fenster! Die Angst der Tante davor, dass ein Stück ihres bescheidenen Wohlstands leiden könnte, war mit Händen zu greifen. Als ob ein Kratzer auf den hölzernen Stufen dafür sorgen würde, dass die Costiers in die Armut zurückfallen würden, in der Tante Louise bis zu ihrer Heirat aufgewachsen war. Nachdem Gabrielle das begriffen hatte, witterte sie ihre Chance, frühzeitig nach Aubazine zurückkehren zu können. Sie zog die Schuhe absichtlich nicht aus, sondern lief damit die Treppe einmal hoch und wieder runter. Sie stibitzte einen Pfirsich, obwohl Tante Louise peinlich darauf achtete, dass zwischen den Mahlzeiten nicht genascht wurde und dass vor allem jeder das Gleiche bekam. Eines Abends schlich sich Gabrielle aus dem Zimmer, hockte sich auf die oberste Stufe und belauschte ein Gespräch. Paul war spät von der Arbeit zurückgekehrt.
»Ich weiß nicht weiter«, begann Tante Louise, ihre Stimme war brüchig. »Julia ist ein braves Mädchen, mit ihr ist es einfach. Antoinette erscheint mir ein wenig mürrisch. Aber Gabrielle … Sie benimmt sich unmöglich!«
»Morgen habe ich frei. Ich werde mit den dreien eine lange Wanderung unternehmen, dann kannst du dich ein wenig ausruhen. Und ich werde mir die junge Dame vorknöpfen. Wahrscheinlich bist du zu nachsichtig mit ihr.«
»Was muss sie nur erlebt haben, dass sie so voller Hass steckt?«
Die nächsten Worte konnte Gabrielle nicht verstehen, aber sie wagte nicht, ein paar Stufen nach unten zu schleichen, denn das Holz knackte bei jedem Schritt und hätte sie verraten.
»Ich wünschte, ich könnte das Vertrauen der Kleinen gewinnen«, war Tante Louise wieder deutlich zu hören. »Nur fürchte ich, lange halte ich das nicht mehr aus.«
Der letzte Satz klang wie ein Versprechen in Gabrielles Ohren.
Am nächsten Morgen stahl sie sich früh aus dem Haus, eine Schere in der Hand. Zum Frühstück legte sie ihrer Tante einen Strauß Rosen neben den Teller.
»Ich wollte mich entschuldigen«, sagte sie, ohne aufzusehen. »Sicher meinst du es gut mit uns. Das bin ich nicht gewöhnt.« Gabrielle musste schlucken, denn in dem Moment wurde ihr bewusst, dass sie meinte, was sie gerade gesagt hatte. Die Nonnen von Aubazine ausgenommen, hatte es nicht viele Menschen in ihrem Leben gegeben, die sie ohne Hintergedanken gut behandelt hatten. Sofort tat Gabrielle schrecklich leid, was sie getan hatte.
»Schon gut, mein Kind.« In Tante Louises Augen schimmerten Tränen. »Es ist nicht deine Schuld.«
»Sehr nett, dass du dich entschuldigst.« Paul nickte zufrieden und griff nach einem Hörnchen. »Woher hast du diese schönen Rosen?«, wollte er wissen, während er das Gebäck in seine Schale mit Milchkaffee tunkte. Gabrielle schwieg.
»Das sind doch wohl nicht …« Tante Louise wartete noch eine Sekunde, ehe sie aufsprang und zur Tür stürzte. Einen Wimpernschlag später war ein Aufschrei zu hören. »Um Himmels willen, was hast du nur getan? Meine Beete! Nur noch nackte Stängel! Wie konntest du nur? Du hast mir meinen gesamten Garten ruiniert!«
Vier Jahre später
Aubazine und Moulins, Sommer 1900
»Julia, Gabrielle, Antoinette, hopp, hopp, die Mutter Oberin will euch sehen.« Die Schwester vom Heiligen Herzen Mariens drehte auf dem Absatz um und ging voraus. Sie wusste, die drei würden ihr selbstverständlich folgen. Gabrielle tat es an diesem Tag besonders gern. Sie hatte Vorhänge für den Bedürfnisraum genäht, damit es den Bengels aus dem Dorf nicht mehr möglich war, durchs Fenster hereinzuspähen. Gabrielle hatte die Arbeit am Tag zuvor beendet. Sicher wollte die Oberin ihr ein Lob dafür aussprechen. Julia klopfte, die Mädchen betraten die schmale Stube, in der es kein Tageslicht gab, und begrüßten die Oberin, wie sie es gelernt hatten. Sie stand trotz ihrer Jahre wie immer kerzengerade an dem schlichten hölzernen Schreibpult, an der Wand darüber flackerte Kerzenlicht.
»Die Zeit ist gekommen, ihr müsst uns verlassen«, begann sie ohne Umschweife. Damit hatte Gabrielle nicht gerechnet. Ihre beiden Schwestern offenbar auch nicht.
»Wohin sollen wir denn gehen?«, fragte Julia, ihre Augen füllten sich sofort mit Tränen. »Wir haben keinen anderen Ort.«
»Erinnert ihr euch? Vor einigen Wochen haben wir über das Leben einer Novizin gesprochen.« Die Oberin sah von einer zur anderen. »Keine von euch ist bereit, das Gelübde abzulegen, Antoinette ist ohnehin noch zu jung dafür. Ihr wisst, dass kein Mädchen bleiben kann, dass das achtzehnte Lebensjahr erreicht hat, und nicht in den Orden eintreten will.«
Als angehende Ordensschwester hätte Gabrielle einen weißen Schleier tragen dürfen. Das war aber auch schon alles, was ihr an dieser Vorstellung gefiel. Sie hatte andere Pläne und sich immer ausgemalt, einmal eine reiche begehrte Frau zu sein. Nur hatte sie nie darüber nachgedacht, was genau sie nach Verlassen des Waisenhauses tun würde, um ihr Ziel zu erreichen. Sie war nicht einmal auf die Idee gekommen, jemand anders könne bestimmen, wann die Zeit im Kloster vorüber ist.
»Eure Tante Louise aus Varennes …«, hörte sie die Oberin sagen und fiel ihr ins Wort:
»Ich gehe auf keinen Fall zu ihr! Da lebe ich lieber auf der Straße.« Julia gab einen erschrockenen Laut von sich. Gabrielles Herz dagegen klopfte wild. Noch immer beschämte sie die Erinnerung an die Sommerferien vor vier Jahren. Gewiss, Tante Louise war pingelig und bieder, doch sie hatte sich alle Mühe gegeben, es ihren Nichten so schön wie möglich zu machen. Gabrielle hatte es ihr mit ungehörigem Verhalten und peinlicher Überheblichkeit gedankt. Sie wollte ihr nie wieder unter die Augen treten müssen.
»Es steht auch nicht zur Debatte, dass ihr zu ihr zieht.« Der strenge Blick der Oberin durchbohrte Gabrielle geradezu. »Aber sie hat etwas für euch arrangiert. Ihr kommt zu ihrer …« Sie zögerte, ehe sie den Satz beendete: »… Schwester. Gewissermaßen. Wenn ich das alles richtig verstanden habe«, murmelte sie mit kraus gezogener Stirn. »Wir haben morgen noch Gelegenheit, uns zu verabschieden.« Damit tunkte sie ihre Feder in ein Tintenfässchen, das deutliche Zeichen, dass die Audienz zu Ende war.
Der Abschied vom Waisenhaus war seltsam. Julia weinte bitterlich, Antoinette ließ die Prozedur über sich ergehen, Gabrielle war hin und her gerissen. Es waren gute Jahre bei den Nonnen gewesen. Eine freudig-aufgeregte Stimme in ihr malte die Zukunft in bunten Farben aus. Ein neuer Lebensabschnitt. Gabrielle war siebzehn, also bald erwachsen. Sie würde endlich selbst bestimmen können. Mindestens ebenso laut dämpfte eine zweite Stimme Gabrielles Hoffnungen. Was konnte sie schon erwarten, wenn Tante Louise es für sie arrangiert hatte? Wieder einmal stiegen die drei in einen Wagen, ohne zu wissen, wohin die Reise ging. Wieder einmal hatte jemand anderes für sie die Entscheidung getroffen. Das musste aufhören. Die Kutsche setzte sich in Bewegung, Gabrielle warf einen letzten Blick auf das Klostergemäuer. Wo auch immer sie heute Nacht schlafen würde, was auch immer man für sie vorgesehen hatte, Gabrielle würde ihr Leben in die eigenen Hände nehmen. Jetzt.
»Ist das der Weg nach Courpière?«, wollte Julia nach einer Weile wissen.
»Ich bin nicht sicher, könnte schon sein.« Gabrielle fiel etwas ein. »Aber ich glaube nicht, dass wir zu Onkel Augustin und unseren Brüdern kommen. Die Mutter Oberin hat von einer Schwester von Tante Louise gesprochen.«
»Ach ja.« Julia drohte schon wieder, in Tränen auszubrechen. Auch Gabrielle wurde das Herz mit jeder Stunde schwerer. Sie hatte den Eindruck, der Wagen fuhr in Richtung Varennes, sie sah die gleichen Wiesen, die gleichen Schafe wie damals auf dem Weg in die Sommerferien. Gabrielle meinte sogar, die eine oder andere Hütte zu erkennen. Ihr wurde immer beklommener zumute. Was, wenn sie am Ende doch bei Tante Louise wohnen sollten? Oder in ihrer direkten Nähe. Die Fahrt dauerte den ganzen Tag. Julia machte sich Sorgen, Antoinette quengelte. Am Abend passierten sie eine Ansammlung stattlicher Gebäude, vor denen Soldaten Wache hielten. Eine Kaserne, vermutete Gabrielle. Sie überquerten einen Fluss und fuhren schließlich durch ein steinernes Tor in ein Städtchen, in dem sie noch nie gewesen waren. Der Wagen hielt vor einem einfachen Häuschen.
»Da wären wir«, sagte der Kutscher, stellte das wenige Gepäck auf die Straße und schickte sich an, wieder auf seinen Bock zu steigen.
»Moment, Sie können uns doch nicht einfach …«, begann Gabrielle. Da öffnete sich die Tür des kleinen Hauses.
»Großvater Henri! Großmutter Angelina!«
»Wir ziehen zu euch?« Antoinette rieb sich müde die Augen. Sie blickte zwischen der Haustür, in der sich die Großeltern aneinanderdrängten, und dem Rest des Bauwerks hin und her, ihre Miene wechselte zwischen Freude und Skepsis. Kein Wunder, der weiße Putz der Behausung, der vor möglicherweise hundert Jahren über einfache Steine gestrichen worden war, bröckelte an vielen Stellen ab, und das Gebäude war so schmal, dass Gabrielle sich nicht vorstellen konnte, wie die Möbel darin Platz finden sollten. Sie drehte sich einmal um die eigene Achse. Gleich gegenüber ragte das Hôtel de Paris stolz in den Abendhimmel. Ein majestätischer Anblick, der sie an das Schloss mit dem Turm in Brive-la-Gaillarde erinnerte. Gabrielle sah ihre Mutter vor sich, ihr Herz krampfte sich zusammen.
»Was steht ihr denn herum?« Großmutter Angelina schob sich an ihrem Mann vorbei und zog eine nach der anderen an sich. »Willkommen in Moulins, Kinder! Es gibt etwas zu essen, dann könnt ihr euch ausruhen. Ihr fallt ja gleich um, so erledigt seht ihr aus. Wie sollte es anders sein nach so einer langen Reise? Schrecklich, ein ganzer Tag in einer engen Kutsche. Und dann diese Schlaglöcher und holperigen Wege. Ihr müsst völlig durchgeschüttelt sein.« Sie lachte. »Bestimmt ist euch ganz schwindelig.«
»Ja, von deinem Geplapper.« Großvater verdrehte die Augen. »Aber sie hat recht, rein mit euch, sonst stehen wir morgen noch hier draußen.«
Gabrielle wusste nicht, ob sie glücklich sein oder verzweifeln sollte. Nachdem der Moment der Überraschung vorüber war, kam die Erkenntnis, dass sie in Zukunft nicht mehr lernen durfte, sondern wieder schuften musste. Ihre Großeltern zogen von Markt zu Markt, wie es auch Vater und Mutter zeitweise getan hatten. Sie waren nicht mehr jung, sahen aber auch nicht gebrechlich aus. Gabrielle zweifelte nicht daran, dass sie ihrer Tätigkeit bis zum heutigen Tag nachgingen. Sie seufzte und betrat das Haus. Drinnen war es wirklich sehr beengt, wie sie feststellte, nachdem sich ihre Augen an das spärliche Licht einer Petroleumlampe gewöhnt hatten. Ein wenig muffig war es, aber sonst einigermaßen gemütlich. Großmutter tischte kaltes Hühnchen auf und Fisch, den sie stark mit Rosmarin und Knoblauch gewürzt hatte. Doch Gabrielles feiner Nase konnte sie nichts vormachen. Kein Gewürz der Welt hätte den strengen Geruch der nicht mehr ganz frischen Forelle vor ihr verbergen können.
»Adrienne ist schon im Bett, morgen ist Schule«, erklärte Oma Angelina. »Da muss sie ausgeschlafen sein.« Ihre Wangen glänzten und waren von dunkelroten Adern durchzogen. Sie füllte die Teller und stellte sie ihren Enkelinnen hin. »Gleich morgen früh bringen wir euch ins Pensionat, dann lernt ihr sie kennen.«
»Die armen Dinger haben keine Ahnung, wovon du sprichst.« Opa Henri schüttelte den Kopf. »Wie ist das nur möglich? Du redest wie ein Wasserfall, aber sagst nichts, woraus die Mädchen schlau werden könnten.«
Oma Angelina bedachte ihn mit einem strafenden Blick, sparte sich jedoch einen Kommentar.
Sie wünschte einen guten Appetit, dann erklärte sie: »Louise, unsere Älteste hat den Vorschlag gemacht, euch in die Schule zu schicken, in die unsere Jüngste geht, seit sie zehn ist. Adrienne ist unser Küken.« Ihre Augen strahlten.
»Wie ich«, sagte Antoinette leise.
»Ja, mein Kind, wie du.« Oma Angelina tätschelte ihre Wange. »Jedenfalls finden wir, es ist eine gute Idee. Im Institut Notre-Dame bekommt ihr eine gute Ausbildung, ihr werdet sehen. Euer Vater ist der gleichen Meinung«, schloss sie.
»Vor allem, weil er kein Schulgeld für euch zahlen muss«, setzte Opa Henri hinzu.
»Das ist wahr. Natürlich geht ihr deshalb auch nicht in die freie Schule wie unsere Adrienne. Und ihr wohnt nicht zu Hause, sondern im Pensionat. Ein wirklich sehr guter Vorschlag von Louise, schließlich habt ihr kein Zuhause. Wo also solltet ihr sonst schlafen? Heute Nacht bleibt ihr natürlich hier. Es wird ein bisschen eng, aber es wird schon gehen.« Wieder lachte sie und sah fröhlich in die Runde. Gabrielle aß das Hühnchen. Sie würde doch weiter zur Schule gehen können, eine gute Nachricht. Die vielen Fragen, die in ihr auftauchten, schob sie beiseite, wie den Fisch.
Das Schulgebäude mit einem kleinen Park davor machte keinen üblen Eindruck. Alles wirkte hell und viel freundlicher als das Kloster in Aubazine. Allerdings hatte das Waisenhaus Gabrielle gezeigt, dass der äußere Schein nicht unbedingt auf das Innere schließen ließ. Neugierig betrachtete sie jedes Detail, das ihr etwas über ihre Zukunft verraten konnte. Ihre Großeltern hatten sie so lange wie möglich schlafen lassen, ehe sie die drei Mädchen bei dem Direktor ablieferten.
»Adrienne ist längst im Unterricht«, erklärte Oma Angelina ihnen, als sie vor der schweren, mit Ornamenten verzierten Holztür standen. »Sie kommt in der großen Pause hierher und zeigt euch alles. Wartet nach dem Gespräch mit dem Herrn Direktor hier auf sie.«
Der Termin mit dem Leiter des Instituts Notre-Dame dauerte nicht lange. In erster Linie machte er ihnen unmissverständlich klar, wie sie sich zu benehmen hatten.
»Unsere Schülerinnen bilden zwei Gruppen«, ließ er sie mit unbewegter Miene wissen. »Da sind die Töchter von guter Herkunft, deren Eltern Schulgeld bezahlen, und die nach dem Unterricht nach Hause gehen. Die meisten von ihnen leben in ansehnlichen Bürgerhäusern.«
Gabrielle fand, dass in seinem Blick eine Arroganz lag, die sich für einen Mann in seiner Position nicht gehörte. Als ob er nicht genau wusste, wo die drei Chanel-Schwestern die letzte Nacht verbracht hatten und wo Adrienne lebte, die immerhin zu den Töchtern mit guter Herkunft zählte.
»Dann wären da noch die armen Mädchen, die in den Kammern des Internats untergebracht sind.« Er sah von einer zur anderen. »So wie ihr. Für euch wird das Schulgeld von den reichen Familien der Stadt übernommen. Ihr seid es ihnen schuldig, euch vollständig auf eure Ausbildung zu konzentrieren. Moulins mag für ein junges Ding vom Lande einige Verlockungen zu bieten haben. Wir erwarten von euch, dass ihr ihnen widersteht.« Sein Ton bekam etwas Dunkles, Drohendes. »Ihr seid in diesem Institut etwas Besonderes. Wir erwarten, dass euer Benehmen diesem Umstand gerecht wird.«
Während er zusammenfasste, wie ein Tagesablauf und ein üblicher Wochenplan aussahen, hingen Gabrielles Gedanken an einem Wort fest. Besonders. Manchen mochte die Vorstellung gefallen, etwas Besonderes zu sein. Gabrielle haderte mit ihr. Wer sich bemühte, dieses Attribut zu tragen, kam anscheinend nicht auf die Idee, dass besonders nicht automatisch den Zusatz gut trug. Irgendwann würde sie auch zur privilegierten Gruppe gehören. Dann würde sie das Geld für die armen Mädchen spenden und von der Schulleitung fordern, dass sie das gleiche Leben führen durften wie alle anderen auch.
»Gabsi!« Julia schlug ihr sanft auf den Oberarm.
»Oder ist noch etwas?«, wollte der Direktor von Gabrielle wissen. Sein Blick durchbohrte sie, er wartete offenbar schon länger auf eine Antwort von ihr.
»Nein, vielen Dank, ich habe alles verstanden.«
Nachdem sich die verzierte Holztür wieder hinter ihnen geschlossen hatte, blieben die drei im Flur stehen, wie Oma Angelina ihnen aufgetragen hatte. Julia gingen tausend Fragen im Kopf herum, die sie alle loswerden musste, Antoinette stand am Fenster und beobachtete wieder einmal Wolken, die über den Himmel schwebten. Und dann war Adrienne da. Mit federndem Schritt kam sie den Gang entlang, sah Gabrielle an und strahlte. Sie trug das gleiche schwarze Kleid, das alle Schülerinnen trugen, mit dem breiten Kragen, der wie eine Stola über den Schultern lag. Kein auffälliger Schmuck, kein Farbtupfer, und doch schien sie zu leuchten wie ein Regenbogen.
»Da seid ihr ja, genau wie Maman es angekündigt hat. Herzlich willkommen im Institut Notre-Dame. Ich bin Adrienne.«
»Du bist die Schwester unseres Vaters?« Antoinette zog die Augenbrauen hoch.
»Stimmt. Und die eurer Tante Louise«, erklärte Adrienne fröhlich.
»Dann bist du meine Tante!« Gabrielle ärgerte sich. Das war nicht gerade ein kluger erster Satz. Dabei hätte sie gern den bestmöglichen Eindruck bei diesem Wesen hinterlassen, das mit seiner bloßen Anwesenheit den Moment zu einer Sternstunde machte.
Adrienne lachte. »Stimmt. Eine absolut richtige Schlussfolgerung.«
»Wie alt bist du?«, sprudelte es aus Gabrielle heraus.
»Sechzehn. Ich bin das Nesthäkchen.«
Gabrielle konnte es nicht fassen: »Eine Tante, die jünger ist als ich?«
»Als wir«, korrigierte Julia. Gabrielle hatte sie und Antoinette beinahe vergessen.
»Ich gehe zur Schule. Was habt ihr gedacht, wie alt ich bin?« Wieder lachte Adrienne laut auf und ließ dabei ihre weißen Zähne sehen. »Ist doch lustig, findet ihr nicht?« Julia hatte die Überraschung verdaut und bestürmte Adrienne mit all ihren Fragen. Gabrielle dagegen fühlte sich wie in Trance. Ihr war, als habe Vaters jüngste Schwester eine Aura um sich, die Gabrielle seit der Sekunde faszinierte und anzog, in der sie sich zum ersten Mal in die Augen gesehen hatten. Adrienne war nicht einfach hübsch, sie war bildschön. Das war nicht diese künstliche Schönheit von Frauen, die ihre ausdruckslosen Gesichter mit Rouge erst in Szene setzen mussten, es war ein Glanz, der aus ihrem Inneren kam. Und es war wie ein Blick in den Spiegel, denn Adrienne sah Gabrielle auf eine irritierende Weise ähnlich.
»Wenn ihr Lust habt, zeige ich euch nach dem Unterricht die Stadt.«
»Das geht nicht«, antwortete Julia sofort. »Wir sollen uns vollkommen auf die Schule konzentrieren, statt durch den Ort zu schlendern, als hätten wir nichts Besseres zu tun.«
»Ich habe Lust!« Gabrielle sah Adrienne an.
»Aber der Direktor hat doch eben gerade …«, setzte Julia an.
Gabrielle fiel ihr ins Wort: »Er hat nichts davon gesagt, dass wir hier eingesperrt sind. Vielleicht bleiben wir für immer, dann müssen wir Moulins doch kennen.«
»Schön, wir treffen uns um fünf Uhr unten im Park.« Adrienne nickte Gabrielle zu. »Und jetzt bringe ich euch zur Kleiderkammer, damit ihr eure Uniformen bekommt. Ohne die hier …« Sie strich über den weiten schwarzen Rock, der ihr bis zu den Knöcheln reichte. »… seid ihr keine echten Notre-Dame-Schülerinnen.«
Gabrielle hatte kaum abwarten können, dass es fünf Uhr wurde. Zu ihrem Ärger schlossen sich Julia und Antoinette doch an. Es waren ihre Schwestern, also war es nicht richtig, sie nicht dabei haben zu wollen. Nur fühlte es sich an, als habe Gabrielle in Adrienne die erste wahre Schwester gefunden, eine Seelenschwester. Seite an Seite zogen sie los, als würden sie sich seit Ewigkeiten kennen. Julia und Antoinette trotteten hinter ihnen her. Sie kamen nach wenigen Schritten am Hôtel de Paris vorbei. Der Brunnen davor war Gabrielle am Abend ihrer Ankunft gar nicht aufgefallen. Und noch etwas war ihr entgangen. Adrienne machte sie darauf aufmerksam.
»Das Geschäft dort drüben hat erst vor einem Jahr oder zwei eröffnet.« Sie seufzte. »Ich könnte nicht mehr ohne es leben.« Jetzt lachte sie keck. »Allerdings ist es ein seltenes Vergnügen, dort etwas kaufen zu können. Ist auch besser, sonst würde ich bald nicht mehr in die Schuluniform passen.«
»Was gibt es da?« Gabrielle reckte den Hals. Palets d’Or stand über dem verschnörkelten Eingang, der aussah, als habe jemand einfach die Ecke aus dem unteren Stockwerk des Gebäudes geschnitten und durch eine Säule ersetzt. Der gleiche Schriftzug prangte auch auf den Mäuerchen unterhalb zweier Schaufenster.
»Schokolade!« Adriennes Antwort war ein einziges wohliges Stöhnen. Gabrielle versuchte, im Inneren des Ladens etwas zu erkennen. War die Decke über dem Verkaufstresen wirklich bunt bemalt? Nein, das musste eine Täuschung gewesen sein, eine Reflexion wahrscheinlich. Sie bekam keine Chance auf einen zweiten Blick, denn Adrienne lief bereits weiter. Sie führte die drei durch ein Gewirr aus Gassen und Wegen und sprang leichtfüßig über das Kopfsteinpflaster hinweg. Nachdem sie die Kathedrale Notre-Dame hinter sich gelassen hatten, fanden sie sich an einer riesigen Halle wieder. Das mächtige Dach erinnerte Gabrielle an einen Bahnhof. Es überspannte einen Körper, der vollständig von einem Metallgerüst umschlossen war.
»Die Markthalle«, erklärte Adrienne, die ihren Blick bemerkt haben musste.
»Die hätte Maman gefallen«, flüsterte Gabrielle. Ein Ort an dem die Händler vor Wind und Regen geschützt waren! Warum versuchte ihr Vater hier nicht sein Glück? Wie im Traum taumelte Gabrielle weiter neben Adrienne her bis auf einen großen Platz, auf dem die Damen und Herren geschäftig unterwegs waren oder unter Kastanien ausruhten.
»Die Place d’Allier, das Herz der Stadt«, sagte Adrienne. »Le Grand Café«, fügte sie beinahe ehrfürchtig hinzu und deutete auf ein Lokal. Vor der gläsernen Tür stand ein Herr, der sehr elegant aussah. Näherte sich Kundschaft, öffnete er und begrüßte die Gäste mit einer geschmeidigen Verbeugung. Gerade steuerte eine kleine Gruppe junger Männer auf den Eingang zu. Alle trugen scharlachrote Pluderhosen, einige nur helle Hemden dazu, andere Jacken mit goldenen Knöpfen. Die meisten hatten Käppis mit Schirm auf dem Kopf. Sofort fiel Gabrielle die Kaserne auf der anderen Seite des Flusses ein, die sie am Abend ihrer Ankunft in Moulins gesehen hatte. Gabrielle war fasziniert von den jungen Offizieren. Nicht, dass einer ihr sonderlich aufgefallen wäre, aber in der Art, wie sie sich bewegten und rasch zu ihr und Adrienne herübersahen, lag ein Versprechen auf ein besseres Leben.
»Das Grand Café ist leider den feinen Leuten vorbehalten, unsereins wird es nie von innen zu sehen bekommen.« Adrienne seufzte zwar, doch ihre fröhliche Miene ließ Gabrielle vermuten, dass ihr Bedauern sich sehr in Grenzen hielt. Vielleicht ahnte sie auch, dass sie sehr wohl eine Chance hatte, wenn ihre Eltern gute Geschäfte auf dem Markt machten. Nur für Mädchen, deren Familien nicht einmal selbst ihr Schulgeld aufbringen konnten, würde das Café wohl wirklich verschlossen bleiben. Stellte sich allerdings die Frage, ob sich Gabrielle damit abfinden oder sich lieber nach einer Eintrittskarte umschauen wollte.
»Zeit, umzukehren«, verkündete Adrienne und wandte sich Julia zu. »Du hast schon recht, ihr solltet euch nicht in der Stadt herumtreiben.« Sie zuckte mit den Achseln. »Aber jetzt habt ihr wenigstens eine Idee davon, wo ihr lebt.«
Für Gabrielle hätte der Ausflug noch ewig weitergehen können, doch sie musste sich fügen. Gemeinsam gingen die vier zurück zur Rue de Paris.
»Louise holt mich oft zum Wochenende ab«, sagte Adrienne beim Abschied. »Nicht diese Woche, aber bestimmt danach. Ich habe schon mit ihr gesprochen. Ihr seid ihr in Varennes natürlich willkommen. Ihr kennt sie ja.«
»Ja, sie ist wirklich nett.« Julia lächelte.
»Hör bloß mit der auf!«, entgegnete Gabrielle finster.
»Gabsi!«, fauchte Julia.
»Was hast du gegen meine Schwester?« Adrienne neigte den Kopf leicht zur Seite. »Louise ist wunderbar. Ich möchte auch einmal sein wie sie.«
»Du meine Güte!«, entfuhr es Gabrielle. Sie wollte Adrienne um keinen Preis verärgern, aber das war nun wirklich ein seltsamer Wunsch.
»Warum denn nicht? Sie hat ein eigenes Haus mit Garten, einen Mann, der nicht nur ein sicheres regelmäßiges Einkommen hat, sondern auch noch anständig und zuverlässig ist. Von meinem lieben Bruder kann man das sicher nicht sagen.« Damit verschwand sie in das schmale Haus ihrer Eltern.