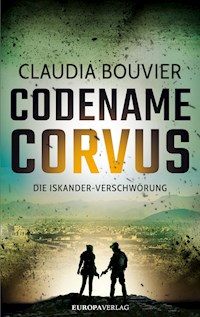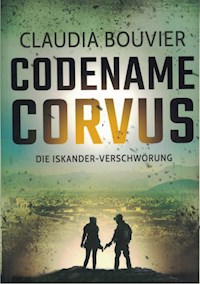7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach ihrer abenteuerlichen Flucht vor einer unbekannten Terrortruppe in der afghanischen Provinz Zabul sind die deutsche Bundeswehrärztin Carla Rossi und der französische Nachrichtendienstoffizier Gwénaël Kérmovan zurück in Europa. Beiden ist klar, dass sie es in Afghanistan nicht mit einer Handvoll einfältiger Taliban oder einfacher Al-Quaida-Kämpfer zu tun hatten, sondern mit einer skrupellosen Geheimoperation unter westlicher Führung. Doch wer war der geheimnisvolle Amerikaner, der die unbekannte Terrortruppe im afghanischen Hochtal anführte und dort die Plünderung einer historischen Ausgrabungsstätte im großen Stil leitete? Auf der Suche nach Antworten werden Rossi und Kérmovan für die deutsch-französische Sondereinheit Corvus rekrutiert, die den Drahtzieher hinter den mysteriösen Vorgängen in Afghanistan aufspüren soll. Schnell stoßen die beiden auf eine Spur, die bis in höchste Kreise der amerikanischen Regierung führt, und geraten in ein tödliches Dickicht aus Geheimoperationen der CIA und Terrorfinanzierung auf höchster Ebene. Indes wächst in Europa die Angst vor islamistischen Attentätern, die der geheimnisvolle Unbekannte geschickt für seine Zwecke in Stellung bringt ....
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 891
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Codename Corvus
Das Erzengel-Gambit
Claudia Bouvier
© 2022 Claudia Bouvier
2. Auflage, Vorgängerausgabe 2020
Lektorat: Silwen Randebrock (www.textum.biz/)
Buchsatz von tredition, erstellt mit dem tredition Designer
Verlagslabel: HELGONVERLAG
ISBN Softcover: 978-3-347-61852-7
ISBN E-Book: 978-3-347-62160-2
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
PROLOG
Grenze zwischen Belgien und Deutschland – am Übergang der Ardennen in das Eifelgebirge – irgendwo im Hertogenwald unweit des Hohen Venn
Ahmadi sah niemanden, doch er fühlte, dass die »Geister« ihnen dicht auf den Fersen waren. Es war sein Fehler gewesen. Er war überzeugt, dass sie während dieser langen Nacht vor allem die Hilfe Allahs brauchten. Sein Freund Fahem hatte widersprochen. Er hatte gesagt, dass sie vor allem einsatzbereite Waffen brauchten, ihre Sprengladungen überprüfen und sich noch einmal den Plan der NATO-Raketenbasis einprägen mussten. Ahmadi wusste natürlich, dass Fahem wie immer recht und er wieder einmal unrecht gehabt hatte.
Sie hatten sich Dschihad4Belgium nach ihrer Freilassung aus dem Knast natürlich nicht nur wegen der Gratis-Arabischkurse oder der Koran-Studiengruppe angeschlossen, sondern vor allem, weil der charismatische Imam ihrer Lieblingsmoschee in Charleroi sie mit Männern bekannt machte, die wahre Action in Aussicht stellten und ihnen alle vierzehn Tage einen Umschlag mit Cash für ihre Familien aushändigten. Das Geld, das von einem reichen Gönner ihrer Sache aus dem Golf-Emirat Katar gespendet wurde, gab es immer, wenn sie sich auf dem abgelegenen ehemaligen Bauernhof zwischen Presgaux und Brûly-de-Pesche unweit der belgisch- französischen Grenze trafen. Dort, in dem extrem dünn besiedelten und stark bewaldeten Gebiet, befand sich auch das Trainingscamp, wo sie zusammen mit einem Dutzend Glaubensbrüder aus ganz Belgien während der letzten Monate gelernt hatten, was sie in dieser Nacht umsetzen sollten.
Fahem war topmotiviert, die Sache mit der NATO-Raketenbasis ordentlich und professionell durchzuziehen. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Mission könnte er endlich in den Irak abhauen, um sich dort der brandneuen Gruppe anzuschließen, die gegen Amerikaner und Ungläubige kämpfte, um das Kalifat ad-dawla alislâmiyya fiq al-'Irâq zu errichten, in dem alle wahren Rechtgläubigen einen angemessenen Platz finden würden. Aber zuvor wollte er für das Team ausgewählt werden, das in ein paar Wochen irgendwo in einer europäischen Hauptstadt eine spektakuläre Aktion durchführen sollte. Fahem war so tief in seinen Gedanken versunken, dass er nicht bemerkt hatte, wie Ahmadi versehentlich sein Handtuch am Flussufer zurückließ, nachdem er sich gewaschen und dort gebetet hatte.
Ahmadi war hinter Fahem zurückgefallen und versuchte angestrengt, seine Atmung wieder unter Kontrolle zu bringen. Seine Unachtsamkeit war es gewesen, die den »Geistern« gezeigt hatte, welcher Spur sie folgen mussten. Es wäre allein seine Schuld, wenn sie weder für die spektakuläre Aktion ausgewählt würden, noch mit Hilfe und finanzieller Unterstützung ihrer neuen, reichen Freunde aus dem Persischen Golf ins künftige Kalifat reisen dürften. Plötzlich fühlte er sich unendlich erschöpft und musste sich an einen Baum lehnen, damit ihm die Beine nicht wegknickten.
× × ×
Fahem versuchte so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Er wusste, dass er Ahmadi auf keinen Fall aus den Augen verlieren durfte. Sie waren ein Team, und nur gemeinsam konnten sie die Mission erfolgreich zum Abschluss bringen. Mit Sorge bemerkte er, dass sein Freund rund einhundertfünfzig Meter zurücklag, und gab ihm ein deutliches Handzeichen. Der vergessene Pfad, den sie ausgewählt hatten, um sich unbemerkt der NATO-Raketenbasis zu nähern, war extrem schwierig und anstrengend. Vermutlich war Ahmadi durch den langen Nachtmarsch am Ende seiner Kräfte und musste verschnaufen, obwohl ihnen in diesem Augenblick die Zeit davonlief. Ahmadi hatte sich schon im Trainingslager bei der praktischen Kampfausbildung schwerer getan als er. Fahem verdrängte den Gedanken an das Risiko, das der Nachzügler darstellen konnte, und konzentrierte sich wieder auf ihre Mission.
Der Weg zog sich verlassen und leicht gebogen nach rechts. Dichte Bäume standen zu beiden Seiten. Falls es ihnen gelang, den Sicherheitszaun der NATO-Raketenbasis unbeobachtet zu erreichen, dann hatten sie auch eine gute Chance, ihn zu überwinden und es bis zu der Radarkuppel zu schaffen, die ihr eigentliches Zielobjekt war.
Fahem dachte kurz an den erschreckenden Zwischenfall zurück, dessen zufällige Zeugen sie mit Ahmadi bei Einbruch der Dämmerung geworden waren. Der unvermutete Verlust von Abū Sufyān und Abu Talib war natürlich ein harter Schlag für die Mission. Die Aktion war unglaublich schnell gegangen und brutal effizient gewesen. Durch den Verlust der beiden Kämpfer hatten sie jetzt nur noch die Hälfte des benötigten Sprengstoffs und natürlich auch zwei bewaffnete Mudschahedin weniger, falls sie sich ihren Fluchtweg aus der NATO-Raketenbasis freikämpfen mussten.
Als sie noch zusammen im Gefängnis von Jamioulx eingesessen hatten, hatte Fahem den Eindruck gehabt, dass die schlecht französisch sprechenden Jungs aus dem flandrischen Vilvoorde irgendwie erheblich mehr Ahnung vom Dschihad hatten als er oder Ahmadi. Als sie sich dann auf dem abgelegenen ehemaligen Bauernhof unweit der belgisch-französischen Grenze zufällig wiedertrafen und mit dem Kampftraining begannen, stellte er allerdings umgehend fest, dass die beiden trotz ihrer sehr guten Arabischkenntnisse, geilen Kampfnamen und wilden, hennagefärbten Bärte auch nur mit Wasser kochten. Weder Abū Sufyān noch Abu Talib hatten je mit den Taliban in Afghanistan gekämpft, wie sie es in Jamioulx behauptet hatten, nur um in der Hackordnung des Knasts aufzusteigen. Ihre Arroganz und mangelnde Umsicht hatte sie nun vor ein paar Stunden Kopf und Kragen gekostet.
Ein Teil von Fahem war erleichtert, dass sie die beiden Angeber aus Vilvoorde los waren. Er wusste, dass sie es auch allein schaffen würden. Er kniff die Augen zusammen. Der fahle spätherbstliche Vollmond war die einzige Lichtquelle, doch der nördlich des Hohen Venns gelegene Hertogenwald war viel zu dicht, um vernünftig sehen zu können. Mit dem dritten Team hatten sie keinen Kontakt aufgenommen. Bei der Planung der Mission war vereinbart worden, dass die beiden Mudschahedin aus dem Brüsseler Stadtteil Molenbeek auf einem anderen Weg zur NATO-Raketenbasis vordringen sollten, um dort ein Ablenkungsmanöver zu versuchen, während das Duo Fahem/Ahmadi sich um die Radarkuppel kümmerte. Fahem spähte angestrengt durch die Büsche. Modrige Blätter, trockene Nadeln und Tannenzapfen lagen in einer dicken Schicht auf dem Boden. Hier war schon sehr lange niemand entlanggelaufen. Er verzog den Mund zu einem zufriedenen Schmunzeln. Sie hatten ihr Ding zusammen mit Ahmadi richtig gut geplant. Sie hatten sich nicht einfach nur aufs Internet und Google Maps verlassen, sondern vernünftiges Kartenmaterial der Gegend besorgt und dabei auch diesen Weg entdeckt, der es ihnen erlaubte, sich der NATO-Raketenbasis im Schutz der Bäume zu nähern, ohne dabei durch offenes Gelände schleichen zu müssen.
× × ×
Obwohl er wieder leichter atmete, hämmerte Ahmadis Herz immer noch wild gegen seine Brust. Er hatte Angst, dass die »Geister«, die er mit seinem vergessenen Handtuch gerufen hatte, ihn in der stillen Nacht hören könnten und ihnen dann das gleiche Schicksal blühte wie den beiden Typen aus Vilvoorde, die sie aus dem Knast kannten.
Er biss die Zähne zusammen, massierte sich mit der Hand die stechende Seite und setzte sich wieder in Bewegung, um mit Fahem aufzuschließen. Sein Freund hatte einen Vorsprung von mindestens einhundertfünfzig Metern erlaufen, während er selbst noch im Dickicht verschnaufte. Er erkannte ihn nur vage als formlosen, dunklen Schatten zwischen den Bäumen. Zumindest betete er, dass dieser Schatten sein Freund war und nicht einer der »Geister«.
× × ×
Fahem wusste nicht, was sie am Ende des Weges erwartete. Sie waren jetzt ganz in Gottes Hand. »Inschā'allāh!«, flüsterte er, als Ahmadi endlich zu ihm aufschloss. Er legte seinem schwer atmenden Kindheitsfreund aufmunternd die Hand auf die Schulter. Die Rucksäcke und die Waffen lasteten schwer. Ahmadi schien noch mehr mit dem Gepäck zu kämpfen als er, und trotz der körperlichen Anstrengung war ihnen kalt. Nach gefühlten Stunden auf ihrem einsamen Weg tauchte am Horizont endlich einer der Wachtürme auf.
»Wahnsinn«, flüsterte Ahmadi. Er verdrängte das ungute Gefühl, dass die unheimlichen »Geister« ganz nahe lauerten, um zuzuschlagen und sie, genau wie Abū Sufyān und Abu Talib, zu eliminieren.
»Wir haben es fast geschafft«, flüsterte Fahem.
× × ×
Die NATO-Raketenbasis war Anfang der 1960er- Jahre eingerichtet worden. Sie stammte noch aus dem Kalten Krieg. Das riesige Gelände in einem fast menschenleeren Gebiet im Osten des Gebirgsplateaus an der Grenze zwischen Belgien und Deutschland umfasste rund sechshundert Hektar. Während des etwas mehr als vierzig Jahre andauernden Konflikts zwischen der NATO un- ter Führung der USA und dem von der UdSSR dominierten Warschauer Pakt waren hier amerikanische und belgische Soldaten stationiert, die zehn atomare Flugabwehrraketen vom Typ Nike bedienten. Die Nike erreichten eine maximale Sprengkraft von vierzig Kilotonnen und dank eines vierstufigen Antriebs eine Reichweite von hundertdreißig Kilometern bei einer Flughöhe von über dreißig Kilometern. Inzwischen waren sie, genau wie die UdSSR, längst Geschichte.
Die Männer in den Ghillie Suits beobachteten das letzte der drei Zweierteams aufmerksam durch ihre Nachtsichtgeräte. Nachdem sie das erste Duo bereits am Vortag eliminiert hatten und das zweite in der Abenddämmerung bei einem Wanderparkplatz erwischten, wo sie zwei gestohlene Geländemotorräder in den Büschen versteckten, waren nur noch diese beiden Möchtegerne-Dschihadisten übrig. Über viele Stunden hatten sie Fahem und Ahmadi aus Charleroi komplett aus den Augen verloren und sie nur zufällig wiedergefunden, weil einer der beiden ein Handtuch an einer Biegung des Hillbachs vergessen hatte. Oberhalb des Flusses begann ein völlig vernachlässigter und schwer begehbarer Pfad, der bis an die äußerste Grenze der NATO-Raketenbasis und den Sicherheitszaun führte. Die Männer mit den Nachtsichtgeräten hatten einem Bauchgefühl folgend dort genauer nachgesehen und dabei die frischen Fußspuren im feuchten Laub entdeckt.
Die beiden Kleinkriminellen aus dem Problemviertel Ville Haute hatten sich im Gefängnis radikalisiert. Nach ihrer Freilassung waren sie zum ersten Mal im Forum einer französischsprachigen Website der Dschihadisten-Szene aufgefallen. Keiner der beiden besaß einen Schulabschluss, und ihre »Kampfausbildung« beschränkte sich auf gewalttätige und bewaffnete Rangeleien im Drogenmilieu von Charleroi und ein paar Wochenenden auf einem Bauernhof im Westen des Hainault, der als Ausbildungslager der salafistisch orientierten Geheimen Bruderschaft firmierte. Dafür hatten sie sich gar nicht mal dumm angestellt.
Die beiden Männer in Spezialtarnkleidung nickten einander zu.
Dann flüsterte einer in sein Kehlkopfmikrofon: »Sie sind jetzt am Zaun!«
Sie beobachteten Fahem und Ahmadi noch eine Weile durch ihre Nachtsichtgeräte. Dann öffneten sie fast gleichzeitig die Verschlüsse ihrer Pistolenholster, die sie am Oberschenkel trugen, und setzten sich in Bewegung. Sie hatten zahllose harte und riskante Kampfeinsätze in brandgefährlichen Ländern hinter sich. Was sie hier taten, war, verglichen zu früheren Missionen, ein Kinderspiel. Die Kameraden auf der NATO-Raketenbasis beobachteten alles von einem der Wachtürme aus. Die Jungs aus Charleroi hatten natürlich keine Chance mehr. Allerdings war vereinbart, dass sie erst im allerletzten Moment zugreifen wollten. Die beiden Männer schlossen schnell und unbemerkt zu Ahmadi und Fahem auf. Durch die Ghillie Suits waren sie quasi unsichtbar. Sie schoben sich an exakt der gleichen Stelle unterm Zaun durch, wo auch die beiden Möchtegerne-Dschihadisten in die NATO-Raketenbasis eingedrungen waren.
× × ×
Der offizielle Zugang zur Anlage erfolgte durch ein Tor an der Nordostseite. Neben dem Tor befand sich ein Schutzbau für die diensthabenden Wachleute. Im äußeren Bereich konnten Fahem und Ahmadi weitere Gebäude ausmachen: Werkstätten, Kantine, Magazine. Hinten lagerten während des Kalten Krieges die Raketenkörper in einer großen Halle. Alles sah genauso aus wie auf dem Plan, den sie sich für die Vorbereitung besorgt hatten. Fahem und Ahmadi gingen äußerst vorsichtig vor. Jetzt, auf den letzten Metern vor der Zielgeraden, wollten sie kein unnötiges Risiko eingehen. Seit sie es geschafft hatten, unbemerkt durch den Zaun zu schlüpfen, waren ihre Kraftreserven geboostet. Ahmadis Sorge, dass die »Geister« sie entdeckt hatten, war wie weggeblasen. Als sie schließlich unter der Radarkuppel standen, pfiff Fahem leise durch die Lippen.
»Geil!«, sagte er zu seinem Freund, der im gleichen Maß beeindruckt schien. Die im Mondlicht hell schimmernde Schutzhülle bestand aus mit Glasfaser verstärktem Kunststoff. Sie setzten ihre Rucksäcke ab. Nun mussten sie nur noch reinkommen, die Sprengstoffbrote und den Timer an den richtigen Stellen anbringen und dann wieder auf dem gleichen Weg verschwinden. Fahem und Ahmadi hatten zwei kleine Brecheisen im Gepäck. Die hatten ihnen schon am Sicherheitszaun gute Dienste geleistet. Jeder setzte ein Brecheisen unter einem der Scharniere der Sicherheitstür an, und gemeinsam pressten sie mit aller Kraft nach oben, um die mit einem massiven Vorhängeschloss gesicherte Tür aus den Angeln zu heben.
× × ×
»Okay! Sobald unsere beiden Freunde wieder rauskommen, könnt ihr sie abgreifen.«
Der SOG-Operator mit dem Decknamen Honi Salam hatte den großen Baustrahler genau auf den Eingang der Radarkuppel ausgerichtet, den Finger auf dem Schalter. Das unvorsichtige Zweierteam aus Molenbeek, das sich schon am Vortag von seinen beiden Kollegen in den Ghillie-Suits hatte einfangen lassen, befand sich bereits – betreten und enttäuscht – in dem großen, isoliert gelegenen Ferienhaus, das in der Nähe von Longfaye für das »Auswahlwochenende« angemietet war. Sie waren nutzloser Ballast. Gleich am Montag würde Honi die beiden auf den Weg in die Türkei und über die Grenze in den Irak schicken. Dort konnte man sie mit einem Sprenggürtel um die Hüften ins Paradies und zu den legendären zweiundsiebzig Jungfrauen schicken, und damit war gesichert, dass sie sich nicht versehentlich in ihrem heimatlichen Molenbeek, wo die belgischen Sicherheitsdienste die lokale Dschihadisten-Szene relativ gut im Auge hatten, verplapperten. Ein schneller und billiger Weg, die Dummen und Unfähigen loszuwerden, die sie gelegentlich versehentlich rekrutierten.
Das zweite Team, Abū Sufyān und Abu Talib, die beiden Knastfreunde von Fahem und Ahmadi, waren zwar keine großen Leuchten, aber sie konnten in der Zukunft problemlos für irgendetwas innerhalb Belgiens benutzt werden, das keine allzu große Intelligenz erforderte. Die beiden warteten im Campingcar in der ehemaligen Raketenhalle. Der Landwirt, der die ausgediente und leer geräumte ehemalige NIKE-Raketenbasis seit rund zwanzig Jahren gepachtet hatte, benutzte die leeren Hallen als Lager für Maschinen, Heu und Stroh oder als Unterstand für seine Rinder, die die riesigen Grünflächen auf dem ehemaligen Hochsicherheitsbereich um die Abschussrampen der atomaren Sprengköpfe beweideten. Neben der Landwirtschaft verdiente sich der Bauer eine goldene Nase damit, seine »geheime NATO-Raketenbasis« für Bares an Paintball-Gruppen aus den Anrainerländern zu vermieten. In dieser Einöde konnte man Woodlandspiele mit Tarnkleidung durchziehen, ohne dabei von gutmenschelnden Beobachtern sofort als Neonazis, Wehrsportler und Kriegsverherrlicher abgestempelt zu werden. Die SOG »buchten« regelmäßig bei ihm, um ihre Rekruten diskret und unter lebensechten Bedingungen auszutesten.
Der Operator, der unter dem Decknamen Salah Bensaid arbeitete, tippte seinen SOG-Kollegen Honi Salam leicht an und streckte ihm einen kleinen Tablet-PC hin, auf dem sie über die Mini-Kameras mit Bewegungsmeldern beobachten konnten, was unterhalb der alten, ausgedienten Radarkuppel vorging. Die beiden Jungs aus Charleroi hatten ihre Sache überraschend professionell geplant und die Sprengbrot-Dummys aus bunter Knetmasse korrekt an der ausgedienten Antennenstruktur befestigt. Obwohl ihnen die Sprengbrote von Abū Sufyān und Abu Talib fehlten, hätten sie so im Rahmen eines echten Terroranschlags gegen ein funktionierendes Radom durchaus erheblichen Schaden angerichtet.
»Sie dürften gleich rauskommen«, flüsterte Honi in sein Kehlkopfmikrofon. »Wir blenden sie mit dem Baustrahler. Ihr springt sie an, werft sie zu Boden und macht ein bisschen Druck. Dann könnt ihr sie loslassen und euch in Luft auflösen. Wir kümmern uns um den Rest.«
»Roger and Over!«, antwortete einer der Ghuillie-Suits amüsiert. Ihr Fahrzeug stand in einem Hangar des riesigen ausgedienten Militärgeländes versteckt. Sie würden sich umgehend aus dem Staub machen und ins Radisson Blu im nahe gelegenen Spa zurückdüsen, wo sie sich eingemietet hatten. Hier wollten sie sich ein paar Stunden ausruhen und dann mit der Standseilbahn zu den Thermen fahren und von einem erholsamen Sonntag mit Wasser und Wellness profitieren, bevor sie am Abend zurück nach Anderlecht fuhren.
Teil 1
ERSTES KAPITEL
Frankreich – Paris – Montmartre
Ben Kingsley setzte sich mit einer Tasse Tee vor den Computer. Er war zufrieden. Der Kontakt, den sein Freund Saif ihm besorgt hatte, besaß genau das richtige Profil. Das Treffen war positiv verlaufen. Er hatte den Mann glauben gemacht, dass er eine in gewissen Kreisen bekannte, islamische, karitative Organisation repräsentierte. Er hatte dabei die Rolle eines wohlhabenden Geschäftsmanns aus Katar gespielt, der sich persönlich und finanziell engagierte, um islamische Bildungsinitiativen zu fördern und das Studium der arabischen Sprache und des Korans zu unterstützen.
Der Kontaktmann hatte einen für Frankreich typischen Migrationshintergrund. Seine Koranschule war natürlich völlig illegal. Doch er hatte enormen Einfluss auf die angeschlossene offizielle Moscheengemeinde seiner Banlieue und er bekam regelmäßig Ärger mit der Polizei und dem Staatsschutz, weil er ungezügelt und in arabischer Sprache zur Gewalt gegen Juden aufrief. Der Kontaktmann, der sich selbst als »Imam« bezeichnete, stellte dabei auch noch die Französische Republik infrage und hielt seine Koranschüler dazu an, die französischen Gesetze zu missachten und einzig nach den Gesetzen der Scharia zu leben. Aber dem Mann fehlte es an Geld und an den entsprechenden Kontakten, um willige Mitglieder seiner »Studiengruppe« auf den Weg nach Afghanistan oder in den Irak zu schicken, um dort das Kämpfen zu lernen.
Der selbst ernannte Imam war motiviert und ambitioniert. Er war nur noch einen ganz kleinen Schritt davon entfernt, aktiv zur Gewalt auf französischem Boden aufzurufen. Ben Kingsley war überzeugt, dass die zornigen jungen Männer, die in seiner illegalen Koranschule »studierten«, ihm folgen würden. Die Saudis hatten den Prediger eher durch einen Zufall entdeckt, als er in ihrer Botschaft in Paris vorgesprochen hatte. Er wollte ein Stipendium, um in Saudi-Arabien den Islam zu studieren. Ihre Botschaftsangehörigen untersuchten den Hintergrund solcher Leute immer gründlich und schickten anschließend entsprechende Einschätzungen nach Riad. Da Prinz Mukrin als Chef des saudischen Auslandsnachrichtendienstes nicht wusste, was er mit solchen Informationen tun sollte, reichte der Al Muchābarāt die besten Profile meist an Saifs Dienststelle weiter. Saif hatte eine Liste mit Namen von Sympathisanten, die seinen Agenten auch gelegentlich als Laufburschen und Handlanger dienten.
Ben hatte schon nach kurzem Gespräch mit dem selbst ernannten Imam gefühlt: Wenn man diesem Mann richtig zur Hand ging, dann würde er bereitwillig etwas organisieren. Er hatte eine eigene Website, bloggte aktiv, unterhielt ein Internetforum, auf dem ihm »Brüder und Schwestern«, die nicht in seine Koranschule kommen konnten, Fragen stellten. Vor ein paar Monaten hatte er gar angefangen, das neue Videoportal YouTube zu nutzen, um dort seine sogenannten Lehrveranstaltungen zu verbreiten, meist zweisprachig auf Arabisch mit französischen Untertiteln. Nicht hollywoodreif, aber beachtlich für einen Schulabbrecher und ehemaligen Kriminellen mit Gefängniserfahrung, der Allah und dem Koran erst hinter den Gittern der berüchtigten Haftanstalt von Fresnes begegnet war. Der Möchtegern-Imam war ambitioniert, er hatte Organisationstalent und er hatte das nötige Charisma. Ein Vorzeige-Gefährder mit perfektem Profil war genau, was Ben Kingsley in den Reihen seiner künftigen Schattenkrieger in Frankreich noch gefehlt hatte.
Die meisten Frauen und Mädchen, die in den unansehnlichen Wohntürmen im Viertel des Predigers lebten, trugen bereits resigniert irgendeine Form der Verschleierung, nur um von ihm und seinen Koranschülern in Ruhe gelassen zu werden. Die älteren Männer kuschten aus Furcht vor der Aggressivität ihrer Söhne oder Enkel. Die letzten in den unansehnlichen Betonblöcken verbliebenen Franzosen ohne nordafrikanischen Migrationshintergrund waren dabei, aufzugeben und wegzuziehen. Die Polizei traute sich schon lange nicht mehr in diese Ecke der Pariser Banlieue. Villiers le-Bel war eine rechtsfreie Zone, in der selbst Krankenwagen oder Feuerwehrfahrzeuge regelmäßig angegriffen und mit Molotowcocktails und Steinen beworfen oder sogar beschossen wurden. Männer aus Ben Kingsleys SAD-Team hatten dort innerhalb von achtundvierzig Stunden sämtliche illegalen Händler identifiziert und eine Auswahl von Schnellfeuerwaffen und Handfeuerwaffen zu Discountpreisen angeboten bekommen: Kalaschnikows gab es schon ab tausend Euro, hochwertige Handfeuerwaffen bereits ab achthundert.
Die ortsansässigen Banden nordafrikanischer Jugendlicher beherrschten das Bild. Sie lungerten in jedem Hauseingang, auf jedem kleinen Grünstreifen. Arbeitslos und vor allem auch arbeitsunwillig lebte eine Mehrheit von Sozialhilfe, Kleinkriminalität und den nicht unerheblichen Einkünften ihrer Söhne aus dem Drogenhandel. Und alle zusammen verachteten »les petits blancs« – »die kleinen Weißen«.
Unter dem Druck des radikalen Imams war es üblich geworden, sämtliche Nachbarn ohne den entsprechenden Migrationshintergrund als Ungläubige zu beschimpfen und die wenigen noch verbliebenen Ladengeschäfte von asiatischen oder christlichen schwarz- afrikanischen Besitzern entweder systematisch zu boykottieren oder gleich kaputt zu schlagen. Es war guter Ton, regelmäßig Mülltonnen und Autos in Brand zu stecken und jede Form der vom französischen Staat finanzierten Infrastruktur zu zerstören, wenn die staatliche Autorität ihnen irgendetwas abzufordern versuchte, das ihnen nicht passte. Die ortsansässigen Bandenchefs unterstützten den Imam dabei ohne Wenn und Aber, denn er half ihnen, das Viertel als völlig rechtsfreien Raum zu halten. Sie waren in diesem Augenblick allerdings auch die Einzigen, die ihn und seine illegale Koranschule finanziell unterstützten.
Ben Kingsley hatte sich mit seinem künftigen Star-Imam natürlich nicht in der Pariser Banlieue getroffen. Sie waren zusammen durch den Jardin des Serres d’Auteuil gewandert. Er liebte diesen Ort im Spätherbst, und sein neuer Freund begriff, dass es unmöglich war, diesen Teil des riesigen Botanischen Gartens von Paris auch nur ansatzweise mit Videokameras zu überwachen: geradezu ein Traumort für ein konspiratives Treffen im Herzen der französischen Hauptstadt.
Sein »Neuer« befand sich schon länger im Visier der französischen Sicherheitsdienste, und die überwachten ihre Hassprediger und potenziellen Gefährder systematisch. Sie hatten dafür entsprechende technische Hilfsmittel und eine ganze Menge gut ausgebildetes und motiviertes Personal einschließlich Mitarbeitern, die fließend Arabisch in den unterschiedlichen nordafrikanischen Varianten sprachen und auch äußerlich nicht auffielen.
Ben Kingsley warf zuerst einen kurzen Blick auf seinen E-Mail- Eingang, dann skypte er seinen Chef Frank Mahooney an. Sie hatten täglich ein konkretes Zeitfenster für ihre Gespräche unter vier Augen vereinbart. Er hoffte, dass Frank inzwischen etwas über die Männer herausgefunden hatte, die Jones’ russische Söldner und ihren Anführer Matveev niedergekämpft und das Dorf Rustam Kalay in Schutt und Asche gelegt hatten. Der entkommene Gefangene war bedauerlicherweise vom Erdboden verschwunden geblieben. Weder die Suche in Richtung Qalat und entlang der Ring Road noch die Suche an der Grenze zu den Stammesgebieten und zu Pakistan hatten etwas ergeben. Er war zwar, wie Jones auch, inzwischen gewillt zu akzeptieren, dass der Unbekannte höchstwahrscheinlich einfach irgendwo in den Bergen krepiert war, aber er brauchte gleichzeitig auch die Gewissheit, dass in Iskanderga’l alles so weitergehen konnte wie bisher. Taher hatte gerade mit der Freilegung der dritten Kammer begonnen und bei ihrem letzten Gespräch angedeutet, dass der Inhalt ihre wildesten Erwartungen übertraf.
Mahooneys kantiges Kriegergesicht erschien umgehend auf dem Computerbildschirm.
»Wir können die ganze Sache anlaufen lassen, Frank«, erklärte Ben Kingsley dem Director of National Intelligence. Er hatte das soziale Klima in Frankreich analysiert. Das Land war reif. Es war nicht schwierig, einen innenpolitischen Brandsatz zu legen und die Schuld dabei radikalislamistischen Organisationen in die Schuhe zu schieben, wenn man von Anfang an die richtigen Täterprofile auswählte mit dem richtigen persönlichen Hintergrund. Sämtliche seiner »Schattenkrieger« zeigten entsprechende Spuren der Radikalisierung, die Polizei und Sicherheitsbehörden ohne große Schwierigkeiten finden konnten. Einige waren gar schon aktenkundig; die sogenannten Fichier S.
In Belgien war es noch einfacher als in Frankreich. Ben verschwendete kaum Energie auf das Land, in dem sich außer dem riesigen Verwaltungsapparat der EU-Kommission auch das Hauptquartier der NATO befand. Er kannte sich dort aus und verfügte seit den Jahren seines Vaters als US-Botschafter in Brüssel über ausgezeichnete Kontakte. Ein einfacher Telefonanruf oder eine SMS genügten, um eine belgische Aktion ins Rollen zu bringen. Sein Team war undercover in Belgien ansässig und »bediente« von dort aus den Süden, Frankreich, Benelux und Deutschland. In Belgien funktionierten auch der Polizei- und Sicherheitsapparat nicht sonderlich gut. Und der Verwaltungs-Wirrwarr, der auf der Teilung des Landes zwischen Flamen und Wallonen gewachsen war, erleichterte jede Form der kriminellen Aktivität noch zusätzlich. Nicht nur fehlte es den Belgiern an finanziellen Mitteln, an qualifiziertem Personal und an entsprechenden Technologien im Inlandsgeheimdienst, um die große Gruppe der potenziellen Gefährder korrekt zu überwachen, die verschiedenen Behörden tauschten sich untereinander auch nicht aus.
In den Brüsseler Problembezirken Molenbeek und Anderlecht oder in Antwerpen gab es völlig abgeschottete Gemeinschaften von Einwanderern aus Nordafrika und dem Nahen Osten, in denen seit Jahren radikale Islamisten mit Kampferfahrung aus den Kriegen in Ex-Jugoslawien, Afghanistan und im Irak untertauchten. Sie rekrutierten dort, während sie sich ausruhten, neues Gotteskrieger-Material und knüpften ihr europäisches Netzwerk weiter. Der Dschihadisten-Tourismus war gut organisiert, und Belgien als europäische Drehscheibe im illegalen Handel mit Waffen machte es zu einem Kinderspiel, sich alles, von der Pistole über diverse Sprengstoffe bis zu Sturmgewehren, schnell, unkompliziert und billig zu besorgen.
Ben wusste genau, wen man aus der in Belgien ansässigen Islamistentruppe nach Bedarf und mit einfachen Mitteln manipulieren und instrumentalisieren konnte. Die meisten Männer waren auch kriminell unterwegs und konnten nicht nur problemlos Waffen besorgen, sondern auch Fahrzeuge, Papiere und konspirative Unterkünfte. Sie waren eine gut vernetzte und gewaltbereite Szene. Dank der Schengen-Zone gab es einen »kleinen Grenzverkehr« mit sämtlichen Nachbarstaaten, den Kingsley sich für die Operation Regen- bogen zunutze machte.
»Wir müssen nur noch ein paar zusätzliche konspirative Wohnungen einrichten, Frank«, erklärte er seinem Freund und Vorgesetzten auf der anderen Seite des Atlantiks. »Es gibt da ein paar Ecken im Großraum Paris, die sind völlig rechtsfreier Raum. Da traut sich die Polizei nicht rein. Selbst die Feuerwehr oder Rettungsfahrzeuge werden systematisch angegriffen.«
»Es ist wichtig, dass die gesamte Bevölkerung ausreichend erschüttert wird, Ben. Es muss allen eine Heidenangst einjagen – bis ganz nach oben in die politische Führung des Landes.«
Der General dachte an ein Szenario, bei dem es auch ein paar minderjährige Opfer geben würde. Wenn Kinder zwischen die Fronten gerieten, empörte sich ganz Frankreich und forderte schnell strengeres staatliches Eingreifen, »… und zwar über Parteigrenzen und politische Meinungsrichtungen hinweg«. »Sobald wir den Probelauf gemacht haben, Frank.«
»Wie weit ist die Gruppe, Ben?«
»Prêt à l’emploi«, amüsierte sich der amerikanische Geheimdienstmann, »die Jungs sind betriebsbereit.«
»Und was will dein brandneuer, vielversprechender inoffizieller Mitarbeiter für sich persönlich?«
Frank Mahooney erinnerte sich, wie sie während der Siebziger- und frühen Achtzigerjahre ihre wichtigsten europäischen Verbündeten erfolgreich manipulierten, indem sie die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffenen geheimen paramilitärischen Einheiten der Operation Gladiostay-behind einsetzten. Der Erfolg hatte allerdings seinen Preis gehabt; politisch wie auch finanziell. Die Anführer der erfolgreichsten Gruppen waren zwar alle stramme Antikommunisten gewesen, aber sie waren auch alle intelligent genug gewesen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und sich aus den schwarzen Kassen der CIA stolze Summen bezahlen zu lassen.
Washington und die britische Regierung hatten damals Angst gehabt, dass der Einzug der Kommunisten in die Regierungen verschiedener Mitgliedsstaaten die NATO von innen heraus schwächen und sowjetischen Agitatoren Tür und Tor öffnen würde. Um dies zu verhindern, hatten sie die Bevölkerungen der gefährdeten Länder – Italien, Belgien, Deutschland, Luxemburg und Griechenland – massiv manipuliert. Die von ihnen ausgebildeten Kommandokämpfer der Staybehind-Gruppen der Operation Gladio, von denen viele aus dem rechtsextremen politischen Spektrum kamen, hatten reihenweise terroristische Anschläge ausgeführt. Diese waren dann durch manipulierte Spuren systematisch politischen Gegnern – Linken, Sozialisten, Kommunisten und Umweltschutz-Aktivisten – angelastet worden. Und sie hatten es geschafft, Einflussagenten bei den Linken einzuschleusen, die die Idioten in deren Reihen dazu aufheizten, politische Verbrechen zu begehen: Entführungen von Wirtschaftsbossen, Politikern oder Richtern, Bombenterror … Meist waren es junge Leute aus guten Familien, die sich hatten einwickeln lassen. In Deutschland war es die RAF gewesen, die Rote-Armee-Fraktion. In Italien die Roten Brigaden und in Frankreich die Action Directe.
Gleichzeitig mit der CIA hatte auch der KGB diese Traumtänzer manipuliert. Sie hatten alle ein böses Ende gefunden. Die echten Profis, die noch im Zweiten Weltkrieg vom CIA-Vorgänger OSS und von ihren britischen Verbündeten des MI-6 ausgebildet worden waren, hatten die Drecksarbeit erledigt und waren unentdeckt entkommen. Die meisten von ihnen waren jetzt im friedlichen Ruhestand und profitierten von dem guten Geld, das man ihnen bezahlt hatte. Lediglich 1983 beim Anschlag auf das Münchner Oktoberfest war der deutschen Polizei schnell klar geworden, dass der Attentäter aus einer rechtsextremen Gruppe kam und kein Maoist, Trotzkist oder anderer Kommunist gewesen war. Doch dem zum Trotz: Die jeweilige Bevölkerung hatte – durch den blinden Terror eingeschüchtert – immer nach mehr Polizei, weniger Freiheitsrechten und weiterer Überwachung durch den Staat und nach einer stärkeren militärischen Präsenz des großen amerikanischen Verbündeten in Europa gerufen. Und Wahlen, die dem Blutvergießen folgten, hatten fast immer entsprechende, den USA genehme Politiker in Amt und Würden gebracht, ohne dabei den Verdacht zu erwecken, dass die Demokratie manipuliert wurde.
Es war ein Unglück, dass die Operation Gladiostay-behind wegen eines zu neugierigen italienischen Untersuchungsrichters aufgeflogen war. Das Europaparlament hatte nach einer hitzigen Debatte am 22. November 1990 seinen scharfen Protest gegenüber der NATO und den beteiligten Geheimdiensten ausgedrückt, und sie hatten den ganzen Laden über Nacht dichtmachen müssen.
Aus ihren alten Fehlern klug geworden, hatten sie im Nachgang zu den ersten Anschlägen von bin Ladens al-Qaida, nach dem Ersten Golfkrieg, eine Wiedergeburt des Konzepts von A bis Z überdacht und eine neue »Strategie der Spannung« geschrieben. Sie richteten die neuen Strukturen unauffälliger ein als die der alten Gladio-staybehind-Gruppen, denn sie wussten, dass sie ihre europäischen Verbündeten in diesem neuen »Kalten Krieg« brauchen würden, um mit der nicht wirklich fassbaren Bedrohung des politischen Islams fertigzuwerden.
Sie verstanden, dass sie Feuer nur mit Feuer bekämpfen konnten. Es würde für mindestens ein Vierteljahrhundert sehr schmutzig werden. Bereits jetzt sahen sie im Irak, dass es mit den Mitteln und Möglichkeiten des zivilisierten und kodifizierten Krieges, den hoch entwickelte Industrienationen im Rahmen internationaler Organisationen und Konventionen nach dem 8. Mai 1945 festgeschrieben hatten, unmöglich war, mit dieser neuen und nichtlinearen Bedrohung fertigzuwerden. Aus diesem Grund blieb nur die harte Methode. Terror eignete sich vor diesem Hintergrund mehr als jede andere Strategie, um große Bevölkerungsmassen, die gewaltentwöhnt waren und behütet und sicher lebten, schnell und relativ einfach zu manipulieren.
Ben Kingsley grinste seinen Chef an: »Mein Spitzengefährder will das Übliche, Frank. Er will Geld und Hilfe, um seine Gefolgsleute in den Heiligen Krieg zu schicken. Dorthin, wo echte Action ist: in den Irak oder nach Afghanistan.«
»Wie viele Rekruten für anspruchsvolle Aufgaben hast du jetzt eigentlich in Frankreich, Ben?«
General Frank Mahooney schmunzelte. Die Worte des Jüngeren auf der anderen Seite des Bildschirms erinnerten ihn an den Lieblingssatz seines Vaters: »Jeden Tag steht ein Dummer auf. Du musst ihn nur finden!« Ben war ein wahrer Meister im Auffinden solcher Vollidioten.
Kingsley strahlte:
»Ich habe schon ein Dutzend, Frank! Von allerbester Qualität. Alle haben einen kriminellen Hintergrund, die meisten waren im Gefängnis und sind den Behörden auch schon wegen ihrer radikalislamischen Ideen ins Auge gesprungen«, sagte er mit einem fast väterlich anmutenden Stolz. »Meine künftigen ›Gotteskrieger‹ sind reif wie Rohmilch-Camembert nach einundzwanzig Tagen!«
»Und Belgien?«
Kingsley machte eine abwiegelnde Handbewegung:
»Belgien, Frank … Belgien ist das europäische Zuchtbecken für qualitativ hochwertige, radikale Islamisten. In Molenbeek, Verviers oder Leuven reicht es, einmal mit dem Käscher durchzufahren, und du hast zwei Dutzend auf einen Streich, die bereits kampferfahren sind und schon Zeit in Afghanistan, im Irak oder in Subsahara-Afrika verbracht haben. Und sie sind erstklassig indoktriniert. Die leben abgeschottet und in einer völlig anderen Welt. Dagegen sind Birmingham und Londonistan geradezu Horte intellektueller Aufklärung und Modernität. In Molenbeek habe ich von selbst ernannten Scharia-Experten Sachen gehört, die selbst Abdul-Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh, der reaktionäre Großmufti von Saudi-Arabien, als obskurantistisch abtäte.
Mahooney schüttelte vor seinem Computerbildschirm auf der anderen Seite des Atlantiks belustigt den Kopf. Sein jüngerer Protegé war einer der besten Experten der US-Intelligence-Community, was den radikalen und politisierten Islam anging. Und er kannte sich genauso gut in Frankreich, den Benelux-Ländern und Deutschland aus wie auf der Arabischen Halbinsel und in zahlreichen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Während der Operation Cyclone gegen die Sowjets hatte er seine ersten Schritte als Geheimdienstoperator in Afghanistan gemacht. Ben hatte, dank der Ausgrabungen, an denen er als Archäologiestudent teilgenommen hatte, ausgezeichnete Kenntnisse der arabischen und persischen Sprache. Seine Kindheit in Louisiana, die Besuche in den Schulferien bei den Großeltern in Frankreich, die väterliche Botschaft in Belgien: Sein Französisch war perfekt. Und er schwamm in den undurchsichtigen Wassern wie ein Fisch. Er konnte nicht nur den perfekten Franzosen oder Belgier mimen. Er war auch als Golfaraber so gut, dass ihre saudischen Freunde regelmäßig beeindruckt waren, wenn er sich »verkleidete«.
Ben Kingsley war einer der Ersten gewesen, der nach 9/11 die geopolitischen Auswirkungen des Bruchs zwischen den Schiiten und Sunniten richtig analysiert und auf diesem basierend vorgeschlagen hatte, den ewigen innerislamischen Streit, den schon Mohammed prophezeite, zu benutzen. Bens Lieblingszitat des Propheten war dabei fast schon eine Strategie:
»Die Kinder Israels spalteten sich in 71 Gruppen und die Gemeinde Jesu in 72. Meine Gemeinde wird sich in 73 spalten, von denen alle in die Hölle fahren werden – bis auf eine.«
»Ich lasse dir selbstverständlich freie Hand, mein Junge«, antwortete Mahooney. »Und wenn dein neuer Star-Imam wirklich nichts anderes will als Hilfe, um seine Märtyrer in spe aus ihrem Pariser Vorort in den Irak oder nach Afghanistan zu schicken, damit sie sich dort in die Luft sprengen können – da helfen wir ihm gerne.«
»Ich werde erst einmal dafür sorgen, dass mein ›Star-Imam‹ Bares auf die Hand bekommt und eine solide Spende für sein Gemeinschaftszentrum Al-Essallam, damit die französischen Kollegen im entsprechenden Moment eine Geldspur nach Katar finden. Da die Mächtigen in Paris die Herrscherfamilie Al Thani so sehr lieben, wird eine Geldspur nach Doha alle in helle Aufregung versetzen, die während der letzten Legislatur ein politisches Amt innehatten. Und die neue Regierung bekommt garantiert ziemliches Herzflattern, denn die Investitionen aus dem Emirat haben großes volkswirtschaftliches Gewicht. Investoren aus dem Umfeld des Scheichs halten Aktienpakete in Schlüsselunternehmen, und die Al-Thanis wiederum kaufen Waffen und halten Dassault, Thales, Safran und die anderen französischen Rüstungsschmieden in Brot und Arbeit. Eine terroristische Aktion, deren Spuren nach Katar führen! Das widerliche Frettchen, das seit dem 6. Mai im Élysée-Palast sitzt, wird ausflippen und um sich schlagen.«
Mahooney nickte seinem Untergebenen zu und klopfte mit der flachen Hand auf eine Mappe auf seinem Schreibtisch.
Der neue französische Staatschef Louis Poniatowski hatte erste persönliche Kontakte mit Hamad Ben Khalifa Al Thani geschmiedet, als er noch Innenminister am Place Beauveau gewesen war. Sein Kabinettsdirektor, den die amerikanische Geheimdienst-Community sehr gut kannte, seitdem er vor einem Vierteljahrhundert frisch diplomiert von der Kaderschmiede ENA zum ersten Mal an einem Seminar des brandneuen Thinktanks »The Euro-Atlantic Alliance for Democratic Progress« teilgenommen hatte, hatte vor fünf Jahren alles eingetütet. Der Politiker war damals gezielt dazu verführt worden, sich hinter dem Rücken des amtierenden Präsidenten, seines politischen Ziehvaters, ein einflussreiches Netzwerk aufzubauen, das ihm irgendwann einmal nützlich sein konnte, um seine Ambitionen auf das höchste Staatsamt umzusetzen.
»Die französischen Konservativen werden kurzfristig nicht mehr wissen, auf welchem Fuß sie tanzen sollen. Wir fahren sie an die Wand. Wir fahren Präsident Poniatowski an die Wand. Schlucken, Maul halten und mitspielen, oder alle Welt erfährt von den ›unsäglichen‹ Verbindungen der französischen Polit- und Wirtschaftselite zu den ›Terror-Bankern‹ von Katar. Es wird natürlich nicht so einfach sein wie mit den Deutschen, oder so kooperativ wie mit den Briten. Aber es ist wichtig, auch die Franzosen einzunorden und dafür zu sorgen, dass sie in den internationalen Gremien nicht mehr ausscheren und sich auch im Rahmen der NATO unterordnen.« Ben Kingsley schüttelte leicht den Kopf:
»Dazu bedarf es keiner verdeckten Operation, Frank. Alles deutet darauf hin, dass Präsident Poniatowski diesen Schritt sowieso unternehmen möchte. Wenn auch nicht aus den Gründen, aus denen wir die Franzosen gerne wieder in der militärischen NATO integriert sehen möchten. Meine Quellen im Élysée und der Kontakt im Kabinett des Verteidigungsministers haben sogar schon einen Zeitplan angedeutet. Die Rede ist von maximal vierundzwanzig Monaten. Trotzdem wird es erheblich mehr als nur einen mittleren Skandal um ein Golfemirat und Parteienfinanzierung brauchen, mach dir da nichts vor.«
Mahooneys scharf geschnittenes Kriegergesicht verzog sich vor dem Bildschirm auf der anderen Seite des Atlantiks zu einem breiten Grinsen. Er wirkte plötzlich um Jahre jünger:
»Überrasche mich, mein Freund! Ich bin zu jeder Schandtat bereit!«
Er wusste, dass seine Tage als Director of National Intelligence gezählt waren. Er hatte seinem Land, mit einer kurzen Unterbrechung von gerade einmal drei Jahren in der Privatwirtschaft, vierzig Jahre lang treu gedient. Aber er wurde nicht jünger, und er gehörte zu der seltenen Kategorie Menschen im US-amerikanischen Staatsdienst, die sich ein Leben ohne ihre Position und das damit verbundene Prestige sehr gut vorstellen konnten. Aus diesem Grund bemühte er sich, eine Auswahl jüngerer Leute zu protegieren, die in der sehr exklusiven und geschlossenen US-Intelligence-Community seine Nachfolge antreten konnten, sobald er keine Lust mehr hatte, den Job zu machen.
Ben Kingsley gehörte zu Mahooneys Protegés. Er war wahrscheinlich sogar derjenige mit dem größten Potenzial, denn er hatte einen Hintergrund, der ihn nicht nur für die siebzehn US-Nachrichtendienste akzeptabel machte, sondern auch für die Teile der Streitkräfte, die eng mit ihnen zusammenarbeiteten. Er kam aus dem US Special Forces Command und war ein Ehemaliger der Delta Forces, genauso wie Mahooney selbst. Doch Ben war auch sehr eigenwillig. Mit großer Leidenschaft verlor er sich immer wieder in seinen akademischen Spielereien, und er schaffte es, die höheren Ziele verdeckter Operationen aus den Augen zu verlieren, weil er sich auf der operativen Ebene im Mikro-Management verzettelte.
»Ich verlasse mich ganz auf dich. Du kennst den Zeitrahmen«, meinte Mahooney zu seinem Zögling.
Der Islam war in der öffentlichen Wahrnehmung der westlichen Welt inzwischen genau das, was in den Tagen der Sowjetunion der Kommunismus gewesen war: ein unberechenbarer, gewalttätiger, auf die Weltherrschaft zielender, völlig skrupelloser Gegner. Im Jahr 1979 hatte der politische, fundamentalistische und gewalttätige Islam es geschafft, dem Kommunismus als Weltdogma fast unbemerkt den Rang abzulaufen.
Frank Mahooney erinnerte sich noch ganz genau, wie der Stein ins Rollen gekommen war: Es war weder die iranische Revolution und die Rückkehr aus dem Exil des Ayatollah Khomeini am 1. Februar 1979 gewesen noch der Einmarsch der Sowjets in Afghanistan am 25. Dezember des gleichen Jahres.
Alles hatte am 20. November kurz nach halb sechs Uhr morgens angefangen, im Innenhof der Großen Moschee von Mekka, wo Tausende argloser Gläubiger sich zu einem ganz speziellen Morgengebet versammelt hatten. Man feierte ein neues Jahrhundert nach islamischer Zeitrechnung, den 1. Muharram des Jahres 1400.
Nur Augenblicke später hatte ein Mann mit schulterlangem, lockigem, schwarzem Haar dem Imam das Mikrofon entrissen, während Horden schwer bewaffneter sunnitischer Fundamentalisten das wichtigste Heiligtum des Islams in Mekka stürmten: die Moschee. Endlich – so predigte der Lockige wild – erfüllte sich die uralte Prophezeiung, das Weltende und der finale Sieg des Islams über den Unglauben standen bevor. Dschuhaiman Ibn Seif al-Uteibi, ehemaliger Korporal der saudischen Nationalgarde und Anführer der Bewaffneten, war zu dieser Zeit in seiner Heimat ein prominenter Gegner des saudischen Königshauses und vor allem der rasenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Modernisierung des Landes mit dem Ölboom. Und Dschuhaiman hatte nur ein Jahr zuvor in einem Studenten der Religionswissenschaften der Universität Riad – Mohammed Abdullah al-Kahtani – den »Mahdi« entdeckt, den Auserwählten, der in einem apokalyptischen Krieg gegen Christen und Juden siegen, eine ideale Gesellschaft gründen und die islamische Welt regieren würde.
Der Überlieferung nach erschien der Mahdi zu Beginn eines neuen muslimischen Jahrhunderts an der Kaaba in Mekka. Dschuhaiman hatte alles in die Wege geleitet, um der Prophezeiung zu helfen, sich zu erfüllen.
Der saudische König Chalid wollte damals sein Militär gegen die Terroristen losschicken, um dem Spuk ein Ende zu setzen, doch der Prophet hatte ausdrücklich das Kämpfen in der heiligen Stadt Mekka untersagt. Chalid wusste, dass ihn nur eine Fatwa, ein religiöses Gutachten, aus der Zwickmühle befreien konnte. Doch die von ihm angerufenen Religionsgelehrten standen selbst vor einem Dilemma. Den von Dschuhaiman ausgerufenen Mahdi Mohammed Abdullah al-Kahtani erkannten sie natürlich nicht an. Aber sie teilen sämtliche fundamentalistischen Ideale der Rebellen und deren wütende Kritik an der Modernisierung des Landes.
Und so handeln die Gelehrten mit König Chalid einen Deal aus: Ihre Fatwa würde dem Königshaus ein gewaltsames Ende des Geiseldramas ermöglichen, aber im Gegenzug verpflichte sich der saudische Herrscher, die gesellschaftliche Liberalisierung wieder zurückzudrängen und einen Großteil der Milliardenerlöse aus dem Ölhandel zur weltweiten Verbreitung des wahhabitischen Islams einzusetzen. Faktisch zwangen die saudischen Religionsgelehrten das Königshaus Al-Saud damals, sich Dschuhaimans Programm zu eigen zu machen, um ihn loszuwerden. Und so veränderte sich das zuvor vorwärtsgewandte Saudi-Arabien zurück in einen islamisch-konservativen Staat.
Unterdessen verbreiten sich im ganzen Land die wildesten Gerüchte über die Ereignisse von Mekka. Selbst die CIA und die US-Diplomaten hatten nur Informationsbrocken. Washington nahm selbstverständlich an, dass Khomeini und das schiitische Ayatollah- Regime im Iran hinter dem Terror steckten. Und der Iran reagierte genauso selbstverständlich empört auf die Anschuldigungen und beschuldigte seinerseits umgehend Amerika, Israel und »den Westen«. Spekulationen über die angebliche »Attacke der Ungläubigen« auf das Heiligtum in Mekka verbreiteten sich rasend schnell in der gesamten muslimischen Welt. Daraufhin ging in Pakistan die US- Botschaft in Flammen auf, in Indien und Bangladesch attackierten Muslime US-Konsulate.
Erst am 4. Dezember 1979 konnte die Besetzung der großen Moschee gewaltsam beendet werden. Der angeblich unsterbliche Mahdi Mohammed Abdullah war bei den Kämpfen getötet worden. Sein Kriegsherr Dschuhaiman und knapp einhundert Getreue wurden gefangen genommen und anschließend hingerichtet.
Washington legte die leidige Geschichte von Mekka schnell zu den Akten und schloss sich der Darstellung des saudischen Königshauses an, das den Angriff als einen Akt religiös und geistig verwirrter Einzeltäter beschrieb. Dahinter steckte eine ganz gewaltige Portion Pragmatismus, gepaart mit einem fundamentalen Unverständnis für die arabische Welt.
Als die Sowjetunion dann am 12. Dezember 1979 den Einmarsch in Afghanistan beschloss, nutzten die CIA diese Gelegenheit sofort, um die islamische Wut umzulenken.
Mit Geld, Waffen und der begeisterten Hilfe des saudischen Königshauses formieren sie unter dem Codenamen Operation Cyclone eine Front fundamentalistischer Islamisten gegen die sowjetischen Invasoren, während sie gleichzeitig gewaltige Armeestützpunkte in den Golfstaaten aufbauten und sich zum militärischen Beistand für alle Staaten in der Golfregion verpflichteten. Diese von der Administration Carter beschlossene Doktrin war immer noch gültig, aber es wurde zunehmend schwieriger, sie im Alleingang, mit gelegentlicher Unterstützung der Briten und ihrer ehemaligen Commonwealth-Staaten und unter Ausnutzung der Situation durch die Israelis, umzusetzen und auf die Dauer in diesem großen Rahmen aufrechtzuerhalten.
Sie mussten, wie in den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als der Kommunismus ihr Gegner war, um jeden Preis überzeugen und engagierte Verbündete um sich scharen, die bereit waren, ohne Einschränkungen und Vorbehalte an ihrer Seite zu kämpfen, bis der politische, fundamentalistische Islam denselben Weg gehen würde, den der Kommunismus gegangen war, und der Islam im Allgemeinen genauso gezähmt sein würde wie heute die Russen und die Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes. Eine gewaltige Aufgabe!
Ben hatte den besonderen Auftrag während seiner Amtszeit als stellvertretender Direktor der Alliance Base, die Operation, der sie den Codenamen Regenbogen gegeben hatten, in Frankreich, dem Benelux und Deutschland – altem traditionellen EU-Kernland – anzuleiern und eine Reihe von Strukturen zu installieren, die es ihnen ermöglichen sollten, Regenbogen völlig unabhängig von offiziellen Budgets der US-Geheimdienste zu finanzieren. Ihr Ziel war es, langfristig diskret innenpolitischen Einfluss auf dieses wirtschaftliche und politische Kernland der Europäischen Union zu nehmen und dort einen ähnlichen sicherheitspolitischen Spannungsbogen zu schaffen wie den, der diese Länder in den Jahren des Kalten Krieges im Schulterschluss mit den USA gehalten hatte. Und es war wichtig, die Mitgliedsstaaten der wirtschaftlich starken EU, die im Bereich Verteidigung lediglich minimalistische Beträge investieren wollten, zu motivieren, die Ausgaben zu erhöhen und sofort verfügbare Waffensysteme in den USA zu kaufen, anstatt Eigenentwicklungen zu versuchen, die dann weltweit wieder Konkurrenzprodukte zu US-Entwicklungen darstellen würden.
Der 11. September 2001, der alle NATO-Mitglieder eng um die USA geeint hatte, lag schon Jahre zurück. Diese Einigkeit der Verbündeten löste sich gerade wieder auf, ähnlich, wie nach der deutschen Wiedervereinigung und dem Untergang der Sowjetunion. Und die Zivilgesellschaften der leidlich unwilligen Verbündeten reagierten immer unleidiger auf jede Form staatlicher Kontrolle und Überwachung. Seit dem Einmarsch in den Irak fühlten sie in den Gründungsmitgliedern der EU eine neue Form des Antiamerikanismus aufkeimen, die langfristig dazu führen würde, dass neue europäische Politiker in Amt und Würden gewählt würden, deren erstes Ziel eine real funktionierende, wirklich geeinte europäische Union in allen Bereichen war. Und falls ihnen dieser Schildbürgerstreich gelang, dann stand den USA plötzlich auf der internationalen Szene ein echter Konkurrent um die Vormachtstellung gegenüber, der eine liberale und demokratische Werteordnung gepaart mit wirtschaftlichem Erfolg und humanitären Werten anbieten konnte.
Mahooney wusste, das Problem waren wie immer die Franzosen. Sie hatten sich 1966 unter der Regierung Charles de Gaulle aus den militärischen, integrierten Kommandostrukturen der NATO verabschiedet, ihr eigenes Atomwaffenprogramm vorangetrieben und ein eigenständiges nationales Spionage- und Überwachungssystem entwickelt. Sie waren gerade dabei, sich auch noch solide eigene Mittel zur Satellitenaufklärung zu bewilligen, die sie in Kriegs- und Krisensituationen von amerikanischen Bildern unabhängig machen sollten. Und sie schafften es über bilaterale Kooperationen und die Gremien der Europäischen Union, die Deutschen immer stärker in ihren Bann zu ziehen. Der französische militärische Spionagesatellit Helios war bereits mit zwei deutschen Radarsatelliten verbunden. In ein paar Wochen würde ein dritter dazukommen. Im Austausch für die Integration ihrer Radarsatelliten bekamen die Deutschen dann Zugriff auf militärisches Bildmate- rial. Dadurch wurden sie de facto von den USA unabhängig. Genau das Gleiche geschah gerade mit den deutschen Zugängen zum »Frenchelon«, wie das französische Abhör- und Überwachungs- system scherzhaft in Anspielung auf ihr amerikanisches »Echelon« genannt wurde.
Mahooney fühlte, dass die Gefahr real war, Deutschland driftete von den USA weg. Und es würde der Tag kommen, an dem dieser Prozess einen Punkt erreichte, von dem es kein Zurück mehr gab.
Der Zweite Weltkrieg lag schon sechzig Jahre zurück. Die letzten aktiven Kriegsteilnehmer starben, und ihre Kinder, die in das durch den Marshallplan geschaffene deutsche Wirtschaftswunder hineingeboren worden waren, gingen in Rente. Die deutsche Dankbarkeit gegenüber Amerika verwässerte zusehends, und die jungen Generationen interessierten sich kaum noch für Politik. In ihren Augen war jeder Ausdruck militärischer Stärke schlecht.
Das zeigte sich gerade wieder im Rahmen der mühsamen Koalition in Afghanistan. Der Bundeswehr fehlte es an allem: vernünftiger Ausrüstung, einem soliden Mandat aus dem Bundestag und Rückhalt in der Bevölkerung. Der Bundesregierung mangelte es vor allem an Motivation. Und die Deutschen interessierten sich nicht für die ISAF-Mission am Hindukusch oder den Krieg gegen den Terror. Terrorismus war ihnen fremd geworden. Mogadischu kannten die meisten nur aus dem Kinohit von Ridley Scott Black Hawk Down. Mit »Landshut« brachten sie den Sitz der Regierung von Niederbayern in Verbindung. Die Jüngeren hatten die schwarzen Siebziger- und Achtzigerjahre und die RAF nicht erlebt. Die Älteren interessierten sich für ihren Sozialstaat, Vollbeschäftigung, Konsum, Selbstverwirklichung und den Erfolg ihrer Unternehmen. Patriotische Aspirationen beschränkten sich auf den Export von hochwertigen Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen oder innovativen Technologien und die Erwirtschaftung eines Außenhandelsüberschusses. Wenn die Deutschen ihre Flagge schwenkten und die Nationalhymne anstimmten, dann, um einen Sieg in einem internationalen Fußballturnier zu feiern.
Vor dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung hatte sich den meisten Deutschen der Sinn der NATO, der Bundeswehr und ernsthafter Landesverteidigung leichter erschlossen: Alle Gefahren für ihren Wohlstand und ihre freiheitliche Lebensart kamen aus dem Osten, gingen von der Sowjetunion und vom Kommunismus aus.
Seit der Wiedervereinigung und der Auflösung der UdSSR hatte sich das deutsche Blatt jedoch gewendet. Allerdings war die Kanzlerin eine überzeugte Atlantikerin, denn das Bündnis mit den USA nahm ihr das leidige Nachdenken über eine echte europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik im Schulterschluss mit den Franzosen ab. Sie mochte derartige Gedanken nicht, denn sie implizierten unweigerlich höhere Verteidigungsausgaben als die lauen 1,2 Prozent des Bruttosozialproduktes des reichsten Landes Europas, mit denen man sich im Moment durchlavierte.
»Unser Test läuft, Frank«, antwortete Ben Kingsley, »und am Freitag endet der Ramadan. Die Zeit reicht, um die restlichen Spuren zu legen. Und wenn sie sich schwertun sollten, die Fährte aufzunehmen, dann biete ich den Franzosen anschließend einfach über die Alliance Base unsere Hilfe an. Meine Informanten im Innenministerium und am 36, Quai des Orfèvres halten mich auf dem Laufenden.«
»Hast du eigentlich einen Plan, um deine ›Versuchskaninchen‹ elegant loszuwerden, falls sie sich ungeschickt anstellen oder irgendetwas in die Hose geht?«
Frank war neugierig. Er hatte Ben völlig freie Hand gelassen.
Der Jüngere grinste: »Warte ab, lass dich überraschen. Du wirst schon sehen.«
Das Szenario war geschrieben und vorbereitet: ein Showdown, der von den beiden Männern ausreichend übrig lassen würde, um sie zu identifizieren, und der so spektakulär war, dass jeder, der das sah, umgehend »Islam« und »Terrorismus« denken musste. Die Medien würden den Rest tun, um Panik heraufzubeschwören.
Ben wollte am Wochenende nicht nur wegen der Lieferung und der Antiquitäten nach Brüssel fahren, sondern vor allem, um den Einsatz mit den Männern im Detail zu besprechen, die in diesem Augenblick als »Paten« und Begleiter der belgischen Rekruten dienten.
Er wechselte das Thema:
»Hast du eigentlich etwas über die Typen herausfinden können, die uns auf der Grabungsstätte Ärger gemacht haben, Frank?«
Er hatte von Jones erfahren, dass die Suche nach dem entflohenen Überlebenden sowohl in Richtung Pakistan und der Stammesgebiete als auch Richtung Ring Road und Qalat erfolglos verlaufen war.
Dadullahs Cousin Borjahn hatte seine Leute ebenfalls losgeschickt. Auch sie hatten nichts gefunden. Drei von Jones’ Männern, die anschließend Kisten mit Fundstücken nach Kabul gebracht hatten, hatten sich dort selbst umgesehen und umgehört. Alles erfolglos. Über ein Zufallstreffen mit einem der Presseleute der ISAF hatten sie dann erfahren, dass der abgeschossene MedEvac als »Absturz aufgrund schlechter Witterungsbedingungen« zu den Akten gelegt worden war. Die Maschine war aus Kandahār gekommen.
Mahooney nickte und machte eine abwiegelnde Handbewegung.
»Es gibt keinen Grund zur Sorge, Ben.« Es war erstaunlich einfach gewesen, etwas herauszufinden. Er hatte nur rasch mit seinem Kontakt im US CENTCOM in Tampa gesprochen.
»Mitglieder einer französischen Einheit«, erklärte er. »Die Soldaten hatten Probleme mit ihrem GPS, sind dadurch von ihrer geplanten Strecke abgekommen und haben sich anschließend komplett verlaufen.«
Er erklärte Ben, dass die Männer aus Spin Boldak unterwegs gewesen waren. Die Soldaten des COS hatten keine der üblichen Routinepatrouillen in die Berge gemacht, sondern einen nationalen Auftrag ausgeführt. Alle sechs Mitglieder des Teams galten seit dem plötzlichen Verschwinden des MedEvac als vermisst. MIA – Missing in Action. Und seitdem die Wrackteile gefunden worden waren, waren sie offiziell KIA – Killed in Action. Der Chef des COS hatte dies in einer kurzen und klassifizierten Mitteilung gegenüber US CENTCOM bestätigt und darum gebeten, man möge kein Aufheben machen, da es nicht üblich war, Verluste des COS in Frankreich publik zu machen. US CENTCOM Bagram hatte Bens Lieblingssöldner Jones nicht informiert, weil die Strecke der Franzosen laut dem übermittelten OPLAN absolut kein Problem für die Grabungsstätte gewesen war.
»Dieser General, der die Special Forces befehligt, hat den Jungs im CENTCOM bereitwillig erzählt, warum die Leute unterwegs waren. Sie verfolgten eigene nationale Hinweise auf das Versteck des ehemaligen Taliban-Provinz-Gouverneurs von Zabul, Ahmad Jan. Sie wollten den Mann erwischen und nach Frankreich bringen, um ihn dort vor Gericht zu stellen.«
Der Kontakt hatte Mahooney sogar eine Kopie des OPLAN gemailt. Man vermutete schon lange, dass Ahmad Jan sich in der Gebirgsregion unweit der Stadt Mapan versteckt hielt, denn er hatte in der Gegend viele Verwandte.
Die Franzosen waren nicht die Einzigen, die den ehemaligen Taliban-Gouverneur unbedingt erwischen wollten, aber ihre Soldaten waren ganz offensichtlich die inkompetentesten und orientierungslosesten bei der Jagd nach diesem Mann, dem die CIA schon vor Jahren den Spitznamen »Terror-Banker« gegeben hatte. Er stand auch auf der US-Abschussliste, und es gab ein attraktives Kopfgeld. Doch sie jagten im Augenblick lediglich seine Kontaktleute im Ausland, denn sie hofften, so dem internationalen Hawala-Netzwerk von Ahmad Jan auf die Spur zu kommen. »Follow the Money!«
Auch die Spanier und die Deutschen interessierten sich für den Mann. Denen ging es allerdings, genau wie den Franzosen, nicht um die Schandtaten, die er als Taliban-Gouverneur der Provinz Zabul verübt hatte, oder um sein Hawala-Netzwerk. Sie wollten auch nicht herausfinden, wie es ihm gelang, innerhalb von Stunden substanzielle Summen in bar von einer auf die andere Seite der Welt zu verschicken. Sie suchten ihn wegen seiner Beihilfe zu einer Attentat- serie in den Jahren 2002 und 2003 auf Touristenzentren im nordafrikanischen Raum, bei denen eine große Anzahl von Landsleuten getötet und verletzt worden war. Ahmad Jan hatte den lokalen Attentätern die Sponsorengelder auf Bitte von Osama bin Laden selbst zukommen lassen.
Der Terror-Banker stand seit dem Ende der Neunzigerjahre auf der allgemeinen UN-Terrorliste, die mit dem Beschluss 1967 des Sicherheitsrates herausgegeben worden war. Darüber hinaus handelte der Mann international mit Rauschgift. Ganz am Anfang, in den Wochen nach 9/11, war er einer amerikanischen Spezialeinheit durch einen spektakulären Sprung aus einem Fenster in einem konspirativen Haus in Peschawar entkommen. Dabei hatte er Teile seiner Buchhaltung auf einem Laptop zurücklassen müssen. Der Computer hatte ihnen dann auch einigen Aufschluss zum Thema Drogen gegeben. Allerdings wussten sie immer noch viel zu wenig über die Hawala-Kontaktmänner, mit denen er in Europa und in den USA zusammenarbeitete. Der Zwischenfall führte damals zu erheblichen Spannungen mit den Pakistani, denn die waren über den unkoordinierten Zugriffsversuch auf ihrem Staatsgebiet nicht erfreut gewesen.
»Ich weiß, Frank. Die Franzosen sind wegen der Sachen in Marokko und in Tunesien schon seit Jahren hinter Ahmad Jan her«, antwortete Ben Kingsley. Er verbarg geschickt seine Erleichterung.
Natürlich wusste er persönlich schon seit Jahren, in welchem Haus in Mapan der ehemalige offizielle Taliban-Gouverneur und jetzige Schatten-Gouverneur von Zabul lebte. Er kannte natürlich auch den großen Wehrhof etwas außerhalb der Provinzstadt und rund drei Stunden Fußmarsch von Iskanderga’l entfernt, auf dem Ahmad Jan seine konspirativen Treffen veranstaltete. Doch der Mann war der Schwiegervater der Lieblingscousine von Dadullahs Frau Asma. Aus diesem Grund waren Ben Kingsley die Hände gebunden. Er hatte, während er noch in Langley gewesen war, die Zähne zusammengebissen und diskret dafür gesorgt, dass die CIA Ahmad Jan weitgehend in Ruhe ließ, obwohl der Taliban mit »Krediten« für Operationen an diverse terroristische Organisationen Unsummen verdiente. Selbstverständlich konnte Ben das nicht einmal Frank gegenüber erwähnen. Es gab Grenzen, die ein Director of National Intelligence nicht überschreiten konnte, und Frank konnte, um auf seinem Posten zu überleben, definitiv nicht dulden, dass einer seiner Untergebenen aus ganz persönlichen und privaten Gründen einen Mann wie Ahmad Jan deckte, auch wenn der Untergebene gleichzeitig ein enger Freund war.
Mit Dadullah war es anders. Dadullah war seit den Tagen der Operation Cyclone »ihr Mann«, und Frank hatte das nie infrage gestellt oder gar Ben Kingsley zu diesem Thema intensiver befragt. Frank hatte während des Krieges gegen die Sowjets vor Ort und mit eigenen Augen gesehen, wie sehr die CIA von dieser persönlichen, intimen Freundschaft zwischen seinem Untergebenen Ben Kingsley und dem Paschtunen aus dem königlichen Clan der Mohammadzaï profitierte. Frank kannte auch Dadullahs Insiderberichte aus der Taliban-Bewegung, die regelmäßig über seinen Untergebenen auf seinem Schreibtisch landeten, seitdem der Paschtune sich in den letzten Tagen des afghanischen Bürgerkriegs aus wirtschaftlichem und familienpolitischem Kalkül mit den rückwärtsgerichteten Wahnsinnigen um den halb blinden Mullah Omar verbandelt hatte.
Aus diesem Grund gab es seit Mahooneys Amtsantritt am Tyson’s Corner auch das streng geheime Memorandum, die vom Präsidenten unterzeichnete Generalamnestie und das auffällig schlechte Foto auf der Terrorliste, die die USA veröffentlichte.
Wenn der zivilisierte und urbane »Geschäftsmann aus Karatschi« Dadullah Khan reisen wollte, dann hinderte ihn niemand daran. Er war der Sohn eines erfolgreichen Geschäftmanns aus Pakistan, dem es in den 1970er-Jahren gelungen war, aus einem traditionellen orientalischen Basarladen erst ein florierendes Import- Export-Business zu machen und daraus dann ein solides, mittel- ständisches Unternehmen, das mit moderner Elektronik, IT und Hightech handelte. Dadullahs Brüder leiteten die Handelsniederlassungen der Firma in der Türkei und in den Golfstaaten. Die exzellenten Beziehungen der Mohammadzaï-Paschtunen in die Türkei existierten bereits seit dem Osmanischen Reich und dem Emir Habibullah Khan.
Mr. D. Khan, der jüngste Sohn des Firmengründers und offiziell fürs Marketing der Gruppe zuständig, hatte auf seinem pakistanischen Pass sowohl ein britisches Dauervisum als auch eine US-Greencard. Er besaß Diplome der von Deutschland finanzierten Technischen Universität Kairo und der berühmten SOAS-School of Oriental and African Studies in London, und niemand wäre je auf die Idee gekommen, den erfolgreichen und dynamischen Manager aus Karatschi, der gerne modische High-End-Anzüge der italienischen Nobelmarke Ermenegildo Zegna trug, mit dem schwarz gekleideten, wilden und bärtigen Warlord aus den afghanischen Bergen in Verbindung zu bringen, der mit ein paar professionell in Szene gesetzten Enthauptungsvideos und islamistischen Brandreden auf Paschtu auf dem Sender Al-Jazeera für einen Medien-Buzz gesorgt hatte.
Ahmad Jan war immer nur ein kleines, gieriges, korruptes und völlig skrupelloses Arschloch gewesen, der alles dealte, womit man schnell und einfach Geld verdienen konnte. Doch in der paschtunischen Stammesgesellschaft konnte man unangenehme Verwandte nicht einfach so vermeiden und verleugnen. Und sie umzubringen führte zu blutigen Fehden, die mindestens zweihundert Jahre dauerten. Es war genau wie bei Ben Kingsley zu Hause in Louisiana: Blut war dicker als Wasser, egal wie peinlich es manchmal wurde. Seine Freunde suchte man sich aus. Die Familie ertrug man.
»Die Franzosen haben handfeste Beweise, um diesen Ahmad Jan in Frankreich vor ein französisches Gericht zu stellen und zu verurteilen, falls es ihnen gelingt, Hand an ihn zu legen und ihn aus Afghanistan zu entführen«, erklärte Ben.
Bens Kontakt im Innenministerium am Place Beauveau hatte es Anfang März erwähnt. In der Presse war ein langer Artikel zu dem Attentat auf der Urlaubsinsel Djerba erschienen, das insbesondere die Europäer im Jahr 2002 erschüttert hatte. Die Aktionen der Interessengemeinschaft der Angehörigen von Terrorismusopfern trugen Früchte.
»Ein bekannter französischer Antiterrorrichter hat bereits vor drei Jahren einen internationalen Haftbefehl gegen Ahmad Jan erlassen.« Ben seufzte leise.
»Die Franzosen haben schon mehrfach die afghanische Regierung offiziell um seine Auslieferung ersucht und dabei aus dem Präsidentenpalast von Kabul immer dieselbe Antwort erhalten: ›Unmöglich, dort, wo Jan sich aufhält, irgendwie auf ihn zuzugreifen.‹«
Frank Mahooney schüttelte den Kopf. Den Franzosen ging es nicht besser als den Amerikanern oder anderen Nationen, die die afghanische Regierung um die Auslieferung von Terroristen ersuchten.
»Dieser General Morillon vom COS erklärte meinem Kontakt im CENTCOM, dass sie diese verdeckte Operation aus genau diesem Grund aufgezogen hatten, allerdings sehr überstürzt, weil sie einen ganz speziellen Hinweis zum Verbleib von Ahmad Jan bekommen hätten und schnell handeln mussten.«
»Was die Jagd in den Bergen und den sehr vagen OPLAN erklärt!« Ben erinnerte sich.
Ahmad Jan hatte damals auf direkte Bitte von bin Laden die lokale Al-Qaida-Zelle Salafiya Jihadia mit Geldmitteln versorgt, um die Selbstmordanschläge im April 2002 gegen die Al-Ghriba-Synagoge auf der Insel Djerba und ein Jahr später im Mai 2003 in Casablanca zu organisieren. Dabei waren die Ziele zwar jüdische Einrichtungen gewesen, doch die Leute, die ihr Leben verloren hatten, waren vor allem deutsche, spanische und französische Touristen. In Casablanca waren anschließend noch einmal vierzig Menschen zu Tode gekommen, und es hatte über hundert Verletzte gegeben. Auch hier waren die Betroffenen fast ausschließlich Europäer.
Es ergab Sinn. Die Jagd der Franzosen auf den berüchtigten »Terror-Banker« machte deswegen Sinn, weil genau in diesem Augenblick vier lebend gefasste Mitglieder der Kommandos von Djerba und Casablanca in Paris vor Gericht standen. Sie besaßen alle die doppelte Staatsbürgerschaft und waren von den Marokkanern ausgeliefert worden, nachdem die Franzosen massiv Druck auf Rabat gemacht und mit knallharten Wirtschaftssanktionen gedroht hatten. Dieser Prozess zog im Augenblick die Aufmerksamkeit der gesamten französischen Medien und der Bevölkerung auf sich.
»Die Franzosen haben wohl während der Untersuchungen gegen die vier Angeklagten noch zusätzliches belastendes Material gegen Ahmad Jan in die Hände bekommen«, sagte Ben zu Mahooney, »und soweit ich weiß, gibt es als Nebenkläger wieder diese gemeinnützige europäische Vereinigung der Angehörigen von Terrorismusopfern, die dem französischen Staatspräsidenten, der deutschen Kanzlerin und dem spanischen Präsidenten ständig die Hölle heiß machen. Der neue französische Präsident Poniatowski war damals, als die Anschläge geschahen, auch noch Innenminister, und er hat Versprechen gegeben, die er jetzt einhalten muss, wenn er nicht ins Kreuzfeuer der Kritik seiner politischen Gegner geraten möchte.«
Taher lag mit seiner wilden Verschwörungstheorie über die Israelis und die Franzosen also irgendwie doch richtig, auch wenn er selbst nicht die Zielperson dieser speziellen Truppe gewesen war. Ben beschloss, die Informationen, die er von Frank bekommen hatte, vorerst für sich zu behalten, um keine unnötige Panik auszulösen.
Taher war zwar sein Freund, seitdem sie an der Universität von Cambridge im ersten Semester das Zimmer geteilt hatten. Aber Taher war im Augenblick auch extrem nervös, und er hatte inzwischen zwei gültige Reisepässe an der Hand, die auf keiner Such- oder Terrorliste der Welt standen und ihm gestatteten, ohne Probleme in zahlreiche Länder der Welt zu reisen. Zu diesen Pässen hatte er auch entsprechend gut gefüllte Bankkonten. Im Gegensatz zu 2003/2004 konnte er jetzt leicht und ohne fremde Hilfe irgendwo abtauchen.
Er würde wohl nicht gleich den brandneuen amerikanischen Pass riskieren. Der saudische Reisepass, den Saif um ihrer alten Freundschaft willen für Taher besorgt hatte, stand zwar im Henley Visa Restriction Index nur auf sechsundneunzigster Stelle, aber man konnte mit ihm immer noch ohne Probleme und visafrei in eine ganze Reihe Länder reisen: Jordanien, Marokko, Tunesien, Libanon – ja sogar Neuseeland