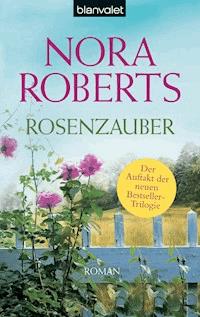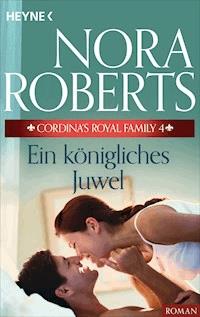
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Cordina-Serie
- Sprache: Deutsch
Die beliebte Cordina-Saga: Liebe, Intrigen und Leidenschaften am Königshof der Fürstenfamilie von Cordina
Camilla de Cordina nimmt eine Auszeit von ihren öffentlichen Aufgaben und verlässt für eine Weile den Hof, um wieder zu sich zu finden. Als sie einen leichten Autounfall hat, kümmert sich der gut aussehende Archäologe Delaney Caine um sie. Der hat keine Ahnung, wen er gerettet hat und wer ihn anschließend gegen Verpflegung und Logis bei seiner Arbeit unterstützt. Prinzessin Camilla lässt ihn über ihre wahre Herkunft im Ungewissen. Doch auch er hat ein Geheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nora Roberts
Cordina’s Royal Family 4
Ein königliches Juwel
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Emma Luxx
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
PROLOG
Sie war eine Prinzessin. Eine echte, akribisch ausgebildete Prinzessin. Mit perfekter Haltung, vornehmer Ausdrucksweise und vollendeten Umgangsformen. Sie strahlte Jugend, Selbstbewusstsein und Würde aus – das alles bei einem hübschen, sorgfältig geschliffenen Äußeren.
Sie wusste, dass dies von einem Mitglied der Fürstenfamilie von Cordina erwartet wurde – zumindest bei öffentlichen Auftritten. Und die Wohltätigkeitsgala in Washington D. C. war ein solcher höchst öffentlicher Auftritt. Deshalb tat sie ihre Pflicht und begrüßte Gäste, die für die Gelegenheit, einen Abend lang mit Fürstlichkeiten auf Tuchfühlung zu sein, eine stattliche Summe gezahlt hatten.
Sie beobachtete ihre Mutter, Ihre Durchlaucht Gabriella von Cordina, die das Pflichtprogramm mühelos absolvierte. Zumindest schaffte sie es, sich den Anstrich von Mühelosigkeit zu geben, obwohl sie für die Vorbereitung dieser Veranstaltung ebenso hart gearbeitet hatte wie ihre Tochter.
Sie sah, wie ihr Vater – blendend aussehend und souverän – und ihr ältester Bruder, der an diesem Abend die Rolle ihres Begleiters innehatte, mit der Menge verschmolzen. Einer Menge, die sich aus Politikern, Prominenten und den Reichsten der Reichen zusammensetzte.
Als es an der Zeit war, nahm Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Camilla von Cordina ihren Platz für den ersten Teil des Abendprogramms ein. Ihr Haar war zu einer komplizierten Frisur hochgesteckt, die ihren schlanken, mit einem Smaragdcollier geschmückten Hals vorteilhaft zur Geltung brachte. Ihr elegantes schwarzes Abendkleid betonte ihre gertenschlanke Figur. Eine Figur, die sich in letzter Zeit gefährlich der Grenze zur Magerkeit näherte, wie sie und ihre Schneiderin wussten.
Früher war ihr Appetit besser gewesen.
Ihr Gesichtsausdruck war ruhig, ihre Haltung perfekt. Hinter ihren Augen tobte ein stechender Kopfschmerz.
Sie war eine Prinzessin, aber sie war auch eine Frau am Rande der Erschöpfung.
Sie applaudierte. Sie lächelte. Sie lachte.
Es war fast Mitternacht – sie hatte einen Achtzehnstundentag hinter sich –, als ihre Mutter es schließlich schaffte, zum ersten Mal an diesem Abend ein privates Wort an sie zu richten.
Sie legte Camilla einen Arm um die Taille, beugte sich zu ihr herüber und sagte leise: »Du siehst gar nicht gut aus, Liebling.« Um die Erschöpfung, die sich auf Camillas Gesicht spiegelte, wahrzunehmen, erforderte es schon das scharfe Auge einer Mutter, und Gabriella hatte in der Tat scharfe Augen.
»Ich bin nur ein bisschen müde, das ist alles.«
»Geh. Fahr zurück ins Hotel. Und widersprich jetzt nicht«, drängte Gabriella leise. »Du bist völlig überarbeitet. Ich hätte darauf bestehen sollen, dass du ein paar Wochen auf der Farm ausspannst.«
»Aber es gibt doch so viel zu tun.«
»Du hast genug getan. Ich habe Marian bereits gebeten, den Sicherheitsdienst zu informieren, damit man dich zum Wagen bringt. Dein Vater und ich werden in einer Stunde ebenfalls aufbrechen.« Als Gabriella aufschaute, registrierte sie, dass sich ihr Sohn offenbar prächtig mit einer berühmten amerikanischen Sängerin unterhielt. »Soll Kristian dich begleiten?«
»Nein.« Es lag an ihrer Erschöpfung, dass Camilla ihrer Mutter nicht widersprach. »Er amüsiert sich. Davon abgesehen ist es ohnehin klüger, wenn wir alle einzeln nacheinander verschwinden.« Und unauffälliger, wie sie hoffte.
»Die Amerikaner lieben euch – vielleicht sogar ein bisschen zu sehr.« Gabriella lächelte und gab ihrer Tochter einen Kuss auf die Wange. »Schlaf dich erst einmal richtig aus. Und morgen früh reden wir weiter.«
Aber es gab kein unauffälliges Entkommen. Trotz der Limousine vor dem Haupteingang, die als Köder dienen sollte, trotz aller Vorkehrungen, die der Sicherheitsdienst getroffen hatte, und trotz der Tatsache, dass Camilla das Gebäude durch einen Seitenausgang verließ, hatten die Medien von ihrem Abgang irgendwie Wind bekommen.
Sobald sie den Fuß vor die Tür gesetzt hatte, flammten Kamerablitze auf und erhellten die Nacht. In ihren Ohren hallten Schreie wider. Sie spürte, wie sie von der Menschenmenge umringt wurde, spürte Hände, die an ihr zerrten, dann merkte sie zu ihrer Beschämung, dass ihr die Beine zitterten, als ihre Leibwächter sie zu der wartenden Limousine lotsten.
Geblendet von Kamerablitzen, die es ihr unmöglich machten, etwas zu sehen oder auch nur einen einzigen Gedanken zu fassen, rang sie verzweifelt um Haltung, während sie sich, flankiert von ihren Bodyguards, durch die Menschenmenge bewegte.
Es war so entsetzlich heiß, so scheußlich eng. Bestimmt fühlte sie sich deshalb so krank. Krank und schwach und idiotisch verängstigt. Am Ende war sie sich nicht sicher, ob sie stolperte, geschubst wurde oder mit dem Kopf voraus ins Auto sprang.
Als der Wagenschlag hinter ihr zufiel und das Geschrei außerhalb der Stahl- und Glashülle anschwoll, erschauderte sie, und der plötzliche eisige Luftzug der Klimaanlage bewirkte, dass ihre Zähne aufeinanderschlugen. Sie schloss die Augen.
»Hoheit, ist alles in Ordnung mit Ihnen?«, hörte sie wie von fern die besorgte Stimme eines Leibwächters fragen.
»Danke, ja, mir geht es gut.«
Aber sie wusste, dass das nicht stimmte.
1. KAPITEL
Was immer auch gesagt werden mochte und zweifellos auch gesagt werden würde, es war keine spontane Entscheidung gewesen. Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Camilla von Cordina handelte niemals spontan.
Aber sie war verzweifelt.
Und diese Verzweiflung hatte sich zugegebenermaßen seit Monaten in ihr angestaut. Um schließlich in dieser heißen, stickigen, endlosen Juninacht trotz aller Anstrengungen, sie zu leugnen, ihren Höhepunkt zu erreichen.
Der wilde Paparazzischwarm, der über sie hergefallen war, als sie versucht hatte, die Wohltätigkeitsgala unbemerkt zu verlassen, war der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte.
Auch wenn ihre Leibwächter sie so erfolgreich abgeschirmt hatten, dass sie mit einem letzten Rest von Würde in die wartende Limousine hatte schlüpfen können, hatte sie innerlich geschrien.
Lasst mir doch wenigstens Luft zum Atmen. Um Himmels willen, macht mir ein bisschen Platz.
Und auch als sie jetzt, zwei Stunden später, in ihrer Luxussuite hoch über Washington D. C. auf und ab ging, hatte sie sich immer noch nicht beruhigt.
Weniger als drei Autostunden von hier in Richtung Süden lag die Farm, auf der sie einen Teil ihrer Kindheit und Jugend verbracht hatte. Mehrere tausend Meilen weiter östlich, jenseits des Ozeans, lag das kleine Land, in dem sie den anderen Teil verbracht hatte. Ihr Leben war aufgeteilt zwischen diesen beiden Welten. Obwohl sie beide gleichermaßen liebte, fragte sie sich doch hin und wieder, ob sie wohl je in einer von beiden ihren Platz finden würde.
Auf jeden Fall wurde es Zeit – höchste Zeit –, dass sie ihn fand.
Vorher jedoch musste sie sich erst einmal selbst finden. Aber wie konnte sie das, wenn sie ewig umzingelt war? Ja, schlimmer noch, wenn sie das Gefühl hatte, dass man sie wie ein Wild jagte? Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn sie nicht die Älteste der drei jungen Frauen der nachwachsenden Generation der cordinianischen Prinzessinnen gewesen wäre – und diejenige, zu der man sich am leichtesten Zugang verschaffen konnte, weil sie einen amerikanischen Vater hatte und eine gewisse Zeit im Jahr in den Vereinigten Staaten verbrachte.
Aber es war nicht anders, sondern so, wie es war. Und im Augenblick erschien es ihr, als ob ihr ganzes Dasein nur aus Diplomatie, Protokoll und Medien bestünde. Aus Bitten, die man an sie richtete, Eingaben, Terminen, Verpflichtungen. Gerade hatte sie als stellvertretende Vorsitzende einer Stiftung für behinderte Kinder diese Wohltätigkeitsgala organisiert – eine Aufgabe, die sie sich mit ihrer Mutter geteilt hatte.
Sie glaubte an das, was sie tat, sie war fest überzeugt, dass sich die Mühe lohnte. Aber musste der Preis wirklich so hoch sein?
Die Organisation dieser Wohltätigkeitsgala hatte Wochen in Anspruch genommen, und am Ende hatte sie sich vor lauter Erschöpfung gar nicht mehr über die Früchte ihrer Arbeit freuen können.
Wie sie sich von all diesen Kameras, diesen vielen Gesichtern in die Enge getrieben gefühlt hatte!
Sogar von ihrer Familie – Gott schütze sie – fühlte sie sich in letzter Zeit eingeengt. Darüber mit ihrer persönlichen Assistentin zu sprechen schien illoyal, undankbar und unmöglich. Aber ihre Assistentin war zugleich ihre langjährige und beste Freundin und Vertraute.
»Ich bin es wirklich leid, mein Gesicht ständig auf allen Illustrierten zu sehen und von irgendwelchen Romanzen, die man mir andichtet, zu lesen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mir das alles zum Hals heraushängt, Marian.«
»Mit Geschichten über Königshäuser, Schönheit und Sex verkaufen sich Zeitschriften eben besser. Und wenn man die drei Faktoren kombiniert, kommt man mit dem Drucken nicht mehr nach.« Marian Breen war eine praktische Frau, was sich auch in ihrem Tonfall widerspiegelte. Da sie und Camilla sich schon seit ihrer Kindheit kannten, schwang darin eher Belustigung als Ehrerbietung mit. »Ich weiß, es war ein schrecklicher Abend, und ich kann es dir nicht verdenken, dass du fix und fertig bist. Ich würde wirklich gern wissen, wer es hat durchsickern lassen, welchen Ausgang …«
»Das ist doch jetzt auch egal. Passiert ist passiert.«
»Sie sind wie die Jagdhunde«, meinte Marian. »Aber du bist eben eine Prinzessin von Cordina … einem Land, bei dem vor allem Amerikaner an Märchen denken. Du bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, was heißt, dass du wunderschön bist. Und die Männer fühlen sich von dir angezogen wie die Schnäppchenjäger von Sonderangeboten. Davon leben die Medien, besonders der aggressivere Teil.«
»Der Adelstitel ist ebenso wenig mein Verdienst wie mein Aussehen. Und was die Männer betrifft …« Camilla machte eine unwirsche Handbewegung, als wollte sie damit das gesamte männliche Geschlecht beiseite fegen. »Keiner von ihnen meint wirklich mich. Was sie anzieht, ist nur das Äußere – genau das, was dazu beiträgt, dass sich diese idiotischen Illustrierten verkaufen.«
»Eine absurde Situation.« Da Camilla sie am Zubettgehen hinderte, naschte Marian von den Weintrauben aus der überquellenden Obstschale, die die Hoteldirektion heraufgeschickt hatte. Obwohl sie gelassen wirkte, war sie doch besorgt. Ihre Freundin war viel zu blass. Und es hatte den Anschein, als ob sie abgenommen hätte.
Wenn sich Camilla ein paar Tage in Virginia ausruht, ist sie bestimmt bald wieder ganz die Alte, versuchte sich Marian zu beruhigen. Die Farm war so abgeschirmt wie der Palast in Cordina. Dafür hatte Camillas Vater gesorgt.
»Ich weiß, es ist schrecklich lästig, bei jedem Schritt in der Öffentlichkeit von Bodyguards umringt und von sensationsgierigen Reportern belagert zu werden«, fuhr sie fort. »Aber was hast du für eine Wahl? Einfach weglaufen?«
»Ja.«
Marian nahm sich kichernd noch eine Weintraube. Dann rutschte sie ihr aus den Fingern, als sie den stählernen Glanz in Camillas goldbraunen Augen sah. »Mir scheint, du hast einen kleinen Schwips.«
»Ganz gewiss nicht«, erwiderte Camilla ruhig. »Ich habe nur ein Glas Champagner getrunken. Und das nicht einmal ganz.«
»Dann muss es ja ein ziemlich großes gewesen sein. Hör zu, ich gehe jetzt wie ein braves Mädchen auf mein Zimmer, damit du schlafen kannst. Und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.«
»Ich denke seit Wochen darüber nach.« Camilla hatte mit der Idee gespielt. Herumfantasiert. Und heute Nacht würde sie sie in die Tat umsetzen. »Du musst mir helfen, Marian.«
»Non, non, c’est impossible. C’est complètement fou!«
Marian, die so durch und durch amerikanisch war wie apple pie, verfiel nur selten ins Französische. Als sich ihre Eltern in Cordina niedergelassen hatten, war sie zehn gewesen. Sie und Camilla hatten damals schnell Freundschaft geschlossen und waren seitdem eng befreundet. Doch jetzt antwortete die zierliche Frau mit den hochgesteckten honigbraunen Haaren vor Schreck in der Sprache ihrer Wahlheimat. Sie riss alarmiert die warmen leuchtend blauen Augen auf.
Ihre Freundin hatte einen Gesichtsausdruck aufgesetzt, den sie kannte. Und fürchtete.
»Es ist weder unmöglich noch verrückt, sondern durchaus möglich und ganz normal«, erwiderte Camilla bestimmt. »Ich brauche dringend ein bisschen Zeit für mich allein, ein paar Wochen, deshalb werde ich sie mir nehmen. Und zwar als Camilla MacGee, nicht als Camilla von Cordina. Ich lebe jetzt schon seit Grand-pères Tod …«
Sie sprach den Satz nicht zu Ende. Es tat immer noch weh. Ihr Großvater war jetzt seit fast vier Jahren tot, und sie hatte den Verlust noch nicht überwunden.
»Er war unser Fels«, fuhr sie fort und versuchte, Haltung zu bewahren. »Obwohl er bereits viel Verantwortung an Onkel Alex abgegeben hatte, regierte er bis zum Schluss. Seit seinem Tod muss die Familie einen größeren Beitrag leisten … wir müssen uns alle ständig zusammenreißen. Trotzdem ist es richtig so, ich würde es gar nicht anders wollen. Ich habe es nie bereut, dass ich mich damals bereit erklärt habe, mehr offizielle Pflichten zu übernehmen.«
»Aber?« Marian, die sich mittlerweile in ihr Schicksal gefügt hatte, ließ sich auf der Armlehne der Couch nieder.
»Ich muss dieser Treibjagd für eine Weile entkommen. Unter allen Umständen«, sagte Camilla und presste sich eine Hand aufs Herz. »Ich fühle mich wie ein gehetztes Wild. Ich kann keinen Fuß auf die Straße setzen, ohne dass sich nicht sofort irgendwelche Fotografen an meine Fersen heften. Wenn das so weitergeht, werde ich mich noch selbst verlieren. Ich weiß ja schon jetzt nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Und es gibt inzwischen schon viel zu viele Momente, in denen ich mich nicht einmal mehr spüren kann.«
»Du brauchst Ruhe. Du musst dringend ein bisschen ausspannen.«
»Ja, aber das ist nicht alles. Es ist komplizierter, Marian. Ich weiß einfach nicht, was ich für mich will. Nur für mich ganz allein. Schau Adrienne an«, fuhr sie in Anspielung auf ihre jüngere Schwester fort. »Sie ist erst einundzwanzig und schon verheiratet. Mit sechs hat sie Philippe zum ersten Mal gesehen, und das war es dann. Sie wollte nur eins … ihn heiraten und in Cordina ihre gemeinsamen Kinder großziehen. Und meine Brüder sind wie die beiden Hälften unseres Vaters. Der eine der Farmer, der andere der Sicherheitsexperte. Nur ich habe irgendwie keine Richtung, Marian. Kein Talent.«
»Das stimmt absolut nicht. In der Schule hast du immer mit den besten Noten geglänzt. Dein Gehirn ist wie ein verdammter Computer, wenn irgendetwas dein Interesse weckt. Du bist eine ganz wunderbare Gastgeberin und arbeitest unermüdlich für Dinge, die es wert sind.«
»Pflichten«, sagte Camilla. »In puncto Pflichterfüllung übertreffe ich mich in der Regel selbst. Und was ist mit den Dingen, die Spaß machen? Ich kann ein bisschen Klavier spielen, ein bisschen singen. Ein bisschen malen, ein bisschen fechten. Aber wo sind meine Leidenschaften?« Sie legte sich die Hand aufs Herz. »Ich werde es herausfinden … oder wenigstens ein paar Wochen ohne Bodyguards, ohne Protokoll und ohne die verdammten Medien mit dem Versuch zubringen, es herauszufinden! Wenn ich nicht für eine Weile meine Ruhe habe«, fuhr sie leise fort, »habe ich Angst … große Angst, zu zerbrechen.«
»Sprich mit deinen Eltern, Cam. Sie werden dich verstehen.«
»Mama schon. Bei Daddy bin ich mir da nicht so sicher.« Aber sie lächelte, als sie es sagte. »Obwohl Adrienne inzwischen seit drei Jahren verheiratet ist, ist er immer noch nicht darüber weg, dass er seine kleine Tochter verloren hat. Und Mama … sie war bei ihrer Heirat so alt, wie ich jetzt bin. Noch jemand, der genau wusste, was er wollte. Obwohl vorher …«
Sie schüttelte den Kopf und begann wieder, auf und ab zu gehen. »Die Entführung und die Attentatsversuche auf meine Familie. Das alles ist zwar schon so lange her, für uns aber immer noch sehr real. Ich kann es meinen Eltern nicht vorwerfen, dass sie stets so besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder waren. An ihrer Stelle hätte ich mich genauso verhalten. Aber mittlerweile bin ich längst erwachsen, und ich brauche … ich brauche einfach etwas ganz für mich allein.«
»Einen Urlaub also.«
»Nein, ich muss mich auf die Suche nach mir selbst machen.« Sie ging zu Marian und ergriff ihre Hände. »Du hast dir ein Auto gemietet.«
»Ja, ich brauchte es, um … oh. Oh Camilla!«
»Gib mir die Schlüssel. Ruf die Mietwagenfirma an, und lass den Vertrag verlängern.«
»Du kannst unmöglich aus Washington wegfahren!«
»Warum nicht? Ich bin eine ausgezeichnete Fahrerin.«
»Oh, Camilla, ich bitte dich! Deine Familie wird wahnsinnig werden, wenn du einfach verschwindest. Und die Medien werden verrückt spielen.«
»Ich würde es nie zulassen, dass sich meine Eltern meinetwegen Sorgen machen. Deshalb werde ich sie morgen früh gleich als Erstes anrufen. Und du teilst der Presse mit, dass ich an einem geheim gehaltenen Ort Urlaub mache. Dabei wirst du ganz beiläufig das Wort Europa erwähnen, dann werden sie mir ja wohl kaum hier in den Staaten nachjagen.«
»Muss ich dich wirklich darauf hinweisen, dass dein Gesicht auf jeder Illustrierten zu sehen ist?« Marian griff wahllos nach einer der Zeitschriften auf dem Couchtisch und hielt sie hoch. »Dein Gesicht gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Welt, Cam. Du kannst nicht einfach irgendwo in der Menge untertauchen.«
»Das werde ich aber.« Obwohl sie wusste, wie töricht ihr Vorhaben war, ging sie mit einem Kribbeln im Bauch zum Schreibtisch, wo sie eine Schublade öffnete. Und eine Schere herausnahm. »Prinzessin Camilla.« Sie zog die Haarnadeln aus ihrer kunstvoll aufgesteckten Frisur heraus und schüttelte den Kopf, sodass das tiefrote Haar, das ihr fast bis zur Taille reichte, herunterfiel, dann atmete sie tief durch. »Es wird Zeit, dass ich mir ein völlig neues Outfit zulege.«
Auf Marians Gesicht spiegelte sich blankes Entsetzen, über das Camilla gelacht hätte, wenn sie nicht selbst etwas Ähnliches verspürt hätte. »Das ist ja wohl nicht dein Ernst! Camilla, du kannst doch nicht … du kannst dir doch nicht einfach die Haare abschneiden. Deine wunderschönen Haare!«
»Stimmt.« Camilla hielt ihr die Schere hin. »Du schneidest.«
»Ich? Oh nein … niemals. Unter gar keinen Umständen.« Marian versteckte ihre Hände hinter dem Rücken. »Hör zu, ich schlage vor, dass wir uns jetzt hinsetzen, ein gutes Glas Wein trinken und einfach warten, bis dieser Anfall von Verrücktheit abgeklungen ist. Und morgen wirst du dich ganz bestimmt wieder besser fühlen.«
Davor fürchtete sich Camilla. Sie fürchtete sich davor, dass es vorbeigehen und sie einfach immer so weitermachen würde. Dass sie weiterhin geduldig ihre Pflicht tun, ihre Aufgaben erfüllen und wieder in die unbestreitbaren Annehmlichkeiten ihres Lebens zurückgleiten würde. Immer auf der Flucht vor den Medien.
Wenn sie nicht jetzt irgendetwas tat – einfach nur irgendetwas –, wann dann? Oder würde sie gar nichts tun und in nicht allzu ferner Zukunft – wie es die Medien ständig prophezeiten – einen dieser Lackaffen heiraten, die für eine Frau ihres Standes als passend erachtet wurden und … einfach weitermachen?
Sie presste die Lippen aufeinander, riss so entschlossen den Kopf hoch, dass ihre Freundin erschrocken nach Luft schnappte, griff nach einer langen Strähne – und schnitt sie ab.
»Oh nein!« Marian, der die Knie weich geworden waren, ließ sich auf einen Stuhl sinken. »Oh Camilla!«
»Es sind doch nur Haare.« Aber ihre Hand zitterte leicht. Ihr Haar gehörte so zu ihr, dass es fast war, als hätte sie sich eine Hand abgehackt. Sie blickte auf die lange rote Strähne, die zwischen ihren Fingern baumelte. »Den Rest erledige ich im Bad. Aber hinten könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen.«
Schließlich gab sich Marian dann doch noch einen Ruck und gesellte sich zu Camilla, wie es sich für eine gute Freundin geziemte. Am Ende der Aktion war der ganze Boden im Bad mit Haaren bedeckt, und Camilla musste ihr Bild von sich selbst komplett überarbeiten. Ein Schnipp hier, ein Schnapp dort. Einen Schluck Wein zur Stärkung. Und noch ein Schnipp, damit es gleichmäßig war. Am Ende waren ihre Haare so kurz wie die eines Jungen, mit langen Stirnfransen zum Ausgleich.
»Es ist schrecklich … na ja … anders«, sagte Camilla mühsam, während sie sich im Spiegel betrachtete.
»Ich fange gleich an zu heulen.«
»Untersteh dich.« Sie selbst würde es auch nicht tun, schwor sich Camilla. »Ich muss mich umziehen und ein paar Sachen zusammenpacken. Ich bin sowieso schon zu spät dran.«
Sie packte alles ein, was ihr wichtig erschien, und war gleichermaßen überrascht wie beschämt, weil die Sachen einen Koffer und eine riesige Reisetasche bis zum Platzen füllten. Sie zog Jeans, Stiefel und einen Pullover an und darüber einen langen schwarzen Mantel.
Sie erwog, eine Sonnenbrille und einen Hut aufzusetzen, entschied sich dann aber dagegen, weil es eher verkleidet als unauffällig gewirkt hätte.
»Und? Wie sehe ich aus?«, fragte sie.
»Nicht wie du.« Marian schüttelte den Kopf und ging zweimal um Camilla herum.
Der jungenhafte Haarschnitt bewirkte eine drastische Veränderung in Camillas Aussehen, wenngleich auch eine faszinierende, wie Marian zu ihrer Überraschung gestehen musste. Durch das kurze Haar wirkten Camillas große goldbraune Augen noch größer und irgendwie verletzlicher. Der Pony verdeckte die Stirn und verlieh dem Gesicht eine jugendlich frische Note, die hohen Wangenknochen wurden betont. Ohne Make-up sah man Camillas zarten blassen Teint, und der große Mund wirkte voller.
Statt kühl, zurückhaltend und würdevoll erschien sie jetzt jung, sorglos und fast ein bisschen leichtsinnig.
»Überhaupt nicht wie du«, wiederholte Marian. »Ich würde dich zwar erkennen, aber nicht auf den ersten Blick. Ich müsste noch mal hinschauen.«
»Das reicht.« Camilla sah auf die Uhr. »Wenn ich jetzt fahre, kann ich bis morgen früh schon ganz schön weit weg sein.«
»Wohin willst du eigentlich?«
»Keine Ahnung. Irgendwohin.« Camilla legte der Freundin die Hände auf die Schultern und gab ihr erst auf die eine, dann auf die andere Wange einen Kuss. »Mach dir keine Sorgen. Ich melde mich. Versprochen. Und denk daran, dass sogar eine Prinzessin irgendwann mal ein Anrecht auf ein kleines Abenteuer hat.« Sie lächelte. »Vielleicht sogar gerade eine Prinzessin. Versprich mir, bis morgen früh keinem Menschen etwas zu sagen – und dann auch nur meiner Familie.«
»Ich tue es zwar nicht gern, aber ich verspreche es.«
»Danke.« Camilla hievte die Reisetasche hoch, dann ging sie durchs Zimmer, um den Koffer aus dem Schlafzimmer zu holen.
»Warte. Lauf nicht so.«
Verblüfft drehte sich Camilla um. »Wie ‚so‘?«
»Wie eine Prinzessin. Beweg dich ein bisschen lässiger, schwing ein wenig die Hüften. Ich weiß auch nicht, Cam, du musst eben wie ein ganz normales Mädchen gehen. Nicht, als würdest du schweben.«
»Oh.« Camilla rückte den Riemen ihrer Reisetasche auf der Schulter zurecht und versuchte es. »So?«
»Ja, schon besser.« Marian tippte sich mit einem Finger an die Lippen. »Du darfst nur einfach nicht so steif und würdevoll gehen, als ob du einen Stock verschluckt hättest.«
Camilla übte noch, gab sich Mühe, lockerer, entspannter zu schlendern. »Bald hab ich‘s drauf«, versprach sie. »Aber jetzt muss ich los. Ich melde mich morgen.«
Noch bevor sie an der Tür war, kam Marian ihr nach. »Cam, sei um Himmels willen vorsichtig. Sprich nicht mit Fremden. Und vergiss nie, die Autotür abzuschließen. Ach ja … hast du Geld, dein Handy? Hast du …«
»Mach dir keine Sorgen.« Bei der Tür angelangt, drehte sich Camilla noch einmal um und lächelte Marian strahlend an. »Ich habe alles, was ich brauche. A bientôt.«
Aber als sich die Tür hinter ihr schloss, rang Marian unglücklich die Hände. »Oh Mann. Bonne chance, m‘amie«.
Nach zehn Tagen kannte Camilla den Song, der gerade im Radio gespielt wurde, längst auswendig und sang mit. Sie liebte amerikanische Musik. Sie liebte es, zu fahren. Sie liebte es, zu tun und zu lassen, wonach ihr der Sinn stand und dorthin zu gehen, wo sie hingehen wollte. Obwohl die ganze Sache natürlich durchaus auch ihre Schattenseiten hatte. Sie wusste, dass sich ihre Eltern Sorgen machten. Vor allem wahrscheinlich ihr Vater.
Vermutlich war er immer noch zu sehr Polizist, als dass er sich nicht jede nur mögliche Fallgrube und jede Katastrophe vorstellen konnte, in die eine alleinstehende junge Frau tappen oder verwickelt werden könnte. Besonders wenn es sich bei der jungen Frau um seine Tochter handelte.
Er hatte darauf bestanden, dass sie sich jeden Tag meldete. Sie hatte im Gegenzug angeboten, sich einmal in der Woche zu melden. Und ihre Mutter – wie immer die ausgleichende Kraft – hatte durch schwierige Verhandlungen erreicht, dass Camilla und ihr Vater sich am Ende auf einen Anruf alle drei Tage geeinigt hatten.
Sie liebte die beiden so sehr. Liebte, was sie für sie und füreinander waren. Was sie für die Welt waren. Aber sie mussten so vielen Anforderungen gerecht werden. Und sie wusste, sie wären entsetzt, wenn sie wüssten, dass sie das starke Bedürfnis hatte, zwar allem und jedem gerecht zu werden, aber eben auch sich selbst.
Andere Schattenseiten waren eher praktischer denn gefühlsmäßiger Natur. Erst als sie zum ersten Mal in einem Motel eingecheckt hatte – und was für eine Erfahrung war das gewesen! –, war ihr schlagartig aufgegangen, dass sie es nicht riskieren durfte, eine Kreditkarte zu benutzen. Wenn irgendein findiger Angestellter den Namen Camilla MacGee zuordnen konnte und ihre Identität herausfand, genügte ein einziger Anruf bei der lokalen Tageszeitung, um sie »auffliegen« zu lassen, wie ihr Bruder Dorian sich ausdrücken würde.
Folglich schmolz ihr Häufchen Bargeld immer schneller dahin. Ihr Stolz, ihre Sturheit und ihre Verärgerung über ihren eigenen mangelnden Weitblick bewahrten sie davor, ihre Eltern zu bitten, ihr Geld zu schicken, damit sie ihre Reise fortsetzen konnte.
Es würde schließlich einen der Hauptzwecke ihrer Reise ins Gegenteil verkehren. Ein paar wertvolle Wochen totaler Unabhängigkeit.
Sie überlegte, wohin man sich am besten wandte, wenn man etwas verkaufen wollte. Ihre Armbanduhr war mehrere tausend Dollar wert. Damit würde sie bestens über die Runden kommen. Vielleicht würde sie sich, wenn sie das nächste Mal haltmachte, nach einem Pfandleihhaus umsehen.
Aber fürs Erste war es herrlich, einfach nur zu fahren. Sie war von Washington aus in nördlicher und westlicher Richtung gefahren und hatte verschiedene Teile von Virginia und Pennsylvania erkundet. Sie hatte in Fastfood-Restaurants gegessen und in schlechten Betten in Highway-Motels geschlafen. Sie war durch die Straßen von verschlafenen kleinen Nestern und größeren Städten geschlendert und in Menschenansammlungen angerempelt worden. Und einmal, als sie angehalten hatte, um sich etwas zu trinken zu kaufen, war sie von dem Mann hinter dem Tresen sogar übersehen worden! Was sie prompt veranlasst hatte, sich zu beschweren.
Es war herrlich gewesen.
Kein Mensch – kein einziger – hatte sie fotografiert.
Irgendwo im Hinterland von New York war sie durch einen kleinen Park geschlendert und hatte zwei alte Männer entdeckt, die an einem Campingtisch Schach gespielt hatten. Sie war stehen geblieben, um zuzuschauen, dann hatten die beiden sie in ihre Unterhaltung über Weltpolitik mit einbezogen. Es war sowohl interessant als auch unterhaltsam gewesen.
Sie hatte es genossen, mitzuerleben, wie der Sommer über Neuengland hereinbrach. Es war so ganz anders als in Cordina und Virginia. Es war so … so befreiend, sich einfach treiben zu lassen, wo niemand sie kannte, wo niemand etwas von ihr erwartete oder sie mit dem Sucher seiner Kamera einfing.
Sie ertappte sich dabei, dass sie etwas tat, was sie sonst nur mit ihrer Familie oder ihren engsten Freunden machte. Entspannen.
Jeden Abend schrieb sie einfach so zum Vergnügen ihre Erlebnisse und Beobachtungen des Tages in ein Tagebuch.
Bin sehr müde jetzt, aber es ist eine angenehme Müdigkeit. Morgen werde ich Vermont erreichen. Dort muss ich mich entscheiden, ob ich weiter nach Osten an die Küste fahre oder umkehre. Amerika ist so groß. Kein Buch, keine Unterrichtsstunde, keine der Reisen, egal, ob mit der Familie oder aus irgendeinem offiziellen Anlass, hat mir jemals wirklich die Größe, die Verschiedenartigkeit und außergewöhnliche Schönheit der Landschaft und der Menschen, die dort leben, gezeigt.
Ich bin zur Hälfte Amerikanerin und war schon immer stolz auf mein väterliches Erbe. Seltsamerweise fühle ich mich, je länger ich hier ganz auf mich allein gestellt bin, umso fremder. Mir wird klar, dass ich diesen Teil meiner Abstammung viel zu lange vernachlässigt habe. Das wird ab jetzt anders werden.
Im Moment bin ich in einem kleinen Motel abseits der Autobahn, in den Adirondack Mountains. Sie sind absolut atemberaubend. Was ich von meinem Zimmer nicht unbedingt behaupten kann. Es ist zwar sauber, aber winzig. Die Annehmlichkeiten beschränken sich auf ein winziges Stück Seife und zwei Handtücher, die so rau sind wie Schmirgelpapier. Aber direkt vor meiner Tür befindet sich ein Getränkeautomat, falls ich Cola oder Limo möchte.
Obwohl ich eigentlich eher Lust auf ein gutes Glas Wein hätte, doch einen derartigen Luxus muss ich mir im Augenblick versagen.
Ich habe heute Abend zu Hause angerufen. Mama und Daddy sind mit Kristian und Dorian in Virginia auf der Farm. Sie fehlen mir alle, die Bequemlichkeiten und die Sicherheit, die sie repräsentieren. Trotzdem bin unendlich glücklich, dass ich dabei bin, herauszufinden, wer ich bin, und dass ich merke, dass ich auch allein zurechtkommen kann.
Ich glaube, ich bin ziemlich selbstgenügsam und risikofreudiger, als ich mir je hätte vorstellen können. Ich habe ein gutes Auge für Einzelheiten, einen hervorragenden Orientierungssinn und kann besser allein sein, als ich gedacht hätte.
Ich habe keine Ahnung, was das letzten Endes alles bedeutet, aber es ist sehr schön, es zu wissen.
Vielleicht kann ich ja als Reiseführerin arbeiten, wenn die Luft für Prinzessinnen dünn wird.
Sie liebte Vermont. Die grünen Berge, die vielen Seen, die sich dahinschlängelnden Flüsse. Deshalb fuhr sie von der Autobahn ab, auf kurvenreichen Landstraßen durch schmucke Neuengland-Städtchen, Waldgebiete und Weideland.
Sie vergaß, ihre Armbanduhr zu verkaufen, und schob es auf, nach einer Übernachtungsgelegenheit Ausschau zu halten. Durch das geöffnete Fenster wehte die warme Sommerluft ins Auto, das Radio lief, und sie aß beim Fahren genüsslich die Pommes frites, die in einer Tüte auf ihrem Schoß lagen.
Sie war nicht beunruhigt, als sich dicke, schwarze Wolken vor die Sonne schoben. Was für ein interessantes Licht das doch war, das da durch das Blätterdach der hohen Bäume am Straßenrand fiel, und die Luft, die zum Fenster hereinwehte, war elektrisch aufgeladen.
Als die ersten dicken Regentropfen auf der Windschutzscheibe zerplatzten, dachte sie sich nichts weiter dabei, obwohl sie, wenn sie nicht klatschnass werden wollte, jetzt das Fenster zumachen musste. Und als der erste Blitz über den Himmel zuckte, genoss sie das Naturschauspiel.
Doch als der Regen anfing, auf das Autodach zu prasseln, der Wind heulte und Blitze sie blendeten, beschloss sie, auf die Autobahn zurückzufahren und sich nach einer Übernachtungsgelegenheit umzusehen.
Zehn Minuten später verwünschte sie sich, weil sie allergrößte Mühe hatte, auf der Straße noch irgendetwas zu erkennen, und auch die sich hektisch hin und her bewegenden Scheibenwischer waren gegen die auf die Windschutzscheibe niedergehende Sturzflut praktisch machtlos.
Selbst schuld, dachte sie grimmig. Sie fuhr jetzt direkt in das Unwetter hinein statt davon weg. Außerdem stand zu befürchten, dass sie bei Dunkelheit und strömendem Regen die Auffahrt verpasste.
Sie sah nichts, nur den von ihren Scheinwerfern angestrahlten schwarz glänzenden Asphalt und den dichten Regenvorhang. Donner krachte, und Sturmböen rüttelten am Auto.
Sie erwog, rechts ranzufahren und zu warten, bis das Unwetter nachließ. Aber ihre sture Seite – derentwegen ihre Brüder sie so gern neckten – trieb sie an, weiterzufahren. Bestimmt sind es nicht einmal mehr zwei Meilen, redete sie sich gut zu. Dann würde sie wieder auf der Hauptstraße sein. Und dort bestimmt gleich ein Motel finden, wo sie sicher im Trockenen sitzen und das Unwetter sogar genießen konnte.
Plötzlich schoss etwas unter den Bäumen hervor und sprang vor den Wagen. Sie sah einen Sekundenbruchteil lang die weit aufgerissenen Augen des Rehs im Scheinwerferlicht glitzern, im nächsten Moment riss sie auch schon das Lenkrad herum.
Das Auto kam ins Schleudern, drehte sich auf der nassen Straße einmal um sich selbst und landete dann mit einem Ruck und einem ominösen Kreischen von Metall mit der Kühlerhaube voran im Straßengraben.
In den nächsten zwei Minuten hörte sie nichts außer dem Prasseln des Regens und ihren eigenen keuchenden Atemzügen. Dann riss ein greller Blitz sie aus ihrer Erstarrung.
Sie atmete tief ein und langsam wieder aus. Wenn sie dreimal hintereinander tief ein- und ausatmete, beruhigte sie das normalerweise. Aber dieses Mal kam der dritte Atemzug zusammen mit einem Fluch heraus. Sie schlug mit der flachen Hand aufs Lenkrad, biss die Zähne zusammen und legte den Rückwärtsgang ein.
Als sie Gas gab, drehten die Räder durch und gruben sich noch tiefer in den Matsch ein. Sie versuchte, das Auto von der Stelle zu bewegen – vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Mit jedem Zentimeter Boden, den sie gewann, verlor sie zwei.
Sie gab auf und stieg, Verwünschungen vor sich hin murmelnd, aus, um im strömenden Regen Bestandsaufnahme zu machen.
Außer einer verbeulten Stoßstange konnte sie keinen Schaden entdecken, aber da es dunkel war, hatte das nicht viel zu besagen. Als sie genauer hinschaute, sah sie, dass ein Scheinwerfer zersplittert war. Das Auto stand halb auf der Straße und halb im Graben, die Vorderräder waren tief im Schlamm eingesunken.
Als sie wieder ins Auto stieg und ihr Handy herauskramte, fröstelte sie, weil sie bei ihrem kurzen Aufenthalt im Freien bis auf die Haut durchnässt worden war. Sie musste einen Abschleppdienst anrufen, wusste jedoch nicht, was für eine Nummer sie wählen sollte. Nun, vielleicht könnte ihr die Auskunft ja weiterhelfen.
Camilla schaltete das Handy ein und blickte auf das Display. Nicht betriebsbereit.
Na toll!, dachte sie verärgert. Einfach toll. Da fahre ich mitten durch die Landschaft, weil die Bäume so hübsch sind, und trällere ein fröhliches Liedchen vor mich hin, ohne zu bemerken, dass ein schlimmes Gewitter aufzieht. Schließlich lande ich am einzigen Ort der Welt, an dem es keine Handyverbindung mehr gibt, im Straßengraben, weil mir ein dämliches Reh vors Auto läuft und ich bremsen muss, um es nicht zu überfahren.
Wie es schien, würde der nächste Teil ihres Abenteuers darin bestehen, dass sie die Nacht, bis auf die Haut durchnässt, im Auto zubrachte.
Nach zehn Minuten fror sie in ihrer nassen Kleidung ganz schrecklich und sah keine andere Möglichkeit mehr, als ihren Koffer aus dem Kofferraum zu holen.
Dann musste sie sich nur noch in einem Auto am Straßenrand umziehen.
Als sie den Koffer aus dem Kofferraum zu hieven begann, sah sie durch den Regenvorhang in der Ferne das schwache Glitzern von Autoscheinwerfern. Sie zögerte keine Sekunde, sondern lief um das Auto herum auf die Fahrerseite, riss die Tür auf und drückte dreimal fest und lang anhaltend auf die Hupe. Dabei rutschte sie aus und wäre fast mit dem Gesicht im Straßengraben gelandet, zum Glück aber fing sie sich wieder und eilte auf die Straße, wo sie die Arme wie Windmühlenflügel auf und ab bewegte.
Kein weißer Hengst hatte je so prächtig ausgesehen wie der verbeulte Truck, der jetzt an den Straßenrand fuhr und anhielt. Kein Ritter in seiner glänzenden Rüstung hatte je so heroisch gewirkt wie die dunkle Gestalt, die jetzt das Fenster herunterkurbelte und zu ihr heraussah.
In dem schwachen Licht und dem strömenden Regen konnte sie seine Augen nicht erkennen, ja, nicht einmal sein Alter einschätzen. Als sie hinlief, sah sie nur den schattenhaften Umriss seines Gesichts und einen Kopf mit abenteuerlich zerzaustem Haar.
»Ich habe ein Problem«, begann sie.
»Ehrlich?«
Jetzt sah sie seine Augen. Sie glänzten flaschengrün unter unwirsch zusammengezogenen schwarzen Brauen. Sein Blick glitt über sie hinweg, als ob sie unwichtig und nur lästig wäre – was sie sehr in Wut brachte, wenngleich sie sich bemühte, dankbar zu sein. Dann musterte er das Auto.
»Bei so einem Unwetter hätten Sie besser auf der Standspur angehalten und nicht daneben«, versuchte er gegen das Heulen des Windes anzuschreien.
»Das ist zweifellos ein hilfreicher Hinweis.« Ihr Ton war eisig und schrecklich höflich – eine Fähigkeit, mit der sie sich bei ihren Brüdern den Spitznamen Prinzessin Etepetete eingehandelt hatte.
Als er den Blick wieder auf sie richtete, blitzte in seinen Augen etwas auf, das man als Belustigung hätte deuten können. Oder als Gereiztheit. »Ich wäre Ihnen wirklich unendlich dankbar, wenn Sie mir aus dem Graben heraushelfen würden.«
»Das kann ich mir lebhaft vorstellen.« Seine Stimme klang tief, heiser und ein bisschen müde. »Aber da ich meinen super Kraftanzug auf Krypton gelassen habe, haben Sie leider Pech.«