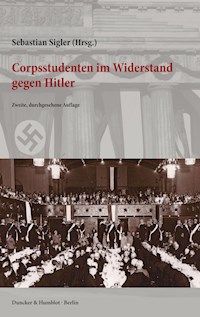
Corpsstudenten im Widerstand gegen Hitler. E-Book
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Widerstand im Dritten Reich, der am 20. Juli 1944 schlagartig sichtbar wurde, ist ab spätestens 1937 als ein dynamisches Netzwerk faßbar. Die Menschen hinter diesem Widerstand kamen in ihrer Mehrzahl aus fest umrissenen sozialen Gruppen. Eine davon bestand aus mindestens 38 Männern, die sich als Studenten einem akademischen Corps angeschlossen hatten. Im Gesamtnetzwerk des Widerstands gab es eine Vielzahl von Mehrfachbindungen in soziale Netzwerke: Viele Akteure waren miteinander verwandt, kannten sich aus Internaten oder trafen sich später in kirchlichen Kreisen wieder – und sie waren insgesamt zahlreicher als bisher bekannt. Natürlich gab es auch einige wenige Einzelattentäter gegen Hitler, und sie setzten Zeichen, die bekannt und unvergessen sind. Interessant ist aber das sieben Jahre lang operierende Netzwerk des Widerstands, das noch nicht vollständig erforscht ist. Durch viele indirekte Kontaktflächen nahmen hier die korporierten Studenten, besonders die 38 Corpsstudenten, eine erkennbare Rolle ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
SEBASTIAN SIGLER (Hrsg.)
Corpsstudenten im Widerstand gegen Hitler
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildungen:
Corps Masovia in Königsberg am 14. Juni 1930 (© Wikipedia)
Hakenkreuz-Fahnen am Brandenburger Tor, September 1933 (© ullstein bild – Herbert Hoffmann)
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten © 2014 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: Konrad Triltsch GmbH, Ochsenfurt Druck: AZ Druck und Datentechnik, Berlin Printed in Germany
ISBN 978-3-428-14498-3 (Print) ISBN 978-3-428-54498-1 (E-Book) ISBN 978-3-428-84498-2 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ƀ
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort zur Zweiten Auflage
Etwas mehr als 70 Jahre nach dem versuchten Attentat des Grafen Stauffenberg auf Hitler ist die Frage, wie der Widerstand gegen den Nationalsozialismus strukturiert war, aktueller denn je. Nachdem noch in der Nachkriegszeit die Widerstandkämpfer häufig als Verräter angesehen wurden, sind nun Rolle und Bedeutung derjenigen, die gegen Hitler aufstanden, unstrittig. Sie gehören unter anderem zur geistig-ethischen Grundlage der heutigen Bundesrepublik. Die Generation der Enkel fragt heute freier und unbefangener denn je nach dem, was damals, vor 70 Jahren, geschah.
Im Netzwerk des Widerstands waren die familiären Bindungen, die gemeinsame Internatszeit oder die Mitgliedschaft im Johanniterorden von großer Bedeutung. Doch auch die zu Studienzeiten erworbene lebensgeschichtliche Klammer durch die gemeinsame Mitgliedschaft in einem akademischen, einem „Kösener“ Corps konnte in individuellen Einzelfällen während der Zeit der NS-DiktaturWirksamkeit entfalten – gegen eine Mehrheit, die dem Nationalsozialismus nichts entgegensetzte oder ihn sogar begrüßte. So kommt es, daß sich im näheren oder weiteren Umfeld Stauffenbergs einige der Corpsstudenten befanden, denen dieser Band gewidmet ist.
Corpsstudenten im Widerstand gegen Hitler – das könnte sogar eine Fallstudie für die Struktur des gesamten widerständigen Milieus im Dritten Reich sein. Die genauere Erforschung der Zusammenhänge im Widerstand gegen Hitler steht indes noch aus. Beim hier vorliegenden Werk handelt es sich um eine Sammlung von Lebensbildern und Kurzbiographien. Diese Art, über Menschen zu berichten, die damals enormen Mut und vorbildliche Zivilcourage bewiesen haben, findet dabei zur großen Freude des Herausgebers und aller Autoren durchaus Anklang. So kann heute die zweite Auflage diesesWerkes in Druck gegeben werden. Einige sachliche Richtigstellungen gegenüber der ersten Auflage waren anzubringen, doch im Wesentlichen hat das Werk Bestand. Der Dank an Autoren, Lektoren, Korrektoren und den überaus umsichtig und hilfreich tätigen Verlag sei hiermit von Herzen erneuert.
Steinhagen / München, am 1. August 2014
Sebastian Sigler
Vorwort des Herausgebers
Der Widerstand im Dritten Reich, am 20. Juli 1944 schlagartig sichtbar, ist ab spätestens 1937 als dynamisches Netzwerk von Menschen faßbar. Eine der Gruppen in diesem durch die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus getragenen, aber vielfach inhomogenen Verbund bestand, soweit wir wissen, aus 38 Männern, die sich in ihrer Studentenzeit einem akademischen Corps angeschlossen hatten. Im Gesamtnetzwerk des Widerstands gab es dabei eine Vielzahl von Verknüpfungen: Verwandtschaft, Internate, kirchliches Engagement – oder auch ein Corps. Die Mehrzahl derer, die in diesem Band mit einem Lebensbild gewürdigt werden, konnte über zwei, drei oder vier verschiedene Anknüpfungspunkte im Netzwerk des Widerstandes erreicht werden und selber agieren. Die Art und Weise, wie dies geschah, verdient ausführlicher erforscht zu werden, als dies bisher geschah, denn das würde auch die Bedeutungen der sozialen Gruppen wie etwa der Corps noch genauer sichtbar machen. In dem hier vorgelegten Band sollen aber die Personen des Widerstands mit ihren individuellen Motiven vorgestellt werden. Vor allem ist es gelungen, mehrere Widerstandskämpfer, von denen dies bisher unbekannt war, einem Corps zuzuordnen. Dies wertet die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe als Motivation zum Widerstand deutlich auf – analog gilt dies weit über das Corpsstudententum hinaus. Der hier vorliegende Band soll Anstoß sein, auch andernorts die Herkunft und Zusammengehörigkeit von Widerstandskämpfern genauer zu beleuchten.
Ein herzlicher Dank gilt denjenigen, die zur Entstehung dieses Werkes beigetragen haben. Zunächst seien alle Autoren genannt, die mit viel Mühe und Sorgfalt die Lebensbilder ehrenamtlich erstellt haben und von denen einige Tag und Nacht dem Herausgeber mit Rat und Tat zu Seite standen. Für die Erstellung des Registers und für sorgfältiges Korrektorat sei Eva-Maria Dempf gedankt. Groß war die Geduld des Verlages mit dem Herausgeber und den Autoren, stellvertretend sei hier Heike Frank genannt. Und ohne das Wohlwollen von Dr. Florian Simon hätte es diesen Band wohl kaum gegeben.
Schließlich sei, und dies ist dem Herausgeber ein besonderes Anliegen, den Spendern gedankt, die den Druck dieses Werkes ermöglicht haben. An hervorgehobener Stelle sei hier das Corps Palatia Bonn genannt; ebenso die Corps Borussia Bonn, Saxo-Borussia Heidelberg und Saxonia Göttingen. Enorme Hilfe und viel Rückenwind kamen schließlich vom Kösener Senioren-Convents-Verband und vom Verband Alter Corpsstudenten.
München / Steinhagen, im Mai 2014
Sebastian Sigler
Vorwort des Ersten Vorsitzendendes Verbandes Alter Corpsstudenten, VAC
Corps sind in dem Sinne unpolitisch, daß sie als Körperschaft keine politische Aussage tätigen. Das bedeutet aber nicht, daß der einzelne Corpsstudent unpolitisch wäre. Vielmehr ist er wie jeder sich seiner Verantwortung bewußte Staatsbürger angehalten, sich in den öffentlichen Angelegenheiten seines Landes zu unterrichten und sich seine Meinung zu bilden. Dieser Grundsatz gilt unangefochten seit der Stiftung der ersten Corps vor mehr als 200 Jahren.
Ein Corpsstudent ist gemeinhin ein Zoon Politikon im aristotelischen Wortsinne, also ein soziales, auf Gemeinschaft angelegtes und Gemeinschaft bildendes Wesen. Daher haben Corpsstudenten seit jeher erfolgreich Netzwerke gebildet. Der wohl ausschlaggebende Grund dafür war und ist das tiefe gegenseitige Vertrauen, das durch das Kennen des anderen auch und gerade in besonders fordernden Lebenslagen – wie insbesondere der Mensur – entsteht.
Und schließlich heißt Corpsstudent zu sein, sich für das Wohl der Gemeinschaft, des Ganzen, einzusetzen, verbunden mit der Mahnung, ausnahmslos dem eigenen Gewissen und den corpsstudentischen Idealen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu folgen. Dies vorausgeschickt, wird es nachvollziehbar, warum so viele Corpsstudenten sich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus engagierten und sogar ihr Leben für ein „besseres Deutschland“ wagten.
Für den Verband Alter Corpsstudenten stellt die Forschung und Darstellung des Wirkens von Corpsstudenten im Nationalsozialismus ein wichtiges Element dar. Denn nur gesicherte Erkenntnisse um historische Tatsachen – also positives und nicht nur vermutetes Wissen – dürfen die Grundlage für unser immerwährendes, dankbares Gedenken an unsere Widerstandskämpfer bilden und als Ansporn für kommende Generationen dienen, sich ihr Leben lang für corpsstudentische Ideale einzusetzen.
Das vorliegende Werk schließt eine Lücke unserer Geschichtsforschung, denn es ist erstmalig gelungen, die Corpszugehörigkeit mehrerer Widerstandskämpfer nachzuweisen. So gilt unser Dank dem Herausgeber und den Autoren für ihre hingebungsvolle Arbeit, mit der sie einen maßgeblichen Beitrag zu dem Selbstverständnis unserer Corps geleistet haben. Möge ihr Werk die ihm gebührende Beachtung finden!
Hartung Hubertiae Freiburg, Hasso-Nassoviae, Sueviae Freiburg, Tiguriniae, des Symposion, 1. Vorsitzender des Verbandes Alter Corpsstudenten e.V.
Inhaltsverzeichnis
Sebastian Sigler
Einleitung
Widerstand ab der ersten Stunde
Erica von Hagen
Erinnerungen 1933 bis 1945
Sebastian Sigler
Hans Koch – ein deutsches Schicksal im Widerstand
Markus Wilson-Zwilling
Prittwitz tritt zurück
Günter Brakelmann
Peter Graf Yorck von Wartenburg
Rund um die Septemberverschwörung von 1938
Sebastian Sigler
Eduard Brücklmeier – Netzwerker gegen Hitler
Rainer A. Blasius
Hasso von Etzdorf – vom Königlich Preußischen Leutnant zum Botschafter der Bundesrepublik
Robert von Lucius
Speere werfen und die Götter ehren – Nikolaus von Halem
Wilhelm Girardet
Ulrich v. Hassell – ein großer Gescheiterter der Geschichte
Ulrich v. Hassell
Tübingen
Henning Frhr. v. Soden
Herbert Mumm von Schwarzenstein Palatiae Bonn IdC
Wolfgang Wippermann
Widerstand für Polen und Juden – Rudolf von Scheliha
Wolfgang v. der Groeben
Adam v. Trott zu Solz
Die Freiburger Kreise
Sebastian Sigler
Franz Böhm – wie einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft der Gestapo entkam
Sebastian Sigler
Denken und Handeln für Wahrheit und Freiheit – das Lebenswerk Walter Euckens
Widerstand in der Zivilgesellschaft
Michael Eggers
Wilhelm Abegg – Polizeireformer und Widerstandskämpfer der ersten Stunde
Henning Aretz
„Zu aufrecht und offen, um seine Gesinnung zu verbergen“ – Wilhelm v. Arnim-Lützlow
Sebastian Sigler und Klaus Gerstein
Der einsame Weg des Kurt Gerstein
Rüdiger Döhler
Hans-Wolfram Knaak – Widerstand als aktiver Senior
Maximilian Waldherr
Die Verfolgung des Oberforstmeisters Josef Planke im Dritten Reich
Hans Christoph von Rohr
„Hauptfeind der Nationalsozialisten in Pommern“
Dedo Graf Schwerin v. Krosigk
Friedrich-Karl v. Zitzewitz
Widerstand im Ausland
Christian Prosl v. Chodelbach
Karl Burian und das Corps Ottonen
Hans Kirchhoff
Georg Ferdinand Duckwitz – bewegte Zeit in Dänemark
Sebastian Sigler
Wilhelm v. Flügge – Doppelspiel in Istanbul
Widerstand in der Kriegszeit
Horst-Ulrich Textor
Eberhard von Breitenbuch – ein verhinderter Attentäter
Rüdiger Döhler
Der Fall Max Draeger – ein Mord aus Rache?
Christian-Erdmann Schott
Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und das Corps Saxonia zu Göttingen
Sebastian Sigler
Ernst Vollert – ein Corpsbruder rettete ihn aus dem Prager Gestapokeller
Sebastian Sigler
Das soziale und das korporierte Umfeld der Corpsstudenten im Widerstand
Corpsstudentische Kurzbiographien aus dem Widerstand
Autorenverzeichnis
Abbildungsnachweise
Personenregister
Sachregister
Abkürzungsverzeichnis
AH
Alter Herr; examiniertes Mitglied eines Corps – der Begriff wird unabhängig vom Lebensalter verwandt
AHV
Altherrenvorstand; Vorstand der examinierten Mitglieder eines Corps, internes Gegenstück zum CC
CB
Corpsbursch; studierendes, voll vertretungsberechtigtes Mitglied eines Corps
CC
Corpsburschen-Convent; Entscheidungsgremium der studierenden Mitglieder eines Corps
CV
Cartellverband; Verband der katholischen, farbentragenden, nicht mensurbeflissenen – also keine Pflichtmensuren fordernden – Verbindungen; alternativ wird die Abkürzung verwendet für eine Einzelverbindung, dann meist: CV-Verbindung
DB
Deutsche Burschenschaft
EM; EB
Ehrenmitglied oder Ehrenbursch; besonders verdienter Alter Herr eines Corps
F
Fuchs; noch lernendes, nicht vertretungsberechtigtes Mitglied eines Corps
GRU
Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije; Hauptverwaltung für Aufklärung, Zentralorgan des Geheimdienstes der sowjetischen Streitkräfte
iaCB
inaktiver Corpsbursch; Mitglied eines Corps, das sein Studium noch nicht abgeschlossen, aber alle Pflichten erfüllt hat
IdC
Inhaber der Corpsschleife; Mitglied eines Corps, das nicht alle Pflichten erfüllen konnte und deshalb kein Band trägt; oft geht es hier um die medizinisch indizierte Unmöglichkeit, die Pflichtmensuren zu fechten
KCL
Kösener Corpsliste
KDStV
Katholische Deutsche Studentenverbindung, von den Corps unterschieden unter anderem durch das Fehlen der Pflichtmensur, farbentragend
KSCV
Kösener Senioren-Convents-Verband; Dachverband der Kösener Corps in Deutschland, Österreich, Belgien sowie – assoziiert – Ungarn und Lettland
KStV
Katholischer Studentenverein; nicht mensurbeflissene, keine Farben tragende Verbindung
KV
Kartellverband; Dachverband der KStV
MG
Münchner Gesellschaft; Mittelding zwischen Verbindung und studentischem Club
MKV
Mittelschüler-Kartell-Verband; größter österreichischer Absolventenverband
NKWD
Narodny kommissariat wnutrennich del; Volkskommissariat für innere Angelegen heiten, in etwa das Innenministerium in der stalinistischen Sowjetunion, ab 1946: Ministerium für innere Angelegenheiten
NSDStB
Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund
WSC
Weinheimer Senioren-Convent; Dachverband der Corps an Technischen Universitäten
W.S.C.
Wiener Senioren-Convent; Gremium der legitimistischen, also kaisertreuen Corps in der österreichischen Hauptstadt
Einleitung
Von Sebastian Sigler
Die Zahl derer, die gegen Adolf Hitler und das NS-Regime aufstanden, ist, absolut gesehen, erschreckend klein. Das gilt für die Gesamtbevölkerung im Deutschen Reich ebenso wie für die korporierten Studenten – und die Corps sind davon mitnichten ausgenommen. Beim genaueren Blick auf Lebenslinien und persönliche Schicksale erschließen sich jedoch erstaunliche und darstellenswerte Zusammenhänge. Einige davon, alle im Zusammenhang mit studentischen Korporationen, bilden den thematischen Rahmen dieses Buches. Als Gruppe, an der die Heterogenität der Motivation zum Widerstand bei vergleichbar strukturierter sozialer Distinktion gut erkennbar wird, sind in der vorliegenden Studie die Angehörigen von Kösener Corps für die einzelnen Aufsätze ausgewählt worden.
Jeder Einzelne, der gegen Hitler aufstand, hat Zeichen gesetzt, ist Vorbild geworden. Natürlich ist es klar – in diesem Buch kann nicht die Geschichte einer ganzen Epoche aufgearbeitet werden. Vielmehr sollen die individuellen Geschichten erzählt werden von Menschen, die sich aus eigenem Antrieb dem NS-Regime widersetzten. Ob diese Menschen fehlerfrei agierten und ethisch makellos handelten, muß in manchen Fällen, in denen sich verschiedene Motivationen überlagerten, dahinstehen.1 Der Fokus liegt vielmehr auf einer ungewöhnlich frühen lebensgeschichtlichen Gemeinsamkeit. Sie bildet die Klammer für die hier dargestellten Personen, denn sie alle waren Corpsstudenten. Und die Mitgliedschaft in einem Corps gründet sich auf die Aktivenzeit, die in aller Regel in den ersten Studiensemestern stattfindet; daraus ist die Unterschiedlichkeit der einzelnen Lebenswege zu erklären, zugleich aber erweist sich, wie wirkmächtig die frühe Bindung in sozialen Gruppen ist. Das studentische Mensurwesen ist, das zeigt zumindest die Lebenserfahrung derer, die einer mensurbeflissenen Verbindung angehören, in der Lage, [12] besonders tragfähige Bindungen aufzubauen. Die Corps bilden hier durch Alter und Bekanntheit eine hervorgehobene Rolle. Doch diejenigen, die einer anders zu verortenden Verbindung angehören, sollen auch bedacht sein. In einem weiteren Aufsatz, einer annotierten Reihung, werden sie gewürdigt. Dieses Buch steht dabei nicht ohne Bezüge – die Forschungslandschaft ist vielfältig, und speziell christlich motivierten Widerstandskämpfern oder auch den Diplomaten ist bereits in einigen Sammelbänden gedacht worden.2 Es ist der Wunsch und das Ziel des Herausgebers, den vorliegenden Band dort eingereiht zu sehen.
Menschen, die in der Zeit des Dritten Reiches schuldig wurden, können nicht Gegenstand dieses Buches sein. Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die thematische Festlegung auf Widerstandskämpfer und Widerstehende nicht als Vergessen, Verschweigen oder die Relativierung von Verbrechen, Zustimmung und Mitläufertum an anderer Stelle mißverstanden werden darf. Die Zahl derjenigen, die in Gesamtgesellschaft und damit auch in den Corps und anderen Verbindungen zu Mitläufern oder gar zu Tätern wurden, ist Legion. Das ist eine absolute Tatsache. Relativ ist lediglich der zeitliche Kontext: zwölf Jahre dauerte die Diktatur des NS-Regimes. Angesichts einer Zeitspanne von über 220 Jahren – so lange gibt es bereits Korporationen in der heute bekannten Form – könnte diese Zeit vergleichsweise kurz genannt werden, doch das wäre völlig verfehlt, sind doch die Auswirkungen der NS-Diktatur bis heute in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen.
Das 19. und 20. Jahrhundert sind bis heute für alle Gesellschaftsbereiche in Deutschland enorm prägend; diese Zeitspanne umfaßt vom Ende des Alten Reiches an die gesamten grundstürzenden Veränderungen politischer und kultureller Natur, denen der mitteleuropäische Kulturraum seither ausgesetzt war. Die Korporierten sind Zeitzeugen, und aus vielen Aufzeichnungen ersehen wir, daß sie wache, kundige und bewußte Zeugenschaft ablegten. Ein besonders komplexes Einzelthema in diesem zeitlich weit gefaßten Kontext ist der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Hier kann nur der Versuch unternommen werden, exemplarisch aufzuzeigen, wie die Strukturen dafür, daß es unter Corpsstudenten doch eine nennenswerte Zahl von Widerstandskämpfern geben konnte, angelegt waren. Keinesfalls kann hier auch nur ansatzweise eine Vollständigkeit erwartet werden. Die Namen der hier gewürdigten Widerstandskämpfer stehen damit für viele weitere Persönlichkeiten innerhalb wie außerhalb der Korporationsszene, die sich, oft in kleinen Gesten, aktiv gegen Hitler und seine Helfershelfer engagiert haben.
Diejenigen, die sich widersetzten, waren zumeist menschlich sehr isoliert.3 Es kann nicht genug betont werden: unerträglich viel höher, so fühlen und wissen wir [13] aus heutiger Sicht, war die Zahl der Täter gegenüber den Wenigen, die widerstanden – eine Tatsache, die auch uns heute noch nachdenklich sein lassen muß und die zu großer Aufmerksamkeit Anlaß gibt. Das „Nie wieder!“ ist zentrale Aufgabe. Auch heute.
Woher aber kamen die, die sich widersetzten? Gab es ein corpsstudentisch motiviertes Netzwerk, das gegen Hitler konspirierte? Oder gab es, um genauer zu formulieren, ein von Personen, die corpsstudentisch geprägt und erzogen waren, geknüpftes Netzwerk? Die Antwort auf diese spannende Frage sei vorweggenommen. Es gab ein Netzwerk, dem in signifikanter Zahl Angehörige der verschiedenen genannten Gruppen mit kongruenter sozialer Distinktion angehörten – zu nennen sind pars pro toto die Familienverbände, der Johanniterorden, bestimmte Einheiten des preußischen Militärs und das Corpsstudententum. Das ist auch logisch, denn es gab eine – vielfach festgestellte – mentalitätsmäßige Übereinstimmung zwischen preußischem Offizierscorps, den diese Offiziersschicht mehrheitlich tragenden Familien, darin wieder viele Johanniter, und eben den Kösener Corps. Doch die hier genannten Gruppen bildeten vielleicht eine Art Rückgrat des Netzwerks des Widerstands, aber sie waren nicht exklusiv vertreten. Auch eine ganze Anzahl katholischer Gruppen und auch die politische Linke bildeten Strukturen, in und aus denen Widerstand wachsen konnte. Ein wichtiger Aspekt daran ist, daß es vielfache Überschneidungen sind, die die Materie komplex machen.
Corpsstudenten, Offizierscorps, Johanniterorden und Familienverbände – diese vier gesellschaftlichen Gruppen verdienen es, mit den Methoden der Netzwerkforschung gründlich untersucht zu werden. Dieses Netzwerk einer korporierten Gesellschaft ist komplex, denn viele andere Gruppen spielten in diesem oder jenem Fall mit hinein. Die Gesamtschau der überproportional häufig – besser: weniger selten – im Widerstand anzutreffenden gesellschaftlichen Gruppen wird zusätzlich erschwert, weil es kaum Kompatibilität zwischen akademischen Berufen und militärischem Dienst gab. Die Abkunft aus einer alten Familie ließ sich mit dem Johanniter- oder dem Malteserorden gut kombinieren – je nach Konfession. Dazu paßte entweder das Corpsstudententum oder der Dienst als Offizier – und zwar, ziemlich streng, nur eines von diesen beiden. Zudem waren katholische Corpsstudenten kaum denkbar, denn seit dem Kulturkampf des 19. Jahrhunderts stand die Exkommunikationsdrohung für gläubige Katholiken, die sich einer scharfen Mensur stellten, im Raum. So waren die Kösener Corpsstudenten fast durchweg evangelisch-lutherisch und – dies zumindest häufig – Reservisten der Reichswehr oder des preußischen Militärs. Dabei ist auch zu bemerken, daß in evangelischen Kreisen die Frage nach der Legitimität des Tyrannenmords, speziell die Diskussion des Römerbriefs, Kapitel 13, großen Raum einnahm und viel Kraft raubte. Auf katho[14]lischer Seite, wo sich seit dem späten Mittelalter die Lehre von der Legitimität des Tyrannenmords fest verankert hatte, taten sich die widerständigen, widerstehenden, zum Handeln entschlossenen Frauen und Männer leichter.
Dieser Band ist, so gesehen, nur ein Anfang. Für die heutigen Corpsstudenten unter den Lesern ist die hier gefundene Reihung von Lebensbildern indes mehr. Ein neuer Blick darauf, wie die Idee des Corpsstudententums sich in der schwersten Zeit auch bewährte, soll gewagt werden. Dieser Band enthält eine Vielzahl großer und kleiner Geschichten der Hoffnung in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext des Scheiterns, der die Gesamtgesellschaft des Deutschen Reiches betrifft.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß den Corpsstudenten ein charakterliches Merkmal, das sonst fast überall im Widerstand und bei schuldlos Verfolgten zu beobachten ist, fast komplett zu fehlen scheint – die habituelle Selbstverortung als Opfer. Das ist eine wichtige Unterscheidung von anderen Gruppen, denn ihre intrinsische Motivation zum Widerstand, die zweifelsohne vorhanden war, tritt hier nicht so klar zutage wie etwa bei Gewerkschaftern oder katholischen Priestern. Daher sei, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, schon vorab darauf hingewiesen. Wie äußerte sich das aber praktisch?
Im Überblick über die hier geschilderten Lebensbilder der Corpsstudenten läßt sich eine Tendenz feststellen, den Widerstand gegen das NS-Regime als selbstverständliche Pflicht zu empfinden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß das bereits im 18. Jahrhundert zu seiner heutigen Form gebrachte, aber viel ältere Ritual des „Landesvaters“, eine zentrale Weihehandlung unter Korporierten, die von den alten Corps in den Kanon der studentischen Bräuche eingeführt wurde, nicht der Person des jeweiligen Landesherrn, sondern vielmehr der transpersonalen Idee des Gemeinwesens gewidmet ist. Wenn derjenige, der sich als Widerstandskämpfer erhob, an dieses Ritual seiner Studentenzeit anknüpfte, dann konnte er daraus Bestärkung im Entschluß zum konkreten Handeln ziehen.
Der Grund für das Fehlen einer habituellen Selbstverortung als Opfer wird jedoch nicht allein in den corpsinternen Ritualen, sondern auch im Erleben der Betreffenden zu suchen sein. Hier kommt der jeweilige soziale Status ins Spiel, zu dem die Erziehung zu Pflichterfüllung, Ritterlichkeit und Tapferkeit gehörte. In jene alten Internate, aus denen die Corps überproportional häufig ihren Nachwuchs zogen und bis heute ziehen, schickten die Familien ihre Söhne, die auf diese Tugenden wert legten. So läßt sich der Schluß wagen, daß diese durch Internat, Militär, Corps und vor allem eine bestimmte Erziehung geprägt waren, die es ihnen ermöglichte, sich selbst gar nicht als Opfer zu sehen. Um zu dieser Sichtweise zu gelangen, waren Vorbilder vonnöten. Sowohl in alten, großen Familien wie in den Offizierscorps bestimmter Regimenter als auch in den alten Kösener Corps fanden sie Menschen, für die diese Attribute galten. Damit schließt sich dieser Kreis. In anderen Dachverbänden konnte die Wahrnehmung erheblich differieren. Dort hatt [15] das Bewußtsein, Opfer zu sein, mehr Raum; beispielhaft sind hier die konfessionsgebundenen – und darunter eher die katholischen – Verbindungen zu nennen.4
Gesondert sei erwähnt, daß es in den alten und noblen Corps unüblich ist, von seiner Corpsmitgliedschaft gesellschaftlich Gebrauch zu machen etwa in der Weise, daß Couleur getragen wird, um als Gruppe zu renommieren. Oft saß, um ein Beispiel zu nennen, Peter Graf Yorck v. Wartenburg mit Corpsbrüdern in Berlin zusammen, aber nie trug auch nur einer von ihnen Couleur. Dem Außenstehenden muß es erscheinen, als hätten Yorck und seine Corpsbrüder das Interesse am Corps Borussia Bonn, dem sie angehörten, verloren. Auch in der Forschung hat dies vielfach zu Irritationen geführt, wie das Verhältnis der Widerstandskämpfer zu ihren Corps zu bewerten sei. Die scheinbare Distanz war aber nur Attitüde;5 und dies gilt für die übrigen Corpsstudenten im Widerstand analog.
Widerstand im Auswärtigen Amt
Unter den Korporierten im Widerstand sticht eine Gruppe hervor: die Diplomaten. 6 Adam v. Trott zu Solz, Herbert Mumm v. Schwarzenstein, Ulrich v. Hassell, Hasso v. Etzdorf und Eduard Brücklmeier – sie alle waren Corpsstudenten.7 Bis auf Etzdorf, der unentdeckt blieb, wurden sie alle durch Hitlers Schergen gehenkt. Zwei weitere von ihnen gehörten der Münchner Gesellschaft – kurz „MG“ genannt – an, einem Mittelding zwischen Adelsclub und Studentenverbindung, in etwa nach Art eines Kösener Corps. Es handelt sich um Albrecht v. Kessel und Ulrich Wilhelm [16] Graf v. Schwerin. Kessel überlebte, Schwerin wurde gehenkt. Alle diese Männer konnten sich auf das Stillschweigen von Ernst v. Weizsäcker, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, verlassen. Zwar trat v. Weizsäcker nicht im Widerstand in Erscheinung, er wußte aber zweifelsfrei schon früh von der Existenz dieses widerständigen, vielleicht ab 1937 bestehenden, spätestens aber seit dem Frühjahr 1938 einen Staatstreich mit Entmachtung Hitlers planenden Netzwerks.8 Da die meisten von ihnen erst nach dem 20. Juli enttarnt wurden, folgt daraus, daß auch Weizsäcker hier zumindest geschwiegen, möglicherweise aber auch unauffällig und höchstpersönlich seine schützende Hand über diese Widerstandskämpfer gehalten hat.9 Er ließ dabei Vorsicht walten und wirkte nach außen sehr systemkonform – so wie im übrigen auch die Mehrzahl der genannten Widerstandskämpfer, die pro forma in ihrer Mehrheit Mitglieder der NSDAP und teils auch mit einem SS-Rang ausgestattet waren.10 Trefflich mag man darüber streiten, ob dies eine Form der Anpassung oder der Vereinnahmung war. Daß sie so wenig als Vertreter eines manifesten Widerstands sichtbar wurden und vielfach auch nicht voneinander wußten, ist nur mit einer heute fast unvorstellbar dichten Überwachung und Bespitzelung in einem totalitären Deutschen Reich unter dem NS-Hakenkreuz zu erklären. Zeitzeugen berichten davon eindrücklich.11 Immerhin fand über v. Weizsäcker die erste Fühlungnahme von Widerstandsgruppen im Auswärtigen Amt und im Amt Abwehr statt. Hier waren es die bereits genannten Diplomaten, dort Offiziere um Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Henning v. Tresckow und Hans Oster. Die Fühlungnahme geschah über die wechselweise Entsendung von Mitarbeitern.12 Auf diese – später dann vermehrt in enger Abstimmung agierende – Gruppe, die sich im Auswärtigen Amt und im Amt Abwehr auch nach v. Weizsäckers Versetzung nach Rom und der Entmachtung von Wilhelm Canaris noch bis Frühjahr 1943 – genauer: bis zur [17] Verhaftung Hans v. Dohnanyis – halten konnte, wird in diesem Buch verschiedentlich eingegangen, denn in ihr befanden sich zeitweise auch einige Corpsstudenten: Adam v. Trott zu Solz, Rudolph v. Scheliha, Hasso v. Etzdorf und Eduard Brücklmeier; engen Kontakt hielt man mit Ulrich v. Hassell, der als Botschafter natürlich zum Amt gehörte.
Gewöhnlich werden die genannten Diplomaten zusammen mit Carl Goerdeler und vielen Anderen dem „nationalkonservativen Widerstand“ zugerechnet. Dies ist eine Pauschalierung, die nicht weiterführt. Einige Widerstandskämpfer, die als „nationalkonservativ“ tituliert werden, verfolgten in Einzelfragen dezidiert sozialistische Ideen, so etwa Moltke, Yorck, teils auch Schulenburg und in bestimmten Fragen auch Trott. Zudem waren die Überschneidungen zwischen dem Kreisauer Kreis und dem Widerstand der Diplomaten auf wenige Personen beschränkt. Es gab einige wenige „Nachrichtenoffiziere“, die Informationen von einer Gruppe zur anderen brachten. Eduard Brücklmeier hatte zum Beispiel aller Wahrscheinlichkeit nach eine solche Verwendung als Übermittler; er sprach in Berlin mit verschiedenen Gruppen, insbesondere mit den Verschwörern aus dem Amt Abwehr und dem Auswärtigen Amt. Er traf sich öfters mit Schulenburg, und er trug Informationen nach Potsdam zu Angehörigen des militärischen Widerstands weiter, darunter Schwerin.13 Die Diplomaten im Auswärtigen Amt und im Amt Abwehr sind eine der wichtigen Wurzeln des bürgerlichen Widerstands – aber nur eine unter mehreren. Sie in einem ungenau, ja, diffus definierten „nationalkonservativen“ Widerstand zu subsummieren, verunklart das Bild. Hier steht eine grundlegende Arbeit aus, die Klärung und Differenzierung schafft. Speziell für Carl Friedrich Goerdeler, einen der führenden Köpfe des Widerstands, der auch derart klassifiziert wurde, ist indes eine Klärung erfolgt. Vielfach wurde gerade auch er als „nationalkonservativ“ und – als wäre dies ein Automatismus – latent judenfeindlich dargestellt, doch Peter Hoffmann hat das so verfälschte Bild in seiner Monographie „Carl Goerdeler gegen die Verfolgung der Juden“ jüngst nachdrücklich geradegerückt.14
Die Frage nach den Netzwerken
Sie sind in ihrer Wichtigkeit für den Widerstand im NS-Regime nicht zu überschätzen: soziale Gruppen, die schon vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, genauer: vor dem Tag von Potsdam und der Reichstagswahl vom 5. März 1933, Bestand hatten. Teils sogar, wie der Johanniterorden, damals bereits über acht Jahrhunderte, oder, wie die Korporationen, immerhin anderthalb Jahrhunderte. Diese Netzwerke waren ein unverzichtbares Mittel zum Aufbau der kleinen, höchst konspirativ arbeitenden und gegenseitig manchmal auch nichts voneinander wis[18]senden Gruppen. Die Gemeinsamkeit der Korporationszugehörigkeit war ein Weg unter mehreren zur Bildung des Netzwerks. Man darf sich das aber durchaus bildlich vorstellen: da blätterten Alte Herren von Corps – oder auch Burschenschaften – in ihren Mitgliederverzeichnissen, um zu sehen, wer noch aufgrund seines Charakters und seiner Position für den Widerstand in Frage käme. Das haben übrigens durchaus nicht nur die Corpsstudenten so gemacht, sondern auch Angehörige des Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem. Die Johanniter Erwin v. Witzleben, Friedrich v. Rabenau und Ewald v. Kleist-Schmenzin sowie mindestens zwölf weitere Ritterbrüder wurden durch das NS-Regime hingerichtet. Fünf der hingerichteten Widerstandskämpfer waren zugleich Johanniter und Corpsstudenten: v. Trott zu Solz, v. Hassell, Graf Yorck, Mumm v. Schwarzenstein und v. Hagen; der MGist Schwerin, ebenfalls Johanniter, sei ebensowenig vergessen wie der Überlebende Eberhard v. Breitenbuch, Angehöriger der Corps Silvania Tharandt und Franconia Fribergensis, Rechtsritter des Johanniterordens.
Fast durchgehend agierten die Corpsstudenten auch in der Gestapohaft und in Konzentrationslagern souverän und beherrscht. Sie blieben „Herren“, auch unter Folter, vor dem Volksgerichtshof zumal. Und dann, ganz am Ende, auf ihrem letzten Gang. Dieses Fehlen eines Signals an die Um- und Nachwelt, daß sie Opfer seien, hat vielfach den Blick auf ihre wahre Geschichte verstellt. Und wenn schon die Tatsache, daß sie Corpsstudenten, Angehörige alter Familien oder Johanniter waren, nur höchst mittelbaren Einfluß auf ihr Engagement im Widerstand hatte – das Fehlen der Opfer-Attitüde, das ihnen mit ganz wenigen Ausnahmen gemeinsam war, ist sicher mit dieser sozialen Verortung in Zusammenhang zu bringen und es unterscheidet sie sehr trennscharf von anderen Gruppen, die ebenfalls im Widerstand gegen Hitler tätig waren.
Dieser Band kann, es wurde bereits erwähnt, keine Aufarbeitung einer Epoche sein. Sogar die abschließende Bewertung auch nur einer Gruppe unter denen, die Widerstand leisteten, kann kaum gelingen. „Es ist irreführend, die Beteiligung an Umsturzplänen zum Kriterium der Zugehörigkeit zum Widerstand zu machen“, stellt Professor Hans Mommsen fest.15 Widerstand war auch der wohlverstandene Ungehorsam gegen menschenverachtende Gesetze, das mutige Entgegentreten oder sogar nur die Bereitschaft, für den Fall des Umsturzes bereitzustehen.
Fast durchgängig ist schließlich in der älteren Forschung die Zuschreibung von Personen zum Widerstand davon abhängig gemacht worden, ob ihre Haltung und die Kenntnis ihrer offen erkennbaren oder arkan ausgeführten Widerstandstätigkeit auch an die Nachwelt – also über den Zusammenbruch von 1945 hinaus – übermittelt worden sind. Diese hemmende Barriere galt es in einigen Fällen zu überwinden; beispielhaft sei hier auf Wilhelm v. Flügge, der der Corps Saxo-Borussia Heidelberg angehörte,16 hingewiesen. Auch die Frage, ob die Taten der Gestapo [19] bekannt wurden, ob die Widerstandskämpfer also überhaupt verfolgt wurden oder ob schlußendlich ein Todesurteil am Ende stand – all dies ist ebenfalls kein Kriterium für die Zugehörigkeit zum Widerstand. Wie unterschiedlich die Biographien waren, wird in diesem Band niedergelegt; explizit sei auch auf die corpsstudentischen Kurzbiographien verwiesen, in denen Schicksale, in denen der Bereich des Widerstands berührt wurde oder die das Unglück von Opfern des NS-Regimes aufscheinen lassen. Der ganze Band ist in einem bewußt gut lesbaren, einem narrativen Stil gehalten. Die einzelnen Autoren nähern sich den beschriebenen Persönlichkeiten ganz unterschiedlich, und bewußt wurde diese Heterogenität belassen. Angemerkt sei auch, daß es jedem freistand, die neuesten Reformen der Rechtschreibung zu benutzen oder in der Orthographie zu bleiben, die seit Jahrzehnten allen vertraut ist.
„Alles ging verloren – die Ehre nicht!“ Diese Parole eint diejenigen, die in diesem Band Aufnahme gefunden haben. Dem gerecht zu werden – das haben sich die hier versammelten Autoren zur gemeinsamen Richtschnur gemacht.
1 Auch die Frage, ob Hochverrat vorlag oder Landesverrat und wie – gegebenenfalls – letzterer zu werten sei, kann nicht in jedem Fall beantwortet werden. Dort, wo eine faktische Antwort möglich ist, bedeutet dies jedoch immer noch nicht, daß auch eine moralische Wertung möglich ist. Albrecht v. Hagen äußerte dazu: ,,Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen.“ Vgl. dazu: Steinbach, Peter / Tuchel, Johannes (Hrsg.): Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Bonn 1994, S. 12. Verwiesen sei auch auf Golo Mann, der in diesem Zusammenhang äußert: „Unter der Diktatur des Verbrechens gab es keine Regel, an die man sich halten konnte.“ Vgl. Mann, Golo, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1958, hier verwendete Ausgabe: Frankfurt am Main 1992, S. 949.
2Ringshausen, Gerhard, Widerstand und christlicher Glaube angesichts des Nationalsozialismus, Lüneburger Theologische Beiträge, Bd. 3, Berlin 2007; Vollmer, Antje mit Keil, Lars Broder, Stauffenbergs Gefährten, Berlin 2013; Käßmann, Margot, Christlicher Widerstand, München 2013; Wala, Michael / Schulte, Jan Erik: Widerstand und Auswärtiges Amt, München 2013.
3 Die Frage, inwieweit ein Buch wie dieses seine Berechtigung hat, wurde mit Ratgebern aus unterschiedlichen Bereichen ausgiebig erörtert. Exemplarisch genannt sei ein Satz aus einer Nachricht, die Detlef Graf v. Schwerin am 22. Juli 2011 an den Herausgeber sandte: „Ich finde es richtig, daß man den heutigen Korporierten die Männer des Widerstandes aus ihren Reihen als Beispiel politischer und menschlicher Haltung vor Augen führt, aber sie standen in keiner Weise für die Haltung ihrer Verbindungen, sondern waren isoliert und Einzelkämpfer.“ Das sei hiermit unterstrichen.
4 Vgl. dazu: Moll, Helmut (Hrsg.), Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, Paderborn 20105; vgl. für die evangelisch-lutherische Konfession: Schultze, Harald und Kurschat, Andreas (Hrsg.), „Ihr Ende schaut an…“ Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts, Leipzig 2006; vgl. weiterhin in diesem Band: Beitrag „Korporierte aller Couleur im Widerstand gegen Hitler“, dort den Abschnitt: „Widerstand im Glaubenszusammenhang“.
5 Noch heute ist es so üblich.
6 Zur Bewertung des Widerstands im Auswärtigen Amt eine immer noch grundlegende Studie: Deutsch, Harold C., Verschwörung gegen den Krieg. Der Widerstand in den Jahren 1939–1940, München 19692, passim.
7 In dieser Abhandlung geht es nicht darum, möglichst viele Träger eines Bandes aufzuzählen, sondern es soll insgesamt einer Art und Weise, in der Sozialisierung stattfand, nachgespürt werden. Das soziale Milieu, das den Corps nahestand, reicht durchaus noch etwas weiter, als es die Kösener Corpsliste ausweist. Als Beispiel sei genannt Bernhard Klamroth, der als Oberstleutnant im Generalstab am Stauffenberg-Attentat teilnahm und am 15. August 1944, im selben Prozeß wie Adam v. Trott zu Solz Saxoniae Göttingen, zum Tode verurteilt wurde. Auch sein Vetter zweiten Grades, Johann-Georg, den er in Stauffenbergs Pläne eingeweiht hatte, empfing in diesem Prozeß sein Todesurteil. In der Familie Klamroth war es über Generationen hinweg gute Übung, beim Corps Hansea Bonn aktiv zu werden. Die Bonner Hanseaten nennen Bernhard Klamroth als Spefuchs in jenen Jahren, also jemanden, der sicher das weiß-rot-weiße Band aufgenommen hätte, wenn ihm die Zeit verblieben wäre. Vgl. dazu Altherrenverein des Corps Hansea Bonn e. V. (Hrsg.), Geschichte des Corps Hansea zu Bonn 1929 bis 1999.70 Jahre seiner Geschichte, Bonn 2006 (Selbstverl.), S. 56; vgl. weiterhin Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Royce, Hans (Bearb.), 20. Juli 1944, Bonn 1969, S. 221.
8Weizsäcker, Ernst v., Erinnerungen, München 1950, S. 173–177, zitiert bei: Hoffmann, Peter, Widerstand – Staatsstreich – Attentat, S. 87: „Ebenso wie in der Abwehr gab es im Auswärtigen Amt eine Gruppe junger und älterer Mitarbeiter, die konspirativ tätig waren und von ihren Vorgesetzten, in jenem Falle Canaris, in diesem v. Weizsäcker, geduldet und weitgehend gefördert wurden. (…) wie auch v. Weizsäcker selbst in entsprechenden Beziehungen zu Beck, nach dessen Rücktritt zu Halder, und zu Canaris stand.“; Deutsch, Verschwörung gegen den Krieg, S. 43 f.
9 Eher kritisch – und wohl auch etwas kritischer als durch den Autor – wird v. Weizsäcker gesehen von: Blasius, Rainer A., Für Großdeutschland – gegen den großen Krieg. Staatssekretär Ernst Frhr. von Weizsäcker in d. Krisen um die Tschechoslowakei und Polen 1938/39, Köln 1981 (Diss.). Hier ist zu überlegen, ob eine Unterscheidung gemacht werden sollte zwischen einem „frühen“ Weizsäcker, der von 1937 bis 1939 entschieden gegen den Krieg und damit für die Opposition gegen Hitler optierte, und einem „späten“ Weizsäcker, der nach und nach resignierte und am Ende sogar Mitwisser des Holocausts wurde.
10 Hier ist wieder das „Gesetz über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehrmacht“ vom 24. September 1935, RGBl., Bd. I, S. 1203 f., zu nennen; ab Anfang 1938, zunehmend 1939 wurde zudem Stück für Stück erzwungen, daß höhere Beamte Parteimitglieder und SS-Mitglieder zu sein hatten. Die Biographien vieler späterer NS-Opfer weisen Parallelen zu diesen beiden Wellen der Selbstradikalisierung des NS-Systems auf.
11Dönhoff, Um der Ehre willen, S. 13.
12 Ebd., S. 22.
13 Interview des Autors mit dem Mitverschwörer vom 20. Juli, dem damaligen Leutnant Heinrich-Ewald v. Kleist-Schmenzin, am 23. September 2009 in dessen Privathaus in München-Menterschwaige.
14Hoffmann, Peter, Carl Goerdeler gegen die Verfolgung der Juden, Köln / Weimar / Wien 2013, passim.
15Prof. Dr. Mommsen, Hans, Festvortrag anläßlich der Tagung „Widerstand und Auswärtiges Amt“, Tutzing, 10. September 2011.
16Gerlach, Otto (Hrsg.), Kösener Corpslisten 1960, Kassel 1961, Nr. 66–1169.
Widerstand ab der ersten Stunde
Erinnerungen 1933 bis 1945
Von Erica von Hagen
Der hier vorliegende Text stammt aus der Feder der Witwe des Widerstandskämpfers Albrecht v. Hagen. Es handelt sich um wörtliche Auszüge persönlicher Lebenserinnerungen, die die Autorin speziell für ihren Enkel Helmuth verfaßt hat.1 Lange Passagen rein privater Schilderungen wurden ausgelassen, und nur dort, wo es zum Textverständnis notwendig ist, wurde das angezeigt. So sind einige zeitliche Sprünge zu erklären, doch die thematische Geschichte des Widerstandskämpfers Albrecht von Hagen aus der Sicht seiner Ehefrau ist in sich geschlossen und kohärent. Es sei dem Herausgeber gestattet, einige biographische Worte zur Person Albrecht von Hagen vorauszuschicken.
Albrecht von Hagen wurde am 11. März 1904 als viertes von sieben Kindern des Gutsbesitzers und Reserveoffiziers Gerhard von Hagen und dessen Ehefrau Elisabeth aus der Familie von Stülpnagel auf dem hinterpommerschen Rittergut Langen im Kreis Belgard geboren, das seit 1820 der Familie, einem neumärkisch-pommerschen Uradelsgeschlecht, gehörte. Er studierte ab 1922 Rechtswissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und belegte einige Semester an der Albertus-Universität Königsberg. Bereits 1922 ist er bei Saxo-Borussia Heidelberg rezipiert worden; bekannt ist aus seiner Aktivenzeit, daß er als Senior einer Forderung auf schwere Säbel nachkam, möglicherweise durch einen österreichischen Burschenschafter.
Nach dem Referendariat war v. Hagen als Syndikus bei der Osthilfe und einer Privatbank beschäftigt. Am 29. Mai 1927 heiratete er Erica v. Berg, die auf dem Rittergut Perscheln in Ostpreußen aufgewachsen war. Drei Kinder wurden dem Paar geboren: 1928 Helmuth, der bereits im Januar 1933 an einer Hirnhautentzündung verstarb, 1933 Albrecht Hans Berthold und 1935 Helmtrud-Erica.
Bereits 1933 war v. Hagen ein kompromißloser Gegner des Nationalsozialismus, und das war auch bekannt. Ebenfalls seit 1933 war er als Angestellter bei der „Bank für deutsche Industrieobligationen“ in Stettin tätig. Aufgrund falscher Korruptionsvorwürfe zog ihn der Direktor der Bank nach Berlin ab. Wegen seiner standhaften Weigerung, der NSDAP beizutreten, wurde Hagen nur bis zum Handlungsbevollmächtigten befördert. 1935 nahm er an freiwilligen Offizierslehrgängen der [24] Erica von Hagen Wehrmacht teil, nicht zuletzt, um als Offizier nicht Parteimitglied werden zu müssen – „der Partei“ wollte er um keinen Preis angehören.
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde Hagen als Leutnant der Reserve zur 10. Panzerdivision eingezogen. Er wurde zunächst als Ordonnanzoffizier im Versorgungsstab in Wünsdorf bei Berlin eingesetzt. Später wurde er zur Teilnahme am Frankreichfeldzug und zum Vormarsch in die Sowjetunion befohlen. 1943, bei einer Verwendung während des Afrikafeldzuges lernte er in Tunis Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg kennen und schloß sich unter dessen Einfluß dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten an. Um ihn bei einem Staatsstreich im Zentrum des Geschehens einsetzen zu können, organisierten die Offiziere im Widerstand seine Versetzung zum Oberkommando der Wehrmacht, wo er für den Kurierdienst zwischen den Dienststellen in Berlin und dem Führerhauptquartier Wolfsschanze zuständig war. Sein Vorgesetzter war Generalmajor Hellmuth Stieff, Chef der Organisationsabteilung des Heeres. Im November 1943 vergrub er gemeinsam mit dem befreundeten Major im Generalstab Joachim Kuhn ein Kilogramm Sprengstoff. Der war für den Wehrmachtsoffizier Axel Freiherr von dem Bussche-Streithorst bestimmt, der sich bei einer Uniformvorstellung mit Adolf Hitler in die Luft sprengen wollte. Der vergrabene Sprengstoff wurde von der Geheimen Feldpolizei gefunden, aber Hagen und Kuhn blieben unbehelligt. Im Mai 1944 besorgte Hagen abermals Sprengstoff für ein Attentat auf Adolf Hitler und übergab ihn seinem Vorgesetzten Stieff. Den Sprengstoff, den Stauffenberg am 20. Juli 1944 zündete, beschaffte allerdings Wessel Freiherr von Freytag-Loringhoven.
Von Hagen wurde unmittelbar nach dem gescheiterten Umsturzversuch verhaftet. In der Nacht zum 1. August 1944 wurden seine Eltern und seine Ehefrau verhaftet, die beiden Kinder wurden in ein NS-Kinderheim verschleppt. Am 8. August 1944 wurde Albrecht von Hagen vom Volksgerichtshof in einem Schauprozeß zum Tod verurteilt und noch am selben Tag in Plötzensee auf ausdrücklichen Befehl Hitlers durch Erhängen hingerichtet.
1933, Stettin
„Deutschland erwache!“ oder (…) ehrgeizige, aufrührerische Sprüche wie „Heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt“ und schließlich „Führer wir folgen Dir!“ – Alle diese wilden Lieder hämmerten auf nach politischer Freiheit lechzende Menschen (ein), denn Deutschland war ein mächtiges und geachtetes Land gewesen, bevor es den 1. Weltkrieg verlor. Die Propaganda war raffiniert aufgezogen. Nur wenige Menschen erlagen nicht. Zu ihnen gehörten Albrecht und seine engsten Freunde.
Mit Sorge sahen sie (Albrecht von Hagen und seine Frau Erica, d. Hrsg.) den Aufmärschen der SA und den wilden Fackelzügen zu, welche sich durch die Falkenwalder Straße zum Paradeplatz in Stettin hin ergossen, eskortiert von der halben [25] Stadtbevölkerung. Die Hakenkreuzfahnen hingen plötzlich ab 1933 aus vielen Fenstern. Es war schon überwältigend.
1935
Im Sommer 1935 meldete Albrecht sich freiwillig zu Wehrmachtslehrgängen in Döberitz, im märkischen Sand von Döberitz. Dort erlebte er den preußischen Militärdrill in Reinkultur. Seine Schilderungen waren sehr komisch, denn Kleider und Schuhe putzen sowie Dielenschrubben gehörten nicht zu seinen Ambitionen. Er wurde dann auch bald Stubenältester. Als solcher erfand er die sehr brauchbare Lehre, daß langweilige Dinge so schnell und so gut zu besorgen seien, daß man erstens fix damit fertig sei und zweitens keine Beanstandungen passieren können, damit man Zeit für nützliche Dinge übrig behielt. Wenn man bedenkt, daß ihm zu Hause jeder Strumpf einzeln von irgendwoher nachgeräumt werden mußte!
Zu dieser Zeit erwartete Erica wieder ein Kind.2 Es war ihr während der ersten Monate nicht gut gegangen. Sie hatte viel liegen müssen. So paßte es gut in das Konzept, daß Albrecht bei den Soldaten quasi untertauchte. Er tat dies auch aus politischen Gründen, denn in der Wehrmacht entzog er sich dem Zugriff der SA. Trotz Drängens von Seiten der Partei wurde er nicht PG, weil er den Zwang zur politischen Haltung ablehnte. Er bejahte nach wie vor das Recht auf freie Meinungsäußerung. Im Beruf als Jurist in der Industriebank machte er aus diesem Grunde keine Karriere. Er war jedoch froh, daß er nicht rausflog. Er hatte, ohne davon zu wissen, einen Schutzpatron: Direktor Dr. Boetzkes, der im Vorstand der Bank das Sagen hatte. Der achtete diesen klugen, bescheidenen Mann.
Stark waren die Nazis in der Bevormundung bis in die Spitzenpositionen in allen Betrieben. Auch ein Bankdirektor wurde über Nacht abgeholt und in ein Konzentrationslager gesperrt, wenn er nur irgendwie verdächtigt wurde, sich gegen die Partei geäußert zu haben. Die Angst vor dem Nächsten, dem Nachbarn, dem Angestellten, die pure Angst ging um. In drei Jahren hatten die Nazis erreicht, daß die Eltern selbst ihren Kindern nicht mehr trauen konnten. In der Hitlerjugend mußten Kinder über alle Äußerungen ihrer Eltern und Bekannten berichten.
1936
Vor allem Albrecht empörte sich über die diktatorischen Methoden mit solcher Schärfe, daß man ihm vorwarf, die Großstadt Berlin hätte ihm den klaren Blick für die Realitäten getrübt. Auf dem Land hätte man eine klarere Urteilsfähigkeit. Man sähe doch, daß es keine Arbeitslosen mehr gäbe und die Gammler durch die Arbeitsdienstpflicht von der Straße weg seien. Es war vergeblich, daß Albrecht auf die Zwänge der Partei hinwies.
[26] Ja, meinte Mutter Duchen,3 wenn er Parteimitglied würde, dann hätte auch er eine bessere und höher bezahlte Position zu erwarten. Albrecht winkte mit einem Lächeln ab. Diese Geste war so bezeichnend für ihn, den Unbelehrbaren.
1937
Das Jahr 1937 verging ohne besondere Vorkommnisse. Albrecht übte im Sommer sechs Wochen weiter in Döberitz bei der Infanterie. Inzwischen war er Unteroffizier. (…) Die Hagens waren beide Lebenskünstler, Sportfreunde und grundsätzlich zufriedene Menschen. Sie gingen bewußt Problemen aus dem Weg. Es fiel nie ein böses Wort, und wenn Erica mal nervös reagierte und gerne mal gezankt hätte, lachte Albrecht sie aus. Nur die Frage, was werden solle, wenn der Naziterror sich weiter zuspitzen würde, erregte im Hause Hagen heftige Diskussionen.
1938
Im Februar hatten die Hagens sich zur Skifahrt nach Hirschegg im Kleinen Walsertal aufgemacht. Sie trafen dort Albrechts Bruder Fritz-Gustav und seine Frau Ada, Adas Bruder Koko Blittersdorff mit Frau Marion und Etti Natzmer. Albrecht stand zum erstenmal auf Skiern. Dank seiner Energie konnte er sehr bald mithalten und hatte großen Spaß an der Sache. In diesen Wochen geisterte der Nationalsozialismus durch ganz Österreich. Das Kleine Walsertal gehörte zu Österreich.
Eines Abends sahen sie über die Höhen lange, geisterhafte Fackelzüge ziehen: Großdeutschland war am Erwachen und zog in noch unbekannte Qualen in der nahen Zukunft. Viele im Gasthaus brachen in Jubel aus. Viele aber erbleichten angesichts dieser Fackelzüge. Albrecht und Erica hielten sich an der Hand und verstummten. Sie konnten nur mühsam die Tränen zurückhalten, trugen sie doch das tiefe Wissen in sich, daß durch dieses Regime der Gewalt über den Einzelnen ein Land nicht zu regieren sei. „Wohin geht ihr“, sagte Albrecht vor sich hin, „mein Gott, wohin?“.
In Österreich gab es damals wirtschaftliche Not und Arbeitslosigkeit. Nun stürzten sich die Leute den Nazis entgegen, allen großen Versprechungen glaubend und den Sand in den Augen ebenso wenig gewahrend, wie es den Deutschen ergangen war.
Was blieb den Menschen am Rande übrig? Stillhalten und durchhalten in dem Hoffen auf bessere Einsichten. Entgegen allen internationalen Zusagen marschierten die deutschen Armeen im Herbst 1938 in die Tschechei ein, Deutschland stand am Rande des 2. Weltkriegs durch das Glücksspiel, das Adolf Hitler veranstaltete: Glücksspiel mit dem ganzen Volk!
[27] Es gab damals ein bitteres Erwachen. Aber man paßte auf. Viele Zweifler am „Tausendjährigen Reich“ verschwanden in Konzentrationslagern. Das Programm der Judenverfolgung wurde durchgeführt über Hunderttausende von Leben hinweg. Die „Kristallnacht von Berlin“ schockte das ganze Volk. In der „Kristallnacht“ wurden alle Schaufenster von jüdischen Läden zerschmissen und geplündert.
Tiefe Scham erfaßte jeden denkenden Menschen. Wer irgendwie konnte, emigrierte. Jedoch keine Warnungen verfingen. Im Gegenteil, die Zeitungen waren voller Schmähungen: Die feigen, vollgefressenen Engländer würden es nicht wagen, sich zu wehren, und die degenerierten Franzosen seien erst recht unfähig, ihr Land zu verteidigen. Die Maginotlinie sei eine lächerliche Schöpfung der törichten Generäle Frankreichs und so fort. Deutschland sei so gut gerüstet, daß es reif sei, die Herrschaft in ganz Europa anzutreten, noch bevor der „Duce“ in Italien bereit sei, dieses Vorhaben zu sanktionieren. So und ähnlich hörte, las und sah man die Propaganda von Goebbels auf die Bevölkerung einhämmern. Die Stiefel der SS dröhnten durch die Straßen von Berlin und allen Orten Deutschlands. Der Blockwart der Gestapo im 2. Stock sagte eines Tages zu Erica, er freue sich, ihr mitteilen zu können, daß eine Überprüfung ihres Mannes gut ausgegangen sei. Beim „Bierchen“ in der Eckkneipe hätte er mal angeklopft, ob der Herr von Hagen auch richtig denke. Nur schade, daß er noch nicht Parteigenosse sei. Er, als Blockwart, könne doch gutsagen für ihn. Sie mußten zukünftig die Fenster schließen und das Telefon zudecken, wenn jemand zu Besuch kam.
Im Winter 1938/39
Albrecht und Erica genossen sehr bewußt Berlin mit den Abwechslungen, die sie haben konnten. Sie sahen öfter die heute noch berühmten Künstler Gustav Gründgens, Marianne Hoppe, Käthe Gold, Mathias Wiemann, Willi Birgel und so weiter … Es waren so viele.
Sie erlebten den Anfang von Karajan als 2. Mann neben Furtwängler in der alten Philharmonie. Ganz Berlin strömte zu allen nur möglichen Veranstaltungen geistiger Genüsse. Sie überfluteten die politischen Kabaretts, besonders das „Kabarett der Komiker“, wo Werner Fink seinen Humor und Spott an der Politik ausließ zum Jubel aller Zuschauer. Er vermeinte, Narrenfreiheit zu genießen. Aber Goebbels ließ ihn doch einsperren, eben wegen des Publikumsjubels, der zuviel von der unterdrückten Meinung blicken ließ, die eben ganz anders war.
„Das Niveau sinkt immer tiefer, und immer tiefer sinkt das Niveau!“ Dieses Lied zeigte so recht auf, wie niemand sich getraute, seine Empörung auszusprechen über die menschenunwürdige Behandlung der Juden. Die mit dem Stern an der Brust dekorierten Menschen schlichen angstvoll wie scheue Tiere durch die Straßen. Nur die allernötigsten Gänge taten sie öffentlich. Albrecht und Erica litten bis tief ins Herz beim Anblick der gepeinigten Menschen. „Für Juden verboten“ stand an Parkbänken und wer weiß wo überall, an Geschäften, Restaurants und Cafés: [28] „Juden unerwünscht“. Und dauernd beherrschten das Straßenbild die Uniformen von SA und SS. Wieviel Gestapo-Leute in Zivil rumliefen, ahnte man nie.
Im Grunde war jeder froh, wieder ungeschoren zu Hause angelangt zu sein. Die Furcht ums nackte Leben herrschte überall in den Straßen, in den Familien, kurz überall, wo Menschen beisammen waren.
Albrecht und Erica fuhren, sooft es ging, raus nach Alt-Gaul zu Rüdiger.4 Aber auch dort sprach man über Politik. Natürlich, denn es knisterte vor Spannung, ob ein Krieg vermieden werden könnte oder nicht. Alle zitterten davor, daß diese Art des politischen Glücksspiels, das von Hitler betrieben wurde, auf die Dauer friedlich ausgehen würde. Arbeitslosigkeit gab es nicht, weil alle Waffenfabriken auf Hochtouren liefen. Würde es Krieg geben? Mein Gott, wie sehr zitterte Deutschland innerlich vor Angst. Das konnte man kaum ermessen.
In der Industriebank arbeitete Albrecht nach wie vor unangefochten, aber auch weiterhin als „Nicht-Parteigenosse“. Ohne Abzeichen wurde er auch nicht befördert. So kam die Weihnachtszeit 1938/39 heran. Sie fuhren mit den lustigen Kindern wieder nach Langen per Auto. Die Kinder waren in Langen nun schon wie zu Hause.
Sommer 1939
Es war in den letzten Augusttagen, und es lag eine Gewitterschwüle über dem Land in der Oderniederung. Die Menschen reagierten gespannt und ebenfalls reizbar bis zum Bersten. Am Samstag gab es laute, heftige Streitgespräche zwsichen den Brüdern, obwohl sie beim Wein so friedlich am großen, runden Tisch in der Halle saßen. Dauernd lief das Radio mit Meldungen. Und dann, war’s noch am Samstag oder am Sonntag? Die Kriegserklärung gegen Polen! Mobilmachung! Ein aufgeregter Ansager verkündete, daß die deutsche Wehrmacht bereits seit Stunden tief in Polen einmarschiert sei und der Feldzug nur eine Sache von mehreren Tagen sein werde. Von all den Toten und den wirklichen Gewalt- und Greueltaten sagte niemand etwas, wagte niemand etwas zu sagen. Bei dieser Nachricht gingen Albrecht und Erica still hinaus auf die Terrasse. Sie hielten sich an den Händen und weinten beide. Albrechts Worte waren: „Nun ist es geschehen, nun gibt es keine Hoffnung mehr!“ Das sagte dieser Mann, der immer optimistisch war, immer ausgeglichen und zufrieden.
Sie packten die Koffer und fuhren zurück nach Berlin. Am nächsten Tag kam für Albrecht der Gestellungsbefehl zur 10. Panzerdivision als Leutnant der Reserve. Er wurde in den Stab übernommen als Ordonnanzoffizier im Versorgungsstab. Die Division lag in der Nähe von Berlin, in Wünsdorf. Zunächst blieben Mutter und Kinder in Berlin. Jedoch setzte sofort die Zwangswirtschaft ein: Rationalisierung aller Lebensmittel und sonstiger Verbrauchsgüter. Erica traf das hart, denn sie hatte nie Sinn und Meinung für Vorratswirtschaft gezeigt. Das Geld war für jeden Monat [29] eingeteilt. Da blieb nichts übrig fürs Hamstern. Diese wahre Krankheit brach sofort aus, vom Strumpf bis zur Butter. Die Leute eilten wie aufgescheuchte Bienen umher. Jeder brauchte plötzlich alles so nötig. Diejenigen, die sowieso alles hatten, wollten mehr und mehr, solche, die wirklich was brauchten, bekamen nichts mehr, nur noch auf Zuteilung, und die war von Anbeginn an knapp.
Da Albrechts Einheit unweit von Berlin lag, konnte er zunächst öfter nach Hause fahren. Die Trennung war für Erica wie ein Schock. Sie ging ruhig ihrem Tagewerk nach, aber es war leer im Haus trotz Kinderjubel. Sie fühlte, daß ihr Leben in eine neue, unabänderliche Phase eingetreten war. Noch lastete die Verantwortung für das kommende Dasein nicht auf ihr, aber jeder begab sich zu jener Zeit von der Geborgenheit der Gegenwart in die Unsicherheit der Zukunft. Immer schon lastete auf ihr die Sorge, daß sie schlecht gerüstet war in der Idee, daß man für den Unterhalt selbst sorgen müßte. Aber Albrecht beruhigte sie, daß diese Gedanken überflüssig wären. Nun stand die Zukunft dunkel vor ihr. Zwar überschlugen sich die Siegesmeldungen. Doch gerade, als Albrecht zu Hause war, kam die Nachricht aus dem Radio, daß England den Krieg erklärt hatte. Albrechts Reaktion: „Das ist der Anfang vom Ende Deutschlands! Das schafft die Wehrmacht niemals, und es ist auch nicht zu wünschen, denn stell’ Dir mal vor, die Nazis würden ganz Europa beherrschen.“ Weiter sagte er, indem er, ganz gegen seine Gewohnheit, aufgeregt hinund herlief: „Ich bin gegen den Krieg. Ich werde mich bemühen, niemanden zu töten! Du weißt, daß ich ein toter Mann bin, wenn ich den Kriegsdienst verweigere. Damit ist niemandem geholfen. In dieser Situation gehe ich als Sportsmann in den Krieg. Nur so, indem ich alles um mich her als Sport ansehe, kann ich es bewältigen. Und sollte ich fallen, dann schreibe in den Nachruf nur: Gefallen für das Vaterland, hörst Du, nur für das Vaterland.“
Sie umschlangen einander und hielten sich lange fest. Sie weinten miteinander. Es war wie ein Abschied. Dann hielten sie Rat und beschlossen, auf Albrechts Zureden, Berlin zu verlassen. Albrecht rechnete felsenfest mit der Zerstörung der deutschen Städte durch Luftangriffe. Diese Meinung teilten nur ganz wenige Menschen.
Zunächst fragte Albrecht seinen Bruder Rüdiger, ob er Erica und die Kinder aufnehmen wolle. Man versuchte es miteinander, aber es ging nicht so recht. Auch sah Rüdiger die Notwendigkeit nicht ein. Zunächst passierte ja auch nichts, denn es gab weiterhin nur Jubel und Siegesmeldungen. Mit Rußland bestand ein Nichtangriffspakt. Man wiegte sich allgemein in Sicherheit. Von den grauenhaften Kämpfen in Warschau wurde man natürlich durch die Presse falsch informiert. Im Westen wartete man auf eine Auseinandersetzung. Warum sollten Familien Berlin verlassen?
Inzwischen hatten sich die Langener5 überlegt, daß es für Erica und die Kinder besser sei, nicht in Berlin zu leben, solange die Zeiten derartig unübersichtlich [30] seien. Sie überlegten mit Albrecht, ob seine Familie nicht in Langen am besten geborgen sei. Außerdem könnte Erica eine gute Mithilfe darstellen und sich ausgefüllt fühlen. Für Erica war es ein sehr schwerer Entschluß, denn sie gab ihre Selbstbestimmung auf durch diese Übersiedlung auf unabsehbare Zeit. Aber es war ja nicht das erste Mal, daß sie längere Zeit in Langen zugebracht hatte, und es war immer gutgegangen. Die Idee, wieder auf dem Lande zu leben und den Kindern dies freie Landleben in der Kinderzeit geben zu können, fand sie gut. Diese Erwägung erleichterte ihr den Entschluß.
So packten sie weitsichtig alle wichtigen Dinge, um sie in Langen sicher zu haben. Sie verstauten, was ging, im Keller des Hauses in Grunewald, immerhin Kisten und Kasten. Man lächelte eigentlich über die Vorsicht. Aber man war nicht allein mit dieser Vorsicht. Erica arbeitete, schleppte und raffte, was alles ganz gegen ihre Natur war. Sie litt.
Albrecht kam öfter von Wünsdorf nach Hause in diesem sonnigen September und Oktober 1939. Ganz bewußt genossen sie diese Stunden. Sie spielten nicht mehr Tennis in ihrem kleinen Club am Hohenzollerndamm, sondern auf den beiden Plätzen auf dem Hubertussportplatz an der Hubertusallee. Zunächst lag seine Einheit immer noch im nahen Wünsdorf, so daß er die Möglichkeit hatte, nach Hause zu fahren.
Weihnachten 1939
Albrecht konnte sich nach Langen beurlauben lassen. Wie im Traum begingen sie alle die Festtage in einer inneren Anspannung ohnegleichen. Jeder war bereit, so froh und glücklich zu sein wie möglich: Bereitschaft für alle. In Bereitschaft lag das deutsche Heer dem französischen gegenüber: der Westwall der Maginotlinie.
Weihnachten 1939, das letzte Weihnachten mit Albrecht. Mehr als früher befaßte er sich mit seinen Kindern. Besonders bemerkte er Helmtruds Entfaltung in ihrem fünften Lebensjahr zu einem bildhübschen Kind mit strahlenden Augen. Man konnte richtig reden mit ihr, denn sie war kein Schreihals mehr.
Wie immer seit Helmuths6 Tod gingen Albrecht und Erica mit den Kindern zum Grab bei der Kapelle. Schnee lag über der stillen Stätte. Schnee deckt so vieles zu, was leben möchte. In Albrechts Herz brannte tiefste Hoffnungslosigkeit. Man diskutierte nicht mehr mit ihm über Politik. Man war dankbar für jede Minute des Beisammenseins.
Die Haltung der Großeltern war bewundernswert. Sie fühlten sich in der Pflicht des Durchhaltens, komme, was da wolle. Sie verschlossen sich ganz und absichtlich allen durchsickernden Nachrichten über Greueltaten der Nazis in Polen und in den KZ-Lagern. Kam Erica aus Berlin zurück und erzählte von Geschehnissen und was sie gesehen hatte in den Straßen, so wurde sie hart zurechtgewiesen zu schweigen. [31] Sie konnten nicht bestehen, wenn sie zugehört hätten. Sie gingen zur Tagesordnung über. Die verlief gradlinig wie ein Uhrwerk. Mangel litten die Menschen auf dem Lande nicht. Geflügelhaltung und Wild waren frei von der Bewirtschaftung, desgleichen Gemüse und Obst. Solange kein Mangel herrscht, bleibt das Volk ruhig.
1940
Nach der Rückkehr vom Langener Weihnachtsfest beschlossen Albrecht und Erica, einen Teil der Wohnung zu vermieten. Zögernd gab Frau Wiener ihre Einwilligung, aber sie sah dann ein, daß die Rückkehr der Familie in unabsehbare Ferne gerückt war.
Münchhausen, ebenfalls Angestellter der Industriebank, übernahm das große Wohnzimmer und die hinteren beiden Zimmer. Nach einer ungemütlichen Kramerei hatte Erica die verbleibenden drei Zimmer wohnlich gemacht, so gut es ging. Noch mehr Sachen wurden im Keller verstaut und noch mehr nach Langen gebracht. (…) Eine Bombe genügte, um das Haus zu zerstören und ihrer Hände Arbeit. Aber das passierte erst im Februar 1944.
1940 war es in Berlin immer noch ruhig. Goebbels schwor, niemals würde ein fremdes Flugzeug sich vorwagen können, eine deutsche Stadt anzugreifen. Die Wehrmacht stand Gewehr bei Fuß. Dann, im März zur Schneeschmelze, wurde es im Westen lebendig. Vati Albrecht kam nicht mehr nach Hause. Die 10. Panzerdivision begann ihren sagenhaften Siegeszug durch Belgien bis zur Küste in Frankreich: Dieppe. Albrecht schickte Briefe und Berichte. Er war und blieb gesund.
Die Vorgänge in Dieppe zu schildern, gehört nicht hierher. Die sind Weltgeschichte geworden, Kriegsgeschichte. Der Siegeszug der 10. Panzerdivision führte über Paris bis nach Lyon. Jedenfalls zeigt es die bunte Postkarte auf, die durch alle Geschehnisse gerettet werden konnte. Vati Albrecht berichtete von einem „sehr fröhlichen“ Feldzug ohne große Verluste. Auf seine Art des „kleinen Lords“ und Lebenskünstlers bewältigte er die Schwierigkeiten. Ein Mann erzählte später: „Bei einem Sturmgefecht gegen Morgen um 8 Uhr saß der Herr Leutnant hinter seinem Kübelwagen beim Frühstück, den heißen Kaffee auf einem Spirituskocher und ließ sich nicht stören.“ Erica erinnerte sich an seine Worte, diesen Krieg als „Sportsmann“ mitmachen und niemanden töten zu wollen. – Nach Beendigung dieses Feldzugs wurde die 10. Panzerdivision nach Schlesien in Ruhestellung verlegt. Das war im Juni 1940.
Sie (Erica v. Hagen, d. Hrsg.) konnte sogar eine Woche nach Schlesien reisen, nach Sagan. Dort lag die 10. Panzerdivision in Bereitschaft. Guderian bereitete die Armee auf den Ostfeldzug vor. Zwar galt noch der Nichtangriffspakt mit Rußland. Aber General Guderian instruierte seine Panzerdivision: „Ihr werdet Tausende von Kilometern in kurzer Frist bewältigen müssen!“ Niemand sprach vom Krieg gegen Rußland. Jedoch diese Instruktion konnte nur so gemeint sein.
[32] Erica und Albrecht trafen sich in einem Hotel in Sagan. Sie erlebten die Stunden bewusst als Geschenk in jener Zeit, in der die Ungewissheit über jedem Menschen hing. Erica erfuhr von den Vorbereitungen, in Rußland einzumarschieren. Man fragte sich, ob das gut gehen könne.
Nach außen wurde verlautbar, daß die Wehrmacht im Osten zur Abwehr dort zusammengezogen läge, aber in Wirklichkeit lag sie startbereit an der gesamten Ostgrenze. Es ist lange bewiesen, daß Rußland überhaupt nicht zum Überfall auf Deutschland gerüstet war, also dringend des Nichtangriffspaktes bedurfte. So schwelten die Gerüchte im Volk, aber nur im Flüsterton sprach man darüber. Bis zum Sommer 1941 lag die 10. PZ-Division in Schlesien. Albrecht kam ganz selten nach Berlin. Zu solchen Treffs in der Paulsborner Straße rüstete Omama ihre Schwiegertochter mit guten Sachen aus vom Land: Hühnchen, Tauben mit etwas Speck, Eier und Wurst aller Sorten. Erica hatte inzwischen in Langen ihren ersten Wohnsitz, das heißt, daß sie in Berlin keinen Anspruch auf Lebensmittel hatte. So schleppte sie unverdrossen nach Berlin, was sie schleppen konnte. Gute Weine und Cognac hatte Albrecht vom glorreichen Feldzug in Frankreich organisiert. So also gestalteten sich die Wochenenden in Berlin feucht und fröhlich. Die Münchhausens feierten mit und alte Freunde und Kollegen von der Industriebank.
1941
Zu Ostern erschien Albrecht in seinem Wehrmachtsauto in Langen. Die Kinder schwärmten um ihn herum, voller Ehrfurcht, denn Vatilein trug Uniform. Er war zum Oberleutnant befördert worden. Dies freute ihn, denn die Partei-Organe konnten ihn als Offizier der Wehrmacht nun nicht mehr drängen, Parteimitglied zu werden. Die ganze Familie mühte sich, für ihn das Beste zu geben. Omama sorgte für herrliche Mahlzeiten, und Opapa holte seinen besten Wein aus dem Keller. Die Kinder zankten nicht miteinander, und Erica wurde von allen Ämtern in Ställen, Haus und Garten freigestellt, damit sie Zeit hatte für ihren Mann.
Danach kam Albrecht nicht mehr nach Langen bis 1942, als die bittere Nachricht eintraf, daß Gerd7 in Rußland vermißt sei. Es bestand kein Zweifel, daß Albrecht seiner Mutter am nächsten von allen Söhnen stand. Wie tröstlich für sie, daß er bei ihr war, als die Nachricht sie so hart traf. Albrecht wußte, was es hieß: „… vermißt in Rußland.“
1941 war der Sturm auf Rußland losgebrochen. In vier Monaten wollte Hitler diesen Kampf gegen Rußland siegreich durchführen, so hämmerten die Sondermeldungen aus den Radios. Die 10. Panzerdivision rollte siegreich bis vor die Tore Moskaus. Albrecht, als Ordonnanzoffizier im Stab für den Nachschub, erlebte und berichtete, daß bereits ein riesen Sprengstofflager etwa an der Moskauer Ringbahn lagerte, um von dort den letzten Vorstoß zu starten. Den gesamten Nachschub an [33] Munition und Verpflegung überhaupt bis dorthin organisiert zu haben, war eine tolle Leistung bei den herbstlich regnerischen Wochen im Oktober. Die Unregbarkeit Rußlands war bekanntermaßen furchtbar. Albrecht erhielt nachträglich das Verdienstkreuz für Tapferkeit vor dem Feind. Er erzählte später, daß er, wie durch ein Wunder, nie getroffen wurde bei seinen Fußmärschen ganz allein entlang eines Schienenstrangs von einem Versorgungslager zum anderen.
Die Russen zogen sich zurück, immer tiefer nach Sibirien hin zogen sie sich zurück. Sie hatten treue Verbündete; die Weite, den Winter und die Amerikaner. Und dann kam der Winter im November. Es war nicht zu begreifen, daß das Heer im Osten ohne Winterausrüstung gelassen wurde. Im Führerhauptquartier hieß es, das sei nicht mehr nötig, denn der Sieg, die Einnahme von Moskau, stünde kurz bevor.





























