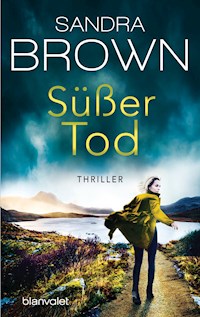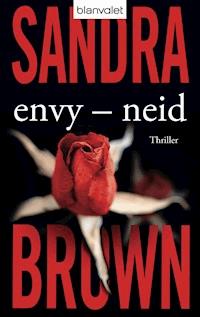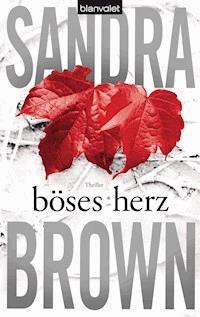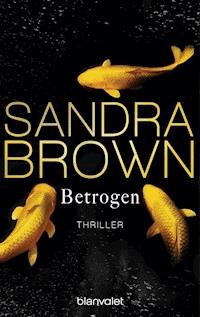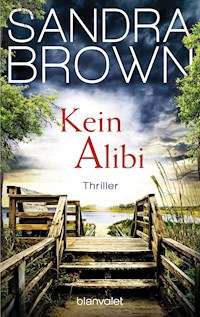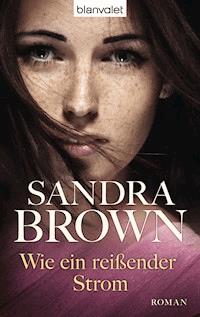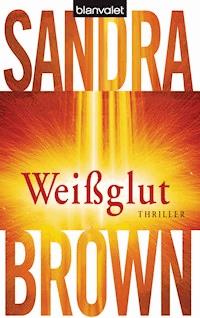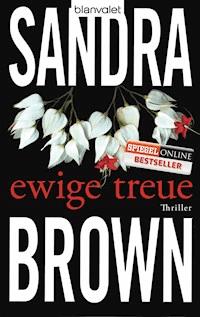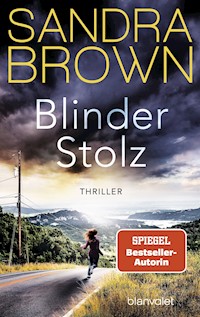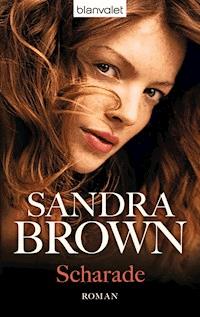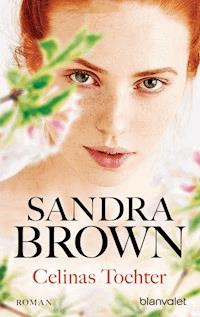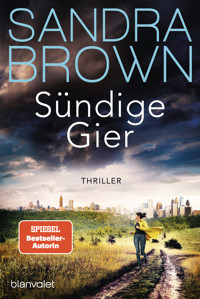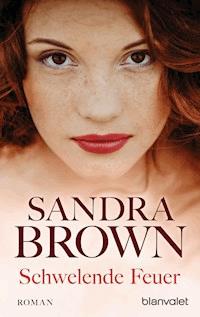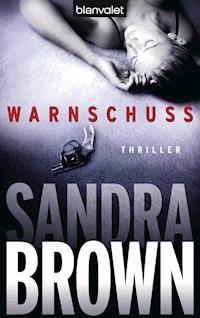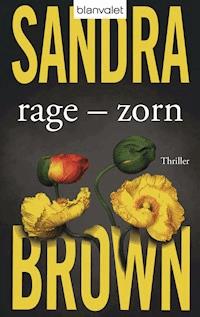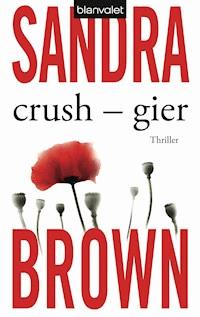
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Atemlose Spannung, raffinierte Abgründe und knisternde Sinnlichkeit!
Ausgerechnet die angesehene Ärztin Rennie Newton ist als Geschworene für den Freispruch des Profikillers Lozada verantwortlich. Jetzt aber steht sie selbst unter Mordverdacht. Hat Rennie tatsächlichen einen Mord in Auftrag gegeben – oder tötet Lozada aus eigenem Antrieb für die Frau, die er vergöttert? Nur ein Mensch vertraut Rennie noch: der vom Dienst suspendierte Polizist Wick Threadgrill. Wick ahnt jedoch nicht, wie viele Geheimnisse Rennie tatsächlich zu verbergen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Dr. Lee Howells Telefon läutete um 2 Uhr 07.
Seine Frau Myrna, die neben ihm im Bett lag, grummelte in ihr Kissen: »Wer ruft denn um diese Uhrzeit an? Du hast heute Nacht keine Bereitschaft.«
Die Howells waren noch keine Stunde im Bett. Ihre Gartenparty am Pool war gegen Mitternacht zu Ende gegangen. Bis sie die leeren Teller und Margaritagläser weggeräumt, alle verderblichen Reste im Kühlschrank verstaut und ihrem im Kinderzimmer schlafenden Sohn einen Gutenachtkuss auf die Wange gehaucht hatten, war es kurz vor eins geworden.
Während sie sich bettfertig machten, hatten sie sich gegenseitig zu der gelungenen Feier gratuliert. Die gegrillten Steaks waren kaum zäh gewesen, und der neue elektrische Insektenvernichter hatte den ganzen Abend über gebritzelt und die Mückenpopulation auf ein Minimum reduziert. Alles in allem eine nette Party.
Obwohl sich die Howells ziemlich beschwingt fühlten, waren sie sich einig, dass sie viel zu erschöpft waren, um an Sex auch nur zu denken, und hatten sich nach einem letzten Kuss den Rücken zugekehrt, um gleich darauf einzuschlafen.
Auch wenn Dr. Howell gerade erst eingenickt war, war sein Schlummer, dank mehrerer Margaritas, tief und traumlos gewesen. Dennoch war er jetzt, nach jahrelanger Übung, sofort hellwach, aufnahmebereit und klar im Kopf, als das Telefon klingelte. Er griff nach dem Hörer. »Tut mir Leid, Schätzchen. Vielleicht ist was mit einem meiner Patienten.«
Sie nickte in mürrischer Resignation in ihr Kissen. Ihr Mann verdankte seinen Ruf als exzellenter Chirurg nicht nur seinen Fähigkeiten im Operationssaal. Er widmete sich seinen Patienten ganz und gar und nahm vor, während und nach der Operation Anteil an ihrem Wohlergehen.
Auch wenn es nicht oft vorkam, dass er außerhalb des Bereitschaftsdienstes mitten in der Nacht zu Hause angerufen wurde, so war es doch kein Einzelfall. Diese und einige andere Unannehmlichkeiten waren der geringe Preis, den Mrs. Howell bereitwillig für das Privileg zahlte, mit dem Mann ihrer Träume verheiratet zu sein, der nebenbei eine hoch geschätzte Kapazität auf seinem Gebiet war.
»Hallo?«
Er hörte ein paar Sekunden schweigend zu, dann schlug er die Decke zurück und setzte sich auf. »Wie viele?« Dann: »O Gott. Okay. Natürlich, ich bin schon unterwegs.« Er legte auf und erhob sich.
»Was ist denn?«
»Ich muss los.« Ohne das Licht einzuschalten, tastete er sich zu dem Stuhl vor, über dem die Dockers hingen, die er heute Abend getragen hatte. »Das ganze Team wurde ins Krankenhaus gerufen.«
Mrs. Howell stützte sich auf einen Ellbogen. »Was ist denn los?«
Das Tarrant General Hospital war ein zentral gelegenes Großstadtkrankenhaus und daher ständig in Alarmbereitschaft für mögliche Katastropheneinsätze. Die Belegschaft war darauf trainiert, im Notfall die Opfer eines Flugzeugabsturzes, Hurrikans oder terroristischen Anschlags zu versorgen. Im Vergleich dazu war der Einsatz heute Nacht eher profan.
»Eine Massenkarambolage auf dem Freeway. Mit mehreren Fahrzeugen.« Howell schob die nackten Füße in ein Paar Dock-Sides, die er innig liebte und seine Gemahlin ebenso innig verabscheute. Er hatte diese Schuhe schon besessen, als sie ihn kennen lernte, und er weigerte sich standhaft, sie wegzuwerfen, weil sich das Leder angeblich erst jetzt richtig an seine Füße zu schmiegen begann und die Schuhe optimal eingelaufen waren.
»Das totale Chaos. Ein Tanklastzug ist umgekippt und hat Feuer gefangen«, erläuterte er, während sein Kopf in seinem Golfhemd verschwand. »Dutzende Opfer, und die meisten sind schon auf dem Weg in unsere Notaufnahme.«
Er streifte die Armbanduhr über, klemmte seinen Piepser an den Hosenbund und beugte sich anschließend über das Bett, um ihr einen Kuss zu geben. Er verpasste ihren Mund nur knapp und landete mit seinen Lippen zwischen Nase und Kinn. »Wenn ich nicht bis zum Frühstück zurück bin, rufe ich dich an und erzähl dir, was es Neues gibt. Schlaf ruhig weiter.«
Sie murmelte, schon wieder halb in ihr Kissen zurückgesunken: »Pass auf dich auf.«
»Tu ich doch immer.«
Noch ehe er unten an der Treppe angekommen war, war sie wieder eingeschlafen.
Malcomb Lutey war gerade am Ende des dritten Kapitels in seinem neuesten Sience-Fiction-Thriller angekommen. Das Buch handelte von einem in der Atmosphäre schwebenden Virus, der nur Stunden nach dem Einatmen menschliche Organe zu einer schwarzen, öligen Pampe zersetzte.
Während er sich in die Passage über die ahnungslose, zum Tode verurteilte Pariser Hure vertiefte, zupfte er an dem Ungetüm auf seiner Wange herum, allen mütterlichen Ermahnungen, den Pickel in Frieden zu lassen, zum Trotz. »Davon wird er nur noch größer, Malcomb. Solange du nicht daran rumspielst, fällt er gar nicht weiter auf.«
Na sicher. »Auffallen« war gar kein Ausdruck. Der Eiterhöcker war der neueste Gipfel in der nie zur Ruhe kommenden, knubbelig-roten Kraterlandschaft, die sein Gesicht überzog. Die schwere, narbige Akne hatte Malcomb in der Pubertät befallen und trotzte seit nunmehr fünfzehn Jahren sämtlichen Behandlungsversuchen, egal ob äußerlich oder innerlich, mit verschreibungspflichtigen Medikamenten oder Hausmitteln.
Seine Mutter führte seine schlechte Haut auf mangelhafte Ernährung, mangelnde Sauberkeit und mangelnden Schlaf zurück. Mehr als einmal hatte sie angedeutet, dass auch Onanie Akne erregen könnte. Aber ganz egal, welche Hypothese sie gerade vertrat, das Fazit lautete unweigerlich, dass Malcomb irgendwie selbst schuld daran war.
Der frustrierte Dermatologe, der ihn heroisch, aber erfolglos behandelte, hatte andere, doch mindestens ebenso zahlreiche Theorien entwickelt, warum Malcomb mit der Gesichtstopografie einer Gruselmaske geschlagen war. Allgemeines Fazit: Es war unerklärlich.
Als würde die Akne nicht ausreichen, um sein Selbstwertgefühl auf Gullyhöhe zu drücken, war Malcombs Körperbau ebenso unvorteilhaft. Er war dünn wie ein Bleistift. Jedes Supermodel, das dafür bezahlt wurde, unterernährt auszusehen, musste ihn um seinen Stoffwechsel beneiden, den eine tiefe Abneigung gegen alle Kalorien auszuzeichnen schien.
All das wurde von einer weiteren genetischen Heimsuchung gekrönt – seinem struppigen, karottenroten Haar. Der feurige Busch auf seinem Haupt hatte die Dichte und Beschaffenheit von Stahlwolle und war der Grund dafür, dass seine Kindheit schon vor dem Einsetzen der Akne ein einziger Albtraum gewesen war.
Malcolmbs eigenwillige Erscheinung und seine daraus resultierende Schüchternheit hatten ihn sich stets als Außenseiter fühlen lassen.
Außer bei der Arbeit. Er arbeitete nachts. Und allein. Dunkelheit und Einsamkeit waren seine beiden besten Freunde. Die Dunkelheit tönte seine grellen Farben auf ein erträgliches Maß ab und half, die Akne zu verbergen. Die Einsamkeit war ein wesentliches Merkmal eines Jobs als Nachtwächter.
Natürlich war seine Mutter ganz und gar nicht begeistert über seine Berufswahl. Ständig nörgelte sie an ihm herum, drängte ihn, sich einen neuen Job zu suchen. »Jede Nacht ganz allein da draußen«, sagte sie oft, um dann unter leisem Ts-ts den Kopf zu schütteln. »Wie willst du denn jemals ein Mädchen kennen lernen, wenn du immer allein bist?«
O Mann, Mutter. Genau das ist der Witz dabei. So lautete Malcolmbs Standard-Antwort – die er allerdings nie laut auszusprechen wagte.
Die Arbeit in der Nachtschicht bedeutete, dass er nur selten ein Gespräch führen musste, bei dem sich sein Gegenüber alle Mühe gab, ihn nicht anzustarren. Und die Nachtarbeit erlaubte es ihm, den größten Teil des Tageslichtes zu verschlafen, das seinen Schopf zum Leuchten brachte wie einen fluoreszierenden Textmarker. Er fürchtete die zwei Nächte in der Woche, an denen er frei hatte, und die Tiraden seiner Mutter, dass er selbst sein schlimmster Feind sei, über sich ergehen lassen musste. Wobei das wiederkehrende Leitmotiv ihrer Predigten lautete, dass er viel mehr Freunde haben könnte, wenn er nur etwas offener gegenüber anderen Menschen wäre.
»Du hast so viel zu geben, Malcomb. Warum gehst du nie aus wie die anderen jungen Leute? Wenn du ein bisschen freundlicher wärst, könntest du vielleicht sogar eine nette junge Dame kennen lernen.«
Na sicher.
Mutter schimpfte ihn immer, weil er Sciencefiction las, aber wenn einer in einer Traumwelt lebte, dann doch wohl sie.
Im General Hospital hatte er den Posten am Ärzteparkplatz inne. Die anderen Nachtwächter drückten sich so gut wie möglich um den Dienst dort draußen, aber Malcomb war das nur recht. Nachts war kaum was los. Erst in den frühen Morgenstunden, wenn allmählich die Ärzte eintrudelten, kam sozusagen ein bisschen Leben in die Bude. Aber die meisten Ärzte waren noch gar nicht da, wenn er sich um sieben Uhr morgens ausstempelte.
Da heute aber Freitagabend war, standen mehr Autos auf dem Parkplatz als unter der Woche. Am Wochenende herrschte immer Hochbetrieb in der Notaufnahme, und ständig kamen und fuhren neue Ärzte. Erst vor ein paar Minuten war Dr. Howell vorgefahren und hatte mit der Fernbedienung, die er an seiner Sonnenblende festgeklemmt hatte, die Schranke hochgefahren.
Dr. Howell war okay. Er schaute nie durch Malcomb hindurch, als würde er gar nicht existieren, und manchmal winkte er sogar, wenn er am Wachhäuschen vorbeifuhr. Howell machte auch keinen Aufstand, wenn die Schranke mal nicht funktionierte und Malcomb sie von Hand hochkurbeln musste. Dr. Howell schien ganz in Ordnung zu sein, überhaupt nicht hochnäsig. Nicht wie ein paar von diesen aufgeblasenen reichen Arschlöchern, die mit den Fingern auf die gepolsterten Lenkräder trommelten, wenn sie mal auf die Schranke warten mussten, und dann mit Volldampf an ihm vorbeirasten, als müssten sie ganz dringend irgendwohin und etwas entsetzlich Wichtiges erledigen.
Malcomb las die erste Seite des vierten Kapitels. Wie zu erwarten, schied die Pariser Nutte mitten während des Koitus aus dem Leben. Sie starb unter qualvollen Verrenkungen und grotesken Kotzattacken, aber Malcomb bedauerte vor allem ihren glücklosen Freier. Wenn das kein Schuss in den Ofen war!
Er legte das Buch mit dem Gesicht nach unten auf seinen Tisch, richtete sich auf, streckte den Rücken durch und suchte eine angenehmere Sitzposition. Dabei fiel sein Blick auf sein Spiegelbild im Fenster. Der Pickel wuchs von Sekunde zu Sekunde. Schon jetzt war er ein wahrer Eitervulkan. Angeekelt richtete Malcomb den Blick auf den Parkplatz dahinter.
An strategischen Punkten waren Quecksilberdampflampen aufgestellt, die das Gelände gleichmäßig erhellten. Nur unter den künstlich aufgeschütteten Hügeln rundum war es dunkel. Nichts hatte sich verändert, seit Malcomb das letzte Mal hinausgeschaut hatte, bis auf Dr. Howells neu hinzugekommenen silbernen BMW – dritte Reihe, zweiter Wagen. Er konnte das glänzende Dach erkennen. Dr. Howell pflegte seinen Wagen mit Liebe. Malcomb würde es genauso machen, wenn er sich so eine Kiste leisten könnte.
Er versenkte sich wieder in seinen Roman, hatte aber erst ein paar Absätze gelesen, als ihm etwas Seltsames auffiel. Wieder schaute er zu Dr. Howells BMW hinüber. Seine hellen Brauen zogen sich verunsichert zusammen. Wieso hatte er Dr. Howell nicht bemerkt, als der Doktor an seinem Häuschen vorbeigekommen war?
Um den Fußweg zu erreichen, der zum nächstgelegenen Angestellteneingang führte, musste man direkt am Wachhäuschen vorbei. Es war Malcomb in Fleisch und Blut übergegangen, jeden zu registrieren, der vorbeikam, ob er nun ins Krankenhaus wollte oder zu seinem Auto zurückging. In beiden Fällen war das Ereignis zeitlich mit einem zweiten gekoppelt. Entweder verließ jemand das Krankenhaus und fuhr gleich darauf mit dem Auto weg, oder jemand fuhr auf den Parkplatz und kam auf dem Weg zum Krankenhaus an seinem Fenster vorbei. Unterbewusst behielt Malcomb immer den Überblick.
Neugierig kennzeichnete er die Seite in seinem Buch und legte es unter die Theke neben das Lunchpaket, das ihm seine Mutter gepackt hatte. Dann zog er den Schirm seiner Uniformmütze tiefer. Wenn er schon mit jemandem reden musste, wollte er demjenigen zumindest den Anblick seines unansehnlichen Gesichtes nicht mehr als unvermeidlich zumuten, selbst wenn der Gesprächspartner so locker war wie Dr. Howell. Der Mützenschirm warf einen zusätzlichen, schützenden Schatten.
Als er aus dem klimatisierten Häuschen trat, merkte er, dass die Außentemperatur seit seinem letzten Rundgang nicht spürbar gesunken war. August in Texas. Mittagshitze im Morgengrauen. Die vom Asphalt aufsteigende Wärme strahlte durch die Gummisohlen seiner Schuhe, auf denen er praktisch lautlos erst an der ersten und dann an der zweiten Autoreihe vorbeiging. Am Ende der dritten Reihe blieb er stehen.
Zum ersten Mal, seit er diesen Job vor fünf Jahren angetreten hatte, spürte er ein nervöses Kribbeln. Bis jetzt war in seiner Schicht noch nie irgendetwas Aufregendes passiert. Vor ein paar Monaten hatte ein Kollege im Hauptgebäude einen Typen überwältigen müssen, der mit einem Fleischermesser eine Krankenschwester bedroht hatte. Letztes Silvester war ein Wachposten herbeigerufen worden, um eine Schlägerei zwischen zwei Vätern zu schlichten, die sich nicht einigen konnten, wessen Baby das erste im Neuen Jahr gewesen war und damit mehrere Preise gewonnen hatte.
Gott sei Dank war Malcomb in keinen der beiden Vorfälle verwickelt gewesen. Wie er gehört hatte, hatten sie Schaulustige angezogen. Bei so vielen Blicken hätte er garantiert vor Verlegenheit keinen Finger rühren können. Die einzige Krise, die er bislang im Dienst erlebt hatte, hatte in der Standpauke eines Gehirnchirurgen bestanden, der bei seiner Rückkehr feststellen musste, dass sein Jaguar einen Platten hatte. Aus Gründen, die Malcomb immer noch unerfindlich waren, hatte der Chirurg ihm die Schuld daran gegeben.
Abgesehen davon waren seine Schichten zum Glück völlig ereignislos verlaufen. Darum wusste er nicht, warum er jetzt so nervös war. Auf einmal kam ihm seine alte Freundin Dunkelheit nicht mehr so gütig wie sonst vor. Ängstlich sah er sich um und schaute sogar den Weg zurück, den er eben gekommen war.
Der Parkplatz lag still und schweigend da wie ein Grab – im Moment keine besonders tröstliche Analogie. Nichts regte sich, nicht einmal die Blätter an den Bäumen rundherum. Nichts erschien irgendwie ungewöhnlich.
Trotzdem bebte Malcombs Stimme leicht, als er laut »Dr. Howell?« rief.
Er wollte dem Doktor schließlich keinen Schreck einjagen. Selbst in einem hellen Raum voller Leute war sein Gesicht so abstoßend, dass es beinahe Furcht einflößend wirkte. Wenn er sich jemandem unerwartet im Dunkeln näherte, könnte der arme Kerl vor Schreck tot umkippen.
»Dr. Howell? Sind Sie hier?«
Keine Antwort. Inzwischen meinte Malcomb, gefahrlos hinter dem ersten Auto in der Reihe hervortreten und nach Dr. Howells BMW sehen zu können, nur um sicherzugehen. Er musste Dr. Howell übersehen haben, so einfach war das. Offenbar hatte er sich, als der Doktor an ihm vorbeigekommen war, etwas zu sehr auf das konzentriert, was die blonde Nutte mit ihrem Freier anstellte, bevor sie in schmerzhafte Zuckungen verfiel und schwarzen Schleim über den armen Kerl reiherte. Oder er war gerade durch die neueste vulkanische Formation auf seiner Wange abgelenkt gewesen. Oder Dr. Howell hatte ausnahmsweise nicht den geteerten Weg genommen, sondern sich durchs Gebüsch geschlagen. Er war zwar groß, aber dünn. Jedenfalls schlank genug, um sich durch die Hecke zu quetschen, ohne dass es groß auffiel.
So oder so hatte er Dr. Howell bestimmt im Dunkeln übersehen, ganz einfach.
Ehe er am ersten Wagen in der Reihe vorbei war, schaltete Malcomb, nur um sicherzugehen, die Taschenlampe ein.
Sie wurde später unter dem ersten Wagen in der Reihe gefunden, wo sie liegen geblieben war, nachdem sie ihm aus der Hand gefallen und mehrere Meter weit gerollt war. Das Glas war zersplittert, das Gehäuse verbeult. Aber die Batterien hätten dem nervtötenden rosa Plüschhäschen alle Ehre gemacht. Denn die Birne brannte immer noch.
Was im Strahl von Malcombs Taschenlampe zu sehen war, hatte ihm mehr Angst eingejagt als alles, was er je in irgendeinem Sciencefiction gelesen hatte. Es mochte vielleicht nicht so grotesk, nicht so blutig und auch nicht so bizarr sein. Aber es war Wirklichkeit.
1
»Hübsch hast du’s hier.«
»Mir gefällt’s.« Ohne auf die bissig-herablassende Bemerkung einzugehen, kippte Wick die gekochten Shrimps aus dem Topf in ein Abtropfsieb, das nie ein Küchenaccessoire-Geschäft von innen gesehen hatte. Es war aus weißem Plastik und fleckig braun. Er wusste nicht mehr, wie es in seinen Besitz gelangt war, aber vermutlich hatte es ein Vormieter in dieser Behausung hinterlassen, die sein Freund offenbar so wenig standesgemäß fand.
Nachdem das heiße Wasser abgelaufen war, platzierte er das Abtropfsieb mitten auf dem Tisch, stellte eine Rolle Küchenpapier daneben und bot seinem Gast ein neues Bier an. Er öffnete zwei Flaschen Red Stripe, setzte sich rittlings auf einen Stuhl und forderte Oren Wesley über den Tisch hinweg auf: »Hau rein!«
Oren riss gewissenhaft ein Blatt von der Küchenrolle und legte es auf seinen Schoß. Wick war bereits beim dritten Shrimp, als Oren endlich seinen ersten ausgesucht hatte. Sie schälten und schmausten schweigend und teilten sich dabei ein Glas Cocktailsoße als Dip. Oren achtete streng darauf, dass nichts von der rosafarbenen Meerrettichtunke an seinen blütenweißen Manschetten hängen blieb. Wick schlürfte und leckte sich die Finger, wohl wissend, dass er mit seinen miserablen Tischmanieren seinen peniblen Freund in den Wahnsinn trieb.
Die Schalen häuften sie auf der alten Zeitung, die Wick über den Tisch gebreitet hatte, nicht um dessen hoffnungslos verkratzte Oberfläche zu schonen, sondern um das Saubermachen zu erleichtern. Der Deckenventilator brachte die Ecken ihrer provisorischen Tischdecke zum Flattern und quirlte das würzige Aroma der Shrimp-Bouillon in die schwüle Küstenluft.
Nach längerem Schweigen bemerkte Oren: »Ziemlich gut.«
Wick zuckte mit den Achseln. »Kinderleicht zu machen.«
»Sind die Shrimps von hier?«
»Ich kaufe sie frisch vom Schiff. Der Fischer gibt mir Rabatt.«
»Anständig von ihm.«
»Von wegen. Wir haben ein Abkommen.«
»Und was musst du dafür tun?«
»Mich von seiner Schwester fern halten.«
Wick lutschte einen weiteren dicken Shrimp aus und warf die Schale auf den wachsenden Haufen. Er grinste Oren an, während sein Freund offensichtlich zu entscheiden versuchte, ob er damit die Wahrheit gesagt hatte oder nicht. Wick war berühmt dafür, andere auf den Arm zu nehmen, und nicht einmal sein bester Freund konnte immer zielsicher Dichtung und Wahrheit voneinander unterscheiden.
Wick riss ein Papier von der Rolle und wischte sich Hände und Mund damit ab. »Mehr fällt dir nicht ein, Oren? Die Shrimpspreise? Nur deshalb hast du die lange Fahrt auf dich genommen?«
Oren wich seinem Blick aus und stieß leise hinter vorgehaltener Hand auf. »Komm, ich helfe dir beim Saubermachen.«
»Vergiss es. Und nimm dein Bier mit.«
Ein schmutziger Tisch fiel nicht weiter auf in Wicks Haus – das man kaum als solches bezeichnen konnte. Eigentlich war es eine windschiefe Hütte mit drei Räumen, die aussah, als würde sie der nächsten Brise vom Golf mit Windgeschwindigkeiten über fünf Knoten zum Opfer fallen. Sie bot Schutz vor den Elementen – notdürftig. Das Dach leckte bei Regen. Die Klimaanlage war ins Fenster eingebaut und so schwachbrüstig, dass Wick sie so gut wie nie einschaltete. Die Miete für dieses Loch war wöchentlich fällig, und zwar im Voraus. Bislang hatte er dem Vermieter dieses Lochs einundsechzig Schecks ausgeschrieben.
Die Fliegentür quietschte in den rostigen Angeln, als sie hinaustraten auf die hintere Veranda, ihr ungehobelter Holzboden war gerade breit genug für zwei eiserne Gartenmöbel aus den fünfziger Jahren. Die salzhaltige Luft hatte schon mehrere Lackschichten durchfressen, zuletzt ein kränklich wirkendes Erbsmusgrün. Wick setzte sich in die Hollywoodschaukel. Oren betrachtete misstrauisch die rostige Sitzfläche des Lehnstuhls daneben.
»Er beißt nicht«, versprach Wick. »Du könntest dir Flecken auf deiner Anzughose holen, aber ich verspreche dir, die Aussicht ist die Reinigungskosten wert.«
Oren ließ sich zögerlich nieder, und ein paar Minuten später wurde Wicks Versprechen erfüllt. Im Westen überzog sich der Himmel mit einer grellen Streifenorgie in Blutrot und Knallorange. Die dunkellila Gewitterwolken am Horizont sahen aus wie eine Kette goldgerahmter Hügel.
»Das ist doch was, oder?«, fragte Wick. »Und jetzt sag du mir, wer hier verrückt ist.«
»Ich habe nie behauptet, dass du verrückt bist, Wick.«
»Nur ein bisschen durchgeknallt, weil ich alles stehen und liegen lassen hab, um mich hier niederzulassen.«
»Nicht einmal durchgeknallt. Verantwortungslos vielleicht.«
Wicks lockeres Lächeln gefror.
Oren bemerkte das und sagte: »Du kannst ruhig sauer werden. Mir egal. Irgendwer muss es dir ja mal sagen.«
»Na schön. Vielen Dank auch. Jetzt hast du’s gesagt. Wie geht’s Grace und den Mädchen?«
»Steph ist jetzt Cheerleader. Laura hat ihre Tage gekriegt.«
»Soll ich gratulieren oder mein Beileid aussprechen?«
»Wofür?«
»Beides.«
Oren lächelte. »Ich nehme beides. Grace hat gesagt, ich soll dich von ihr küssen.« Nach einem kurzen Blick auf Wicks Stoppelkinn ergänzte er: »Wenn’s dir nichts ausmacht, verzichte ich auf das Vergnügen.«
»Schon in Ordnung. Küss sie stattdessen von mir.«
»Das tue ich gern.«
Ein paar Minuten tranken sie wortlos ihr Bier und beobachteten, wie die Farben des Sonnenuntergangs intensiver wurden. Keiner brach das Schweigen, doch beide spürten es – beide spürten all das, was unausgesprochen blieb.
Schließlich räusperte sich Oren. »Wick …«
»Kein Interesse.«
»Woher willst du das wissen, wenn du mich nicht mal ausreden lässt?«
»Warum willst du einen perfekten Sonnenuntergang ruinieren? Ganz zu schweigen von dem guten jamaikanischen Bier.«
Wick sprang mit einem Satz aus der Hollywoodschaukel, die kurz unter protestierendem Quietschen zurückschaukelte und gleich darauf wieder zur Ruhe kam. Am Rand der verwitterten Veranda stehend, die gebräunten Zehen um die Holzkante gekrallt, leerte er sein Bier in einem langen Zug und warf die leere Flasche dann in ein altes Ölfass, das ihm als Mülleimer diente. Das Scheppern scheuchte ein paar Möwen auf, die in dem festen Sand nach Futter gepickt hatten. Wick beneidete sie darum, einfach wegfliegen zu können.
Er und Oren hatten eine gemeinsame Vergangenheit, die bis in die Zeit vor Wicks erstem Arbeitstag beim Fort Worth Police Department zurückreichte. Oren war einige Jahre älter, und Wick musste zugeben, dass er auch eindeutig weiser war. Er besaß ein ausgeglichenes Temperament, mit dem er mehr als einmal Wicks stürmischeres im Zaum gehalten hatte. Oren ging methodisch vor. Wick impulsiv. Oren liebte nur seine Frau und seine Kinder. Wick war eingefleischter Single und Oren zufolge in sexueller Hinsicht nicht wählerischer als ein Straßenkater.
Trotz dieser Unterschiede oder möglicherweise gerade deswegen waren Wick Threadgill und Oren Wesley exzellente Partner gewesen. Sie gehörten zu den wenigen gemischtrassigen Duos beim FWPD. Miteinander hatten sie Gefahren gemeistert, viel gelacht, einige Triumphe und diverse Enttäuschungen erlebt – und ein Tal der Tränen durchwandert, das keiner von beiden je vergessen würde.
Als Oren gestern Abend nach monatelanger Funkstille angerufen hatte, hatte sich Wick aufrichtig über seinen Anruf gefreut. Er hatte gehofft, dass Oren kommen würde, um mit ihm über alte, bessere Zeiten zu plaudern. Diese Hoffnungen zerplatzten in dem Moment, in dem Oren ankam und aus dem Auto stieg. Keine Flipflops oder Turnschuhe, sondern ein Paar blank polierte, zweifarbige Schuhe hatten tiefe Abdrücke im Sand von Galveston hinterlassen. Oren war nicht zum Angeln oder Sonnen gekommen, und auch nicht auf einen gemütlichen Plausch auf der Veranda bei einem kühlen Bier und einer Footballübertragung im Radio.
Seine Kleidung hatte auf den ersten Blick verraten, dass ein beruflicher Anlass ihn hergeführt hatte. In Anzug und Schlips, die Fleisch gewordene Bürokratie. Schon beim Händeschütteln war Wick die steinerne Miene seines Freundes aufgefallen, aus der er ebenso sicher wie enttäuscht geschlossen hatte, dass dies kein Freundschaftsbesuch war.
Und Wick wusste genauso sicher, dass er nicht hören wollte, was Oren ihm zu sagen hatte, was immer das auch sein mochte.
»Du bist nicht gefeuert worden, Wick.«
»Nein. Ich nehme ›unbefristeten Urlaub‹.«
»Du hast das selbst so entschieden.«
»Unter massivem Druck.«
»Du brauchtest Zeit, um Abstand zu gewinnen und dich zu erholen.«
»Warum haben mich diese Bürohengste nicht einfach rausgeschmissen? Um die Sache für alle Beteiligten zu vereinfachen?«
»Weil sie klüger sind als du.«
Wick drehte sich um. »Ach ja?«
»Sie und alle, die dich näher kennen, wissen, dass du für diese Art von Arbeit wie geschaffen bist.«
»Diese Art von Arbeit?« Er schnaubte. »Scheiße schippen, meinst du? Selbst wenn ich meinen Lebensunterhalt als Stallknecht verdienen würde, hätte ich nicht so viel Scheiße wegräumen müssen wie beim FWPD.«
»Wobei du dich meistens selbst reingeritten hast.«
Wick schnippte mit dem Gummiring, den er immer um sein Handgelenk trug. Er wurde nicht gerne an diese Zeit und diesen Fall erinnert, der ihn bewogen hatte, seinen Vorgesetzten mit energischen Worten die Ineffizienz des Justizsystems im Allgemeinen und des Fort Worth Police Department im Besonderen vorzuhalten. »Sie haben mit diesem Typen einen Deal auf Mittäterschaft bei einer Vergewaltigung abgeschlossen.«
»Weil sie ihn nicht wegen Mordes drankriegen konnten, Wick. Sie haben das gewusst, und der Staatsanwalt hat es gewusst. Er hat immerhin sechs Jahre bekommen.«
»In nicht mal zweien ist er wieder draußen. Und dann wird er es wieder tun. Noch jemand wird sterben müssen. Darauf kannst du dich verlassen. Und alles nur, weil unser Department und der Staatsanwalt den Schwanz eingekniffen haben, als es um die ›Verletzung der Bürgerrechte‹ dieses kleinen Scheißers ging.«
»Weil du bei seiner Verhaftung brutale Gewalt angewendet hast.« Mit gesenkter Stimme ergänzte Oren: »Aber das war es nicht, weswegen du mit dem Department Probleme bekommen hast, das weißt du genau.«
»Oren«, sagte Wick drohend.
»Der Fehler mit –«
»Scheiß drauf«, knurrte Wick. In zwei langen Schritten war er im Haus. Die Fliegentür klappte hinter ihm zu.
Oren folgte ihm zurück in die Küche. »Ich wollte nicht alles wieder aufkochen.«
»Ach nein?«
»Könntest du mal einen Moment stehen bleiben und mich ausreden lassen? Du wirst dir das ansehen wollen, glaub mir.«
»Falsch. Ich will gar nichts, außer einem frischen Bier.« Er holte eines aus dem Kühlschrank und hebelte den Kronkorken mit dem Flaschenöffner ab. Die Metallkappe ließ er achtlos auf den welligen Linoleumboden fallen.
Oren zauberte eine Akte hervor, die er mitgebracht hatte, und hielt sie Wick hin, der halsstarrig darüber hinwegsah. Doch sein Rückzug durch die Hintertür wurde unvermittelt aufgehalten, als er mit dem nackten Fuß in den scharfkantigen Kronkorken trat. Fluchend kickte er das hinterhältige Hindernis weg und ließ sich auf einen der chrombeinigen Küchenstühle fallen. Die leeren Shrimpsschalen begannen bereits zu riechen.
Er legte den Fuß auf das andere Knie und besah sich den Schaden. Die Zacken des Kronkorkens hatten tiefe Male hinterlassen, waren aber nicht durch die Haut gedrungen.
Ohne das geringste Mitgefühl setzte sich Oren ihm gegenüber. »Offiziell bin ich gar nicht hier. Kapiert? Die Situation ist ziemlich kompliziert. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.«
»Hast du was an den Ohren, Oren?«
»Ich weiß, dass du die Sache genauso spannend finden wirst wie ich.«
»Vergiss deine Jacke nicht, wenn du gehst.«
Oren holte mehrere 18-mal-24-formatige Schwarzweißfotos aus der Akte. Eines davon hielt er so hoch, dass Wick unmöglich daran vorbeisehen konnte. Nach ein paar Sekunden zeigte er ihm das zweite.
Wick starrte auf das Foto und sah dann wieder Oren an. »Konntet ihr keine Bilder machen, auf denen sie was anhat?«
»Du kennst doch Thigpen. Die hat er zum Angeben geschossen.«
Wick zeigte mit einem Schnauben, was er von dem Kollegen hielt.
»Zu Thigpens Verteidigung sei gesagt, dass wir von unserem Beobachtungsposten genau in ihr Schlafzimmer schauen.«
»Das ist keine Entschuldigung. Es sei denn, sie ist Exhibitionistin und wusste, dass sie beobachtet wird.«
»Ist sie nicht und hat sie nicht.«
»Und worum geht’s?«
Oren grinste. »Das würdest du zu gern wissen, wie?«
Als Wick vor über einem Jahr seine Marke zurückgegeben hatte, hatte er nicht nur seinem Beruf als Polizist, sondern dem gesamten Strafverfolgungssystem den Rücken gekehrt. In seinen Augen war es wie ein behäbiges, festgefahrenes Auto. Es ließ die fetten Räder durchdrehen und heulte zornig auf – von Freiheit, Gerechtigkeit, Amerika –, ohne dabei vom Fleck zu kommen.
Ein Haufen Bürokraten und Schwätzer hatten in ihrer panischen Angst vor negativen Schlagzeilen den Polizisten allen Schneid abgekauft. Und nun versanken alle Ideale von Gerechtigkeit langsam, aber sicher im Schlamm.
Und wenn du der arme, dumme Trottel warst, der noch an die gute Sache glaubte, der den Karren aus dem Dreck ziehen wollte, der sich reinkniete und mit aller Kraft buckelte, um die Kiste wieder in Fahrt zu bringen, der die Bösewichte schnappte, damit sie für ihre Verbrechen vor Gericht kamen, dann bekamst du dafür nur Dreck ins Gesicht geschleudert.
Doch trotz alledem merkte Wick, wie sich seine natürliche Neugier regte. Oren hatte ihm die Bilder nicht zum Aufgeilen gezeigt. Oren war kein Neandertaler wie Thigpen und wusste mit seiner Zeit Besseres anzufangen, als Fotos von halb nackten Frauen anzugaffen. Außerdem würde ihm Grace den Kopf abreißen, wenn sie ihn dabei erwischte.
Nein, Oren war bestimmt nicht ohne Grund von Fort Worth bis nach Galveston gefahren, und wider besseres Wissen wollte Wick erfahren, was ihn hierher getrieben hatte. Er war gespannt, genau wie es Oren – verflucht noch mal – vorhergesagt hatte.
Er griff nach den restlichen Fotos und schaute sie erst schnell und dann noch einmal langsamer, genauer durch. Die Frau war im Fahrersitz eines neuen Jeeps fotografiert worden; zu Fuß unterwegs auf einer weiten Betonfläche, wahrscheinlich einem Parkplatz; in ihrer Küche und im Schlafzimmer, vollkommen ahnungslos, dass Feldstecher und Zoomkameras in ihre Privatsphäre eindrangen, hinter denen Schmierfink wie Thigpen lauerten.
Die meisten Aufnahmen aus dem Schlafzimmer waren körnig und ein bisschen unscharf. Aber scharf genug. »Was wird ihr vorgeworfen? Hat sie Unterwäsche geklaut?«
»M-m.« Oren schüttelte den Kopf. »Mehr kriegst du erst, wenn du versprichst, dass du mit mir zurückfährst.«
Wick warf die Fotos in Orens Richtung. »Dann bist du umsonst hergekommen.« Er zupfte wieder an dem Gummiband um sein Handgelenk und ließ es schmerzhaft gegen die Haut schnalzen.
»Jede Wette, dass du mitkommen willst, Wick.«
»Eher fahr ich zur Hölle.«
»Du sollst dich ja nicht langfristig verpflichten, du musst auch nicht zurück ins Department. Es geht nur um diesen einen Fall.«
»Trotzdem nein.«
»Ich brauche deine Hilfe.«
»Tut mir Leid.«
»Ist das dein letztes Wort?«
Wick setzte sein frisches Bier an die Lippen, nahm einen tiefen Zug und rülpste vernehmlich.
Trotz der stinkenden Shrimpsreste beugte sich Oren über den Tisch. »Es geht um einen Mord, der Schlagzeilen gemacht hat.«
»Ich sehe nicht fern und lese keine Zeitung.«
»Ganz gewiss nicht. Denn sonst wärst du schon längst nach Fort Worth zurückgerast und hättest mir diese Reise erspart.«
Wick konnte nicht anders; er musste einfach fragen. »Wieso?«
»Beliebter Arzt auf dem Parkplatz des Tarrant General Hospital ermordet.«
»Sehr griffig, Oren. War das die Schlagzeile?«
»Nein. Das ist alles, was wir über den Mord wissen. Das Verbrechen ist fünf Tage her, und mehr haben wir nicht.«
»Nicht mein Problem.«
»Der Mord wurde nur wenige Meter von einem möglichen Zeugen entfernt verübt, aber niemand hat den Täter gesehen. Oder gehört. Lautlos. Unsichtbar. Und ohne eine Spur zu hinterlassen, Wick.« Oren senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Keine einzige beschissene Spur.«
Wick blickte forschend in die dunklen Augen seines Expartners. Seine Nackenhärchen stellten sich auf.
»Lozada?«
Oren sank mit einem selbstzufriedenen Lächeln in seinen Stuhl zurück.
2
Dr. Rennie Newton trat aus dem Aufzug und steuerte auf die zentrale Leitstelle des Pflegedienstes zu. Die sonst so redselige Schwester hinter der Theke wirkte auffällig bedrückt. »Guten Abend, Dr. Newton.«
»Hallo.«
Die Schwester bemerkte das schwarze Kleid unter Rennies Arztkittel. »Die Beerdigung war heute?«
Rennie nickte. »Ich hatte keine Zeit, mich danach umzuziehen.«
»War es eine schöne Feier?«
»Für eine Beerdigung schon. Die Trauergesellschaft war riesig.«
»Dr. Howell war bei allen beliebt. Und er war gerade erst befördert worden. Wie schrecklich.«
»Da haben Sie Recht. Schrecklich.«
Der Schwester traten Tränen in die Augen. »Wir – wir alle auf unserer Station – haben ihn fast jeden Tag gesehen. Wir können es immer noch nicht fassen.«
Rennie konnte das ebenso wenig. Vor fünf Tagen war ihr Kollege Lee Howell gestorben. Ein plötzlicher Tod nach einem Herzanfall oder einem Unfall wäre schon schwer genug zu akzeptieren gewesen, denn Lee war noch nicht so alt. Aber er war kaltblütig ermordet worden. Alle, die ihn gekannt hatten, standen noch immer unter Schock, weil er so unerwartet und vor allem auf so grausame Weise gestorben war. Immer noch rechnete sie halb damit, dass er hinter einer Tür hervorspringen und »Reingelegt!« johlen würde.
Doch dieser Mord war keiner der lausigen Streiche, für die Lee Howell berüchtigt gewesen war. Heute Morgen hatte sie mit eigenen Augen seinen verschlossenen, mit Blumen überhäuften Sarg neben dem Altar stehen sehen. Sie hatte die bewegten Grabreden seiner Verwandten und Freunde gehört. Sie hatte Myrna und seinen Sohn beobachtet, die laut weinend in der ersten Bank gesessen hatten und dadurch Lees Tod in all seiner Unwiderruflichkeit erschreckend real und noch schwieriger zu akzeptieren gemacht hatten.
»Wir alle brauchen Zeit, um über diesen Schock hinwegzukommen«, versuchte Rennie das Thema möglichst ruhig abzuschließen.
Doch die Schwester war noch nicht fertig. »Ich habe gehört, die Polizei hätte jeden verhört, der neulich auf Dr. Howells Party war.«
Rennie vertiefte sich in die Patientenakten, die ihr während des Wortwechsels gereicht worden waren, und überhörte geflissentlich die unausgesprochene Frage in der Bemerkung der Krankenschwester.
»Dr. Howell war immer so lustig, nicht wahr?« Die Krankenschwester kicherte, als würde sie sich an etwas besonders Komisches erinnern. »Und Sie beide haben sich immer gefetzt wie Hund und Katz.«
»Wir haben uns nicht ›gefetzt‹«, korrigierte Rennie. »Wir hatten gelegentlich Meinungsverschiedenheiten. Das ist etwas anderes.«
»Aber bei manchen dieser Meinungsverschiedenheiten ging es ziemlich zur Sache, wenn ich mich recht erinnere.«
»Wir waren einander ebenbürtig«, stellte Rennie mit einem traurigen Lächeln fest.
Am Vormittag hatte sie noch vor der Trauerfeier zwei Operationen durchgeführt. In Anbetracht der Umstände wäre es keine Schande gewesen, die Operationen abzusagen und den Nachmittag freizunehmen. Doch sie stand ohnehin unter Zeitdruck, weil sie vor kurzem aus wichtigem Grund zehn Tage pausiert hatte, was für sie und ihre Patienten schon ziemlich unerfreulich gewesen war.
So kurz nach ihrer Rückkehr einen Tag Urlaub zu nehmen wäre gegenüber jenen Patienten, deren Operationen schon einmal verschoben worden waren, ausgesprochen unfair gewesen. Außerdem wäre sie dadurch noch mehr in Verzug geraten und hätte den nächsten Stau in ihrem streng durchorganisierten Terminplan provoziert. Darum hatte sie sich entschieden, alle heute fälligen Operationen durchzuführen und auch Sprechstunde zu halten. Lee hätte das bestimmt verstanden.
Die Abendvisite bei den frisch operierten Patienten war ihre letzte offizielle Pflicht an diesem langen, zehrenden, anstrengenden Tag, den sie so schnell wie möglich hinter sich bringen wollte. Sie ließ das Thema des hingeschiedenen und beigesetzten Kollegen fallen und erkundigte sich stattdessen nach Mr. Tolar, dessen Zwerchfell-Hernie sie an diesem Morgen geflickt hatte.
»Er ist immer noch benommen, aber er erholt sich gut.«
Die Mappen unter den Arm geklemmt, betrat Rennie den Aufwachraum. Mrs. Tolar nutzte gerade die fünfminütige Besuchszeit, die einmal pro Stunde jeweils einem Familienmitglied eingeräumt wurde. Rennie stellte sich neben sie ans Bett. »Hallo, Mrs. Tolar. Wie ich höre, ist er noch ziemlich benommen.«
»Als ich das letzte Mal bei ihm war, wurde er lang genug wach, um mich zu fragen, wie spät es ist.«
»Das wird hier oft gefragt. Weil sich das Licht hier drin nie ändert. Das erschwert die Orientierung.«
Die Frau legte die Hand an die Wange ihres schlafenden Mannes. »Aber jetzt scheint er durchzuschlafen.«
»Das ist ein gutes Zeichen. Laut unserer Akte gab es bisher keine Überraschungen«, erklärte ihr Rennie, während sie die Daten überflog. »Blutdruck ist gut.« Sie klappte den Metalldeckel der Mappe wieder zu. »In ein paar Wochen wird er sich wie neu geboren fühlen. Dann braucht er auch nicht mehr in Schräglage zu schlafen.«
Ihr fiel der zweifelnde Blick auf, mit dem die Frau ihren Gemahl betrachtete, darum ergänzte sie: »Er erholt sich ausgezeichnet, Mrs. Tolar. Nach einer Operation sieht jeder ein bisschen mitgenommen aus. Morgen wird er schon wesentlich besser aussehen, dafür wird er sich dann so verkatert und wehleidig fühlen, dass Sie sich wünschen werden, wir würden ihn wieder in Narkose legen.«
»Mit einem muffigen Gesicht kann ich leben, solange er nur nicht mehr so leiden muss.« Sie sah Rennie an und senkte vertraulich die Stimme. »Ich denke, jetzt kann ich es Ihnen sagen.«
Rennie legte fragend den Kopf schief.
»Er war ziemlich skeptisch, als ihn der Internist an Sie überwiesen hat. Er hält nicht viel von Chirurginnen.«
Rennie lachte leise. »Ich hoffe, ich habe mir sein Vertrauen verdient.«
»Aber ja doch. Schon nach dem ersten Besuch in Ihrer Sprechstunde war er überzeugt, dass Sie Ihr Handwerk verstehen.«
»Das freut mich zu hören.«
»Allerdings hat er gesagt, Sie wären viel zu hübsch, um Ihr Gesicht hinter einer Operationsmaske zu verstecken.«
»Dann muss ich mich wohl bei ihm bedanken, wenn er aufgewacht ist.«
Die beiden Frauen lächelten sich an, doch dann wurde Mrs. Tolar wieder ernst. »Ich habe das von Dr. Howell gehört. Haben Sie ihn gut gekannt?«
»Sehr gut. Wir waren seit mehreren Jahren Kollegen. Für mich war er ein Freund.«
»Das tut mir so Leid.«
»Vielen Dank. Er wird uns fehlen.« Weil sie nicht schon wieder über die Beerdigung reden wollte, wandte sie sich wieder dem Patienten zu. »Er ist noch so benebelt, dass er gar nicht mitbekommen wird, ob Sie heute Abend hier sind oder nicht, Mrs. Tolar. Versuchen Sie, sich auszuruhen. Sparen Sie sich Ihre Kräfte für die Zeit nach seiner Entlassung auf.«
»Noch ein Besuch, dann fahre ich heim.«
»Dann sehen wir uns morgen.«
Rennie ging weiter zur nächsten Patientin. An deren Bett stand niemand Wache. Die alte Dame war ein Sozialfall. Sie lebte in einem staatlichen Pflegeheim. Ihrer Krankengeschichte zufolge hatte sie außer einem Bruder, der in Alaska lebte, keine weiteren Angehörigen. Die über siebzig Jahre alte Frau erholte sich gut, doch Rennie blieb trotzdem an ihrem Bett stehen, nachdem sie ihren Zustand überprüft hatte.
Sie war der Ansicht, dass die ärztliche Fürsorgepflicht über eine Gratisbehandlung hinausging. Im Gegenteil, die Gratisbehandlung war noch das Geringste dabei. Sie hielt der Frau die Hand und strich ihr über die Stirn, weil sie hoffte, dass die betagte Patientin unterbewusst neue Kraft aus ihrer Anwesenheit, ihrer Berührung zog. Erst als sie überzeugt davon war, trotz der nur wenigen Minuten, die sie erübrigen konnte, etwas bewirkt zu haben, überließ sie die alte Dame bis auf weiteres den Krankenschwestern.
»Ich habe heute Abend keine Bereitschaft«, sagte sie der Krankenschwester auf der Station, als sie die Krankenakten zurückbrachte. »Aber rufen Sie mich trotzdem an, wenn es einem der beiden Patienten unerwartet schlechter gehen sollte.«
»Natürlich, Dr. Newton. Haben Sie schon zu Abend gegessen?«
»Wieso?«
»Bitte entschuldigen Sie meine Direktheit, aber Sie sehen ziemlich fertig aus.«
Sie lächelte müde. »Es war ein langer Tag. Und ein sehr trauriger.«
»In diesem Fall empfehle ich einen Cheeseburger mit Pommes frites, ein Glas Wein und ein heißes Bad.«
»Wenn ich die Augen so lange aufhalten kann.«
Sie wünschte eine gute Nacht und machte sich auf den Weg zum Aufzug. Während sie vor der Tür wartete, bohrte sie beide Fäuste in ihren Rücken und streckte sich durch. Die mehrtägige, erzwungene Abwesenheit hatte sie nicht nur Zeit gekostet und ihr Unannehmlichkeiten eingebracht. Seither hatte sie das Gefühl, aus dem Takt zu sein. Irgendwie hatte sie immer noch nicht in den Krankenhausrhythmus zurückgefunden. Es war kein besonders regelmäßiger Rhythmus, aber er war immerhin vertraut.
Und kaum war sie wieder in die Gänge gekommen, hatte man Lee Howell auf dem Parkplatz ermordet, den sie täglich auf ihrem Weg zum Krankenhaus überquerte.
Noch ehe sie sich von diesem Schlag erholen konnte, hatte sie sich mit weiteren Unannehmlichkeiten herumschlagen müssen. Wie alle anderen, die an jenem Abend bei den Howells gewesen waren, war auch sie von der Polizei vernommen worden. Es hatte sich um eine Routinevernehmung gehandelt, die nach einem festgelegten Ritual ablief. Trotzdem hatte das Gespräch Rennie belastet.
Heute hatte sie Lee Howell das letzte Geleit gegeben. Nie wieder würde sie mit ihm über so entscheidende Dinge streiten wie eine Terminänderung im OP oder über unbedeutenden Kleinkram wie Milch mit und ohne Haut. Nie wieder würde sie über einen seiner dämlichen Witze lachen.
Wenn sie alle Ereignisse der letzten Wochen zusammennahm, war die Behauptung, dass die vergangenen drei Wochen sie aus ihrem Alltagsrhythmus geworfen hatten, eindeutig untertrieben.
Das war keine Kleinigkeit. Denn Dr. Rennie Newton hielt sich mit fanatischer Selbstdisziplin an ihren strikt durchorganisierten Tagesablauf.
Ihr Haus war vom Krankenhaus aus mit dem Auto in zehn Minuten zu erreichen. Die meisten Juppies zog es in die neueren, schickeren Viertel von Fort Worth. Rennie hätte sich jedes Viertel leisten können, doch sie gab dieser älteren, bürgerlicheren Gegend den Vorzug.
Ganz abgesehen von der angenehmen Nähe zum Krankenhaus mochte Rennie die schmalen, von Bäumen gesäumten Backsteinstraßen, die vor Jahrzehnten gepflastert worden waren und dem Viertel eine malerische Atmosphäre verliehen. Die zugewachsenen Gärten sahen nicht aus, als wären sie erst gestern angelegt worden. Die meisten Häuser stammten aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, was ihnen einen Hauch von Dauerhaftigkeit und Stabilität verlieh, der Rennie gefiel. Ihr eigenes Haus war damals als »Bungalow« angepriesen worden. Mit seinen fünf Zimmern war es perfekt geeignet für eine allein stehende Frau, wie sie es war und auch bleiben würde.
Das Haus war zweimal renoviert worden, und sie hatte es vor ihrem Einzug einer dritten Sanierung und Modernisierung unterzogen. Die stuckverzierten Außenmauern waren taubengrau und weiß gestrichen. Die Haustür war preiselbeerrot und mit einem glänzenden Messingklopfer versehen. In den Blumenbeeten unter den dunklen, wachsblättrigen Büschen blühte weißes und rotes Rührmichnichtan. Ausladende Bäume überschatteten den Rasen, auch wenn die Sonne noch so grell vom Himmel brannte. Sie zahlte der Gärtnerei gutes Geld, damit der Garten stets sorgsam gepflegt und gemäht war.
Sie bog in die Einfahrt ein und öffnete mit der Fernbedienung – einer ihrer Neuerungen – das elektrische Garagentor. Dann fuhr sie in die Garage, ließ das Tor wieder herunter und betrat das Haus durch die Verbindungstür zur Küche. Die Dämmerung hatte sich noch nicht gesenkt, darum badete der kleine Raum im goldenen Abendlicht, das durch die großen Platanen hinter ihrem Haus drang.
Auf den empfohlenen Cheeseburger mit Pommes frites hatte sie verzichtet, aber weil sie heute Abend keine Bereitschaft hatte, schenkte sie sich ein Glas Chardonnay ein, das sie mit ins Wohnzimmer nahm – wo sie es um ein Haar hätte fallen gelassen.
Auf dem Couchtisch in ihrem Wohnzimmer stand eine Kristallvase mit roten Rosen.
Fünf Dutzend perfekte Knospen kurz vor der Blüte. Selbst von weitem sahen sie samtig aus. Wohlriechend. Teuer. Auch die Kristallvase wirkte luxuriös. Die zahllosen Facetten funkelten, wie es nur bei wirklich edlem Kristall der Fall ist, und überzogen die Wände mit einem Schauer aus winzigen Regenbögen.
Als sich Rennie von ihrem ersten Schreck erholt hatte, stellte sie das Weinglas auf dem Tisch ab und suchte zwischen den Rosen nach einer Karte. Sie fand keine.
»Verflucht noch mal!«
Sie hatte nicht Geburtstag, und selbst wenn, würde niemand davon wissen. Sie feierte keine Jahrestage, welcher Art auch immer. Waren die Rosen eine Kondolenzgeste? Natürlich hatte sie jahrelang tagaus, tagein mit Lee Howell zusammengearbeitet, doch deswegen war es weder erforderlich noch auch nur angemessen, ihr Blumen zu schenken; schließlich waren sie nur Kollegen gewesen.
Ein dankbarer Patient? Möglich, aber unwahrscheinlich. Welcher Patient kannte schon ihre Privatadresse? Im Telefonbuch stand nur die Adresse ihrer Praxis. Wäre ein Patient wirklich derart von Dankbarkeit überwältigt worden, dann wären die Rosen entweder dort oder im Krankenhaus gelandet.
Nur eine Hand voll Freunde wusste, wo sie wohnte. Und Gäste empfing sie hier so gut wie nie. Gesellschaftliche Verpflichtungen erwiderte sie ausschließlich mit einer Einladung zum Brunch oder zum Abendessen in einem Restaurant. Sie hatte viele Kollegen und Bekannte, doch keiner war so eng mit ihr befreundet, dass sie oder er ihr ein extravagantes Blumenbukett zukommen lassen würde. Keine Familie. Kein Geliebter. Nicht mal ein Ex-oder Möchtegerngeliebter.
Wer würde ihr Blumen schicken? Doch noch wesentlich beunruhigender war die Frage, wie der Strauß in ihr Haus gelangt war.
Sie nahm einen stärkenden Schluck Wein, bevor sie ihren Nachbarn anrief.
Der geschwätzige Witwer hatte gleich nach Rennies Einzug versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen, doch sie hatte ihm seine unangemeldeten Besuche so taktvoll wie möglich ausgetrieben. Trotzdem blieb sie mit ihm auf freundlichem Fuß, und der alte Herr freute sich immer, wenn Rennie einen Augenblick erübrigen konnte, um mit ihm an der gemeinschaftlichen Azaleenhecke zu plaudern.
Wahrscheinlich aus Einsamkeit und Langeweile hatte er stets das Ohr am Puls der Nachbarschaft und wusste über alles und jedes Bescheid. Wenn man irgendetwas über irgendwen erfahren wollte, dann war Mr. Williams der Richtige.
»Hallo, hier ist Rennie.«
»Hallo Rennie, wie schön. Wie war die Beerdigung?«
Vor ein paar Tagen hatte er sie abgefangen, als sie die Zeitung ins Haus holen wollte. Erst hatte er sie mit Fragen nach dem Mord bombardiert und dann zutiefst enttäuscht gewirkt, als sie ihn nicht mit grausigen Details versorgte. »Der Gottesdienst war sehr bewegend.« Um weiteren Fragen vorzubeugen, setzte sie sofort nach: »Mr. Williams, weswegen ich anrufe –«
»Ist die Polizei dem Mörder schon auf der Spur?«
»Da bin ich überfragt.«
»Wurden Sie denn nicht vernommen?«
»Doch, genau wie alle anderen, die an jenem Abend auf Dr. Howells Party waren. Soweit ich weiß, konnte niemand wirklich weiterhelfen.« Statt sie zu entspannen, bereitete der Wein ihr Kopfschmerzen. »Mr. Williams, wissen Sie zufällig, ob mir heute etwas geliefert wurde?«
Er war der einzige Nachbar, der einen Schlüssel zu ihrem Haus hatte. Sie hatte ihn nur unter schweren Bedenken weitergegeben, jedoch nicht, weil sie Mr. Williams nicht vertraut hätte. Die Vorstellung, dass jemand während ihrer Abwesenheit ihr Haus betreten könnte, war einfach widerwärtig. Sie legte nicht nur großen Wert auf einen geregelten Tagesablauf, sondern auch auf ihre Privatsphäre.
Dennoch hatte sie das Gefühl, jemand sollte einen Ersatzschlüssel haben, falls es zu einem Notfall kam oder irgendwelche Handwerker ins Haus gelassen werden mussten. Die Wahl war auf Mr. Williams gefallen, weil er ihr direkter Nachbar war. Soweit Rennie wusste, war er noch nie allein in ihrem Haus gewesen.
»Ich erwarte nämlich ein Päckchen«, log sie. »Ich dachte, es könnte vielleicht bei Ihnen abgegeben worden sein, weil ich nicht zu Hause war.«
»War denn kein Zettel an ihrer Tür? So ein gelber Aufkleber?«
»Nein, aber es wäre ja möglich, dass der Fahrer den vergessen hat. Sie haben keinen Lieferwagen vor meinem Haus parken sehen?«
»Nein, da war nichts.«
»Hmm. Na ja, solche Päckchen kommen nie an, wenn man darauf wartet, stimmt’s?«, flötete sie fröhlich. »Trotzdem vielen Dank, Mr. Williams. Und entschuldigen Sie die Störung.«
»Haben Sie schon von den neuen Welpen bei den Bradys gehört?«
Verflixt! Sie hatte nicht schnell genug aufgelegt. »Nein, noch nicht. Sie wissen ja, ich war ein paar Wochen kaum zu Hause und –«
»Beagles. Sechs Stück. Die süßesten kleinen Dinger, die man sich nur vorstellen kann. Sie wollen die Kleinen verschenken. Sie sollten einen nehmen.«
»Ich habe keine Zeit für ein Haustier.«
»Die sollten Sie sich aber nehmen, Rennie«, erklärte er mahnend wie ein strenger Vater.
»Meine Pferde –«
»Das ist was anderes. Die wohnen nicht bei Ihnen. Sie brauchen ein Tier im Haus. Ein Tier kann das ganze Leben verändern. Menschen mit einem Haustier leben länger, haben Sie das gewusst? Ich wüsste nicht, was ich ohne Oscar machen würde«, lobte er seinen Pudel. »Ein Hund oder eine Katze wäre am besten, aber selbst ein Goldfisch oder ein Wellensittich können die Einsamkeit vertreiben.«
»Ich bin nicht einsam, Mr. Williams. Ich habe nur sehr viel zu tun. Vielen Dank noch mal. Auf Wiederhören.«
Sie legte augenblicklich auf, und das nicht nur, um sich einen Vortrag über die Vorzüge eines Haustiers zu ersparen. Sie war zutiefst verängstigt. Die Rosen waren keine Einbildung, und sie hatten sich auch nicht von selbst auf ihrem Couchtisch materialisiert. Jemand war in ihrer Wohnung gewesen und hatte sie hier abgestellt.
Eilig überprüfte sie die Haustür. Sie war verriegelt, genau wie am Morgen, als sie zum Krankenhaus aufgebrochen war. Rennie lief durch den Flur ins Schlafzimmer, wo sie unter dem Bett und im Schrank nachschaute. Alle Fenster waren fest verschlossen und verriegelt. Das Fenster über der Badewanne war so klein, dass nicht einmal ein Kind durchgepasst hätte. Als Nächstes überprüfte sie das zweite Zimmer, das sie als Arbeitszimmer nutzte. Dort kam sie zum gleichen Ergebnis: nichts. Dass in der Küche alles unverändert war, wusste sie bereits.
Im Grunde wäre sie erleichtert gewesen, ein zerschlagenes Fenster oder ein verkratztes Schloss zu entdecken, denn damit wäre wenigstens ein Teil des Rätsels gelöst. Sie ging zurück ins Wohnzimmer und ließ sich aufs Sofa fallen. Der Wein schmeckte ihr nicht mehr, trotzdem nahm sie noch einen Schluck, in der Hoffnung, er würde ihre Nerven beruhigen. Er tat es nicht. Als das Telefon auf dem Couchtisch zu läuten begann, schoss sie vor Schreck hoch.
Sie, Rennie Newton, die mit vierzehn die schmale Leiter am Wasserturm ihres Heimatortes erklettert hatte, die unzählige Male ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatte, indem sie praktisch jeden Gefahrenherd dieser Erde aufsuchte, die Herausforderungen liebte und noch nie vor einer Mutprobe zurückgeschreckt war, die weder Tod noch Teufel fürchtete, wie ihre Mutter oft betonte, und die täglich Operationen durchführte, bei denen man Nerven wie Drahtseile und eine absolut ruhige Hand brauchte, fuhr vor Schreck fast aus der Haut, nur weil das Telefon läutete.
Den verschütteten Wein von der Hand schüttelnd, griff sie nach dem schnurlosen Apparat. Die meisten Anrufe betrafen ihre Arbeit, darum antwortete sie kühl und geschäftsmäßig wie sonst auch.
»Dr. Newton hier.«
»Hier ist Detective Wesley, Dr. Newton. Wir haben vorgestern miteinander gesprochen.«
Das hätte er nicht extra erwähnen müssen. Sie hatte ihn als durchtrainierten, imposanten Schwarzen in Erinnerung. Mit hoher Stirn. Ernstem Gesicht. Durch und durch professionell. »Ja?«
»Ich habe mir vom Krankenhaus Ihre Privatnummer geben lassen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich Sie zu Hause anrufe?«
O doch. Sehr viel sogar. »Was kann ich für Sie tun, Detective?«
»Ich würde Sie morgen gern sehen. Um zehn Uhr?«
»Mich sehen?«
»Um mit Ihnen über den Mord an Dr. Howell zu sprechen.«
»Ich weiß nichts über den Mord. Das habe ich Ihnen doch schon erklärt… wann war das noch mal, vorgestern?«
»Aber Sie haben mir nicht erzählt, dass Sie sich für denselben Posten wie er beworben hatten. Das haben Sie ausgelassen.«
Ihr Herz hämmerte gegen die Rippen. »Das war nicht von Belang.«
»Um zehn Uhr, Dr. Newton. Die Mordkommission ist im zweiten Stock. Fragen Sie einfach nach mir.«
»Verzeihen Sie, aber für morgen Vormittag sind schon drei Operationen angesetzt. Alle drei auf einen anderen Termin zu verlegen, würde den anderen Chirurgen und dem Krankenhauspersonal erhebliche Unannehmlichkeiten bereiten, von den Patienten und ihren Angehörigen ganz zu schweigen.«
»Wann würde es Ihnen denn passen?« Sein Tonfall ließ erkennen, dass er ihr nur so weit wie unbedingt nötig entgegenkommen würde.
»Am frühen Nachmittag, gegen zwei oder drei Uhr.«
»Dann um zwei. Bis dann.«
Er hatte schon aufgelegt, ehe Rennie das tun konnte. Sie legte den Apparat auf den Beistelltisch zurück. Dann schloss sie die Augen, atmete tief durch die Nase ein und ließ die Luft durch den Mund wieder ausströmen.
Lee Howells Ernennung zum Chefarzt war ein schwerer Schlag für sie gewesen. Seit ihr ehemaliger Chef in Ruhestand gegangen war, hatten vor allem sie und Lee um diesen Posten konkurriert. Nach monatelangen ausgiebigen Gesprächen und Leistungskontrollen hatte der Verwaltungsrat des Krankenhauses letzte Woche endlich seine Entscheidung verkündet – praktischerweise, während sie außer Haus gewesen war, in ihren Augen ein Schritt von unerträglicher Feigheit.
Andererseits war sie froh, nicht im Krankenhaus gewesen zu sein, als Lees Ernennung verkündet wurde. Die Nachricht würde sich mit Lichtgeschwindigkeit im Krankenhaus verbreiten. Bis sie wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt war, war das Thema bereits gegessen und die vielen wohlmeinenden und doch peinlichen Mitleidsbekundungen waren ihr erspart geblieben.
Vollends war sie ihnen allerdings nicht entkommen. Im Star-Telegram, der Lokalzeitung, war über Lees Beförderung zum Chefarzt berichtet worden. In dem Artikel waren Dr. Lee Howells chirurgische Künste, sein hohes Berufsethos und sein Wirken im Krankenhaus und in der Gemeinde gepriesen worden. Im Kielwasser dieses gloriosen Artikels hatte Rennie viele mitleidige Blicke einstecken müssen, was sie hasste und was sie so gut wie möglich zu ignorieren versuchte.
Im Grunde war die Ernennung zum Chef irgendeiner Abteilung vor allem mit Wagenladungen von Papierkram, ständigen Personalquerelen und unausgesetztem Gezänk mit dem Verwaltungsrat um einen höheren Etat verbunden. Nichtsdestotrotz war es ein begehrter Titel, und sie hatte ihn begehrt.
Dann, nur drei Tage nach der Zeitungsmeldung, hatte Lee noch einmal Schlagzeilen gemacht, weil er auf dem Parkplatz des Krankenhauses ermordet worden war. In Detective Wesleys Augen war das verdächtig kurz nach seiner Ernennung geschehen und gebot weitere Ermittlungen. Schließlich war es sein Job, allen Spuren nachzugehen. Und natürlich würde Lees berufliche Rivalin zu den ersten Verdächtigen zählen. Das Treffen morgen bedeutete demzufolge nur, dass der Detective gründlich arbeitete und noch einmal alle Möglichkeiten durchgehen wollte.
Sie würde sich deswegen nicht den Kopf zerbrechen. Auf gar keinen Fall. Sie würde Wesley nicht weiterhelfen können. Sie würde seine Fragen wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen beantworten und Schluss. Sie brauchte sich wirklich keine Sorgen zu machen.
Andererseits machten ihr die Rosen durchaus Sorgen.
Sie starrte die Blumen an, als würden sie die Identität ihres Absenders preisgeben, wenn sie nur ausreichend eingeschüchtert wurden. Sie starrte sie so lange an, dass sie den Strauß erst doppelt und dann vierfach sah, ehe sie ihn abrupt wieder fixierte – weil sie einen weißen Umschlag entdeckt hatte.
Tief zwischen den Blättern versteckt, war er ihr bis jetzt entgangen. Sie schob die Finger vorsichtig zwischen den Dornen hindurch und zog die Karte aus dem Umschlag, der mit einem dünnen Satinband an einem Stiel in der Mitte des Buketts befestigt war.
Die Hand, der sie ihren Ruf als außergewöhnlich talentierte Chirurgin verdankte, hob die Karte mit leisem Tremor an. Eine einzige, maschinell geschriebene Zeile stand darauf:
Ich bin verrückt nach Dir.
3
»Onkel Wick!«
»Onkel Wick!«
Die beiden Mädchen stürmten auf ihn zu wie zwei Footballspieler, die ihren Gegner über den Haufen rennen wollen. Obwohl offiziell schon Teenager, demonstrierten sie ihre Zuneigung, vor allem für ihren über alles geliebten Onkel Wick, immer noch mit kindlichem Überschwang.
»Du warst echt ewig nicht mehr hier, Onkel Wick. Ich hab dich total vermisst.«
»Ich habe euch auch vermisst. Seht euch nur an. Könntet ihr bitte endlich aufhören zu wachsen? Bald seid ihr so groß wie ich!«
»Niemand ist so groß wie du, Onkel Wick.«
»Michael Jordan schon.«
»Niemand, der kein Basketballspieler ist, meine ich.«
Laura, die Jüngere, verkündete: »Mom hat endlich erlaubt, dass ich mir die Ohrläppchen piercen lasse«, was sie sofort voller Stolz vorführte.
»Keine Nasenstecker, hoffe ich.«
»Dad würde austicken.«
»Und ich erst.«
»Findest du Zahnspangen hässlich, Onkel Wick? Ich krieg vielleicht eine.«
»Machst du Witze? Zahnspangen sind obersexy.«
»Im Ernst?«
»Im Ernst.«
»Deine Haare sind blonder geworden, Onkel Wick.«
»Ich war viel am Strand. Die Sonne hat sie gebleicht. Und wenn ich mich nicht oft genug einschmiere, werde ich noch so braun wie ihr.«
Das fanden sie zum Totlachen.
»Ich bin Cheerleader geworden.«
»Das habe ich gehört.« Er klatschte Stephanies erhobene Hand ab. »Du kannst mir schon mal einen Platz für eins der Spiele in der nächsten Saison reservieren.«
»Unsere Trikots sehen mega-bescheuert aus.«
»Echt wahr«, pflichtete ihre kleine Schwester tiefernst bei. »Voll bescheuert.«
»Aber Mom sagt, dass sie den Rock kürzer macht, kann ich mir abschminken.«
»Wahr gesprochen.« Jetzt war auch Grace Wesley an der Haustür angekommen. Sie schob ihre Töchter beiseite und schloss Wick in die Arme.
Als er sie wieder losließ, jammerte er: »Grace, warum willst du nicht mit mir durchbrennen?«
»Weil ich eine Ein-Mann-Frau bin.«
»Ich werde mich bessern. Für dich würde ich das tun. Ehrenwort.«
»Ich kann trotzdem nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Weil Oren sich an unsere Fersen heften und dir die Rübe wegpusten würde.«
»Ach Mist«, knurrte er. »Immer wieder der.«
Die Mädchen kreischten vor Lachen. Trotz ihrer lautstarken Proteste schickte Grace die beiden nach oben, wo noch Arbeit auf sie wartete, und führte Wick dann ins Wohnzimmer. »Wie ist es so in Galveston?«
»Heiß. Schwül. Sandig.«
»Gefällt’s dir?«
»Ich genieße mein Leben als Taugenichts. Wo ist dein Gemahl?«
»Am Telefon, aber er müsste gleich fertig sein. Hast du was gegessen?«
»Ich bin bei Angelo’s eingekehrt und hab mir ein Filetsteak genehmigt. Ich wusste gar nicht, wie sehr mir das gefehlt hat, bis ich den ersten Bissen im Mund hatte.«
»Im Kühlschrank steht noch Schokopudding.«
»Ich würde ein Glas von deinem Eistee vorziehen.«
»Süß?«
»Gibt es denn anderen?«
»Kommt sofort. Mach’s dir gemütlich.« Ehe sie das Zimmer verließ, drehte sie sich noch mal um und versicherte ihm mit Nachdruck: »Schön, dich wieder hier zu haben.«
»Danke.«
Er korrigierte sie nicht. Er war noch nicht wieder hier, er wusste nicht einmal, ob er zurückkommen wollte. Er hatte sich lediglich bereit erklärt, darüber nachzudenken. Oren war an einem interessanten Fall. Und er hatte Wick um seine professionelle Einschätzung gebeten. Wick war nur hier, um seinem Freund zu helfen. Und das war alles.
Er hatte die Tür zur Polizeizentrale noch nicht wieder durchschritten und hatte das auch nicht vor. Er war nicht einmal daran vorbeigefahren und hatte auch keine nostalgischen Sehnsüchte danach verspürt. Er war hier, um Oren einen Gefallen zu tun. Punkt.
»Hey, Wick.« Oren kam ins Zimmer. Er trug Freizeitkleidung – knielange Shorts, Turnschuhe und ein T-Shirt mit der Aufschrift »University of Texas« –, doch er war immer noch durch und durch Polizist; unter seinem Arm klemmte ein Ringhefter. Und er hatte den Piepser an den Hosenbund geklemmt. »Wie war die Fahrt?«
»Lang.«
»Wie wahr, wie wahr.« Oren war erst gestern hin und zurück gefahren. »Hast du schon im Motel eingecheckt?«
»Etwas Besseres als dieses Rattenloch hat das FWPD nicht zu bieten?«
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »The Crush« bei Warner Books, Inc., New York
1. Auflage Taschenbuchausgabe März 2007 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © by Sandra Brown Management, Ltd., 2002 Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagsfoto: Corbis/Christies Image MD · Herstellung: Heidrun Nawrot Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-10331-6
www.blanvalet-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe