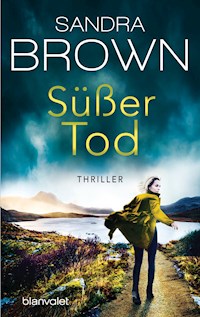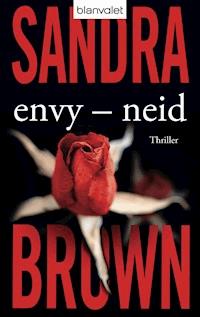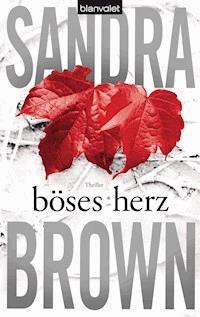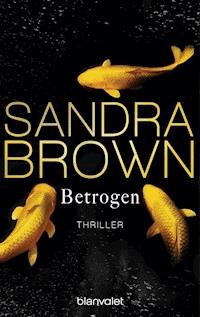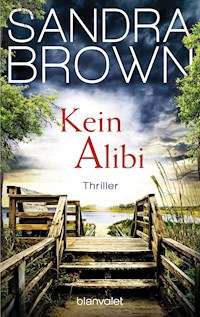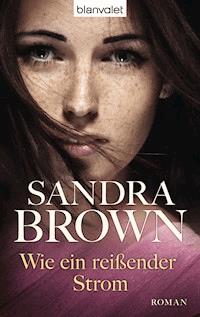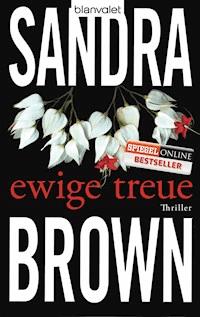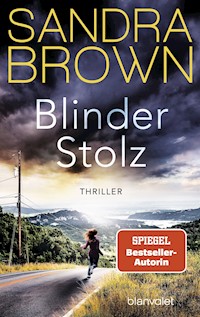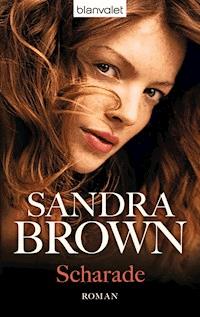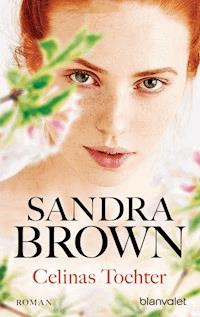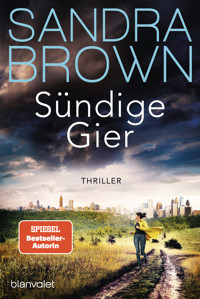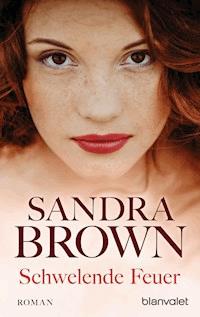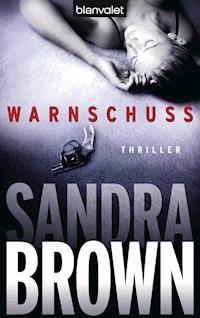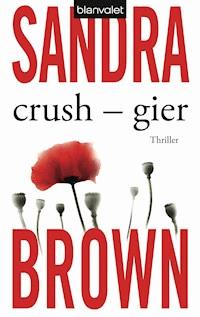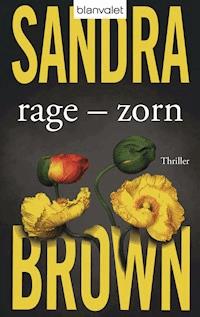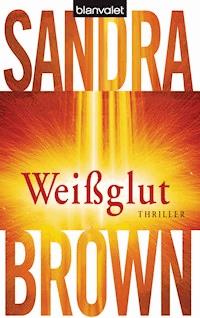
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie hatte sich geweigert seinen Anruf entgegen zu nehmen. Niemals wieder Kontakt zu ihrer Familie, niemals zurück nach Destiny, Louisiana! Jetzt steht Sayre Hoyle am Grab ihres jüngeren Bruders und eins steht fest: Der Mörder kommt aus der eigenen Familie. Sayre sucht die Wahrheit, auch gegen den Willen von Beck Merchant, dem Anwalt ihres Vaters. Seine faszinierende Ausstrahlung zieht Sayre mit der Kraft eines Magneten an – doch Beck ist ein Mann mit sehr gefährlichen Plänen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Der Klang der Kirchenorgel jagt ihr einen Schauer über den Rücken. Nie wieder wollte Sayre Hoyle einen Fuß in ihre Heimatstadt Destiny setzen. Nie wieder wollte sie etwas mit ihrer Familie zu tun haben. Selbst als ihr Bruder Danny sie vor einigen Tagen aufgeregt in San Francisco anrief, weigerte sie sich, mit ihm zu sprechen. Jetzt erklingt die Orgel anlässlich von Dannys Beerdigung. Entsetzt erfährt Sayre, dass der mit er Untersuchung des Todesfalls betraute Hilfssheriff einen Mord vermutet. Kurz entschlossen quartiert Sayre sich ein letztes Mal in Destiny ein, denn sie vermutet den Mörder in der eigenen Familie.
Nichts hat sich geändert am schwülen, aggressiven Klima der Stadt, die ihr tyrannischer Vater Huff und ihr gewalttätiger Bruder Chris mit ihrer Stahlgießerei in eiserner Umklammerung halten – korrupt wie eh und je. Schlimmer noch, sie haben einen Cleveren, undurchsichtigen Anwalt an ihrer Seite: Beck Merchant, einen Mann, dessen abgründige Ausstrahlung Sayre mit der Kraft eines Magneten anzieht. Ihn zu begehren ist töricht, doch ihm zu vertrauen ist für Sayre beinahe tödlich. Als ein weiterer Mann stirbt, entzündet sich die Zündschnur eines hoch explosiven Pulverfasse aus altem Hass, vergangenen Verbrechen und kaltblütig kalkulierter Rache ...
Autorin
Sandra Brown arbeitete mit großem Erfolg als Schauspielerin und TV-Journalistin, bevor sie mit ihrem Roman »Trügerischer Spiegel« auf Anhieb einen großen Erfolg landete. Inzwischen ist sie eine der erfolgreichsten internationalen Autorinnen, die mit jedem ihrer Bücher die Spitzenplätze der Bestsellerlisten erreicht! Sandra Brown lebt mit ihrer Familie abwechselnd in Texas und South Carolina.
Weitere Informationen finden Sie unter:www.sandra-brown.de und www.blanvalet.de
Inhaltsverzeichnis
Im Gedenken an Mark W. SmithEr zeigte Größe im Leben,Würde im Sterben und ist nun geheilt
Prolog
Manche meinten, wenn er sich wirklich hatte umbringen wollen, hätte er sich keinen besseren Tag aussuchen können.
Das Leben war an diesem Sonntagnachmittag wahrhaftig nicht besonders lebenswert, und die meisten Organismen arbeiteten nur auf Sparflamme. Die Luft war dick und heiß wie Maisgrütze. Sie entzog jedem Lebewesen sämtliche Energien, egal ob Pflanze oder Tier.
Alle Wolken verdampften unter der Grausamkeit der Sonne. Ein Schritt aus dem Haus ins Freie war wie das Betreten eines der Hochöfen in Hoyles Gießerei. Vor der familieneigenen Angelhütte am Bayou Bosquet – so genannt wegen der mit Zypressen bewachsenen Insel in der Mitte des gemächlich dahintreibenden Gewässers – backte ein ausgestopfter, zwei Meter langer Alligator in der glühenden Hitze des Gartens. In seinen glasigen Augen spiegelte sich das Flirren des glosenden Himmels. Die Flagge des Staates Louisiana hing wie ausgewrungen am Mast.
Selbst die Zikaden waren zu träge zum Musizieren, nur gelegentlich störte ein besonders ehrgeiziges Insekt die schlaftrunkene Atmosphäre mit einem bestenfalls halbherzigen Zirpen auf. Die Fische blieben wohlweislich unter der Wasseroberfläche und der dichten, grünen Decke aus Wasserlinsen. Sie verharrten in den schattigen, modrigen Tiefen und zeigten nur durch das periodische Pulsieren ihrer Kiemen an, dass sie noch lebten. Eine Mokassinschlange lag faul am Ufer, drohend, aber reglos.
Der Sumpf war ein natürliches Vogelparadies, aber heute schien alles, was Federn trug, ein Nickerchen im eigenen Nest zu halten. Bis auf einen einsamen Falken. Er hockte auf dem Wipfel eines Baumes, der Jahrzehnte zuvor durch einen Blitzschlag abgestorben war. Die Elemente hatten das nackte Geäst weiß gewaschen wie ein säuberlich abgenagtes Gerippe.
Der geflügelte Jäger behielt die kleine Hütte unten fest im Blick. Vielleicht hatte er die Maus erspäht, die zwischen dem Pfahlwerk des Angelsteges umherhuschte. Wahrscheinlicher aber war, dass ihn sein Instinkt vor der drohenden Gefahr warnte.
Der Knall des Schusses war nicht so laut, wie man vielleicht erwartet hätte. Die Luft, dicht wie ein Daunenkissen, schien die Schallwellen zu dämpfen. Der Schuss löste kaum eine Reaktion im Sumpf aus. Die Flagge blieb verwickelt und schlaff an ihrem Mast hängen. Der ausgestopfte Alligator zuckte nicht. Nur die Mokassinschlange glitt mit einem leisen Plätschern ins Bayou, weniger aufgeschreckt als vielmehr pikiert, dass man sie aus ihrem sonntäglichen Schlummer aufgestört hatte.
Der Falke erhob sich in die Lüfte, fast ohne einen Flügelschlag auf der Thermik reitend, um nach etwas Gehaltvollerem als der kleinen Maus Ausschau zu halten.
An den Toten in der Hütte verschwendete er keinen Gedanken.
1
»Erinnerst du dich an Slap Watkins?«
»An wen?«
»Den Typen, der damals in der Bar rumgestänkert hat.«
»Etwas genauer, bitte. In welcher Bar? Wann?«
»An dem Abend, als du hier aufgetaucht bist.«
»Das war vor drei Jahren.«
»Yeah, aber das hast du bestimmt nicht vergessen.« Chris Hoyle beugte sich vor, um dem Gedächtnis seines Freundes auf die Sprünge zu helfen. »Das Großmaul, das den Streit angefangen hat? Mit einer Hackfresse, dass die Uhr stehen bleibt. Und Elefantenohren.«
»Ach, den. Klar. Mit den…« Beck hielt die Hände seitlich an den Kopf, als wären es riesige Ohren.
»Deshalb hat ihn jeder Slap genannt«, sagte Chris.
Beck zog eine Braue hoch.
»Immer wenn es windig wurde, sind ihm die Ohren…«
»An den Kopf geklatscht«, vollendete Beck den Satz.
»Wie ein offenes Gatter im Sturm.« Grinsend erhob Chris seine Bierflasche zu einem stummen Prost.
Die Blenden im Fernsehzimmer der Hoyles waren fest geschlossen, um die bohrenden Strahlen der Spätnachmittagssonne abzuhalten. Daher lag der Raum in einem angenehmen Halbdunkel, in dem das Fernsehbild wesentlich besser zu erkennen war. Es lief gerade ein Spiel der Braves. Ende des neunten Inning, und Atlanta konnte nur noch auf ein Wunder hoffen. Aber trotz des unerfreulichen Spielstandes gab es unangenehmere Arten, den Sonntagnachmittag zu verbringen, als in einem dunklen, klimagekühlten Fernsehzimmer eiskaltes Bier zu trinken.
Chris Hoyle und Beck Merchant hatten schon viele Stunden in diesem Raum vergeudet. Mit dem Riesenfernseher und der Surround-Anlage war er das perfekte Männer-Spielzimmer. Es gab hier eine komplett ausgestattete Bar mit eingebautem Eiswürfelautomaten, einen Kühlschrank voller Soft Drinks und Bier, einen Billardtisch, ein Dartboard und einen runden Kartentisch mit sechs Ledersesseln, von denen jeder so weich und anschmiegsam war wie der Busen des Covergirls auf der aktuellen Ausgabe von Maxim. Das Zimmer war mit Walnusswurzelholz verkleidet und mit massiven Möbeln eingerichtet, die sich nur wenig abnutzten und kaum Pflege brauchten. Die Luft roch nach Tabak und war testosterongeschwängert.
Beck öffnete die nächste Flasche Bier. »Und was ist mit diesem Slap?«
»Er ist wieder da.«
»Ich wusste gar nicht, dass er weg war. Wenn ich es recht überlege, habe ich ihn sowieso nur das eine Mal gesehen, und da waren mir die Augen zugeschwollen.«
Chris erinnerte sich lächelnd. »Für eine Barkeilerei ging es damals ganz schön zur Sache. Du hast dir eine ganze Salve von Slaps gut gesetzten Schlägen eingefangen. Mit den Fäusten konnte er schon immer umgehen. Das hat er gelernt, weil er immerzu die Klappe aufreißen musste.«
»Wahrscheinlich, weil ihn dauernd jemand wegen seiner Ohren verarschen wollte.«
»Bestimmt. Jedenfalls hat ihm seine Klappe einen Haufen Ärger eingebracht. Schon bald nach unserer kleinen Meinungsverschiedenheit begann er eine Fehde mit dem Ex seiner Schwester. Es ging um einen Rasenmäher, glaube ich. An einem Abend beim Krabbenkochen spitzte sich die Sache so zu, dass Slap seinem Exschwager mit einem Messer hinterher ist.«
»Hat er ihn erwischt?«
»Es war nur eine Fleischwunde. Aber die ging quer über den Bauch des Typen und war immerhin so blutig, dass sie Slap eine Anklage wegen schwerer Körperverletzung einbrachte, die wahrscheinlich auf versuchten Totschlag hätte lauten müssen. Sogar Slaps eigene Schwester hat damals gegen ihn ausgesagt. Die letzten drei Jahre hat er in Angola abgesessen, und jetzt ist er auf Bewährung rausgekommen.«
»Wie schön für uns.«
Chris sah ihn ernst an. »Nicht wirklich. Slap hat es auf uns abgesehen. Jedenfalls hat er das gesagt, als er vor drei Jahren im Streifenwagen weggefahren wurde. Er fand es unfair, dass er verhaftet wurde und wir nicht. Damals hat er Beleidigungen und Drohungen ausgestoßen, bei denen es mir heute noch kalt über den Rücken läuft.«
»Kann mich gar nicht erinnern.«
»Wahrscheinlich, weil du da auf der Toilette warst, um deine Wunden auszuspülen. Jedenfalls«, fuhr Chris fort, »ist Slap ein aggressiver und wenig vertrauenswürdiger Loser, ein echter Assi, der nichts kann außer streiten, aber das dafür erstklassig. Wir haben ihm damals eine schwere Schlappe zugefügt, und ich bezweifle, dass das vergeben und vergessen ist, auch wenn er hackedicht war. Nimm dich vor ihm in Acht.«
»Ich betrachte mich hiermit als gewarnt.« Beck schaute über die Schulter in Richtung Küche. »Bin ich zum Essen eingeladen?«
»Wie immer.«
Beck rutschte noch tiefer in das Sofa, auf dem er sich breitgemacht hatte. »Super. Ich weiß nicht, was da im Ofen ist, aber mir wird schon vom Duft der Mund wässrig.«
»Kokoskuchen. Niemand macht besseren Kokoskuchen als Selma.«
»Da kann ich nicht widersprechen.«
Chris’ Vater Huff Hoyle trat in den Raum, das erhitzte Gesicht mit einem Strohhut befächelnd. »Gebt mir sofort ein Bier. Ich bin so verflucht durstig, dass ich keinen Tropfen Spucke zusammenkriegen würde, selbst wenn mein Schwanz in Flammen stände.«
Er hängte den Hut an einen Garderobenständer, ließ sich schwer in seinen Fernsehsessel fallen und wischte mit dem Ärmel über seine Stirn. »Verflucht, ist das eine Scheißhitze.« Seufzend sank er in die kühlen Lederpolster zurück. »Danke, Sohn.« Er nahm die eiskalte Bierflasche entgegen, die Chris ihm geöffnet hatte, und deutete damit auf den Fernseher. »Wer gewinnt?«
»Atlanta bestimmt nicht. Außerdem ist es gerade vorbei.« Beck drehte den Fernseher stumm, während die Kommentatoren das Spiel sezierten. »Wen interessiert schon, warum sie verloren haben. Der Endstand sagt alles.«
Huff grunzte zustimmend. »Die Braves konnten die Saison von dem Moment an abschreiben, als sie zugelassen haben, dass diese überbezahlten, ausländischen Primadonnen den Besitzern vorschreiben, wo’s langgeht. Ein entscheidender Fehler. Das hätte ich ihnen gleich sagen können.« Er nahm einen langen Schluck, mit dem er die Flasche praktisch leerte.
»Hast du den ganzen Nachmittag Golf gespielt?«, fragte Chris.
»Zu heiß.« Huff zündete sich eine Zigarette an. »Wir haben drei Löcher gespielt, dann haben wir ›Scheiß drauf‹ gesagt und sind ins Clubhaus, um Gin Rummy zu spielen.«
»Wie viel hast du ihnen heute abgenommen?«
Die Frage war nicht, ob Huff gewonnen oder verloren hatte. Er hatte noch immer gewonnen.
»Ein paar Hunderter.«
»Gut gelaufen«, kommentierte Chris.
»Wenn du nicht gewinnst, brauchst du auch nicht zu spielen.« Er zwinkerte erst seinem Sohn, dann Beck zu. Mit einem tiefen Schluck leerte er sein Bier. »Hat einer von euch was von Danny gehört?«
»Der wird irgendwann hier auftauchen«, sagte Chris. »Das heißt, wenn er den Besuch irgendwo zwischen dem Sonntagsgottesdienst und dem Abendgebet unterbringen kann.«
Huffs Blick wurde düster. »Versau mir nicht die Laune, indem du davon sprichst. Ich will mir nicht den Appetit verderben.«
Wie Huff gern und oft predigte, waren Gebete, fromme Gesänge und Gottesdienste nur etwas für Weiber oder für Männer, die wie Weiber waren. Für ihn stand die organisierte Religion auf einer Stufe mit dem organisierten Verbrechen, nur dass die Kirchen straffrei blieben und Steuervorteile genossen, und darum waren ihm diese heiligen Brüder genauso zuwider wie Schwule oder Gewerkschafter.
Chris lenkte das Gespräch taktvoll von seinem jüngeren Bruder und dessen jüngster Hinwendung zur Spiritualität weg. »Ich habe Beck eben erzählt, dass Slap Watkins auf Bewährung freigekommen ist.«
»Asozialer Dreck«, knurrte Huff und streifte mit den Zehen die Schuhe vom Fuß. »Und zwar der ganze Haufen, angefangen mit Slaps Großvater, dem verkommensten Halunken auf Gottes weiter Welt. Sie haben ihn schließlich im Straßengraben gefunden, mit einer zerbrochenen Whiskyflasche in der Kehle. Offenbar hat er einmal zu oft Streit gesucht. In der Familie muss es irgendwo Inzucht gegeben haben. Die ganze Sippe ist hässlich wie die Sünde und dumm wie Brot.«
Beck lachte. »Möglich. Aber ich stehe trotzdem in Slaps Schuld. Wenn er nicht gewesen wäre, säße ich nicht hier und würde mich bekochen lassen.«
In Huffs Blick lag eine Zuneigung, die er sonst nur seinen Söhnen gegenüber zeigte. »Nein, Beck, es war dir von Anfang an bestimmt, auf Gedeih und Verderb einer von uns zu werden. Dass wir dich gefunden haben, hat diesen ganzen Gene-Iverson-Schlamassel letztendlich aufgewogen. Du warst das einzig Gute an der ganzen Geschichte«
»Du und die gespaltene Jury«, ergänzte Chris. »Diese zwölf dürfen wir nicht vergessen. Wenn sie nicht gewesen wären, säße ich nicht hier und würde aufs Sonntagsessen warten. Stattdessen könnte ich mir mit Typen wie Slap Watkins eine Zelle teilen.«
Chris mokierte sich oft darüber, dass man ihn des Mordes an Gene Iverson angeklagt hatte. Seine launigen Scherze über diesen Vorfall verursachten bei Beck unweigerlich ein flaues Gefühl, so wie jetzt auch. Er wechselte das Thema. »Ich spreche nur ungern an einem Sonntag eine Geschäftsangelegenheit an.«
»In meinem Kalender ist jeder Tag ein Werktag«, wies ihn Huff zurecht.
Chris stöhnte. »In meinem Kalender nicht, o nein. Ist es was Unangenehmes, Beck?«
»Möglicherweise.«
»Kann es dann nicht bis nach dem Essen warten?«
»Klar, wenn euch das lieber ist.«
»Auf keinen Fall«, sagte Huff. »Du weißt, wie ich zu schlechten Nachrichten stehe. Ich höre sie lieber früher als später. Und ganz bestimmt will ich damit nicht bis nach dem Essen warten. Also, worum geht es, Beck? Sag nicht, dass uns das Umweltamt schon wieder eine Strafzahlung aufgedrückt hat, weil die Kühlteiche …«
»Nein, darum geht es nicht. Nicht direkt.«
»Worum dann?«
»Moment noch. Ich schenke uns erst mal was zu trinken ein«, meinte Chris zu Huff. »Du hörst schlechte Nachrichten lieber früher als später, ich höre sie am liebsten mit einem Glas Bourbon in der Hand. Willst du auch einen?«
»Viel Eis, kein Wasser.«
»Beck?«
»Für mich nicht, danke.«
Chris ging an die Bar und griff nach einer Whiskykaraffe und zwei Gläsern. Dann beugte er sich zum Fenster, spähte zwischen den Lamellen der Blende hindurch und drehte gleich darauf die kleine Kurbel, um den Spalt zu vergrößern. »Wer kommt denn da?«
»Wer kommt denn da?«, echote Huff.
»Der Wagen des Sheriffs hat gerade angehalten.«
»Na, was glaubst du, was er von uns will? Heute ist Zahltag.«
Den Blick immer noch nach draußen gerichtet, antwortete Chris: »Das glaube ich nicht, Huff. Er hat jemanden dabei.«
»Und wen?«
»Keine Ahnung. Hab ich noch nie gesehen.«
Chris schenkte die Gläser ein und brachte eines davon seinem Vater, aber dann lauschten die drei schweigend, wie Selma auf das Läuten der Türglocke hin von der Küche auf der Rückseite der Villa zur Haustür ging. Die Haushälterin begrüßte die Besucher, aber der Wortwechsel war zu gedämpft, als dass man etwas verstanden hätte. Schritte näherten sich dem Fernsehzimmer. Dann erschien Selma in der Tür, gefolgt von den beiden Besuchern.
»Mr. Hoyle, Sheriff Harper möchte Sie sprechen.«
Huff machte ihr ein Zeichen, den Sheriff hereinzubitten.
Sheriff Red Harper war dreißig Jahre zuvor in sein Amt gewählt worden, nachdem Huff seine Kampagne massiv unterstützt und seinen Sieg sichergestellt hatte. Seither war der Sheriff dank Huffs Brieftasche im Amt geblieben.
Sein einst feuerrotes Haupthaar war matt geworden, so als wäre es auf seinem Kopf verrostet. Red Harper war fast einen Meter neunzig groß, aber so dünn, dass der dicke Ledergürtel mit den Insignien seines Amtes an ihm herabhing wie ein Fahrradschlauch an einem Zaunpfahl.
Er wirkte ausgelaugt, und das nicht nur wegen der Gluthitze draußen. Sein Gesicht war lang und hager, als hätten drei Jahrzehnte der Korruption und des schlechten Gewissens daran gezehrt. Sein jammervolles Auftreten war das eines Mannes, der sich unter Wert dem Teufel verkauft hatte. Er war ohnehin keine Frohnatur, doch als er jetzt ins Zimmer trat und den Hut absetzte, wirkte er noch niedergeschlagener als sonst.
Im Gegensatz dazu erschien der junge Officer an seiner Seite, den sie alle noch nie gesehen hatten, mitsamt seiner Uniform wie in ein Stärkebad getaucht. Er war so glatt rasiert, dass seine Wangen rosa leuchteten. Außerdem wirkte er angespannt und hellwach wie ein Sprinter vor dem Startschuss.
Red Harper begrüßte Beck mit einem knappen Nicken. Dann sah der Sheriff auf Chris, der neben Huffs Sessel stand. Schließlich blieben seine trüben Augen an Huff hängen, der in seinem Sessel sitzen geblieben war.
»Abend, Red.«
»Huff.« Statt Huff direkt anzusehen, senkte er den Blick auf die Hutkrempe, die er rastlos zwischen den Fingern drehte.
»Was zu trinken?«
»Nein danke.«
Huff war dafür bekannt, dass er für niemanden aufstand. Eine solche Respektsbezeugung blieb allein Huff Hoyle vorbehalten, das wusste jeder im Parish. Diesmal aber hielt Huff die Spannung nicht mehr aus, drückte die Fußstütze des Sessels nach unten und erhob sich.
»Was ist denn los? Und wer ist das?« Er musterte den blank gewienerten Begleiter von Kopf bis Fuß.
Red räusperte sich. Er ließ die Hand mit dem Hut sinken und klopfte nervös damit gegen den Schenkel. Erst nach einer halben Ewigkeit sah er Huff in die Augen. An alldem erkannte Beck, dass der Sheriff nicht nur hier war, um den monatlichen Scheck abzuholen, sondern aus gewichtigeren Gründen.
»Es ist wegen Danny…«, setzte er an.
2
Der Highway war kaum wiederzuerkennen. Unzählige Male hatte Sayre Lynch die Strecke zwischen dem New Orleans International Airport und Destiny zurückgelegt. Aber heute kam es ihr so vor, als würde sie ihn das erste Mal befahren.
Im Namen des Fortschritts war all das, was diese Gegend einst unverwechselbar gemacht hatte, zugebaut oder vernichtet worden. Der Charme des ländlichen Louisiana war dem grellen Kommerz geopfert worden. Kaum etwas Idyllisches oder Pittoreskes hatte die Zerstörungswut überstanden. Sie hätte überall in den USA sein können.
Wo sich einst nur kleine Familiencafés befunden hatten, gab es nun Fastfood-Läden. Hausgemachter Hackbraten und Muffaletta-Sandwiches waren durch Chicken Wings und Supersize-Meals ersetzt worden. Statt handgemalter Schilder leuchteten überall Neonröhren. Die täglich mit Kreide geschriebene Speisekarte war einer körperlosen Stimme hinter dem Drive-Through-Schalter gewichen.
Während der zehn Jahre ihrer Abwesenheit waren die mit spanischem Moos behangenen Bäume wegplaniert worden, um zusätzlichen Fahrspuren Platz zu machen. Nach der Verbreiterung wirkte das Flussdelta entlang der Straße längst nicht mehr so unermesslich und mysteriös. Die früher unwegsamen Sumpfgebiete waren jetzt von Auf- und Abfahrten eingefasst, auf denen sich SUVs und Lieferwagen drängten.
Erst jetzt begriff Sayre, wie tief ihr Heimweh saß. Gleichzeitig weckten die radikalen Veränderungen in der Landschaft nostalgische Erinnerungen an die Lebensart von früher. Sie sehnte sich nach dem Duftgemisch von Cayenne und Filé. Sie wünschte sich das Patois der Bedienungen zu hören, wenn sie Cajun-Gerichte auftrugen, die sich nicht innerhalb von drei Minuten zubereiten ließen.
Auch wenn die Superhighways die Reisezeit verkürzten, so wünschte sie sich doch die alte, ihr bekannte Allee zurück, die so dicht von Bäumen gesäumt gewesen war, dass sich die Laubkronen wie ein Baldachin über dem Asphalt geschlossen und ein spitzengeklöppeltes Muster aus Licht und Schatten auf den Asphalt gemalt hatten.
Sie sehnte sich danach, wie früher mit offenem Fenster fahren zu können und statt Auspuffgasen die weiche Luft einzuatmen, die nach Geißblatt und Magnolien und dem fruchtbaren Aroma der Sümpfe roch.
Die während des letzten Jahrzehnts vorgenommenen Veränderungen stachen ihr ins Auge und beleidigten ihre Erinnerungen an den Ort, an dem sie aufgewachsen war. Andererseits waren die Veränderungen in ihrem eigenen Leben nicht weniger einschneidend, wenn auch vielleicht nicht so offensichtlich.
Das letzte Mal hatte sie diese Straße in der Gegenrichtung befahren, fort von Destiny. An jenem Tag hatte sie sich mit jeder Meile Entfernung befreiter gefühlt, als würde sie sich immer und immer wieder wieder häuten und eine negative Aura nach der anderen abschütteln. Heute kehrte sie zurück, und die düstere Vorahnung beschwerte sie wie eine Bleiweste.
Ihr Heimweh allein hätte unmöglich so quälend sein können, dass sie noch einmal in diese Gegend zurückgekehrt wäre. Nur der Tod ihres Bruders Danny hatte sie dazu veranlassen können. Offenbar hatte er sich Huff und Chris widersetzt, so lange er konnte, und war ihnen dann auf die einzige Weise entkommen, die ihm seiner Meinung nach noch offen gestanden hatte.
Passenderweise sah sie als Erstes die Schlote, als sie sich den Randbezirken von Destiny näherte. Feindselig erhoben sie sich über die Stadt, groß und schwarz und hässlich. Qualm waberte über ihnen, wie an jedem anderen Tag des Jahres. Es wäre zu kostspielig und unwirtschaftlich gewesen, die Schmelzöfen zu löschen, obwohl es eine Verbeugung vor Dannys Tod bedeutet hätte. Wie sie Huff kannte, war es ihm gar nicht in den Sinn gekommen, seinem jüngsten Kind eine solche Ehre zu erweisen.
Auf der Werbetafel an der Stadtgrenze war zu lesen: »Willkommen in Destiny, der Heimat von Hoyle Enterprises.« Als könnte man darauf stolz sein, dachte sie. Ganz im Gegenteil. Huff hatte mit dem Guss von Rohrleitungen einen Haufen Geld gemacht, aber es war blutiges Geld.
Im Ort steuerte sie den Wagen durch jene Straßen, die sie zuerst auf dem Fahrrad erforscht hatte. Später hatte sie hier das Autofahren gelernt. Als Teenager war sie mit ihren Freundinnen darauf hin und her gefahren, immer auf der Suche nach Action, Jungs oder was sich sonst zum Zeitvertreib angeboten hatte.
Sie hörte die Orgelmusik schon, als sie noch einen ganzen Block von der First United Methodist Church entfernt war. Ihre Mutter, Laurel Lynch Hoyle, hatte die Orgel gestiftet. Auf den Pfeifen prangte eine Messingplakette zu ihrem Gedenken. Die Orgel, die einzige mechanische Orgel in Destiny, war der ganze Stolz der kleinen Gemeinde. Keine der katholischen Kirchen konnte mit so etwas aufwarten, und Destiny war überwiegend katholisch. Es war ein großzügiges und aufrichtig gemeintes Geschenk gewesen, aber es war ein weiteres Symbol dafür, dass die Hoyles über die Stadt und all ihre Bewohner herrschten und sich von niemandem übertreffen lassen wollten.
Wie herzzerreißend, dass diese Orgel nun ein Trauerlied für eines von Laurel Hoyles Kindern spielte, für ihren Sohn, der fünfzig Jahre zu früh und durch die eigene Hand gestorben war.
Sayre hatte die Nachricht am Sonntagnachmittag erhalten, als sie nach einem Meeting mit einem Kunden in ihr Büro zurückgekommen war. Gewöhnlich arbeitete sie sonntags nicht, aber dieser Kunde hatte nur an diesem Tag einen Termin frei gehabt. Julia Miller hatte erst kurz zuvor ihr fünfjähriges Jubiläum als Sayres Assistentin gefeiert. Sie hätte Sayre keinesfalls an einem Sonntag arbeiten lassen, ohne selbst ins Büro zu kommen. Während Sayres Besprechung mit ihrem Kunden hatte Julia Büroarbeiten erledigt.
Als Sayre ins Büro zurückgekommen war, hatte Julia ihr einen rosa Post-it gereicht. »Dieser Herr hat dreimal für Sie angerufen, Ms. Lynch. Er wollte Ihre Handynummer haben, aber die habe ich ihm nicht gegeben.«
Sayre warf einen Blick auf die Vorwahl, knüllte den Zettel zusammen und warf ihn in den Papierkorb. »Ich wünsche mit niemandem aus meiner Familie zu sprechen.«
»Es ist niemand aus Ihrer Familie. Er hat gesagt, dass er für Ihre Familie arbeitet. Und es sei sehr wichtig, dass er Sie so bald wie möglich spricht.«
»Ich spreche auch mit niemandem, der für meine Familie arbeitet. Sind noch mehr Nachrichten für mich da? Hat zufällig Mr. Taylor angerufen? Er wollte die Volants bis morgen schicken.«
»Es geht um Ihren Bruder«, platzte Julia heraus. »Er ist tot.«
Sayre blieb genau vor der Tür zu ihrem Privatbüro stehen. Mehrere lange Sekunden starrte sie durch die Fensterfront auf die Golden Gate Bridge. Nur die obersten Spitzen der orangefarbenen Träger stachen aus der dichten Nebeldecke. Das Wasser in der Bucht sah grau, kalt und düster aus. Wie eine böse Vorahnung.
Ohne sich umzudrehen, fragte sie: »Welcher?«
»Welcher was?«
»Bruder.«
»Danny.«
Danny, der in den letzten Tagen zweimal angerufen hatte. Danny, dessen Anrufe sie nicht entgegengenommen hatte.
Sayre drehte sich zu ihrer Assistentin um, die sie mitleidig ansah. Sie sagte behutsam: »Ihr Bruder Danny ist heute gestorben, Sayre. Ich wollte Ihnen das lieber persönlich und nicht am Handy sagen.«
Sayre atmete tief durch den Mund aus. »Wie?«
»Ich glaube, das sollten Sie diesen Mr. Merchant fragen.«
»Julia, bitte. Wie ist Danny gestorben?«
Sie senkte den Blick. »Anscheinend hat er sich umgebracht. Es tut mir leid.« Sie schluckte und ergänzte dann: »Mehr wollte mir Mr. Merchant nicht verraten.«
Daraufhin zog sich Sayre in ihr Büro zurück und schloss die Tür. Mehrmals hörte sie das Telefon im Vorzimmer läuten, aber Julia begriff, dass Sayre Zeit brauchte, um diese Nachricht zu verarbeiten, und stellte keinen der Anrufe durch.
Hatte Danny sie angerufen, um sich von ihr zu verabschieden? Falls ja, wie sollte sie dann damit weiterleben, dass sie sich geweigert hatte, mit ihm zu sprechen?
Nach etwa einer Stunde klopfte Julia zaghaft an ihre Tür. »Kommen Sie rein«, rief Sayre. Als Julia ins Zimmer trat, sagte Sayre: »Sie brauchen nicht zu bleiben, Julia. Gehen Sie nach Hause. Ich komme schon zurecht.«
Die Assistentin legte ein Blatt Papier auf ihren Schreibtisch. »Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Läuten Sie durch, wenn Sie mich brauchen. Kann ich Ihnen irgendwas bringen?«
Sayre schüttelte den Kopf. Julia zog sich zurück und schloss die Tür wieder. Auf dem Zettel, den sie hereingebracht hatte, waren Zeit und Ort der Bestattungsfeier notiert. Dienstagmorgen um elf.
Es hatte Sayre nicht überrascht, dass die Beerdigung so früh angesetzt war. Huff vergeudete prinzipiell keine Zeit. Er und Chris konnten es bestimmt kaum erwarten, die Sache über die Bühne und Danny unter die Erde zu bringen, damit sie so schnell wie möglich wieder zu ihrem gewohnten Leben zurückkehren konnten.
Andererseits kam es auch ihr zupass, dass die Bestattungsfeier schon so bald stattfinden sollte. Es hielt sie davon ab, sich lange den Kopf zu zerbrechen, ob sie hinfahren sollte oder nicht. Sie konnte nicht lange in ihrer Unentschlossenheit verharren, sondern war zu einer Entscheidung gezwungen.
Am Vortag hatte sie den Vormittagsflug über Dallas – Fort Worth nach New Orleans genommen und war am Spätnachmittag angekommen. Sie hatte einen Spaziergang durch das French Quarter gemacht, in einem Gumbo-Restaurant zu Abend gegessen und anschließend die Nacht im Windsor Court Hotel verbracht. Doch trotz aller Annehmlichkeiten, die das Luxushotel bot, hatte sie kaum ein Auge zugetan. Sie wollte nicht nach Destiny zurück. Auf keinen Fall. Es mochte eine idiotische Vorstellung sein, aber sie hatte Angst, in eine Falle zu tappen, aus der es kein Entrinnen gab, sodass sie für alle Zeiten in Huffs Klauen bleiben müsste.
Auch der anbrechende Tag hatte ihre Sorgen nicht vertrieben. Sie war aufgestanden, hatte sich für die Bestattungsfeier angezogen und sich auf den Weg nach Destiny gemacht, wo sie genau zu der Feier eintreffen und anschließend sofort wieder verschwinden wollte.
Die Menge der parkenden Autos drängte bereits aus dem überfüllten Parkplatz der Kirche in die angrenzenden Nebenstraßen. Sie musste mehrere Blocks von der Bilderbuchkirche mit den Buntglasfenstern und dem hohen, weißen Kirchturm entfernt parken. Gerade als sie unter das von Säulen getragene Vordach trat, begann die Kirchenglocke elf Uhr zu schlagen.
Verglichen mit draußen war es im Vorraum angenehm kühl, aber Sayre fiel auf, dass im Andachtsraum viele der Anwesenden kleine Papierfächer schwenkten, um die schwächelnde Klimaanlage zu unterstützen. Sie rutschte in die letzte Bank, während vorn der Chor die letzten Akkorde des Eröffnungsliedes sang und der Pastor an den Altar trat.
Während alle anderen den Kopf zum Gebet senkten, schaute Sayre auf den Sarg vor dem Altargeländer. Es war ein schlichter, versiegelter silberner Sarg. Das war gut so. Sie hätte es wohl nicht ertragen, Danny zum letzten Mal wie eine Wachspuppe in einem mit Satin ausgeschlagenen Sarg liegen zu sehen. Um nicht länger darüber zu sinnieren, konzentrierte sie sich auf das elegante, klare Arrangement von weißen Callas, das auf dem Sargdeckel lag.
Sie konnte weder Huff noch Chris in der Menge ausmachen, aber sie nahm an, dass beide in der ersten Bank saßen und angemessen trauernd dreinblickten. Bei der ganzen Heuchelei wurde ihr übel.
Sie wurde unter den noch lebenden Familienmitgliedern genannt. »Eine Schwester, Sayre Hoyle aus San Francisco«, dröhnte der Prediger.
Am liebsten wäre sie aufgestanden und hätte durch die Kirche gerufen, dass sie nicht mehr Hoyle hieß. Seit ihrer zweiten Scheidung verwendete sie ihren zweiten Vornamen, der zugleich der Mädchenname ihrer Mutter gewesen war. Irgendwann hatte sie ihren Namen offiziell in »Lynch« ändern lassen. Dieser Name stand auf ihrem College-Diplom, ihrer Geschäftspost, ihrem kalifornischen Führerschein und in ihrem Pass.
Sie war keine Hoyle mehr, aber sie zweifelte keine Sekunde daran, dass der Informant des Predigers absichtlich den falschen Nachnamen angegeben hatte.
Die Trauerrede stammte aus einem kirchlichen Predigtenbuch und wurde von einem Priester mit glänzendem Gesicht verlesen, der kaum volljährig wirkte. Seine Belehrungen waren an die Menschheit im Allgemeinen gerichtet. Danny als Individuum wurde kaum erwähnt, es gab kaum ein ergreifendes oder persönliches Wort, was umso trauriger war, als seine eigene Schwester sich geweigert hatte, mit ihm zu telefonieren.
Als der Gottesdienst unter dem Absingen von »Amazing Grace« schloss, war in der Trauergemeinde vereinzeltes Schniefen zu hören. Getragen wurde der Sarg von Chris, einem blonden, ihr unbekannten Mann und vier weiteren Männern, in denen sie leitende Angestellte von Hoyles Enterprises erkannte. Sie trugen den Sarg durch die Mittelreihe der Kirche nach draußen.
Weihevoll zog die Prozession an ihr vorbei, was ihr Gelegenheit gab, ihren Bruder Chris zu studieren. Er war genauso proper und gut aussehend wie damals und hatte immer noch die leicht verweichlichte Ausstrahlung eines Kinostars aus den dreißiger Jahren. Nur ein Menjou-Bärtchen fehlte ihm noch. Seine Haare waren immer noch schwarz wie Rabenschwingen, doch er trug sie kürzer als früher. Vorn hatte er sie mit Gel aufgestellt, ein eher hippes Styling für einen Mann von Ende dreißig, aber der Stil entsprach Chris. Seine Augen waren irritierend, weil die Pupillen in der dunklen Iris nicht zu erkennen waren.
Huff folgte dem Sarg als Erster. Selbst bei diesem Anlass umgab ihn eine Aura der Überheblichkeit. Er hatte die Schultern zurückgezogen und trug den Kopf hoch erhoben. Jeder Schritt war fest gesetzt, als wäre er ein Eroberer und besäße ein unveräußerliches Anrecht auf den Grund und Boden unter seinen Füßen.
Seine Lippen waren zu dem harten, dünnen, entschlossenen Strich zusammengeschmolzen, an den sie sich so gut erinnerte. Seine Augen glitzerten wie die schwarzen Knopfaugen eines Stofftiers. Sie waren trocken und klar; er hatte nicht um Danny geweint. Seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, war sein ehemals grau meliertes Haar zu einem strahlenden Weiß ausgebleicht, aber er trug es immer noch militärisch-präzise kurz. Um die Taille hatte er ein paar Pfund zugelegt, aber er wirkte so unerschütterlich wie damals.
Zum Glück wurde sie weder von Chris noch von Huff bemerkt.
Um der Menge und der Gefahr, erkannt zu werden, zu entgehen, schlich sie durch eine Seitentür ins Freie. Ihr Auto war das letzte in der Prozession zum Friedhof. Sie parkte in gebührendem Abstand zu dem Zelt, das über dem frisch ausgehobenen Grab errichtet worden war.
In düsteren Gruppen oder allein erstiegen die Menschen die kleine Anhöhe, wo die Grabandacht abgehalten würde. Die meisten Trauernden hatten ihren Sonntagsstaat angelegt, obwohl die Achseln schon von Schweißringen gezeichnet und die Hutbänder mit feuchten Flecken gesprenkelt waren. Die Füße klemmten in Schuhen, die wegen des seltenen Tragens viel zu eng waren.
Viele dieser Menschen kannte Sayre persönlich. Es waren Ortsansässige, die ihr ganzes Leben in Destiny verbracht hatten. Einige führten kleine Geschäfte, aber die meisten von ihnen arbeiteten auf die eine oder andere Art für die Hoyles.
Sie erblickte mehrere Lehrer aus dem Kollegium der hiesigen Schulen. Ihre Mutter hatte sich so sehr gewünscht, dass ihre Kinder auf die exklusivsten Privatschulen des Südens geschickt werden sollten, aber Huff hatte sich stur gestellt. Er wollte, dass sie in Zucht und Ordnung und unter seinem gestrengen Auge aufwuchsen. Immer wenn das Thema aufkam, sagte er: »An einem Internat für verhätschelte Weichlinge lernt man nicht, wie man sich im Leben durchschlägt.« Wie bei allen Meinungsverschiedenheiten hatte ihre Mutter schließlich mit einem resignierenden Seufzen eingelenkt.
Sayre blieb bei laufendem Motor in ihrem Wagen sitzen. Zum Glück war die Ansprache kurz. Sobald sie zu Ende war, kehrten die Trauernden zu ihren Autos zurück, bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, wie eilig sie es hatten.
Huff und Chris waren die Letzten, die dem Priester die Hand reichten und dann das Zelt verließen. Sayre beobachtete, wie sie in die wartende Limousine stiegen, die ihnen Weir’s Funeral Institute zur Verfügung gestellt hatte. Der greise Mr. Weir ging immer noch seinem Beruf als Bestatter nach, obwohl für ihn selbst der letzte Gang längst überfällig gewesen wäre.
Er öffnete Chris und Huff den Wagenschlag und blieb dann in diskreter Entfernung stehen, während sich die beiden kurz mit dem blonden Sargträger unterhielten. Als die Unterhaltung zu Ende war, stiegen sie in den Fond der Limousine, der Mann winkte ihnen nach, Mr. Weir setzte sich hinters Steuer und fuhr sie davon. Sayre war froh, dass sie endlich fort waren.
Sie wartete noch einmal zehn Minuten, bis sich die Trauergemeinde völlig zerstreut hatte. Dann erst stellte sie den Motor ab und stieg aus.
»Ihre Familie hat mich gebeten, Sie zur Beerdigungsfeier zu begleiten.«
Vor Schreck wirbelte sie so schnell herum, dass der staubige Schotter vor ihren Schuhen aufspritzte.
Er lehnte an der Heckstoßstange ihres Wagens. Das Jackett hatte er ausgezogen und über seinen Arm gelegt. Sein Schlips hing schief, der Kragen seines Hemdes stand offen, und er hatte die Ärmel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt. Außerdem hatte er eine Sonnenbrille aufgesetzt.
»Ich bin Beck Merchant.«
»Das habe ich mir gedacht.«
Sie hatte seinen Namen bisher nur gedruckt gesehen und sich gefragt, ob er ihn wohl französisch aussprach. Das tat er nicht. Und von den dunkelblonden Haaren über das entspannte Lächeln mit den blendend weißen Zähnen bis hin zum Schnitt seiner Hosen, der »Ralph Lauren« zu rufen schien, sah er so uramerikanisch aus wie ein gedeckter Apfelkuchen.
Ohne sich von ihrem schneidenden Tonfall einschüchtern zu lassen, sagte er: »Sehr erfreut, Ms. Hoyle.«
»Lynch.«
»Ich bitte meinen Fehler zu entschuldigen.« Er sagte dies mit vollendeter Höflichkeit, aber aus seinem Lächeln sprach leise Ironie.
»Gehört es auch zu Ihrem Job, Botschaften zu überbringen? Ich dachte, Sie wären Anwalt«, sagte sie.
»Anwalt, Laufbursche …«
»Henker.«
Er legte die Hand auf sein Herz und ließ ein noch breiteres Lächeln erstrahlen. »Sie überschätzen mich bei weitem.«
»Wohl kaum.« Sie knallte ihre Autotür zu. »Sie haben die Einladung überbracht. Richten Sie Huff aus, dass ich sie ausschlagen werde. Und jetzt wäre ich gern ein paar Minuten allein, um mich von Danny zu verabschieden.« Sie machte auf dem Absatz kehrt und ging die kleine Anhöhe hinauf.
»Lassen Sie sich Zeit. Ich warte.«
Sie drehte sich noch einmal um. »Ich werde nicht zu der verdammten Beerdigungsfeier gehen. Sobald ich hier fertig bin, fahre ich nach New Orleans zurück und nehme von dort aus den nächsten Flug nach San Francisco.«
»Das könnten Sie tun. Oder Sie könnten den Anstand wahren und auf der Beerdigungsfeier für Ihren Bruder erscheinen. Und später am Abend könnte sie der Firmenjet von Hoyle Enterprises nach San Francisco bringen, ohne dass Sie die Mühsal eines Linienfluges auf sich nehmen müssten.«
»Ich kann mir selbst einen Jet chartern.«
»Noch besser.«
Sie war geradewegs in die Falle getappt und hätte sich dafür ohrfeigen können. Kaum war sie eine Stunde in Destiny, schon fiel sie in alte Gewohnheiten zurück. Aber sie hatte gelernt, die Fallen zu erkennen und zu vermeiden.
»Nein danke. Adieu, Mr. Merchant.« Wieder ging sie die Anhöhe hinauf und auf das Grab zu.
»Glauben Sie, dass Danny sich umgebracht hat?«
Diese Frage war das Letzte, was sie aus seinem Mund erwartet hätte. Wieder drehte sie sich um. Er lehnte nicht länger lässig an der Stoßstange ihres Wagens, sondern war ein paar Schritte auf sie zugekommen, als wollte er ihre Reaktion auf seine überraschende Frage abschätzen.
»Sie etwa nicht?«
»Was ich glaube, zählt nicht«, sagte er. »Das Sheriffsbüro bezweifelt, dass es Selbstmord war.«
3
»Das wird Sie aufmuntern, Mr. Chris«, sagte Selma und bot ihm einen gefüllten Teller an.
»Danke.«
»Ihnen auch etwas, Mr. Hoyle?« Eigentlich hätte die Haushälterin heute nicht arbeiten sollen, aber sie hatte eine Schürze über ihr schwarzes Kleid gezogen. Außerdem trug sie immer noch den Hut, den sie während der Beerdigung aufgehabt hatte, was überhaupt nicht zu ihrer Schürze passte.
»Ich warte noch, Selma.«
»Haben Sie keinen Hunger?«
»Es ist zu heiß zum Essen.«
Der breite Balkon beschattete zwar die gesamte Veranda, aber auch das half kaum gegen die unentrinnbare Hitze. Deckenventilatoren drehten sich im Kreis, verquirlten aber nur heiße Luft. Immer wieder musste Huff mit einem Taschentuch sein verschwitztes Gesicht trockenreiben. Drinnen kühlte die Klimaanlage das Haus auf eine angenehme Temperatur, aber Huffs Ansicht nach gehörte es sich, dass er und Chris die Trauergäste bei ihrer Ankunft begrüßten und ihre Kondolenzen entgegennahmen, ehe sie die Ankommenden ins Haus baten.
»Rufen Sie einfach, Sir, falls Sie irgendwas brauchen, dann bringe ich es raus.« Die verheulten Augen trockentupfend, verschwand Selma durch die breite Haustür, die sie mit schwarzen Kreppbändern geschmückt hatte, im Haus.
Sie hatte sich dagegen gesträubt, dass ein Caterer für die Beerdigungsfeier angeheuert würde, weil sie es nicht ausstehen konnte, wenn jemand Fremdes in ihrer Küche hantierte. Aber Huff hatte darauf bestanden. Selma war nicht in der Verfassung, eine Feier zu schmeißen. Seit der Nachricht über Dannys Tod hatte sie immer wieder aus heiterem Himmel laut zu heulen begonnen, war auf die Knie gefallen und hatte mit gefalteten Händen Jesus um Gnade angefleht.
Sie arbeitete für die Hoyles, seit Huff vor fast vierzig Jahren Laurel als Braut über die Schwelle getragen hatte. Laurel war mit Hauspersonal groß geworden, weshalb es ihr ganz natürlich erschienen war, die Führung ihres Haushalts an Selma zu delegieren. Die Schwarze war damals schon eine mütterliche Frau in den besten Jahren gewesen; wie alt sie jetzt war, konnte man nur noch raten. Mittlerweile wog sie höchstens nur noch fünfundvierzig Kilo, aber sie war kräftig und zäh wie ein Weidenschössling.
Mit der Geburt der Kinder war Selma gleichzeitig deren Kindermädchen geworden. Als Laurel starb, hatte Danny als Jüngster sie am dringendsten gebraucht. Selma hatte ihn bemuttert, weshalb die beiden ein besonderes Band vereinte. Seinen Tod ging ihr sehr zu Herzen.
»Ich habe mir das Büfett im Esszimmer angesehen«, bemerkte Chris. Er stellte den Teller, den Selma ihm gebracht hatte, unangerührt auf einen Rattanbeistelltisch. »Da drin steht fast unanständig viel Essen und Schnaps, meinst du nicht auch?«
»Nachdem du in deinem ganzen Leben nicht einen Tag Hunger leiden musstest, kannst du das wohl kaum beurteilen.«
Insgeheim musste Huff zugeben, dass er vielleicht ein wenig übertrieben hatte. Aber er hatte wie ein Teufel geschuftet, um seinen Kindern nur das Beste zu bieten. Er würde nicht ausgerechnet bei der Beerdigungsfeier für seinen jüngsten Sohn anfangen zu knausern.
»Willst du mich wieder einmal daran erinnern, wie wenig ich all das zu schätzen weiß, was du mir mitgegeben hast, und dass ich im Gegensatz zu dir keine Ahnung habe, wie es ist, ohne das Allernotwendigste überleben zu müssen?«
»Ich bin froh, dass ich das musste. Nur weil ich mich damals ohne irgendwas habe durchs Leben schlagen müssen, war ich so fest entschlossen, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Nur so wurde ich zu dem, der ich heute bin. Und du bist nur dank mir der Mensch geworden, der du heute bist.«
»Entspann dich, Huff.« Chris setzte sich in einen der Schaukelstühle auf der Veranda. »Ich kenne deine Predigten auswendig. Ich habe sie mit der Muttermilch eingesogen. Wir brauchen sie nicht ausgerechnet heute durchzugehen.«
Huff spürte, wie sein Blutdruck auf ein weniger gefährliches Maß sank. »Nein, du hast Recht. Und jetzt raus aus dem Stuhl, da kommt noch mehr Besuch.«
Chris war wieder an seiner Seite, als sich das Paar der Verandatreppe näherte und zu ihnen heraufkam. »Wie geht’s, George? Lila. Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte Huff.
George Robson presste Huffs Rechte zwischen seine Hände. Sie waren feucht, fleischig und bleich. Wie alles an George, dachte Huff angewidert.
»Danny war ein feiner junger Kerl, Huff. Es gibt keinen feineren.«
»Da hast du Recht, George.« Er entzog ihm die Hand und unterdrückte in letzter Sekunde den Impuls, sie am Hosenbein abzuwischen. »Ich weiß es zu schätzen, dass du so denkst.«
»Was für eine tragische Geschichte.«
»Das ist es.«
Georges deutlich jüngere zweite Frau sagte nichts, aber Huff entging nicht, wie sie Chris einen neckischen Blick zuwarf, der sie daraufhin anlächelte und sagte: »Sie sollten diese hübsche Dame lieber nach drinnen und aus der Hitze schaffen, George. Sie sieht so süß aus, dass sie schmelzen könnte. Bedient euch am Büfett.«
»Da drin wartet auch jede Menge Gin, George«, sagte Huff. »Lass dir von einem dieser Barkeeper einen Großen mit einem Spritzer Tonic mixen.«
Der Mann wirkte geschmeichelt, dass Huff sich an seinen Lieblingsdrink erinnerte, und führte seine Gattin eilig ins Haus. Sobald die beiden außer Hörweite waren, wandte sich Huff an Chris. »Seit wann gehört Lila zu den deinen?«
»Seit letzten Samstagnachmittag, als George mit seinem Sohn aus erster Ehe beim Angeln war.« Lächelnd ergänzte er: »In dieser Hinsicht sind Zweitfrauen von Vorteil. Fast immer gibt es irgendwo Nachwuchs, der den Ehemann an mindestens zwei Wochenenden im Monat beschäftigt hält.«
Huff sah ihn finster an. »Wo wir gerade von Ehefrauen sprechen – hast du mit Mary Beth gesprochen, bevor oder nachdem du mit Lila Robson rumgemacht hast?«
»Ungefähr fünf Sekunden lang.«
»Du hast ihr das mit Danny erzählt?«
»Sobald sie sich gemeldet hatte, habe ich gesagt: ›Mary Beth, Danny hat sich umgebracht.‹ Worauf sie erwidert hat: ›Damit ist mein Anteil ab sofort noch größer.‹«
Huffs Blutdruck schoss wieder in die Höhe. »Ihr Anteil, leck mich doch. Das Mädel wird keinen Cent von meinem Geld sehen. Nicht solange sie dir nicht dein Recht zukommen lässt und in die Scheidung einwilligt. Und zwar jetzt. Nicht wann es ihr passt. Hast du sie nach den Scheidungspapieren gefragt, die wir ihr runtergeschickt haben?«
»Nicht direkt. Aber Mary Beth wird bestimmt keine Scheidungspapiere unterschreiben.«
»Dann hol sie zurück und schwängere sie.«
»Ich kann nicht.«
»Du willst nicht.«
»Ich kann nicht.«
Huff kniff die Augen zusammen. »Wie kommt’s? Gibt es da was, von dem ich nichts weiß?«
»Wir reden später darüber.«
»Wir reden jetzt darüber.«
»Das ist nicht der richtige Augenblick, Huff«, erklärte Chris nachdrücklich. »Außerdem läufst du schon wieder rot an, und wir wissen beide, was das für deinen Blutdruck bedeutet.« Er ging zur Tür. »Ich hole mir was zu trinken.«
»Warte. Sieh dir das an.«
Huff dirigierte Chris’ Blick auf die Auffahrt vor dem Haus. Dort ging Beck auf einen Wagen zu, der eben angehalten hatte. Er öffnete die Fahrertür und streckte seine Hand ins Wageninnere.
Sayre stieg aus, aber ohne sich von Beck helfen zu lassen. Im Gegenteil, sie sah aus, als würde sie ihm eine knallen, falls er sie zu berühren versuchte.
»Ich werd nicht mehr«, sagte Chris.
Er und Huff beobachteten, wie die beiden durch den Garten gingen und den Weg zum Haus einschlugen. Etwa auf halbem Weg hob Sayre den Kopf und schaute unter der Krempe ihres schwarzen Strohhutes hervor. Sobald sie ihn und Chris auf der Veranda stehen sah, bog sie seitwärts ab, wo ein Fußweg zur Rückseite des Hauses führte.
Huff sah ihr nach, bis sie hinter der Ecke verschwunden war. Er hatte nicht gewusst, was er von dem ersten Wiedersehen mit seiner Tochter seit zehn Jahren hätte erwarten sollen, aber er war stolz auf das, was er da sah. Sayre Hoyle – diese Namensänderungsgeschichte war doch Pferdescheiße – war eine gut aussehende junge Frau. Verdammt gut aussehend. Seiner Meinung nach war sie ihm wirklich gut geraten.
Beck kam die Stufen hoch und stellte sich zu ihnen.
»Ich bin beeindruckt«, sagte Chris. »Ich dachte, sie würde dich zur Hölle schicken.«
»Nah dran.«
»Was ist passiert?«
»Genau wie du gedacht hast, Huff, hatte sie vor, wieder abzureisen, ohne euch zu sehen.«
»Wie hast du sie dann hergekriegt?«
»Ich habe an ihren Familiensinn und ihren Anstand appelliert.«
Chris schnaubte abfällig.
»Hatte sie schon immer eine so spitze Zunge?«, fragte Beck.
Chris bestätigte das genau in dem Moment, als Huff sagte: »Sie war schon immer leicht reizbar.«
»Eine höfliche Umschreibung für ›Nervensäge‹.« Chris’ Blick ging über die Auffahrt. »Ich glaube, inzwischen sind alle eingetrudelt. Gehen wir rein und erweisen Danny die letzte Ehre.«
Das Haus war rappelvoll mit Gästen, was Beck nicht weiter überraschte. Wer auch nur entfernt mit den Hoyles bekannt oder verbunden war, ließ sich hier blicken, um des Toten zu gedenken.
Die leitenden und mittleren Angestellten aus der Fabrik waren mit ihren Frauen gekommen. Und nur ein paar Arbeiter, von denen Beck wusste, dass sie seit frühester Jugend in der Fabrik angestellt waren. Sie standen abseits der anderen Gäste, trugen Krawatten mit Gummiband zu ihren kurzärmligen Hemden, schienen sich in Huffs Haus fehl am Platz zu fühlen, balancierten verlegen ihre vollgeladenen Teller und gaben sich ansonsten Mühe, nirgendwo einen Fleck zu hinterlassen.
Dann waren da noch die Arschkriecher, die immer darauf bedacht waren, sich gut mit den Hoyles zu stellen, weil ihr Auskommen davon abhing. All die Politiker, Banker, Lehrer, Händler und Ärzte am Ort, die großzügig von Huff bedacht wurden. Falls jemand mit ihm über Kreuz geriet, konnte er sein Geschäft schließen. Das war kein geschriebenes Gesetz, trotzdem war diese Wahrheit tief in das Bewusstsein der Allgemeinheit gedrungen. Alle achteten darauf, sich ins Gästebuch einzutragen, damit Huff in dem unwahrscheinlichen Fall, dass sie nicht persönlich mit ihm sprechen sollten, nachsehen konnte, ob sie da gewesen waren.
Nur ganz wenige unter den Anwesenden waren wirklich wegen Danny gekommen, und sie hoben sich durch ihre aufrichtigen Trauermienen von den übrigen Gästen ab. Größtenteils standen sie in engen Gruppen zusammen und unterhielten sich traurig-gedämpft miteinander, hatten ihm, Chris oder Huff aber wenig zu sagen, sei es aus Angst oder Desinteresse. Nach der gebotenen höflichen Zeit der Anwesenheit verschwanden sie wieder.
Beck mischte sich unter die Gäste und nahm als Quasimitglied der Familie Beileidsbekundungen entgegen.
Sayre mischte sich ebenfalls unter die Gäste, ging ihm, Chris und Huff aber geschickt aus dem Weg und ignorierte sie, als wären sie Luft. Die Gäste mieden Sayre, solange diese nicht auf sie zuging, wie ihm auffiel. Es waren schlichte Kleinstadtbewohner. Sayre kam aus einer anderen Welt. Sie war zugänglich, aber viele schienen vor ihrer Weltgewandtheit zurückzuschrecken.
Nur ein einziges Mal schaffte er es, ihr in die Augen zu sehen. Sie hatte sich bei Selma untergehakt und mit ihr soeben den Hausflur durchquerte. Sayre tröstete die schluchzende Haushälterin, die den Kopf an Sayres Schulter gelegt hatte. Sie bemerkte, dass er sie beobachtete, schaute aber geradewegs durch ihn hindurch.
Nach etwa zwei Stunden begannen die Gäste, sich zu verabschieden. Beck stellte sich zu Chris, der gerade das Büfett abgraste. »Wo ist Huff?«
»Zum Rauchen im Fernsehzimmer. Der Schinken ist gut. Hast du ihn probiert?«
»Später vielleicht. Mit Huff alles in Ordnung?«
»Ich glaube, er ist nur müde. Die letzten Tage haben ihn ziemlich mitgenommen.«
»Wie steht es mit dir?«
Chris zuckte mit den Achseln. »Danny und ich hatten Differenzen, wie du weißt. Aber er war trotz allem mein Bruder.«
»Ich sehe mal nach Huff und überlasse es dir, den Gastgeber zu spielen.«
»Schönen Dank auch«, grummelte Chris.
»So schlimm ist es auch nicht. Da drüben steht Lila Robson.« Chris hatte mit seiner letzten Eroberung geprahlt und damit bestätigt, was Beck schon immer geahnt hatte – dass Lilas Ehemann ein Schlappschwanz war. »Sie sieht ein bisschen verloren aus, so als könnte sie Gesellschaft gebrauchen.«
»Nein, sie schmollt.«
»Und warum das?«
»Sie glaubt, ich will sie nur fürs Bett.«
»Wie kommt sie denn nur auf diese Idee?«, fragte Beck sarkastisch.
»Keine Ahnung. Gleich nachdem sie mir oben im Bad einen geblasen hat, hat sie angefangen zu nerven.« Chris sah auf seine Uhr. »Vor ungefähr zehn Minuten.«
Beck sah ihn an. »Das ist nicht dein Ernst.«
Chris’ Achselzucken war weder Ja noch Nein. »Sieh du nur nach Huff. Ich passe währenddessen auf, dass diese Hinterwäldler nicht das Familiensilber klauen.«
Huff lagerte in seinem Fernsehsessel und rauchte. Beck schloss die Tür hinter sich. »Stört es dich, wenn ich mich dazusetze?«
»Wer hat dich geschickt, Chris oder Selma? Sayre war es bestimmt nicht. Die würde sich bestimmt keine Sorgen um mich machen.«
»Ich kann nicht für sie sprechen.« Beck setzte sich aufs Sofa. »Aber ich mache mir Sorgen um dich.«
»Es geht mir gut.« Huff blies eine Rauchwolke zur Decke.
»Du machst ein tapferes Gesicht, aber du hast gerade deinen Sohn verloren. Das muss dir zusetzen.«
Der Ältere nahm schweigend ein paar Züge von seiner Zigarette und sagte dann: »Weißt du, ich glaube, Danny wäre Laurels Lieblingskind gewesen.«
Beck setzte sich auf und stützte die Unterarme auf die Knie. »Weil …?«
»Weil er genau wie sie war.« Er sah kurz zu Beck hinüber. »Habe ich dir je von Laurel erzählt?«
»Ich habe hier und da was aufgeschnappt.«
»Sie war genau das, was ich damals wollte, Beck. Nicht besonders helle. Aber Scheiße, wer will schon eine kluge Frau? Laurel war nachgiebig und süß und hübsch.«
Beck nickte. Auf dem Ölbild, das oben neben der Treppe hing, war eine nachgiebige, süße und hübsche Frau zu sehen. Aber irgendwie wurde er den Eindruck nicht los, dass Laurel Lynchs Anziehungskraft auch darauf beruht hatte, dass die Gießerei, in der Huff angestellt gewesen war, ihrem Daddy gehört hatte.
»Ich war grob und ungehobelt und derb. Sie war durch und durch eine Lady. Die immer wusste, welche Gabel sie nehmen musste.«
»Und wie hast du sie rumgekriegt, dich zu heiraten?«
»Ich habe sie überrumpelt.« Die Erinnerung ließ ihn leise lachen. »Ich sagte zu ihr: ›Laurel, du wirst meine Frau‹, und sie sagte: ›In Ordnung.‹ All die Männer, die ihr den Hof gemacht hatten, hatten sie wie auf Eierschalen umtanzt. Ich glaube, es gefiel ihr, dass ich so frech war.«
Er sah sinnend dem Rauch nach, der von seiner Zigarette aufstieg. »Du wirst es vielleicht nicht glauben, Beck, aber ich habe sie nie betrogen. Ich bin nie fremdgegangen. Nicht ein einziges Mal. Und auch nach ihrem Tod bin ich lange zu keiner anderen Frau gegangen. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihr das schuldig bin.«
Nach kurzem Nachdenken fuhr er fort: »Als sie schwanger wurde, platzte ich fast vor Stolz. Ich wusste vom ersten Moment an, dass sie einen Jungen bekommen würde. Es ging nicht anders. Chris gehörte mir von der Sekunde an, in der die Hebamme ihn aus ihrem Bauch gezogen und in meine Arme gelegt hatte. Damals durften die Väter noch nicht mit in den Kreißsaal. Aber nachdem ich die Angestellten mit einer riesigen Spende bestochen hatte, war man gleich bereit, mich zu ihr zu lassen. Ich wollte, dass mein Sohn als Erstes mein Gesicht sieht, wenn er diese Welt betritt.
Jedenfalls wollte ich Chris vom ersten Tag an für mich haben, und er war immer mein Sohn. Sayre konnte ich Laurel leichten Herzens überlassen. Sayre war ihr Püppchen, das sie in Rüschenkleider stecken, für das sie Teepartys veranstalten und das sie zum Voltigieren schicken konnte. Diesen ganzen Quatsch. Trotzdem hätte Laurel mächtig Ärger mit Sayre bekommen, wenn sie nicht so früh gestorben wäre. Teepartys sind nicht gerade Sayres Leidenschaft, oder?«
Beck bezweifelte das stark.
»Sie hat sich nicht die Bohne für die Dinge interessiert, die Laurel wichtig waren«, fuhr Huff fort. »Danny hingegen … den hätte seine Mutter vergöttert. Er ist – er war – der geborene Gentleman. Genau wie Laurel ist er hundert Jahre zu spät auf die Welt gekommen. Er hätte zu einer Zeit leben sollen, als alle weiß gekleidet herumspazierten, Krocketkugeln übers Gras schoben, immer saubere Fingernägel hatten und auf der Veranda Champagnercocktails nahmen. Als Müßiggang noch eine Kunstform war.«
Er sah zu Beck herüber, und die Zärtlichkeit, die während dieser Träumerei sein Gesicht gezeichnet hatte, verschwand augenblicklich. »Danny war nicht fürs Geschäft geschaffen. Schon gar nicht für unser Geschäft. Das war ihm viel zu schmutzig. Nicht sauber genug für Menschen wie ihn.«
»Er hat gute Arbeit geleistet, Huff. Die Arbeiter haben ihn geliebt.«
»Sie sollen uns aber nicht lieben. Sie sollen eine Scheißangst vor uns haben. Die Knie sollten ihnen schlottern, sobald wir auftauchen.«
»Ja, aber Danny war eine Art Puffer. Er hat ihnen bewiesen, dass wir auch Menschen sind. Jedenfalls bis zu einem gewissen Grad.«
Huff schüttelte den Kopf. »Quatsch, Danny war zu weich, um ein guter Geschäftsmann zu sein. Ein Waschlappen. Immer hat er demjenigen Recht gegeben, der das letzte Wort hatte. Er ließ sich viel zu leicht umstimmen.«
»Ein Charakterzug, den du oft für dich ausgenutzt hast«, rief ihm Beck ins Gedächtnis.
Huff schniefte zustimmend. »Verdammt noch mal, das kann ich nicht leugnen. Er wollte alle glücklich machen. Ich wusste das, und ich habe das zu meinem Vorteil ausgenutzt. Danny hat nur nie kapiert, dass man nicht alle glücklich machen kann. Sobald du das versuchst, kriegst du eins auf die Mütze.
Leider war ich nicht der Einzige, auf den er gehört hat. Ich will nicht schlecht über ihn sprechen, aber ich habe noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Ich kann den Charakter meiner Kinder ganz ehrlich einschätzen, und Danny war schwach.«
Beck widersprach zwar nicht, aber »schwach« war seiner Meinung nach nicht das richtige Wort, um Dannys Charakter zu beschreiben. Gut, er war seinen Gegnern nicht an die Gurgel gegangen, wie es sein Vater und sein Bruder taten und – ganz nebenbei – auch Beck selbst. Aber Sanftmut hatte ebenfalls Vorteile. Er machte einen nicht unbedingt schwach. Im Gegenteil, Danny hatte fest zu seiner Überzeugung gestanden, wo für ihn die Grenze zwischen Richtig und Falsch verlief.
Beck fragte sich, ob er vielleicht ein Opfer seiner strengen Moralvorstellungen geworden war.
Huff zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und drückte sie dann aus. »Ich sollte wieder zu meinen Gästen gehen.«
Sie standen auf, und Beck sagte: »Ich habe gestern Abend eine Akte auf den Schreibtisch in deinem Zimmer gelegt. Wahrscheinlich hattest du noch keine Zeit, einen Blick hineinzuwerfen.«
»Nein. Worum geht es?«
»Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen. Wir können später darüber sprechen.«
»Gib mir einen Hinweis.«
Beck wusste, dass Huff stets ein offenes Ohr für geschäftliche Dinge hatte, selbst an dem Tag, an dem er seinen Sohn zu Grabe trug. »Hast du schon mal von jemandem namens Charles Nielson gehört?«
»Glaube nicht. Wer ist das?«
»Ein Anwalt für Arbeitsrecht.«
»Saukerl.«
»Die zwei Worte sind Synonyme«, bestätigte Beck mit einem spröden Lächeln. »Er hat uns einen Brief geschrieben. Eine Kopie liegt der Akte bei. Ich muss wissen, wie ich darauf reagieren soll. Die Sache ist nicht dringlich, aber wir müssen uns damit befassen, also wirf möglichst bald einen Blick darauf.«
Seite an Seite gingen sie zur Tür. »Ist er gut, dieser Nielson?«
Beck zögerte. Als Huff das bemerkte, machte er eine Geste, die so viel bedeutete wie »Raus mit der Sprache«.
»Er hat in anderen Landesteilen einen ziemlich guten Ruf«, sagte Beck. »Aber wir werden schon mit ihm fertig.«
Huff schlug ihm auf den Rücken. »Ich vertraue dir voll und ganz. Wer dieser Hurensohn auch ist oder für wen er sich hält – wenn du mit ihm fertig bist, ist er nur noch ein Fliegenschiss an der Wand.«
Er öffnete die Tür zum Flur. Jenseits des breiten Korridors konnten sie in den Salon sehen, den Laurel wegen der teuren Fenster als Wintergarten eingerichtet hatte. Sie hatte ihn mit Farnen, Orchideen, Veilchen und anderen tropischen Pflanzen gefüllt. Der Raum war ihr ganzer Stolz gewesen und auch der des örtlichen Gartenvereins, den sie über viele Jahre geleitet hatte.
Nach ihrem Tod hatte Huff einen Gärtner in New Orleans beauftragt, einmal pro Woche nach Destiny zu kommen und die Pflanzen zu versorgen. Er zahlte ein üppiges Honorar, hatte aber zugleich damit gedroht, die Firma zu verklagen, falls die Pflanzen eingehen sollten. Der Raum war immer noch der schönste im ganzen Haus und wurde gleichzeitig am seltensten genutzt. Die Männer, die hier wohnten, betraten ihn so gut wie nie.
Im Moment jedoch hielt sich jemand darin auf. Sayre saß an dem kleinen Flügel, den Rücken ihnen zugewandt, den Kopf über die Tasten gebeugt.
»Kannst du sie dazu kriegen, mit mir zu reden, Beck?«
»Ich konnte sie kaum dazu bekommen, mit mir zu reden.«
Huff schubste ihn durch die Tür. »Lass deinen Charme spielen.«
4
»Spielen Sie?«
Sayre drehte sich um. Die Hände in den Hosentaschen vergraben, kam Beck Merchant ins Zimmer geschlendert. Als er vor ihrer Klavierbank angelangt war, tat er so, als erwartete er, dass sie zur Seite rutschte und ihm Platz machte. Sie reagierte nicht auf die stumme Aufforderung und blieb eisern sitzen.
»Etwas würde ich gern wissen, Mr. Merchant.«
»Ich auch. Nämlich warum Sie mich nicht Beck nennen.«
»Woher wusste Huff, dass ich auf der Beerdigung war? Hat man ihm vorher Bescheid gegeben, dass ich kommen würde?«
»Er hat gehofft, dass Sie kommen, war sich aber nicht sicher. Wir haben alle nach Ihnen Ausschau gehalten.«
»In der Kirche haben weder er noch Chris erkennen lassen, dass sie mich bemerkt haben.«
»Aber das haben sie.«
»War es meine Aura?«
»So was in der Art. Nennen Sie es Familieninstinkt.« Er verstummte, als erwartete er, dass sie lachte. Als nichts dergleichen geschah, sagte er: »Im Ernst, haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten sich mit einer Sonnenbrille und einem Hut unkenntlich machen?«
»Ich wusste, dass viele Leute zu der Beerdigung kommen würden. Ich hatte gehofft, in der Menge zu verschwinden.«
Wieder schwieg er kurz, ehe er sagte: »Ich glaube nicht, dass Sie in irgendeiner Menge verschwinden könnten, Sayre.«
Es war ein subtiles Kompliment, voller unterschwelliger Andeutungen. Sie hatte keine Schmeicheleien provoziert und wollte keine hören, darum würde sie ihn enttäuschen, falls er dafür ein dahingehauchtes »Danke« erwartete.
»Ohne den Hut hätten Huff und Chris sie sofort bemerkt«, sagte er. »Selbst ich hätte Sie bemerkt, und ich kenne Sie nicht einmal.«
Ihr Hut hatte ihr irgendwann Kopfschmerzen gemacht, deshalb hatte sie ihn abgesetzt. Außerdem hatte sie ihre Haarspange gelöst und die Haare frei fallen lassen. In der feuchten Luft waren ihre Naturlocken, die sie jeden Morgen mit Fön und Spray bändigen musste, sofort hochgesprungen. Wenige Minuten zuvor bei einem zufälligen Blick in den Spiegel im Flur war ihr aufgefallen, dass ihre Haare wieder zu der eigensinnigen Mähne geworden waren, die sie schon als Kind gehabt hatte.
Die Sonne, die durch die hohen Fenster im Wintergarten ihrer Mutter schien, verfing sich in jeder Strähne und setzte sie in leuchtende Flammen. Die Art, wie Beck Merchant das Farbenspiel in ihren Haaren beobachtete, ließ sie wünschen, im Schatten zu sitzen.
Außerdem gefiel es ihr gar nicht, dass sie den Kopf in den Nacken legen musste, um zu ihm aufzusehen. Die Alternative war, mit seiner Gürtelschnalle zu sprechen. Sie rutschte ans andere Ende der Klavierbank, um sich möglichst schnell zu verziehen. »Entschuldigen Sie mich.«
»Interessanter Name.«
Sie blieb verblüfft sitzen und sah über die Schulter zurück. »Verzeihung?«
»Sayre. Wer hat Sie so getauft?«
»Meine Mutter.«
»Kommt der Name in Ihrer Familie öfter vor?«
»Er hat Tradition. Ihre Großmutter väterlicherseits hieß ebenfalls so.«
»Er gefällt mir.«
»Danke. Mir auch.«
»Als ich anfing, für Ihre Familie zu arbeiten, wusste ich ewig lange nicht, wie ich ihn aussprechen sollte.«
»Wie er geschrieben wird.«
»Dann müsste man ihn S-a-y-e-r schreiben und nicht r-e.«
»Ist das wirklich von Bedeutung?«
»Offenbar nicht.«
Sie wollte endlich aufstehen, aber er hielt sie erneut auf. »Sie
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »White Hot« bei Simon & Schuster Inc. New York.
1. Auflage Taschenbuchausgabe Juni 2008 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © Sandra Brown Management Ltd., 2007
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH. Umschlaggestaltung: HildenDesign, München unter Verwendung des Originalcovers von Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, München – Zürich und unter Verwendung eines Motivs von Getty Images/Stone/Carlos Casariego MD · Herstellung: Heidrun Nawrot Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-10343-9
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Leseprobe