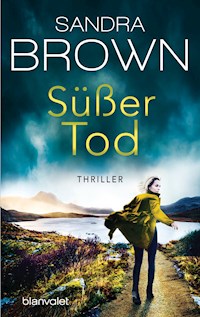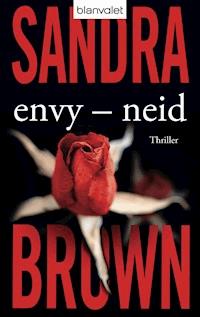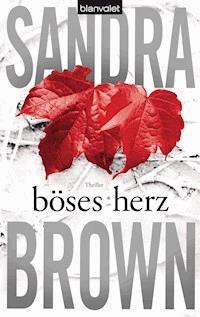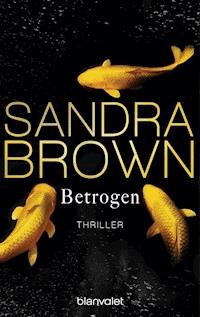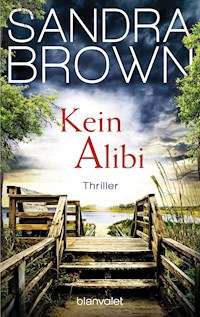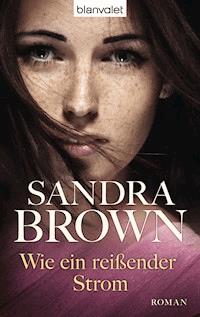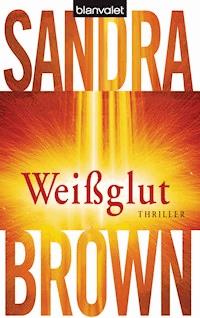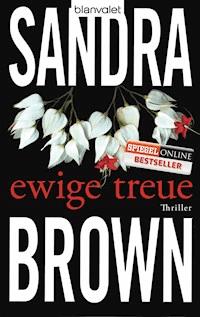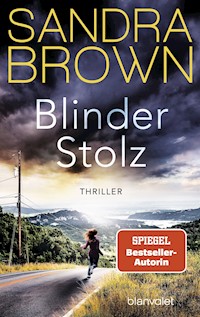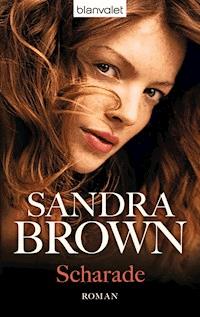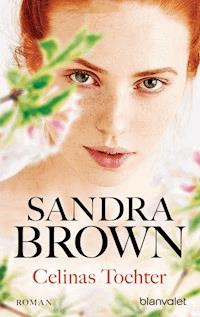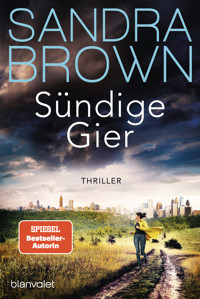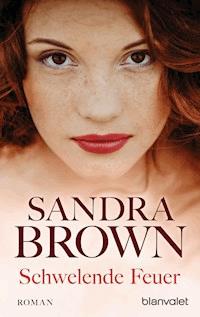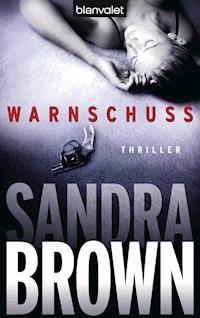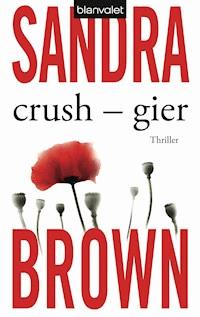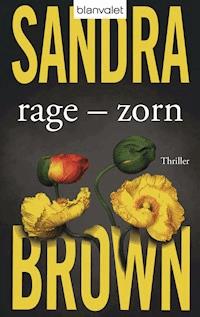9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist kälter als der Tod?
Noch nie im Leben hatte Lilly Martin solche Angst! Nicht vor dem Jahrhundertsturm, der vor ihrer Berghütte tobt und die sonst so friedliche Landschaft unbarmherzig in eine Eiswüste verwandelt, sondern vor dem Mann, der verletzt und blutig den Unterschlupf mit ihr teilt. Im letzten Sommer hatten seine heißen Blicke ihr Herz schneller klopfen lassen, doch nun muss sie befürchten, dass Ben Tierney ein skrupelloser Serienkiller ist. Soll sie sein nächstes Opfer werden? Oder ist er ihre einzige Hoffnung auf ein Überleben? Schon bald weiß Lilly nicht mehr, ob sie Verstand oder Instinkt trauen soll ...
Lassen Sie sich von weiteren romantischen Thrillern von SPIEGEL-Bestsellerautorin Sandra Brown fesseln und lesen Sie auch »Verhängnisvolle Nähe«, »Blinder Stolz« und »Sein eisiges Herz«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Zum letzten Mal wirft Lilly Martin einen Blick auf die Hütte in den verschneiten Bergen von North Carolina. Dutch, ihr Ex-Mann, ist schon nach Cleary zurückgekehrt, wo er als Polizeichef die Suche nach einem verschwundenen Mädchen leitet. Wie bei den früheren Vermisstenfällen gibt es auch diesmal keinerlei Anhaltspunkte – außer einem blauen Band an der Stelle, an der man das Mädchen zum letzten Mal gesehen hat. Lilly will weg von dem Leben mit ihrem hitzköpfigen Ex-Mann; sie will nur noch dem aufziehenden Eissturm zuvorkommen und den spiegelglatten Weg nach Atlanta sicher hinter sich bringen.
Da, ein Schatten, der unvermittelt aus dem Wald auftaucht. Ein Schlag gegen das Auto. Das ist das Letzte, woran sich Lilly erinnert, bevor ihr Wagen gegen einen Baum kracht. Als sie wieder zu sich kommt, stellt sie fest, dass sie einen Mann angefahren hat.
Das Wetter lässt Lilly und dem verletzten Wanderer Ben Tierney keine andere Möglichkeit, als in ihrer Berghütte Schutz vor dem Blizzard zu suchen. Die Spannung zwischen ihnen ist beinache mit Händen greifbar, war es doch ausgerechnet Tierney, der Lilly im letzten Sommer in eine heiße Affäre verwicklet hat. Doch jetzt hüten beide misstrauisch ihre Geheimnisse – bis Lilly ein blaues Band bei Ben findet. Noch kann sie nicht glauben, dass er der gesuchte Mädchenmörder ist. Wie mit kristallscharfen Nadelstichen kriecht die Angst ihren Rücken hinab. Ist der Einzige, der sie in diesem tödlichen Sturm retten kann, gleichzeitig derjenige, dersie in höchste Gefahr bringt ...
Autorin
Sandra Brown ist eine der erfolgreichsten internationalen Autorinnen, die mit jedem ihrer Bücher die Spitzenplätze der »New-York-Times«-Bestseller-liste erreicht! Sie lebt mit ihrer Familie abwechselnd in Texas und South Carolina.
Weiter Informationen finden Sie unter: www.sandra-brown.de
Inhaltsverzeichnis
Das Grab war nur ein Provisorium.
Der vorhergesagte Sturm sollte alle Rekorde brechen.
Das Grab für Millicent Gunn – achtzehn Jahre, kurzes, braunes Haar, graziler Körperbau, ein Meter fünfundsechzig, vor einer Woche vermisst gemeldet – war kaum mehr als eine flache Kuhle, die man dem unnachgiebigen Erdboden abgerungen hatte. Es war gerade so lang, dass das Mädchen hineinpasste. Das Problem mit der mangelnden Tiefe könnte man im Frühling beheben, sobald das Erdreich zu tauen begann. Falls die Aasfresser den Leichnam nicht schon vorher beseitigt hatten.
Ben Tierney lenkte den Blick von dem frischen Grab auf die anderen daneben. Vier insgesamt. Windbruch und Totholz boten eine natürliche Tarnung, und doch veränderte jedes davon auf ganz eigene Weise die zerklüftete Topografie; man musste nur wissen, worauf man zu achten hatte. Über eines war ein toter Baum gestürzt, unter dem es nur für jemanden mit geschultem Blick zu erkennen war.
Für jemanden wie Tierney.
Er warf einen letzten Blick in das leere, flache Grab, hob dann die Schaufel zu seinen Füßen auf und trat einen Schritt zurück. Dabei bemerkte er die dunklen Abdrücke, die seine Stiefel in der weißen Decke aus Hagelkörnern hinterließen. Das war nicht weiter schlimm. Wenn die Meteorologen Recht behielten, wären die Stiefelspuren bald von tiefem Schnee oder Eisregen bedeckt. Und wenn der Boden wieder taute, würden die Abdrücke im Schlamm versinken.
Jedenfalls hielt er nicht an, um sie zu verwischen. Er musste ins Tal hinunter. Sofort.
Den Wagen hatte er ein paar hundert Meter vom Gipfel und dem provisorischen Friedhof entfernt auf der Straße abgestellt. Folglich ging es zwar bergab, doch er musste sich mühsam durch den dichten Wald schlagen. Das dichte Unterholz verhinderte, dass der Boden schlüpfrig wurde, aber das Terrain war uneben und gefährlich, vor allem weil ihm der Hagel ins Gesicht prasselte und ihm die Sicht nahm. Obwohl er es eilig hatte, war er gezwungen, jeden Schritt mit Bedacht zu setzen, um einen Fehltritt zu vermeiden.
Der Wetterbericht hatte diesen Sturm seit Tagen vorhergesagt. Es handelte sich um ein Zusammentreffen mehrerer Wetterfronten, die zusammengenommen das Potenzial hatten, einen der schlimmsten Schneestürme in der jüngeren Geschichte zu bilden. Der Bevölkerung im mutmaßlich betroffenen Gebiet wurde geraten, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, sich mit Proviant einzudecken und alle unnötigen Reisen zu unterlassen. Nur ein Irrer hätte sich heute auf den Berg gewagt. Oder jemand, der etwas zu erledigen hatte, was keinen Aufschub duldete.
Wie Tierney.
Der kalte Nieselregen, der am frühen Nachmittag eingesetzt hatte, war inzwischen in einen mit Hagel vermischten Eisregen übergegangen. Die Körner brannten wie Schrot auf seinen Wangen, während er sich durchs Dickicht schlug. Er zog die Schultern hoch und klappte den Mantelkragen nach oben, damit er die Ohren bedeckte, die vor Kälte schon taub waren.
Die Windgeschwindigkeit hatte merklich zugenommen. Die von wütenden Böen geprügelten Bäume schlugen die nackten Äste gegeneinander wie Trommelstöcke. Der Wind zerrte die Nadeln von den Nadelbäumen und peitschte sie durch die Luft. Eine blieb wie ein Dartpfeil in seiner Wange stecken.
Fünfunddreißig Stundenkilometer aus nordwestlicher Richtung, dachte er mit jenem Teil seines Gehirns, der automatisch den Zustand seiner Umgebung registrierte. Er wusste solche Dinge – Windgeschwindigkeit, Zeit, Temperatur, Richtung – instinktiv, als hätte er in seinem Körper eine Wetterstation, eine Uhr, ein Thermometer und ein GPS, die sein Unterbewusstsein unablässig mit sachdienlichen Informationen fütterten.
Es war eine angeborene Gabe, die er zur Kunst verfeinert hatte, indem er sich als Erwachsener viel draußen aufgehalten hatte. Er musste diese ständig wechselnden Umweltdaten nicht bewusst abrufen, trotzdem verließ er sich oft auf seine Fähigkeit, im Notfall sofort darauf zurückgreifen zu können.
Jetzt zum Beispiel verließ er sich darauf, denn es wäre ungut, auf dem Gipfel des Cleary Peak erwischt zu werden – dem zweithöchsten Berg in North Carolina nach dem Mount Mitchell –, während er sich mit einer Schaufel in der Hand im Laufschritt von vier alten Gräbern und einem frisch ausgehobenen entfernte.
Die örtliche Polizei war nicht gerade berühmt für ihre hartnäckigen Ermittlungen und ihre phänomenale Aufklärungsquote. Im Gegenteil, das örtliche Police Department war ein Witz. Der Chief war ein Großstadtdetective auf dem absteigenden Ast, den man aus seinem früheren Department rausgeworfen hatte.
Chief Dutch Burton führte eine Riege unfähiger Kleinstadtpolizisten – Dorfdeppen in geschniegelten Uniformen und mit funkelnden Polizeimarken –, die schon fast überfordert gewesen waren, den Sprayer zu fangen, der die Müllcontainer hinter der Texaco-Tankstelle mit Obszönitäten besprüht hatte.
Jetzt konzentrierten sie sich auf die fünf ungeklärten Vermisstenfälle. Trotz ihrer Beschränktheit waren die Gesetzeshüter von Cleary zu dem Schluss gelangt, dass es höchstwahrscheinlich doch kein Zufall war, wenn in einer kleinen Gemeinde innerhalb von zweieinhalb Jahren insgesamt fünf Frauen verschwanden.
In einer Großstadt wäre diese Statistik von anderen, grausigeren überschattet worden. Aber hier, in dieser bergigen, dünn besiedelten Gegend schlugen die Wogen hoch, wenn fünf Frauen verschwanden.
Außerdem herrschte allgemein die Auffassung, dass die vermissten Frauen einem Verbrechen zum Opfer gefallen waren, weshalb sich die Behörden darauf konzentrierten, menschliche Überreste und nicht die Frauen selbst zu finden. Es würde jedenfalls Verdacht erregen, wenn jemand mit einer Schaufel durch den Wald spazierte.
So wie Tierney.
Bis jetzt hatte er das Radar unterfliegen können und es vermieden, die Neugier von Police Chief Burton auf sich zu ziehen. Es war extrem wichtig, dass das so blieb.
Im Rhythmus seiner Schritte rekapitulierte er die wichtigsten Daten der Frauen, die in den Gräbern unter dem Gipfel lagen. Carolyn Maddox, eine Sechsundzwanzigjährige mit tiefem Busen, schönem schwarzem Haar und großen braunen Augen. Seit letztem Oktober vermisst gemeldet. Sie war die alleinerziehende Mutter eines zuckerkranken Kindes und hatte in einer der kleinen Pensionen am Ort als Zimmermädchen gearbeitet. Ihr Leben war ein freudloser, endloser Reigen aus Mühsal und Erschöpfung gewesen.
Jetzt hatte Carolyn Maddox umso mehr Frieden und Ruhe. Genau wie Laureen Elliott. Blond, übergewichtig und alleinlebend, hatte sie als Krankenschwester in einer örtlichen Klinik gearbeitet.
Betsy Calhoun, eine verwitwete Hausfrau, war die Älteste.
Torrie Lambert, die Jüngste, war außerdem die Erste, die Hübscheste und die Einzige, die nicht aus Cleary stammte.
Tierney ging schneller, als könnte er seinen verstörenden Gedanken ebenso entfliehen wie dem Wetter. Eine dünne Eisschicht begann die Zweige mit langen Ärmeln zu überziehen. Die Steine bekamen eine Glasur. Die steile, gewundene Straße nach Cleary hinunter wäre schon bald unpassierbar, und er musste um jeden Preis von diesem gottverfluchten Berg verschwinden.
Zum Glück ließ ihn sein eingebauter Kompass nicht im Stich, er trat keine zehn Meter von der Stelle entfernt aus dem Wald, an der er ihn betreten hatte. Es überraschte ihn nicht, dass sein Wagen mit einer dünnen Eis- und Graupelschicht überzogen war.
Schwer atmend und dicke Dampfwolken in die kalte Luft blasend näherte er sich dem Auto. Der Abstieg vom Gipfel war kräftezehrend gewesen. Vielleicht waren sein schwerer Atem und der rasende Puls aber auch ein Zeichen seiner Angst. Oder seiner Frustration. Oder seiner Reue.
Er legte die Schaufel in den Kofferraum. Dann schälte er die Latexhandschuhe ab, die er getragen hatte, warf sie ebenfalls in den Kofferraum und schlug die Klappe zu. Er stieg ein, schloss hastig die Tür und genoss den ersehnten Schutz vor dem beißenden Wind.
Bibbernd blies er in die Hände und rieb sie kräftig, in der Hoffnung, das Blut in seine Fingerspitzen zurückzutreiben. Die Latexhandschuhe musste er tragen, aber sie schützten nicht vor der Kälte. Er zog ein Paar mit Kaschmirwolle gefütterte Lederhandschuhe aus der Manteltasche und streifte sie über.
Dann drehte er den Zündschlüssel.
Keine Reaktion.
Er drückte mehrmals aufs Gaspedal und probierte es wieder. Der Motor keuchte nicht einmal. Nach mehreren erfolglosen Versuchen lehnte er sich zurück und starrte auf die Anzeigen im Armaturenbrett, als erwartete er, sie würden ihm mitteilen, was er falsch machte.
Ein letztes Mal drehte er den Schlüssel, aber der Motor blieb stumm und tot wie die Frauen, die so respektlos in der Erde verscharrt worden waren.
»Scheiße!« Er donnerte beide behandschuhten Fäuste aufs Lenkrad und starrte durch die Scheibe, ohne etwas zu erkennen. Der Eisfilm hatte die Windschutzscheibe komplett überzogen. »Tierney«, murmelte er, »du bist am Arsch.«
Der Wind ist stärker geworden, und draußen kommt so Eiszeugs runter.« Dutch Burton ließ den Vorhang wieder vor das Fenster fallen. »Wir sollten lieber bald runterfahren.
»Ich muss nur noch ein paar Fächer leer räumen, dann bin ich fertig.« Lilly zog mehrere Leinenbände aus dem eingebauten Bücherregal und stapelte sie in eine Umzugskiste.
»Du hast immer geschmökert, wenn wir hier oben waren.«
»Da hatte ich Zeit, die neuesten Bestseller zu lesen. Hier hat mich nichts abgelenkt.«
»Außer mir, schätze ich«, sagte er. »Ich kann mich gut erinnern, wie ich dich gepiesackt habe, bis du dein Buch beiseitegelegt und dich mit mir beschäftigt hast.«
Sie sah von ihrem Sitzplatz auf dem Boden zu Dutch auf und lächelte. Aber sie weigerte sich, in Erinnerungen daran zu schwelgen, wie sie ihre Freizeit in der Berghütte verbracht hatten. Ursprünglich waren sie hergekommen, um an den Wochenenden und in den Ferien dem hektischen Leben in Atlanta zu entfliehen.
Später wollten sie hier allem entfliehen.
Sie war dabei, all das einzupacken, was sie an persönlichen Dingen mitnehmen würde, wenn sie heute abfuhr. Sie würde nicht wieder herkommen. Genauso wenig wie Dutch. Dies war das Schlusskapitel – genauer gesagt der Epilog – zu ihrem gemeinsamen Leben. Sie hatte gehofft, dass ihr letzter Abschied so unsentimental wie möglich vonstatten gehen würde. Er schien entschlossen, noch einmal die Straße der Erinnerungen zu beschreiten.
Es war ihr gleich, ob er die vergangenen Zeiten heraufbeschwor, damit er sich besser fühlte, oder ob er es tat, damit sie sich schlechter fühlte. Sie würde dieses Spiel nicht mitspielen. Ihre guten gemeinsamen Zeiten wurden so von den schlechten überschattet, dass jede Erinnerung alte Wunden aufreißen musste.
Sie lenkte das Gespräch auf pragmatischere Themen zurück. »Ich habe alle Verkaufsdokumente kopiert. Sie sind in dem Umschlag, zusammen mit einem Scheck über deine Hälfte des Verkaufserlöses.«
Er sah auf den hellbraunen Umschlag, ließ ihn aber auf dem Couchtisch aus Eichenholz liegen, wo sie ihn abgelegt hatte. »Das ist nicht fair. Dass ich die Hälfte bekomme.«
»Dutch, wir haben das schon besprochen.« Sie klappte die vier Laschen des Umzugskartons nach innen, um ihn zu verschließen, und wünschte im selben Moment, sie könnte dieses Gespräch genauso leicht abschließen.
»Du hast die Hütte bezahlt«, sagte er.
»Wir haben sie gemeinsam gekauft.«
»Aber dein Gehalt hat das erst möglich gemacht. Mit meinem allein hätten wir sie uns nicht leisten können.«
Erst als sie den Karton über den Boden zur Tür geschoben hatte, stand sie auf und drehte sich um. »Wir waren verheiratet, als wir sie gekauft haben, und wir waren verheiratet, als wir hier waren.«
»Verheiratet, als wir uns hier geliebt haben.«
»Dutch …«
»Verheiratet, als du mir morgens den Kaffee ans Bett gebracht hast und nichts als ein Lächeln und diese Decke am Leib hattest«, sagte er und deutete dabei auf die Häkeldecke über der Rückenlehne des Sessels.
»Bitte tu das nicht.«
»Das ist mein Text, Lilly.« Er machte einen Schritt auf sie zu. »Tu das nicht.«
»Wir haben es schon getan. Vor sechs Monaten.«
»Du könntest es rückgängig machen.«
»Du könntest dich damit abfinden.«
»Ich werde mich nie damit abfinden.«
»Nur weil du es nicht willst.« Sie verstummte, holte tief Luft und senkte dann die Stimme. »Du wolltest dich nie damit abfinden, Dutch. Du sperrst dich gegen jede Veränderung. Und genau deshalb kommst du nie über irgendwas hinweg.«
»Ich will nicht über dich hinwegkommen«, widersprach er.
»Das musst du aber.«
Sie wandte sich von ihm ab, schleifte einen leeren Karton vor das Bücherregal und begann, ihn mit Büchern zu füllen, wobei sie diesmal weniger sorgfältig war als beim ersten Karton. Inzwischen wollte sie nur noch weg von hier, sonst wäre sie gezwungen, ihn noch mehr zu verletzen, um ihn zu überzeugen, dass ihre Ehe endgültig und unwiderruflich zu Ende war.
Die minutenlange angespannte Stille wurde vom Rauschen des Windes in den Bäumen rund ums Haus untermalt. Immer häufiger und immer kräftiger schlugen die Äste gegen den Giebel.
Sie wünschte, er würde vor ihr abfahren, denn es wäre ihr lieber, dass er nicht mehr da war, wenn sie die Hütte verließ. Sie wusste, dass es das letzte Mal wäre und er möglicherweise von seinen Emotionen überwältigt würde. Sie hatte solche Szenen schon öfter erlebt und wollte keine weitere erleben. Ihr Abschied brauchte nicht bitter und hässlich zu werden, aber Dutch steuerte direkt darauf zu, indem er alte Streitpunkte zu neuem Leben erweckte.
Obwohl er eindeutig das Gegenteil beabsichtigte, unterstrich die Tatsache, dass er diese Auseinandersetzungen wieder aufwärmte, wie richtig ihre Entscheidung war, diese Ehe zu beenden.
»Ich glaube, dieser Louis L’Amour gehört dir.« Sie hielt ein Buch hoch. »Willst du ihn haben, oder soll ich ihn den neuen Eigentümern überlassen?«
»Die kriegen sowieso alles«, antwortete er düster. »Da macht ein Taschenbuch mehr oder weniger keinen Unterschied.«
»Es war einfacher, die Möbel zusammen mit der Hütte zu verkaufen«, sagte sie. »Die Einrichtung wurde extra für diese Hütte angefertigt und würde in jeder anderen Wohnung deplatziert wirken. Und was hätte ich damit anfangen sollen, wo keiner von uns Platz dafür hat? Alles herausräumen, nur damit wir es jemand anderem verkaufen können? Und wo hätte ich die Möbel bis dahin untergestellt? Es war nur vernünftig, die Hütte mit allem Inventar zu verkaufen.«
»Darum geht es nicht, Lilly.«
Sie wusste, worum es ihm ging. Er wollte sich nicht vorstellen müssen, dass Fremde in ihrer Hütte wohnten und ihre Sachen benützten. Alles unberührt zu hinterlassen, damit es ein anderer genießen konnte, erschien ihm wie ein Sakrileg, eine Entehrung der vertrauten und intimen Momente, die sie in diesen Räumen geteilt hatten.
Es ist mir egal, ob es vernünftig ist, den ganzen Klumpatsch zu verscheuern, Lilly! Ich pfeif auf vernünftig! Wie kannst du den Gedanken ertragen, dass fremde Leute in unserem Bett und unter unserer Decke schlafen?
So hatte er reagiert, als sie ihm erklärte, was sie mit der Einrichtung vorhatte. Offenbar ärgerte ihn ihre Entscheidung immer noch, aber jetzt war es zu spät, um etwas daran zu ändern, selbst wenn sie dazu bereit gewesen wäre. Was sie nicht war.
Als die Regalfächer bis auf den einsamen Western geleert waren, schaute sie sich noch einmal um, ob sie vielleicht etwas übersehen hatte. »Die Lebensmittel.« Sie deutete auf die Dosen, die sie auf der Frühstückstheke zwischen dem Kochbereich und Wohnzimmer aufgereiht hatte. »Willst du sie mitnehmen?«
Er schüttelte den Kopf.
Sie legte sie in den letzten, nur halb vollen Bücherkarton. »Ich habe Strom und Wasser abstellen lassen, weil die neuen Besitzer erst im Frühjahr einziehen wollen.« Das wusste er mit Sicherheit schon. Sie redete nur, um das Schweigen zu vertreiben, das umso schwerer zu werden schien, je mehr persönliche Dinge sie aus der Hütte herausgeräumt hatte.
»Ich muss noch ein paar letzte Sachen aus dem Bad holen, dann bin ich fertig. Ich werde alles abstellen, abschließen und den Schlüssel wie vereinbart bei der Immobilienagentur abgeben, wenn ich aus der Stadt fahre.«
Seiner Miene und seiner Haltung war deutlich anzusehen, wie unglücklich er war. Er nickte, sagte aber nichts.
»Du brauchst nicht auf mich zu warten, Dutch. Du hast im Ort bestimmt genug zu tun.«
»Das kann warten.«
»Obwohl ein Eissturm vorhergesagt wurde? Wahrscheinlich musst du den Verkehr im Supermarkt regeln«, versuchte sie zu scherzen. »Du kannst dir vorstellen, wie die Leute vor so einer Belagerung zu hamstern anfangen. Lass uns Adieu sagen, dann kannst du schon ins Tal fahren.«
»Ich warte auf dich. Wir fahren zusammen. Du kannst das hier zu Ende bringen«, sagte er und deutete dabei ins Schlafzimmer. »Ich lade solange die Kartons in deinen Kofferraum.«
Er wuchtete den ersten Karton hoch und trug ihn hinaus. Lilly ging ins nächste Zimmer. Das Bett mit den zwei Nachttischen passte genau an die Wand unter der Dachschräge. Ansonsten standen nur ein Schaukelstuhl und eine Kommode im Raum. Die Fenster nahmen die ganze Raumseite gegenüber ein. An der anderen Wand gab es einen Kleiderschrank und ein kleines Bad.
Nachdem sie die Vorhänge schon vorhin zugezogen hatte, lag der Raum im Halbdunkel. Sie warf einen Blick in den Kleiderschrank. Verloren hingen die leeren Bügel an der Stange. Die Schubladen in der Kommode waren leer geräumt. Sie ging ins Bad und sammelte die Toilettenartikel ein, die sie heute Morgen verwendet hatte, zog den Reißverschluss eines Kulturbeutels aus Plastik zu und kehrte, nachdem sie sich überzeugt hatte, dass der Medizinschrank ausgeräumt war, ins Schlafzimmer zurück.
Sie verstaute den Kulturbeutel in ihrem Koffer, der aufgeklappt auf dem Bett lag, und war gerade dabei, ihn zu schließen, als Dutch ins Zimmer kam.
Ohne jede Vorrede erklärte er: »Wenn das mit Amy nicht gewesen wäre, wären wir noch verheiratet.«
Lilly senkte kopfschüttelnd den Blick. »Dutch, bitte, ich will nicht …«
»Wir wären ewig zusammengeblieben.«
»Das wissen wir nicht.«
»Ich weiß es.« Er nahm ihre Hände. In seinem heißen Griff fühlten sie sich eisig an. »Ich übernehme die volle Verantwortung für alles. Dass es mit uns nicht geklappt hat, war allein meine Schuld. Wenn ich anders reagiert hätte, hättest du mich nicht verlassen. Ich sehe das ein, Lilly. Ich habe begriffen, welche Fehler ich gemacht habe. Sie waren riesig. Und dumm. Ich gebe das zu. Aber bitte gib mir noch eine Chance. Bitte.«
»Wir könnten nicht so tun, als wäre nichts passiert, Dutch. Wir sind nicht mehr die Menschen, die sich damals kennen gelernt haben. Begreifst du das nicht? Niemand kann ungeschehen machen, was geschehen ist. Es hat uns verändert.«
Das war sein Stichwort. »Du hast Recht. Menschen ändern sich. Ich habe mich seit der Scheidung geändert. Indem ich hier hoch gezogen bin. Diesen Job angenommen habe. All das hat mir gut getan, Lilly. Mir ist klar, dass Cleary nicht mit Atlanta zu vergleichen ist, aber hier habe ich etwas, worauf ich aufbauen kann. Ein festes Fundament. Hier bin ich zu Hause, und die Menschen hier kennen mich und meine Leute. Sie mögen mich. Und sie respektieren mich.«
»Das ist wunderbar, Dutch. Ich möchte, dass du hier Erfolg hast. Ich wünsche es dir aus vollem Herzen.«
Sie wollte wirklich, dass er hier Erfolg hatte, und zwar nicht nur seinet-, sondern auch ihretwegen. Bis Dutch wieder als guter Polizist angesehen wurde und sich vor allem selbst so sah, würde sie nicht von ihm loskommen. Erst wenn er mit sich und seiner Arbeit wieder im Reinen war, würde er es auch ohne sie schaffen, neues Selbstbewusstsein aufzubauen. Cleary als kleine Gemeinde bot ihm die Möglichkeit dazu. Sie hoffte bei Gott, dass alles gut ausgehen würde.
»Im Beruf und privat«, sprudelte es aus ihm heraus. »Überall habe ich neu angefangen. Aber all das ist bedeutungslos, wenn du mich verlässt.«
Ehe sie es verhindern konnte, hatte er die Arme um sie gelegt und sie an seine Brust gezogen. Er murmelte ihr beschwörend ins Ohr: »Sag, dass du uns noch eine Chance gibst.« Dann versuchte er, sie zu küssen, doch sie drehte den Kopf zur Seite.
»Lass mich los, Dutch.«
»Hast du vergessen, wie gut wir zusammenpassen? Wenn du dich nur ein einziges Mal öffnen würdest, könnten wir wieder ganz von vorn anfangen. Wir könnten all die schlechten Zeiten vergessen und da weitermachen, wo wir früher waren. Damals konnten wir die Finger nicht voneinander lassen, weißt du noch?« Er versuchte sie wieder zu küssen, diesmal, indem er seine Lippen hartnäckig auf ihre presste.
»Hör auf!« Sie schubste ihn weg.
Er strauchelte einen Schritt zurück. Sein Atem hing schwer im Raum. »Ich darf dich nicht mal berühren.«
Sie verschränkte die Arme vor dem Bauch, als wollte sie sich selbst umarmen. »Du bist nicht mehr mit mir verheiratet.«
»Du wirst mir nie verzeihen, stimmt’s?«, schnauzte er sie an. »Du hast die Sache mit Amy dazu benutzt, um dich von mir scheiden zu lassen, aber eigentlich ging es um was ganz anderes, stimmt’s?«
»Hör auf, Dutch. Fahr, bevor…«
»Bevor es mit mir durchgeht?« Er feixte.
»Bevor du dich lächerlich machst.«
Sie ließ sich nicht von seinem hasserfüllten Blick einschüchtern. Unvermittelt drehte er sich um und stampfte aus dem Zimmer. Er schnappte sich den Umschlag auf dem Couchtisch und zog seinen Mantel und Hut von den Kleiderhaken neben der Tür. Ohne sie anzuziehen, knallte er die Tür so fest hinter sich zu, dass die Fensterscheiben klirrten. Sekunden später hörte sie, wie der Motor seines Broncos ansprang und der Schotter unter den übergroßen Reifen aufspritzte, dann war er davongerast.
Sie setzte sich aufs Bett und ließ das Gesicht in die Hände sinken. Nachdem alles vorbei war, erkannte sie, dass sie nicht nur wütend und angewidert gewesen war, sondern dass sie auch Angst gehabt hatte.
Dieser Dutch mit dem explosiven Temperament war nicht mehr der charmante Mann, den sie geheiratet hatte. Trotz seiner Behauptung, er habe ganz neu angefangen, wirkte er verzweifelt. Und diese Verzweiflung äußerte sich in beängstigenden, quecksilberschnellen Stimmungsumschwüngen.
Sie schämte sich beinahe, so erleichtert war sie über die Gewissheit, dass sie ihn nie wiedersehen würde. Es war endgültig vorbei. Dutch Burton war aus ihrem Leben verschwunden.
Vor Erschöpfung ließ sie sich rückwärts aufs Bett fallen und legte den Unterarm über die Augen.
Das Klackern der Hagelkörner auf dem Blechdach weckte sie wieder auf.
Die Wortgefechte mit Dutch hatten sie immer erschöpft. Die angespannten Begegnungen mit ihm während der vergangenen Woche, in der sie in Cleary geblieben war, um den Verkauf der Hütte abzuschließen, waren kräftezehrender, als sie sich eingestehen wollte. Nach dem letzten Durchgang hatte ihr Körper ihren Geist gnädig zur Ruhe kommen lassen und ihr etwas Schlaf geschenkt.
Sie setzte sich auf und rieb gegen die Kälte über ihre Arme. Im Schlafzimmer war es dunkel, so dunkel, dass sie nicht einmal ihre Armbanduhr ablesen konnte. Sie stand auf, trat ans Fenster und zog den Vorhang zurück. Es fiel nur wenig Licht durch den Spalt, aber das reichte, um zu erkennen, wie spät es war.
Die Uhrzeit überraschte sie. Sie hatte tief und traumlos geschlafen, aber zu ihrer Überraschung nicht besonders lang. So dunkel, wie es draußen war, hätte sie gedacht, dass es schon viel später war. Die tiefen Wolken, die unter dem Gipfel hingen, hatten eine frühe, bedrohliche Dämmerung geschaffen.
Inzwischen war der Boden mit einer durchgehenden Hagelschicht bedeckt. Immer noch fielen Hagelkörner, vermischt mit Eisregen und dem, was die Meteorologen als Graupel bezeichnen, winzigen Eiskörnern, die wesentlich heimtückischer aussehen als ihre spitzenbesetzten Cousins. Schon jetzt waren alle Äste in Eispanzer gehüllt, die sichtbar dicker wurden. Kräftige Windböen rüttelten an den Fensterscheiben.
Es war töricht gewesen einzuschlafen. Diesen Fehler würde sie mit einer aufreibenden Fahrt über die Bergstraße bezahlen. Selbst nachdem sie es nach Cleary geschafft hatte, würde der Wettersturz die Heimfahrt nach Atlanta höchstwahrscheinlich um ein Vielfaches verlängern. Nachdem sie hier alles erledigt hatte, wollte sie so schnell wie möglich zurück, zurück in ihren Alltag, in ihr vertrautes Leben. In ihrem Büro würden sich unbeantwortete Anfragen, E-Mails und unerledigte Projekte häufen, mit denen sie sich umgehend befassen musste. Aber statt die Rückkehr zu fürchten, freute sie sich darauf, die Aufgaben anzugehen, die auf sie warteten.
Abgesehen davon, dass sie Heimweh nach ihrer Arbeit hatte, konnte sie es kaum erwarten, Dutchs Heimatstadt zu verlassen. Sie liebte die Atmosphäre in Cleary und die schöne, gebirgige Umgebung. Aber die Menschen hier kannten Dutch und seine Familie seit Generationen. Solange sie seine Frau gewesen war, hatte man sie warmherzig auf- und angenommen. Seit sie sich von ihm hatte scheiden lassen, behandelten die Einheimischen sie spürbar kühler.
Wenn sie bedachte, wie wütend er aus der Hütte hinausgestampft war, war es höchste Zeit, dass sie sein Territorium verließ.
Eilig trug sie ihren Koffer ins Wohnzimmer und stellte ihn neben der Tür ab. Dann unterzog sie die Hütte einer letzten kurzen Inspektion, bei der sie sich davon überzeugte, dass alles ausgeschaltet war und sie nichts zurückgelassen hatten, was ihr oder Dutch gehörte.
Zufrieden, dass alles in Ordnung war, zog sie Mantel und Handschuhe an und öffnete die Haustür. Der Wind packte sie mit einer Kraft, die ihr den Atem verschlug. Sobald sie auf die Veranda trat, peitschten ihr Eiskristalle ins Gesicht. Sie musste ihr Gesicht abschirmen, aber für eine Sonnenbrille war es eindeutig zu dunkel. Die Augen gegen den Hagel zusammengekniffen, trug sie den Koffer zum Auto und stellte ihn auf die Rückbank.
Dann kehrte sie ein letztes Mal in die Hütte zurück und benutzte ihren Inhalator. Die kalte Luft konnte einen Asthmaanfall auslösen. Der Inhalator würde das verhindern helfen. Zuletzt zog sie, ohne sich einen letzten nostalgischen Blick zu gönnen, die Tür zu und schloss mit ihrem Schlüssel den Sperrriegel ab.
In ihrem Auto war es kalt wie in einem Eisschrank. Sie startete den Motor, musste aber abwarten, bis die Scheibenheizung warm geworden war, bevor sie losfahren konnte; die Windschutzscheibe war komplett vereist. Den Mantel fest um den Leib geschlungen, schob sie Nase und Mund in den hochgeschlagenen Kragen und konzentrierte sich darauf, gleichmäßig zu atmen. Ihre Zähne klapperten, und sie schlotterte am ganzen Leib.
Endlich war die Luft aus den Lüftungsschlitzen warm genug, um das Eis auf der Scheibe zu matschigem Schnee zu schmelzen, den die Scheibenwischerblätter beiseiteschieben konnten. Allerdings kamen sie nicht gegen den dichten Eisregen an. Lillys Blickfeld war gefährlich eingeschränkt, das würde sich erst ändern, wenn sie unten im Tal war. Sie hatte keine andere Wahl, als die kurvige Mountain Laurel Road hinunterzufahren.
Die Straße war ihr vertraut, aber so vereist war sie noch nie gewesen. Lilly beugte sich über das Lenkrad und spähte durch die schlierige Windschutzscheibe, bemüht, etwas jenseits der Kühlerfigur zu erkennen.
Auf den Serpentinen schmiegte sie sich eng an den rechten Fahrbahnrand und die Felswand, denn sie wusste, dass an der anderen Straßenseite ein Abgrund drohte. Sie ertappte sich dabei, wie sie in den Haarnadelkurven den Atem anhielt.
Die Fingerspitzen waren trotz der Handschuhe so kalt, dass sie fast taub waren, aber die Handflächen, die das Lenkrad umklammerten, waren verschwitzt. Vor Anspannung begannen die Muskeln in ihren Schultern und ihrem Nacken zu brennen. Ihr ängstlicher Atem ging immer stockender.
In der Hoffnung, ihr Blickfeld zu vergrößern, rieb sie mit dem Mantelärmel über die Windschutzscheibe, aber damit verschaffte sie sich lediglich einen besseren Ausblick auf den dichten Hagelschleier.
Dann sprang ganz unerwartet eine menschliche Gestalt aus dem Wald am Straßenrand direkt vor ihr Auto.
Instinktiv stieg sie auf die Bremse und entsann sich zu spät, dass man auf einer vereisten Straße auf gar keinen Fall abrupt bremsen sollte. Der Wagen kam ins Schleudern. Die Gestalt im Scheinwerferlicht machte einen Satz zur Seite und versuchte sich zu retten. Mit blockierenden Rädern und wild schwänzelndem Heck schlitterte der Wagen daran vorbei. Lilly spürte einen dumpfen Schlag an der hinteren Stoßstange. Mit einem üblen Gefühl im Magen erkannte sie, dass sie ihn getroffen hatte.
Das war ihr letzter peinigender Gedanke, bevor der Wagen gegen einen Baum krachte.
Der Airbag explodierte, knallte ihr ins Gesicht und stieß eine Puderwolke aus, die ihr den Atem raubte und das Wageninnere ausfüllte. Instinktiv hielt sie die Luft an, um den Puder nicht einzuatmen. Der Gurt schnitt ihr wie ein Messer in die Brust.
In einem abgetrennten Teil ihres Gehirns registrierte sie erstaunt die Wucht des Aufpralls. Es war eine relativ schwache Kollision gewesen, trotzdem war sie wie gelähmt. Im Geist ging sie ihre Körperteile durch und kam zu dem Schluss, dass sie nirgendwo Schmerzen spürte, sondern nur erschrocken war. Aber der Mensch, den sie gestreift hatte … »O Gott!«
Sie schlug mit den Händen den erschlaffenden Airbag beiseite, löste den Gurt und schob die Tür auf. Als sie aus dem Wagen kletterte, verlor sie den Halt unter den Füßen und kippte vornüber. Ihr Handballen schlug schmerzhaft auf den vereisten Asphalt, genau wie ihr rechtes Knie. Es tat höllisch weh.
Sich an der Karosserie haltend, humpelte sie zum Heck. Die Augen mit einer Hand gegen den Wind abgeschirmt, sah sie eine reglose Gestalt auf dem Rücken liegen, Kopf und Bauch auf dem schmalen Seitenstreifen, die Füße quer auf der Fahrbahn. An der Größe der Wanderschuhe erkannte sie, dass das Opfer ein Mann war.
Als würde sie auf Schlittschuhen über den spiegelglatten Asphalt gleiten, arbeitete sie sich zu dem Mann vor und ging neben ihm in die Hocke. Er hatte eine Strickmütze über Ohren und Augenbrauen gezogen. Seine Augen waren geschlossen. Sie konnte keine Bewegung seines Brustkorbs feststellen, die darauf hingedeutet hätte, dass er atmete. Darum wühlte sie sich mit ihren Fingern unter den Wollschal, um seinen Hals unter dem Mantelkragen und unter dem Rollkragen seines Pullovers nach einem Puls abzutasten.
Als sie einen spürte, flüsterte sie: »Gott sei Dank, Gott sei Dank.«
Aber dann bemerkte sie den größer werdenden dunklen Fleck auf dem Stein unter seinem Schädel. Sie wollte schon den Kopf anheben und nach der Quelle des Blutes sehen, als ihr einfiel, dass man einen Verletzten mit einer Kopfwunde möglichst nicht bewegen soll. War das nicht eine der Grundregeln für Erste Hilfe? Womöglich hatte er eine Rückgratverletzung, die sich verschlimmern oder ihn gar umbringen konnte, wenn er bewegt wurde.
Sie hatte keine Möglichkeit festzustellen, wie schwer die Kopfverletzung war. Und damit meinte sie die sichtbare Kopfverletzung. Welche Verletzungen hatte er sich noch zugezogen, von denen sie nichts ahnte? Innere Blutungen, eine von einer Rippe punktierte Lunge, Organrisse, Knochenbrüche. Außerdem gefiel es ihr gar nicht, dass er so unnatürlich abgeknickt dalag, fast als wäre sein Kreuz nach hinten durchgebrochen.
Sie musste Hilfe holen. Sofort. Sie stand auf und rannte zu ihrem Auto zurück. Mit ihrem Handy konnte sie die Polizei rufen. Natürlich war der Handyempfang in den Bergen nicht der beste, aber vielleicht …
Sein Stöhnen ließ sie innehalten. Sie drehte sich so schnell um, dass ihr fast die Füße unter dem Leib wegrutschten. Wieder ging sie neben ihm in die Hocke. Seine Lider hoben sich flatternd, er sah zu ihr auf. Solche Augen hatte sie erst einmal in ihrem Leben gesehen. »Tierney?«
Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, und sah im nächsten Moment aus, als müsste er sich übergeben. Mit fest zusammengekniffenen Lippen schluckte er mehrmals, bis der Brechreiz nachließ. Er schloss die Augen wieder, um sie nach ein paar Sekunden erneut aufzuschlagen. »Wurde ich getroffen?«
Sie nickte. »Ich glaube, vom hinteren Kotflügel. Tut Ihnen was weh?«
Nach kurzem, prüfendem Nachdenken antwortete er: »Alles.«
»Ihr Hinterkopf blutet. Ich kann nicht sehen, wie schlimm es ist. Sie sind auf einem Stein gelandet. Ich möchte Sie lieber nicht bewegen.«
Seine Zähne begannen zu klappern. Entweder kühlte er aus, oder er stand unter Schock. Gut war beides nicht.
»Ich habe eine Decke im Auto. Bin gleich wieder da.«
Sie stand auf, zog den Kopf wegen des Windes ein und arbeitete sich zu ihrem Auto vor, während sie gleichzeitig rätselte, was in aller Welt er sich dabei gedacht hatte, ohne jede Vorwarnung aus dem Wald auf die Straße zu springen. Was tat er hier oben überhaupt, mitten in einem Schneesturm und noch dazu zu Fuß?
Der Kofferraumhebel am Armaturenbrett funktionierte nicht, möglicherweise war die Elektrik beschädigt. Oder die Klappe war festgefroren. Sie zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und ging damit zum Kofferraum. Wie befürchtet war das Schloss von einer Eisschicht überzogen.
Sie tastete sich zum Straßenrand vor, hob dort den größten Stein auf, den sie sehen konnte, und nahm ihn, um das Eis wegzuschlagen. In Notsituationen wie dieser sollte man angeblich einen Adrenalinschub spüren, der übermenschliche Kräfte verlieh. Sie spürte nichts dergleichen. Als sie endlich genug Eis weggeschlagen hatte, um die Klappe anzuheben, war sie erschöpft und keuchte schwer.
Nachdem sie die Kartons beiseitegeschoben hatte, sah sie die Picknickdecke in der dazugehörenden Plastikhülle liegen. Sie und Dutch hatten sie zu Footballspielen mitgenommen. Sie half vielleicht gegen eine kühle Herbstbrise, nicht gegen einen Blizzard, aber vermutlich war sie besser als nichts.
Sie kehrte zu der am Boden liegenden Gestalt zurück. Der Mann lag totenstill da. Ihre Stimme überschlug sich vor Schreck. »Mr Tierney?«
Er schlug die Augen auf. »Ich lebe noch.«
»Ich hatte Probleme, den Kofferraum aufzubekommen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.« Sie breitete die Decke über ihn. »Das wird nicht viel helfen, fürchte ich. Ich werde versuchen…«
»Sparen Sie sich die Entschuldigungen. Haben Sie ein Handy?«
Wie sie noch von ihrer ersten Begegnung wusste, war er ein Mann, der gern das Kommando übernahm. Auch recht. Dies war nicht der Zeitpunkt, die Feministin herauszukehren. Sie angelte das Handy aus ihrer Manteltasche. Es war eingeschaltet, das Display leuchtete. Sie drehte es ihm zu, sodass er die Meldung lesen konnte. »Kein Netz.«
»Das habe ich befürchtet.« Er versuchte den Kopf zu drehen, verzog das Gesicht, schnappte nach Luft und spannte dann die Kinnmuskeln an, um das Zähneklappern zu unterbinden. Nach ein paar Sekunden fragte er: »Fährt Ihr Wagen noch?«
Sie schüttelte den Kopf. Sie kannte sich nur begrenzt mit Autos aus, aber wenn die Kühlerhaube aussah wie eine zusammengeknüllte Coladose, konnte man vernünftigerweise annehmen, dass der Wagen nicht mehr fuhr.
»Hier können wir nicht bleiben.« Er unternahm einen Versuch aufzustehen, aber sie drückte seine Schulter mit der Hand auf den Boden zurück.
»Vielleicht haben Sie sich das Rückgrat gebrochen oder verletzt. Ich finde, Sie sollten sich nicht bewegen.«
»Es ist riskant, das stimmt. Aber ich muss mich bewegen, wenn ich nicht erfrieren will. Ich muss das Risiko eingehen. Helfen Sie mir auf.«
Er streckte seine Rechte aus, und sie umklammerte sie mit aller Kraft, während er sich bemühte, den Oberkörper aufzurichten. Aber er konnte sich nicht aufrecht halten. Im nächsten Moment knickte er in der Taille ab und sackte gegen Lilly. Sie fing ihn mit ihrer Schulter ab und hielt ihn so fest, während sie die Decke wieder um seine Schultern legte.
Dann hob sie seinen Oberkörper langsam an, bis er saß. Der Kopf baumelte leblos auf seiner Brust. Frisches Blut rann unter seiner Mütze hervor, sammelte sich vorn an seinem Ohrläppchen und tropfte von dort auf sein Kinn.
»Tierney?« Sie schlug ihm leicht auf die Wange. »Tierney!«
Er hob den Kopf, öffnete aber nicht die Augen. »Ohnmächtig geworden, glaube ich. Mir ist so verflucht schwindlig.«
Er begann tief zu atmen, durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nach einer Weile schlug er die Augen auf und nickte. »Besser. Glauben Sie, dass wir mich mit vereinten Kräften auf die Füße stellen können?«
»Lassen Sie sich bloß Zeit.«
»Wenn wir was nicht haben, dann Zeit. Stellen Sie sich hinter mich, und schieben Sie die Arme unter meine Achseln.« Sie ließ ihn widerstrebend los und trat, als sie sicher war, dass er nicht umkippen würde, hinter ihn. »Ein Rucksack.«
»Genau. Und?«
»Sie lagen so komisch da, dass ich dachte, Sie hätten sich vielleicht das Rückgrat gebrochen.«
»Ich bin auf dem Rucksack gelandet. Wahrscheinlich hat mich das vor einem Schädelbruch bewahrt.«
Sie zog die Träger des Rucksacks von seinen Schultern, damit sie ihn besser stützen konnte. »Ich wäre so weit.«
»Ich glaube, ich kann jetzt aufstehen«, sagte er. »Sie sind da, um mich aufzufangen, falls ich nach hinten kippe. Okay?«
»Okay.«
Er setzte die Hände neben den Hüften auf den Boden und hievte sich hoch. Lilly stand nicht nur hinter ihm, um ihn aufzufangen, falls er umkippte. Sie arbeitete genauso schwer wie er, zog ihn hoch, bis er richtig stand, und hielt ihn dann fest, bis er sagte: »Danke. Ich glaube, jetzt schaffe ich’s.«
Er fasste unter seinen Mantel, als er die Hand wieder herauszog, hielt er ein Handy in der Hand, das offenbar an seinem Gürtel geklemmt hatte. Er sah aufs Display und zog die Stirn in Falten. Sie las den Fluch von seinen Lippen ab. Auch er hatte kein Netz. Er deutete auf das Autowrack. »Ist irgendwas in Ihrem Wagen, was wir in Ihre Hütte mitnehmen sollten?«
Lilly sah ihn überrascht an. »Sie wissen von unserer Hütte?«
Scott Hamer biss vor Anstrengung die Zähne zusammen.
»Gleich hast du’s, Junge. Komm schon. Du schaffst das. Noch einen.«
Scotts Arme bebten vor Anspannung. Die Adern wölbten sich grotesk unter der Haut. Schweiß rollte von seinem Gesicht und tropfte von der Gewichtbank auf die Turnmatte, wo er kleine Pfützen auf dem Gummi bildete.
»Ich kann nicht mehr«, stöhnte er.
»O doch. Gib mir hundertzehn Prozent.«
Wes Hamers Stimme hallte durch die Turnhalle der Highschool. Bis auf die beiden war das Gebäude menschenleer. Alle anderen durften vor über einer Stunde heimgehen. Nur Scott musste hierbleiben, lange nachdem der Unterricht beendet war und lange nachdem die anderen Sportler das Nachmittagstraining absolviert hatten, das ihnen der Coach, Scotts Vater Wes, aufgetragen hatte.
»Ich will, dass du dein Letztes gibst.«
Scott hatte das Gefühl, dass seine Blutgefäße jeden Moment platzen könnten. Er blinzelte den Schweiß aus den Augen und schnaufte mehrmals Speichel sprühend durch den Mund, um Kraft zu tanken. Die Muskeln in seinem Bizeps und Trizeps zitterten vor Überanstrengung. Sein Brustkorb drohte jeden Moment zu explodieren.
Aber sein Dad würde ihn erst entlassen, wenn er zweihundert Kilo gestemmt hatte, mehr als das Doppelte von Scotts Körpergewicht. Fünf Durchgänge waren für heute angesetzt. Sein Vater war ganz groß, wenn es darum ging, Ziele zu setzen. Er war noch größer, wenn es darum ging, sie zu erreichen.
»Hör auf, mir was vorzuspielen, Scott«, sagte Wes ungeduldig.
»Tu ich doch gar nicht.«
»Atme durch. Schick den Sauerstoff in die Muskeln. Du schaffst das.«
Scott holte tief Luft und atmete in kurzen Stößen wieder aus, während er seinen Arm- und Brustmuskeln das Unmögliche abverlangte.
»Das ist es!«, rief sein Dad. »Du hast ihn noch mal zwei Zentimeter angehoben. Vielleicht sogar vier.«
O Gott, bitte lass es vier sein.
»Ein allerletztes Mal! Noch ein einziger Stoß, Scott.«
Ohne dass er es wollte, stieg ein tiefes Knurren aus seiner Kehle, während er seine ganze Kraft in die bebenden Arme lenkte. Aber er schaffte es, die Stange einen weiteren Zentimeter anzuheben und die Ellbogen eine Millisekunde lang durchzustrecken, bevor sein Dad zupackte und die Hantel in die Halterung führte.
Scotts Arme fielen kraftlos zu beiden Seiten herab. Die Schultern sackten auf die Bank zurück. Sein Brustkorb hob sich bebend, um Luft zu schöpfen. Sein ganzer Körper zitterte vor Erschöpfung.
»Gut gemacht. Morgen versuchen wir sechs Durchgänge.« Wes reichte ihm ein Handtuch, wandte sich dann ab und ging zu seinem Büro, in dem das Telefon zu läuten begonnen hatte. »Geh duschen. Ich gehe kurz ans Telefon und schließe dann ab.«
Scott hörte, wie sich sein Vater mit einem knappen »Hamer« meldete und dann in dem abweisenden Ton, in dem er immer mit Scotts Mutter sprach, fragte: »Was willst du, Dora?«
Scott setzte sich auf und wischte mit dem Handtuch über sein Gesicht und seinen Kopf. Er war ausgelaugt, total am Ende. Er fürchtete sogar den Weg in die Umkleide. Nur die Aussicht auf eine heiße Dusche konnte ihn von der Bank locken.
»Das war deine Mutter«, rief ihm Wes durch die offene Bürotür zu.
Wes Hamers Büro war ein chaotischer Verschlag, in den sich nur die Tapfersten wagten. Auf dem Schreibtisch lag stapelweise Schriftverkehr, den Wes für reine Zeitverschwendung hielt und darum so lange wie möglich aufschob. Die Wände waren mit den Saisonkalendern der verschiedenen Teams tapeziert. Ein Zweimonatskalender war mit seinen handgeschriebenen Hieroglyphen bedeckt, die nur Wes allein entziffern konnte.
Außerdem hing eine topografische Karte von Cleary und der Umgebung an der Wand. Darauf waren mit einem roten Marker seine liebsten Jagd- und Fischgründe festgehalten. Auf den gerahmten Fotos der Footballteams aus den letzten drei Jahren stand Chefcoach Wes Hamer stolz in der Mitte der ersten Reihe.
»Sie hat gesagt, es fängt an zu hageln«, erklärte er Scott. »Mach hin.«
Der stechende Gestank in den Umkleideräumen der Turnhalle war Scott so vertraut, dass er ihn überhaupt nicht registrierte. Sein eigener Geruch vermischte sich mit dem Mief aus Knabenschweiß, schmutzigen Socken, Unterhosen und Suspensorien. Der Geruch war so durchdringend, dass er selbst in den Fugen zwischen den Fliesen in der Dusche zu sitzen schien.
Scott drehte den Hahn unter einem Duschkopf auf. Als er sein Hemd über den Kopf zog, blickte er über die Schulter in den Spiegel und begutachtete mit angewidertem Stirnrunzeln die frisch ausgebrochene Akne auf seinem Rücken. Er trat unter die Dusche, drehte den Rücken in den Strahl und schrubbte dann rücksichtslos alles ab, was er mit seiner antibakteriellen Seife erreichen konnte.
Er wusch sich gerade zwischen den Beinen, als sein Vater erschien und ihm ein Handtuch brachte. »Falls du dir keins mitgenommen hast.«
»Danke.« Verlegen nahm er die Hände von seinem Geschlechtsteil und säuberte seine Achseln.
Wes hängte das Handtuch über eine Stange vor der Duschkabine und deutete dann auf Scotts Hoden. »Du kommst ganz nach deinem alten Herrn«, sagte er leise lachend. »Dafür brauchst du dich nicht zu schämen.«
Scott konnte es nicht ausstehen, wenn sich sein Vater bei ihm einschleimen wollte, indem er mit ihm über Sex sprach. Als wäre das ein Thema, das Scott mit ihm besprechen wollte. Als würde er die Anspielungen und das vielsagende Zwinkern genießen.
»Du hast da unten mehr als genug zu bieten, um all deine Freundinnen glücklich zu machen.«
»Dad.«
»Hauptsache, du machst sie nicht allzu glücklich.« Wes’ Lächeln veränderte sich. »Du wärst ein echter Fang für eins von diesen Landeiern, das es hier rausschaffen will. Die schrecken nicht davor zurück, einem Jungen was anzuhängen. Das trifft übrigens auf jede Frau zu, die mir je begegnet ist. Verlass dich bloß nicht darauf, dass das Mädchen verhütet.« Wes wedelte mit dem Zeigefinger, als wäre das eine ganz neue Lektion und keine, die Scott seit seiner Pubertät ständig zu hören bekam.
Scott drehte das Wasser ab, griff nach dem Handtuch und schlang es schnell um seine Hüften. Er machte sich auf den Weg zur Umkleide, aber sein Vater war noch nicht fertig. Er packte Scotts nasse Schulter mit der Hand und drehte ihn wieder um. »Du hast noch jahrelange harte Arbeit vor dir, bevor du da bist, wo du hin willst. Ich will nicht, dass eine von diesen Kühen plötzlich schwanger wird und dir alles verpfuscht.«
»Das wird nicht passieren.«
»Pass gut auf, dass es nicht dazu kommt.« Dann schubste Wes ihn kumpelhaft in Richtung Umkleide. »Zieh dich an.«
Fünf Minuten später schloss Wes von außen die Tür zur Sporthalle ab und sicherte das Gebäude für die Nacht. »Ich wette, morgen fällt die Schule aus«, bemerkte er. Leichter Graupel fiel, vermischt mit einem tristen Regen, der sofort gefror. »Pass auf, dass du nicht hinfällst. Es ist schon ziemlich glatt.«
Vorsichtig arbeiteten sie sich zum Lehrerparkplatz vor, wo Wes einen eigenen Stellplatz hatte, reserviert für den sportlichen Leiter der Cleary Highschool, der Heimat der Fighting Cougars.
Die Wischerblätter kämpften unermüdlich gegen den gefrierenden Regen auf dem beheizten Glas an. Scott bibberte in seinem Mantel und stopfte die Fäuste in die flanellgefütterten Manteltaschen. Sein Magen knurrte. »Hoffentlich hat Mom das Essen fertig.«
»Du kannst dir was aus dem Drugstore holen.«
Scott drehte den Kopf und sah Wes an.
Der sah weiter auf die Straße. »Wir halten dort kurz an, bevor wir heimfahren.«
Scott rutschte tiefer in seinen Sitz, schlang den Mantel enger um sich und starrte trübsinnig durch die Windschutzscheibe, während sie über die Main Street rollten. In den meisten Schaufenstern hingen »Geschlossen«-Schilder. Die Läden hatten zugemacht, bevor das Unwetter richtig einsetzte. Aber so wie es aussah, war niemand direkt nach Hause gefahren. Die Straßen waren voll, vor allem rund um den Supermarkt, der immer noch geöffnet hatte und gute Geschäfte machte.
All das nahm Scott wahr, allerdings nur unbewusst, bis sein Dad an einer der beiden Ampeln auf der Main Street hielt. Gedankenverloren starrte er durch die verregnete Scheibe, bis sein Blick zufällig auf den Flyer fiel, der an einen Telefonmasten getackert war.
Vermisst!
Unter der fetten Überschrift war ein Schwarz-Weiß-Foto von Millicent Gunn abgedruckt, gefolgt von einer knappen Personenbeschreibung, dem Datum, an dem sie verschwunden war, und zuletzt einer Liste von Telefonnummern, die man anrufen konnte, wenn man etwas über ihren Verbleib wusste.
Scott schloss die Augen und rief sich ins Gedächtnis, wie Millicent ausgesehen hatte, als er ihr das letzte Mal begegnet war.
Als er die Augen wieder aufschlug, war der Wagen weitergerollt und das Flugblatt nicht mehr zu sehen.
Bist du sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen könnten? Wasserflaschen und Essensdosen?«
Marilee Ritt gab sich Mühe, sich nicht anmerken zu lassen, wie wütend sie war. »Ja, William. Ich habe die Einkaufsliste, die du mir mitgegeben hast, extra noch mal kontrolliert, bevor ich aus dem Supermarkt raus bin. Ich habe sogar noch am Elektroladen Halt gemacht, um neue Taschenlampenbatterien zu kaufen, weil es im Supermarkt keine mehr gab.«
Ihr Bruder spähte durch das große Fenster des Drugstores, der seinen Namen trug. Auf der Main Street krochen die Autos dahin, nicht wegen der Straßenverhältnisse, die immer unwägbarer wurden, sondern weil der Verkehr so dicht war. Die Menschen hatten es eilig, dorthin zu kommen, wo sie den Sturm überdauern wollten.
»Der Wetterbericht sagt, diesmal könnte es schlimm kommen und mehrere Tage dauern.«
»Ich höre auch Radio, und ich sehe auch fern, William.«
Er sah seine Schwester kurz an. »Ich wollte damit nicht sagen, dass du inkompetent wärst. Nur manchmal ein bisschen zerstreut. Wir wäre es mit einem Kakao? Aufs Haus.«
Sie blickte durch das Fenster auf die langsam dahinziehende Autoschlange. »Ich glaube nicht, dass ich schneller heimkomme, wenn ich jetzt fahre, also schön. Ich hätte gern einen Kakao.«
Er begleitete sie zur Kaffeetheke vorn im Laden und bedeutete ihr, auf einem der Chromhocker an der Theke Platz zu nehmen. »Linda, Marilee möchte einen Kakao.«
»Mit extra viel Schlagsahne, bitte«, sagte Marilee lächelnd zu der Frau hinter der Theke.
»Kommt sofort, Miss Marilee.«
Linda Wexler hatte schon an der Kaffeebar gearbeitet, lang bevor William Ritt den Drugstore gekauft hatte. Er war klug genug gewesen, Linda zu behalten, als er das Geschäft übernahm. Sie war eine Institution, kannte jeden im Ort und wusste, wer Milch in seinen Kaffee haben wollte und wer ihn schwarz trank. Den Tunfischsalat machte sie jeden Morgen frisch, und sie wäre nicht auf die Idee gekommen, für die Hamburger, die sie auf Bestellung an ihrem Grill zubereitete, tiefgefrorenes Hackfleisch zu verwenden.
»Ist das Chaos da draußen zu fassen?«, fragte sie, während sie die Milch für den Kakao in eine Stielkasserolle schüttete. »Ich weiß noch, wie aufgeregt wir als Kinder jedes Mal waren, wenn Schnee vorhergesagt wurde, und wie wir uns immer gefragt haben, ob wir am nächsten Tag schulfrei bekommen würden oder nicht. Wahrscheinlich genießen Sie einen schulfreien Tag genauso wie Ihre Schüler.«
Marilee lächelte. »Falls wir schneefrei bekommen, werde ich wahrscheinlich Arbeiten korrigieren.«
Linda schniefte missbilligend. »Das nenne ich einen freien Tag verschwenden.«
Die Ladentür ging auf, und die Glocke bimmelte. Marilee drehte sich auf ihrem Hocker um, um zu sehen, wer hereingekommen war. Zwei etwa siebzehnjährige Mädchen traten kichernd in den Laden und schüttelten ihre nassen Haare aus. Sie waren in Marilees Grammatik- und Literaturkurs.
»Ihr solltet was auf den Kopf setzen«, sagte sie zu ihnen.
»Hi, Miss Ritt«, erwiderten sie im Chor.
»Was macht ihr bei diesem Wetter draußen? Solltet ihr nicht zu Hause sein?«
»Wir wollten ein paar Videos ausleihen«, antwortete die eine. »Nur für den Fall, dass morgen keine Schule ist, Sie wissen schon.«
»Hoffentlich sind noch ein paar neue da«, bemerkte die andere.
»Danke, dass ihr mich daran erinnert habt«, sagte Marilee. »Vielleicht nehme ich auch ein, zwei Filme mit.«
Die Mädchen sahen sie fassungslos an, als wären sie noch nie auf den Gedanken gekommen, dass Miss Marilee Ritt tatsächlich einen Film ansehen könnte. Oder dass sie irgendwas tun könnte außer Tests ausarbeiten, Aufsätze benoten und während der Pausen die Gänge im Schulhaus beaufsichtigen, um allzu brutales Gerangel zu unterbinden. Wahrscheinlich konnten sie sich nicht vorstellen, dass es für ihre Lehrerin ein Leben außerhalb der Korridore der Cleary Highschool gab.
Bis vor Kurzem hätten sie damit auch Recht gehabt.
Sie merkte, wie ihre Wangen warm wurden, sobald sie an ihren neuen Zeitvertreib dachte, und wechselte schnell das Thema. »Ihr solltet heimfahren, bevor die Straßen vereisen«, warnte sie die Schülerinnen.
»Machen wir«, antwortete die eine. »Ich muss sowieso zu Hause sein, bevor es dunkel wird. Wegen Millicent. Meine Leute sind voll panisch.«
»Meine auch«, bestätigte die andere. »Total. Sie wollen rund um die Uhr wissen, wo ich bin.« Sie verdrehte die Augen. »Als würde ich diesen Irren so nahe an mich ranlassen, dass er mich packen und wegschleifen kann.«
»Ich kann mir vorstellen, dass sie sich Sorgen machen«, sagte Marilee. »Das sollten sie auch tun.«
»Mein Daddy hat mir eine Pistole gegeben, die ich im Auto liegen habe«, sagte das andere Mädchen. »Er hat gesagt, ich soll nicht zögern, jeden zu erschießen, der sich an mich ranmachen will.«
Marilee murmelte: »Es ist eine beängstigende Situation.« Sie sah ihnen an, dass sie es kaum erwarten konnten, ans Filmregal zu kommen, und wünschte ihnen noch einen schönen schneefreien Tag, falls es tatsächlich einen geben sollte, bevor sie sich wieder der Theke zudrehte, auf der Linda eben ihren Kakao abstellte.
»Vorsicht, Schatz, er ist heiß.« Linda sah den Mädchen nach. »Die Leute sind völlig übergeschnappt.«
»Hmm.« Marilee nippte vorsichtig an der heißen Schokolade. »Ich weiß nicht, was mich mehr beunruhigt. Die fünf vermissten Frauen oder die Tatsache, dass inzwischen die Väter ihre halbwüchsigen Töchter mit Pistolen bewaffnen.«
Ganz Cleary lebte in Angst wegen der verschwundenen Frauen. Die Menschen verriegelten Türen, die bis dahin nur zugezogen worden waren. Frauen jeden Alters wurden gewarnt, sich in Acht zu nehmen, wenn sie allein unterwegs waren, und dunkle, abgeschiedene Plätze zu meiden. Sie bekamen den Rat, niemandem zu trauen, den sie nicht gut kannten. Seit Millicent verschwunden war, hielt man es sogar für angebracht, dass die Ehemänner und Lebensgefährten ihre Partnerinnen abends von der Arbeit abholten und sie nach Hause begleiteten.
»Man kann den Leuten kaum einen Vorwurf machen.« Linda senkte die Stimme. »Merken Sie sich, was ich sage, Marilee. Die kleine Gunn ist so gut wie tot.«
Es war eine pessimistische Prophezeiung, aber Marilee konnte ihr kaum widersprechen. »Wann fahren Sie nach Hause, Linda?«
»Sobald Ihr Sklaventreiber von Bruder sagt, dass ich heim darf.«
»Vielleicht kann ich ihn überreden, Sie früher gehen zu lassen.«
»Kaum. Wir haben den ganzen Nachmittag über ein Bombengeschäft gemacht. Die Leute glauben, dass es Tage dauern wird, bis sie wieder aus dem Haus kommen.«
Seit Marilee denken konnte, hatte es an der Ecke Main Street und Hemlock Street einen Drugstore gegeben. Als kleines Mädchen hatte sie sich jedes Mal, wenn ihre Familie in die Stadt fuhr, darauf gefreut, hier einzukehren.
William hatte offenbar ebenso gute Erinnerungen an den Drugstore, denn sobald er sein Pharmaziestudium abgeschlossen hatte, war er nach Cleary zurückgekehrt und hatte angefangen, hier zu arbeiten. Als sein Arbeitgeber beschlossen hatte, sich zur Ruhe zu setzen, hatte William ihm den Laden abgekauft und dann sofort einen Bankkredit aufgenommen, um das Geschäft zu erweitern.
Er hatte das leer stehende Nebenhaus gekauft und es in den bestehenden Laden eingegliedert, wobei er Lindas Arbeitsbereich vergrößern und Sitznischen einbauen ließ, um die Kaffeetheke attraktiver zu machen. Außerdem hatte er in kluger Voraussicht einen Bereich für Leihvideos abgetrennt. Abgesehen von seinem Apothekensortiment bot er die größte Auswahl an Taschenbüchern und Zeitschriften im ganzen Ort. Die Frauen kauften ihre Kosmetik und Glückwunschkarten bei ihm. Die Männer ihre Zigaretten. Und alle kamen, um das Neueste aus dem Ort zu erfahren. Falls es in Cleary ein Epizentrum gab, dann war es Ritt’s Drugstore.
Neben den verschriebenen Medikamenten teilte William Rat aus, Komplimente, Glückwünsche oder Kondolenzen, je nach persönlicher Situation seiner Kunden. Obwohl Marilee den weißen Laborkittel, den er im Laden trug, ein wenig prätentiös fand, schienen sich die Kunden nicht daran zu stören.
Natürlich gab es viele, die darüber spekulierten, warum er und Marilee unverheiratet geblieben waren und weiterhin zusammenwohnten. Manche Menschen fanden eine solche Nähe zwischen Bruder und Schwester befremdlich. Freundlich ausgedrückt. Sie versuchte, sich nicht davon beirren zu lassen, dass manche Menschen so über sie dachten.
Die Glocke über der Ladentür bimmelte wieder. Diesmal drehte sie sich nicht um, sondern blickte nur in die Spiegelwand hinter Lindas Arbeitsbereich, wo sie sah, wie Wes Hamer mit seinem Sohn Scott in den Laden trat.
Linda rief ihnen zu: »Hey, Wes, Scott, wie geht’s?«
Wes erwiderte ihren Gruß, aber gleichzeitig suchte er über den Spiegel Marilees Blick. Er kam an die Theke geschlendert, beugte sich über ihre Schulter und atmete den Kakaoduft ein. »Verdammt, riecht das gut. So einen nehme ich auch, Linda.«
»Hallo, Wes. Scott«, sagte Marilee.
Scott begrüßte sie mit einem gemurmelten: »Miss Ritt.«
Wes ließ sich auf dem Hocker neben ihrem nieder. Als er seine Beine unter die Theke schob, streifte sein Knie ihres. »Darf ich mich dazusetzen?«
»Aber natürlich.«
»Sie sollten nicht fluchen, Wes Hamer«, sagte Linda. »Schließlich sollen Sie den Kindern ein Vorbild sein und so.«
»Was habe ich denn gesagt?«
»Sie haben ›verdammt‹ gesagt.«
»Seit wann sind Sie denn so zickig? Ich kann mich an ein, zwei Gelegenheiten erinnern, an denen Sie auch kein Blatt vor den Mund genommen haben.«
Sie schnaubte, aber sie lächelte dabei. Frauen reagierten so auf Wes.
»Möchtest du auch einen Kakao, Schatz?«, fragte sie Scott, der mit gesenktem Kopf hinter seinem Vater stand, in seinen Mantel gehüllt, die Hände in den Taschen, und von einem Fuß auf den anderen trat. »Klar. Danke. Super.«
»Keine Sahne für ihn«, sagte Wes. »Er wird bei den Footballscouts keinen Stich machen, wenn er eine Wampe hat.«
»Ich glaube nicht, dass er Gefahr läuft, in nächster Zeit eine Wampe zu bekommen«, sagte Linda. Aber sie stellte die Sahne beiseite. Auch so reagierten die Menschen auf Wes.
Er drehte sich auf seinem Hocker zur Seite und sah Marilee an. »Wie macht sich Scott im Literaturkurs?«
»Sehr gut. In dem Test über Hawthorne hat er zweiundachtzig Prozent geschafft.«
»Zweiundachtzig, wie? Nicht schlecht. Nicht atemberaubend. Aber auch nicht schlecht«, wandte er sich über die Schulter an Scott. »Geh schon nach hinten und sprich ein paar Takte mit den jungen Damen. Seit du reingekommen bist, führen sie sich auf wie aufgescheuchte Hühner. Und lass William wissen, dass du da bist.«
Scott schlenderte mit seinem Kakao in der Hand davon.
»Die Mädchen umschwirren den Jungen wie die Fliegen«, sagte Wes, während er Scott nachschaute, der durch den Gang in Richtung Videoabteilung verschwand.
»Das überrascht mich nicht«, sagte Linda. »So niedlich, wie er ist.«
»Das scheinen sie alle zu glauben. Ständig rufen sie bei uns an und legen sofort wieder auf, wenn er nicht am Telefon ist. Das macht Dora ganz irre.«
»Und wie stehen Sie dazu, dass er bei den Damen so beliebt ist?«, fragte Marilee.
Wes’ Blick kam wieder auf ihr zu liegen, dann zwinkerte er ihr zu. »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.«
Sie sah in ihre Tasse und suchte nervös nach einer Erwiderung. »Scott macht sich auch im Nachhilfeunterricht gut. Seine Aufsätze sind bedeutend besser geworden.«
»Nachdem Sie ihn unterrichten, muss er schließlich was lernen.«
Im Herbst hatte sich Wes wenige Wochen nach Schulanfang an sie gewandt und gefragt, ob sie Scott samstagmorgens und sonntagabends Nachhilfe geben könne. Er bot ihr an, eine Aufwandsentschädigung für ihre Bemühungen zu zahlen, was sie anfangs abgelehnt hatte. Er hatte sich nicht abbringen lassen.
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Chill Factor« bei Simon & Schuster Inc., New York.
1. Auflage Deutsche Erstausgabe November 2009 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © Sandra Brown Management Ltd., 2005
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH. Umschlaggestaltung: HildenDesign, München Umschlagfoto: © Nicholas Reuss / Lonely Planet Images MD ∙ RF
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-10326-2
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Leseprobe