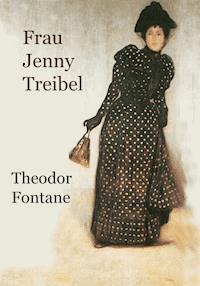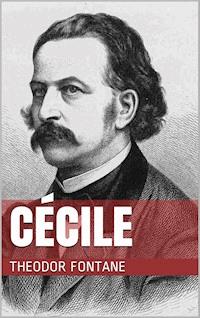17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die kurzweiligsten und angriffslustigsten Theaterkritiken Fontanes. Lachen entwaffne die Kritik, meint Fontane, unfreiwillig Komisches aber rufe den Theaterkritiker auf den Plan. Mit Fontane sitzen wir auf Parkettplatz 23 im Königlichen Schauspielhaus Berlin. Ob Klassiker oder Kassenschlager, ob französisches Theater oder „Freie Bühne“: Unvoreingenommen, aber mit scharfer Zunge beobachtet er den Erfolgsautor Hugo Lubliner, der statt Menschen nur „quiekende Puppen“ auf die Bühne stellt, die „hinreißende Gewalt“ Ibsen’scher Stücke und Goethes Schauspiel „Torquato Tasso“, das ihn unberührt lässt. Wir begegnen einem stummen Gefängniswärter, der als Einziger nichts Dummes sagt, und einem Klappstuhl, der in einer Hauptrolle zu sehen ist. Herausgegeben von Debora Helmer Mit einen Nachwort von Simon Strauß
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Theodor Fontane
Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 im märkischen Neuruppin geboren. Er erlernte den Apothekerberuf, den er 1849 aufgab, um sich als Journalist und freier Schriftsteller zu etablieren. Ein Jahr später heiratete er Emilie Rouanet-Kummer. Nach seiner Rückkehr von einem mehrjährigen England-Aufenthalt galt sein Hauptinteresse den »Wanderungen durch die Mark Brandenburg«. Neben der umfangreichen Tätigkeit als Kriegsberichterstatter, Reiseschriftsteller und Theaterkritiker schuf er seine berühmt gewordenen Romane und Erzählungen sowie die beiden Erinnerungsbücher »Meine Kinderjahre« und »Von Zwanzig bis Dreißig«. Fontane starb am 20. September 1898 in Berlin.
Informationen zum Buch
Die kurzweiligsten und angriffslustigsten Theaterkritiken Fontanes
Lachen entwaffne die Kritik, meint Fontane, unfreiwillig Komisches aber rufe den Theaterkritiker auf den Plan. Mit ihm sitzen wir auf seinem angestammten Parkettplatz 23 im Königlichen Schauspielhaus Berlin, wenn er Klassiker oder Kassenschlager, französisches Theater oder die »Freie Bühne« auf sich wirken lässt: Mit Wortspiel und Witz bewertet er in seinem charakteristischen Plauderton Stück, Sujet und Schauspieler.
»Ihr werdet schmunzeln und lächeln und blättern und lesen und immer weiterlesen.« Kurt Tucholsky über Fontanes Theaterkritiken
Mit einem Nachwort von Simon Strauß
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Theodor Fontane
Da sitzt das Scheusal wieder
Die besten Theaterkritiken
Herausgegeben und mit einer Einführung von Debora Helmer
Mit einem Nachwort von Simon Strauß
Inhaltsübersicht
Über Theodor Fontane
Informationen zum Buch
Newsletter
»›Da sitzt das Scheusal wieder‹, habe ich sehr oft auf den Gesichtern gelesen«. Eine EinführungVon Debora Helmer
Frivole Franzosen?
Eugène Scribe/Ernest Legouvé: Feenhände
Alexandre Dumas (père): Mademoiselle de Belle-Isle oder Die verhängnisvolle Wette
Victorien Sardou: Les vieux garçons
Philippe Dumanoir: Les femmes terribles
Alexandre Dumas (fils): L’étrangère
Wo die Natur versagt: Das Spiel
William Shakespeare: Hamlet
Friedrich Schiller: Kabale und Liebe
G.Conrad: Phädra
Johann Wolfgang Goethe: Götz von Berlichingen
Friedrich Schiller: Die Jungfrau von Orleans
William Shakespeare: Amleto, Principe di Danimarca
Albert Emil Brachvogel: Narziß
William Shakespeare: Othello, der Mohr von Venedig
Charlotte Birch-Pfeiffer: Die Waise von Lowood
Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg
»Ich danke für Obst!« – Kuddelmuddel und Grundkonfuses
Bernhard Scholz: Eine moderne Million
Leonhard Kohl von Kohlenegg: Macchiavella
Salomon Hermann von Mosenthal: Die Sirene
Johann Wolfgang Goethe: Die Geschwister; Anton Günther: Comtesse Dornröschen
Gustav von Moser: Reflexe; Eugen Staegemann: Die Namensvettern
A.Hackenthal: Eine Ehe von heut
A.Weimar: Magdalena
Otto Franz Gensichen: Lydia; Lothar Clement: Die vier Temperamente
Gustav zu Putlitz: Die Unterschrift des Königs; Johann Friedrich Jünger: Verstand und Leichtsinn; Gustav zu Putlitz: Epilog
Ludwig von Dóczi: Letzte Liebe
Gefühlsunwahrheiten
Ernst Raupach: Vor hundert Jahren
Karl Gutzkow: Der Gefangene von Metz
Rudolf Gottschall: Katharina Howard
Rudolf Gottschall: Herzog Bernhard von Weimar
Richard Voß: Treu dem Herrn
Von jenseits des gesunden Menschenverstandes
Carlo Marenco: Pia dei Tolomei
Gustav zu Putlitz: Die Idealisten
Otto Franz Gensichen: Frau Aspasia
Hugo Bürger: Aus der Großstadt
Franz von Schönthan: Roderich Heller
Friedrich Wilhelm Hackländer: Magnetische Kuren
Felix Philippi: Daniela
Hugo Lubliner: Der Name
Urteile der höheren Instanz: Das Gesetz in unserer Brust
Salomon Hermann von Mosenthal: Deborah
Wilhelmine von Hillern: Die Geier-Wally
Erckmann-Chatrian: Die Rantzau
Henrik Ibsen: Gespenster
Ernst von Wildenbruch: Der Fürst von Verona
Henrik Ibsen: Die Wildente
Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenaufgang
Arno Holz/Johannes Schlaf: Die Familie Selicke; Alexander Kielland: Auf dem Heimwege
Simon Strauß: Ein Fremdling auf der anderen Seitenlinie
Personenverzeichnis
Impressum
»›Da sitzt das Scheusal wieder‹, habe ich sehr oft auf den Gesichtern gelesen«Eine EinführungVon Debora Helmer
Auf seinem Stammplatz, dem Parkettplatz 23 im Königlichen Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, saß Theodor Fontane zum ersten Mal am 17.August1870; man gab Schillers »Wilhelm Tell«. Bis April hatte er zehn Jahre lang als Redakteur für die erzkonservative »Kreuz-Zeitung« gearbeitet, jetzt war er als Theaterkritiker bei der als liberal geltenden »Vossischen Zeitung« angestellt und hatte diesen Posten knapp zwanzig Jahre inne. In dieser Zeit sind insgesamt etwa 700 Theaterkritiken entstanden (649 Haupt- und 44 Nachtkritiken), von denen hier eine Auswahl von 46 Texten vorliegt.
Diese Zusammenstellung bildet einen repräsentativen Querschnitt, wobei von Klassikeraufführungen über französisches Theater, zeitgenössische Dramen und Gastspiele berühmter Schauspieler bis hin zu den Aufführungen naturalistischer Stücke auf der »Freien Bühne« alles versammelt ist, womit sich Fontane in dieser Zeit als Theaterkritiker auseinandergesetzt hat. 1889 übergab er seinen Posten bei der ›Vossin‹ an seinen Nachfolger Paul Schlenther, besprach aber noch fünf Aufführungen der »Freien Bühne«.
In der vorliegenden Auswahl überwiegen die Verrisse, was durchaus repräsentativ ist. Das mag zum einen an der Textsorte und dem Publikationsort liegen, schließlich schrieb Fontane für das Feuilleton einer der größten Berliner Tageszeitungen, war also zu Unterhaltung verpflichtet. Zum anderen hat er seine Aufgabe sehr ernst genommen und das, was sich ihm darbot, stets einem kritisch-professionellen Blick unterzogen. Auch wenn ihn ein Kollege als »Theaterfremdling«, abgeleitet von seinen Initialen Th. F., zu verunglimpfen suchte, weil er auf diesem Gebiet keine akademische Vorbildung besaß, hatte er sich doch bereits als Journalist profiliert, war mit poetischen Texten an die Öffentlichkeit getreten und gehörte verschiedenen literarischen Vereinigungen an. Nicht weniger wichtig war ihm jedoch die eigene Überzeugung seiner ästhetischen Urteilsfähigkeit, die ihn erkennen ließ, wenn er eine dramatische oder schauspielerische Glanzleistung – oder eben ein ›grundkonfuses Kuddelmuddel‹ vor sich hatte. Und in letzterem Falle scheute er sich nicht, seine Meinung zu sagen, gerade wenn sie abwich von der des Publikums, das sich in Fontanes Augen nicht unbedingt durch Sicherheit in Geschmacksfragen auszeichnete.
Obwohl das Königliche Schauspielhaus subventioniert wurde und nicht in gleicher Weise wie die vielen privaten Berliner Theater auf finanziellen Erfolg angewiesen war, wurde der Spielplan einerseits von zeitgenössischen Lustspielen, oft nach französischem Vorbild, dominiert, andererseits bot ein festes Repertoire an Klassikern vor allem den gastierenden Schauspielern die Gelegenheit, ihr Können als Luise Millerin, Don Carlos, Gretchen oder Othello zu zeigen. Weiterhin gehörten zum Repertoire ältere, in Fontanes Augen veraltete Dramen, die nur mehr ›verstaubt‹ daherkamen. Ein viel bedientes Genre in dieser Hinsicht war das historische Trauerspiel. Eher selten fühlte sich Fontane von dem, was er auf der Bühne sah, »in das Reich idealer Kunst emporgetragen«, wie er anlässlich einer Aufführung von Schillers »Piccolomini« schrieb. Dabei sprach er dem Theater durchaus die Aufgabe einer Bildungsstätte zu – eine Aufgabe, der sich die Königlichen Schauspiele unter den Intendanten Botho von Hülsen, der das Amt bis 1886 innehatte, und Bolko von Hochberg gerade nicht stellten. Nun war die zweite Hälfte des 19.Jahrhunderts nicht unbedingt eine Blütezeit des deutschen Dramas; von den zeitgenössischen Autoren, die heute noch zum Kanon gehören, wie Friedrich Hebbel und Franz Grillparzer, besprach Fontane lediglich Grillparzers »Des Meeres und der Liebe Wellen« und Hebbels »Herodes und Mariamne«.
Bei alledem zog Fontane ein gut gespieltes triviales Lustspiel einer schlechten Klassiker-Aufführung vor: »Ein gut gemalter Kohlkopf jagt drei schlecht gemalte Heilige zum Tempel hinaus.« (Kritik vom 20.12.1883) Wiederholt gab er zu bedenken, dass das Ensemble des Königlichen Schauspielhauses für das »Klassisch-Ideale« wie für das »Historisch-Romantische« ungleich weniger geeignet sei als für Lustspiel und Konversationsstück. Auch ist hierbei die damalige Aufführungspraxis zu berücksichtigen, speziell die des Königlichen Schauspielhauses, während im Wiener Burgtheater zum Teil andere Regeln galten. So war es zum Beispiel üblich, selbst für Neueinstudierungen oder Novitäten nicht mehr als drei Proben anzusetzen. Auch einen Regisseur oder Dramaturgen im heutigen Verständnis gab es zu dieser Zeit am Königlichen Schauspielhaus nicht. Die entsprechenden Aufgaben übernahm in der Regel einer der erfahreneren Schauspieler selbst. Bisweilen wurden auch Rollenmonopole zum Problem: Dem Schauspieler Theodor Liedtcke stand laut Vertrag von 1853 die Rolle des ersten bzw. jugendlichen Liebhabers sowie des Bonvivants im Lustspiel zu, und weil er 1884 immer noch auf dieser Vertragsklausel bestand, musste der Intendant schließlich den Kaiser höchstpersönlich bitten, einzugreifen und den inzwischen auf die sechzig zugehenden Liedtcke zu veranlassen, geeignetere Rollen zu übernehmen.
In Fontanes Theaterkritiken wird, wenn es sich um ein neues oder neu einstudiertes Stück handelt, vor allem der Inhalt referiert und bewertet. Im Falle von Klassikern oder viel gespielten zeitgenössischen Stücken steht die Aufführung als solche im Vordergrund, wobei wir heutigen Leser vollständig auf die Vermittlung durch den Kritiker angewiesen sind. Während Fontane in dieser Hinsicht, der Bewertung der schauspielerischen Leistungen, zurückhaltender ist, transportieren seine höchst amüsanten Inhaltsangaben oft schon ein Gutteil der Bewertung.
Kapitel 1 enthält vor allem Kritiken zu Aufführungen des französischen Theaters. Auf Wunsch der Kaiserin Augusta wurde 1874 und 1877 bis 1879 jeweils von Januar bis April erstmals wieder eine französische Theatertruppe nach Berlin eingeladen, nachdem der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 diese jährlichen Gastspiele unterbrochen hatte. Diese Wiederaufnahme der seit 1828 bestehenden Tradition stieß angesichts des angespannten deutsch-französischen Verhältnisses nicht überall auf Beifall, auch galten die favorisierten französischen Lustspiele und Konversationsstücke gemeinhin als frivol und sittenlos. Fontane allerdings war bei allen Vorbehalten durchaus der Meinung, dass das Ensemble des Königlichen Schauspielhauses von den französischen Kollegen einiges lernen könnte.
Um mangelhafte bis unzureichende schauspielerische Leistungen geht es im Kapitel 2 mit Besprechungen zu Klassikern wie Goethe, Schiller und Shakespeare, zu Wohlbekanntem wie Charlotte Birch-Pfeiffers »Die Grille« und weniger Bekanntem wie G.Conrads »Phädra« (unter diesem Pseudonym veröffentlichte Georg, Prinz von Preußen, Großneffe von König Friedrich Wilhelm III., seine Dramen). Das kritische Interesse gilt hier vor allem den Auftritten von Gastschauspielern, berühmten wie der Tragödin Clara Ziegler und weniger berühmten wie Louise Eppner vom Freiburger Stadttheater. Bei den vielen ›Gastspielen auf Engagement‹, die die immer wiederkehrende Aufführung von Stücken mit Paraderollen zur Folge hatten, sollte dem jeweiligen Gast die Möglichkeit geboten werden, anhand von drei aussagekräftigen Auftritten Publikum und Rezensenten von der Qualität seines Spiels zu überzeugen. Diese Kritiken sind in der Regel eher kurz, weil Fontane meistens kaum etwas über das jeweilige Drama und nur wenig über die Aufführung als solche sagt, sondern sich auf die betreffende Gastschauspielerin oder den Gastschauspieler konzentriert.
Kapitel 3–5 umfassen Texte, die sich in ihren Hauptkritikpunkten entsprechen.
Unter dem Titel »Ich danke für Obst« (Kapitel 3) finden sich Besprechungen zu Stücken, die in Fontanes Augen ›grundkonfus‹ und ›abgestanden‹ sind und in ihrer schlimmsten Ausprägung ein »Kuddelmuddel, ja […] ein vollständiges Gequatsche« darstellen (S. 115). Meist sind es zeitgenössische Lust- und Schauspiele, in denen statt originaler Figuren und Situationen nur mehr Typen die Szene bevölkern: die Kicherkatze und der dumme Pantoffel-Präsident, der nichtssagende Lückenbüßer-Freund und die kokette Generalin: »mitunter wird einem mehr zugemuthet, als zu tragen möglich ist« (S. 104). Und gerade wenn Fontane bestrebt ist, den Eindruck des Nörglers und Krittlers doch noch durch ein Lob wettzumachen, ist der Erfolg seines Bemühens mehr als zweifelhaft: So heißt es z.B. am Schluss der Besprechung von A.Hackenthals »Eine Ehe von heut‹« (ein Schauspiel, das er zu Beginn als ›gescheitert‹ bezeichnet): »Das Stück, mit all seinen Fehlern, ist doch sehr talentvoll und selbst mein innerlichstes Widerstreben gegen Stoff und Richtung desselben kann mich nicht hindern dies allerbereitwilligst zuzugestehen.« (S. 98)
Die für Kapitel 4 ausgewählten Stücke vom Typus des Historiendramas sind in Fontanes Augen mit dem Makel der ›Gefühlsunwahrheit‹ behaftet. Für sie gilt, was er in der Kritik zu Ernst Raupachs »Vor hundert Jahren« schreibt: »Ein bühnengeschicktes, effektvolles, aber innerlich hohles Ding, unwürdig, grundsatzlos, ethisch-verwirrend, weil alles richtige Empfinden darin auf den Kopf gestellt wird.« (S. 119) Die Kritiken zu selbigen Historiendramen sind vergleichsweise lang, weil sich der Rezensent ausführlich mit dem Inhalt beschäftigt. So legt er anhand der Nacherzählung von Richard Voß’ »Treu dem Herrn« detailliert dar, was er in erster Linie zu beanstanden hat: »Und so nicht blos an dieser Stelle, sondern wohin man blickt; nirgends klappt es und paßt es in diesem Stück«, und alles »berührt häßlich, alles ist krumm und schief« (S. 137).
Die Kritiken in Kapitel 5, »Von jenseits des guten Menschenverstandes«, befassen sich mit Stücken, denen es vor allem an innerer Logik des Handlungsablaufs fehlt. Die einzelne Szene zähle mehr als das große Ganze; viele Rollen seien »zu sehr aus dem Unverstand des Lebens geschöpft«, und im schlimmsten Falle ist »alles Unsinn von Anfang bis Ende« (S. 165). Hugo Lubliner und Otto Franz Gensichen wirft er vor, ihre Stücke seien nicht viel mehr als ›Szenen-Aneinanderreihungskunst‹, bei der »mit Vorliebe gepflegtes Achthaben auf die Theile, leicht zur Vernachlässigung des Ganzen führt« (S. 150).
Das 6. und letzte Kapitel präsentiert Texte, die sich durch ihren Enthusiasmus von den vorherigen deutlich absetzen. Ausschlaggebend für ihre Aufnahme war jedoch nicht das Kriterium des Lobes (auch ein absoluter Verriss ist mit der Kritik zu Ernst von Wildenbruchs »Fürst von Verona« darunter), sondern die selbstreflexiven Passagen, in denen Fontane Rechenschaft ablegt über seine Tätigkeit als Kritiker. Hier kommen die Kriterien zur Sprache, nach denen er seine Bewertungen vornimmt, hier spricht er über das ›Gesetz in unserer Brust‹, das wichtiger ist als ›das ästhetische Gesetz‹.
In diese Gruppe gehören auch die naturalistischen Dramen (Ibsen, Schlaf/Holz, Hauptmann), deren Aufführungen in das Ende seiner Zeit als Theaterkritiker fallen. Fontane stand dieser Strömung mit einer bemerkenswerten Offenheit gegenüber – anders als viele seiner Kollegen. So hat er neun Aufführungen des Vereins »Freie Bühne« besprochen. Dieser Verein hatte sich 1889 gegründet, um unabhängig von der Theaterzensur moderne, und das heißt: vor allem naturalistische Dramen aufführen zu können. Als Verein, dessen Mitglieder einen Jahresbeitrag zahlten und sich damit das Recht erwarben, jährlich an die zehn Aufführungen zu besuchen – die also nicht öffentlich waren –, befand er sich außerhalb des Zugriffes der Zensur. Die »Freie Bühne« brachte Gerhart Hauptmanns »Vor Sonnenaufgang« als Uraufführung heraus, Bjørnstjerne Bjørnsons »Ein Handschuh« und von Johannes Schlaf/Arno Holz »Die Familie Selicke«, ein Stück, das Fontane nachhaltig beeindruckte. Hier werde wirkliches Neuland betreten, schreibt er in seiner Kritik, die u.a. der Frage nachgeht, was denn eigentlich Kunst ausmache und wie ›wirkliches Leben‹ in Kunst zu überführen sei.
»Ich bin nicht ungern ins Theater gegangen, und wenn ich mal da war, habe ich mich immer amüsiert, auch wenn es scheußlich war, fällt aber der Zwang fort, so werde ich von nun an wohl lieber zu Hause bleiben«, schrieb er am Ende seiner Amtszeit an seinen Nachfolger Paul Schlenther (Brief vom 4.Dezember1889). Immerhin war er zu diesem Zeitpunkt fast 70 Jahre alt. In den Erinnerungen an die Zeit als Theaterkritiker beschreibt er seinen Parkettplatz 23 als einen ›merkwürdigen Platz‹, auf dem er zwar viele angenehme Stunden verbracht habe, der aber von seiner Anordnung her schon etwas abgesondert war: Der Kritiker war dort den Blicken eines Publikums ausgesetzt, das nicht immer seiner Meinung war und das mitunter auch vernehmlich kundtat. »Denn man bilde sich nur nicht ein, daß ein Theaterkritiker ein Richter ist, viel öfter ist er ein Angeklagter. ›Da sitzt das Scheusal wieder‹, habe ich sehr oft auf den Gesichtern gelesen.« (Theodor Fontane: Kritische Jahre – Kritiker-Jahre. Autobiographische Bruchstücke aus den Handschriften herausgegeben. Hrsg. von Conrad Höfer. Eisenach 1934, S.7.)
Dem missbilligenden Blick auf seine Person, hervorgerufen durch die kritische Besprechung eines Schauspielers oder eines Dramas, suchte Fontane zu begegnen, indem er in den Kritiken selbst auf seine Rolle einging, sich für harsche Urteile rechtfertigte und seinen Lesern die Kriterien darlegte, anhand deren er seine Wertungen vornahm. So heißt es etwa in der Kritik zu Ernst von Wildenbruchs »Fürst von Verona«: »Es ist nicht so schlimm mit dem Rezensententhum, wie dem Publikum beständig vorgeredet wird; die Kritik ist kein Tadel-Institut, aber freilich auch keine Beifalls-Statistik; sie hat Besseres zu thun, als die Zahl der Hervorrufe zu registriren; sie soll nicht durch Applaus und nicht einmal durch dauernd erscheinende Triumphe bestimmt werden, sie soll ihr Gesetz, am besten das ins eigene Herz geschriebene, haben und danach verfahren; wenn sie das nicht kann, so ist sie ›gut für nichts.‹« (S. 202)
In der Tat richtete sich Fontane in seinen – oft situationsgebundenen – Urteilen lediglich nach den eigenen Vorstellungen von gut und schlecht; dabei war er vorurteilsfrei gegenüber Neuem, revidierte gegebenenfalls seine Meinung und scheute sich nicht, Goethes »Torquato Tasso« uninteressant, Wilhelmine von Hillerns »Geier-Wally« dagegen brillant zu finden.
Die zeitüberdauernde Lebendigkeit seiner Theaterkritiken verdankt sich nicht zuletzt dieser Unabhängigkeit seines Urteils, mehr noch aber seinem berühmten Plauderton und seiner unakademischen, bilderreichen und durch Berolinismen und Neologismen angereicherten Sprache.
Dennoch ist der Abstand von etwa 140 Jahren nicht zu übersehen, der uns von der Entstehungszeit dieser Texte trennt. Vieles, was dem Zeitungsleser von damals selbstverständlich bekannt war, gehört heute nicht mehr zum allgemeinen Wissensstand. Manche Anspielungen und Vergleiche bedürfen der Erläuterung – was aber nicht heißt, dass man Fontanes Theaterkritiken nicht auch ohne sie lesen, verstehen und genießen könne. Alle aber, die durch die Lektüre dieses Auswahlbandes so recht auf den Geschmack gekommen sind und einen Sinn für umfassende Erläuterungen und vertiefende Kontextualisierung haben, seien an dieser Stelle auf die vierbändige, erstmals vollständig edierte und kommentierte Gesamtausgabe der Theaterkritiken hingewiesen, die 2018 ebenfalls im Aufbau Verlag erschienen ist.
Frivole Franzosen?
Eugène Scribe/Ernest LegouvéFeenhände
Aufführung vom 31.10.1871; Kritik vom 2.11.1871
Dienstag den 31. Oktober zum ersten Male: »Feenhände«, Lustspiel in 5 Akten nach dem Französischen des Scribe von Ch. v. Graven.
Widerstreitende Empfindungen haben uns gestern bei der Aufführung dieses Scribe’schen Stücks begleitet. Es konnte nicht anders sein. Das Ganze ist eine Mischung von bewährter, liebenswürdiger Routine auf der einen Seite und von häßlicher Condescenz gegen die Tagesphrase auf der andern: wo jene sich geltend macht, wie in den Rollen der Marquise von Méneville, der Frau von Berny, des Herzogs von Penn-Mar und des bretagnischen Edelmanns Richard von Kerbriand, wird man sehr angenehm berührt und in die heiteren Regionen der Kunst erhoben; wo diese, die Condescenz gegen die Tagesphrase, hervortritt (und dies ist der eigentliche Inhalt des Stücks, sein Lebenskeim) wird man abgestoßen und gelangweilt zu gleicher Zeit. Hier soll die Neuheit und die Piquanterie liegen, diese Piquanterie ist aber nur Gesinnungslosigkeit, ein rücksichtsloses Rücksichtnehmen auf das Eine: was wirkt heute? was will der Epicier hören und sehen? Aus diesem feigen sich Unterwerfen, worin die französischen Schriftsteller (und die populären am meisten) immer groß waren, ist zu erheblichem Theile das Unheil entstanden, das alle 20 Jahr einmal, in dieser oder jener Gestalt, über die Pariser Bevölkerung hereinbricht; alles was berufen wäre, geistig zu leiten, zieht es vor, servil die Schleppe zu tragen, und wenn dann die Saat aufgeht, dann ist ein Verwundern, dann giebt es ein Weiß-waschen oder wohl gar eine sittliche Empörung, und die Deportations-Schiffe füllen sich mit Tausenden, die an einem warmen Sumpfplatz die Zeche bezahlen müssen. Der ältere Dumas – in vielen Beziehungen der Liebenswürdigsten einer, die je gelebt – er theilte nichtsdestoweniger die große Krankheit seiner Nation, und als er 1848 in die Assemblée gewählt werden wollte, empfahl er sich seinen Wählern nicht als Alexander Dumas, sondern als »Arbeiter«, und rechnete seinen anwesenden neuen Collegen vor, welchen Nutzen er der Produktion respective der Ouvrierschaft Frankreichs dadurch gethan habe, daß er durch seine Arbeit die Arbeit von drei Papiermüllern, sechs Setzern und wenigstens 600 Theaterleuten gesichert habe. In ähnlicher Weise proklamirt der alte Scribe in diesem seinem Lustspiel den Satz, daß der alte Adel, wenn er in der Klemme ist, am besten thut, ein Putzgeschäft zu etabliren. Dies muß natürlich sämmtliche Nätherinnen von Paris, sämmtliche Rigolettes und ihre Liebhaber bis zu schwindelnder Bewunderung hinreißen. Wir unsererseits können diesem Gefühlsfluge nicht folgen. Aber erst die Geschichte.
Die alte gräfliche Familie Lenève lebt in der Bretagne: die Gräfin-Wittwe, der Graf ihr Sohn, Graf Tristan ihr Enkel, noch eine Enkelin und eine Nichte. Diese letztere ist die glückliche Inhaberin der »Feenhände«, wovon man aber wenig gewahr wird. Es steht schlecht mit den Finanzen des Hauses, Graf Tristan, der durch eine reiche Heirath die Dinge wieder in Balance bringen soll, hat das Unglück, sich in die Nichte (Gräfin Helene), die arm ist, zu verlieben, und so bleibt nichts anderes übrig, als die schöne Helene aus dem Hause zu schicken. Wer Feenhände hat, wird schon durchkommen. Und so geschieht es denn auch. Zwei Jahre sind ins Land gegangen; Gräfin Helene ist vorläufig verschollen; die bretagnische Familie kommt nach Paris, immer noch mit Ordnung ihrer Finanzen beschäftigt. Ja, diese Dinge haben bereits eine äußerste Dringlichkeit angenommen. Da plötzlich, im Vorzimmer der Marquise von Méneville, treffen die gräfliche Familie Lenève und die verschollen geglaubte Helene zusammen. Sie ist reich geworden, man findet sie schöner, mehr Fee denn je; die Annahme scheint gerechtfertigt, daß sie Herzogin von St. Leu geworden sei; alles drängt sich an sie, besonders der in Geldnöthen ringende Graf; da fällt die Maske, – Gräfin Helene, die geträumte Herzogin von St. Leu, ist Putzmacherin, Vorsteherin eines großen Kleider-Kunstinstituts. Die Familie ist entsetzt; die Gräfin-Wittwe wie deren Sohn, der brouillirte Graf, sagen sich von ihr los, kennen sie nicht mehr. Aber – das Verhängniß schreitet schnell. Ueber dem Haupte des Grafen schlagen schlimme Wechsel, Doppelverkauf eines ihm nicht gehörigen Guts und ähnliche trübe Wellen immer bedrohlicher zusammen, da tritt die »Fee« rettend dazwischen, hier nimmt sie 60000 Francs aus dem Schubfach, dort legt sie eine Eisenbahn über die Güter des Grafen, alles staunt, alles schluchzt, »sie ist doch eine Lenève«, und als sie schließlich ihre Hand dem Grafen Tristan reicht, der seinerseits eine Art Putzgeschäft innerhalb der Advokatur zu treiben gedenkt, fällt der Vorhang und alles ist aus.
Vielleicht hatte Scribe selbst eine Vorstellung davon, daß das Ganze eigentlich ein Märchenstoff sei, und gab ihm deshalb den Titel »Feenhände«. Es ist Aschenputel, es ist die Kehrseite vom Kesselflicker, der sich als Prinz träumt. Märchenhaft aufgefaßt, als Königstochter, die die Schafe weidet und dann in ihres Vaters Schloß zurückkehrt, um dem Prinzen Kolibri ihre Hand zu reichen, könnte dies alles entzückend sein, als Zeit- und Lebensbild aber ist es, um das Mindeste zu sagen, nicht hinnehmbar.
Man mißverstehe uns nicht. Wir gehören nicht zu denen, die die Menschheit erst vom Baron an aufwärts zu rechnen beginnen, wir haben mitunter ein leises Vorgefühl davon, als würden wir unsere Tage nicht hier, sondern in Gegenden beschließen, wo es keine Herzöge und keine Grafen giebt, und wir glauben dabei des Einen sicher zu sein, daß die Feudalpyramide mit zu dem Letzten gehören dürfte, was wir da drüben wirklich entbehren würden. Ja, ein weiteres Geständniß mag hier eine Stelle finden: Wir haben auch »diesseits des großen Wassers« nichts dagegen, daß eine Gräfin ihre Feenhände dazu verwendet, den Confections-Geschäften und Modistinnen der Hauptstadt Concurrenz zu machen. Eine liebenswürdige Putzmacherin von altem Adel ist unzweifelhaft mehr werth, als eine pretentiöse Bettelgräfin, – es kommt nur darauf an, ob diese Dinge in einem Einzelfall, als einfache, nichts bedeuten-wollende Thatsache an uns herantreten, oder ob sie mit einem »geht hin und thut desgleichen«, will also sagen als ein neues Zeit-Evangelium, prinzipiell und gesinnungstüchtig, von der Bühne her zu uns sprechen. Hier, in der alten Welt, wie die Dinge nun mal liegen, ist dies alles einfach Umsturz; natürlich (denn dazu ist dies alles viel zu dünn) keine Pulvermine, die den ganzen Bau großartig über den Haufen wirft, sondern ein einzelner Spatenstich unter den hunderten und tausenden, die jeden Tag gemacht werden, die Fundamente zu untergraben.
Und das that ein Scribe! Daß er es that, das ist es ganz speziell, was unserem Unmuth immer neue Nahrung giebt. Die Thorheit, die Unconsequenz, vor allem die Kurzsichtigkeit, sie sind es, die uns verdrießen, – das gänzliche Vergessen des alten: heute Dir und morgen mir.
Die Welt liegt in Wehen; wer will sagen, was geboren wird! Der Sturz des Alten bereitet sich vor. Gut, die Dinge gehen ihren ewigen Gang; thut eure Maulwurfsarbeit, ihr, die ihr unten seid. Millionen leben, die an dem Fortbestand dessen, was da ist, kein besonderes Interesse haben können, die eine Art Recht haben, wie an der Glücksbude, die Chancen eines Wechsels der Dinge zu befragen. Mögen sie thun, was sie nicht lassen können, und mag es über uns hereinbrechen früher oder später. Aber Wahnsinn ist es und Verbrechen, wenn die »begünstigte Minorität«, der Scribe in einem eminenten Sinne angehörte, wenn die, die nur verlieren und nie gewinnen können, wenn diese, sag ich, aus Eitelkeit, aus Popularitätshascherei und Gewinnsucht von heut auf morgen (denn die Gefahr des Uebermorgen beschwören sie selbst herauf) sich selber das Brett unter den Füßen fortziehen. Das zu sehen ist unheimlich, widerwärtig und reizt zum Widerspruch.
Der alte Scribe, er wob diese fünf Akte nicht mit jenen leichten, graziösen »Feenhänden«, die er sonst wohl hatte; ein röthlich schimmerndes, wunderliches Gewebe ist dieses Stück, in das der alte Lustspielmeister noch hier und da gefällige Figuren einzuzeichnen verstand, das aber vor allem auch jenen dämonischen Einschlag hat, aus dem zu gegebener Stunde die Flamme schlägt. Th. F.
Alexandre Dumas (père)Mademoiselle de Belle-Isle oder Die verhängnisvolle Wette
Aufführung vom 3.12.1873; Kritik vom 5.12.1873
Mittwoch den 3.Dezember neu einstudirt: Mademoiselle de Belle-Isle, oder: Die verhängnißvolle Wette, Drama in 5 Abtheilungen, nach dem Französischen des A.Dumas von F.v. Holbein.
Die alte Anziehungskraft dieser »verhängnißvollen Wette« – denn um eine solche handelt es sich in diesem vielleicht besten Dumas’schen Stücke – hatte sich neu bewährt und das Haus war in Parquet und Rängen gut besetzt. Ob die Erwartungen in Erfüllung gingen, mit denen das Publikum herbeigekommen war, möchten wir nach den Beifallsbezeugungen, die sich auf temperirter Stufe hielten, bezweifeln. Vor dreißig Jahren zählte Mademoiselle de Belle-Isle zu den Lieblingsstücken und erntete bei jeder Vorstellung reichlichsten Applaus; warum blieb er gestern aus? lag es einfach daran, daß der Zauber der Neuheit hin ist, oder aber lag es am Spiel? Alte Theater-Enthusiasten, die alle Herrlichkeit der Kunst immer nur in zurückliegenden Jahrzehnten erblicken, werden natürlich von den »Tagen der Crelinger« sprechen und damit rund und nett ihr Urtheil gegeben haben; wenn wir aber im Gedächtniß behalten, daß diese Tage der Crelinger auch die Tage Crüsemann’s und Grua’s waren, die mit ihr, auch in diesem Stück, nach dem Preise rangen, so können wir nicht zugeben, seitdem Rückschritte gemacht zu haben. Im Gegentheil. Und doch müssen wir andererseits den nur geringen Erfolg, den Mademoiselle de Belle-Isle am Mittwoch Abend zu erringen wußte, einer gewissen Unausreichendheit des Spieles zuschreiben. Nicht daß es früher besser gewesen wäre, nur einfach, wie sich die Dinge gestern gaben, gaben sie sich nicht gut. Nicht gut, weil wir vielleicht größere Anforderungen stellen. Der Zauber dieses Stückes beruht auf dem Umstand, daß alles an und in ihm specifisch-französisch ist und es kann heutzutage nur wirken, wenn die Darstellung dieser nationalen Seite gerecht wird. Hat man aber beständig die Empfindung, daß das Stück am Hofe des Markgrafen von Schwedt spiele, und daß die Wiege der Marquise von St. Prie an Pegnitz oder Regnitz, die Wiege des schönen Fräuleins von Belle Isle aber sogar an Ober- oder Unterspree gestanden habe, da wo sie die Grenze zwischen Teltow und Nieder-Barnim zieht, so ist all’ diesen Gestalten ihr chic genommen, und wir haben nicht mehr Leben, sondern nur noch Komödie vor uns. An Fräulein Stollberg’s (Marquise von St. Prie) Gehen oder Bleiben hätte eben nie und nimmer eine Ministerkrisis hängen können, und vor Fräulein Keßler’s (Gabriele v. Belle-Isle) gemüthlich-weinerlichen Ton wären die Pforten der Bastille wie von selber aufgesprungen. Dann aber hätte das ganze Stück ein Ende gehabt. Aehnliches gilt von Herrn Liedtke’s Herzog von Richelieu. Das Feuer dieses Herzogs würde nie und nimmer den Schlüssel zur geheimen Thür in 2 Stunden 40 Minuten von Paris nach Chantilly geschafft haben. Die gute Haltung war da, aber was wir vermißten, war: »le diable au corps«. Und das kann füglich im Hinblick auf die Darstellung von jeder einzelnen Rolle des Stückes gesagt werden. Alles spielt in Charlottenburg aber nicht in Chantilly. Es fehlt das Temperament. Herr Ludwig (Chevalier d’Aubigny) trachtete seiner Rolle jenes Maaß von Leidenschaft zu geben, das ihr zukommt, aber es war die Leidenschaft eines Ferdinand v. Walter, nicht die eines d’Aubigny. Keiner der Mitspielenden ließ es an Eifer und gutem Willen gebrechen, jeder indeß blieb in den Fesseln seiner Nationalität. Man kann sagen, wie sich Fräulein Horn, eine übrigens sehr angenehme Erscheinung, in der kleinen Rolle der Mariette zu einer wirklichen fille de chambre verhielt, so verhielt sich die ganze Aufführung zu einer ächt-französischen. An dieser Aechtheit hängt aber alles. Champagner der nicht mehr schäumt, ist kein Champagner mehr. Th. F.
Victorien SardouLes vieux garçons
Aufführung vom 1.1.1874; Kritik vom 3.1.1874
Die Vorstellungen der französischen Schauspieler-Gesellschaft (unter Leitung des Herrn Luguet) begannen am Neujahrstage im Saaltheater des königlichen Schauspielhauses. Sardou’s Les vieux garçons hatte man zur Eröffnung gewählt. Auf 6½ Uhr war der Beginn der Vorstellung festgesetzt. Um eben diese Stunde machte der Saal noch einen Eindruck, wie – vor 50 Jahren wenigstens – eine Karte von Inner-Afrika. Wir sagten freilich besser von Grönland, weil wir dadurch zugleich die Temperaturverhältnisse angedeutet haben würden. Durch das Fenster links kam eine eisige Luft, und wir begannen bereits den sicheren Einsatz an Gesundheit gegen einen unsicheren an Genuß zu berechnen. Aber es kam Alles anders. Der Saal füllte sich rasch, jedenfalls aber während der ersten Akte, mit Licht, Leben, Wärme, und gleichen Schritt mit dem Wachsen dieser letzteren hielt, von dem Aufgehen des Vorhangs an, auch die Herzenswärme, die vom Nullpunkt nicht gerade bis zur Siedehitze des Enthusiasmus, aber doch bis zur wohlthuenden Temperatur des »satisfait« sich steigerte. Wir möchten annehmen, daß Herr Luguet sich und die Seinen zu dem Resultate der Vorstellung beglückwünscht hat. Wenigstens durfte er es.
Bei dem Inhalt des Stückes verweilen wir nicht, denselben als bekannt voraussetzend. Der moderne Mensch muß Alles wissen und weiß deshalb »bekanntlich« auch Alles, am meisten Das, was er nicht weiß. Der Inhalt ist übrigens in Bezug auf Das, was ich noch zu sagen haben werde, gleichgiltig. Nur um Gestalten handelt es sich und um die Fähigkeit, dieselben wahr und lebensvoll darzustellen. Der Gang des Stückes, wie es endet, wie die Verwickelungen geschürzt und gelöst werden, alles Dies kommt für unsere heutige Besprechung wenig in Betracht.
»Les vieux garçons« besteht aus 14 Rollen. Es wäre unbillig zu verlangen, daß sie sammt und sonders in guten Händen sein sollten. Einzelnes war geradezu schwach. Wir bezeichnen Niemand, um nicht nutzlos die schon schwierige Situation noch schwieriger zu machen. Nur Diejenigen seien nahmhaft gemacht, die durch vortreffliches Spiel hervorragten. Es waren dies: Mr. Luguet in der Rolle des Mortemer, Mr. Lacombe in der des Veaucourtois, Mr. Gauthier in der des Chavenay, Mademoiselle Dany in der Rolle der Antoinette und Mademoiselle Britchel in der der Nina.
Mr. Luguet – bei seinem Auftreten vom Publikum begrüßt – ist ein vorzüglicher Darsteller. Er glänzt durch das Beste, was ein Künstler haben kann, durch Einfachheit und Natürlichkeit. Keine Spur von Uebertreibung, keine falschen Mittel, keine Versuche, den Beifall beschleunigen oder erzwingen zu wollen. Er muß kommen; in Ruhe wartet er seiner Zeit. Man charakterisirt Mr. Luguet’s Spiel vielleicht am Besten, wenn man es als ein gutes deutsches Spiel bezeichnet.
Mr. Lacombe (Veaucourtois) ist von großer komischer Kraft. Diese Mischung von Frivolität, Bonhommie und Selbstpersiflage, diese heiter-zweifelvolle Stellung zu der ganzen Welt der Grundsätze und Prinzipien, mit Ausnahme des einzigen: möglichst angenehm zu leben, diese theils in Naturanlage, theils in Angewohnheit wurzelnde Begabung, auch das Verdrießliche leicht, das Schmerzliche lustig zu nehmen, dies ganze, den französischen »vieux garçon« so vollkommen und zugleich so liebenswürdig würdig charakterisirende Wesen kam in seinem Spiel vortrefflich zur Erscheinung.
Mr. Gauthier (Chavenay) gab mit gleicher Auszeichnung eine andere Type der französischen Gesellschaft: den eleganten, die ganze Welt der Formen mit vollkommenster Sicherheit beherrschenden Cavalier. Jene Modezeitungsbilder: schwarzes Haar und Schnurrbart, 6 Fuß hoch, gradlinig-aufrecht ohne Steifheit, Jagdrock und Gamaschen, Hühnerhund und Doppelflinte – jene Halbgötter, denen gegenüber ich so oft, kleinlaut und wehmüthig, die Frage an das Schicksal gerichtet habe: »giebt es solche Menschen?« hier hatt’ ich einen. Ach, und es ist nutzlos, sich durch Scherze mit ihnen abfinden und sie das »geistige Uebergewicht« empfinden lassen zu wollen; sie siegen doch. Und es ist auch gut so. Das in seiner Fortdauer lediglich auf den Professor gestellte Menschengeschlecht, wo würd’ es schließlich landen?!
Mademoiselle Dany (Antoinette) war eine höchst anmuthige Vertreterin jenes »chic«, der seine vollkommensten Blüthen nur in Frankreich treibt. An die Stelle der Natur tritt eine Berechnung, der gegenüber in jedem Augenblick das Wort Lady Milfort’s citirt werden kann: »Ich lasse alle Minen springen.« Was der alte Fritz vom preußischen Staat verlangte, immer »en vedette« zu sein, das wird hier von jedem Organ des physischen Menschen verlangt. Von der Chevelure bis zur Chaussure, von dem rothblonden Haar an bis hinunter zum Fuß, der vorgestreckt wird, um ihn am Kaminfeuer zu wärmen – Alles befindet sich auf einem unausgesetzten qui vive. Nichts darf ruhen und rasten, denn der nächste Augenblick schon kann neue Bataillone nöthig machen. Jetzt blitzen die Zähne, jetzt starrt oder rollt das Auge, jetzt spitzt oder rundet sich der Mund zu geheimnißvollen Schönheitsformen, als gält’ es eine calla aethiopica oder irgend eine andere tropische Blüthe plastisch nachzubilden, – vor allem aber wird jedes Wort gemodelt und die Sprache gehandhabt, als ob jede Sylbe nebenher noch eine Note sei. Das Ganze der Gegensatz zu einem bloßen, gefälligen sich Treiben-lassen; statt seiner ein beständiges vor dem Spiegel-stehn, das uns in jedem Augenblick Auskunft geben soll über die Situation und über uns selbst. Diese Form des französischen Wesens kam in dem Spiel der Mademoiselle Dany zu vorzüglichstem Ausdruck.
Mademoiselle Britchel gab die Nina, ein volksliedersingendes, genial angeflogenes Dorfmädchen, das durch Veaucourtois an die Pariser Oper kommt und ihrem alten Verehrer, dessen Diner- und auch wohl Souperstunden sie eine zeitlang erheitert hat, mit der ganzen Treue einer Chanteuse dankt. Eine spezifisch französische Erscheinung auch diese; nicht der Sache nach, die sich wohl auch in den Sittlichkeitsländern findet, aber dem Ton nach, in dem sich die Sache giebt.
So viel über die besten Kräfte der Truppe, so weit sie bei der gestrigen Vorstellung betheiligt waren. Es war selbstverständlich nicht möglich ihrem Spiel zu folgen, ohne zugleich Parallelen zwischen ihnen und den schauspielerischen Kräften unserer königlichen Bühne zu ziehen. Diese letzteren verkleinern zu wollen, kann uns nicht einfallen. Vielmehr haben wir die Ueberzeugung gewonnen, daß sie diese Concurrenz ertragen und mehr als ertragen können. Weder im Leben noch in der Kunst vermögen wir Erscheinungsformen, wie sie uns in dem Spiel der Mademoiselle Dany entgegentreten, als die höchsten anzusehen. Es haftet diesen Dingen allerdings ein außerordentlicher Reiz an, dem der Tugendphilister meist am allerwenigsten widerstehen kann. Alles Kokette gleicht dem Fuchs, der in Hühner- und Taubenställen am furchtbarsten haust. Aber mag man sich, dieser ganzen Welt von Koketterie gegenüber, auch noch so sehr als armes Huhn fühlen, so bleibt es doch bestehen, daß der wahre Adel, in Haltung wie Erscheinung, immer wieder mit dem Schön-Natürlichen zusammenfällt und in der Herstellung von Mund-Tulpen und Aehnlichem nicht seine letzten Aufgaben finden kann. Vergleichen wir beispielsweise zwischen Frau Erhartt und Mademoiselle Dany, so ist jene dieser letztern vielleicht nicht an chic und Pikanterie, aber gewiß an Vornehmheit überlegen. Oder wenigstens doch an dem, was der germanischen Welt als solche erscheint. Denn diese Unterschiede in der nationalen Auffassung müssen freilich immer wieder und wieder hervorgehoben werden.
Aehnliche Parallelen könnten wir auch zwischen den männlichen Darstellern hüben und drüben ziehen – Vergleiche, die vielfach zu unsern Gunsten ausfallen würden.
Nichtsdestoweniger bleibt bestehen, daß auch unsere Besten, und wenn sie ersten Ranges wären, allerhand von diesen ihren französischen Collegen lernen können, trotzdem diese letzteren, in ihrer Heimath, sehr wahrscheinlich keine ersten Stellungen innerhalb der Bühnenwelt bekleiden. Und zwar können die Unsrigen deshalb von ihnen lernen, weil ein so erheblicher Bruchtheil alles dessen, was unsere Bühne bringt, nicht nur französischen Ursprungs ist, sondern auch, unverhohlen und unzweifelhaft, französische Gestalten vor uns hinstellen will. Das vermögen unsere Schauspieler aber nur voll und ganz zu leisten, wenn sie entweder lange Zeit in Frankreich selbst gelebt oder aber sich mit französischen Bühnen-Figuren und der Darstellung dieser durch National-Franzosen vertraut gemacht haben. Darin liegt nichts Choquantes. Man kann auch von Personen lernen, die kleiner sind als man selbst. Nehmen wir z.B. die oben näher charakterisirte Rolle des Veaucourtois und denken wir uns dieselbe durch unsre beste komische Kraft, also durch Herrn Döring dargestellt. Er würde unzweifelhaft einen vortrefflichen »alten Junggesellen«, aber nie und nimmer einen ächten »vieux garçon« zu geben wissen. Und doch handelt es sich um einen solchen.
Zu dem Allem nur noch das Eine, wie wir auf’s Neue erkannt haben, daß die »Lehre vom Ensemble« kein leerer Wahn sei. Wie vollendet arrangirt war beispielsweise im 2.Akt der Salon Frau v. Chavenay’s, wie natürlich saß und stand man, wie ungezwungen beschäftigte man sich, während man bei unsern »Gruppenbildern« nur allzu oft die Empfindung hat: was will er nur noch? warum geht er nicht ab? Unsere Verdrießlichkeit deckt sich dann jedesmal mit der Verlegenheit Derer, die im Geiste Fliegen fangend, an der einen oder andern Coulisse ausharren müssen.
Von einigen Seiten her ist das Auftreten einer französischen Schauspieler-Gesellschaft in Berlin gemißbilligt, mindestens als verfrüht bezeichnet worden. Verfrüht? Wollten wir warten, bis die Franzosen ihre innerliche Stellung zu uns änderten, uns als ebenbürtig oder wohl gar als überlegen ansähen, so würden wir lange warten müssen. Sie werden sich nicht ändern; dafür sind sie eben Franzosen, d.h. eine liebenswürdige, eminent-interessante, mit allen möglichen Vorzügen, aber auch mit allen möglichen Schwächen ausgerüstete Nation. Zu diesen letztern gehört, weltbekanntermaßen, daß sie sehr eitel sind und sich, nach wie vor, für die Ersten halten. Lassen wir ihnen das; wir sind in der glücklichen Lage es zu können. Es zu können, weil wir Ruhe und Besonnenheit genug haben, wirkliche Vorzüge als solche gelten zu lassen, und eingebildete oder gleichgiltige – zu denen doch zuletzt alle diese »Comedies« und ihre Vorstellungen gehören – zu belächeln. Th. F.
Philippe DumanoirLes femmes terribles
Aufführung vom 30.3.1878; Kritik vom 3.4.1878
Am Sonnabend, nachdem das schon in der Woche vorher gegebene 1aktige Lustspiel »Les projets de ma tante« wiederholt worden war, kamen die Dumanoir’schen »Les femmes terribles« zum ersten Male zur Aufführung. Ein 3aktiges allerliebstes Stück, das gute Rollen hat und zwei Stunden lang vorzüglich unterhält. Daß es im Grunde genommen immer wieder dasselbe ist, daß man die Figuren längst kennt und acht Tage nach der Aufführung keine rechte Vorstellung mehr davon hat, ob diese oder jene Scene zu Nos Intimes oder Nos bons Villageois, zu Jean qui pleure oder Jean qui rit gehört (von denen der Jean auch gelegentlich eine Jeanne sein kann) – an dieser Aehnlichkeit der Scenen und Figuren darf man keinen Anstoß nehmen. Sonst ist man freilich verloren. »Frankreich«, wie Cardinal Antonelli sagte, »ist das Land der Saucen.« Und an diesen hängt nicht blos die Kochkunst, sondern auch die Lustspielkunst.
Die »femmes terribles« zehren von einem ganz kleinen Kapital. Die Gräfin Daranda ist im Bois de Boulogne an der Seite eines fremden Herrn gesehen worden; ebenso Madame Pommerol. Beide Damen, was die komische Wirkung erhöht, treten übrigens gar nicht auf. Auf diesem Nichts von Thatsächlichem baut sich das Stück auf. Madame de Ris, die eigentliche »femme terrible«