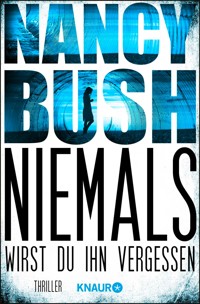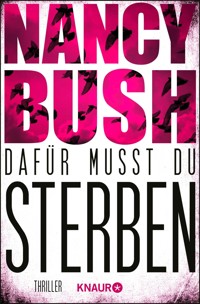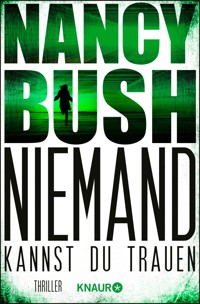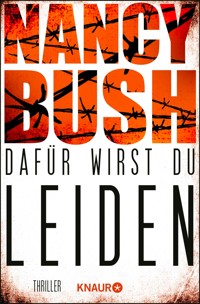
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Detectives-Rafferty-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nach der Thriller-Trilogie "Nirgends wirst du sicher sein", "Niemals wirst du ihn vergessen" und "Niemand kannst du trauen" um die Detectives August und September Rafferty schickt die amerikanische Bestseller-Autorin Nancy Bush in "Dafür wirst du leiden" ein Journalisten-Duo ins Rennen. Jay und Jordanna bekommen es in diesem schnellgetakteten Thriller mit einem fanatischen Serienkiller mit tödlicher Mission zu tun. September Rafferty und die Detectives des Laurelton Police Department übernehmen auch hier wieder die Ermittlungen – ein mitreißender Pageturner! Enthüllungsjournalist Jay Danziger entgeht nur knapp einem Bombenattentat. Jordanna Winters, ebenfalls Journalistin und glühende Verehrerin von Jay, versteckt ihn daraufhin zu seiner eigenen Sicherheit in ihrem Heimatort in Oregon. Doch das kleine Rock Springs birgt seine eigenen Gefahren: Plötzlich taucht die Leiche eines unbekannten Mannes auf, ein Brandmal – ein umgedrehtes Kreuz, Zeichen des Satans – ins Gesäß eingebrannt. Zeitgleich verschwindet spurlos eine junge Frau. Die ehrgeizige Journalistin Jordanna versucht, die Fäden zu verknüpfen. Mit Jays Hilfe begibt sie sich auf die Fährte eines besessenen, hochgefährlichen Serienmörders. Derweil beginnen die Detectives September und August Rafferty ihre Ermittlungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Nancy Bush
Dafür wirst du leiden
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Enthüllungsjournalist Jay Danziger entgeht nur knapp einem Bombenattentat. Jordanna Winters, ebenfalls Journalistin und glühende Verehrerin von Jay, versteckt ihn daraufhin zu seiner eigenen Sicherheit in ihrem Heimatort in Oregon. Doch das kleine Rock Springs birgt seine eigenen Gefahren: Plötzlich taucht die Leiche eines unbekannten Mannes auf, ein Brandmal – ein umgedrehtes Kreuz, Zeichen des Satans – ins Gesäß eingebrannt. Zeitgleich verschwindet spurlos eine junge Frau. Die ehrgeizige Journalistin Jordanna versucht, die Fäden zu verknüpfen. Mit Jays Hilfe begibt sie sich auf die Fährte eines besessenen, hochgefährlichen Serienmörders.
Derweil beginnen die Detectives September und August Rafferty ihre Ermittlungen.
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Epilog
Prolog
Das schlafende Mädchen lag auf dem Rücken, die Hände über der Brust gefaltet. Sie war vielleicht achtzehn, neunzehn; jung für einen Ausbruch der Krankheit, aber nicht zu jung. Wie auch immer – sie würde ohnehin bald sterben. Friedlich entschlafen aufgrund der Überdosis, die er ihr verabreicht hatte. Er hatte ihr die Kleidung ausgezogen. Taubengrau schimmerte ihre makellose Haut im fahlen Mondlicht, das durch die offene Tür ins Innere der Scheune fiel.
Er spähte hinaus und überlegte, wie viele Stunden ihm bis zum Anbruch der Dämmerung noch blieben, dann sprang er von der Ladefläche des Pick-ups und ging zum Kohlebecken, wo er das Brenneisen aus den weiß glimmenden Kohlen zog. Die glühende Spitze mit dem Brandstempel zog einen orangefarbenen Streifen durch die dunkle Nacht, als er schnellen Schritts zum Pick-up zurückkehrte und auf die Ladefläche kletterte. Zu ihr. Er beugte sich über sie und hob ihre linke Hüfte mit der Stiefelspitze an, um sie nicht mehr als unbedingt nötig zu berühren – wenngleich es ihn nach ihrem Fleisch verlangte. Als es ihm gelungen war, sie so zu drehen, dass ihre Pobacke ihm zugewandt war, drückte er das Brenneisen auf ihre Haut. Sofort roch die Luft nach verbranntem Fleisch.
Er musste sichergehen, dass sie das Teufelsmal trug.
Nach getaner Arbeit sprang er erneut von der Ladefläche, legte das Brenneisen zurück in die Feuerschale und löschte die Kohle mit einem Eimer Wasser. Es zischte laut, Dampf stieg in die Höhe und verschleierte ihm für einen Moment die Sicht. Unwillkürlich schweifte sein Blick zu der Tür an der Rückseite der Scheune, zu der Tür, die er mit einem dicken Holzbalken versperrt hatte. Einen Augenblick lang meinte er, dahinter ein Geräusch zu vernehmen, aber er wusste, dass das nicht sein konnte. Der Teufel verhöhnte ihn. Wieder einmal. Er ermahnte sich, nicht darüber nachzugrübeln, was er getan hatte – hatte tun müssen –, doch das gewaltige Ausmaß all dessen überwältigte ihn mit einer solchen Wucht, dass er plötzlich in Tränen ausbrach. Wütend wischte er sich mit dem Handrücken über die Wangen. Manchmal musste man eben schwierige Entscheidungen treffen.
Eilig kletterte er in die Kabine seines Pick-ups, ließ den Motor an und legte den Gang ein. Der schwere Wagen machte einen Satz nach vorn. Er fuhr aus der Scheune, ließ den Motor im Leerlauf und sprang hinaus, um das große Rolltor zuzuziehen und fest zu verschließen. Anschließend stieg er wieder ein und gab Gas. Er fuhr schlingernd übers offene Feld, dem Pfad des Mondlichts folgend, das ihn zu ihrer letzten Ruhestätte geleitete.
Möge sie in Frieden ruhen, dachte er finster, wohl wissend, dass es für die Erwählten Satans keinen Frieden geben würde.
Kapitel eins
Langsam kam der Mann wieder zu Bewusstsein. Er spürte, dass er seine Sinne aus irgendeinem Grund abgeschaltet hatte, und doch war da die schwere Last der Sorge, die ihn unerbittlich niederdrückte. Wo ist Maxwell? Wo bin ich? Diese Fragen quälten ihn, störten seinen Schlaf, auch wenn er ihre Bedeutung nicht recht erfasste.
Da waren Stimmen. Um ihn herum. Unregelmäßig ansteigende und wieder abfallende Stimmen. Menschen kamen und gingen. Plötzlich wurde ihm klar, dass er sich in einem Krankenhausbett befand. Wem gehörten die Stimmen? Schwestern, Ärzten, Angehörigen oder Freunden?
Wo ist Maxwell?
Die Explosion! Schlagartig fiel es ihm wieder ein, dann wurde ihm bewusst, dass er kurzzeitig das Gehör verloren hatte. In seinen Ohren vernahm er ein leises Klingeln, aber das würde sicher bald vergehen. Immerhin konnte er schon wieder etwas verstehen.
Er war verletzt, sonst wäre er nicht hier. Fühlte sich dumpf und benommen. Vermutlich hatte man ihm Schmerzmittel verabreicht. Er war dorthin gegangen, um … Maxwell … aufzusuchen, aber er hatte seinen Schwager nicht angetroffen.
Angestrengt überlegte er, versuchte das Treibgut zu sortieren, das durch sein angeschlagenes Gehirn schwamm. Die Explosion sollte Maxwell töten, dachte er. Maxwell, seinen Vertrauten. Seinen Freund. Aber Max war nicht da gewesen.
»Mr. Danziger?« Eine Frauenstimme. Eine Krankenschwester?
Dann eine weitere Frauenstimme, lauter diesmal. »Können Sie mich hören?«
Maxwell war nicht da gewesen, weil er von der Bombe – oder was immer in die Luft gegangen war – gewusst hatte. Die plötzliche Erkenntnis ließ ihn hochschrecken. Für Maxwell war der Sprengsatz nicht bestimmt gewesen – nein, er war für ihn gedacht, ganz allein für ihn.
Maxwell hatte davon gewusst und sich absichtlich nicht blicken lassen.
»Sind Sie sicher, dass er aufwacht?«, fragte die erste Frau skeptisch.
»Ja. Seine Ehefrau möchte zu ihm.«
»Oh. Da hat sie sich ja ziemlich viel Zeit gelassen.«
Ehefrau? Carmen? Rein gefühlsmäßig hatten sie sich schon vor Jahren getrennt, offiziell geschieden waren sie allerdings erst seit ein paar Monaten, obwohl sie nach wie vor unter einem Dach lebten, hauptsächlich, damit »die Leute« – Leute wie Maxwell – nicht mitbekamen, dass ihre Ehe zerbrochen war. Carmens Idee, nicht seine, aber er war damit einverstanden gewesen, dieses Affentheater mitzuspielen, tat alles, was sie wollte, nur damit er endlich aus dieser Beziehung herauskam.
»Mr. Danziger?«, fragte die zweite Schwester, jetzt etwas eindringlicher. »Ihre Frau möchte Sie sehen.«
»Der wacht nicht auf«, stellte die erste Stimme in überlegenem Tonfall fest.
Jay Danziger spürte, wie er zurück in die Tiefen der Bewusstlosigkeit glitt. Was gut war. Er wollte nicht denken. Wo ist Max?, fragte seine innere Stimme erneut, aber diesmal gab er sich selbst die Antwort: Weit, weit weg von der Bombe, die dich hätte töten sollen.
Als er wieder auftauchte und die Augen aufschlug, wusste er nicht, wie viel Zeit verstrichen war. Mit Sicherheit eine geraume Weile. Vage nahm er die Frau wahr, die neben seinem Bett saß und seine Hand hielt. Ihre Handfläche schwitzte.
»Mr. Danziger«, begrüßte ihn eine Männerstimme. Mit großer Anstrengung konzentrierte er sich darauf und drehte vorsichtig die Augen in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Er verspürte einen dumpfen Schmerz im Kopf. Ein Mann in weißem Kittel stand am Fußende des Betts, eine Patientenakte in der Hand. »Wir haben uns schon gefragt, wann Sie wohl wieder aufwachen würden.«
Auf seinem Namensschild stand Dr. William Cochran. Ebenso vorsichtig wie zuvor löste Jay den Blick von dem Arzt und wandte sich der Frau an seinem Bett zu, die er auf Ende zwanzig schätzte. Sie hatte die braunen Haare zu einem lockeren Knoten geschlungen, aus dem sich ein paar lockige Strähnchen lösten – dieselbe Frisur, die Carmen meist trug. Kein Wunder, dass man sie für seine Ehefrau hielt. Doch er war sich ziemlich sicher, dass er sie bis zu diesem Augenblick noch nie gesehen hatte.
»Ich bin so froh, dass du aufgewacht bist, Jay. Wir haben uns schreckliche Sorgen um dich gemacht«, flüsterte sie.
Er überlegte, ob er etwas erwidern, ob er klarstellen sollte, dass sie eine Schwindlerin war, aber er entschied sich dagegen. Zumal im Augenblick tatsächlich aufrichtige Besorgnis in ihren haselnussbraunen Augen stand. Sie hatte Angst, vermutlich davor, dass er ihre Deckung auffliegen lassen würde, denn sie war verdammt noch mal nicht Carmen. Er hatte keinen blassen Schimmer, wer sie sein mochte, und die Tatsache, dass sie sich als seine Ex-Frau ausgab, war verwirrend, wenngleich nicht wirklich alarmierend, was einiges über seinen momentanen Geisteszustand aussagte. Er hätte zutiefst beunruhigt sein müssen, vor allem über die hässliche Erkenntnis, dass Max ihn hatte töten wollen. Oder war sein angeblicher Freund in letzter Sekunde gewarnt worden? War er deshalb nicht dort gewesen? Nein … der Gedanke fühlte sich nicht richtig an. Danziger spürte, dass irgendwo in den Untiefen seines Gehirns ein Klumpen Wahrheit begraben lag, der ihm soeben das Signal gesendet hatte, Maxwells Motive zu hinterfragen. Aber was, wenn das nicht stimmte? Wenn die Bombe, oder was auch immer die Explosion verursacht hatte, doch nicht für ihn bestimmt gewesen war? Wenn es sich einfach um einen schrecklichen Unfall handelte, der ihm einen tiefen Schnitt am Schenkel eingetragen hatte?
Unwillkürlich wanderte sein Blick zu seinem linken Bein. Es war von der Hüfte bis unterhalb des Knies verbunden. Eine Oberschenkelverletzung. Dennoch verspürte er keinerlei Schmerz; die Medikamente wirkten gut.
»Max hat nach dir gefragt«, ließ sich die Frau, die seine Hand hielt, vernehmen. Er spürte die unterschwellige Dringlichkeit ihrer Worte.
Maxwell Saldano. Sie weiß von Max.
Jay »Dance« Danziger hatte sich bei zahlreichen Gelegenheiten auf sein Gespür verlassen, und ebendieses Vertrauen auf seine Instinkte hatte ihn während der letzten zehn Jahre, in denen er als Enthüllungsjournalist so mancher brisanten Story auf der Spur gewesen war, aus allen möglichen brenzligen Situationen gerettet. Auch jetzt verließ er sich wieder darauf, also sah er »Carmen« direkt in die Augen und krächzte: »Bring mich nach Hause.«
Sie klappte verdutzt den Mund auf, doch bevor sie etwas erwidern konnte, mischte sich der Arzt ein. »Wir müssen noch verschiedene Untersuchungsergebnisse abwarten, um sicherzugehen, dass wirklich alles in Ordnung ist. Die Operation gestern ist gut verlaufen – die Muskelverletzungen konnten großteils behoben werden. Sie können morgen entlassen werden – vorausgesetzt, wir finden nichts Unerwartetes bei Ihrer MRT.«
»Heute wäre mir lieber«, murmelte Dance.
»Nun … vielleicht …«
»Ich will heute schon nach Hause«, wiederholte er mit Bestimmtheit.
»Na schön, dann werde ich mir die Ergebnisse eben gleich ansehen.« Dr. Cochran wandte sich zum Gehen. Sobald Dance allein war mit der Frau, die immer noch seine Hand hielt, warf er ihr einen stummen Blick zu. Fragend.
»Zu Hause dürfte nicht unbedingt der sicherste Ort sein«, sagte sie zögernd, als wolle sie ihm zu verstehen geben, dass sie hier nicht frei sprechen konnte. Obwohl sie allein im Zimmer waren, schweifte ihr Blick zur offenen Tür. Gut möglich, dass jemand vom Flur aus ihr Gespräch belauschte.
»Wohin soll ich gehen?«, stieß er mit einiger Mühe hervor.
Sie sah ihn an, dann blickte sie auf seine Hand in ihrer. »Ich kenne einen Ort …«
»Wo?«
»Irgendwo.«
»Wie soll ich dich nennen?«
Sie warf einen weiteren argwöhnischen Blick Richtung Flur. »Wie meinst du das?«, fragte sie vorsichtig.
Die Wirkung der Medikamente ließ ein wenig nach. Er spürte, wie sein Bein anfing zu schmerzen – eine stumme Mahnung, in welchem Zustand es sich befand. Auch der Druck in seinem Kopf nahm zu. »Nun … Carmen bist du nicht.«
Er kämpfte gegen eine neuerliche Ohnmacht an, obwohl es im Grunde ein Segen gewesen wäre, für eine Weile ins Vergessen abzutauchen. Fast hätte er ihre Antwort überhört, so leise sagte sie: »Jordanna.«
»Jordanna«, wiederholte er, doch seine Stimme war schon nicht mehr zu vernehmen, begraben unter der übermächtigen Woge der Bewusstlosigkeit.
Jordanna Winters hatte immer schon einen gesunden Respekt vor der Polizei empfunden.
Mit vierzehn hatte sie mit einem Kleinkalibergewehr auf ihren Vater geschossen, als der versuchte, ihre ältere Schwester zu vergewaltigen. Sie hatte auf die harte Tour erfahren müssen, dass die Gesetzeshüter in Rock Springs, Oregon, chauvinistische Widerlinge waren, fest entschlossen, einem aufrechten Bürger wie Dr. Dayton Winters Glauben zu schenken, dass seine mittlere Tochter psychisch labil und daher nicht zurechnungsfähig war. Der Apfel fiel eben nicht weit vom Stamm – »Machen wir uns doch nichts vor, Officers!« –, und dieser Stamm war Gayle Treadwell Winters, Jordannas Mutter, die – ebenfalls labil – an einer erblich bedingten Erkrankung gestorben war, die zu massiven physischen und psychischen Aussetzern geführt hatte. Der üble Gendefekt, der den bedauernswerten Treadwells seit Generationen zu schaffen machte, trat nach dem Zufallsprinzip auf, und längst nicht alle Familienmitglieder waren davon betroffen. Aber dennoch genügend. Grauenvolle Unfälle, Suizide und sogar Mord gingen – wenn man den Einwohnern von Rock Springs Glauben schenken konnte – auf ebendiesen Gendefekt zurück. Jordanna, so das kollektive Fazit der Bürger nach den Schüssen, die ihren Vater an der Schulter streiften, trug das Gen definitiv in sich, nichts anderes konnte ihr volatiles Verhalten erklären. Der gute Dr. Winters war selbstverständlich über jeglichen Verdacht erhaben, während Jordanna mehr und mehr außer Kontrolle und in den Einflussbereich des Bösen geriet. Und wieder einmal erfüllt sich der Treadwell-Fluch!
Was kompletter Blödsinn war. Oder?
In Jordannas Augen war der liebe alte Dad ein geiler Pädophiler, der ihr jede Menge Gründe lieferte, so schnell wie möglich von zu Hause abzuhauen. Sie hatte schon sehr früh gelernt, sich auf niemand anderen zu verlassen als auf sich selbst. Sogar ihre ältere Schwester Emily hatte hartnäckig behauptet, sie sei aus eigenem Verschulden im Bett ihres Vaters gelandet. Emily hatte Jordanna versichert, dass sie wieder einmal schlafgewandelt sei – direkt unter Dads Bettdecke. Sie habe von ihrer Mutter geträumt und nach ihr gesucht. Als Jordanna Einwand erhob, hatte Emily ihr vorgeworfen, sie sei tatsächlich so verrückt, wie alle behaupteten. Sie sei diejenige, die Hilfe brauche.
Jordanna hatte unbeirrt an ihrer Version festgehalten. Sie habe Emily »Dayton!« rufen hören, als sei sie völlig verängstigt, doch mit ihrer Sturheit hatte sie nichts erreicht. Niemand hatte ihr geglaubt, und kaum ein Jahr später war Emily an einem ganz besonders eisigen Tag bei einem Autounfall auf den heimtückischen Serpentinen oberhalb von Rock Springs, ganz in der Nähe der Wasserfälle, ums Leben gekommen. Ihr Wagen war über die Böschung geschossen und eine schroffe Klippe hinabgestürzt.
Bei Emilys Beerdigung hielt sich Jordanna so weit abseits wie nur möglich von ihrem Vater und dem Rest der Familie. Sie kam sich vor wie eine Aussätzige, und dazu hatte sie auch allen Grund: Alle dachten, sie trage den Treadwell-Fluch in sich, obwohl niemand wagte, ihr das ins Gesicht zu sagen.
Irgendwann war ihre jüngere Schwester Kara im heftig prasselnden Januarregen an ihre Seite getreten und hatte mit angespannter Stimme geflüstert: »Es war kein Unfall.«
»Wie meinst du das?«, wollte Jordanna wissen.
»Jemand hat Emily umgebracht«, antwortete Kara.
»Unser Dad?«, mutmaßte Jordanna. Aber Kara zuckte bloß die Achseln und schüttelte den Kopf. Die Mädchen starrten über den Friedhof auf die Stelle, an der die Sargträger ihre Schwester zur letzten Ruhe betteten. Jordanna spürte den Blick ihres Vaters, reckte das Kinn vor und schwor sich, eines Tages die Wahrheit herauszufinden … wenn sie älter, stärker, überzeugender wäre und der richtige Zeitpunkt gekommen war.
Mit siebzehn war sie von zu Hause ausgezogen und bei einer Gruppe Studenten gelandet, die die Portland State University besuchten. Tagsüber arbeitete sie in Coffeeshops und Restaurants, abends belegte sie Seminare an der Uni mit den Hauptfächern Journalismus und Kommunikationswissenschaften, außerdem Kurse in Strafrecht und kriminaltechnischen Ermittlungsmethoden. Nach einer Weile erstellte sie einen eigenen Internetblog, in dem sie unter einem Pseudonym über Opfer von Verbrechen berichtete, darüber, was nach der Tat aus ihnen wurde oder was womöglich ausschlaggebend für das Verbrechen gewesen war. Es gelang ihr, ihre Artikel in verschiedenen Zeitungen unterzubringen. Bislang war sie bis zum Laurelton Register und der Lake Chinook Review vorgedrungen, doch es war ihr Traum, in die obere Liga aufzusteigen. Darauf arbeitete sie seit zehn Jahren hin, befeuert von den miserablen Erfahrungen, die sie in ihrer Heimatstadt gemacht hatte, fest entschlossen zu beweisen, dass man den Treadwell-Fluch bei ihr vergebens suchte. Sie war nicht verrückt, ganz gleich, was die anderen behaupteten. Bislang hatte sie einen anständigen Job gemacht, hatte nie irgendwelche Regeln oder Gesetze ignorieren oder gar dagegen verstoßen müssen. Als einzige Schwäche sah sie ihre Verehrung des erfolgreichen Enthüllungsreporters Jay Danziger. Er war ihr Held, ihn bewunderte sie wegen seiner Einsicht, seiner Klugheit und seines Erfolgs beim Graben nach der Wahrheit. Ihm nachzueifern, ihm zu folgen hatte sie in diese aberwitzige Situation gebracht, und nun saß sie hier, im Allgemeinkrankenhaus von Laurelton, und gab sich als seine Ehefrau aus. Mit hämmerndem Herzen und schwitzenden Handflächen hatte sie am Empfang gestanden und mit angespannter Stimme hervorgestoßen: »Informieren Sie Officer McDermott, dass Carmen Danziger hier ist.«
»Wie bitte, Ma’am?« Die Schwester sah sie verdutzt an.
»Jay Danziger ist mein Ehemann.« Die Lüge ging ihr leicht über die Lippen. Niemand würde sie jetzt noch aufhalten. »Er ist eines der Bombenopfer. Man hat mich angerufen.« Sie musste sich gar nicht erst Mühe geben, ihr Kinn vor Aufregung zittern zu lassen.
»Ähm … ja …« Die Empfangsschwester sah sich Hilfe suchend um, doch es herrschte Chaos. Zwar war der Sprengsatz schon vor über vierundzwanzig Stunden in die Luft geflogen, aber der Großteil der Verletzten war ins Laurelton General Hospital eingeliefert worden, weshalb es nur so wimmelte von zusätzlichem medizinischen Personal und natürlich auch von Polizisten. Jordanna hegte die begründete Vermutung, dass man Jay Danziger ebenfalls hierherverfrachtet hatte. Sie wusste, dass er bei der Explosion in dem Gebäude in der Innenstadt von Laurelton zu Schaden gekommen war. Sie wusste es, weil sie ihn dort gesehen hatte, von der gegenüberliegenden Straßenseite aus, als die Bombe hochgegangen war und Staub und Trümmer durch die Luft wirbelten. Die Wucht der Druckwelle hatte auch sie umgeworfen, aber es war ihr gelungen, sich aufzurappeln und mit klingelnden Ohren ihr Handy aus der Tasche zu ziehen, um die Neun-eins-eins anzurufen, doch dann hörte sie in der Ferne bereits heulende Sirenen. Also hatte sie das Smartphone wieder eingesteckt, war in ihren Toyota RAV4 eingestiegen und zu ihrer Wohnung gefahren.
Nachdem sie sich den Staub abgewaschen hatte, schaute sie in den Badezimmerspiegel und fragte sich, was um Himmels willen passiert war. Sie hoffte inständig, dass Jay Danziger noch lebte. Die Vorstellung, er könnte tot sein, ließ sie so heftig schaudern, dass ihr die Knie einknickten. Diese verfluchten Saldanos!, dachte sie, außer sich vor Zorn. In dem Augenblick fasste sie ihren verrückten Plan. Wenn Danziger tatsächlich noch am Leben war, würde sie ihn ausfindig machen, ihn interviewen und ihn davon überzeugen, dass die Saldanos abgrundtief schlecht waren. Sie war Danziger gelegentlich gefolgt – na schön, böse Zungen könnten behaupten, sie habe ihn gestalkt –, und zwar seit Wochen, hatte ihn vor seinem Haus abgepasst oder war ihm nachgefahren, wenn er sich mit Angehörigen der Familie Saldano traf. Dieser verbrecherische Klan, der seine Finger in unzähligen Betrieben und Regierungsämtern hatte! Bis Danziger in das Netz der Gier, das die Saldanos geknüpft hatten, hineingezogen wurde, hatte Jordanna den Mann aufrichtig bewundert. Hatte insgeheim für ihn geschwärmt, von ihm geträumt, denn um die Wahrheit zu sagen: Der Kerl war verdammt attraktiv. Dennoch standen für sie sein unorthodoxer Ermittlungsstil und die Ergebnisse, die er vorweisen konnte, an erster Stelle.
Außerdem war er verheiratet, und sie war definitiv nicht an verheirateten Männern interessiert. Sie wollte lediglich Danzigers Story, und die würde sie kriegen, und wenn sie dabei draufging. Ein paar Tricks, und sie ähnelte Carmen Danziger genügend, um sich in sein Krankenzimmer zu mogeln, solange es im Laurelton General drunter und drüber ging. Carmen hielt sich für gewöhnlich vom Rampenlicht fern, aber Jordanna wusste, dass sie ihr langes, braunes Haar meist zu einem losen Knoten geschlungen trug und knallenge Kleider sowie schwindelerregende High Heels bevorzugte, in denen kaum eine Frau gehen konnte. Nach der Explosion hatte Jordanna beides im nahe gelegenen Einkaufszentrum besorgt und sich fast den Knöchel gebrochen, als sie auf den hohen Absätzen ins Krankenhaus gehastet war, aber zum Glück war das niemandem aufgefallen.
»Rufen Sie ihn bitte«, hatte Jordanna die Schwester gedrängt und sich mit einem Taschentuch die Tränen abgetupft, die sich tatsächlich in ihren Augenwinkeln bildeten. Angst? Aufregung? Auf alle Fälle wirkte es überzeugend.
»Haben Sie einen Ausweis bei sich?«
Mist. »Ich …« Sie heuchelte Verwirrung und blickte durch die automatische Glasschiebetür hinaus auf den Parkplatz.
In dem Moment durchquerte Officer McDermott mit großen Schritten das Foyer. Sie hatte ihn zuvor in den Nachrichten gesehen und wusste, dass er mit den Ermittlungen befasst war. Offen weinend legte sie ihm die Hand auf den Arm. »Bitte sagen Sie mir, dass mein Mann am Leben ist.«
Er bedachte sie mit einem ungeduldigen Blick. »Wer ist Ihr Mann, Ma’am?«
»Jay … Jay Danziger. Ist er hier? O bitte …«
Sollte Carmen Danziger bereits eingetroffen sein, hätte Jordanna ein Problem gehabt. Womöglich hätte man sie sogar verhaftet. Allerdings hatte sie Carmen vor ein paar Tagen mit tonnenweise Gepäck zum Flughafen fahren sehen. Jordanna hoffte, dass Danzigers Ehefrau weit, weit weg war.
»Mrs. Danziger.« Man sah McDermott an, dass er ihre Hand am liebsten abgeschüttelt hätte.
»Ist er hier? Geht es ihm gut?«
»Er wurde gerade erst operiert.«
Entsetzt schlug sie die freie Hand vor den Mund.
»Es tut mir leid, Ma’am. Wir haben jede Menge Verletzte. Bitte schließen Sie sich mit dem Krankenhauspersonal kurz.«
Jordanna hatte genickt und seinen Arm losgelassen. Der Sprengsatz war im Hauptfirmensitz der Saldanos explodiert, wo diese laut allgemeiner Spekulationen und Jay Danzigers früherer Ermittlungen – bevor er in die Familie eingeheiratet hatte – Unmengen illegaler, unter das Betäubungsmittelgesetz fallender Substanzen bezogen und in alle Welt verschickten. Max Saldano und der Rest der Familie wiesen diese Vorwürfe selbstverständlich vehement zurück. Sie waren ehrliche Geschäftsleute mit florierenden Import-/Exportfirmen, die mit Gütern aus Zentral- und Südamerika, vor allem aus Mexiko, handelten. Sie betrieben keine illegalen Geschäfte, und kriminell waren sie schon gar nicht.
Unsinn.
Danziger war ein langjähriger Freund von Max Saldano, dem Mann, der ihn mit seiner Schwester Carmen bekannt gemacht hatte. Jay und Carmen hatten ungefähr zu der Zeit geheiratet, in der Jordanna begann, Danzigers journalistischen Stil zu bewundern. Erst nachdem die Saldanos in den Verdacht krimineller Machenschaften geraten waren, fürchtete sie, ihr Idol könne einen Fleck auf seiner weißen Weste haben. Geld regiert die Welt, dachte sie düster. Viel Geld. Und Jay Danziger hatte eine Kehrtwende vollzogen, ganz ähnlich wie ihr Vater, als er nach dem Tod von Jordannas Mutter in die Markum-Familie eingeheiratet hatte.
Eilig verschloss sich Jordanna den Erinnerungen und konzentrierte sich stattdessen darauf, Jays Krankenzimmer ausfindig zu machen. Noch bevor sie sich wieder an die Empfangsschwester wenden konnte, fing sie zufällig den Namen »Danziger« auf. Zwei Krankenschwestern eilten an ihr vorbei in Richtung der Fahrstühle. Sie nickte Officer McDermott zu, der keinerlei Anstalten machte, sie aufzuhalten, folgte den beiden und stellte sich als Danzigers Ehefrau vor. Die Schwestern warfen einen Blick auf ihr enges grünes Kleid und ihre Vierzehn-Zentimeter-Absätze, dann schauten sie zu dem Polizisten hinüber. Anscheinend glaubten sie ihr, denn sie schickten sie hinauf in den dritten Stock, wo sie mit dem Arzt sprechen sollte, dessen Namen Jordanna in den Nachrichten aufgeschnappt hatte. Es war fast zu leicht, zu Jay vorzudringen. In dem Augenblick begriff sie, dass Jay Danziger womöglich in echter Gefahr schwebte. Niemand von den Saldanos hatte sich zum Zeitpunkt der Explosion im Firmenhauptsitz aufgehalten, allerdings waren zahlreiche Angestellte verletzt worden. Die anfängliche Theorie lautete, dass ein konkurrierendes Unternehmen den Saldanos eine deutliche Warnung hatte zukommen lassen, auch wenn Victor Saldano, der Patriarch, diese These als absurd abtat.
Jordanna hatte beschlossen, Danziger auf die potenzielle Gefahr aufmerksam zu machen. Selbst wenn sie seinen Motiven nicht länger traute, ließ sich nicht leugnen, dass ihn seine Verbindung mit den Saldanos beinahe das Leben gekostet hätte.
Deshalb war sie als Carmen verkleidet in sein Krankenzimmer geschlüpft, doch er war nicht bei Bewusstsein gewesen. Vielleicht schlief er auch nur oder stand noch unter Narkose. An seinem linken Oberschenkel prangte ein dicker Verband. Einen Moment lang verunsichert, hatte sie beschlossen, sich zu ihm zu setzen und darauf zu warten, dass er aufwachte. Angespannt nahm sie auf dem Stuhl an seinem Bett Platz und hörte die innere Uhr in ihrem Kopf ticken. Tick, tick, tick – wie der Countdown eines Zeitzünders, der sie mit jeder verstreichenden Sekunde daran erinnerte, dass Carmen Saldano Danziger oder sonst wer aus der Familie jeden Augenblick hereinschneien könnte, aber es kamen nur die beiden Krankenschwestern, die in regelmäßigen Abständen nach ihm sahen.
Und dann war Jay Danziger aufgewacht, und sie hatte angefangen zu improvisieren.
Er hatte mitgespielt.
Jetzt schaute sie in sein blasses Gesicht auf dem Kissen. Ein schönes Gesicht, auf dem sich im Schlaf zwei tiefe Sorgenfalten zwischen den Augenbrauen bildeten. Ahnte er, dass er in Gefahr war? Gut möglich, dass er weit mehr wusste als sie. Immerhin hatte er sie nicht auffliegen lassen. Stattdessen hatte er ihre Scharade ohne Fragen zu stellen zugelassen, und nun fühlte sie sich verpflichtet, ihn hier rauszuholen. Das alte Farmhaus in Rock Springs, in dem sie aufgewachsen war – ihr ehemaliges Elternhaus und gleichzeitig ein Ort, den sie seit Jahren gemieden hatte –, kam ihr in den Sinn. Dorthin würde sie ihn bringen. Dort wäre er in Sicherheit.
Hoffentlich.
Kapitel zwei
Jordanna stand an dem nach Nordosten gehenden Fenster von Jay Danzigers Krankenzimmer und schaute durch die Lamellenjalousien auf den Parkplatz hinab. Um genau zu sein, gab es drei Parkplätze auf verschiedenen Ebenen, denn das Krankenhaus war an einen Hang gebaut. Der Haupteingang und die Notaufnahme befanden sich im obersten Geschoss, der Hinterausgang mit dem Nordparkplatz im untersten.
Wenn ich dort hinten parke, kann ich wegfahren, ohne gesehen zu werden, dachte sie. Nie und nimmer würde sie Danziger durch den Haupteingang hinausschmuggeln können, ohne dass die Presse davon Wind bekam und sie mit Fragen bombardierte. Auch auf der mittleren Etage gab es eine Tür zu einem Parkplatz, der nach Osten ging, aber die unterste zum Nordparkplatz führte schneller zur Hauptstraße. Ob es dort Überwachungskameras gab? Vermutlich. Selbst wenn sie von hier aus keine sehen konnte. Allerdings war es verblüffend, wo sich heutzutage überall Kameras befanden. Doch, sie musste durchaus davon ausgehen, dass man sie bei ihrer Flucht mit Danziger auf Video bannen würde.
Jordanna atmete tief durch. Zahlreiche Angestellte von Saldano Industries waren verwundet worden, aber keiner hatte so schwere Verletzungen davongetragen wie Danziger. In den Nachrichten hatte es geheißen, der Sprengkörper sei vor der dem Eingang gegenüberliegenden Wand deponiert gewesen, genau dort, wo Danziger gestanden hatte. Das konnte kein Zufall sein, zumal Jordanna ohnehin nicht an Zufälle glaubte – für sie war klar, dass der Anschlag Jay Danziger gegolten hatte.
Sie wandte sich vom Fenster ab und warf einen Blick auf den Mann, der in seinem Krankenhausbett den Schlaf des Bewusstlosen schlief. Sein Atem ging jetzt gleichmäßig, doch während der Zeit, die sie an seinem Bett verbracht hatte, war er mehrfach hochgeschreckt und hatte nach Luft geschnappt – ob er Schmerzen hatte oder das traumatische Erlebnis verarbeitete, konnte sie nicht sagen. Sie wusste nur, dass ihr jedes Mal beinahe das Herz stehen blieb.
Jordanna durchquerte den Raum und spähte vorsichtig zur Tür hinaus. Der Flur war leer. Von der Schwesternstation hinter der Ecke drang eine Frauenstimme zu ihr hinüber, die sich wegen irgendetwas beschwerte. Unweigerlich musste Jordanna an ihre Tante Evelyn denken, die große Freude daran hatte, jedem, der ihr Gehör schenkte, bis ins Detail ihre tatsächlichen oder eingebildeten Wehwehchen zu klagen. Die ältere Schwester ihrer Mutter beschwerte sich ständig über alles Mögliche. Kein Wunder, dass sie auch Tante Evelyn seit Jahren nicht gesehen hatte.
Weil sich ihre Blase meldete, verließ Jordanna das Krankenzimmer und stöckelte unsicher auf ihren hohen Absätzen den Flur entlang. Am liebsten hätte sie die High Heels ausgezogen und wäre barfuß gegangen. Die Dinger hatten ihren Zweck erfüllt, jetzt galt es, schnell voranzukommen. Bevor sie den Gedanken jedoch in die Tat umsetzen konnte, hörte sie Schritte hinter sich und blickte verstohlen über die Schulter. Fast hätte ihr Herz ausgesetzt, als sie Officer McDermott erblickte. Zusammen mit einem jüngeren Kollegen betrat er soeben Jay Danzigers Raum. Eilig bog sie um die Ecke, erleichtert, dass die beiden sie nicht bemerkt hatten. Sie mochte sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie mit ihnen hätte reden müssen – vielleicht hatte McDermott längst herausgefunden, dass sie nicht Carmen war.
Eine Klingel schrillte an der Schwesternstation zu ihrer Linken und ließ ihre bis zum Zerreißen gespannten Nerven vibrieren. Hastig schlüpfte sie rechts in die Damentoilette. Mit hämmerndem Herzen lehnte sie sich im Waschraum an die Wand und beobachtete, wie langsam die Tür hinter ihr zufiel. Den Kopf schief gelegt, lauschte sie angestrengt, doch es war nichts zu hören. Sie war allein im Waschraum. In dem Augenblick fiel ihr Blick auf ihr Spiegelbild. Ihre Gesichtszüge waren verzerrt vor Anspannung. Es kostete sie einige Mühe, die Sorgenfalten zu glätten.
Nachdem sie sich erleichtert und gründlich die Hände gewaschen hatte, nahm sie all ihren Mut zusammen, trat hinaus auf den Flur und blieb vor der Schwesternstation stehen, unschlüssig, ob sie zu Danzigers Krankenzimmer zurückkehren sollte.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte eine helle Frauenstimme hinter ihr.
Erschrocken wirbelte Jordanna herum und sah sich einer jungen Schwesternhilfe gegenüber, die aus der anderen Richtung des Flurs gekommen sein musste. An der Schwesternstation entdeckte sie eine weitere Angestellte, die eine Krankenakte in der Hand hielt.
»Ich überlege gerade, ob ich noch einmal zu meinem Mann gehen soll oder ob es besser ist, ihm Zeit zum Ausruhen zu geben«, sagte Jordanna und nickte in die Richtung von Jays Krankenzimmer.
»Dort drüben gibt es einen Wartebereich.« Die Schwesternhilfe deutete in die entgegengesetzte Richtung des Flurs.
»Danke«, sagte Jordanna. Die junge Frau drehte sich lächelnd um und betrat die Schwesternstation. Jordanna überlegte für einen kurzen Moment, dann beschloss sie, den Wartebereich aufzusuchen, doch zuvor warf sie einen kurzen Blick um die Ecke in den Flur, der zu Jays Zimmer führte. Einer der beiden Officer stand davor, doch er bemerkte sie nicht. Im Wartebereich angekommen, ließ sie sich auf einen von mehreren braunen Kunstledersesseln fallen, die um einen Glastisch mit glänzenden Metallbeinen gruppiert waren. Vom Fenster aus sah man den Nordparkplatz, wo Jordanna ihren Wagen parken wollte, um unbemerkt mit Danziger zu verschwinden. Das Kinn in eine Hand gestützt, maß sie im Kopf die Entfernung von Danzigers Zimmer zu den Aufzügen. Von dort wäre es nicht weit bis zur Parkplatztür …
Die Frauenstimme klang ausgesprochen ungehalten. »… er schläft. Sobald er aufwacht und wieder voll bei Bewusstsein ist, können Sie ihn befragen.«
»Wir bleiben«, verkündete eine Männerstimme, kühl, unerbittlich.
»Ich habe Dr. Cochran angepiept«, warnte die Frau. »Ich möchte, dass Sie im Flur warten, bis er eintrifft.«
»Ma’am, wir haben mit Dr. Cochran gesprochen; er weiß, dass wir hier sind.«
»Selbst wenn das stimmt, steht das Wohlergehen der Patienten im Laurelton General Hospital an allererster Stelle.« Die Frau schien nicht beeindruckt. »Bitte warten Sie im Flur, bis Mr. Danziger aufwacht.«
Schweigen. Dance stellte sich vor, wie sich der Mann und die Frau anfunkelten. Selbst in seinem benommenen Zustand war ihm klar, dass der Mann von der Polizei sein musste. Das hörte er an seinem Tonfall. Die Cops wollten ihn also befragen. Wollten herausfinden, was er zu der Explosion zu sagen hatte. Dr. Cochran hatte im Grunde eingewilligt, ihn zu entlassen, und sie würden sich die Gelegenheit, noch im Krankenhaus mit ihm zu sprechen, bestimmt nicht entgehen lassen.
Dance spielte mit der Idee, die Krankenschwester weiter mit den Polizisten streiten zu lassen; es musste sich um mindestens zwei Cops handeln, sonst hätte der Mann nicht im Plural gesprochen.
Allerdings würde das nicht wirklich etwas bringen. Dance spürte, dass er in Schwierigkeiten steckte. Entweder war tatsächlich er das Ziel des Anschlags gewesen, oder er war irgendwem in die Quere geraten. Was das konkret bedeutete, konnte er nicht sagen. Sein Kopf fühlte sich an, als sei er voller Watte; es war schmerzhaft, einen klaren Gedanken zu fassen. Wie auch immer: Er wollte unbedingt raus aus dem Krankenhaus, wo er sich fühlte wie auf dem Präsentierteller. Wenn diese Jordanna ihn von hier wegbringen wollte, würde er mit ihr gehen.
Sie könnte in die Sache verwickelt sein.
Er schlug die Augen auf.
Zwei Personen standen im Zimmer, eine dritte vor der offenen Tür. Wie erwartet, sah er eine mittelalte Schwester mit vorgeschobenem Kinn und stahlhartem Blick sowie einen etwa fünfzigjährigen Mann mit kurz geschnittenem grauem Haar in Polizeiuniform. Den Mann im Flur konnte er nicht richtig erkennen.
Plötzlich betrat dieser das Zimmer und begegnete Dance’ Blick.
»Er hat die Augen geöffnet«, unterbrach er den Machtkampf der beiden.
»Mr. Danziger!« Die Schwester eilte geschäftig an seine Bettseite. »Wie geht es Ihnen? Können Sie sprechen? Diese Polizisten möchten Ihnen ein paar Fragen stellen, aber Sie müssen nicht antworten, wenn Sie nicht wollen.«
»Ich kann reden«, krächzte Dance.
Sie presste die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. »Ich habe Dr. Cochran angepiept, er –«
»Ich werde die Fragen der Polizisten beantworten«, beharrte Dance und räusperte sich. »Ich bestehe darauf.«
Sie holte tief Luft, zögerte für einen Augenblick, dann lenkte sie leicht schnippisch ein: »Wie Sie möchten.« Ihr Tonfall ließ deutlich erkennen, was sie davon hielt.
»Mr. Danziger …« Der Polizist ignorierte die Schwester und bedachte Dance mit einem ernsten Blick. »Wir bitten Sie, uns das Unglück aus Ihrer Sicht zu schildern, vorausgesetzt, Sie fühlen sich tatsächlich dazu in der Lage.«
»War es eine Bombe?«, fragte Dance.
Der ältere Officer – McDermott stand auf seinem Namensschild – warf der Schwester einen vielsagenden Blick zu, die daraufhin empört das Zimmer verließ.
Als sie fort war, wandte McDermott Dance seine volle Aufmerksamkeit zu. »Es sieht ganz danach aus.«
Der jüngere Officer, auf dessen Namensschild Billings stand, schwieg. Offenbar überließ er die Befragung lieber seinem erfahreneren Kollegen.
»Wir haben darauf gewartet, dass Sie aufwachen, weil wir Ihnen gern ein paar Fragen stellen möchten«, erklärte McDermott. »Glauben Sie, Sie schaffen das?«
Dance, der wusste, dass die Cops ihre Fragen stellen würden, ganz gleich, ob er Ja oder Nein sagte, nickte vorsichtig.
»Uns interessiert, warum Sie heute bei Saldano Industries waren«, fing McDermott an.
»Ich war dort mit Maxwell Saldano verabredet.«
»Ging es um etwas Geschäftliches?«
»Wir wollten Golf spielen«, antwortete Dance ausweichend. »Ich wollte Max abholen.«
»Maxwell Saldano ist Ihr Schwager?«
»Ja.«
»Ihre Frau war vorhin hier …« Der Officer schaute stirnrunzelnd zur Tür, als frage er sich, wohin Carmen Saldano Danziger verschwunden war.
Dance fragte sich dasselbe, nur dass seine Gedanken um die Frau namens Jordanna kreisten. Hatte sie wirklich vor, ihn von hier fortzubringen? Er hoffte inständig, dass sie nicht zurückkehren würde, solange die Polizei bei ihm war, auch wenn er sich nicht recht erklären konnte, warum er ihr vertraute, als kenne er sie schon sein Leben lang, während er der Polizei gegenüber eher Misstrauen verspürte. Nein, das war nicht ganz richtig. Er misstraute den Polizisten nicht von vornherein, doch ihm war klar, dass er bis über beide Ohren in irgendetwas hineingeraten war – in was, erinnerte er im Augenblick selbst nicht. Er wusste nur, dass er froh sein konnte, noch am Leben zu sein. Und dass er rauswollte aus diesem Krankenhaus.
Du kennst diese Jordanna doch gar nicht. Sie könnte Teil eines abgekarteten Spiels sein.
Eines abgekarteten Spiels? War das hier eine Falle? Plötzlich kehrte das Bruchstück einer Erinnerung zurück. Das Tonband …
»Mr. Saldano befand sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht im Gebäude«, stellte McDermott fest.
»Er hat sich verspätet.« Dance fühlte sich erschöpft. Vielleicht waren seine Verletzungen doch schlimmer, als er hoffte. Egal. Er würde das Laurelton Country General heute verlassen, da konnte Cochran sagen, was er wollte.
Die Medikamente machten es ihm unmöglich, klar zu denken. Es konnte bei dem Anschlag nicht um ihn gegangen sein, schließlich war niemand hinter ihm her. Oder doch? Niemand wusste von dem Tonband. Außer Max.
Und Max war nicht da gewesen …
Dance fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen und fragte: »Haben Sie mit Max gesprochen?«
»Einer unserer Detectives hat mit Mr. Saldano geredet, und sie würde sich auch gern mit Ihnen unterhalten.«
»Sie?«
»Detective Rafferty.«
Dance vernahm eine unterschwellige Missbilligung in der Stimme des Officers. Weil Detective Rafferty eine Frau war? Oder weil sie Detective war und er Officer? Oder womöglich beides? Er beschloss, das Messer in der Wunde ein klein wenig zu drehen. »Diese Rafferty ist Ihre Vorgesetzte?«
»Nein«, schnauzte McDermott, dann beherrschte er sich und presste eilig die Zähne zusammen. Der jüngere Officer schwieg verlegen. Dance hatte genügend Recherche betrieben, um zu wissen, dass nicht selten eine Mauer zwischen den Uniformierten und den Detectives stand. War dann auch noch eine Sie unter den Ranghöheren, streute das nicht selten Salz in die Wunden der anderen. Außerdem hatte dieser McDermott etwas an sich, etwas … Dance konnte nicht genau erklären, was, aber seine journalistische Spürnase verriet ihm, dass der Kerl ein Frauenfeind war. Vielleicht war es auch schlichter Neid, aber Dance war sich ziemlich sicher, dass McDermott mit dieser Befragung seine beruflichen Kompetenzen überschritt.
»Wir würden gern die Aussagen der bislang befragten Augenzeugen untermauern«, preschte McDermott vor.
… und Jay Danziger als Ersten vernehmen, dachte Dance. Anscheinend war der Uniformierte auf eine Beförderung aus.
»Erinnern Sie sich an die Explosion?«, fragte McDermott.
»Nein«, antwortete Dance wahrheitsgemäß. Er konnte sich an die Zeit davor und danach erinnern, doch der Augenblick, in dem der Sprengsatz in die Luft geflogen war, fehlte komplett. War das nicht genau das, was Traumapatienten berichteten? Ihm fielen die Pläne ein, die er am Vormittag geschmiedet hatte … via Handy, mit Max. Sie hatten Golf spielen wollen. Anschließend hatten sie kurz über Carmen gesprochen, die in Europa war, auf dem Weg nach Italien. Den eigentlichen Sachverhalt – dass sie getrennt waren, die Probleme, die ihre Trennung mit sich brachte – behielt er für sich. An die Fahrt zum Firmensitz konnte er sich dagegen überhaupt nicht mehr erinnern. Er wusste noch, dass er in seinen Highlander gestiegen war – den Wagen, den seine Ex so gern durch einen BMW ersetzt hätte –, den Rückwärtsgang eingelegt hatte und … Konnte er sich wirklich daran erinnern? Seine Hand hatte auf der Gangschaltung gelegen, doch da war etwas … ein Gefühl unterschwelliger Furcht …
Er meinte, die Explosion vor sich zu sehen oder vielmehr zu hören. Das gewaltige BUUUM! ließ seine Ohren immer noch klingeln. Doch das Einzige, was er tatsächlich erinnerte, war die Tatsache, dass er Max nicht angetroffen hatte.
Max war nicht da. Max war nicht da …
Langsam hatte er es satt, dass ihm dieser eine Satz unablässig durch den Kopf ging.
»Was hat Max gesagt?«, wollte er wissen.
»Das fragen Sie am besten Detective Rafferty«, kam umgehend die eher schroffe Antwort.
Volltreffer. Frauenfeind. Karriere-Neider. »Sie können mir keine Auskunft geben?«, drängte Dance den Officer.
»Sie hat Mr. Saldano befragt, nicht ich.«
»Wenn sie sich nicht beeilt, wird sie mich zu Hause aufsuchen müssen«, warnte Dance. »Ich habe bereits um Entlassung gebeten.« Zu Hause wird sie mich allerdings nicht finden.
»Heute noch?« McDermotts Augenbrauen schossen in die Höhe.
»Ja«, antwortete Dance mit Bestimmtheit. »Ich würde Ihnen wirklich gern weiterhelfen, aber ich gehe davon aus, dass dieser Anschlag den Saldanos galt.«
»Können Sie das mit Bestimmtheit sagen?«, schaltete sich Billings eifrig ein, was ihm einen finsteren Blick von McDermott eintrug.
»Das ist das wahrscheinlichste Szenario«, schlussfolgerte Dance, auch wenn er selbst nicht recht an das glaubte, was er da sagte. Er hatte es satt, sich mit den beiden zu unterhalten, vor allem weil er ahnte, dass er das Ganze mit dem weiblichen Detective später noch einmal durchkauen musste.
Kurz darauf verabschiedeten sich McDermott und Billings. Dance ließ sich in die Kissen zurücksinken, froh über den Aufschub. Er fühlte sich stark genug, um das Krankenhaus zu verlassen, und genau das würde er tun. Vielleicht war er verrückt, dass er die Hilfe dieser Jordanna annahm, aber er würde ihr vertrauen.
Du weißt doch gar nicht, wer sie ist! Sie hat sich als deine Frau verkleidet, um sich Zutritt zu deinem Krankenzimmer zu verschaffen, Herrgott noch mal!
Im selben Augenblick schwang die Tür auf und Jordanna trat ein, immer noch in engem grünem Kleid und High Heels. Ihr Blick traf seinen. Den Zeigefinger auf die Lippen gelegt, schloss sie die Tür hinter sich.
»Ich werde jetzt nach Hause fahren und ein paar Sachen zusammenpacken«, sagte sie. »Wenn ich wiederkomme, nehme ich wenn möglich die Hintertür am nördlichen Parkplatz. Auf diesem Weg werden wir das Krankenhaus verlassen. Wann sind deine Entlassungspapiere fertig?«
»Bald, hoffe ich. Ich wusste gar nicht, dass wir uns duzen – Jordanna.«
»Carmen«, widersprach sie. »Hier bin ich Carmen. Zum Sie können wir später übergehen.«
Dance verzog die Lippen trotz seiner Kopfschmerzen zu einem schiefen Grinsen. »Okay, Carmen. In Kürze wird hier ein Detective aufkreuzen, der vorhat, mich zu befragen. Zwei Officer waren schon da.«
»McDermott und sein junger Kollege. Ich habe mitbekommen, wie die beiden dein Zimmer verlassen haben.«
»Haben sie dich gesehen?«, erkundigte er sich neugierig.
»Nein, aber ich hatte bereits das Vergnügen mit McDermott«, räumte sie ein.
»Als Carmen?«
»Nun ja. Ich bin ihm am Empfang begegnet.«
»Ich bin mir sicher, dass du ihm nicht wiederbegegnen möchtest, zumal er anfangen wird, Fragen zu stellen.«
»Da hast du recht.« Ein flüchtiges Lächeln trat auf ihre Lippen.
»Was ist deine Rolle bei diesem Spiel?«
Sie zögerte, dann erwiderte sie: »Ich traue den Saldanos nicht.«
»Du kennst die Familie?«
»Nur dem Ruf nach, aber das genügt mir.« Ihr Ton zeigte mehr als deutlich, was sie von den Saldanos hielt.
»Sie sind nicht so schlimm, wie du anscheinend meinst.«
»Warum liegst du dann hier und nicht zum Beispiel Maxwell?«
»Schlechtes Timing.«
»Sehr schlechtes Timing, fast zu schlecht, um wahr zu sein«, pflichtete sie ihm bei. »Hast du an einer Story gearbeitet?«
»Nein«, log er.
Sie sah ihm forschend ins Gesicht.
»Du hast an irgendetwas, die Saldanos betreffend, gearbeitet.« Eine Feststellung, keine Frage.
»Wieso interessierst du dich für die Familie?«
»Ich …« Sie verstummte.
Als sie nicht weitersprach, fragte er ungeduldig: »Ich will wissen, was du hier zu suchen hast. Warum du mich aus dem Krankenhaus holen willst.«
»Ich möchte dir bloß helfen.«
»Das ist gelogen«, widersprach er mit Bestimmtheit. Als sie sich abwandte, dämmerte es ihm plötzlich. »Du weißt etwas über die Saldanos und mich.«
»Nein.«
»Ach, hör doch auf. Du bist Reporterin. Channel Seven, stimmt’s?«
Sie fuhr erstaunt zu ihm herum. »Ich bin nicht beim Fernsehen.«
»Aber du bist Reporterin. Auf der Suche nach einer Story.« Der Hohn in seiner Stimme war nicht zu überhören.
»Ich bin hier, um dir den Hintern zu retten«, blaffte sie empört. »Ja, ich bin Reporterin, und vielleicht bin ich an einer Story interessiert. Aber es gibt einen Grund dafür, dass du in diesem Krankenhausbett liegst. Sie waren es. Die Saldanos.«
»Was macht dich da so sicher?«
»Ich bin dir gefolgt, Mr. Danziger. Ich habe keine Ahnung, was vorgefallen ist, aber irgendwas liegt derart im Argen, dass sie dich loswerden wollen.«
»So ein Blödsinn. Du solltest aufpassen, was du sagst. Vorwürfe wie diese könnten gefährlich sein.«
»Ausgerechnet du sprichst von Gefahr?«, forderte sie ihn heraus. »Ich war da, als alles in die Luft flog – gleich auf der anderen Straßenseite. Wenn es keine Bombe war, war es ein Gasleck, auf alle Fälle etwas Großes. Du hast verdammtes Glück, dass du noch am Leben bist.«
»Es war eine Bombe.« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Du warst da? Bist du mir gefolgt?«
»Du weißt etwas über die Saldanos, deshalb bist du für sie zur Bedrohung geworden.«
»Du hast doch keine Ahnung«, knurrte er und ließ sich zurück in die Kissen sinken.
»Dein Leben ist in Gefahr! Du weißt, warum – ich dagegen weiß nur, dass das so ist.«
»Und deshalb bist du gekommen – um mich zu retten?«, fragte er sarkastisch.
»Ja.« Sie würde keinen Rückzieher machen. Sollte er doch denken, was er wollte! »Willst du immer noch mitkommen?«
Das Dumme war, dass sie gar nicht so unrecht hatte, überlegte er. Auch er hegte entschiedene Zweifel an der Familie, in die er eingeheiratet hatte. Und dann war da noch das Tonband … der Grund für sein Unbehagen.
»Ja«, krächzte er. »Ich will immer noch mitkommen.«
Sie sah ihn mit ihren haselnussbraunen, von langen dunklen Wimpern umrahmten Augen an, nüchtern, durchdringend, dann warf sie einen Blick auf die geschlossene Zimmertür. »Ich werde jetzt aufbrechen, um alles vorzubereiten. In ein paar Stunden bin ich wieder zurück.« Sie wandte sich zum Gehen.
»Jordanna …« Sie drehte sich zu ihm um. »Mach keinen Unsinn«, bat er und sah, wie sich ihre Mundwinkel nach oben verzogen, ganz leicht nur, die kaum sichtbare Andeutung eines Lächelns.
»Im Augenblick ist wohl alles, was ich tue, Unsinn«, bemerkte sie trocken.
Dance holte tief Luft. Einen Moment lang musterten sie einander, als wollten sie sich gegenseitig einschätzen, dann stieß er die angehaltene Luft aus und sagte: »Stell den Wagen eine halbe Meile entfernt ab und geh zu Fuß zum Krankenhaus, damit die Nummernschilder nicht von den Überwachungskameras erfasst werden.«
»Eine halbe Meile? So weit kannst du doch gar nicht laufen.«
Sie hatte recht. »Dann such dir eine Stelle, wo du die Nummernschilder ungesehen abmontieren kannst, bevor du auf den Parkplatz fährst. Dann kommst du rein und holst mich ab. Wir fahren zusammen weg, halten dann sobald wie möglich an und schrauben die Schilder wieder fest.«
»Das könnte funktionieren – vorausgesetzt, die Polizei stoppt mich nicht«, überlegte sie.
»Dann lass dich nicht stoppen.«
»Haha.« Trotzdem nickte sie, öffnete die Tür seines Krankenzimmers und spähte in den Flur hinaus. Bevor sie ging, drehte sie sich noch einmal zu ihm um. »Und du spazierst hier raus, egal, ob der Arzt dich entlässt oder nicht?«
»Mach dir deswegen keine Gedanken. Bis du zurückkommst, halte ich die Entlassungspapiere in der Hand.«
»Du siehst grauenhaft aus. Ich an Dr. Cochrans Stelle würde dich nicht gehen lassen.«
»Ich bin kein Gefangener.«
»Nein, aber du bist Patient, und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mal sicher, ob du es bis zu meinem Wagen schaffst.«
»Fahr einfach vor, um den Rest kümmere ich mich.«
»Okay.«
Er schloss die Augen, doch das Bild von ihr wollte nicht verschwinden, als habe es sich in die Innenseite seiner Lider eingebrannt. Sie war eine ausgesprochen hübsche Frau, sehr viel hübscher als Carmen, dabei sah auch seine Ex gut aus. Gleichzeitig war Jordanna ziemlich verwegen – eine Reporterin eben. Ja, das konnte er gut nachvollziehen. Er war genauso.
Er musste eingeschlafen sein, denn als er die Augen wieder aufschlug, stand eine Schwester an seinem Bett und überprüfte seine Werte. Die Streitaxt von vorhin. Als er erneut um seine Entlassungspapiere bat, wiederholte sie ihre Drohung, Dr. Cochran zu rufen. »Rufen Sie ihn, so oft Sie wollen«, sagte er zu der Frau. »Ich werde das Krankenhaus verlassen, ganz gleich, ob Sie die Papiere ausstellen oder nicht.«
Sorgfältig darauf bedacht, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht zu übertreten, fuhr Jordanna zu ihrer Wohnung. Sie stand nur lose mit dem Laurelton Register und der Lake Chinook Review in Verbindung – manchmal kaufte die eine oder andere Zeitung zu einem lächerlich niedrigen Satz einen ihrer Artikel, und immer ließ man sie spüren, dass man in Wahrheit auch gut und gern auf sie verzichten konnte. Niemand würde sie vermissen, wenn sie eine Weile nichts anbot, vermutlich auch nicht, wenn sie nie wieder in einer der Redaktionen auftauchte. Ihr Apartment hatte sie für zwei Monate im Voraus bezahlt, bar, wie sie es immer tat, wenn sie gerade etwas Geld zur Verfügung hatte. So musste sie sich in schlechten Zeiten zumindest keine Sorgen wegen der Miete machen. Genauso verfuhr sie mit den Nebenkosten.
Willst du das wirklich durchziehen?
»Und ob!«, murmelte sie, während sie die Treppe zu ihrer Wohnung im ersten Stock hinaufstürmte, zwei Stufen auf einmal nehmend. Die Wohnung war alles andere als ein anheimelndes Zuhause, aber sie erfüllte ihren Zweck. Jordanna konnte sich auf dem Herd eine schnelle Mahlzeit zubereiten und hatte Fertiggerichte im Wasserbad aufgewärmt, als ihre Mikrowelle kaputtgegangen war. Inzwischen hatte sie sich eine neue besorgt, und genau die packte sie nun als Erstes ein. An dem Ort, wo sie hinfahren würden, gab es nicht viele Annehmlichkeiten. Außer der Mikrowelle nahm sie eine Luftmatratze mitsamt Pumpe sowie Bettzeug und Handtücher mit.
Immer wieder lief sie die Treppe hinunter zu ihrem Wagen, bis der zehn Jahre alte Toyota RAV4 vollgepackt war. Sie hatte gerade noch genug Platz für ein paar Tüten mit Lebensmitteln gelassen, und nun plünderte sie ihren speziellen Notfallfonds für unvorhergesehene Ausgaben: in Plastikbeutel verpacktes Bargeld, das sie unter ihrer Matratze aufhob. Sie nahm drei dieser Beutel, betrachtete lange die restlichen drei und entschied dann, diese ebenfalls einzustecken. Auch ihr Laptop, das iPad und die Hälfte ihrer Klamotten kamen mit. Sie zog sich rasch um, legte ihre »Carmen-Kleider« ordentlich über die Stuhllehne und fuhr zum Supermarkt.
Dort kaufte sie Brot, Erdnussbutter, Käse, abgepackten Salat, Äpfel, Salz, Pfeffer, Mayonnaise, eingelegte Gurkenscheibchen, Barbecuesoße und Hähnchen in der Dose. Sie war sich nicht sicher, was sie in dem alten Farmhaus erwarten würde, da sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr dort gewesen war. Vorsichtshalber packte sie daher auch Plastikbesteck sowie Pappteller und Schüsseln in ihren Einkaufswagen.
Sie hatte den Kontakt zu ihrem Vater in voller Absicht abgebrochen, doch dann und wann telefonierte ihre jüngere Schwester Kara mit ihm oder seiner neuen Frau und hielt Jordanna auf dem Laufenden über das, was in Rock Springs passierte – ob sie wollte oder nicht.
»Ich kann es immer noch nicht fassen, dass er Jennie geheiratet hat«, hatte Kara bei ihrem letzten Telefonat gesagt.
»Wieso nicht? Sie ist doch genau im richtigen Alter«, hatte Jordanna schnippisch erwidert. »Außerdem ist sie die Tochter von Polizeichef Markum.«
»Glaubst du wirklich, dass es ihm nur darum geht?« Karas Stimme klang enttäuscht. Sie hatte stets weit mehr an ihren Vater geglaubt als Jordanna.
Jennie Markum, jetzt Jennie Winters, eine examinierte Krankenschwester, war die Tochter von Polizeichef Greer Markum und rein zufällig eine ehemalige Klassenkameradin von Jordannas älterer Schwester Emily. Jordanna hatte aus dem Rock Springs Pioneer von der Hochzeit erfahren, die im vergangenen Sommer in der Freiluftkirche auf dem Felsvorsprung oberhalb der Fool’s Falls stattgefunden hatte. Reverend Miles von der Green-Pastures-Kirche hatte die beiden getraut. Das Wetter war außergewöhnlich schön gewesen, der strahlend blaue Himmel und das Rauschen des in die Tiefe stürzenden Wassers hatten ihr Übriges zu diesem perfekten Tag getan, an dem sich der beliebte Allgemeinarzt von Rock Springs und seine strahlende Braut das Jawort gaben.
»Wenn Jennie unseren Vater davon abhält, sich an anderen jungen Frauen zu vergreifen, haben die zwei meinen Segen«, hatte sie trocken bemerkt.
»Dad ist nicht das Problem«, erhob Kara Einspruch, wie sie es immer tat.
»Was dann?«, fragte Jordanna, wie sie es immer tat.
»Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen, aber dir und mir ist doch klar, dass in Rock Springs etwas faul ist. Deshalb sind wir von dort abgehauen!«
»Ich kann dir genau sagen, was dort faul ist: Dayton Winters.«
»Nein … Unsinn, Jordanna, ich meine etwas anderes. Jedes Mal, wenn ich dort bin, spüre ich, dass sich etwas auf mich herabsenkt wie ein erstickendes Leichentuch. Das macht mich total klaustrophobisch!«
Kara sprach ständig in Rätseln, was Jordanna furchtbar auf die Nerven ging. »Du meinst das erstickende Leichentuch, das sich auf unsere große Schwester herabgesenkt hat?«
»Keine Ahnung. Vielleicht.«
Am liebsten hätte Jordanna der Jüngeren die Meinung gegeigt, aber sie wollte nicht das einzige Familienmitglied verprellen, das ihr noch geblieben war, deshalb schluckte sie die bissigen Kommentare, die ihr auf der Zunge lagen, herunter und entschied sich stattdessen für ein neutrales »Hm«.
»Ich werde eine Zeit lang nicht da sein«, hatte Kara bei ihrem letzten Gespräch verkündet. »Ich wollte immer schon in den Himalaya reisen, bergsteigen. Es muss ja nicht unbedingt der Mount Everest sein, aber mir fehlen die Berge. Übrigens das Einzige, was ich an Rock Springs vermisse.«
»Die Kaskadenkette ist nun wirklich nicht der Himalaya.« Die Bemerkung konnte sich Jordanna nicht verkneifen.
»Ich weiß. Aber in den Bergen fühle ich mich frei, dort kann ich meine Seele baumeln lassen. Auch Emily hat so empfunden.«
Ohne näher darauf einzugehen, fragte Jordanna: »Hast du genug gespart?«
»Ach, ich werde einfach eine Weile arbeiten.« Kara kellnerte und nahm jede Menge seltsame Jobs an, die meiste Zeit aber ließ sie sich treiben. Selbst Jordanna verdiente gerade nur so viel Geld, dass sie über die Runden kam, und manchmal fragte sie sich, wie Kara das alles hinbekam.
Es war das letzte Gespräch gewesen, das Jordanna mit ihrer Schwester geführt hatte, und wie immer hatte sie sich anschließend wie eine Außenseiterin in ihrer eigenen Familie gefühlt. Nicht dass sie sich ein engeres Verhältnis zu ihrem Vater gewünscht hätte, aber es wäre schön gewesen, wenn sie einen besseren Zugang zu Kara gefunden hätte.
Jordanna glaubte keine Sekunde, dass Dayton Winters wegen Jennie seine perversen sexuellen Neigungen aufgegeben hatte, aber da ihr ohnehin niemand glaubte, konnte sie momentan wenig ausrichten. Damals hatte man Jordanna Therapiestunden auferlegt. Zehn Stunden hatte sie bei einer Psychologin abgesessen, die ihr Daytons guter Freund, Polizeichef Markum, empfohlen hatte. Anna Eggers war sehr freundlich gewesen, Jordannas voreingenommener Meinung nach jedoch völlig inkompetent. Das einzig Nützliche, das sie bei Dr. Eggers gelernt hatte, war, dass es sich beim Treadwell-Fluch um einen reinen Mythos handelte.
»Die mentale Verfassung ändert sich mit dem Alter«, hatte sie Jordanna am Ende ihrer gemeinsamen Sitzungen erklärt, als sich diese stark genug fühlte, den Fluch zu thematisieren. »Das passiert vielen Menschen.«
»Auch jungen?«, wollte Jordanna wissen. »Meine Mutter hat diese Zustände mit Mitte dreißig bekommen.«
»Mitunter betrifft es auch jüngere Menschen.«
»Glauben Sie an den Treadwell-Fluch?«, hatte Jordanna mühsam hervorgestoßen.
»Ich denke, dass hier in der Gegend vermehrt über potenziell genetisch bedingte Geisteskrankheiten spekuliert wird. Deine Familie sieht sich schon seit langer Zeit völlig ungerechtfertigten Anschuldigungen ausgesetzt.«
Bei ihren Worten hatte Jordanna eine ungeheure Erleichterung verspürt, doch die war schnell vergangen, denn Dr. Eggers’ Meinung wurde keineswegs von Tante Evelyn geteilt, die ihr kundtat, dass Anna Eggers’ Vater ein Benchley war. Die Benchleys und die Treadwells hätten seit Generationen untereinander geheiratet – sehr zum Nachteil ihrer mentalen Gesundheit. »Selbstverständlich vertritt sie diese Ansicht«, verkündete Tante Evelyn naserümpfend. »Sie möchte schließlich nicht zugeben, dass sie ebenfalls betroffen ist, noch dazu, da sie mit beiden Familien verwandt ist. Ich selbst kann mich glücklich schätzen, dass ich von dem Fluch verschont geblieben bin, dem gnädigen Gott sei Dank. Aus dem Grund bete ich jeden Tag für dich, meine Liebe, genau wie ich für die Seele deiner bedauernswerten Mutter bete.«
Tante Evelyn Treadwell war zehn Jahre älter als ihre Schwester, Jordannas Mutter, und anscheinend nicht von dem Leiden betroffen. Allerdings war die Furcht vor dem Treadwell-Fluch der Grund dafür, dass sie nie geheiratet oder Kinder bekommen hatte. Jordanna hätte gern geglaubt, dass das Ganze ein einziger großer Schwindel war, ein aufgebauschtes Lügenmärchen ohne Hand und Fuß, doch dazu waren ihr die Anfälle und Ausraster ihrer Mutter sowie deren zunehmender Realitätsverlust noch allzu gut im Gedächtnis.
»Ich wünschte, du würdest jemanden finden, der dir wirklich hilft. Dein unberechenbares Verhalten ist ausgesprochen besorgniserregend. Dein Vater ist ein wundervoller Mensch, der mit Gayle ein großes Päckchen zu tragen hatte. Ich weiß nicht, ob ein anderer Mann so geduldig gewesen wäre wie er.«
»Meine Mutter war krank!«, entgegnete Jordanna aufgebracht.
»Sie ist nicht zur Kirche gegangen.« Diese Bemerkung kam aus den tiefsten Tiefen von Tante Evelyns üppiger Brust, eine bittere Anklage gegen die Schwester, der trotz ihrer Krankheit Liebe zuteilgeworden war. Noch bevor Jordanna ihre Mutter ein weiteres Mal verteidigen konnte, beendete Evelyn das Gespräch mit dem Satz: »Begib dich in Gottes Hände, und du wirst gerettet werden. Warte nicht, bis du jemandem wirklichen Schaden zufügst, denn dann ist es zu spät, Jordanna.« In den Augen ihrer Tante war sie die undankbare, labile Tochter, die versucht hatte, Dr. Dayton Winters’ ehrbaren Namen in den Schmutz zu ziehen.
Na schön. Sie brauchte Tante Evelyn nicht, sie brauchte Kara nicht. Und ihren Vater brauchte sie erst recht nicht. Sie hatte gelernt, die Dinge so zu nehmen, wie sie waren, und die Jahre, die sie fernab von Rock Springs verbracht hatte, hatten sie abgehärtet gegen die ungerechte Behandlung, die ihr dort widerfahren war. Inzwischen dachte sie zumeist: Was soll’s? Es ist vorbei. Sie lebte nicht mehr in Rock Springs, würde nie wieder dorthin zurückkehren, also kümmerte sie das, was damals dort passiert war, nicht mehr.
Bloß dass sie jetzt doch dorthin zurückkehrte, Jay Danziger im Schlepptau.
Jay Danziger.
Ihr Herz fing an zu flattern, und sie gab ein schnaubendes Lachen von sich. Was sie vorhatte, war verrückt, daran bestand kein Zweifel. Vielleicht hatten all die Schandmäuler und Fingerdeuter in Rock Springs doch einen Grund, sich Sorgen um sie zu machen. Selbst wenn sie der aufrichtigen Überzeugung war, dass Jay Danziger in Gefahr schwebte, wurde ihr fast schwindlig bei dem Gedanken, dass sie sich mit ihrem einstigen Idol verbündete. Der Kerl war verdammt attraktiv.
An der Supermarktkasse bezahlte Jordanna ihre Einkäufe, kehrte noch einmal in ihre Wohnung zurück und zog das Carmen-Outfit an. Anschließend frischte sie ihr Make-up auf, richtete ihre Frisur, schloss ihr Apartment ab und setzte sich in ihren RAV4. Sie fuhr Richtung Portland, dann nahm sie die Ausfahrt auf der Sunset und ordnete sich auf der Straße zum Laurelton General Hospital ein. Nachdem sie an mehreren Verwaltungsgebäuden vorbeigekommen war, bog sie auf die Zufahrt zu dem fast leeren Parkplatz auf der Rückseite des Krankenhauses ein, die an einem leer stehenden Einkaufszentrum vorbeiführte. Sie hielt bei der ehemaligen Ladenzeile an und sah sich bei laufendem Motor gründlich nach allen Seiten um. Weit und breit war niemand zu sehen. Eilig zog sie den verstellbaren Schraubenschlüssel aus ihrer Handtasche und stieg aus. Mit rasendem Puls und zitternden Händen ging sie vor dem Toyota in die Hocke und schraubte das Nummernschild ab, dann hastete sie um den RAV4 herum und löste auch das hintere Kennzeichen. Sie hatte kurz überlegt, ob sie die Nummernschilder eines anderen Wagens stehlen und austauschen sollte, doch dann entschied sie sich dagegen. Ein fehlendes Kennzeichen ließe sich vielleicht noch erklären, ein gestohlenes dagegen nicht. Überhaupt war es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass sie auf dieser Zufahrtsstraße von der Polizei kontrolliert würde.
Jordanna warf die Nummernschilder auf die Gepäckstücke im Auto, dann stieg sie wieder ein und hielt kurz darauf mit wild pochendem Herzen auf dem Parkplatz gleich neben der Hintertür an. Sie verließ den Wagen, blickte an der Fassade hinauf und zählte die Fenster, bis sie Danzigers Zimmer gefunden hatte.
Anschließend betrat sie das Gebäude und entdeckte ein Schild neben dem Hintereingang, welches die Besucher darauf aufmerksam machte, dass diese Tür um neunzehn Uhr verschlossen wurde. Bis dahin waren sie längst weg und auf dem Weg nach Rock Springs.
Kapitel drei
Hast du etwas herausgefunden?«, schallte Detective Gretchen Sanders’ Stimme blechern aus dem Lautsprecher von September Raffertys Handy, die soeben in ihren Dienstwagen stieg.
September warf ihre Tasche auf den Beifahrersitz, steckte das Smartphone in den Becherhalter des Jeeps, dann antwortete sie ihrer Partnerin: »Nicht viel. Maxwell Saldano war zutiefst erschüttert und konnte gar nicht glauben, was passiert war. Angeblich macht er sich schreckliche Sorgen um seinen Schwager.«
»Danziger. Der Kerl, den es bei der Explosion am schlimmsten erwischt hat«, sagte Gretchen.
»Ja. Ich bin auf dem Weg ins Laurelton General, um ihn zu befragen.«
»Kopfverletzung, aber nicht wirklich schlimm. Sein Bein soll übel aussehen …«
»Das hab ich auch gehört. Und dass er heute noch entlassen wird.«
»Der Arzt lässt ihn raus? Jetzt schon?«, fragte Gretchen ungläubig.
»Keine Ahnung.«
»Gib mir Bescheid, wenn du etwas in Erfahrung bringen konntest.«
Septembers Partnerin war letzten Herbst vom Dienst beurlaubt worden, nachdem sie einen Mann erschossen hatte, um September das Leben zu retten. Obwohl der Fall eindeutig war und Gretchen, vollständig rehabilitiert, Anfang des Jahres an ihren Schreibtisch im Polizeipräsidium von Laurelton zurückgekehrt war, zögerte ihr Boss, Lieutenant Aubrey D’Annibal, noch immer, die beiden wieder zusammenzustecken. Was weder Gretchen noch September gefiel, aber es hatte zwei verschiedene Schießereien innerhalb einer extrem kurzen Zeitspanne gegeben, beide mit Polizeibeteiligung, und D’Annibal war nur vorsichtig. Zu vorsichtig, fand September, auch wenn es galt, die Wogen, die diese Vorfälle in der Öffentlichkeit geschlagen hatten, zu glätten, vor allem in Anbetracht des momentan turbulenten politischen Klimas. Gretchen und September waren beide beim Laurelton Police Department – kurz: LPD – beschäftigt, das eng mit dem Büro des Sheriffs von Winslow County zusammenarbeitete.
»Bernstein vom Portland PD hat unmittelbar nach der Explosion mit den Saldanos gesprochen. Könnte sein, dass sein Department den Fall übernimmt.«
»Das würde mich nicht überraschen. Die Saldanos sind überwiegend außerhalb von Laurelton tätig; hier haben sie nur ihren Hauptsitz. Allerdings dachte ich, D’Annibal wollte, dass wir ermitteln.«
»Wir sollen die Untersuchungen weiterführen«, stellte September klar.
»Sieht eher danach aus, als wolle er sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.«
»Kann sein. Auf alle Fälle fahre ich jetzt ins Krankenhaus.«
»Halt mich auf dem Laufenden.«
»Darauf kannst du wetten.«