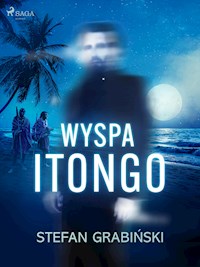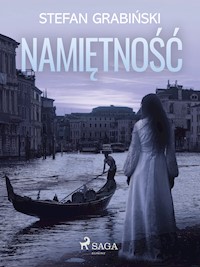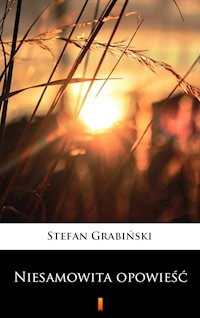1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Signale mit geheimnisvoller Bedeutung, eine einsame Bahnstation am Ende der Welt, eine geisterhafte Erscheinung im Zug, deren Erscheinen eine bevorstehende Katastrophe anzeigt, ein Toter, der Alarmsignale sendet und die Mysterien der Abstellgleise. Skurril, komisch und immer etwas unheimlich, das sind die Eisenbahngeschichten, die Stefan Grabinski zu Beginn des 20. Jahrhunderts schrieb. Stefan Grabiński (* 26. Februar 1887 in Kamionka Strumiłowa, heute Ukraine; † 12. November 1936 in Lwów) war ein polnischer Schriftsteller und Autor von Horrorliteratur, der gelegentlich auch als "der polnische Poe" bezeichnet wurde. Grabiński arbeitete in Lemberg und Przemyśl als Lehrer und wurde für seine in Demon ruchu gesammelten Eisenbahngeschichten bekannt. Eine Anzahl seiner Werke wurden von Miroslaw Lipinski ins Englische übersetzt und als "The Dark Domain" publiziert. Andere Werke, wie zum Beispiel Szamota's Mistress, wurden verfilmt. Grabiński starb im Jahr 1936 an Tuberkulose.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Abstellgleis
Düstere Welten Band 7
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Düstere Welten – Band 7
Stefan Grabinski – Das Abstellgleis
1. eBook-Auflage – Juli 2013
© vss-verlag Hermann Schladt
Titelbild: Armin Bappert unter Verwendung eines Fotos von http://www.freepics.com/
Übersetzung: Izabella Steffens
Lektorat: Hermann Schladt
Stefan Grabinski
Das Abstellgleis
Noch mehr merkwürdige Eisenbahngeschichten
Ultima Thule
Ultima Thule
Zehn Jahre ist es her. Das Ereignis hat inzwischen verschwommene, fast schemenhafte Formen angenommen, sich in den blauen Nebel vergangener Dinge gehüllt. Heute kommt es mir vor wie eine Vision oder wie ein verrückter Traum. Gleichwohl weiß ich, dass alles bis ins kleinste Detail genau so war, wie ich es im Gedächtnis bewahre. Seit jenem Moment haben sich viele Begebenheiten vor meinen Augen zugetragen, vieles habe ich inzwischen erlebt, mancher Schlag hat mein ergrautes Haupt getroffen — doch die Erinnerung an jenen Fall blieb unverändert haften, das Bild des merkwürdigen Augenblicks hat sich für immer tief in meine Seele gegraben; die Patina der Zeit hat die scharfen Konturen der Zeichnung nicht verwischt, ja mir ist, als ob die Schatten, die sich im Laufe der Jahre darüber gesenkt haben, sie auf geheimnisvolle Weise unterstreichen . . .
Ich war damals Bahnhofsvorsteher in Krepacz, einer kleinen Gebirgsstation unweit der Grenze. Von meinem Bahnsteig aus hatte ich das weite, gezackte Grenzland ganz nahe vor Augen.
Krepacz war die vorletzte Station vor der Grenze, außer ihr war fünfzig Kilometer entfernt nur noch Szczytniski, die letzte Station in Polen, in der Kazimierz Joszt, mein Freund und Berufskollege, seinen Dienst versah.
Er selber liebte es, sich mit Charon zu vergleichen, und der seiner Obhut anvertrauten Station gab er den literarischen Namen Ultima Thule. Ultima Thüle, die im Norden Britanniens gelegene Insel, wahrscheinlich Island, wurde von den alten Griechen für das äußerste Ende der Welt gehalten.
Ich habe in dieser Absonderlichkeit nicht nur eine Reminiszenz seiner klassischen Studien gesehen, doch das Motiv für beide Namen steckte tiefer, als ich geglaubt hatte.
Die Umgebung von Szczytniski war von eigenartiger Schönheit. Obwohl von meiner Station aus in einer knappen Dreiviertelstunde mit dem Personenzug erreichbar, verriet es doch einen grundsätzlich anderen, einen eigenständigen Charakter, wie ich ihm nirgendwo sonst in diesem Landstrich begegnet bin.
Das winzige Stationsgebäude, an eine senkrecht abfallende, mächtige Granitwand gelehnt, erinnerte an ein in der Felsnische klebendes Schwalbennest. Darüber erhoben sich zweitausend Meter hohe Berggipfel und hüllten die Gegend, die Station und die Lagerschuppen in Halbdunkel. Die düstere Schwermut, die von den Stirnen der Bergriesen herab wehte, bedeckte mit einem unerklärlichen Trauerflor die ganze Station. In der Höhe verdichtete sich der ewige Nebel und wallte hinab als Turban aus feuchtem Dunst. In einer Höhe von tausend Metern, also ungefähr in der Mitte, bildete die Wand einen Sims in Gestalt einer riesigen Terrasse, deren Auskehlung einer Trinkschale gleich randvoll mit silber-blauem Wasser gefüllt war. Ein paar Grundwasserbäche, die sich insgeheim im Leib des Bergriesen verbrüdert hatten, drangen aus seinen Weichen in regenbogenfarbenen Kaskaden.
Auf der linken Felsseite Zirbelkiefern und Tannen mit ihren immergrünen Pellerinen über den Schultern, rechts ein wilder, ungestümer Felshang mit Zwergkiefern, gegenüber, wie ein Grenzpfahl, der starre Berggrat. Darüber der Himmel, bewölkt oder rötlich schimmernd im Licht der Morgensonne — dahinter eine andere, fremde, unbekannte Welt. Eine wilde, unzugängliche Einöde, in unheilvolle Bergromantik gehülltes Grenzland . . .
Die Station verband mit der übrigen Strecke ein langer, in den Fels gehauener Tunnel; hätte es ihn nicht gegeben, wäre die Abgeschiedenheit dieses entlegenen Winkels vollkommen gewesen.
Der Bahnverkehr, der durch die einsame Bergwelt irrte, nahm ab, wurde schwächer, erschöpfte sieh. Die wenigen Züge, die sich vom Hauptverkehr lösten, tauchten, Meteoren glleich, nur selten aus dem Schlund des Tunnels auf und fuhren leise, ohne Geräusch, vor den Bahnsteig, als trügen sie Sorge, die Berge in ihrem tiefen Nachdenken zu stören. Die geringen Vibrationen, die ihre Einfahrt in die Gebirgsstille hervorriefen, schwollen rasch an und erstarrten in jähem Schreck.
Wenn die Wagen geräumt wurden, glitt die Lok ein paar Meter außerhalb des Bahnsteigs und schob den Zug in eine in die Granitwand gehauene gewölbte Halle. Dort stand er ein paar Stunden, mit den leeren Augenhöhlen der Fenster ins Dunkel des Gewölbes starrend und auf Ablösung wartend. Wenn der ersehnte Gefährte einfuhr, verließ er träge die düstere, felsige Herberge und kehrte in die Welt des pulsierenden Lebens zurück. Dafür nahm der andere seinen Platz ein, und von neuem versank die Station in traumverlorenen, nebelverhüllten Schlaf.
Wie liebte ich diese Einsiedelei in den Bergen! Sie war für mich ein Symbol geheimnisvoller Grenzen, ein mystischer Grenzraum zweier Welten, eine Art Niemandsland zwischen dem Reich des Lebens und des Todes.
Ich nutzte jede freie Minute zu einem Besuch meines Kollegen Joszt. Nachdem ich Krepacz der Obhut meines Stellvertreters anvertraut hatte, fuhr ich mit einer Draisine nach Szczytniski. Unsere alte, schon auf der Schulbank geschlossene Freundschaft wurde durch den gemeinsamen Beruf und die nahe Nachbarschaft noch gefestigt. Wir hatten uns aneinander gewöhnt und waren dank des offenen Gedankenaustausches zu einer höchst seltsamen Einheit verschmolzen.
Joszt stattete mir jedoch niemals eine Gegenvisite ab.
»Ich rühre mich hier nicht mehr vom Fleck«, pflegte er auf meine Vorhaltungen zu antworten. »Hier bleibe ich bis an mein Lebensende. Ist es nicht schön hier?« fügte er dann nach einer Weile hinzu und umfasste die Umgebung mit begeistertem Blick.
Ich musste ihm im stillen zustimmen, und dabei beließen wir es.
Er war ein ungewöhnlicher, ja überaus eigenartiger Mensch, der Kollege Joszt. Trotz seiner wahrhaft taubenhaf-ten Sanftmut und beispiellosen Gutmütigkeit erfreute er sich in der Gegend dort keiner besonderen Sympathie. Die Bergbewohner schienen den Stationsvorsteher zu meiden und wichen ihm schon von weitem aus. Grund dafür lag in der seltsamen Meinung, die sich die Leute in unerklärlicher Weise über ihn gebildet haben. Joszt galt unter den Goralen als »Seher« und das im umfassenden Sinn des Wortes. Es ging das Gerücht um, er könne bei den Leuten seiner Umgebung das »Zeichen des Todes« voraussehen und irgendwie seinen kühlen Hauch auf den Antlitzen der vom Tode Auserwählten spüren.
Wie viel Wahres daran war, weiß ich nicht, jedenfalls bemerkte auch ich etwas an ihm, was die Sinne empfindsamer und zu Vorurteilen neigender Naturen beunruhigen konnte. So hatte sich zum Beispiel das folgende eigenartige Zusammenspiel von Umständen meinem Gedächtnis eingeprägt:
Unter den Angestellten in Szczytniski befand sich auch ein Weichenwärter namens Glodzik, ein fleißiger und gewissenhafter Mann. Joszt mochte ihn sehr und behandelte ihn nicht wie seinen Untergebenen, sondern wie einen Gleichgestellten.
Eines Sonntags, als ich Joszt wie üblich einen Besuch abstattete, traf ich ihn in trüber Verfassung an; seine Stirn war umwölkt, und er blickte düster drein. Nach der Ursache befragt, tat er meinen Eindruck als trügerisch ab und zwang sich zur Heiterkeit. Da kam Glodzik hinzu, erstattete irgendeine Meldung und bat um Anweisungen. Der Vorsteher druckste herum, sah ihn seltsam an und drückte seine raue, schwielige Hand.
Der Weichenwärter ging hinaus, ein wenig befremdet über das Verhalten des Vorgesetzten, und kratzte sich misstrauisch den großen kraushaarigen Kopf.
»Armer Teufel!« flüsterte Joszt und blickte ihm traurig nach.
»Warum?« fragte ich, ohne die Szene zu begreifen. Da rückte Joszt endlich mit einer Erklärung heraus. »Ich hatte in dieser Nacht einen schlechten Traum«, sagte er, meinen Blick meidend. »Einen sehr schlechten.« »Du glaubst an Träume?«
»Leider ist der, den ich heute träumte, ein ganz typischer, und er trügt gewiss nicht. Ich sah heute Nacht wieder das alte, eingefallene Haus mit den eingeschlagenen Fensterscheiben. Sooft mir diese verdammte Bruchbude im Traum erscheint, passiert ein Unglück.«
»Was hat das mit dem Weichenwärter zu tun?«
»Hinter einem der leeren Fenster sah ich ganz deutlich sein Gesicht. Er beugte sich aus diesem schwarzen Loch und wedelte mir mit dem karierten Tuch zu, das er immer um den Hals trägt.«
»Und was soll das bedeuten?«
»Das war eine Abschiedsgeste. Dieser Mensch wird bald sterben — morgen, heute, jeden Augenblick.«
»Träume sind Schäume«, versuchte ich ihn zu beruhigen.
Joszt zwang sich zu einem Lächeln und schwieg.
Seine Befürchtung traf ein: Glodzik kam noch am selben Abend durch eigenes Verschulden ums Leben. Eine fehlgeleitete Lok fuhr ihm beide Beine ab; er verstarb an Ort und Stelle.
Dieser Vorfall erschütterte mich zutiefst, lange Zeit mied ich jedes Gespräch über dieses Thema. Schließlich, vielleicht ein Jahr später, kam ich wie von ungefähr doch darauf zu sprechen.
»Seit wann hast du diese unheilkündenden Vorgefühle? Soweit mir bekannt ist, hast du früher niemals ähnliche Eigenschaften gezeigt.«
»Du hast recht«, entgegnete er unangenehm berührt von meiner Frage. »Diese verfluchte Eigenschaft hat sich in mir erst später herausgebildet.«
»Verzeih, dass ich dich mit dieser peinlichen Sache bedränge, doch ich wäre froh, wenn ich ein Mittel fände, dich von dieser fatalen Gabe zu befreien. Wann hast du sie zum ersten Mal bei dir festgestellt?«
»Etwa vor acht Jahren.«
»Also ein Jahr nach deiner Übersiedlung in diese Gegend ?«
»Ja, ein Jahr nach meinem Umzug nach Szczytniski. Damals, im Dezember, genau am Heiligen Abend, habe ich den Tod des damaligen Dorfschulzen Grociel vorausgeahnt. Die Geschichte sprach sich überall herum, und innerhalb weniger Tage hatte sie mir den makabren Beinamen >Seher< eingebracht. Die Bergbewohner begannen vor mir die Flucht zu ergreifen wie vor einer Nachteule.«
»Eigenartig. Und dennoch muss etwas Wahres daran sein. Das wäre demnach ein klassisches Beispiel für das sogenannte zweite Gesicht, über das ich seinerzeit viel in alten Büchern der Magie gelesen habe. Über ähnliche Eigenschaften sollen lehr häufig schottische und irische Bergbewohner verfügen.«
»Ja, auch ich habe die Geschichte dieser Erscheinungen mit einem leicht begreiflichem Interesse gelesen. Ich glaube sogar, ich habe in allgemeinen Umrissen den Grund gefunden. Dein Hinweis auf die irischen oder schottischen >Nachteulen< ist sehr zutreffend, bedarf aber ein paar ergänzender Worte. So hast du vergessen hinzuzufügen, dass jene von der Umgebung gehassten und oft wie Aussätzige aus ihrem Dorf vertriebenen Unglücksraben ihre unheilvollen Gaben nur so lange besitzen, solange sie auf ihrer Insel sind. Auf den Kontinent verjagt, verlieren sie ihre makabre Eigenschaft und unterscheiden sich in nichts mehr von Durchschnittsmenschen.«
»Das ist merkwürdig. Das, was du sagst, würde also davon zeugen, dass dieses außerordentliche psychische Phänomen doch letztlich abhängig ist von Faktoren chthonischer, also irdischer Natur.«
»So ist es. Dieses Phänomen hat sehr viele tellurische, von der Erde herrührende Elemente. Wir alle sind Söhne der Erde und unterliegen ihren starken Einflüssen sogar auf Gebieten, die scheinbar von ihrem Nährboden abgetrennt sind.«
»Führst du die Erscheinungen deiner eigenen Gabe auf ähnliche Quellen zurück?« fragte ich nach einigem Zögern.