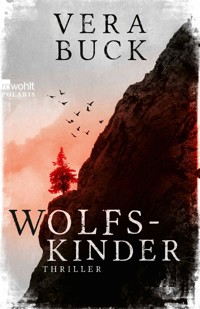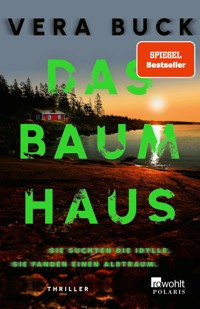
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn der Bullerbü-Urlaub zum Albtraum wird: der neue Thriller der Meisterin der Gänsehaut-Atmosphäre. Spätestens nach dem ersten Twist werden Sie dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen können! Als Henrik und Nora mit ihrem fünfjährigen Sohn Fynn ins schwedische Västernorrland fahren, erwarten sie einen idyllischen Urlaub. Doch bereits bei ihrer Ankunft spüren sie, dass die verlassene Ferienhütte etwas Bedrohliches umgibt. Der Eindruck bestätigt sich, als im angrenzenden Wald ein jahrzehntealtes Kinderskelett gefunden wird. Dann verschwindet Fynn. Während seine Eltern sich in ihrer eigenen Schuld verstricken, kommt die Ermittlerin Rosa Lundqvist in den Tiefen des Waldes einem düsteren Geheimnis auf die Spur. Denn sie hat allen anderen etwas voraus: ein außergewöhnliches Gespür für den Tod. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Fynns Verschwinden und dem toten Kind? Und was hat es mit dem längst verfallenen Baumhaus in der alten Esche auf sich? Ein Baumhaus, in dem noch immer jemand zu wohnen scheint …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Vera Buck
Das Baumhaus
Sie suchten die Idylle. Sie fanden einen Albtraum.
Thriller
Über dieses Buch
Du wirst dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen können.
Als Henrik und Nora mit ihrem fünfjährigen Sohn Fynn nach Västernorrland fahren, spüren sie gleich, dass die verlassene Ferienhütte etwas Bedrohliches umgibt: Fußabdrücke im Staub, Spuren überall im Haus. Jemand war hier. Während Henrik daraus Inspiration für sein neues Kinderbuch schöpft, versucht Nora, den idyllischen Familienurlaub zu retten und etwas wiedergutzumachen, von dem niemand erfahren darf …
Rosa Lundqvist ist frustriert: Statt ihre forensischen Forschungen voranzutreiben, wohnt sie wieder zu Hause, um ihren Bruder zu pflegen. Doch dann findet Rosa bei einer nächtlichen Grabung ein Kinderskelett. Und als ganz in der Nähe des Fundorts der kleine Fynn verschwindet, wird sie von der Polizei als Ermittlerin eingesetzt und kommt in den Tiefen des Waldes einem düsteren Geheimnis auf die Spur. Denn Rosa hat allen anderen etwas voraus: ein außergewöhnliches Gespür für den Tod.
«Verstörend schön, unheimlich und spannend von der ersten Seite an!» Bernhard Aichner
Vita
Vera Buck, geboren in Nordrhein-Westfalen, hat Journalistik, Europäische Literaturwissenschaft und Drehbuchschreiben quer durch Europa und auf Hawaii studiert. Für ihr Schreiben erhielt sie Stipendien und Auszeichnungen im In- und Ausland. Ihr Debütroman «Runa» schaffte es gleich auf die Shortlist für den renommierten Friedrich-Glauser-Preis 2016. Heute lebt Vera Buck in der Schweiz, wo sie als freie Schriftstellerin tätig ist. In den Bergen und auf Reisen findet sie bei mitunter halsbrecherischen Touren die Inspiration für ihre packenden Thriller.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung semper smile, München
Coverabbildung Jan Håkan Dahlström/plainpicture; Shutterstock
ISBN 978-3-644-01403-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für alle, deren erste Helden Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter und Jonathan Löwenherz waren.
Und für meine Mutter, die diesen Figuren in meiner Kindheit Leben eingehaucht hat.
Prolog
Die See ist hässlich und rau. Der Wind schiebt Wasserberge vor sich her, als müsse das ganze Meer umsortiert und ausgeweidet werden. Ich zittere. Meine Haare sind salzig und zu lang, sie wehen mir ins Gesicht und in die Augen. Der Mann ist ungeduldig. Er will, dass ich mich bis auf die Unterhose ausziehe und ins Wasser wate. Dabei ist mir noch immer schlecht von der Fahrt in der Kiste, und mir ist kalt. Ich schaue hoch. Vielleicht kann ich erkennen, in welche Himmelsrichtung wir gefahren sind, und so herausfinden, wie das Meer vor mir heißt. Er hat mir beigebracht, mich am Stand der Sonne zu orientieren. Aber die Sonne ist von dunklen Wolken bedeckt. Ich glaube, es gibt ein Gewitter.
«Nun mach schon», sagt er. «Das wird ein Abenteuer!»
Schlotternd steige ich aus meiner Hose und stakse auf allen vieren über die Steine nach vorn. Das Wasser ist kalt. Ich ziehe die Luft ein.
«Es konnte noch niemand so gut schwimmen wie du», sagt der Mann. Er klingt stolz und deutet nach vorn, wo weit entfernt der Umriss eines Felsens aus den Fluten ragt, oder vielleicht ist es auch eine Insel. Das hektische Auf und Ab der Wellen frisst die Umrisse und gibt sie wieder frei, frisst sie und gibt sie wieder frei. Es sieht aus, als würde die Insel selber schwanken. Ich beiße die Zähne zusammen und ziehe noch einmal scharf die Luft ein, als das Wasser auch meine Beine frisst.
Dass ich gut schwimmen kann, wusste der Mann schon, als er mich vor vierzehn Wochen im Schwimmbad abgefangen hat. Ich bin an dem Tag beim Nachwuchswettbewerb am schnellsten geschwommen, und das, obwohl ich erst zehn bin und alle anderen in meiner Kategorie schon elf oder zwölf. Ich war sehr stolz darauf. Und als dann sogar ein Mann kam und fragte, ob ich nicht Lust hätte, im Nationalteam zu schwimmen, er wolle mich trainieren und seiner Talentgruppe vorstellen, da bin ich fast geplatzt vor Freude.
Ich dachte: Endlich kann ich es den anderen zeigen. Endlich kann ich ihnen zeigen, dass ich besser bin als sie. Trotz meiner hässlichen Badehose von der Kleiderspende, und obwohl meine Eltern nicht da waren, um mich anzufeuern, so wie ihre.
Jetzt wünschte ich, ich hätte nie gewonnen. Ich wäre unsichtbar geblieben und hätte mich unter Wasser versteckt. Vielleicht hätte der Mann mich dann nie gesehen. Hätte mir nie Bonbons gegeben und mich mitgenommen.
Der Wind wird stärker. Die See tobt und heult vor mir. Ich muss mich richtig gegen die Böen stemmen, um nicht umgerissen zu werden. Hinter mir lädt der Mann sein Kanu vom Wagendach. Der Wind greift ins Innere des Boots und reißt daran. Ich sehe den Mann straucheln, doch er geht nicht in die Knie. Er ist wie diese knorrigen Bäume im Wald, in dem ich jetzt wohne. Der Wind kann an ihm reißen, doch er fällt nicht um. Der Mann klemmt das Kanu unter den Arm und stemmt sich gegen den Wind, bis er die Steine erreicht. Dann schiebt er es vor sich ins Wasser.
«Was ist?», ruft er in meine Richtung, das Gesicht ganz zerknittert und finster wegen dem Wind.
«Mir ist kalt.»
«Das wird sich beim Schwimmen schon ändern, vertrau mir! Komm, wir sind zwei Piraten auf hoher See! Haha!» Er lacht und reißt die Arme hoch.
Mir wird schlecht. Er lacht viel, der Mann. Er hat auch gelacht, als er an dem Tag, an dem er mich mitnahm, meinen Turnbeutel öffnete und die blaue Schwimmbrille aus dem nassen Knäuel an Handtüchern zog. Die Schwimmbrille war kaputt, weil die anderen mich nach dem Wettkampf im Gang vor der Dusche abgefangen hatten. Sie hatten das Band hinten festgehalten und die Brille vorne so lang gezogen wie eine Flitsche. Damit mir die Brille gegen die Augen schlägt, wenn sie loslassen. Einer nach dem anderen durfte mal dran sein damit. Weil ich es nicht verdient hatte zu gewinnen. Weil ich ja noch nicht mal einen Papa habe, der mich zur Schule bringt oder vom Schwimmunterricht abholt. Weil mein Papa abgehauen ist und Mama uns Kinder mitten in der Nacht zum Essen weckt: Nudeln mit Tomatensauce, in die sie alle Gewürze kippt, die sie im Schrank findet. Sogar die, die nach Weihnachten schmecken.
Die anderen Kinder haben sich lustig gemacht. Ich habe geweint. Aber der Schmerz an diesem Tag war nichts im Vergleich zu dem, wie weh es tut, bei dem Mann zu leben. Der Mann hat auch meine Schwimmkappe gefunden, die er angeschaut hat wie ein sehr fremdes Objekt.
«Wozu ist das denn?»
«Damit die Haare nicht nass werden.»
«Und später, in der Dusche? Machst du dir die Haare da nicht nass, um sie zu waschen?» Und er hat so laut gelacht, dass sein ganzer Bauch gewackelt hat. «So einen Schnickschnack brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier nur Kraft und Mut. Hast du das?»
Ich habe mit den Schultern gezuckt, aber er hat es mich laut wiederholen lassen: «Ich habe Kraft und Mut. Ich habe Kraft und Mut! Ich habe Kraft und Mut!» Und dabei habe ich mir vor Angst in die Hose gemacht. Als der Mann es gerochen hat, hat er gemeint, das müssten wir trainieren, mit der Kraft und dem Mut. Im Wald, wo ich jetzt wohne, gibt es viele Seen und Flüsse, die sich dazu eignen. Danach hat er mich zu schnelleren Flüssen geschleppt, zu reißenden Wildwasserbächen und Schluchten. Und jetzt sind wir hier, am Meer.
Der Untergrund ist glitschig. Steine und Muscheln stechen mir in die Füße. Schon die zweite Welle reißt mich um. Ich strampele, als ich den Boden unter den Füßen verliere, versuche mich an der Oberfläche zu halten, als das Meer mich in sich hineinzieht. Neben mir wackelt das Kanu des Mannes auf und ab, auf und ab, wie ein außer Kontrolle geratenes Schaukelpferd.
«Also dann, los!», ruft er mir zu und sticht mit dem Paddel in den weißen Schaum, den die Wellen bilden. Ich versuche, dem Kanu nachzuschwimmen. Aber das Meer ist ganz anders als ein See. Er ist ganz anders als ein Schwimmbad und selbst als der Fluss. Ich strampele mehr, als dass ich schwimme, um meinen Kopf über Wasser zu halten, und das Meer zieht mich einfach, wohin es will. Immer wieder schwappen die Wellen in mein Gesicht oder schlagen über mir zusammen. Ich blinzele. Salzwasser brennt in meinen Augen.
«Was ist?!», brüllt der Mann. Wegen dem Sturm kann ich ihn nur schlecht verstehen.
«Das … Wasser», huste ich. «Ich kann nichts mehr sehen! Die Wellen sind zu hoch.»
«Ich bin doch im Boot direkt neben dir. Da müssen wir hin! Da, zu der Insel!» Ungeduldig deutet er mit dem Paddel in die Richtung, und ich versuche es. Ich schwimme so fest ich kann, um mich neben dem Kanu zu halten. Aber mir geht bald die Kraft aus, und als ich die Insel schließlich sehe, zwischen einer hohen Welle und der nächsten, ist sie immer noch viel zu weit weg.
«Ich schaffe das nicht!», schreie ich gegen den tosenden Lärm an. Ich hoffe, dass der Mann mich ins Kanu zieht, einsieht, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so weit geschwommen bin, aber er ist ganz plötzlich verschwunden. Ich drehe mich panisch im kiesgrauen, schaumigen Wasser, suche den Horizont ab, in eine Richtung, in die andere. Ich bin ganz allein auf dem Meer.
«Hilfe!», brülle ich. «Hilfe!!!»
Und dann sehe ich die gelbe Spitze des Kanus plötzlich ein paar Meter von mir entfernt auf und ab tanzen.
«Gut so!», höre ich den Mann von irgendwo, oder vielleicht ist es auch der Wind in meinen Ohren, der mich anfeuert. Und dann höre ich noch etwas anderes, ein Tuten, und ich wende den Kopf nach links. Da ist ein Boot, ganz in meiner Nähe. Da sind Menschen. Andere Menschen! Ich huste noch einmal, spucke Wasser, stoppe meine Bewegungen. Unschlüssig lasse ich mich von den Wellen hin und her werfen. Dann wende ich mich um und halte auf das Boot zu.
«Nein! Nicht dahin! Hierher! Hierher!», brüllt der Mann. Er klingt jetzt wieder näher, ist irgendwo hinter mir. Ich kneife die Augen vor Anstrengung zusammen und schwimme weiter. Wenn ich winke und die Menschen auf dem Boot mich sehen, dann könnte das meine Rettung sein! Sie könnten mich vor dem Mann beschützen! Ich nehme all meine Kraft zusammen. Erst als ich noch einmal etwas tuten höre, laut und aufgebracht, hebe ich erschrocken den Kopf. Das Boot ist sehr viel größer, als ich dachte. Es ist ein Schiff! Ich halte inne. Meine Arme treiben lahm im Wasser, wie gekappte Taue. Ich reiße die Augen auf, trotz des Salzwassers, das darin brennt. Das Schiff ist jetzt direkt vor mir.
«Neeeeeiiiin!», brüllt der Mann. Seine Stimme ist verzweifelt. Er klingt, als hätte er Angst um mich. Ich habe auch Angst, aber nur kurz, dann ist da eine schwarze Wand aus Metall vor meinen Augen, ein harter Schlag, ein Sog unter meinen Füßen. Mein Körper wird herumgerissen, ich will schreien, bekomme Wasser in die Lungen und schlucke noch mehr, weil ich husten muss. Und dann ist da nur noch Panik, nackte, dunkle Panik, und Metall, das gegen meinen Körper drückt, mich nach unten drückt. Es tut weh, tut in der Lunge weh, im Brustkorb, der mit Salzwasser gefüllt ist. Ich bin schon einmal fast ertrunken, als Jannes und Mario mich im Schwimmbad runtergedrückt haben. Weil ich so ein Assi bin. Weil ich keiner bin, der eine Schwimmmedaille verdient hat. So hat es sich angefühlt, fast zu ertrinken. Wie Messer in meinen Lungen. Noch einmal höre ich das Schiff tuten. Und dann höre ich nichts mehr.
Erster Teil
«Der Wald, so endlos und so tief,
darin ein Kindlein sich verlief,
die Wolken schwarz, der Donner grollt,
das Kindlein hatte heimgewollt.
Der Tag, der war so ewig lang,
und duster war’s, dem Kind so bang,
es wandert unter Tränen dort
allein an diesem finstren Ort.
Es weint und denkt: Ach, nimmermehr
in Vaters Wohnstatt ich heimkehr’,
nein, hier in Finsternis und Not
holt mich gewiß alsbald der Tod.»
Aus: Astrid Lindgren, Wie wir in Småland Weihnachten feierten
Rosa
Eine Schaufel Erde fliegt durch die Luft. Im Licht des Baustrahlers landet sie auf meinem zusammengerollten Zelt. Sollte einer kommen und fragen, was ich da tue, werde ich sagen, dass ich hier übernachten und eine Grube für ein Feuer ausheben will. Das darf man überall in der schwedischen Natur, wir nennen es «Allemansrätt», das Jedermannsrecht. Sicher, die Grube ist ein bisschen tiefer, als sie es für eine Grillstelle sein müsste, aber ich werde sagen, dass das Feuer schließlich nicht auf die Bäume übergreifen soll. Es ist eine dämliche Erklärung, doch bei jungen Frauen gehen die Leute ja immer davon aus, sie seien ein bisschen naiv. Ungläubige Blicke ernte ich erfahrungsgemäß nur dann, wenn ich bei der Wahrheit bleibe und sage, dass ich nach Kadavern suche.
Die Esche, unter der ich die Grube aushebe, habe ich gestern mit gelber Kreide markiert. Ich muss die Beschaffenheit und Farben der Blätter bei Tag sehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo die Kadaver liegen. Das funktioniert nicht bei Nacht. Und manchmal funktioniert es gar nicht. Die Grabung gestern zum Beispiel hat nichts ans Licht gebracht, keinen müden Knochen. Das kann passieren. Wissenschaft basiert auf Misserfolgen. Möglich sogar, dass ich die Blätter richtig gedeutet, aber einfach auf der falschen Seite des Baums gegraben habe und damit knapp an der Verwesungsinsel vorbei.
Als ich auf Wurzeln stoße, trete ich mit dem Gummistiefel auf die Spatenkante und ramme die Spitze härter in den Boden. Ich ärgere mich, dass ich in aller Heimlichkeit graben muss, nachts. Als wäre Wissenschaft ein Verbrechen. Der aufgewühlte Waldboden riecht modrig, erdig. Er riecht vertraut. Irgendwo hoch über mir ruft ein Waldkauz. Ich verfalle in einen Rhythmus, den das scharfe Geräusch meiner Schaufel vorgibt – und mein schwerer Atem. Ich heble Erde heraus, schaufele, steche wieder nach. Es ist eine anstrengende Tätigkeit, die ich noch von meinem Praktikum auf dem Friedhof kenne. Aber seitdem sind einige Jahre vergangen, und in meinen Armen steckt bereits der Muskelkater der vergangenen Nächte.
Mit dem Handrücken wische ich mir den Schweiß aus dem Gesicht. Mein Blick fällt auf die kleinen weißen Hülsen, die im Licht des Baustrahlers im dunklen Boden schimmern. Ich pule eine davon aus dem Dreck und zerreibe sie zwischen den Fingern. Reste von Madenpuppen. Bingo. Ich hebe das Tagebuch auf und mache mir eine Notiz: Datum. Koordinaten des Fundorts. Insektenkundliche Spuren. Bodenbeschaffenheit. Zustand der potenziellen Zersetzungsinsel.
Ich benutze immer Tagebücher für meine Aufzeichnungen, teils aus reiner Gewohnheit, teils zu Ehren von Oskar, der für immer unter «1. Januar 1997» verewigt sein wird. Mein erster Kadaver. Mein Katerchen. Ihm beim Verwesen zuzusehen, war etwas ganz Besonderes.
In den letzten Tagen habe ich einen Elchschädel, einen verendeten Biber und ein Reh gefunden und vermerkt. Die Überreste liegen jetzt hinter dem Schuppen meines Vaters, bereit für die metabolomische Analyse: Ich will herausfinden, welchen Unterschied die Verwesung verschiedener Tierarten für den Stoffwechsel der Bäume macht. Die Blätter an dieser Esche haben zum Beispiel eine intensivere Farbe als die der vorangegangenen Grabungsstätten. Am Tag leuchten sie in einem satten Grün, das mich an frisches Basilikum erinnert. Darum hoffe ich jetzt, auf einen Fleischfresser zu stoßen. Vielleicht auf einen Vielfraß, einen Luchs oder kleinen Fuchs. Die drei Tiere der vorangegangenen Nächte waren allesamt Herbivore, Pflanzenfresser.
Ich nehme meine Arbeit wieder auf, schaufele weiter, während der Wald um mich herum heller wird. Mir läuft die Zeit davon. Wir sind zwar schon einige Wochen vom Midsommar und den nie enden wollenden Junitagen entfernt, aber auch Anfang August ist die Zeitspanne noch kurz, in der ich im Wald graben kann, ohne vom Sonnenlicht verraten zu werden. Und die Grube ist bereits jetzt so tief, dass mir keiner mehr die Geschichte mit dem Lagerfeuer abnehmen würde, egal wie dumm ich mich stelle. Ob ich in dieser Tiefe überhaupt noch ein verendetes Tier vorfinde?
Nicht sehr wahrscheinlich. Dabei war ich mir so sicher! Die Blattfarbe. Der Boden. Und dann die Reste der Madenpuppen!
Frustriert steche ich den Spaten in den schwarzen Boden – und halte inne. Da war ein Knirschen. Ein nur widerwillig nachgebender Widerstand, zu zart für einen Stein. So als hätte ich die Spatenspitze in porösen Kalkstein getrieben. Oder in einen Knochen. Vorsichtig ziehe ich den Spaten wieder heraus, es knirscht erneut. Ich gehe in die Hocke und schiebe mit der Hand etwas Dreck beiseite, doch die Grube ist inzwischen so tief, dass es hier unten stockdunkel ist. Ich muss über den Rand klettern und den Baustrahler holen, um die Grabungsstelle auszuleuchten. Da schimmert etwas schmutzig Gelbes in der Erde. Angespannt steige ich zurück in die Grube, gehe in die Hocke und lege meinen Fund frei. Es ist wirklich ein Knochen! Erst halte ich es für den Brustbeinkamm eines großen Vogels, doch es könnte auch das Schulterblatt eines Wirbeltiers sein. Ich puste auf den Knochen, befreie ihn von Dreckklumpen. Ja, eher ein Schulterblatt. Ich schiebe weiter Erde und Steine weg, finde Rippen, dann ein zweites Schulterblatt. Ich scharre nun mit den Händen im Dreck. Eine unwissenschaftliche Vorgehensweise, fahrig geradezu. Auf diese Weise fördere ich weitere kleine Knochen, Wirbel und Knöchelchen ans Licht, lege alles an den Rand, voller Ungeduld, endlich an den Schädel des Tiers zu gelangen. Meine Finger streifen etwas, das sich glatt und synthetisch anfühlt, wie eine Plastikplane, doch als ich es hervorziehe, ist es ein brauner Stofffetzen mit einer metallenen Öse, wie für die Kordel einer Kapuze. Irritiert halte ich inne und rücke, so weit es in dem engen Loch eben geht, zur Seite, um mir nicht selbst im Licht zu sitzen. Ist das ein Stück von einer verrotteten Jacke? In meinen Ohren schrillt es. Ich lasse den Stofffetzen fallen. Jetzt sehe ich auch die Schädeldecke. Wie ein halb vergrabenes Straußenei schimmert der Knochen im Licht meiner Lampe. Milchig gelb und voller Flecke. Ich greife mit beiden Händen danach. Der Schädel ist klein und leicht, als ich ihn aus der Erde löse. Wie der eines Affen, die es hier in Schweden natürlich nicht gibt. Kein Affe. Es ist der Schädel eines jungen Menschen. Eines Jugendlichen vielleicht. Oder der eines Kindes.
Ich starre in die schwarzen Augenhöhlen, während mir die Tragweite meiner Entdeckung bewusst wird. Ein Kinderschädel. Eine alte Kapuze. Knochen, Wirbel und Schulterblätter. Wen zum Teufel habe ich da ausgegraben?
Henrik
Ich frage mich, warum ich sie nicht einfach angelogen habe. Ihr nicht einfach erzählt habe, dass sich kurzfristig, direkt vor unserer Abreise, doch noch ein Käufer für das Haus gefunden hat. Nicht, dass ich nicht darüber nachgedacht hätte. Ich bin gut darin, die Wahrheit zurechtzubiegen, wenn es mir nützt.
Ich lehne meinen Kopf ans Autofenster. Überall kann ich hier meinen Opa sehen. Er steht am Straßenrand und zwinkert mir zu, in dieser Landschaft, die vorbeifliegt, als spule man einen Astrid-Lindgren-Film vor. Er tritt zwischen den hohen, schmalen Bäumen hervor und legt einen Finger an die Lippen, damit ich ihn nicht an meine Frau verrate, die das Lenkrad hält wie das Steuerrad eines Schiffs und mich nach Bullerbü entführt.
«Das wird super, wenn wir das Haus erst mal hergerichtet haben», sagt Nora jetzt. «Wenn Fynn dann in die Schule kommt, sind wir nicht auf die überteuerten Ferienwohnungen während der Schulferien angewiesen. Und du kannst dich hierher zum Schreiben zurückziehen, wann immer dir danach ist! Ich meine, welcher Ort würde sich wohl besser anbieten als Schweden, um den nächsten Kinderbuch-Bestseller zu schreiben?» Sie dreht sich lachend zu Fynn um, der auf der Rückbank hinter mir sitzt und einen Seufzer von sich gibt, der mir aus der Seele spricht.
Die Wahrheit – und es ist ironisch, dass ausgerechnet ich das sage – die Wahrheit ist, dass meine Kinderbücher wenig mit denen von Astrid Lindgren gemein haben. Die meisten meiner Bücher spielen in fantastischen Welten. Es gibt darin alle möglichen Kreaturen und Wesen, die ich zusammen mit Fynn erfinde, und viel Düsterkeit. Keine Idylle wie hier. Es sind Welten, die nur Kindern zugänglich sind und sich Erwachsenen verschließen, weil dieses Maß an Fantasie ihnen längst abhandengekommen ist.
Fynn rutscht halb unter dem Anschnallgurt durch und tritt mit der Fußspitze gegen meinen Sitz. Ihm ist langweilig, und das lässt er mich spüren. Von Greifswald bis zu unserem Ferienhaus in Norrland sind es insgesamt fünfzehn Stunden Autofahrt, und das Buch mit den Astrid-Lindgren-Geschichten hat er schon nach zehn Minuten in den Fußraum rutschen lassen. «Können wir Feuerwehrmann Sam hören? Oder Paw Patrol?», mault er. Småland kennt er nur aus dem IKEA.
Ich überlasse Nora die Antwort, wende mich wieder dem Seitenfenster zu, suche meinen Großvater zwischen den endlosen Baumreihen und finde ihn am Ufer des nächsten Sees. Er steht von mir abgewandt, die faltigen Hände auf dem Rücken verschränkt, und schaut ins Wasser. Früher, kurz nach seinem Verschwinden aus dem Krankenhaus, habe ich oft geträumt, wie er am Rand irgendeines Gewässers steht. Jedes Mal wollte er ins Wasser waten, und ich habe geschrien, um ihn aufzuhalten und meine Eltern damit zu Tode erschreckt. Jetzt aber sitze ich ganz still und ruhig. Ich bin älter geworden, und es ist lange her, dass ich mit seinem Tod gehadert habe.
Mein Großvater ist in Schweden ertrunken. Kein schöner Tod, und ich nehme es meinem Vater noch immer übel, dass es dazu gekommen ist. Aber mittlerweile denke ich auch, es war besser für meinen Opa, an einem Ort zu sterben, den er sich ausgesucht hat: mitten in der Natur statt in einem Pflegeheim in Deutschland, in das er gesteckt worden wäre, nachdem weder mein Vater noch meine Tante bereit waren, sich um ihn zu kümmern.
Das Navigationssystem weist Nora an, links zu fahren, und obwohl außer uns niemand auf der Straße ist, setzt sie den Blinker, bevor sie abbiegt. Zwischen den Bäumen tauchen verstreute rot-weiße Holzhäuschen auf. Eine Siedlung, die mich an Kindheit erinnert, weil auch ich hier früher mal über Bäche gesprungen bin und mit Stöckchen gespielt habe, wie ein Bullerbü-Kind. Mein Gott, wie lange ist das jetzt schon her?
Das letzte Mal, als ich hier durchgefahren bin, saß ich auf dem Rücksitz im Auto meiner Eltern, und wir folgten dem Krankenwagen, in dem mein Opa lag. Ich erinnere mich noch, dass es regnete, dass ich meinen Eltern irgendwas erzählen wollte. Etwas, das mit der Dunkelheit der Tannen draußen zu tun hatte. Aber meine Eltern hatten sich in den Haaren, sie hörten mir nicht zu.
Es waren keine schönen Umstände, unter denen wir Schweden verlassen haben. Vielleicht hatte deshalb keiner von uns das Bedürfnis, hierher zurückzukehren, in das kleine Haus, das meinem Opa gehört hat. Jetzt gehört es uns.
Wir kommen an einer Insel vorbei, die auf einem glitzernden See liegt. Und plötzlich kommt mir eine der vielen Geschichten in den Sinn, die diesen Ort einspinnen und die viel älter als Michel aus Lönneberga oder Pippi Langstrumpf sind. Ich tippe gegen das Fenster, sage: «Fynn! Schnell! Siehst du da? Den Wolf?»
Fynn hört augenblicklich auf, gegen meinen Sitz zu treten, und richtet sich auf dem Kindersitz auf, klebt Stirn und Hände ans Seitenfenster, hinter dem die Insel bereits vorbeigeflogen ist.
«Wo?», fragt er und quetscht seine Nase gegen die Scheibe.
«Auf der Insel», erkläre ich. «Das war Fenrir, der Riesenwolf.» Ich rolle das «r», um den Namen noch schrecklicher klingen zu lassen, und es verfehlt seine Wirkung nicht.
«Ein Riesenwolf?!»
«Der hat hier vor vielen Hundert Jahren die Wälder unsicher gemacht. Keine Kette konnte ihn halten, also haben die Götter ihn auf die Insel gebracht.»
«Wieso?», fragt Fynn und dreht sich jetzt zur Heckscheibe um, wo der See hinter uns zurückbleibt.
«Weil er die Menschen gefressen hat. Und die Götter.»
Nora zieht die Augenbrauen hoch. Das ist nicht die Art von Geschichte, die ihren pädagogischen Vorstellungen entspricht.
«Ich meine, warum haben sie ihn auf die Insel gebracht?», sagt Fynn. «Kann er nicht schwimmen?»
«Natürlich nicht, er war ja ein Wolf. Die können nicht schwimmen.»
Nora runzelt die Stirn und mischt sich nun doch ein: «Also das stimmt so nicht ganz! Wölfe können sogar sehr gut schwimmen. Ich habe erst kürzlich einen Artikel in der «National Geographic» gelesen, in dem es um Wölfe an der Küste in British Columbia ging. Die Tiere leben dort auf winzigen Inseln und nutzen den Ozean als Nahrungsquelle. Sie knacken Krabben und Muscheln und Walkadaver und schwimmen auf ihrer Futtersuche viele Kilometer weit.»
Ich wende mich zum Fenster, damit Nora mich nicht grinsen sieht. Es ist typisch für sie, Fynn mit Wissen ködern zu wollen. Sie hat schon versucht, an seinen Verstand zu appellieren, als er gerade mal einen Löffel greifen konnte. Wenn er nachts vor unserem Bett steht, Angst vor Monstern und Ungeheuern hat, dann schlägt sie nicht einladend die Decke zurück, sondern lässt sich von ihm den genauen Unterschied zwischen Monstern und Ungeheuern erklären. Aber jetzt will Fynn wissen, was ein Walkadaver ist und warum dieser Riesenwolf nicht weiß, dass er schwimmen kann. Schmunzelnd überlasse ich es Nora, ihm all das zu erklären. Wenn er heute Nacht im Schlafzimmer steht und Angst hat, der Wolf könne den See überquert haben, dann werde ich sie daran erinnern, dass das der Teil der Geschichte war, den sie erzählt hat.
Das Navigationssystem weist uns noch einmal an abzubiegen. Doch der Pfad ist so schmal und zugewachsen, dass wir ihn zunächst verpassen und wenden müssen.
«Da rein?», fragt Nora fassungslos, bevor sie den Wagen vorsichtig von der Straße lenkt. Wir holpern über ungeteerten Untergrund. Tannenäste streifen das Auto wie blinde Riesen, die befühlen, wer sich nach so langer Zeit hierher verirrt.
«Da werden wir wohl jemanden beauftragen müssen, der die Schneise frei schlägt», murmelt Nora und beugt sich konzentriert nach vorn, der Lichtung entgegen, die sich jetzt vor uns eröffnet. Ich höre die Unsicherheit in ihrer Stimme, sage jedoch nichts. Das Sommerhaus wiederherzurichten, war ihre Idee, nicht meine. Irgendwie ist das Gespräch zwischen ihr und meiner Mutter über die Osterfeiertage auf dieses Häuschen in Schweden gekommen, und von dort aus haben sich Noras Pläne verselbstständigt. Ich habe lediglich den verstorbenen Großvater beigesteuert, dem all das früher einmal gehört hat.
Nora parkt das Auto im kniehohen Gras und stellt den Motor ab. Und dann sind die Erinnerungen mit einem Schlag wieder da. In diesem kleinen roten Holzhaus am See habe ich die schönsten Sommer meines Lebens verbracht. Ich kann den Rand des alten Ruderboots erkennen, das neben dem Steg im Wasser versunken ist. Hier hat mein Opa mir das Angeln beigebracht. Hier hat er mit einem Handtuch gestanden, wenn ich prustend aus dem Wasser aufgetaucht bin, und mich eingewickelt, kaum dass ich bibbernd im taunassen Gras stand. Bei dem Gedanken daran geht mir das Herz auf.
«Sind wir da?» Fynn lehnt sich zwischen unseren Sitzen durch. Er will endlich aus dem Auto, und auch wir sind steif und verspannt von der langen Fahrt. Wir steigen aus, und ich öffne die kindergesicherte Tür. Fynn ist bereits abgeschnallt, rutscht vom Sitz und rennt voraus, um als Erster beim Haus zu sein. Er hängt sich an die Türklinke, brüllt: «Ist gar nicht abgeschlossen!», und macht dann: «Whoa! Voll cool! Und voll stinkig hier! Glaubst du, hier ist wer gestorben, Papa?»
Nora wirft mir einen Blick zu, der mir bedeuten soll, dass unser Sohn definitiv nach mir kommt. Dann folgen wir Fynn, ohne die Koffer aus dem Wagen zu holen, und stapfen durch die Wiese zur Veranda. Das Haus ist in die Jahre gekommen. Von den Verstrebungen vor den blinden Fenstern blättert die Farbe ab. Das Dach biegt sich an einigen Stellen nach oben, als drücke eine große Faust von innen dagegen. Und die Fahnenstange neben der Tür, an der früher einmal eine stolze kleine Schwedenflagge flatterte, ist jetzt nicht mehr als ein dürrer, verhungerter Arm, den das Haus uns im Hilferuf entgegenstreckt. Mit einem Mal tut es mir leid, dass wir diesen Ort, den mein Großvater so sehr liebte, einfach haben verkommen lassen.
Als wir durch die Tür treten, rümpft Nora die Nase. «Fynn hat recht. Es stinkt. Wahrscheinlich liegt hier irgendwo eine tote Maus.»
Wir machen uns gleich auf die Suche, reißen alle Fenster auf, um die Sommerluft hereinzulassen, und ich betrete vorsichtig das obere Stockwerk, in dem die beiden Schlafzimmer und das Bad liegen. Schritt für Schritt prüfe ich den knarrenden Holzboden, damit nicht am Ende noch einer von uns durch die Decke bricht. Er ist bedeckt von Staub und Mäusekot, hält meinem Gewicht aber stand. Die Schlafzimmer ähneln Zeitkapseln: offene Schränke, ein zerwühltes Bett. Sogar ein Wasserglas steht noch auf dem Nachttisch. Der Boden ächzt, als ich mich auf den Schrank im Schlafzimmer zubewege. Auch darin ist die Zeit stehen geblieben. Die Kleidung hängt da, als warte sie geduldig auf die Rückkehr meines Opas. Ich erkenne die kratzigen Norwegerpullis, in denen ich früher gerne mein Gesicht vergraben habe, wenn seine Geschichten so spannend wurden, dass mich die Angst in der Brust gekitzelt hat.
Ich lehne mich vor, bis meine Nase einen Ärmel berührt, zucke jedoch zurück, als mir ein strenger Gestank entgegenschlägt. Auf dem Schrankboden liegt ein toter Vogel.
«Armes Kerlchen», murmele ich, gehe ins angrenzende Bad und finde auf dem Hocker neben der Badewanne eine vergilbte Zeitung, die ich unter den Vogel schiebe, um ihn nach draußen zu tragen.
Nora ist im unteren Stockwerk ebenfalls fündig geworden. Sie hat eine tote Maus entsorgt und bearbeitet den kotübersäten Boden mit einem Besen, während Fynn auf der Tischplatte in der Küche sitzt und ungeduldig die Beine pendeln lässt. Er wartet auf den Startschuss für seine eigene Entdeckungstour.
«Mama lässt mich wegen den Mäuseköteln nicht spielen», beschwert er sich.
«Mäuse übertragen Krankheiten», sagt Nora, ohne von ihrer Besenarbeit aufzublicken.
«Die anderen Kinder im Kindergarten übertragen auch Krankheiten», sagt Fynn, dem Nora genau das erst kürzlich erklärt hat, als er mit Windpocken im Bett lag.
«Komm, Fynn», sage ich. «Du kannst mir helfen, den Vogel im Garten zu beerdigen.»
«Der muss doch nicht beerdigt werden», sagt Nora pragmatisch. «Wirf ihn einfach in den Müll.»
Fynn sieht mich geschockt an, und ich zucke entschuldigend die Schultern, bevor ich rausgehe und den Vogel in den Wald hinter dem Haus werfe. Ich merke nicht, dass Fynn vom Tisch rutscht und mir nachkommt, bis er plötzlich hinter mir steht.
«Was hast du jetzt mit ihm gemacht?», fragt er. Ich hocke mich neben ihn und deute auf die Krone der Tanne. «Ich habe ihn hochgeworfen, und da hat er plötzlich den Wind unter den Flügeln gespürt und ist weggeflattert.»
«Echt?», Fynn legt den Kopf in den Nacken und folgt meinem Fingerzeig, dorthin, wo in diesem Moment glücklicherweise wirklich ein Vogel zwitschert. «Aber er war doch tot.»
«Und jetzt ist er wieder lebendig, siehst du doch.»
«Bloß weil du ihn hochgeworfen hast?»
Ich nicke fachmännisch.
«Wie hoch?», verlangt Fynn zu wissen. «So hoch wie den Baum?»
«Noch höher.» Und dann packe ich ihn und zeige ihm, wie hoch ich den Vogel geworfen habe, und er quietscht vor Freude. Mein wundervoller Sohn kann jetzt fliegen, und ich beneide ihn wieder einmal um seine Fähigkeit, in jedem Moment alle Zeit der Welt zu haben.
Ich werfe den lauthals lachenden Fynn erneut in die Luft und spüre plötzlich einen Blick in meinem Rücken, bei dem ich den Kopf wende, in der festen Annahme, dass es Nora sein muss, die uns beobachtet. Aber da sind nur der Wald und unser Auto. Nora ist im Haus. Ich kann sie von drinnen rumoren hören. Und was sollte sie auch im Wald zwischen den Bäumen?
«Papa!», kreischt Fynn, halb freudig, halb panisch, und ich fange ihn gerade rechtzeitig auf. Er protestiert, als ich ihn zurück auf die Füße stelle. Doch dann bemerkt er meinen Blick, der noch immer am Wald hängt.
«Was ist da, Papa?», fragt er, und als ich nicht gleich reagiere: «Was ist denn da, Papa, Papaaa!» Er zieht an meinem Arm wie am Seil einer Kirchenglocke, doch ich bin in Gedanken woanders. Da ist eine flatterige Aufregung in meinem Bauch, weniger ein Gefühl als eine Idee davon, ganz ähnlich dem Kitzeln, das ich vorhin bei den Pullis im Schrank empfunden habe. Beug dich mal her zu mir, sagt die Idee, ich will dir was erzählen.
Ohne auf Fynn zu achten, lasse ich meinen Blick über das Haus streichen, über den Wald. Ich suche nach einem Wort, das zu dem Gefühl passt.
«Papa!» Fynn reißt noch einmal an meinem Ärmel, heftiger, und mit dem Ruck reißt auch der Gedanke ab wie ein Faden. Ich sehe Fynn an, und er schaut entrüstet zurück. Ich wuschele ihm durch die sommerblonden Haare. Mir liegt eine Geschichte über Trolle auf den Lippen, die es hier in den Wäldern gibt. Noch ist Fynn in einem Alter, in dem er meinen Erzählungen mit leuchtenden Augen lauscht. Aber er würde darauf bestehen, den Troll mit mir suchen zu gehen, und heute hält mich etwas davon ab. Vielleicht ein Fünkchen schlechtes Gewissen Nora gegenüber – doch vor allem ist es der Wald selbst. Ein Wald, aus dem sich gerade eine Geschichte geschält und von hinten an mich angeschlichen hat.
«Hattest du gerade wieder eine Idee, Papa?», fragt Fynn, und ich blinzele verwirrt. Ich muss mich noch daran gewöhnen, wie viel er inzwischen begreift. Ich fahre ihm noch einmal durch die Haare, von der Stirn zum Hinterkopf, sodass sie hochstehen wie ein Drachenkamm.
«Ja, vielleicht.»
«Für ein Kinderbuch?»
«Vielleicht.»
«Und steht dann auch wieder mein Name ganz vorne drin?» Seit Fynn geboren ist, habe ich ihm jede meiner Geschichten gewidmet. Selbst die, für die er eigentlich noch zu klein ist.
«Gleich auf der ersten Seite!», bestätige ich und hebe ihn auf meine Schultern. Ich fange an, mit ihm über die Wiese zu traben, laut schnaubend wie ein Pferd. Für meinen Sohn tue ich alles. Für ihn bin ich ein Pferd, ein Pilot, ein Magier, Wikinger und Pirat. Ich erfinde Geschichten, und es gibt kein dankbareres Publikum als ihn, Fynn, für den noch alles glaubhaft und möglich ist. Darum schreibe ich für Kinder und nicht für Erwachsene.
Ich halte Fynns Beine fest, weil er sonst vor Lachen von meinen Schultern fallen würde. Er gluckst und kichert bei jedem Sprung. Es macht mich glücklich, so viel Freude auf den Schultern zu tragen. Vielleicht hatte Nora recht. Es war eine gute Idee herzukommen. Die Wälder und der dunkle See vor unserem Haus bieten sich geradezu dafür an, hier zu schreiben und Geschichten zu erzählen. Ein Wald und ein See, das sind die besten Brutstätten für Ungeheuer und Ängste aller Art.
Marla
Mein Zuhause liegt hoch oben in einem Baum, den man Esche nennt. Wir aber nennen ihn Yggdrasil, wie den Weltenbaum aus den alten Geschichten. Yggdrasils Wurzeln reichen bis in die tiefsten Tiefen der Erde und seine Zweige bis in den höchsten Himmel hinein. Unter den Wurzeln schläft ein Drache, und oben in den Zweigen kuschele ich mich unter der dicken Wolldecke ein. Die Hütte in den Zweigen ist mein Nest. Mein Rabennest. Könnte ich ein Tier sein, dann wäre ich gerne ein Rabe. Raben sind leise Schatten, sie sind Späher. Wenn sich böse Menschen zwischen den Bäumen herumtreiben, dann sind sie die Ersten, die es wissen.
Ich schiebe meine Hand unter der Decke hervor, zu der Feder, die ich gestern auf der Lichtung gefunden habe. Sie ist glänzend und weich und groß und muss einem besonderen Raben gehören, vielleicht Hugin oder Munin, so heißen die beiden Raben von Odin.
Odin ist der wichtigste Gott von allen. Er ist der Gott des Krieges und des Todes und Vater der Menschen und aller anderen Götter. Er trägt einen Helm und hat nur ein Auge, weil er sich das zweite selber ausgerissen und in einen magischen Brunnen geworfen hat. Warum, habe ich vergessen, aber ich traue mich nicht, den Mann danach zu fragen.
Ich drehe mich auf den Rücken, halte die Feder ins Licht und flüstere das Gedicht, das wir zusammen auswendig gelernt haben, der Mann und ich:
«Dem Gott des Nordens, Odin, stand
Ein Rabenpaar zur Seite,
Der Eine Hugin zubenannt,
Und Munin hieß der Zweite;
Es trug sie ihrer Flügel Schwung
Durch alle Zeit und Schranke. –
Munin war die Erinnerung,
Und Hugin der Gedanke.»
Odin lässt seine Raben jeden Tag fliegen, damit sie für ihn die Welt ausspähen, und jeden Abend kommen sie zurück, um ihm zu berichten. Aber Odin hat auch Angst. Davor nämlich, dass die Raben eines Tages nicht zurückkommen. Raben sind wilde Tiere. Wenn man ihnen die Federn stutzt, dann wachsen ihnen neue, noch größere. Sie lassen sich nicht bezwingen oder einsperren.
Die Feder tanzt zwischen meinen Fingern. Der Nebel vor dem Fenster leuchtet. Man kann in ihm verschwinden, so blendend hell ist er. Ich flüstere:
«Ob auch auf kurze Zeit gezähmt,
Sie waren nicht zu zwingen;
Ob auch ihr Flügelpaar gelähmt,
Es wuchsen neue Schwingen,
Und mit gewalt’gem Flügelschwung
Aus Odins Dienst und Schranke
Floh Munin, die Erinnerung,
Und Hugin, der Gedanke.»
Der Mann hat es mir erklärt, das Gedicht. Odin hat Angst um Hugin, weil er ihn mag. Aber vor allem fürchtet er um Munin. Der ist ihm der wichtigste. Wir sind nichts ohne unsere Erinnerungen.
Ich strecke die Feder aus, in Richtung der Milchsonne. Ich möchte ein Rabe sein, der durch das Fenster fliegt und durch den Nebel bricht, hoch in den Himmel. Ich möchte in dem leuchtenden Nebel verschwinden und nie zurückkommen. Ich möchte nicht mehr hier gefangen sein.
Die Leiter knatscht. Das sind die Stricke, die am Holz reiben. Ich zucke zusammen. So hört es sich an, wenn der Mann sich unten auf die erste Sprosse schwingt. Bis zu meinem Nest sind es zweiunddreißig Stufen die Strickleiter rauf. Ich zähle immer mit, obwohl die Anzahl sich nie ändert. Die Leiter kündigt den Mann an, zweiunddreißigmal, und mit ihm den Schmerz. Ich verstecke die Feder unter meiner Matratze, rolle mich auf dem Boden zusammen und wünschte, ich wäre tot. Ich hasse es, dieses Geräusch der Strickleiter. Wenn der Mann kommt, bedeutet das nie etwas Gutes für mich.
Nora
Das rote Holzhaus mit den weißen Fenstern. Der Wald. Die Wiese. Der kleine See, der in der Sonne leuchtet und über dem die Mücken schwirren. Sogar die vertäfelte Küche wirkt wie eine Bullerbü-Kulisse. Es gibt einen Ohrensessel, der aussieht wie der Sitzplatz eines Märchenonkels, und daneben ein beiges Schnurtelefon auf einem Telefontisch. Bauernmalerei ziert den Rundofen in der Ecke. Ich höre Fynn und Henrik draußen im Garten lachen, meine zwei Kinder, von denen ich eins geboren und das andere geheiratet habe, und staune über das Gefühl, das all dies in mir auslöst. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Ort, an dem ich noch nie war, nostalgisch stimmen könnte. Dass ich überhaupt anfällig sein könnte für diese Art von Kitsch und Wehmut.
«Bullerbysyndromet». So nennt man die überzogene Liebe der Deutschen zum idyllischen Heile-Welt-Schweden. Einem Schweden, das sich direkt aus Kindergeschichten speist. Das «Bullerbü-Syndrom». Ich habe im Internet darüber gelesen. In Schweden gibt es ganze wissenschaftliche Abhandlungen und Fernsehdiskussionen über dieses kuriose Verhalten der Deutschen, die Bullerbü auf Google Maps suchen, als könnten sie dort ihre Ferien verbringen. Die sich Urlaub an einem Ort wünschen, den es nicht gibt.
Ich habe diesen kindlichen Frieden lange nicht gespürt. Er ist mir irgendwann einfach verloren gegangen, zwischen Sorgen um die ständig wachsenden Ausgaben eines Drei-Personen-Haushalts, den Herausforderungen der Arbeit – und Menschen, die ich in mein Leben gelassen habe, ohne es besser zu wissen. Ich werfe einen nervösen Blick zum Fenster und binde mir dann verärgert die Haare zu einem Knoten auf. Ich bin nicht hierhergekommen, um mich wieder von der gleichen Angst lähmen zu lassen.
Schweden soll ein Rückzugsort für uns werden. Nicht nur für mich, auch für Henrik. Wir haben uns schon immer etwas Eigenes gewünscht, ein kleines Häuschen, das nur uns gehört. Bei den Wohnungspreisen in Greifswald wäre das mit unserem Gehalt niemals möglich gewesen. Und jetzt haben wir eins geschenkt bekommen.
Mit diesem Haus hat Henriks Opa sich vor der Rente einen Traum erfüllt. Die Gegend liegt ganz am Rande der letzten europäischen Wildnis, im Västernorrland. Nördlich von uns fängt bereits Lappland an, und an der Westseite liegt Jämtland mit dem Bergrücken, der Schweden von Norwegen trennt. Im Winter sollen Rentierherden hierherkommen, um nach Nahrung zu suchen. Die Wälder und Moore sind so groß und weitläufig, dass man stundenlang unterwegs sein kann, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen. Das ist es, was ich jetzt brauche: keine anderen Menschen außer Henrik und Fynn. Ich habe mich sogar von den sozialen Medien abgemeldet, um eine Zeit lang einfach mal unauffindbar zu sein.
Die Küste hier ist wild und zerklüftet. Die Flüsse kristallklar. Ich habe gelesen, dass sich im Hochsommer Elche in die hiesigen Wälder zurückziehen und in den Seen abkühlen. So ein Elch kann bis zu sechs Meter tief tauchen, um vor der Sommerhitze zu fliehen. Dazu hätte ich jetzt auch Lust. Es ist lange her, dass ich tauchen war. Als ich zu Beginn meiner Arbeit noch Offshore-Windkraftanlagen in 40 Metern Wassertiefe anschloss, habe ich nicht geahnt, dass ich eines Tages mal hauptsächlich vor dem Bildschirm sitzend enden würde. Aber seit der Geburt von Fynn hat sich einiges verändert. Vor der Schwangerschaft war ich oft freitauchen. Es ist faszinierend, was der Körper ohne Sauerstoffflasche schaffen kann, und wie leicht der Kopf wird, wenn man sich die absolut grundlegendste aller menschlichen Fähigkeiten verwehrt. Alles wird weich und leicht, wenn man nicht mehr atmet, man ist am Rande der Ohnmacht und gleichzeitig so sehr mit dem Wasser verbunden wie nirgends sonst. Ich vermisse diese Zeit.
Wieder blicke ich aus dem Fenster, hinter dem unser See liegt. Es ist wirklich unser See, denn er ist Teil des Grundstücks. Ich kann noch immer nicht verstehen, warum Henrik nicht viel früher von diesem Ort erzählt hat.
Mein Telefon vibriert, und ich zucke so heftig zusammen, dass mir fast der Besen aus der Hand fällt. Es ärgert mich selbst, aber ich kann nichts dagegen tun. Seit sich Eric Bleike in mein Leben gedrängt hat, braucht lediglich eine Nachricht einzugehen, und schon stehe ich stocksteif da und traue mich kaum, auf das Display zu sehen.
Ich stehe vor deinem Fenster, Liebling.
Schönes Höschen trägst du heute.
Pass gut auf Fynn auf. Ich hab ein ganz dummes Gefühl, dass ihm heute was zustoßen könnte.
Mit angehaltenem Atem tippe ich das Handy an.
Ist alles in Ordnung? Du hattest dich doch melden wollen, wenn ihr angekommen seid.
Ich atme erleichtert aus. Die Nachricht ist von meiner Mutter. Ich rufe sie an, und sie ist sofort am Telefon: «Na endlich, Nora! Ich dachte schon, euch wäre was zugestoßen!»
«Hallo, Mama. Was soll uns denn zugestoßen sein? Wir sind doch nur in Schweden!»
«Na, aber eine weite Fahrt ist das ja trotzdem. Wie lange wart ihr jetzt im Auto?»
«Rund achtzehn Stunden. Mit Zwischenübernachtung.»
«Und Fynn? Hat der das denn gut mitgemacht?»
«Ja, alles gut. Er und Henrik spielen gerade im Garten.»
«Ach, der kleine Fratz!» An ihrer Stimme kann ich hören, dass sie lächelt. «Das ist bestimmt was für ihn. Schweden soll ja ein richtiges Kinderparadies sein. Und du hast wirklich Glück, dass Henrik dir mit Fynn so gut hilft.»
«Ich soll froh sein, dass Henrik mir mit seinem eigenen Sohn hilft?»
«Ach, du weißt doch, was ich meine, Nora.»
Ich lasse das Thema fallen. Henrik hat nach unserem Kennenlernen nicht lange gebraucht, um meine Familie und den ganzen Freundeskreis um den Finger zu wickeln. Schon als er ihre Frage nach seinem Beruf beantwortet hat, haben sie mir hinter seinem Rücken anerkennende Blicke zugeworfen. Aus irgendwelchen Gründen gilt Henrik als Schriftsteller als mein bisher bester Fang, nicht mal übertroffen von dem Piloten, den ich ein paar Monate lang gedatet habe. Und dabei erfüllt Henrik keins der typischen Kriterien, die ein Berufsbild in der Regel so attraktiv machen. Er hat wenig Geld, trägt keine Uniform und rettet keine Leben. Wobei Henrik als leidenschaftlicher Schriftsteller mir in diesem Punkt wahrscheinlich widersprechen würde.
«Ist irgendwas los?», fragt meine Mutter.
«Nein, was soll los sein?»
«Du bist so schweigsam.»
«Ich bin nur am Putzen, Mama. Hier ist so viel zu tun.» Ich angele mit dem Besen nach den Spinnweben und stoße dabei so ungeschickt gegen die alte Hängelampe, dass sie gefährlich schwankt und ich den Kopf einziehe.
«Bei dir ist immer so viel zu tun, Nora», seufzt meine Mutter, während ich mit einer Hand einen Stuhl heranzerre. «Du bist wie dein Vater. Der kann die Hände auch nicht stillhalten. Den Auftrag in Island nimmst du jetzt aber nicht an, oder?»
«Ich habe nie einen Auftrag aus Island bekommen.» Was sie meint, ist das Angebot aus Norwegen, wo in den nächsten Jahren Offshore-Windkraftanlagen gebaut werden sollen, die rund dreißig Gigawatt Strom pro Jahr produzieren. Aber es ist besser, mich dreißig Sekunden dumm zu stellen und damit eine stundenlange Diskussion zu vermeiden.
«Du weißt, was ich meine», sagt meine Mutter wieder.
«Und wie geht es euch so?», frage ich. «Wie geht’s Papa?»
«Ich verstehe ja, dass dir die Welt am Herzen liegt, Nora», ignoriert sie meine Frage. «Aber man kann sich doch auch von Greifswald aus darum kümmern. Umweltschutz gibt es auch hier. Ich habe gestern beim Spazierengehen erst wieder so eine Gruppe junger Leute gesehen, die am Strand Müll gesammelt haben. Die tun ja auch ein gutes Werk.»
«Mhm», mache ich.
Meine Mutter gehört zu jenen Personen, die finden, ich täte mir einen Gefallen damit, mein brennendes Interesse für den Klimawandel jetzt auf mutterkompatible Art auszuleben. Dadurch zum Beispiel, dass ich meinem Sohn die Karottensticks in einer nachhaltigen Pausenbrotdose mitgebe oder dass ich ihm erkläre, wie die Mülltrennung funktioniert und warum er das Licht im Bad ausschalten soll, wenn er auf der Toilette war.
Der Stuhl wackelt, als ich daraufklettere.
«Hörst du mir überhaupt zu?», fragt meine Mutter.
«Ja, ich mache nur nebenbei ein paar Spinnweben weg.»
«Wirklich unglaublich, dass das Haus die ganze Zeit leer gestanden hat! Als ich Doris und Christine beim Kaffeetrinken am Sonntag von eurem unerwarteten Erbe erzählt habe, sind sie ganz neidisch geworden. Übernachtet ihr denn heute schon dort, oder geht ihr in ein Hotel?»
Ich erstarre auf meinem Stuhl, als der Satz zu mir durchsickert. Meine Mutter hat Doris und Christine von unserem Haus in Schweden erzählt. Und mal angenommen, die beiden haben es weitererzählt …
«Nora?»
«Nein, wir übernachten hier», sage ich mit trockenem Mund und muss mich kurz an der wackligen Stuhllehne festhalten, um nicht zu fallen. «Hast du Doris und Christine auch erzählt, wo genau unser Ferienhaus ist?»
«In Döljamåla, meinst du? Ich weiß nicht mehr genau. Warum fragst du?»
«Sag mir einfach, ob ihr darüber gesprochen habt.»
«Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ja … ach, jetzt, wo du fragst, natürlich! Christine hat den Ort auf ihrem Handy gesucht, weil sie wissen wollte, wie weit er von Bullerbü entfernt ist. Sag mal, wusstest du, dass es Bullerbü gar nicht gibt?»
Ich antworte nicht.
«Reine Erfindung!», fährt meine Mutter fort.
Ich strecke den Besen wieder zu den Spinnweben und schiele zum Fenster. Eine weitere schlechte Angewohnheit von mir, seit Bleike, die Hände in den Taschen, ein paarmal hinter der Scheibe gestanden und zu mir hereingeblickt hat.
«Du bist ja sehr gesprächig heute», beschwert sich meine Mutter.
«Ich balanciere gerade auf einem Stuhl, Mama. Können wir wann anders noch mal telefonieren? Morgen vielleicht, wenn wir hier aus dem Gröbsten raus sind?»
«Jaja, macht ihr erst mal. Aber gib Fynn einen Kuss von mir, wenn ich ihn schon nicht an den Hörer bekommen habe.»
«Mache ich.»
«Und schick doch später mal ein paar Urlaubsfotos!»
Über diese Bitte muss ich fast lachen, so wenig fühlt es sich im Moment noch nach Urlaub an.
«Mache ich», verspreche ich trotzdem, und als wir beide auflegen, hängt mein Blick noch immer am Fenster, vor dem die Wiese grün und friedlich daliegt. Ich klettere vom Stuhl, gehe hinüber und spähe vorsichtig durch das Glas, bevor ich es aufschiebe und mich hinauslehne. Die Luft ist warm. Im Garten ist es still bis auf das Zwitschern der Vögel. Ich atme durch. Ich bin in Schweden, und Bleike ist in Greifswald. Auch er kann Bullerbü nicht finden. Zeit zu lernen, sich wieder ohne Angst im Erdgeschoss aufzuhalten.
Ich will mich gerade umdrehen, als ich ein Knistern unter meinen Fingern bemerke. Erstaunt hebe ich die Hand von der Fensterbank. In meiner Handinnenfläche klebt ein kleines glänzendes Bonbonpapier, türkis mit neongelben Streifen. Ich pflücke es von der Haut und brauche einen Moment, um zu begreifen, was mir an diesem Papier komisch vorkommt: Die Folie ist zu neu und glänzend für diesen Ort. Irritiert blicke ich mich um. Zum ersten Mal kommt mir der Gedanke, dass das Haus die ganzen Jahre unverschlossen war.
Zögernd greife ich zum Besen und gehe zur Tür. Jetzt, da ich auf Zeichen achte, kann ich sie überall sehen: blank abgegriffene Schrankknäufe im Wohnzimmer und in der Küche, ausgesessene Stellen auf dem Sofa, platt gedrückte Kissen. Hier war jemand im Haus, bevor wir kamen. Und vielleicht ist er immer noch da. Mit dem Gefühl von Frieden ist es augenblicklich vorbei. Den Besenstiel vor der Brust, drehe ich mich um die eigene Achse. Das Haus bietet Schlupflöcher. Die Lücke hinter der alten Schrankvitrine. Die schweren, langen Gardinen. Die dunkle Ecke hinter der Treppe. Und die Schränke! Ich beuge mich vor, spähe in jeden Spalt, klopfe mit dem Besen gegen die Wohnzimmergardinen, und dabei spielt sich in meinem Kopf ein Film ab, den ich bereits kenne. Kann Bleike von unseren Schwedenplänen Wind bekommen haben? Weiß er von diesem Ort?
«Buh!»
Ich zucke mit einem Schrei zusammen und fahre herum. Henrik und Fynn haben sich angeschlichen. Fynn kriegt sich vor lauter Lachen gar nicht wieder ein.
«Du hast dich erschrocken, Mami!», gluckst er. Auch Henrik grinst. Erst als er bemerkt, dass ich den Besen vor der Brust halte wie einen Kampfstock, mit dem ich mich verteidigen muss, runzelt er irritiert die Stirn.
«Alles in Ordnung?»
«Klar», rufe ich, eine Spur zu fröhlich, und senke den Besen beschämt zu Boden. Ich scheine paranoid geworden zu sein. Bleikes Anrufe, seine Nachstellungen und Drohungen haben mich zu einer anderen Person gemacht. Ich war doch früher nicht so. Ich bin diejenige, die Ruhe bewahrt und weiß, was zu tun ist, wenn wir auf der Autobahn liegen bleiben. Ich bin diejenige mit dem Überblick über sämtliche Versicherungen und Notfallnummern. Sogar die verdammten Spinnen sauge ich aus den Wohnzimmerecken, wenn Henrik mich ruft. Ich will mich nicht durch einen einzigen idiotischen Typen so aus der Bahn werfen lassen.
Das Schlimmste ist, dass ich an alldem selber schuld bin. Ich habe Bleike Einblick in mein Innenleben und meine Familie gegeben, in viele kleine, eigentlich belanglose Dinge, die erst dann, wenn sie gegen einen verwendet werden, bedeutsam und intim werden. Als ich die Affäre beenden wollte und es plötzlich mit den WhatsApp-Nachrichten und den Anrufen losging. Irgendwann in der Zeit, in der wir miteinander ausgegangen sind, muss sein Interesse an mir in Obsession umgeschlagen sein. Wenn ich aus der Dusche kam, fand ich plötzlich Nachrichten auf meinem Handy, er fände meine nassen Haare und das kurze Handtuch sexy. Es waren keine dieser plumpen Anfeindungen, die mich sonst über die sozialen Medien erreichen und die sich vor allem um meine Geschlechtsorgane, meinen vermeintlichen Platz in der Gesellschaft und um meinen Hormonhaushalt drehen, der sowieso der Ursprung allen Übels scheint. Ich habe nie verstanden, was meine Periode mit Stahlbautechnik und der Berechnung von Strömungsgeschwindigkeiten zu tun haben soll, und ich kann solche Anfeindungen inzwischen halbwegs ignorieren. Aber Bleikes Nachrichten waren anders. Von Anfang an gingen sie mir unter die Haut.
In Greifswald wohnen wir in einem Altbau mit hohen Fenstern, und ich wusste, er musste irgendwo auf der Straße stehen und mich beobachten. Aber statt ihn bei der Polizei zu melden, zog ich nur gewaltsam die Vorhänge vor.
Ich dachte, nicht mehr auf ihn zu reagieren, wäre das Beste, was ich tun konnte, und er würde irgendwann von allein das Interesse verlieren. Was er zwischendurch auch tat.
«Was hast du da an der Wohnzimmergardine gemacht?»
«Was?»
«Du hast mit dem Stock gegen die Wohnzimmergardinen geklopft!»
«Ach, doch nur wegen des Staubs.»
Fynn sieht mich skeptisch an. Er spürt wohl, dass mit meiner Fröhlichkeit etwas nicht stimmt. Unser Sohn erfasst unsere Stimmungen immer sofort und saugt sie auf wie ein Schwamm. Man muss aufpassen, was man in seiner Gegenwart sagt.
«Also, wer kommt jetzt mit in den See?», rufe ich, um jedes Misstrauen zu zerstreuen. Ich ziehe mich noch im Wohnzimmer bis auf die Unterwäsche aus und laufe dann aus dem Haus und auf den brüchigen Steg, von dem aus ich in den glitzernden, kühlen See springe. Das Wasser umschließt mich so gutwillig, als rufe es: Na endlich, Nora, wo bist du denn geblieben? Ich tauche unter. Halte die Luft in den Lungen. Es ist herrlich. Es ist genau das, was ich gebraucht habe. Meine gereizten Nerven, die ganze Angst – das kam alles von der Hitze und dem Stress zweier langer Tage Autofahrt. Ich tauche auf und sehe, dass Fynn aus dem Haus gelaufen kommt. Sein Gesicht verrät Unglauben, als er mich planschen sieht. So eine Frau bin ich also geworden. Mein fünfjähriger Sohn traut mir nicht die Verrücktheit zu, in Unterwäsche in einen See zu springen. Für ihn bin ich nur die arbeitende, gestresste Mutter. Wann habe ich aufgehört, all die anderen Personen zu sein? Die Backpackerin? Die Freitaucherin? Diejenige, die alle Pläne an den Nagel hängt, um ein halbes Jahr mit einem Motorrad durch Eurasien zu fahren?
Henrik taucht nun ebenfalls auf der Veranda auf. Mit einem Schrei packt er den kreischenden Fynn, rennt mit ihm zum Steg und wirft ihn mit einem Übermut in den See, bei dem mir kurz das Herz stehen bleibt. Fynn schreit, als er im hohen Bogen ins Wasser fliegt. Er hat sogar seine Kleidung noch an. Ich schwimme hin, bin bei ihm, als sein Kopf prustend wieder an der Oberfläche auftaucht. Er hustet, Henrik hockt lachend auf dem Steg und spritzt noch ein bisschen Wasser nach.
«Alles gut, Fynn?», frage ich, und er nickt tapfer und paddelt mit seinen Armen und Beinen wie ein Hund, als ich ihm zum Steg zurückhelfe.
«Ich hab Hunger, Mami.»
«Wir haben unterwegs nichts gekauft, Schatz. Da müssen wir mal zum nächsten Supermarkt fahren.»
«Aber ich hab jetzt Hunger!»
«Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns eine Angel zu holen und einen großen, fetten Fisch zu fangen!» Henrik zieht Fynn an beiden Armen aus dem Wasser, als sei dieser selbst der große, tropfende Fisch, und lacht ihm ins Gesicht. Ich nehme Schwung und hieve mich neben sie auf den Steg.
«Wer fährt?», frage ich, während ich mir die Haare auswringe und in Gedanken nun doch wieder bei dem bin, was es noch zu tun gibt.
«Ich übernehme das», sagt Henrik. «Ich hab gehört, dass es hier riiiiesige Zimtschnecken in den Bäckereien gibt. Mit Zuckersirup und Hagelzucker drauf! So eine muss ich mir unbedingt kaufen!»
«Ich komme mit!», ruft Fynn und springt aufgeregt auf dem Steg herum, der das nur deshalb aushält, weil unser Sohn so ein Leichtgewicht ist.
Ich sehe den beiden nach, wie sie zum Auto gehen und in unserem Gepäck nach einem Handtuch und trockener Kleidung für Fynn suchen, und in diesem Moment fühlt sich alles richtig und gut an. Wir sind wieder eine Familie, und das war doch der Hauptgrund dafür, warum ich überhaupt herkommen wollte, oder etwa nicht? Ich wollte einen Neuanfang. Hier ist er: ein Haus, ein Steg, ein Garten, der bereits dem Urwald ähnelt, in dem er liegt, auf eine dunkle Art verheißungsvoll. Ich schaudere, ohne richtig zu wissen, warum. Dann streiche ich die nassen Haare zurück, stehe auf und gehe durch das kniehohe Gras zum Haus, um meine verstreuten Sachen einzusammeln.
Rosa
Ich habe schon immer gern mit Leichen rumgehangen. Vielleicht weil ich nie viele Freunde hatte. Lebende Freunde, meine ich. Ihre Interessen interessierten mich nicht. Ihre Spiele waren langweilig. Und wenn ich versehentlich doch mal auf einen Kindergeburtstag eingeladen wurde, dann gab ich vor, krank zu sein. Das stellte ich mir ohnehin oft vor, todkrank oder tot zu sein. Man kann es prima alleine spielen, einfach auf einer Wiese liegend oder halb unter Erde versteckt im Wald. Man braucht kein anderes Kind dafür, und es bringt den Tag herum. So etwas ist wichtig in Schweden, den Tag herumzubringen. Gerade im Sommer sind die Tage so lang, dass man kaum weiß, wie man es anstellen soll.
Ich habe noch den Dreck vom Waldboden unter den Fingernägeln, als ich die Hand an den Türknauf lege. Früher hat mein Bruder mir nie erlaubt, sein Zimmer zu betreten, und ich hätte auch jetzt gern darauf verzichtet. Ich nehme an, das hätten wir beide. Nur kann er seine Wünsche jetzt nicht mehr äußern.
Ich stoße die Tür auf. Im Zimmer stinkt es, das ist Ebbe, mein Bruder. Er hat den Geruch aus dem Krankenhaus mitgebracht, aus dem er vor einer Woche entlassen wurde. Ich gehe an dem Bett vorbei und öffne das Fenster. Dahinter liegt der würzige Duft des Waldes. Viel lieber würde ich jetzt dort draußen meine Forschungen weiterbetreiben.
Als ich mich umdrehe, sehe ich, dass Ebbes Blick meiner Bewegung zum Fenster gefolgt ist. Sein Atem geht schnaufend, und Adern durchziehen das Weiß seiner Augen wie rote Wurzeln. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich war noch nie gut darin, Menschen zu lesen.
Stumm nehme ich die Liste zur Hand und beginne mit den darauf vorgegebenen Tätigkeiten: Umlagerung. Wechsel des Urinbeutels. Kontrolle des Katheters. Hilfestellung bei der Nahrungsaufnahme. Darmmanagement.
Darmmanagement. Was für ein Wort. Wie eine eigene Berufsbezeichnung. Guten Tag, mein Name ist Rosa Lundqvist, ich habe ein abgeschlossenes Studium in forensischen Wissenschaften, aber jetzt bin ich die Darmmanagerin meines Bruders. Ich lasse das Blatt sinken und ziehe mir die Gummihandschuhe über.
Ebbe gefällt das ebenso wenig wie mir. Das kann sogar ich sehen. Unsere Mutter war früher im häuslichen Pflegedienst tätig, aber ich habe nicht ihr Talent im Umgang mit Menschen geerbt. Ihre liebenswerte, sanfte, tröstende Art. Ihr Helfersyndrom. Dass Ebbe ans Bett gefesselt ist und ausgerechnet ich seine Krankenschwester bin, ist ein doppelter Schicksalsschlag für ihn.
Die Ärzte sagen, Ebbe habe großes Glück gehabt. Weil er beim Freiklettern aus enormer Höhe abgestürzt ist und trotzdem überlebt hat. Weil er sich nur den fünften Halswirbel und ein paar weitere Wirbel weiter unten gebrochen hat und damit immer noch selbstständig atmen und schlucken kann. Ein Halswirbel weiter oben, und es wäre auch damit vorbei gewesen. Aber ich kenne meinen Bruder. Er wäre lieber tot als in diesem Zustand. Ausnahmsweise sind wir da wohl einer Meinung.
Anders als beim Leben weiß man beim Tod immer, woran man ist und was als Nächstes kommt: die Trübung der Hornhaut, das Austrocknen der Lippen, die Verflüssigung der inneren Organe. Dann blähen Bauch und Haut sich auf, und die