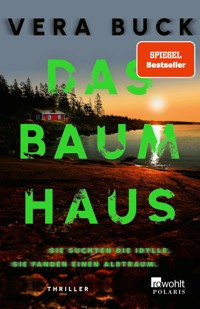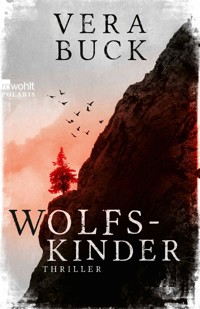
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein spannungsgeladener und atmosphärischer Thriller über menschliche Abgründe, ein abgelegenes Bergdorf und eine Gemeinschaft, aus der es kein Entkommen gibt. Die sechzehnjährige Rebekka verschwindet spurlos. Und sie ist nicht die Einzige. In der Bergregion werden immer wieder Frauen vermisst. Die Journalistin Smilla erkennt sofort Parallelen zum Fall ihrer Freundin Juli, die vor Jahren in der Gegend verschwand. Und als ihr ein verwahrlostes Mädchen vors Auto läuft, das eine verblüffende Ähnlichkeit zu Juli hat, reißen alte Wunden wieder auf. Einige Höhenmeter weiter lebt Jesse in der Siedlung Jakobsleiter, abgeschottet von der modernen Welt. Er und die anderen Bewohner des Bergdorfes werden unten in der Stadt misstrauisch beobachtet. Während das Misstrauen gegenüber der Jakobsleiter immer weiter wächst und in brutalen Angriffen auf Jesse und weitere Kinder eskaliert, kommt Smilla einem schockierenden Geheimnis auf die Spur, das alle vermeintlichen Wahrheiten aus den Angeln hebt. Wo lauert das Böse wirklich? «Ein unheimlich einnehmendes Thrillerdebüt, voller Düsternis und Licht gleichermaßen.» Romy Hausmann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Vera Buck
Wolfskinder
Thriller
Über dieses Buch
In Wahrheit ist ein Wald nicht still. Er ist voller Geräusche und aus dem Stoff, aus dem Albträume sind.
Hoch in den Bergen liegt die Siedlung Jakobsleiter, abgeschieden von der modernen Welt. Hier gelten die Regeln der Natur – rau, erbarmungslos, aber verlässlich. Das denkt zumindest Jesse. Ihm und den anderen Kindern von Jakobsleiter wurde eingetrichtert, dass alles Böse unten in der Stadt wohnt. Doch seine Freundin Rebekka glaubt nicht daran, sie will die Siedlung verlassen. Dann verschwindet Rebekka. Und sie ist nicht die Einzige. In der Bergregion werden immer wieder Frauen vermisst. Nur die Journalistin Smilla, die vor Jahren ihre Freundin Juli in der Gegend verloren hat, sieht einen Zusammenhang. Erst recht, als ihr ein verwahrlostes Mädchen vors Auto läuft, das verblüffende Ähnlichkeit mit Juli hat. Das Misstrauen gegenüber den Bewohnern von Jakobsleiter wächst, und nicht nur Jesse wird Opfer von brutalen Angriffen. Währenddessen gerät Smilla einem Geheimnis auf die Spur, das alle vermeintlichen Wahrheiten aus den Angeln hebt …
Vita
Vera Buck, 1986 in NRW geboren, studierte Journalistik, Europäische Literaturwissenschaft und Scriptwriting in Europa und den USA. Sie erhielt Stipendien und Auszeichnungen im In- und Ausland. Ihr erster Roman «Runa» war für den Friedrich-Glauser-Preis 2016 nominiert. Vera Buck lebt und arbeitet als freie Autorin in Zürich. «Wolfskinder» ist ihr Thriller-Debüt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01402-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Papa,
den pensionierten Kommissar
PROLOG
Die Wände schwarz. Der Boden schwarz. Es riecht nach Moder und Schimmel und nassem Stein. Mein Atem geht hektisch, stoßweise.
Finde den Ausgang.
Ich bin auf allen vieren, schon wieder. Ich habe Platzangst. Etwas kriecht mir über die Hand, und ich reiße sie so erschrocken hoch, dass sie gegen den Fels schlägt. Schmerz schießt in meine Finger, bis in die abgeschabten Fingernägel. Ich schüttele hektisch mein Handgelenk. Was auch immer es war, es ist weg, versuche ich mich zu beruhigen. Sicher nur ein Tausendfüßler. Eine Schabe. Ein Spinnenläufer. Es gibt hier nichts, was du nicht kennst.
Eine Lüge, die ich mir erzählen muss, um vor lauter Panik nicht vollends den Kopf zu verlieren. Die Wahrheit nämlich ist, dass ich hier gar nichts kenne. Die Höhle ist mir fremd. Dieses Labyrinth im Berg, aus dem es angeblich einen zweiten Ausgang geben soll.
Finde den Ausgang.
Ein einfacher Auftrag. Selbst Ratten finden den Weg aus einem Labyrinth. Aber hier gibt es nur Schwärze. Egal, in welche Richtung ich mich vortaste: Schwärze. Irgendwo tropft es.
Ein plötzlicher Ruck an meinen Beinen, meinen Fußgelenken. Zuerst ganz leicht.
Nicht jetzt schon, flehe ich in Gedanken.
Der zweite Ruck kommt so heftig, dass ich vor lauter Schreck vergesse zu schreien. Plötzlich fehlen die Knie unter meinem Körper, ich lande auf dem Bauch, werde nach hinten gerissen, als wäre da ein Sog, der mich rückwärts durch den Tunnel zieht. Diesen Tunnel, durch den ich gerade so mühsam gekrabbelt bin. Mit den Armen versuche ich meinen Kopf zu schützen. Zu schnell, denke ich, zu schnell, und schlage in der nächsten Sekunde schon mit dem Rumpf gegen eine Ecke, die ich in der Dunkelheit nicht kommen sah. Ich schreie nun doch, meine Füße werden um die Ecke herumgerissen, mein Körper knallt gegen die gegenüberliegende Wand, ich werde rückwärts durch den nächsten Tunnelgang geschleift. Ich schreie lauter, greife um mich, will mich irgendwo festhalten. Aber der Stein ist glatt und der Zug an meinen Füßen stark. Ich weiß, was dort draußen steht und an mir zerrt und dass ich ihm nichts entgegenzusetzen habe.
Meine Knie, mein Bauch, mein ganzer Körper brennt. Ich lege die Arme wieder schützend um den Kopf, lasse mich widerstandslos ziehen, wie eine Puppe.
Was für eine Ironie, dass ich dem Berg entkommen wollte.
Und jetzt stecke ich mittendrin.
SMILLA
Ich habe auch diesmal niemandem Bescheid gesagt. Das hier bleibt unser Geheimnis, Juli, wie damals. Nenn es leichtsinnig oder dumm. Aber ich versuche alles, um die gleichen Bedingungen zu schaffen. Als wären dieser Wald und der Felsen Teil eines wissenschaftlichen Experiments.
Ich habe einen Schlafsack dabei und eine Thermoskanne mit heißem Kakao, in den ich, ebenfalls wie damals, einen Schuss Amaretto gegeben habe. Wir haben in dieser Zeit in alles Amaretto gekippt, weißt du noch? Amaretto und Orangensaft, Amaretto und Kirschsaft, Amaretto mit heißer Schokolade. Nur einen Fingerhut voll, aber wir haben getan, als wären wir betrunken. Nein, nicht so getan. Wir haben es geglaubt. Wir haben so vieles geglaubt in jener Zeit, Juli. Wir haben geglaubt, dass nur die Sommerferien endlich sind und dass wir ewig leben. Wir haben geglaubt, dass wir gemeinsam studieren würden und irgendwann Zac Efron heiraten, auch beide natürlich, weil beste Freundinnen sich ja alles teilen. Wir haben geglaubt, dass es für immer so weitergehen würde, du und ich und «High School Musical», wovon damals gefühlt jedes Jahr ein neuer Teil rauskam. Nachdem du weg warst, Juli, hat auch das aufgehört. Wie alles andere.
Inzwischen wärst du, bist du, 26, so wie ich. Ich habe deinen Geburtstag gefeiert, Juli, jedes Jahr. Und dieses Jahr zu deinem zehnjährigen Verschwinden übernachte ich noch einmal am Faunfelsen. Darum bin ich hier. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass ich viel schlafen werde, aber das ist ja nichts Neues. Weißt du, dass ich das ohnehin nicht mehr kann, seelenruhig durchschlafen? Nicht seit jener Nacht, als ich seelenruhig neben dir geschlafen habe, tief und fest, während jemand dir die Hand über den Mund gelegt und dich fortgezogen haben muss.
Meine Eltern haben mich zu Entspannungspädagogen geschleppt, zu Psychotherapeuten und diversen Ärzten. Denn das ist die Reihenfolge: Erst versuchen sie, dir das Atmen beizubringen, dann den Satz: «Ich bin nicht schuld an der Entführung meiner Freundin» – und am Ende stehen die Medikamente. Ich habe das alles mitgemacht, für eine gewisse Zeit. Aber langfristig wirkt nichts davon. Langfristig gibt es nur die Nacht und dich und mich und irgendeinen Unbekannten, den ich in meiner Erinnerung zu erkennen versuche, während sein Gesicht sich immer weiter zurückzieht, undeutlich wird, als entferne der Mann sich in einem dichten Nebel. Manchmal, in diesem Zustand zwischen Schlaf und Wachsein, in diesem Zustand des Wahnsinns, scheint es mir das Wichtigste, dem Mann zu folgen, ihn an der Schulter zu packen und umzudrehen, damit ich endlich sein Gesicht sehen kann. Und hin und wieder gelingt mir das auch. Aber wenn ich dann wach werde, kann ich mich nicht erinnern, wie er ausgesehen hat. Und wie sollte ich auch?
Die Wissenschaft sagt, dass alle Gesichter, denen wir im Traum begegnen, Gesichter sind, die wir schon einmal im Wachzustand gesehen haben. Und ich habe deinen Entführer nie gesehen, Juli. Ich habe geschlafen, tief und fest – und vielleicht zum letzten Mal in meinem Leben traumlos.
Der Faunfelsen ist größer als in meiner Erinnerung. Dabei sind weder er noch ich seit jenem Tag gewachsen. Ich stehe da und blicke auf das Loch im Fels, wegen dem wir damals hier waren. Wegen dieses verdammten Lochs und dem Gerücht, das Sonnenlicht würde morgens die Form eines Teufels auf den Boden malen, wenn es hindurchfällt. Die Form eines Teufels, dass ich nicht lache! Das Felsloch ist oval, und ich verstehe nicht, wie wir damals glauben konnten, wir würden am Morgen irgendetwas anderes sehen als einen ovalen Sonnenfleck am Boden. Aber bei etwas so Abstraktem wie dem Teufel lässt sich formtechnisch wohl streiten, oder? Vom Teufel weiß niemand, wie er aussieht. Außer dir, Juli. Vielleicht war er wirklich da, als die Sonne aufging, und hat dich gefunden. Vielleicht hast du genau in seinem Fleck gelegen, und darum hat er dich mitgenommen – dich und nicht mich. Obwohl ich doch diejenige war, die diese beschissene Idee überhaupt hatte.
Weißt du, dass der Polizist, der mich später verhört hat, mich zuallererst darüber aufgeklärt hat, dass Wildcampen verboten sei? Als wäre das das Wichtigste. Als würde es noch irgendeinen Unterschied machen, dass ich unbefugt in einem Schlafsack auf öffentlichem Boden herumgelegen habe, wo mein Verbrechen doch ein viel größeres ist: Ich habe dir das Leben geklaut.
Meinetwegen hast du so vieles verpasst, Juli. Dein erstes Mal, deinen Schulabschluss, dein Studium. Du hast das Smartphone verpasst. Du hast WhatsApp verpasst und Tinder und Spotify und unzählige Partys, auf denen wir zusammen zu Hits getanzt hätten, die du nie hören wirst. Und wenn das alles im Einzelnen gesehen nicht unbedingt die Welt ausmacht, ist es insgesamt doch genau das: die Welt, in der du hättest leben sollen. Wegen mir hast du nur einen Bruchteil dessen kennengelernt, was es heißt, jung zu sein.
Ich rolle meinen Schlafsack an der Stelle aus, von der ich glaube, dass du dort gelegen hast, vielleicht einen Meter weiter rechts oder links. Wenn man Orte nur noch aus Albträumen kennt, verschieben sich die Dimensionen. Es gibt hier kein Kreuz, das die Stelle markiert, an der du das letzte Mal geatmet hast. Es gibt überhaupt nirgendwo ein Kreuz für dich, auch wenn deine Eltern darauf hoffen, dass es einmal so sein wird. Ein Kreuz in schwarzer Erde würde ihnen endlich Frieden bringen. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Mir würde es nur Frieden bringen, wenn sie endlich das Schwein schnappen, das dich aus meinem Leben gerissen hat. Oder noch besser: wenn ich dich wiederfinden könnte, Juli.
Ich setze mich auf den Schlafsack und warte. Worauf, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht darauf, dass der Faunfelsen sich als Teil eines Steinkreises entpuppt, in dem Menschen verschwinden und nach einer exakt berechneten Zeit wieder auftauchen, nämlich nach zehn Jahren, auf den Tag genau. Oder darauf, dass auch mich jemand holen kommt.
Vielleicht wünsche ich es mir ein bisschen, Juli. Dass jemand kommt und mich mitnimmt, wie er es schon damals hätte tun sollen, an deiner Stelle. Warum hat er dich mitgenommen und mich schlafen lassen?
Ich gieße mir Kakao aus der Thermoskanne ein und proste dir in der einbrechenden Dunkelheit zu, wie in einer verqueren Version von «Dinner for One». Selbst das Wetter macht bei der absurden Inszenierung mit. Über den Bergen braut sich ein Sommergewitter zusammen, aber hier ist der Himmel noch klar. In dem Dampf aus meiner Tasse liegt der Geruch nach Amaretto. Mir wird schlecht. Ich muss mich geradezu zwingen, daran zu nippen. Unfassbar, was die Erinnerung an einen Geruch in einem Menschen auslösen kann. Ich habe keinen Amaretto mehr angerührt, seit du weg bist, Juli.
Die Dunkelheit kommt heute nicht schrittweise, vielmehr scheint sie einen Satz zu machen. Mit einem Sprung stülpt sie sich über den Faunfelsen. Die Bäume, die die Lichtung umstehen, werden zu hohen schwarzen Wächtern. Um mich beginnt es zu zirpen, zu rufen und zu rascheln. Wenn die Leute von der «Stille des Waldes» reden, meinen sie den Teil, der von Spaziergängern an einem Sonntagnachmittag totgetreten ist. In Wahrheit ist ein Wald nicht still. Er ist voller Geräusche und aus dem Stoff, aus dem meine Albträume sind.
Mein Puls schlägt mir bis zum Hals. Mir ist völlig klar, dass ich heute Nacht kein Auge zutun werde. Als ganz in der Nähe ein Rabe schreit, springe ich erschrocken auf und verschütte dabei den Kakao auf meinen Pulli. Ich atme tief durch und setze mich zittrig wieder hin. Es fehlen noch die Gruselgeschichten, die wir uns erzählt haben, die werde ich nicht vergessen. Alles so wie damals, Juli. Dabei wissen du und ich längst, dass es nicht wirklich um ein Experiment geht, bei dem die exakten Bedingungen wiederholt werden müssen, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Es geht auch nicht wirklich darum, zu verstehen, was mit dir passiert ist, auch wenn ich das wohl bis zu meinem Lebensende nie aufgeben werde. Es geht um Selbstgeißelung.
Denn es war meine Idee. Ich habe dich zu dieser Sache überredet. Ich habe dich beruhigt, als du die dunklen Wolken in der Ferne gesehen und gemeint hast, hoffentlich würden sie nicht zu uns kommen. Weil das Schlimmste, was du dir in deiner jugendlichen Arglosigkeit vorstellen konntest, ein Schauer war, der auf uns niederging, während wir schliefen. Gott, waren wir naiv, Juli.
Ich hebe meinen Becher.
«Prost», sage ich zur Dunkelheit, zum Wald, zu allem, was darin lauert. Soll es ruhig kommen. Bist du bereit für die erste Gruselgeschichte, Juli?
EDITH
Die Gedärme sind über die gesamte Wiese verteilt. Überall liegen sie im nassen Gras, wie nicht aufgeräumtes Spielzeug sieht das aus. Selbst hinten am Wolfstann, wo es bereits dunkel ist, kann ich noch was von dem blutigen Zeug entdecken. Der Kopf ist vom Körper abgerissen und hängt an dem Strick, dessen Ende um einen Pflock gebunden ist. Es sieht ein bisschen komisch aus, mit dem Kopf und dem Strick. Es muss ja wirklich niemand Angst haben, dass der jetzt noch davonrollt.
Unser Priester ist da, wie immer, wenn etwas gestorben ist. Er stößt mit dem Schuh gegen den toten, aufgerissenen Körper. Die Fliegen brummen verärgert und stieben auseinander, aber nur kurz, dann setzen sie sich wieder auf das Fleisch, in die Augen und die zerfetzte Kehle. Fliegen sind stur. Sie hören nicht auf unseren Priester. Nicht mal auf meinen Papa. In der Hütte müssen wir immer alles gut mit Tüchern abdecken, weil sie überall dran wollen. Am liebsten sitzen sie auf Fleisch. Auf verrottenden Früchten. Und auf allem, was tot ist. Fliegen können mit den Füßen schmecken. Fliegen legen ihre Eier auf alles, und wenn man die Eier aus Versehen mitisst, hat man Schmerzen im Bauch. Die kommen von den Maden, die nämlich aus den Fliegeneiern schlüpfen. Wenn man so eine weiße, gesichtslose Made ansieht, dann kann man sich gar nicht richtig vorstellen, dass da mal eine schwarze Fliege draus entstehen soll. Aber genauso ist es. Ich habe das beobachtet.
Fliegen können außerdem nicht wirklich fressen, sondern nur trinken, darum machen sie überall ihre Spucke drauf, und die Spucke löst das Fleisch dann auf, sodass sie es durch ihre Rüssel saugen können. Ich weiß viel über Fliegen. Ich weiß überhaupt sehr viel, auch wenn immer alle denken: Die Edith, die spricht ja gar nicht, und zur Schule geht sie auch nicht, die ist bestimmt ein bisschen dumm im Kopf. Aber es ist genau andersrum. Ich spreche nicht, weil ich so einiges kapiere. Man muss nicht in die Schule gehen, um ein schlaues Köpfchen zu sein.
Unser Priester wendet sich um und sieht hoch zum Antennenmast. Dann spuckt er auf den Boden. Mitten zwischen seine Füße spuckt er, wo die tote Ziege liegt. Als wäre er selbst eine Fliege, die das Fleisch trinken will.
«Es ist die Antenne», sagt er. «Nur wegen der beschissenen Antenne kommen die Viecher so nah an Jakobsleiter. Ich sage, wir reißen das Ding ab, bevor noch mehr von deinen Ziegen dran glauben müssen.»
Jesses Vater sagt lange nichts, weil er auch nicht so gern spricht. Aber dann knurrt er doch etwas durch die Zähne: «Erst mal knall ich das Scheißvieh ab.»
«Den Wolf?», fragt unser Priester. «Aber der ist nur der Schwanz deines Problems! Kapierst du’s denn nicht, Gabriel? Bevor nicht die verdammte Antenne verschwunden ist, wird der nächste Wolf durchdrehen und danach wieder einer. Das Ding muss weg, bevor wir vor die Hunde gehen.»
Ich schaue die beiden an. Ich weiß, was es heißt, wenn einer sagt, dass man vor die Hunde geht. Früher, da haben die Menschen mit Hundemeuten gejagt, auch hier oben am Berg. Hunde können sehr schnell sein. Sie springen das Opfer an und zerfetzen es. Ich hätte auch gerne so einen Jagdhund, aber Papa hat sein Gewehr und seine guten Augen, und er sagt, dass uns das reicht. Und außerdem hat er ja mich. Ich helfe ihm bei der Jagd, darin bin ich sehr gut, denn ich kann mich so leise anschleichen wie sonst keiner. Richtig mucksmäuschenstill kann ich sein. Manchmal, da probiere ich unten in Almenen aus, wie lange ich hinter jemandem herschleichen kann, ohne dass die Person sich umdreht. Ich bin so nah hinter ihnen, dass ich sie antippen kann, und dann bleiben sie plötzlich stehen und fassen sich in den Nacken, aber bis sie sich umdrehen, habe ich mich schon längst hinter einer Hausecke versteckt. Almenen ist voller guter Verstecke, fast so wie der Wald.
Noch einmal spuckt unser Priester zwischen die Füße. Einen richtigen Schleimklumpen spuckt er, es macht ihm gar nichts, dass da noch ein Kopf liegt. Er sagt: «Das Biest wird uns noch alle zugrunde richten, Gabriel.»
SMILLA
Im Osten dämmert es. Es ist diese klamme Stunde zwischen Tag und Nacht, in der die Sonne sich anschleicht und der Himmel bereits ein wenig Farbe bekommt. Es ist kalt. Alles ist taunass, regennass, einschließlich mir. Am Ende ist der Gewitterschauer doch noch gekommen, ist einmal über die Lichtung gezogen, und ich bin einfach sitzen geblieben. Es ist ein Trugschluss, dass der Wald ein Schutzraum ist. Er war kein Schutzraum für dich, Juli.
Vielleicht bin ich hin und wieder eingenickt, auf meinem Schlafsack. Doch ich fühle mich wie sechsunddreißig Stunden wach. Der Kakao in der Thermoskanne ist noch warm. Ich gieße mir einen Becher ein, um mir meine kalten, zittrigen Finger zu wärmen. Mein Atem bildet feine Gespenster in der Luft, während die Sonne näher kriecht. Sie leckt bereits am Faunfelsen, als wäre sie selbst der Teufel mit der langen Zunge. Ich starre unbeirrt auf das Loch. Meine Augen sind schwer und müde. Ich fühle mich, als hätte ich die Nacht durchgetanzt und durchgetrunken, nur ohne die euphorischen Erinnerungen, die damit einhergehen. Als die Sonne durch das Loch im Felsen fällt, kneife ich die Augen zusammen, so hell blendet das Licht. Ich sitze am richtigen Ort. Genau im Teufelslicht. Ich blicke um mich, erfasse die Form, die sich bildet. Es ist alles andersherum, als sie es uns beigebracht haben, Juli. Der Teufel ist nicht Schatten, er ist Licht.
Und dann sehe ich ihn plötzlich.
Über dem blendenden Kreis aus Morgenlicht steht eine Gestalt auf dem Felsen und blickt ruhig auf mich herab. Den Becher Kakao noch in der Hand, erstarre ich zu absoluter Reglosigkeit. Natürlich weiß ich, dass in dieser Region Wölfe leben. Wer Vieh hat, der versucht sie abzuknallen, andere stellen Plakate auf, um sie zu schützen. Und wir, die Unbeteiligten, hören die Wölfe nachts manchmal heulen. Aber ich habe nie einen gesehen. Wir blicken uns an, er und ich. Das Blut pumpt bis unter meine Schädeldecke. Mein Körper ist bereit zur Flucht, die Angst zerrt an meinen Organen. Von dem wenigen, das ich über Wolfsangriffe gehört habe, weiß ich, dass der Mensch in den meisten Fällen der Unterlegene ist. Wir sind nur Herrscher über die Welt, solange wir uns in unseren selbst geschaffenen Sicherheitszonen bewegen. Die Natur aber, der Wald, die Berge sind wild.
In meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken, während der Wolf einfach weiter ruhig dasteht und mich anblickt, als wolle er mir etwas sagen. Aber was? Es kann doch kein Wolf sein, der dich von mir fortgezogen hat, oder, Juli? Man hätte dich irgendwo gefunden. Hätte Spuren gefunden. Es ist nicht wie im Märchen, in dem ein böser Wolf kommt, dessen Magen groß genug ist, um sieben Geißlein und noch eine ganze Großmutter zu verspeisen. Ein Wolf ist auch kein Teufel, der dich schultern und mit in seine Unterwelt nehmen kann. Oder doch? Ich blicke wieder um mich, auf die Form, die das Sonnenlicht bildet.
Mit einem Mal bin ich ganz ruhig. Ich breite die Arme aus. Eine einladende Geste.
«Bist du gekommen, um mich zu holen, Teufel?»
JESSE
Ich strecke mich neben Rebekka auf dem Moos aus und blicke in den Himmel. Wir haben unsere Jacken auf den Waldboden gelegt, denn das Moos ist noch nass vom nächtlichen Schauer. Es riecht so intensiv nach Wald, dass ich am liebsten meine Lungen mit dem Duft füllen und einen Vorrat für den Winter anlegen würde. Die Tannen zeichnen sich vor dem Blau ab wie ein Scherenschnitt. Freigeist schnüffelt an meinem Gesicht, und ich schiebe ihn beiseite, als er mir das Kinn leckt. Er legt sich ebenfalls ins Gras, direkt neben mich, rollt sich auf die Seite. Wenn ich den Kopf abknicke, kann ich seinen warmen Bauch als Kissen benutzen.
Unsere Sommer hier oben in Jakobsleiter sind kurz, und dieser ist fast vorbei. Nicht einmal fünf Monate lang ist der Wald schneefrei, darum sind Tage wie diese selten. Wir sollten das genießen. Aber Rebekka ist mit ihren Gedanken woanders. Ist in der Stadt, wo sie nie wirklich gewesen ist, aber von wo der Kerl kommt, der ihr den verhängnisvollen Zettel zugesteckt hat. Sie hat ihn dabei, diesen Zettel. Ich sehe, wie sie ihn in der hohlen Hand versteckt. Er ist bereits ganz klein gedrückt und verschwitzt, hoffentlich so sehr, dass man die Schrift darauf nicht mehr lesen kann.
Ich habe die Blicke gesehen, die Rebekka und der Antennenkerl sich vor ein paar Tagen zugeworfen haben. Der Mann war etwas älter als wir und nicht mal attraktiv. Aber hier oben fehlt ihm die Konkurrenz und Rebekka der Vergleich. Er hatte auch einen Kollegen dabei, Mitte vierzig, schätze ich, mit Bart und Bauch und großen Schweißflecken unter den Armen, die schon da waren, bevor er überhaupt mit der Arbeit begonnen hat. Sie sind auf den Turm gekraxelt und haben etwas von «Smart Farming» und «Precision Farming» erzählt. Aber als wir alle mit unseren Gerätschaften Aufstellung nahmen, mit Spaten und Harken und Spitzhacken, Geräten, die weit entfernt von jeder Digitalisierung sind, da haben sie doch recht schnell das Maul gehalten. Wir haben uns um den Antennenmast versammelt wie ein Lynchtrupp, während die Männer oben stumm und nervös ihre Arbeit verrichteten. Eine Arbeit, um die sie niemand von uns gebeten hat. Selbst die Antenne hat sich gesträubt, weil sie nicht bei uns bleiben wollte, und es hat lange gedauert, bis die Männer sie endlich bezwungen und an dem Mast festgeschraubt hatten.
Bisher war die Kapelle von Jakobsleiter der höchste Punkt weit und breit. Jetzt ist es die Antenne. Über ihr gibt es nur noch die Berge, massive Dreitausender, die immer schneebedeckt sind. Darum haben sie den Antennenmast hierhingestellt. Er wird in einem Umkreis von fünfzehn Kilometern alles mit Internet versorgen, hat Frau Bender in der Schule unten im Dorf gesagt und sehr froh darüber ausgesehen, denn Almenen liegt auch im Umkreis dieser fünfzehn Kilometer. Weil ich Frau Bender mag, hatte ich der Antenne eine kleine, eine winzige Chance eingeräumt, doch nicht so schlecht zu sein, wie unser Priester es uns allen prophezeit. Doch das war, bevor der Kerl, der sie brachte, Rebekka den Kopf verdreht hat.
Die Installateure waren hungrig und durstig, als sie nach ihrer stundenlangen Arbeit endlich von dem Mast heruntergeklettert kamen. Aber keiner von uns hat sie auf ein Mittagessen eingeladen oder auch nur auf einen Schnaps, wie man ihn hier nach getaner Arbeit sonst kippt. Diese Männer waren nicht von hier. Sie waren von «dort», waren Stadtmenschen und damit alles, vor dem man uns immer gewarnt hat. Und trotzdem hat Rebekka diesen Zettel angenommen und nervös in ihre Rocktasche gesteckt, als sie glaubte, keiner würde es sehen. Als alle anderen damit beschäftigt waren, die neue Antenne anzustarren wie einen Fremdkörper. Und genau das ist sie auch: ein Kommunikationsmast – ausgerechnet in einem Ort, in dem das höchste Gut das Schweigen ist.
Ich blicke Rebekka von der Seite an. Müsste ich wetten, würde ich sagen, dass eine Telefonnummer auf dem Zettel steht. Er ist also eigentlich völlig wertlos, weil es in Jakobsleiter ja nicht mal ein Telefon gibt. Aber Rebekka dreht den Zettel zwischen den Fingern, als wäre er ihr Ticket in ein anderes Leben. Sie will weg, das will sie schon lange. Aber jetzt, wo sie eine Adresse oder eine Telefonnummer hat, irgendetwas, das Freiheit und Abenteuer verspricht, weiß sie auch, wie sie es anstellen kann. Warum muss sie bloß immer gegen alles rebellieren?
Freigeists Flanke bewegt sich unter mir, als er den Kopf hebt. Irgendetwas hat er gehört oder gewittert. Bestimmt nur ein Kaninchen, denke ich, lege ihm beruhigend die Hand auf die Schnauze und mache: «Schhhscht.» Er bleibt noch zwei Sekunden angespannt, dann legt er den Kopf zurück auf die Pfoten. Ich atme durch. Ich wünschte, ich könnte ihm das Jagen abgewöhnen.
Vor acht Monaten hat mein Vater die Wölfin erschossen, die Freigeist geboren hat. Sie ist zu nah an die Siedlung gekommen, ist unseren Ziegen zu nahe gekommen, und darum sind wir eines Nachts losgezogen, auf Wolfsjagd. Mein Vater drückte mir das Gewehr in die Hand, als könnte ich damit etwas ausrichten. Als hätte ich jemals etwas anderes geschossen als ein paar Konservendosen vor unserem Haus. Und natürlich war am Ende er es, der den Abzug drücken musste. Im Gegensatz zu mir trifft mein Vater immer. Im Gegensatz zu mir hasst er die Wölfe. Ich kann ihn verstehen, wir leben von den Ziegen. Aber wir leben auch mit den Wölfen. Teilen kann ich seinen Hass darum nicht. Nach dem Schuss hat das sterbende Tier vor uns gelegen und in den Waldboden geblutet. In der Dunkelheit hat das Blut schwarz ausgesehen, ein schwarzes Loch, das sich unter ihm ausbreitete. An den prallen Zitzen habe ich erkannt, dass es eine Wölfin war und dass es irgendwo noch Wolfsjunge geben musste. Zwei Tage später habe ich sie in einer Erdhöhle gefunden. Nur eines von ihnen hat überlebt.
Freigeist.
Den Namen hat Rebekka sich ausgedacht. Freigeist, weil dieser Wolf nirgends hingehören soll, so meinte sie, nicht zu den Berggeistern und nicht zu den Talgeistern. Weil dieser Wolf Rebekkas Meinung nach ein Grenzgänger ist. Aber ich habe in ihren Augen gesehen, dass sie im Grunde selbst dieser Freigeist sein will.
Ich ziehe das Lederband aus der Tasche, das ich in der Nacht zuvor geknüpft habe.
«Ich habe etwas für dich gemacht», sage ich und halte es hoch. Ich hoffe, dass Rebekka den kleinen geschnitzten Anhänger daran erkennt. Aber sie ist abwesend, als sie sich bedankt. Und als ich ihr das Armband ums Handgelenk knote, legt sie nicht einmal den Zettel beiseite. Mit der freien Hand fährt sie durch Freigeists Fell, ihre Finger sind direkt neben meinem Gesicht, ihre dunklen Haare fallen nach vorn, und ich nehme den Geruch nach Seife wahr, der von ihnen ausgeht. Wir riechen hier oben alle nach der gleichen Kernseife. Eine, die in den Boden sickern kann, ohne ihn zu vergiften. In der Stadt nennt man so etwas biologisch abbaubar. Aber bei uns ist alles biologisch abbaubar, und ich weiß nicht, warum man sich mit etwas anderem waschen sollte. Mit etwas, das giftig ist.
«Es soll ein Wolf sein», sage ich, und an ihrem verwirrten Blick erkenne ich, dass sie einen Moment lang nicht einmal weiß, wovon ich spreche. «Der Anhänger. Das soll ein Wolf sein.»
Sie nickt. «Freigeist», sagt sie und dann, ohne erkennbaren Zusammenhang: «Ich glaube übrigens nicht mehr an Talgeister.»
Es klingt ein wenig trotzig und so, als verkündige sie etwas, das sie lange Zeit im Kopf gewälzt hat. Dabei ist mir die Information gar nicht neu. Spätestens seit wir zur Schule gehen, wissen wir beide, dass die Sache mit den Talgeistern ja eigentlich nichts weiter sein kann als eine Geschichte, die die Erwachsenen sich ausgedacht haben, damit wir uns nicht zu weit von der Siedlung entfernen. Aber das ändert nichts daran, was im Tal, in der Stadt, mit meiner Mutter geschehen ist. Irgendjemand muss ihr das zugefügt haben, und wenn es nicht die Talgeister waren, dann waren es die Städter. Tagelang haben wir sie in den Wäldern gesucht, als sie eines Abends nicht nach Hause kam. Und als mein Vater sie endlich fand und zurückbrachte, war etwas mit ihrem Kopf passiert, das sie für immer verändert hat. Ihr Lachen, ihre glasklare Stimme, ihr ganzes Wesen – alles ausgelöscht. Seitdem müssen mein Vater und ich uns um sie kümmern, wie um ein kleines Kind. Mama kann nicht mehr alleine auf die Toilette gehen. Sie kann nicht mehr sprechen. Manchmal weiß ich nicht mal, ob sie mich noch erkennt.
Rebekka weiß das, so wie wir alle es wissen. Meine Mutter musste jahrelang als Beweis dafür herhalten, dass die Geschichte über Talgeister stimmt. «Das waren die Talgeister!» war das Erste, was mein Vater damals gesagt hat, nachdem er meine Mutter zurückgebracht hatte. Und er hat es häufig wiederholt, bis ich älter wurde und sich die Geschichte ein wenig veränderte, so als würde sie zusammen mit mir wachsen. Die brutale Geschichte, wie man meiner Mutter den Schädel eingeschlagen hatte, wurde detaillierter, wie eine Gestalt im Nebel, die man von Weitem nur verschwommen sieht und die erst beim Näherkommen deutlich aus ihrer Umgebung hervortritt.
Mag ja sein, dass es keine Talgeister gibt. Mag sein, dass es nur Menschen gibt, gute und schlechte. Aber man muss nur meine Mutter ansehen, um zu wissen, wer auf welcher Seite lebt.
Rebekka streicht sich eine Strähne hinters Ohr und sieht mich endlich an. In ihren Augen spiegeln sich der Wald und der Berg, aber auch noch etwas anderes, das ich nicht greifen kann. In meinen Augen liegen schon immer nur der Berg und der Wald. Sonst nichts.
«Wir brauchen die Welt dort draußen nicht», sage ich. Ich sage es fest und bestimmt und merke selbst, dass ich dabei klinge wie mein Vater.
ISAIAH
Unser Jesse ist mit Rebekka im Wald verschwunden. Ich kann mir schon vorstellen, was er da mit ihr anstellt. Dieses Ferkel. Da kann er noch so unschuldig tun. Er ist jetzt siebzehn, und es gibt keinen in unserer Siedlung, dem nicht aufgefallen ist, wie Rebekka herangereift ist.
Wir haben drei Frauen in Jakobsleiter, von denen zwei durch jedes Raster fallen: Die eine ist ständig betrunken und die andere bescheuert im Kopf. Und dann ist da Rebekka, sechzehn Jahre jung und jetzt drall und weich. Ich schaue zum Wald und kratze mir durch mein Priestergewand den Sack. Es ist ja eh nicht normal, wie wir hier oben leben, fast nur unter Männern.
Ich stelle mir vor, wie sie es da im Wald treiben. Hinter einem umgefallenen Baum versteckt. Oder an den rauen Stamm einer Tanne gepresst. Bevor ich die Hand unter mein Gewand schieben kann, weht ein Windstoß den Gestank des Plumpsklos neben der Kapelle herüber. Das verdirbt mir jegliche Lust. Irgendwer hat wohl seinen Dienst verpennt und das Klo nach der letzten Messe nicht geleert. Ich werde in meiner Dienstliste nachsehen müssen, wer. Alles totale Trottel hier oben. Diese Siedlung ist ein dermaßen beschissener Ort, dass ich mich manchmal frage, warum ich mich überhaupt mit dem Pack abgebe. Ich mache kehrt und will zu meiner Hütte gehen, stoße dabei aber mit Abel zusammen, der plötzlich hinter mir steht. Wenn man vom Teufel spricht.
Abel hat etwas Zähes, Tropfendes in der ausgestreckten Hand, das ihm durch die Finger rinnt wie Wichse.
«Isaiah», sagt er. Ich verziehe das Gesicht, muss mich aber wohl oder übel mit ihm abgeben. Jetzt sehe ich, dass es zerbrochene Eier sind, die er mir entgegenstreckt.
«Kein einziges Küken», sagt er in seiner dümmlichen, kindlichen Art. Abel ist Anfang dreißig, aber er ist einer von denen, die wohl nie richtig erwachsen werden. Die eigentlich noch die Mama bräuchten, um ihnen den Arsch abzuwischen und sie daran zu erinnern, ihren Hosenstall zuzumachen. Ich habe keine Ahnung, warum er überhaupt hier auf dem Berg ist, und es hat mich auch nie genug interessiert, um ihn danach zu fragen.
Ich fasse sein Handgelenk ein wenig fester als notwendig und sehe mir die zerbrochenen Eier an. Sie sind tatsächlich leer und tot. Nichts als Eiklar.
Es wundert mich nicht, dass Abel damit zu mir kommt, denn so habe ich meine Schäfchen erzogen. Sie holen und fragen mich bei allem, ohne mich geht in diesem gottverlassenen Ort nichts mehr. Ich habe Führungsqualitäten, hatte ich schon immer. Ein guter Anführer zu sein, ist eine Gabe. Man muss Stärke ausstrahlen, manipulieren können und Angst verbreiten. Wenn du Angst verbreitest und gleichzeitig ein Fels bist, werden sich alle an dich klammern, sobald der Boden ihnen unter den Füßen wegrutscht. Bei Abel ist das besonders leicht, denn er ist weich und anhänglich. Er hat nur darauf gewartet, dass einer wie ich kommt, um ihm den Weg zu weisen.
Ich zeige hoch zur Antenne.
«Strahlen», sage ich. «Man muss das Ding abreißen.» Ich sage nicht: «Du sollst» oder «Du solltest», denn das würde klingen wie ein Gebot, und auf so etwas scheißen die Männer. Verbote, Gesetze – so was gibt es in Jakobsleiter nicht, darum leben wir ja hier. Ich habe auch in den Messen längst aufgehört, von den Zehn Geboten zu sprechen, und predige stattdessen Seelenheil und Höllenqualen. Das ist wenigstens eine Sprache, die das Pack versteht.
Abel, der Schwachkopf, blickt mich stumm und fragend an.
«Es ist die Antenne», setze ich nach, um ganz klarzumachen, was ich meine, und um auch bei ihm einen Samen zu säen, der bis zur nächsten Sonntagspredigt keimen kann und dann nur noch gegossen werden muss. «Die Strahlen machen deine Hennen unfruchtbar. Sie werden uns noch alle unfruchtbar machen, wenn wir nichts dagegen tun, Abel, warte es nur ab.»
Und dann lasse ich ihn und seine Eier stehen, weil die mein geringstes Problem sind. Abels Eier und Gabriels Ziegen, drauf geschissen, aber das kapieren sie natürlich nicht. Der wahre Feind sind nicht die Wölfe oder die Strahlen dieser Antenne. Es ist das, wofür die Antenne steht, die Gegenwart, die damit bei uns Einzug hält. Wir brauchen hier kein Internet. Und wir brauchen keine Installateure, die kommen, um das Ding zu reparieren und instand zu halten.
Nur wer in der Vergangenheit lebt, ist für die moderne Welt unsichtbar.
EDITH
Ich stecke das Blatt und den Bleistift hinten in meinen Hosenbund, bevor ich auf alle viere gehe und durch die Höhle krieche. Es ist eigentlich keine richtige Höhle, sondern ein Tunnel. Aber das kann man vorn am Eingang nicht sehen, weil er so lang und verworren ist, und ich glaube, außer mir weiß es auch keiner. Ich selbst habe den Ausgang auf der anderen Seite nur durch Zufall entdeckt, als ich mich beim Spielen in der Höhle einmal so verirrt habe, dass ich schon dachte, ich würde nie mehr nach draußen finden. Und dabei bin ich doch so schlau. Aber an dem Tag war ich gar nicht schlau, weil ich nämlich in die Höhle gekrochen bin, als es draußen schon langsam dunkel wurde. Wenn eine Höhle ein Labyrinth ist, darf man immer nur im Hellen hineinkriechen, weil die unterschiedlichen Schwarztöne im Inneren einem dann nämlich zeigen können, wo es langgeht. Wenn man ganz tief in der Höhle ist, ist es so schwarz, dass man gar nichts mehr sehen kann, nicht mal sich selbst. Die Höhle verschluckt in der Mitte die ganze Welt, und man kommt nur durch Tasten voran. Aber an den Rändern wird die Dunkelheit verschwommener, und man kann die Form der Hände auf dem Boden erkennen. Und auch das leise Pfeifen kann man hören, das der Wind macht. Es klingt, als würde jemand gespitzte Lippen an eine Wasserflasche legen und sanft pusten, nur viel leiser. Und je näher man dem Ausgang kommt, desto mehr wird das Pfeifen zu einem langen Heulen, und man kann den Luftzug spüren. Der Wind war es auch, der mir an dem Tag aus der Höhle herausgeholfen hat, auf der anderen Seite. Erst dachte ich, ich wäre wieder da, wo ich hineingekrabbelt war. Aber als ich aufgestanden bin und mich im Mondlicht orientieren wollte, hat gar nichts mehr zusammengepasst. Es ist, wie wenn man nachts verkehrt herum im Bett aufwacht und beim Aufstehen in die falsche Richtung laufen will. Erst als die Wolken sich verzogen haben, konnte ich etwas sehen: Ich stand in einer Klamm, die sich wie ein Riss durch den Bauch des Berges zieht. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass die Höhle keine Höhle, sondern ein Tunnel ist. Der Wind ist mein Freund, und die Klamm ist jetzt mein Geheimversteck. Im Frühjahr kann man sie nicht begehen, weil dann das Gletscherwasser der Oberen Schwärze hier durchrauscht, aber jetzt ist sie fast ganz trocken. Es war ja auch ein heißer Sommer.
Ich krieche aus dem Loch und springe über die Steine bis zu der Stelle, an der ich die neue Blume entdeckt habe. Niemand außer mir hat diese seltene Blume je gesehen, das weiß ich so genau, weil sie nicht in dem dicken Pflanzenbuch steht, das Jesse mir aus der Schule mitgebracht hat. Ich mag das Pflanzenbuch. Ich habe es versteckt, als Jesse es wieder mitnehmen wollte. Er musste es eigentlich zurückgeben, aber ich glaube nicht, dass sie es in der Schule brauchen, sie haben so viele Bücher dort, dass eins mehr oder weniger gar nicht auffällt. Jesse hat mir gedroht, dass er mir keine Bücher mehr mitbringen kann, wenn ich ihm dieses eine nicht wiedergebe. Aber das ist mir egal. Ich will gar keine anderen Bücher, wenn ich das Blumenbuch behalten kann. Ich brauche kein Buch über das Meer oder über Schiffe oder über afrikanische Tiere. So etwas gibt es bei uns ja sowieso nicht.
Wenn eine Pflanze und Blume nicht in dem dicken Buch steht, dann heißt das, dass sie außer mir noch keiner gesehen hat. Und immer der, der etwas neu entdeckt, darf ihm einen Namen geben. Darum haben ganz viele Blumen hier in meiner Klamm Namen, die nur ich kenne. Das ist das Besondere an meiner Klamm, dass der liebe Herrgott hier Pflanzen erschafft, die es vorher noch nicht gegeben hat. Weil der Riss im Berg seine Werkstatt ist.
Ich hocke mich hin. Ich will die Blume abmalen und benennen und das Bild Jesse schenken. Er hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. In Jakobsleiter gibt es keine Feiern wie unten in Almenen, wo die Menschen sich manchmal auf dem Dorfplatz treffen, Musik machen und tanzen. Feiern und Musik machen Lärm, sie machen, dass die Leute sich anschreien und lauter lachen, und das passt ja nicht dazu, dass man immer still sein soll. Ich kann das am besten von allen, das Stillsein, nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit den Füßen. Man muss bei uns immer schön still sein, wenn man überleben will. Das haben die Frauen und Mädchen in meinem Geheimversteck nicht verstanden.
Als ich in den Wald geschlichen und auf den Baum geklettert bin, hat nur Freigeist mich gehört, und das ist ja kein Wunder. Ein Wolf kann doppelt so gut hören wie ein Mensch und bis zu zwei Kilometer weit wittern.
Wenn ich das Bild für Jesse male und es ihm schenke, macht er mir vielleicht auch so ein Armband, wie er es für Rebekka gemacht hat. Ich habe die beiden im Wald belauscht und gesehen, wie er es ihr geschenkt hat. Ich hätte auch gern so einen kleinen geschnitzten Wolf, aber Rebekka hat sich über ihren gar nicht richtig gefreut. Darum finde ich nicht, dass sie ihn verdient hat.
Ich ziehe meine Malsachen aus dem Hosenbund und konzentriere mich auf meine Aufgabe. Man muss sich beim Malen immer gut konzentrieren, sonst verpasst man eine der Blüten oder Blätter, und dann ist die Zeichnung am Ende falsch. Ich male auch die Härchen, die auf den Blättern wachsen, und dann ziehe ich die Blume vorsichtig aus dem verwesten Körper heraus, um auch die Wurzeln abzumalen. Die Körper sind der Grund, warum der liebe Herrgott diese Klamm zu seinem Laboratorium gemacht hat. Das habe ich längst erkannt. Er kann die Blumen hier so zahlreich und so besonders wachsen lassen, weil es so viel Totes gibt. Totes ist wichtig für die Natur.
Auf Totholz zum Beispiel wachsen Pilze, Moose, Farne und Käfer. Dreißig Kilo Kadaver sorgen für hundert Jahre Dünger. Das hat mein Papa gesagt, um mir zu erklären, warum wir alles, was wir nach der Jagd von den Kadavern nicht brauchen können, zurück in die Wälder bringen und dort verscharren. Unser Wald ist so gesund, dass er nur vier Tage braucht, bevor die Aasfresser das Aas bis auf die Knochen verspeist haben.
Als ich mit Malen fertig bin, lege ich den Stift an meine Lippen, wie man es macht, wenn jemand still sein soll. Aber ich mache das, um zu überlegen. Ich muss mir einen guten Namen ausdenken, und ohne es zu merken, fange ich an, beim Denken auf der Rückseite des Stifts herumzukauen. Jesse mag es nicht, wenn ich das tue. Wenn er mir zum Beispiel erklärt, was Halluzinationen sind, und ich dann auf dem Stift herumkaue, statt zu antworten, nimmt er mir den Stift aus dem Mund. Aber Jesse ist nicht hier, und wenn ich kaue, kann ich besser denken. Ich streiche das Papier auf dem Stein noch einmal glatt und schreibe dann in meiner schönsten Schrift den Namen der neu entdeckten Blume: «Gelbes Rippenkraut», schreibe ich. Nach ihrer Farbe und nach dem Ort, an dem ich sie gefunden habe.
JESSE
Der Weg von Jakobsleiter zur Schule dauert etwa eine Stunde, 750 Höhenmeter den Berg hinab. Es ist mehr ein Pfad als ein Weg, ausgetreten nur durch unsere eigenen Schuhe und kaum sichtbar in den dichten Laub- und Tannenwäldern, durch die er führt. Unsere Siedlung hat trotzdem Vorsichtsmaßnahmen getroffen und Schilder aufgestellt, die jeden Wanderer abschrecken sollen, der sich doch mal in diesen Winkel des Berges verirrt. «Vorsicht: Steinschlag. Lebensgefahr», steht zum Beispiel an der Stelle, wo der Pfad an einer gerölligen Felswand entlangführt. Und etwas weiter unten, bei der Schwarzalm: «Warnung. Frei laufender Stier». In Wahrheit gibt es hier nicht einmal mehr Kühe, seit der alte Janosch verstorben ist. Die Ställe und das Wohnhaus der Schwarzalm sind nur noch eine vom Feuer zerfressene Ruine. Vor einigen Jahren haben Rebekka, Edith und ich noch zwischen den verkohlten Balken Verstecken gespielt. Aber das war, bevor Rebekka angefangen hat, sich mehr wie die anderen Mädchen in der Schule und weniger wie sie selbst zu verhalten.
Nur zwei Schilder stehen zu Recht hier: Eins warnt vor Lawinen, auf dem anderen steht: «Achtung, Wölfe». Unser Wald heißt Wolfstann, weil die Wölfe hier, anders als in anderen Regionen, nie ausgestorben sind. Genauso wenig wie wir.
Vielleicht fühle ich mich den Wölfen deshalb so verbunden. Auch sie haben sich versteckt und sind sie selbst geblieben, während alle anderen sich haben fangen und domestizieren lassen. Wir sind die letzte überlebende Kommune von Alttäufern, die es in Europa noch gibt. Unsere Vorfahren haben Verfolgungen, Zwangskonvertierungen, Plünderungen und Deportationen überlebt. Sie haben überlebt, indem sie sich versteckten – zunächst in verborgenen Höhlen in den Bergen und später in Jakobsleiter, unserer Siedlung. Im Laufe der Generationen mag uns ein wenig von der Religion abhandengekommen sein, aber diese Geschichte von Verfolgung und Ausgrenzung verbindet uns. Im Vergleich zu unseren Vorfahren haben wir, die Übriggebliebenen, ein gutes Leben. Nur Rebekka sieht das nicht.
Wir erreichen den Waldrand. Zu unseren Füßen liegt Almenen, ein kleiner Ort inmitten dunkler Wiesen und bewirtschafteter Felder. Die gedrungenen Häuser scharen sich um den Ortskern wie durstiges Vieh um eine Tränke. Als versuchten alle, möglichst nah dran zu sein an der Post, dem Rathaus, der Apotheke, dem Lebensmittelladen und einer Kirche, die nicht unsere ist. Es gibt von allem nur eins in Almenen, weil eins von allem reicht. Auch daran würde ich Rebekka gerne erinnern. Uns hat doch immer alles gereicht, bevor sie angefangen hat, sich nach Orten zu sehnen, die sie nicht einmal kennt. Die jenseits des dunklen, schmalen Tals liegen.
Ich wende mich um und hebe die Hand, um mich von Edith zu verabschieden, die uns neuerdings immer nachläuft, wenn wir zur Schule gehen. Sie wartet dann hier oben oder stromert durch die Wälder, bis wir mit dem Unterricht fertig sind, um uns auf dem Rückweg wieder nachzulaufen. Ich glaube, Edith würde auch gerne zur Schule gehen, immerhin ist sie inzwischen neun. Aber ihr Vater erlaubt es nicht, und mittlerweile denke ich, dass es vielleicht besser so für sie ist. Schon Rebekka und ich gelten in der Klasse als eigenartig. Für Edith aber, die nie spricht und sich ihr Verhalten von den Tieren abschaut, die selbst unter uns Außenseitern noch eine Außenseiterin ist, würde die Schule sicher zur Hölle werden.
Edith bleibt stehen, als sei meine Geste ein Kommando, doch sie erwidert den Gruß nicht. Ich lächle ihr aufmunternd zu, überlege, ob ich ihr zum Trost versprechen soll, ihr wieder ein Buch mitzubringen, und erinnere mich dann daran, dass ich das nicht mehr tun wollte. Das letzte Buch, das ich ihr mitgebracht habe, hat sie irgendwo versteckt und nie zurückgegeben, und ich musste es in der Schule bezahlen. Mit Geld, das ich nicht habe und das auch mein Vater nicht hat, weil das, was wir mit den Ziegen verdienen, gerade mal für die notwendigsten Einkäufe im Supermarkt reicht. Wenn wir ein gutes Jahr haben.
«Ich erzähle dir später alles, was wir heute lernen», verspreche ich ihr stattdessen, und dann versuche ich Rebekka einzuholen, die mit ihrem Rucksack bereits über die Wiese marschiert. Ihr Gang kommt mir heute entschiedener vor als sonst, sie hat einen richtigen Stechschritt drauf. Erst beim Schultor hole ich sie ein. Rebekka stapft weiter, in Richtung Ortskern.
«Was hast du vor?», frage ich. Sie wirft einen Blick auf die Kirchturmuhr.
«Geh du schon mal rein, ich muss noch was kaufen.»
Ich bleibe neben ihr, halte mit ihr Schritt. Der Lebensmittelladen öffnet um acht, zur gleichen Zeit also, zu der die Schule beginnt. Darum erledigen wir alles, was wir an Besorgungen aufgetragen bekommen, immer erst nach dem Unterricht.
«So dringend?», frage ich, und mein Blick wandert zu ihrer Hand, um zu sehen, ob möglicherweise der blöde Zettel darin steckt.
«Frauensachen, davon verstehst du nichts», spuckt sie aus, streicht sich eine Strähne hinters Ohr, und ich werde knallrot im Gesicht. Wegen ihres herablassenden Tons und weil mir plötzlich klar wird, was sie kaufen muss. Ich bleibe stehen, sie stapft weiter. Es ist seltsam. Ich kenne Rebekka seit Kindesbeinen an. Wir haben gemeinsam Verstecken gespielt und nackt im Schwarzbach gebadet. Wir haben am Gletscher nach den geheimnisvollen Höhlen gesucht, in denen unsere Vorfahren gelebt haben sollen, und sind dabei so tief eingebrochen, dass wir einen vollen Tag lang eng aneinandergepresst in einer Gletscherspalte ausharren mussten, bevor mein Vater uns gefunden hat. Die Obere Schwärze ist ein zerklüfteter, gefährlicher Gletscher, auf den sich kaum mal ein Bergsteiger verirrt. Uns war er eigentlich verboten. Einen vollen Tag lang dort festzustecken, das bedeutet, dass man den Atem des anderen atmet und sich gegenseitig anpinkeln muss. Man sollte meinen, danach gäbe es nichts mehr, das einem voreinander peinlich wäre.
Ich sehe zu, wie sie hinter einer Häuserecke verschwindet, und betrete die Schule, die eigentlich nur aus drei Räumen besteht: dem Klassenraum, einer Abstellkammer für Unterrichtsmaterialien und dem Zimmer der Lehrerin, auf dessen Schild nun seit einiger Zeit nicht mehr «Fr. Walsch», sondern «Fr. Bender» steht.
Hinter vorgehaltener Hand haben die älteren Kinder den jüngeren jahrelang zugeflüstert, hinter zwei der drei Türen verberge sich ein Skelett, und dann haben alle leise gekichert, weil sie damit das Schulskelett in der Abstellkammer und auch Frau Walsch in ihrem Büro meinten. Aber seit Frau Walsch Ende letzten Schuljahres in Rente gegangen ist und Frau Bender da ist, geht der Scherz nicht mehr auf. Frau Bender ist jung und hübsch, bei ihr stechen keine Knochen aus der Hüfte oder den Schultern hervor. Die Erwachsenen im Dorf sind noch immer skeptisch, ob eine so junge Lehrerin uns überhaupt etwas beibringen kann. Und tatsächlich wussten auch wir Schüler am Anfang nicht recht, was wir von ihr halten sollten. Da, wo Frau Bender vorher gearbeitet hat, wurden die Klassen nach Altersstufen unterteilt, sie sagt, das ist normal in der Stadt. Fast täglich haben wir unsere Tische durch den Raum schieben müssen, in Hufeisenform, Halbkreise und andere seltsame Formationen, wir kamen uns schon vor wie eine römische Legion. Aber seit wir die Gruppentische haben, wirkt Frau Bender recht zufrieden. An der Stimmung in der Klasse merkt man, dass wir sie insgeheim alle mögen. Nicht nur, weil sie hübsch ist, sondern auch, weil sie das Lineal entsorgt hat, mit dem Frau Walsch uns auf die Finger gedroschen hat.
Frau Bender kommt aus einer Großstadt, die so weit von hier ist, dass man 85 Stunden zu Fuß gehen müsste, um sie zu erreichen. Das habe ich auf Google Maps nachgesehen. Es ist Frau Bender zu verdanken, dass wir jetzt einen Computer in der Schule haben und dass ich weiß, was Google Maps ist. Frau Bender hat einiges neu an dieser Schule eingeführt, und manche meinen sogar, dass die Antenne in Jakobsleiter auf ihr Konto geht. Schließlich war sie es, die sich in den ersten zwei Wochen ständig darüber beschwert hat, dass man keinen Unterricht in einer Schule abhalten könne, die nicht einmal eine vernünftige Verbindung zum Internet hätte. Als wäre das Lernen nicht jahrhundertelang nur mit Büchern möglich gewesen.
Als ich den Klassenraum betrete, ist Frau Bender schon da. Sie trägt eine Stretch-Jeans, ein sonnengelbes T-Shirt, einen lockeren Pferdeschwanz und sieht damit überhaupt nicht aus, wie ich mir eine Lehrerin vorstelle. Frau Walsch kannte ich nur im schwarzen biederen Kleid mit streng zurückgebundenen Haaren. Jeden Tag das gleiche Kostüm und die gleiche Frisur, so als habe sie sich abends in den Schrank gestellt und sei morgens wieder daraus hervorgetreten.
Vielleicht ist ja Frau Bender auch ein Grund für Rebekkas Veränderung. Als Rebekka jetzt, mit zehn Minuten Verspätung, zur Tür hereinschlüpft und eine Entschuldigung murmelt, lächelt Frau Bender nur nachsichtig und bittet sie, Platz zu nehmen. Sie züchtigt sie nicht für ihre Verspätung, stellt sie nicht bloß. Rebekka muss nicht einmal auf einem Stuhl in der Ecke sitzen, mit dem Gesicht zur Wand. Frau Bender ist eine Städterin, aber sie erfüllt keines der Kriterien, die man uns über die Menschen aus der Stadt beigebracht hat. Sie ist freundlich und nett und geduldig, und einzig die Tatsache, dass sie manchmal ein wenig schreckhaft ist, lässt mich vermuten, dass es da etwas in ihrer Vergangenheit geben muss, das mit Angst und Gewalt zu tun hat. Ich kann es sehen, wenn die Pausenglocke schellt: Jedes Mal zuckt Frau Bender zusammen und verzieht dann kurz das Gesicht, als ärgere sie sich selbst über ihre Schreckhaftigkeit.
Ich betrachte Rebekka von der Seite, als sie sich setzt. Ihre Wangen sind gerötet, vielleicht weil sie sich so beeilt hat oder vielleicht weil ihr die Blicke der anderen peinlich sind. Wir versuchen normalerweise, durch den Tag zu kommen, ohne aufzufallen. Und als Frau Bender meinen Aufsatz über den Einfluss des Klimawandels auf die Alpen vor der ganzen Klasse lobt, senke ich beschämt den Kopf.
In der großen Pause läuft Rebekka zur Mädchentoilette, und ich warte an unserem gewohnten Platz auf dem Schulhof auf sie. Dieser Platz vor dem Fenster des Lehrerzimmers ist strategisch ausgewählt. Es ist der Punkt, wo die Lehrerin uns am besten sehen kann. Das macht diesen Teil des Schulhofs unattraktiv für die anderen Schüler und verschafft uns ein wenig Sicherheit. Die Prügel und Tritte sind schlimmer, wenn sie in Ecken stattfinden, in denen unsere Mitschüler sich unbeobachtet fühlen.
Ich stopfe die Hände in die Taschen und scharre mit dem Fuß auf dem Boden. Außer mir haben sich alle auf der anderen Seite des Schulhofs versammelt, irgendetwas müssen sie entdeckt haben, ich höre es an ihren aufgeregten Stimmen. Es wäre eine Lüge zu behaupten, dass ich nicht neugierig bin, was es ist. Aber ich drehe mich trotzdem nicht zu ihnen um. Es ist besser, alles zu vermeiden, was die Aufmerksamkeit am Ende auf mich lenken könnte.
Rebekka braucht heute lange auf dem Mädchenklo. Ich denke darüber nach, wie herablassend sie zu mir war, als sie von dieser Sache geredet hat, von der ich angeblich nichts verstehe. In Wahrheit verstehe ich wohl mehr davon als sie. Immerhin helfe ich meinem Vater seit Jahren, die Kleider meiner Mutter zu waschen. Und jeden Monat vergrabe ich die vollgebluteten Stofffetzen, die er in den Eimer vor dem Klohaus wirft, hinter dem Ziegenstall. Ich frage mich, ob Rebekka ihre Tage wohl schon öfter bekommen hat und wer ihr eigentlich beim ersten Mal erklärt hat, was zu tun ist. Freundinnen hat sie hier in der Schule nicht, und ihrer Mutter wird sie sich kaum anvertraut haben.
Ich sehe von meinen Füßen auf. Zu meiner Überraschung ist Rebekka gar nicht mehr auf dem Klo, sondern steht ein paar Meter vor dem Schulhof auf der Straße, den Blick von mir abgewandt. Sie sieht dorthin, wo die holprige Dorfstraße einen Knick macht und hinunter ins Tal führt. Dorthin, wo der Ortsausgang liegt.
Als Kind habe ich immer gedacht, dass diese Straße einfach abreißt, ins Nichts führt. Ein bisschen so wie bei einer Weltkarte aus dem Mittelalter: Die unentdeckten Gebiete blieben einfach weiß, so als würden sie nicht existieren. Es ist einfach, auszublenden, dass es Dinge außerhalb dessen geben mag, was man kennt und sehen kann.
Ich könnte so leben. Aber nicht Rebekka. Während ich um die Stelle, an der die Straße aus dem Dorf hinausführt, herumschleiche wie um einen schlafenden großen Hund, den man nur nicht wecken darf, um weiterhin seinen Frieden zu haben, ist Rebekka eine, die sich direkt vor die Nase des Hundes stellt, mit dem Blick stets am Horizont. Warum kann ihr die Welt, die wir haben, nicht genug sein?
Ich sehe mich zu den anderen um, aber die sind glücklicherweise noch immer mit dem beschäftigt, was sie da über den Schulhof jagen. Vielleicht eine streunende Katze oder ein Hund. Manche der Jungen aus dem Dorf haben Spaß daran, die Ruten von Hunden anzuzünden. Und ich habe drei von ihnen mal dabei beobachtet, wie sie zwei Katzen an den Schwänzen zusammengebunden und über eine Wäscheleine gehängt haben. Als die Panik zu groß wurde, fingen die Tiere an, sich gegenseitig die Augen auszukratzen.
Unbemerkt schlüpfe ich durch das Schultor und trete zu Rebekka. Sie zuckt zusammen, als ich sie am Arm berühre, und schaut mich einen Moment erschrocken, fast verwirrt an. Geradeso als habe sie jemand anderen erwartet.
«Hey», sage ich und kicke gegen einen Stein, der über den aufgerissenen Asphalt springt, in Richtung Ortsausgang. Wir folgen ihm beide mit den Augen. Fast als erwarteten wir, dass ihm gleich etwas passiert, dass die Straße sich öffnet oder irgendeine Klaue nach ihm greift. Aber natürlich passiert nichts. Der Stein hopst aus unserem Blickfeld, und was bleibt, ist harmloser, verletzter Asphalt.
«Dieser Stein ist freier als wir», sagt Rebekka düster, und das ärgert mich noch mehr.
Aber ehe ich etwas sagen kann, bricht hinter uns, auf dem Schulhof, lautstarkes Geschrei aus, und wir wenden uns um. Plötzlich erkenne ich, um was sich der Pulk von Schülern versammelt hat, was sie da über den Schulhof gejagt und jetzt in eine Ecke gedrängt haben, weit weg von dem Fenster des Lehrerzimmers: Edith. Die Kinder stehen um sie herum, schreien, lachen, schubsen sie. Edith lässt alles über sich ergehen, selbst als Lorenz ein Feuerzeug in der Hand aufflammen lässt und es an ihre Haare hält. Wieder wird sie geschubst, Edith taumelt und fällt direkt vor die Füße von Rick, der das zum Anlass nimmt zuzutreten.
«Jesse», sagt Rebekka mahnend. Aber ich renne schon zum Schulhof, stoße das Schultor auf.
Die Kinder haben ihren Kreis verengt. Alle treten nun zu. «Bergmädchen!», rufen sie mit jedem Tritt und: «Bist du stumm, du Schlampe?» Ich greife die erste Schulter, die ich zu fassen bekomme, es ist die von Rick. Er ist zwar erst sechzehn, aber einen guten Kopf größer als ich. Einer von jenen, denen körperliche Arbeit guttun würde, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrer wachsenden Kraft. Aber weil die Kinder hier unten nicht arbeiten müssen, weil sie zusammen draußen abhängen und Langeweile haben, braucht Rick ständig ein Ventil, um nicht zu explodieren. Wir Kinder vom Berg sind so ein Ventil.
Als habe er nur auf mich gewartet, lässt er von Edith ab und geht auf mich los. Er verkeilt einen Fuß hinter meinen und stößt mich zu Boden. Es macht keinen Unterschied für ihn, wen er tritt, solange er nur jemanden treten kann. Wir beide kennen das Spiel schon.
«Lauf zu Rebekka», rufe ich Edith zu, die auf die Knie kommt und zwischen den Beinen der anderen hindurchkriecht. Ein paar der Schüler versuchen noch, sie an den nackten Füßen festzuhalten und zurückzuziehen, aber die meisten haben inzwischen begriffen, dass ich nun das Opfer bin, und lassen von ihr ab. Ich sehe, wie Edith aufsteht, in Richtung Schultor rennt, neben Rebekka stehen bleibt und sich zu mir umsieht. Dann schließt sich der Kreis um mich, und eine Sneakerspitze trifft mich im Gesicht. Ich zucke zusammen, schließe die Augen und lege die Arme schützend um den Kopf.
Die Schäden sind schlimmer, als ich erwartet habe. Ich spucke Blut ins Waschbecken der Schultoilette und taste mit der Zunge über die Zähne, um sie zu zählen. Dass mir irgendwann mal jemand einen Zahn austritt, ist meine größte Sorge. Hier im Ort gibt es keinen Zahnarzt, geschweige denn einen Kieferorthopäden, und ich glaube kaum, dass sie mir einen fehlenden Zahn in der Apotheke ersetzen können. Alles andere in meinem Körper wird heilen und zuwachsen, das tut es immer. Aber ein Zahn wächst nicht nach. Daran wird man bei uns oben am Berg immer wieder erinnert, wenn die Bewohner den Mund aufmachen und ihre lückenhaften Zahnreihen zeigen.
Ich spucke noch einmal. Das Blut in meinem Mund ist zäh, aber es scheint nur das Zahnfleisch zu bluten. Keiner der Zähne ist lose. Ich richte mich auf und wische mir den Mund mit einem Papiertuch ab. Da ist ein kleiner Riss über dem Auge, der bereits anzuschwellen beginnt. Außerdem tun mir die Rippen und die Nieren weh. Ich drehe den Wasserhahn auf, wasche mir das Gesicht und die aufgeschürften Hände. Dann trockne ich mich noch einmal ab. Wie immer verbringe ich mehr Zeit auf der Toilette als nötig. Das fließende, warme Wasser ist für mich ein kleiner Luxus, und ich mag die braunen Papiertücher, die man neuerdings aus einer Box neben dem Waschbecken rupfen kann. Auch die gehen auf Frau Benders Konto, natürlich. Frau Bender hat das alte Handtuch, das vorher neben dem Waschbecken hing, mit einem einzigen entsetzten Gesichtsausdruck bedacht und gemeint, das tauge ja wohl lediglich als Wohnstätte für Bakterien und Viren. Daran muss ich nun immer denken, wenn ich das inzwischen fast schwarze Handtuch sehe, mit dem mein Vater sich nach der Arbeit die Hände abwischt. Frau Bender würde sich in Jakobsleiter nicht besonders wohlfühlen.
Als es zur Stunde klingelt, werfe ich die gebrauchten Papiertücher in den Korb und gehe zur Klasse zurück. Ich vermeide es, jemanden anzuschauen, ganz besonders Frau Bender. Aber aus den Augenwinkeln bemerke ich natürlich trotzdem, wie sie die Stirn runzelt, als sie mein Gesicht sieht, und wie sie dann streng in die Runde blickt. Es ist ein Problem von Frau Bender, dass sie glaubt, alles, was ihr nicht passt, so leicht austauschen zu können wie das Handtuch auf der Toilette. Aber es gibt Probleme, die schon viel länger bestehen als sie und die auch noch bestehen werden, wenn Frau Bender wieder weg ist. Ausgrenzung gibt es nicht nur in Almenen.
Ich hätte gedacht, dass ich der Letzte bin, der den Raum betritt, aber auch Rebekkas Stuhl ist noch frei. Ich drücke mich auf meinen Platz und spähe durch das Fenster auf den Schulhof. Lorenz, der auf der anderen Seite des Gruppentischs sitzt, lehnt sich grinsend zur Seite, um mir die Sicht zu versperren. Die anderen Schüler kichern.
«Pssscht», macht Frau Bender, und selbst dieses «Pssscht» klingt ganz anders als das von Frau Walsch. Es klingt nicht scharf, so als würde heißes Wasser überkochen und auf der Herdplatte verzischen. Frau Benders «Pssscht» hat etwas Beruhigendes an sich.