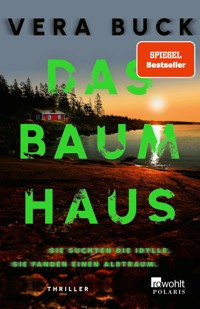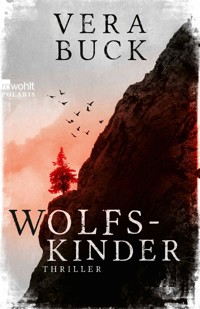9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Man kam nicht her, um zu genesen, sondern um zu sterben.«
Paris, 1884. In die neurologische Abteilung der Salpêtrière-Klinik wird ein kleines Mädchen eingeliefert: Runa, die allen erprobten Behandlungsmethoden trotzt und den berühmten Arzt und Hysterieforscher Dr. Charcot vor versammeltem Expertenpublikum blamiert. Jori Hell, ein Schweizer Medizinstudent, wittert seine Chance, an den ersehnten Doktortitel zu gelangen, und schlägt das bis dahin Undenkbare vor. Als erster Mediziner will er eine Patientin heilen, indem er eine Operation an ihrem Gehirn durchführt. Was er nicht ahnt: Runa hat mysteriöse Botschaften in der ganzen Stadt hinterlassen, auf die auch andere längst aufmerksam geworden sind. Und sie kennt Joris dunkelstes Geheimnis ...
Die Hardcover-Ausgabe erschien unter dem Titel »Runa« bei Limes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 853
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Paris, 1884. In die neurologische Abteilung der Salpêtrière-Klinik wird ein kleines Mädchen eingeliefert: Runa, die allen erprobten Behandlungsmethoden trotzt und den berühmten Arzt und Hysterieforscher Dr. Charcot vor versammeltem Expertenpublikum blamiert. Jori Hell, ein Schweizer Medizinstudent, wittert seine Chance, an den ersehnten Doktortitel zu gelangen, und schlägt das bis dahin Undenkbare vor. Als erster Mediziner will er eine Patientin heilen, indem er eine Operation an ihrem Gehirn durchführt. Was er nicht ahnt: Runa hat mysteriöse Botschaften in der ganzen Stadt hinterlassen, auf die auch andere längst aufmerksam geworden sind. Und sie kennt Joris dunkelstes Geheimnis …
Autorin
Vera Buck, geboren 1986, studierte Journalistik in Hannover und Scriptwriting auf Hawaii. Während des Studiums schrieb sie Texte für Radio, Fernsehen und Zeitschriften, später Kurzgeschichten für Anthologien und Literaturzeitschriften. Nach Stationen an Universitäten in Frankreich, Spanien und Italien lebt und arbeitet Vera Buck heute in Zürich. Ihr Debütroman Runas Schweigen (im Hardcover bei Limes unter dem Titel Runa erschienen) wurde von der Presse hochgelobt und für den renommierten Glauser-Preis nominiert.
Vera Buck
Runas Schweigen
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2015 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Die Hardcover-Ausgabe erschien unter dem Titel Runa.
Copyright dieser Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Jake Olson/Trevillion Images; www.buerosued.de
AF · Herstellung: wag
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23672-4V002www.blanvalet.de
Widmung des Erzählers
Für M. Lecoq, dem ich diese Geschichte verdanke, und für Runa, der ich sie schulde.
MAXIME CHEVRIER,
12. Dezember 1903
PROLOG
Ich holte Luft, als wir uns aufstellten und ich nun selbst sah, was man sich vorhin, beim Umkleiden, nur hinter vorgehaltener Hand zu erzählen gewagt hatte. Zweihundertdreizehn Besucher. Die Zahl hatte die Runde gemacht, war von Mund zu Mund weitergegeben worden wie ein geflüsterter Kanon. Sie hatte uns Chorknaben erreicht, den Pfarrer und am Ende den Kaplan, der das Registerbuch beschwingter aufschlug, als es seine Art war. Zweihundertdreizehn Besucher in der Saint-Médard. Das also würde die Zahl meiner ersten Leserschaft sein.
»Alles in Ordnung, Maxime?«
Ich konnte nur nicken, während ich weiter Luft in meine Wangen blies und durch den Mund ausstieß, als sei ich ein Blasebalg. Ich hielt nach meinem Vater Ausschau und entdeckte ihn hinten an der Tür. Mit vor dem Körper verschränkten Händen stand er da und sah klein aus. Vielleicht wäre es mir lieber gewesen, er wäre nicht gekommen. Gustave legte mir die Hand auf die Schulter und brachte seinen Mund so nah an mein Ohr, dass ich eine Gänsehaut bekam.
»Mach dir keine Sorgen. Du kannst ja beim Minuit Chrétienseinfach ein bisschen leiser singen.«
Ich kniff die Lippen zusammen und nickte. Gustaves Worte klangen wie eine Bitte. Seine Hand hinterließ einen brennenden Fleck auf meiner Haut, als er sich abwandte.
Er konnte ebenso wenig wie alle anderen ahnen, dass es heute kein Minuit Chrétiens geben würde. Dass stattdessen eine Vernissage geplant war, die das Potenzial hatte, die Ordnung von Paris innerhalb einer Nacht auf den Kopf zu stellen.
Ich ballte die Hände zu Fäusten, nahm meinen Platz ein und schloss die Augen. Die Stimmen im Raum wurden leiser. Dann begannen das Husten und Räuspern, einer nach dem anderen gab noch einmal einen gutturalen Laut von sich, bevor man endgültig in Stille versank. Ich hörte mein Blut in den Ohren rauschen und den Sturm, der draußen um die Kirche pfiff. Neben mir stand Gustave. Ich hätte es gern gehabt, wenn er meine Hand genommen hätte.
Es war genau 22.30 Uhr, als wir das Lied anstimmten. Der erste Höhepunkt der heiligen Messe. Alles verlief nach Plan. Dröhnend drangen die Klänge aus den Orgelpfeifen. Sie brandeten durch das Kirchenschiff, prallten an den Wänden ab und wurden zurückgeworfen auf die Kirchgänger, die nach ihren Gesangbüchern griffen. Es waren nicht genügend für alle da, aber man hatte sich arrangiert. Einige der Bücher waren zum Rand gewandert und befanden sich jetzt in den Händen der Stehenden, so weit zumindest reichte die Nächstenliebe an Weihnachten. Ich reckte den Hals, um nach meinem Vater zu sehen, doch im hinteren Teil der Kirche war es nun dunkel. Die hohen Kerzenständer waren nach vorn getragen worden, alles Licht strahlte auf uns. Es beleuchtete den Chor, den Altar und die ersten Sitzreihen. Im schummrigen Rest der Kirche reichte die Helligkeit gerade aus, um die Noten auf den Seiten zu entziffern und die Worte, die darüber geschrieben waren. »Dans une étable obscure.«Im Nachhinein, so würde man mir sagen, hätte ich den Liedtitel nicht besser wählen können. Dans une étable obscure – in einem dunklen Stall.
Den ersten Personen entgleisten die Gesichtszüge, als der Knabenchor zu singen begann. Ich hörte, wie Gustave neben mir zusammen mit den anderen die Verse anstimmte, die wir so oft zusammen einstudiert hatten. Doch die Menschen im Kirchenraum begleiteten sie nicht. Verunsichert brachen die Jungen ihren Gesang ab, einer nach dem anderen, als ertränken sie in der Sprachlosigkeit, die sich in der Kirche ausgebreitet hatte. Nur die Orgel dröhnte weiter durch den Raum, bis auch der Organist merkte, dass etwas nicht stimmte. Ein einzelner Pfeifenton blieb zwischen den Kirchenbänken hängen, verzerrt und düster wie die Sätze, auf die die Menschen starrten.
Da war ein Text über das Lied geschrieben, mit schwarzer Tinte, schwarz wie die Blumen des Bösen. Eine Botschaft, Zeilen, ein Gedicht. Ich spürte ein Kribbeln durch meinen Körper fahren, als ich sah, wie man sich zu mehreren über die Bücher beugte. Aus der bestürzten Stille erwuchs ein Flüstern.
ERSTER TEIL
Entdeckungen
»Vielleicht hätte ich zuerst an Tieren Versuche anstellen sollen. Die geeignetsten, nämlich Kälber, waren indessen ihrer Kosten wegen schwer zu beschaffen und zu erhalten, weshalb ich – mit gütiger Erlaubnis des Oberarztes … meine Experimente im allgemeinen Findelhaus zu Stockholm begann und darnach vielleicht Experimente mit Tieren zu machen gedachte.«
CARL JANSON (1891)
Schwedischer Arzt
Marguerite Desens hatte im hofeigenen Stall ihre Unschuld, ihr Kind und ihr Leben verloren. Alles in derselben Pferdebox, aber nicht alles zur selben Zeit. Der verwitwete Gatte führte Jori an den Pferchen mit den Schweinen vorbei, während er die wichtigsten Ereignisse im Leben der Madame Desens in rückwärtiger Reihenfolge auflistete: 1881 Tod durch eine Heugabel, beim Ausmisten in die Zinken gestürzt, ein tragischer Unfall. Acht Jahre zuvor Fehlgeburt durch einen Huftritt. Und ’73 die Zeugung des verlorenen Kindes selbst. Der Bauer blickte versonnen. Von allen drei Ereignissen hatte das letztgenannte wohl den nachhaltigsten Eindruck bei ihm hinterlassen.
Die Schweine steckten ihre Köpfe durch die Holzbretter und grunzten erwartungsvoll. Sie stießen sich drängelnd zur Seite. In Paris lernte man schnell, was man tun muss, um den besten Platz beim Fressen zu ergattern.
Ein paar Meter weiter standen die Pferde. Jori spähte über die niedrigen Bretterwände. Beim Anblick des verdreckten Strohs wollte er sich die Szenen, die der Bauer ihm beschrieb, lieber nicht ausmalen.
»Wie lange halten Sie sie schon hier drin?«, fragte er, um zum eigentlichen Grund seines Besuchs zurückzukehren.
»Drei Monate. Seit sie die Küchenstühle zertrümmert hat.«
»Sie sperren sie seit drei Monaten hier ein?«
Der Bauer zuckte die Achseln. »Hat den Verstand verloren«, sagte er, als wisse Jori das nicht längst, und drehte mit dem rechten Zeigefinger kleine Kreise neben der Schläfe. Jori roch den schlechten Atem des Bauern, als dieser sich vertrauensvoll zu ihm hinüberlehnte, und wandte sich ab.
Monsieur Desens stieß die Holztür am Ende des Stalls auf, und Jori folgte ihm in einen Raum, der mit Säcken und Arbeitsgeräten voll gestellt war. Im Halbdunkeln konnte er einen alten Pferdepflug erkennen und eine schmale Treppe, die auf den Dachboden führte. Sie war nicht viel breiter als eine Hühnerleiter. Es war kühler in diesem Raum als drüben im Stall. Und es roch nach Staub, Lederfett und Schweinen. Monsieur Desens deutete auf einen Verschlag unter der Treppe, in dem er vor einigen Jahren einmal Kaninchen gehalten hatte.
»Da drin?«
»Ist größer, als es aussieht. Man kann sie ja schlecht hier mit den Sensen und dem Pflug allein lassen.«
Jori ordnete seine Gesichtszüge. Er hatte geglaubt, die Zeiten, in denen man Geisteskranke ankettete und in Ställen einsperrte, seien vorbei.
»Dann öffnen Sie!«
»Können Sie selber machen«, sagte der Bauer und legte die verschränkten Arme auf seinem Bauch ab wie auf einem Tisch. Die Hände schob er unter die schweißbefleckten Achseln. »Ich bin froh, dass ich sie überhaupt da reinbekommen hab.«
Jori wandte sich verärgert um und näherte sich der Treppe. Im Verschlag schien alles ruhig. Er strich über die raue Oberfläche des Holzes. Die Box erinnerte ihn an früher. In Finsterhennen hatte er mit seinen Eltern auf einem kleinen Hof gelebt, nicht zu vergleichen mit der Größe dieses Gehöfts. Lediglich ein paar Kühe, Kaninchen und Hühner hatten sie besessen, alles zum Eigenbedarf, dazu ein Pferd, das den Pflug ziehen konnte. Doch der Geruch war der gleiche gewesen wie auf diesem Hof. Dazu der Anblick der Arbeitsgeräte, die schwere Luft, die Schatten, alles erinnerte Jori an sein Zuhause – selbst die Tatsache, dass in diesem Stall eine Frau gestorben war. Sie hatten vielleicht mehr gemeinsam, als ihm lieb war, Jori und der Bauer Desens.
»Seien Sie vorsichtig«, sagte dieser nun, und Jori zuckte zusammen. »Die ist irre, wie gesagt.«
Jori verzog das Gesicht: »Haben Sie Angst vor Ihrer eigenen Tochter, Monsieur Desens?«
Doch der Bauer hatte es nicht nötig zu antworten. Er war in der überlegenen Position, hinten an der Wand. Jori betrachtete die Vorrichtung, mit der die Tür des Bretterverschlags verschlossen war. Ein einfacher Holzblock, mit einem Nagel am Rahmen befestigt, sodass man ihn drehen und vor die Tür schieben konnte. Sie waren in jedem Land gleich, diese Schlösser, hinter denen man seine Tiere wegsperrte – oder seine Kinder.
Jori ging zur Seitenwand und spähte durch eine Lücke zwischen den Holzbrettern. Im Innenraum war es finster. In dem wenigen Licht, das durch die Bretterspalten fiel, schwebten Staubkörnchen. Sie zogen leuchtende Schlieren und lösten sich dann in der Dunkelheit auf wie das Pulver einer Tablette, die man in ein Wasserglas geworfen hatte. Sonst war nichts zu sehen. Wenn sich ein Mensch hinter diesen Brettern befand, dann musste er an der Wand liegen, an der Jori stand, der Verschlag bot keinen Platz für weitere Versteckspiele. Jori blickte nach unten und entdeckte ein kleines Büschel brauner Haare, das sich durch die Lücke zwischen Verschlag und Boden drückte. Die Kranke lag direkt vor seinen Füßen.
»Die Nachbarn ham schon komisch geguckt«, es lag so viel Trotz in der Stimme des Bauern, dass man den Kommentar mit etwas Wohlwollen für eine Rechtfertigung halten konnte. »Eine Irre auf dem Hof haben – da können Sie auch gleich die Seuche haben. So was spricht sich eben rum.«
Jori schob den Riegel zur Seite. Die Tür war nachlässig gezimmert und wackelte unter seinem Griff. Die äußerste Kante hinterließ einen halbrunden Kratzer auf dem Boden, auf dem angetrockneter Kaninchendreck klebte. Jori kniff die Augen zusammen und blickte ins Dunkel, doch selbst jetzt konnte er nicht mehr als die vage Form eines Körpers erkennen, der an der Seitenwand kauerte, einen nackten Fuß und Haare. Eine Strähne hing an einem Astloch des rauen Holzes, wahrscheinlich war die Kranke die Wand hinuntergerutscht. Jori brauchte eine Weile, um zu erkennen, wo vorne und wo hinten war. Der Kopf zeigte zur Rückwand, die durch die Treppe wie eingedrückt wirkte, das linke Bein war unter den Leib gezogen, das rechte nach vorne ausgestreckt, in Richtung der Tür. Erst jetzt, wo Jori so etwas wie eine Frau erkennen konnte, fiel ihm auf, dass er sich nicht nach dem Namen der Kranken erkundigt hatte.
»Wie heißt sie?«
»Marguerite. Wie ihre Mutter.«
»Hm.« Jori hatte das ungute Gefühl, dass Mutter und Tochter nicht nur den Namen, sondern auch ihr Schicksal miteinander teilen würden, wenn er die junge Frau nicht schleunigst aus diesem Stall befreien würde. Probeweise stieß er mit dem Schuh gegen den rechten Fuß, der sich zurückzog wie eine Schlange, die man mit dem Spazierstock berührte. Jori hörte ein Atmen. Marguerite Desens hatte seine Anwesenheit registriert.
»Kann sie sprechen?«, fragte er über seine Schulter hinweg, ohne die Aufmerksamkeit von der Gestalt im Halbdunkeln abzuwenden.
»Keine Ahnung, glaub schon noch. Aber da kommt eh nur Unsinn aus ihrem Mund. Wollen Sie sie nicht untersuchen?«
Jori beugte sich zu der Kranken hinunter. Sein Blick fiel auf den leeren Holznapf, der neben ihrem Rocksaum lag. Hastig in den Käfig geworfen und offenbar ebenso hastig geleert.
»Wann hat sie die letzte Mahlzeit bekommen?«
»Gestern.«
»Heute noch nichts?«
»Ich fütter sie abends zusammen mit den anderen«, sagte der Bauer und ließ offen, ob er damit die anderen Kinder oder die Tiere meinte. Vom Stall nebenan drang das Grunzen der Schweine. »Isse denn jetzt vom Teufel geritten?«
Jori richtete sich auf, so gut das im Verschlag möglich war, trat einen Schritt näher und stieß noch einmal mit dem Schuh gegen den Körper der Frau, sanft, dorthin, wo er ihre Hüfte vermutete. Sie gab nach, Jori vernahm ein Stöhnen, dann war es wieder still im Kabuff. Er warf einen Blick auf die verfilzten Haare und die Krümmung der Wirbelsäule. In der Dunkelheit und Enge war es unmöglich, eine Diagnose zu stellen.
»Ich denke, sie ist hysterisch. Die genauere Untersuchung übernimmt Doktor Charcot in der Klinik. Ich bin nur für ein erstes Gutachten hier.«
»Ich zahle nichts, wie gesagt«, erwiderte Monsieur Desens, den das Wort Gutachten offenbar alarmierte. Er kannte das schon mit diesen Stempeln. Für alles Mögliche brauchte man plötzlich Gutachten, selbst auf einem Schweinehof.
»Ja, Monsieur, das sagten Sie.«
»Ich zahle nichts.«
»Sie zahlen nichts. Die Kutsche kommt in etwa einer Stunde und holt sie ab.«
»Ist mir recht.« Es klang so gleichgültig, dass Jori sich zu dem Bauern umdrehte. Der Mann hatte die Hände noch tiefer unter die Achseln gegraben und den Mund vorgeschoben.
»Hat Ihre Tochter irgendwelche persönlichen Gegenstände, die sie mitnehmen will? Kleider? Unterwäsche?«
»Damit Sie die ihr in der Klinik wegnehmen können? Ne. Glauben Sie nicht, ich wüsste nicht, wie das läuft.«
Jori biss sich auf die Unterlippe. Es war nicht das erste Mal, dass man ihn beschuldigte, die Familien arm zu rauben, wenn er neben den Kranken auch noch deren persönliche Dinge mitnehmen wollte, man hatte doch ohnehin schon von allem zu wenig, außer von Familienmitgliedern. Die gab man ihm überall mehr als freiwillig mit.
»Kleider und Schmuck werden bei uns aufbewahrt und der Kranken wieder zugeführt, sobald sie nach Hause zurückkehrt.« Jori musste sich um einen gemäßigten Ton bemühen. »Nach ihrer Genesung.«
»Junger Mann, ich rechne weder mit ihrer Genesung noch mit ihrer Rückkehr.« Die Stimme des Bauern war hart geworden, und als die Blicke der beiden Männer sich trafen, prallten sie regelrecht voneinander ab. Jori mahnte sich zur Ruhe. Es gab keinen Grund für Feindseligkeiten. Der eine hatte eine Tochter loszuwerden, der andere sollte eine abholen, ihre Interessen ergänzten sich also ganz wunderbar.
»In einer Stunde dann. Geben Sie ihr vorher noch was zu essen, damit sie den Weg übersteht.«
Jori warf einen letzten Blick auf das Bündel Frau am Boden, es widerstrebte ihm, sie so liegen zu lassen, doch für den Moment konnte er nichts mehr tun, und so schloss er die wackelige Brettertür hinter sich. Er hatte noch eine weitere Person abzuholen an diesem Tag, eine, an der er mehr Freude haben würde als an Marguerite Desens.
Es war ja nicht so, als ob es die Gattung Mensch an sich gewesen wäre, die Jori störte. An der Salpêtrière hatte er ständig mit Menschen zu tun. Die Krankensäle waren überfüllt mit ihnen. Und trotzdem hatte dort alles seine Ordnung. Jeder hatte seinen Platz. Man wusste, wo man wen fand und wer in welchem Bett lag. In der Pariser Innenstadt dagegen herrschten Tag und Nacht Disziplinlosigkeit und unkontrollierbares Chaos.
Er wich den mit Koffern und Personen hoch beladenen Kutschen aus, die wie Zirkuskarawanen durch das Getümmel wankten, in einer Reihe hintereinander her. Dann drückte er sich an das schmiedeeiserne Tor, das zum Haupteingang des Gare de l’Est führte. Den Rücken gegen die Stäbe gepresst, blickte er zum Himmel. Die Nachmittagssonne hing wie ein schwefelgelber Gallenstein über der Stadt, halb verdeckt vom Dampf und Ruß der Züge, die am Bahnhof ankamen und weitere Ladungen Menschen in ein ohnehin schon menschensattes Paris karrten, ein übersättigtes Paris. Rund um das Zentrum wurde in den Banlieues gebaut und erweitert, ohne dem Ansturm je gerecht zu werden. Noch längere Straßen und noch höhere Häuser, oder was man hier eben Häuser nannte. In Finsterhennen, wo Jori aufgewachsen war, hatten Häuser immer eine klare Form gehabt: vier Wände, ein Dach und einen Garten mit einer Kuh darin oder einem Birnbaum. Es gab blauen Himmel und grüne Wiesen und Felder, über die man in die Ferne gucken konnte, so weit, dass man die Berge sah. In Paris dagegen sah man nur Fassaden, Steinfassaden mit Fensterreihen, und hier und da Balkone, die ungenutzt über der Straße hingen. Manche lagen direkt über einem Restaurant oder einem Café. Man hätte den Gästen in ihren Café au laitspucken können.
Ein gekrümmt gehender Mann, der einen Leierkasten vor sich herschob, löste sich aus der Menge. Er überquerte die Straße und steuerte auf Jori zu, den Blick vor sich auf den Boden gerichtet, als dürfe er die ratternden Räder des Kastens nicht aus den Augen verlieren. Er trug eine Jacke aus abgewetztem Samt, hatte weiße Haare und ein rot nässendes Geschwür auf dem Nasenrücken. Auf dem Bürgersteig angekommen, blieb er stehen und blinzelte Jori überrascht an. Offenbar hatte dieser ihn um seinen Stammplatz vor dem Haupteingang gebracht. Joris Blick fiel auf das rote Ulkus in seinem Gesicht. Aus der Entfernung konnte er nicht sagen, ob es ansteckend war, doch sollte der Mann seinen Platz für sich beanspruchen, würde Jori ihm nicht im Weg stehen. Er wollte einen Schritt zur Seite machen, aber der Leierkastenmann musterte Jori eindringlich, die Lider schwer über den Augäpfeln. Dann drehte er sich um wie ein alter Hund, der zu müde oder zu hungrig zum Kämpfen war, und schob den Leierkasten mitten in die Menschen auf dem Gehweg. Kurz darauf wehten seine Klänge schief und traurig von der anderen Seite des Eingangs herüber. Es klang wie ein verspäteter Vorwurf.
Jori fischte nach seiner Taschenuhr und ließ sie aufschnappen, es war zwanzig vor vier. In einer Viertelstunde sollte der Zug eintreffen, Jori hätte sich mehr Zeit lassen können. Er schloss den goldenen Deckel wieder und betrachtete leidenschaftslos den Schützen, der darauf abgebildet war. Er hatte die Uhr vor vielen Jahren auf einem Flohmarkt in der Schweiz gekauft, ein hässliches Ding, aber so verlässlich, dass er keinen Grund hatte, auf eine neue Uhr zu sparen. Er ließ die Schützenuhr in seine Tasche zurückgleiten.
Sein Blick fiel auf einige Aushänge am Zaun neben ihm, auf dünnen Brettern angebracht und zahlreich überklebt. Auf einem wurde Werbung für einen 20-Schuss-Lefaucheux-Revolver gemacht. Ein anderer pries eine neue amerikanische Maschine an, in der sich angeblich 80 Wäschestücke gleichzeitig waschen ließen, und das ganz ohne Handarbeit. Amerika war groß in Mode. Wer mit seinem Leben unzufrieden war und sich irgendwie eine Fahrkarte leisten konnte, der ging dorthin. Wer nicht, der kam zumindest nach Paris, wo es Unterhaltung gab, Arbeit und kokainhaltigen Wein.
Eine Werbung für die Folies Bergère fiel Jori auf. Sie zeigte drei Tänzerinnen in roten Kleidern. Der Rock der vordersten war beim Tanzen leicht hochgerutscht und gab den Blick auf ein seltsam proportioniertes Bein frei, das im Vergleich zum Standbein überlang war und in unnatürlichem Winkel aus der Hüfte stach. Beinlängendifferenz durch Hüftkopfnekrose – Jori stellte die Diagnose fast automatisch.
Er zog noch einmal die Schützenuhr hervor, ließ sie aufschnappen, zuschnappen, es hatte sich nicht viel verändert. Sein Blick wanderte zurück zu den Plakaten. Irgendetwas hatte ihn irritiert. Etwas, das mit der Anordnung der Plakate zu tun hatte oder mit dem Text, er konnte es nicht genau sagen. Erneut betrachtete er das Becken der Frau, die nackten Beine, an denen der Rocksaum hochkroch, aber dort war das Problem nicht zu finden, also wandte er seine Aufmerksamkeit dem Rest des Plakats zu, dem Schriftzug, den verzierten Rändern. Dann entdeckte er, was ihn verunsichert hatte. An der oberen Kante des Plakats war eine überklebte Notiz zu erkennen, auf der, blass und mit krakeligem Bleistiftstrich, ein Zeichen zu erkennen war:
Der Rest wurde von dem Werbeplakat verdeckt. Jori strich mit dem Daumen leicht über das Zeichen, und der Bleistift verwischte. Ein Kreuz unten und ein Kopf darauf. Das war das Symbol für Weiblichkeit, doch auf diesem hier saßen zwei Spitzen, die nach oben ragten, als hätte man der Frau Hörner aufgesetzt. Ein weiblicher Teufel. Jori ließ den Daumen sinken und massierte mit ihm die Außenseite seines Zeigefingers. Seine Hände waren feucht.
Ohne darauf zu achten, dass der kleine Zeiger der Vier bereits ziemlich nahe gerückt war, begann er damit, den Aushang von dem darunter liegenden Zettel zu lösen. Doch das Plakat der Folies Bergère war mit billigem Knochenleim festgeklebt. Die grauen Grafitspuren des Bleistifts hatten sich darin eingefressen wie Lepra in Haut. Und als Jori das Blatt schließlich freigelegt hatte, konnte er nicht einmal die Hälfte der ursprünglichen Informationen lesen. Der Kleber hatte die Buchstaben förmlich aus der Papieroberfläche herausgerissen:
Er brachte sein Gesicht näher an das Papier, das nach feuchter Kellerwand roch. Die Notiz sah aus, als habe ein Kind sie verfasst, die Buchstaben verschieden groß und mehr gemalt als geschrieben – das kleine »t« wie ein Grabkreuz und das »r« wie ein Spazierstock, so hatte Jori das Alphabet damals auch gelernt. Sein Daumen strich fester über die Wurzel seines Zeigefingers. Weitere Symbole oder Zeichnungen fand er nicht. Nur diese mehr oder weniger sinnlose Aneinanderreihung von Buchstaben.
»Jori!«
Jori schreckte auf und fuhr herum zu dem blonden jungen Mann, der da plötzlich strahlend vor ihm stand. Eine Sekunde lang war er verdattert, dann konnte er gar nicht anders, als ebenso zu strahlen. Paul war da! Paul Eugen Bleuler, sein Jugendfreund aus Studienzeiten. Jori hätte am Bahnsteig auf ihn warten sollen.
»Alles in Ordnung? Hast du vergessen, mich abzuholen?«
»Ich war zu früh hier, und in der Halle …«
»Ich weiß, es war zu voll.« Pauls Augen lachten warm. Hellblau und klar, dachte Jori, ein Bleulerblau. Der gleiche Farbton, den auch Paulines Augen hatten, wenn ihre graue Stimmung für ein paar Tage aufgerissen war. Jori hatte die Farbe vermisst, vermisste sie noch immer.
»Du hast abgenommen. Ich glaube, dir fehlt die Schweizer Küche«, sagte Paul.
»Und du bist haariger geworden.«
»Macht mich reifer.« Paul griff an seinen Bart, der ebenso licht war wie sein Haar. Wie gestutztes Gras wuchs er an seinem Kinn, Rasen, nicht Wiese, da fein und akkurat getrimmt. Jori verkniff sich einen Kommentar. Seit vor 15 Jahren ein erstes schwarzes Barthaar aus seiner Haut geschossen war und wie der Stechrüssel einer Zecke in seiner Wange gesteckt hatte, rasierte er sich jeden Tag. Er mochte keine Bärte. Schon beim bloßen Anblick juckte ihm das Gesicht – ganz abgesehen davon, dass er sie für einen Hort von Parasiten und Bakterien hielt. Ein Bart würde ihm das Gefühl geben, nach jeder Patientenbehandlung die Krankheit im Gesicht mit nach Hause zu tragen.
»Was ist das?«, fragte Paul und griff nach dem abgerissenen Werbeplakat, von dem Jori nicht mehr gewusst hatte, dass er es in der Hand hielt. Nun war es zu spät, es verschwinden zu lassen.
»Die ›Folies Bärgär‹?« Paul grinste, als er die halbnackten Frauen sah, und Jori fiel auf, dass sein Französisch ziemlich deutsch klang. »Ist das unser Plan für heute Abend?«
»Nein!« Mit rotem Kopf nahm Jori das Plakat wieder an sich, peinlich berührt, als sei es etwas Anstößiges, in Paris ein Varieté aufzusuchen. »Heute Abend ist Dienstagsvorlesung in der Salpêtrière.«
»Ich weiß. Du hast es in deinen Briefen hundertmal erwähnt. Als ob Hippokrates persönlich uns die Patienten vorstellen würde.« Paul lachte, während Jori sich nach einem Ort umsah, an dem er das Plakat entsorgen konnte. Er steuerte auf den Mülleimer zu, der ein paar Schritte entfernt an der Straßenlaterne festgemacht war, und warf das zerknüllte Plakat hinein. Öffentliche Abfalleimer waren die neueste Erfindung der Stadt. Ein gewisser Monsieur Poubelle hatte sie erst in diesem Jahr installieren lassen. Und demnächst sollte es sogar eine Trennung der Abfälle geben. Poubelle wollte alle Vermieter dazu verpflichten, drei Tonnen vor das Haus zu stellen: eine für Essensreste, eine für Papier und Lumpen und eine dritte für Austernschalen. Jori fand die Idee hervorragend, auch wenn der Erfolg bislang bescheiden war. Allein in einem Umkreis von einer Armlänge um die Mülleimer herum schien es zu funktionieren.
»Besser. Es ist Doktor Charcot, der die Vorlesung hält«, sagte er, plötzlich in gehobener Stimmung. »Und ich sag’s dir, diese Tänzerinnen mit den Hysterikerinnen an der Salpêtrière zu vergleichen ist wie – wie Äther mit Spanischer Fliege zu vergleichen!«
»Mit was?«
»Eben.«
Paul bedachte ihn mit einem Gesichtsausdruck, den Jori nicht deuten konnte. Einen Moment lang hingen ihre Blicke aneinander, warm und vertraulich, als würden sie erst jetzt begreifen, dass sie sich nach so langer Zeit endlich wiedersahen. Und dann auch noch in Paris und mit der Aussicht auf einen Abendvortrag von Prof. Dr. Jean-Martin Charcot, dem berühmtesten Nervenarzt der Welt, über dessen Schriften sie an der Universität in Zürich gemeinsam gebrütet hatten.
Paul stellte seinen Koffer ab, wobei er darauf achtete, dass er nicht umfiel. Dann machte er einen Schritt auf Jori zu, um ihn zu umarmen.
»Gut, dich zu sehen!«, sagte er, und Jori meinte, in den Falten von Pauls Reisemantel noch einen Rest Schweizer Sauberkeit zu schnuppern.
»Willkommen in Paris.« Er atmete tief ein und war sich mit einem Mal nicht mehr sicher, ob dem Freund die Stadt tatsächlich gefallen würde.
Die Reisenden strömten vorbei. Sie besahen sich die beiden Männer neben dem Eingang, wie sie alles besehen wollten, was es in dieser Stadt zu besehen gab. Dutzende Augenpaare auf der Suche nach der nächsten Attraktion, dem nächsten Skandal oder dem nächsten Verbrechen. Und eins dieser Augenpaare saß im Café gegenüber dem Bahnhof und blinzelte über den Rand eines halb vollen Glases Vin Mariani.
Lecoq war kein Mann der kleinen Schlucke. Er bestellte sich kein Getränk, nur um daran zu nippen, ebenso wenig, wie er sich ein Kotelett bestellte, nur um daran herumzunagen. Darum war das hier sein viertes Glas Vin Mariani. Er wusste nicht, wie lange er noch warten musste. Der blonde, bartlose Mann auf der Straßenseite gegenüber schien keine Eile zu haben, auch wenn er noch so oft auf die Uhr sah.
Als er sich neben das Bahnhofstor gestellt hatte, hatte Lecoq noch angenommen, es handele sich um einen ganz gewöhnlichen Taschendieb, obwohl die schmale Gestalt und die wie an den Kopf genähten Verbrecherohrläppchen eher auf einen Brandstifter schließen ließen. In jedem Fall war der Mann jung und unerfahren, man könnte ihn leicht mit ein paar Handgriffen auf den Boden zwingen. Dann aber hatte der Kerl sich an den Aushängen am Zaun zu schaffen gemacht und einen von ihnen abgerissen, als habe er etwas gesucht, bevor er von einem Mann mit einem Koffer unterbrochen worden war. Der Zweite war ein Reisender, offenbar, und von weit her, der altmodische Mantel warf knittrig eingesessene Falten. Lecoq hatte direkt gesehen, dass beide Männer Ausländer waren, Deutsche wahrscheinlich, die Deutschen kamen in Massen nach Paris, schon seit Jahrzehnten. Sie bauten ihre Nester in die Lücken, die von der Revolution und der Pariser Kommune in die Stadt gerissen worden waren. Und wo sie keine natürlichen Lücken fanden, da schufen sie welche – zum Beispiel durch den Deutsch-Französischen Krieg 1870.
Eine junge Frau kam an den Tisch geschlendert, Lecoq bemerkte sie erst, als sie schon vor ihm stand und ihm das abgetragene lila Kleid die Sicht auf den Bahnhof nahm. Verärgert blickte er zu ihr auf, zu ihrem runden Kindsgesicht. Er schätzte, dass sie nicht älter als vierzehn oder fünfzehn Jahre war.
»Mademoiselle.« Er hob die Hand und wollte sie zur Seite schieben, doch sie blieb stehen und drückte ihre Hüfte gegen seine Finger; ihre eigenen Hände hatte sie seitlich in die Taille gestützt. Ein aufdringlicher Duft nach Veilchen umwehte Lecoq. Die junge Frau hatte ein Parfüm gewählt, das zu ihrer Art passte.
»Vier Francs«, sagte sie, und an ihrem Akzent erkannte Lecoq, dass auch sie aus dem Ausland war, aus Ungarn vielleicht. Eines dieser jungen Mädchen, die eigentlich ins Land kamen, um als Kinderfrauen oder Ammen für Neugeborene zu arbeiten und früher oder später feststellten, dass eine andere Klientelgruppe interessierter an ihren Brüsten war. Vier Francs, und das für Veilchen! Lecoq warf ihr einen verärgerten Blick zu. Ihm gefiel nicht, was die junge Frau da tat, und ihr gefiel es offensichtlich auch nicht. Das Lächeln auf ihrem Gesicht wurde nur von einer Schicht Lippenstift und Puder an Ort und Stelle gehalten.
»Excusez-moi, Mademoiselle.« Er packte sie mit beiden Händen und schob sie fort. Ihre Stiefel klackerten auf dem Kopfsteinpflaster, als sie zur Seite stolperte. Sie sagte noch etwas in einer Sprache, die er nicht verstand. Ihre Stimme klang verärgert, aber nicht enttäuscht, Lecoq machte sich da keine Illusionen, er war ein alter Mann.
Der Verdächtige und sein Freund standen noch zwischen den Säulen, wo er sie zuletzt gesehen hatte, und unterhielten sich. Das Plakat hatte die Hände gewechselt, von dem Mann mit den Verbrecherohrläppchen zu dem Bärtigen. Jetzt wanderte es wieder zurück. Der Verdächtige knüllte es zusammen und ging zum Mülleimer, um es hineinzuwerfen, und auch das war verdächtig, hoch verdächtig. Niemand nutzte diese neumodischen öffentlichen Eimer, man warf den Müll auf die Straße, wenn man nichts zu verbergen hatte!
Lecoq nahm noch einen Schluck, den letzten, die Gläser wurden in diesen Tagen immer kleiner. Die zwei Gestalten auf der anderen Straßenseite umarmten sich lange und schienen dann bereit zum Gehen. Der junge Mann mit den Verbrecherohrläppchen nahm dem Reisenden die Tasche ab und deutete in eine Richtung, in die der Bärtige auch gleich losmarschierte, während der andere sich noch einmal umdrehte und zurück zum Tor sah, vor dem er zuvor gestanden hatte. Einen Moment lang schien er sich über irgendetwas unschlüssig zu sein, Lecoq konnte es spüren. Dann trat er vor, riss mit einer einzigen ruckartigen Bewegung einen weiteren Zettel von dem Brett, zerknüllte ihn, trat drei Schritte auf den Mülleimer zu, drehte sich erneut um, unschlüssig, hektisch, und warf das Papier schließlich auf den Boden, bevor er dem Bärtigen mit eiligen Schritten hinterherrannte.
Lecoq sah ihm nach und wippte mit den Knien. Wäre dies ein Auftrag gewesen, hätte er die beiden Männer nun in sicherem Abstand verfolgt. Doch es war kein Auftrag, nur die zufällige Entdeckung eines weiteren potenziellen Verbrechers – eine mehr oder weniger zufällige Entdeckung, Lecoq wusste schon, warum er sich trotz der kleinen Gläser immer wieder in dieses Café setzte. Alle neuen Verbrecher mussten irgendwann an einem der Pariser Bahnhöfe ankommen. Die Bahnhöfe waren die Nadelöhre für den Dreck, der in das Stadtzentrum und in die Außenbezirke gespült wurde, in die Banlieus, wo das Leben kürzer war und die Armut größer. Wäre auch nur einer dieser jungen Pariser Polizistentölpel mit Lecoqs Talent ausgestattet, hätte man die Verbrecher gleich abfangen können, bevor sie ihre Taten begingen.
Er sah, wie das Mädchen in Lila zum nächsten Café stakste. Sie hatte dünne, lange Beine, auf denen sie sich bewegte, als seien sie ihr unerwartet über Nacht gewachsen. Irgendwo würde sie jemanden finden, der lange genug die Luft anhalten konnte, um ihren Veilchenduft zu ertragen.
Die Nachmittagssonne und der Wein machten Lecoqs Kopf schwer. Er hätte sich längst etwas zu essen bestellen sollen, aber er hatte parat sein wollen, um gleich aufzuspringen, wenn seine ermittlerischen Fähigkeiten gefragt waren. Jetzt ärgerte ihn sein Verhalten. Noch nach 17 Jahren, die er nicht mehr für die Sûreté arbeitete, benahm er sich wie ein Bluthund, den man an die Kette gelegt hatte, sobald er eine verdächtige Gestalt sah. Und dabei sollte er doch gerade selbst das nächste große Verbrechen planen.
Er entdeckte einen letzten Rest Wein auf dem Boden des Glases, dort, wo der Stiel auf den tulpenförmigen Bauch traf, doch der Tropfen wollte auch dann nicht herausfließen, als er den Kopf in den Nacken legte und das Glas senkrecht hielt, mit der Öffnung über die Nase gestülpt. Auf halbem Weg zu seinen Lippen blieb er an der Glasinnenseite hängen, sosehr Lecoq auch die Luft einsog. Er stellte das Glas ab. Sein Blick fiel auf den Mülleimer auf der anderen Straßenseite. Was war schon dabei, wenn er sich ansah, was der Mann da weggeworfen hatte? Das hatte doch nichts mit Schnüffeln zu tun. Und nachgehen würde er den Männern ja zumindest nicht, so viel stand fest. Er blickte die Straße hinunter. Die Verdächtigen waren bereits verschwunden.
Lecoq legte das Geld für die Getränke auf den Tisch, dazu ein Trinkgeld von 15 Centime. Das war mehr, als er sich leisten konnte, aber vielleicht würde es dem Kellner bei seinem nächsten Besuch helfen, ein größeres Glas zu finden.
Er steckte die Hände in die Taschen und schlenderte über die Straße wie ein harmloser Passant.
Der Aushang im Abfalleimer war das Erste, worum Lecoq sich kümmerte. Er lag zuoberst auf einem kleinen Haufen Zeitungen. Lecoq hatte einen politischen Aufruf erwartet, ein revolutionäres Flugblatt oder irgendein anderes Dokument brisanten Inhalts und fand es fast ernüchternd, dass sich lediglich ein paar knapp bekleidete Frauen vor ihm entfalteten. Warum sollte jemand so ein Plakat entsorgen? Religiöse Gründe? War der Mann vielleicht ein Moralapostel? Man mochte es sich schon vorstellen, bei dieser unsicheren Körperhaltung, schmal und aufrecht, wie auf einen Stock gesteckt. Und dann die steife Art, mit der sich die Männer umarmt hatten.
Lecoq trat in den Schatten der Säule und bückte sich nach dem zweiten Blatt, das der Verdächtige weggeworfen hatte. Es war deutlich älter und mitgenommener, Bleistift auf altem Papier, eine leicht vergilbte Seite, nicht einmal alle Wörter waren mehr lesbar. Und obendrüber ein Zeichen, das ähnlich aussah wie das Symbol einer Kirche, doch das Kreuz schaute nach unten. Es war das Planetenzeichen des Merkurs.
Lecoq straffte das Blatt und zog es in die Breite, bis die Falten sich glätteten. Er versuchte die krakelige Schrift zu entziffern und murmelte die Worte vor sich hin, um ihren Klang zu erfassen.
»Mouf…et s…s t…rre, mouffette s…s t…rre, mouffette sans terre?« Seine ergrauenden Augenbrauen berührten sich in der Mitte, als er die Stirn in Falten legte. Er ging die Buchstaben erneut durch, doch es schien keine andere Möglichkeit zu geben. Mouffette sans terre, das hieß: Stinktier ohne Erde. Er drehte das Blatt um 90 Grad in die eine und die andere Richtung, doch an der Bedeutung änderte sich dadurch nichts. Mit einer Handschriftenanalyse würde man natürlich Hinweise auf den Verfasser finden, wenn man wollte: auf sein Geschlecht, sein Alter, seine kriminalistischen Absichten et cetera. Aber wollte man? Nein, wollte man nicht, entschied Lecoq. Was für einen Sinn sollte es schon haben, eine Notiz zu analysieren, die man nur gefunden hatte, weil ein Ausländer mit Verbrecherohrläppchen sie von der Wand gerissen hatte – noch dazu, wenn man das mit dem Ermitteln längst aufgegeben hatte. Er klappte sein Notizbuch zu und betrachtete dann noch einmal das Papier der Nachricht genauer. Die rechte Kante war ungleichmäßig ausgerissen und die Oberfläche beschädigt. Es war dünn, so dünn, wie nur Seiten in Gebetsbüchern oder Bibeln waren. Wenn Lecoq es schräg gegen den Himmel hielt, konnte er das Licht durchscheinen sehen. Er kannte jemanden, der das Alter des Buchs bestimmen konnte, allein anhand dieser Seite. Ein befreundeter Antiquar. Wenn Lecoq wollte, könnte er ihm jetzt noch einen Besuch abstatten. Aber man wollte ja nicht.
Energisch faltete er das Blatt zusammen und steckte es zu seinem Notizbuch in die Manteltasche.
Paul und Jori hatten sich an jenem Tag kennengelernt, als beide zum ersten Mal ihren Fuß in die obere Klasse des Zürcher Gymnasiums setzten: Paul in seinen Bally-Schuhen und Jori in Schnürstiefeln, unter denen noch der Dreck vom heimatlichen Hof klebte – auf dem Weg zur Postkutsche hatte er über das Feld laufen müssen.
Für die Dauer der Ausbildung sollte Jori bei seinem Onkel in Zürich wohnen und nur am Wochenende nach Hause kommen. Das hatte die Mutter so entschieden und irgendwie gegen den Vater durchgesetzt. Jeder im Ort wusste, dass die Mutter nicht glücklich mit ihrem Leben war, dass sie keine Bäuerin war wie die anderen Frauen der Gemeinde. Man sah es an ihrer Körperhaltung und an den vorsichtigen Schritten, mit denen sie sich über den Hof bewegte. Von Zürich aufs Land zu ziehen, um einen Bauern zu heiraten, war ihr Entschluss gewesen, doch ihren Sohn wollte sie da nicht mit reinziehen, Jori sollte selbst einmal entscheiden können, ob er den Hof übernahm oder nicht. Was das betraf, tat die Mutter immer so, als sei Jori allein ihr Sohn und nicht der des Vaters. Als hätte sie ihn sowieso geboren, egal ob in Zürich oder Finsterhennen.
Paul, mit seinen gestriegelten Haaren und der tadellosen Kleidung jedenfalls, hätte sich optisch nicht mehr von Jori unterscheiden können, und trotzdem fanden die beiden Jungen zueinander – vielleicht wegen des Taschenmessers, mit dem Paul Joris Schnürsenkel eines Tages vom Stuhlbein abschneiden musste. Pauls Taschenmesser hatte fünf Klingen, die immer gut geschliffen waren, und Jori durfte jede einzelne von ihnen zum Stöckeschnitzen benutzen, wenn er wollte. Es war der Beginn einer tiefgehenden Freundschaft.
Auch Paul wohnte nur unter der Woche in Zürich und kehrte am Freitagabend zu seinen Eltern zurück, die eine gute Gehstunde entfernt am Ufer des Zürichsees wohnten. Die restliche Zeit verbrachten die beiden Jungen gemeinsam, meistens am Ufer der Limmat oder rücklings auf der Wiese im Botanischen Garten liegend. Wenn sie zusammen lernten, hielt Jori das Schulbuch an lang ausgestreckten Armen gegen die Sonne und las die Texte und Aufgaben laut vor, während Paul mit einem gebügelten weißen Taschentuch auf der Stirn im Schatten lag. Aus einem Grund, den kein Arzt feststellen konnte, hatte Paul ständig Kopfschmerzen und musste schließlich die erste Klasse des Gymnasiums wiederholen. Und Jori, der sich einen Unterricht ohne Paul nicht vorstellen konnte, wiederholte freiwillig mit ihm. In diesen Tagen glaubte Jori fest daran, dass es keinen Menschen auf der Welt geben konnte, den er je so gernhaben würde wie Paul. Und dann kam Pauline.
Jori war fast einen Kopf kleiner als sie, als er sie zum ersten Mal sah, doch schon die Kinnhöhe reichte für eine Bewunderung, die an Andacht grenzte. Denn Pauline, mit ihren geflochtenen Zöpfen, der blassen Haut und den strahlenden Augen, die immer in die Ferne blickten, als erwarteten sie Großes von der Welt, sah nicht nur wie das goldig Bethli aus Joris altem Märchenbuch aus, sondern war auch das perfekte weibliche Spiegelbild ihres Bruders.
»Das ist meine Schwester«, sagte Paul überflüssigerweise, und fast hätte Jori sich verneigt. Er dachte an den Dreck unter seinen Sohlen, der dort immer noch oder schon wieder hing, tief in die Rillen geklemmt, so tief, dass nur Jori wusste, er war da. Nervös wischte er sich die Hand an der Hose ab und steckte sie dann doch bloß in die Tasche.
Pauls Eltern waren geschäftlich mit der Kutsche nach Zürich gekommen und hatten Pauline mitgebracht. Und als diese gehört hatte, dass Paul und Jori verabredet waren, hatte sie unbedingt mitgenommen werden wollen.
Jori hatte nichts dagegen, im Gegenteil. Nur war das, was er entdeckt hatte und Paul an diesem Nachmittag zeigen wollte, ganz sicher nichts für Mädchen, und das verkündete er nun auch entschuldigend. Er wusste ja noch nicht, dass Pauline selbst entschied, was für Mädchen angemessen war und was nicht. Und dass ein Nein für sie überhaupt nur funktionierte, wenn es von ihr ausging.
Am Ende machten sie sich also zu dritt auf den Weg zu der Bahnschiene am grasbewachsenen Berghang, ein paar Hundert Meter oberhalb des Sees. Es war ein schöner Tag, der Himmel trug Wolkenschleier, und die Wiese lockte zum Hineinlegen, doch Jori hatte nur Augen für Pauline, die viel lachte, während sie sprach. Sie hatte eine schöne Stimme, die Jori sich gut in Begleitung eines Klaviers vorstellen konnte, und ständig lachte sie, ein helles, zerbrechliches Lachen. Wenn Jori zu jenem Zeitpunkt doch nur schon gewusst hätte, wie zerbrechlich es war.
An einer Stelle gab es unter den Bahnschienen ein Loch, etwa doppelt so groß wie ein Dachsbau, aber breiter, und sie quetschten sich zu dritt hinein, nachdem Pauline versichert hatte, dass das Kleid, das sie trug, ohnehin schon alt war. Sie kicherte, als sie unter die Schiene krabbelte, um sich flach auf den Rücken zu legen, den Blick zum Himmel hinter den Verstrebungen aus Holz und Eisen gerichtet. Rechts von Pauline lag Jori in der gleichen Stellung, und links kroch Paul als Letzter hinzu. Jori konnte in seinen Augen sehen, dass er Angst hatte.
»Wie spät ist es?«, fragte Jori, und Paul versuchte im Liegen an seine Taschenuhr zu kommen.
»Genau sechs nach vier.«
»Dann noch drei Minuten.«
Sie lagen schweigend und mit klopfendem Herzen da und warteten. Dann war plötzlich in der Ferne ein Rumpeln zu hören. Die Bahnschienen über ihnen begannen zu zittern, als das Geräusch näher kam, es war, als hätte es das schlafende Eisen aufgeweckt, als fließe plötzlich Blut durch die Schienen. Joris Schulter berührte die von Pauline, er spürte, wie sie sich verspannte und ihr Atem schneller ging. Er selbst hielt die Luft an. Das Rumpeln wurde noch lauter, es schwoll zu einem Poltern an, ba-bam, ba-bam, ba-bam. Die Bahnschienen begannen zu beben und zu hüpfen, sie stemmten sich gegen die Nägel, die sie am Boden festhielten. Lauter und noch lauter wurde der Zug, dann schrie Paul plötzlich auf, und Jori fuhr zusammen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie der Freund mit dem Kopf gegen die springenden Schienen stieß, als er sich aufrichtete und entsetzt aus dem Loch robbte. Pauline neben Jori zuckte ebenfalls zusammen und blickte Paul nach, offensichtlich trieb sie der Impuls, ihrem Bruder zu folgen. Verunsichert drehte sie das Gesicht zu Jori, doch es war zu spät für ein Wort oder auch nur ein aufmunterndes Lächeln. Der Zug gab ein Tuten von sich, und im nächsten Moment wurde es in dem Loch auch schon schlagartig dunkel, und die Lok ratterte ohrenbetäubend laut über sie hinweg, sie schraken zusammen, beide gleichzeitig, Pauline griff nach Joris Hand, oder vielleicht war es auch umgekehrt, in der Dunkelheit verschränkten sich ihre Finger und drückten ineinander, während die Zugräder nur wenige Zentimeter über ihren Gesichtern Funken sprühten. Jori spürte Paulines Schulter an seiner, er spürte, wie sie zitterte, und dachte daran, dass sie bestimmt die Augen zusammenkniff. Doch in Wahrheit starrte sie genauso fasziniert wie er auf die Lichtstreifen, die wie Blitze aufleuchteten, wo ein Zugwaggon aufhörte und der nächste begann. Dann wieder Funken. Das Zittern in Paulines Schulter nahm zu, jetzt erst merkte Jori, dass sie lachte. Sie lachte mit weit geöffnetem Mund zu den Schienen hinauf, und es war ein befreiendes, irgendwie verzücktes Lachen, das im Lärm des Zuges unterging, ein Lachen aus vollem Hals, das noch anhielt, als der letzte Waggon über sie hinweggedonnert war. Jori blickte Pauline an, die Sonne schien jetzt wieder in ihr Gesicht, und er konnte gar nicht anders, als in ihr Lachen einzustimmen. Sie gackerten ihre Erleichterung aus den angespannten Hälsen hinaus, während das Rattern und Tuten des Zuges sich in der Ferne verloren. Und noch immer hielten sie sich an den Händen.
»Sie wird bald sechzehn«, sagte Paul später leise zu Jori, als sie über die Wiese zurückschlenderten und Jori und Pauline sich immer wieder verschämte Blicke zuwarfen und grinsten. Er sagte es verstimmt und so, als mache das irgendeinen Unterschied für Jori. In der Schule hatten sie gerade den Dreisatz und Bruchrechnen gelernt, und Jori war gut darin: Er wusste, wenn er erst einmal achtzehn wäre, würde Pauline zweiundzwanzig sein, und wenn er zwanzig wäre, würde sie vierundzwanzig sein. Damit wäre sie dann nur noch zwei Zehntel älter als er. Zwei Zehntel, was war das schon. Das waren zwei von zehn Kuchenstücken oder eine von fünf Murmeln, an die würde Jori sich bestimmt nicht klammern. Wozu brauchte man schon Murmeln.
Das letzte Stück den Hang hinunter bis zur Stadt rannten sie über das Gras.
Man roch die Frau, bevor man sie sah. Ihr Urin tropfte gelb von der Matratze, auf die sie für die Vorführung gelegt worden war, und der Geruch nach krankem Kot empfing die zwölf Männer wie eine höhnische Umarmung.
Das war wieder typisch für Anabelle Bouchon. Jedes Mal, wenn sie von den Pflegerinnen aus dem Bett geholt und für die Besucher zurechtgemacht wurde, ließ sich kein Tropfen Flüssigkeit aus ihrem hageren Körper pressen – und selbst mit Klistierspritzen war sie nicht zum Koten zu bewegen. Doch sobald man sie aus dem Schlafsaal isolierte und die Männer sich auf dem Rundgang dem Vorführbett näherten, zahlte sie ihnen ihr Interesse regelrecht heim.
Die nobleren Besucher der Runde hielten sich dezent ein mit Chlor getränktes Taschentuch vor die Nase. Andere setzten eine betont gleichgültige Miene auf und sahen über den Gestank hinweg, als seien sie derlei Gerüche längst gewohnt, abgehärtete und erfahrene Ärzte, denen so schnell nichts etwas anhaben konnte. Doch auch ihre Augen flackerten bei jedem Schrei, der aus den überfüllten Räumen drang, unruhig hin und her. Die Salpêtrière mochte die berühmteste Klinik in ganz Frankreich sein. Sie mochte die modernste sein. Doch nichts konnte über die Tatsache hinwegtäuschen, dass inmitten all dieser Modernität rund 4000 Kranke, Alte und Verrückte lagen, die jammerten, weil sie starben, oder heulten, weil sie noch lebten.
Jori sah zu Paul hinüber. Die widerwillige Faszination, die vom Anblick der angebundenen Körper ausging, hatte auch ihn ergriffen. Charcot hatte die Anstalt einmal als lebendes pathologisches Museum bezeichnet, und die Beschreibung hätte nicht treffender sein können. Alles, was man sonst nur aus dem Lehrbuch und von Zeichnungen kannte, war hier vereint, sorgsam auf die insgesamt 80 Gebäude verteilt und nach Krankheitsbild und Chancen der Genesung geordnet. Unter Charcot hatte sich die Salpêtrière von einem Hospiz zu einem gigantischen Forschungszentrum entwickelt, in dem es einen ständigen Nachschub an Kranken gab. Es ging nicht mehr allein darum, die Irren zu verwahren und den Alten beim Sterben zuzusehen. Es ging um Wissenschaft. Darum hätte die Klinik sich gar keinen Besseren ins Haus holen können als Doktor Jean-Martin Charcot.
Am Kopfende des Bettes hob Georges Guinon gerade die Mappe mit dem Krankenbericht: »Und bei dieser Patientin handelt es sich um eine 43-jährige Spastikerin. Sie wurde vor sechs Jahren bei uns eingeliefert und litt zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren an schlagartig auftretenden Verkrampfungen der Gliedmaßen, die vor allem die linke Körperhälfte betrafen. Das Gesicht war hiervon ausgenommen.« Er hielt inne und suchte in der Kartei nach einer Information, die er vergessen haben könnte. Guinon war seit etwas mehr als einem Jahr der Assistent von Jean-Martin Charcot und als solcher für die Sekretärsarbeiten zuständig. Er musste Anamnesen protokollieren, Bericht erstatten und bei den Vorführungen assistieren. Aber Jori war sich ziemlich sicher, dass der 35-Jährige inzwischen auch alle möglichen anderen Arbeiten für den Nervenarzt übernahm. Und er tat es mit einer Lust und Unterwürfigkeit, die Jori anekelte. Wo immer Charcot auftauchte, konnte der staubleckende Guinon nicht weit sein. Er folgte ihm über das Gelände der Salpêtrière wie ein Schoßhündchen, immer einen Schritt hinter seinem Herrn, liebdienerte und schnappte nach jedem, der Charcot zu nahe kam. Aber er war ein Angstbeißer, das sah man, sobald man Guinon ohne sein Herrchen begegnete. So wie heute. Charcot war zu einem Vortrag außerhalb der Stadt eingeladen und hatte seinen Assistenten deshalb allein auf den Besucherrundgang durch die Anstalt geschickt, der jeden Dienstagnachmittag vor der großen Leçon du Mardi stattfand. Und obwohl Guinon mit den Patientinnen vertraut war und Charcot bei dessen wöchentlichen Erläuterungen so sehr an den Lippen hing, dass er dessen Worte auswendig herunterbeten konnte, stand der Assistent nun mit hängenden Schultern da und nuschelte die Krankengeschichte in seinen Bart, als wolle er sie und sich darin verstecken.
»Es ist wichtig, dass unsere Patientinnen gute und regelmäßige Monatsblutungen haben. Bei dieser Kranken hier aber blieb die Regel häufig aus, dann kam sie wieder heftig. Beides führt bekannterweise zur Entwicklung hysterischer Störungen. Wir haben dem mit warmen Sitzbädern Abhilfe geschaffen, fünf pro Woche, à dreieinhalb Stunden. Zur Unterstützung behandelten wir sie außerdem mit der Ovarienpresse, einem Gerät zur Druckausübung auf den Unterleib, deshalb auch Eierstockkompressor genannt. Das Befinden besserte sich zunächst, dann begannen die Spastiken auf der rechten Körperhälfte und befielen im März ’79 auch das Gesicht. Die Krämpfe können spontan auftreten, besonders bei Annäherung oder durch Körperberührung, weswegen wir von einer hysterisch bedingten Spastik ausgehen. Dafür spricht auch der instabile Nervenzustand der Patientin.«
Es war kaum auszuhalten. Von Charcot geleitet glichen die Führungen durch die Gebäude dem faszinierenden Besuch eines Gruselkabinetts auf dem Jahrmarkt. Der berühmte Nervenarzt fand stets die richtige Mischung aus körperlichen Anomalien, offenen Rücken, hysterischen Schönheiten, Essensverweigerinnen und schwindsüchtigen Greisinnen, um das Interesse des Publikums zu fesseln und die Spannung bis zum Schluss aufrechtzuerhalten – nicht zuletzt deshalb, weil er zu jeder Patientin eine amüsante Anekdote zu erzählen hatte. Und gerade um Pauls willen ärgerte es Jori, dass sie ausgerechnet heute mit Guinon abgespeist wurden, der die Krankenakten herunterlas wie ein Kochrezept und sich auf die nackten Diagnosen beschränkte.
»Die Spastiken lassen sich am leichtesten im Gesicht auslösen. Ich werde dies nun anhand einer Demonstration vorführen.«
Der Rundgang durch ein Leichenschauhaus hätte nicht ermüdender sein können. Und dabei war Anabelle, trotz all ihrer Unarten, einer der anschaulichsten Fälle in der Salpêtrière. Unter Hypnose konnte sie mit ihrem Körper alle vier Phasen des hysterischen Bogens vorführen und streckte den Zuschauern eine krampfende Zunge entgegen, wenn man ihr mit einem Stab gegen den Kehlkopf drückte. Aber für eine solche Darbietung war natürlich eine entsprechende Einführung notwendig. Man musste die Zuschauer neugierig machen, ihre Sensationslust wecken. So wie Guinon es anstellte, würden die Männer sich noch nicht einmal die Mühe machen, die Hälse zu recken, um dem Schauspiel folgen zu können.
Der Assistent zog einen Holzstift aus der Tasche, mit dem er sich Anabelle unsicher näherte. Die Kranke riss die Augen auf, versteifte sich in ihrem Bett und drückte den Rücken durch, bis Kopf und Hals tief in das Kissen gepresst waren. Einen Moment lang sah es so aus, als ob sie schreien wollte, dann aber verkrampfte sich lediglich ihr linker Mundwinkel und zog sich in Richtung Kinn. Sie brachte den Kopf auf die rechte Seite, um Guinon und dem hölzernen Werkzeug auszuweichen. Guinons Hand zitterte. Unbeholfen versuchte er, die Stelle an Anabelles Kehlkopf zu treffen, die den Anfall auslösen sollte, aber sie drückte die rechte Gesichtshälfte nur noch stärker ins Kissen und entwand sich dem Instrument. Guinon musste fast blind stochern und rutschte mit dem Stab immer wieder ab. Jori sah die Schweißperlen auf der Stirn des Assistenten, der einen Schritt zur Seite machte, um Anabelles Hals besser zu erreichen, und nun fast auf der Patientin lag, was peinlich war, peinlich und sehr unprofessionell, denn er stellte sich dabei genau ins Blickfeld der umstehenden Besucher. Jori warf einen Blick auf Paul, der völlig zu Recht enttäuscht dreinblickte, und hatte das Bedürfnis, sich für Guinons Verhalten zu entschuldigen. Doch noch in diesem Moment stieß Anabelle endlich den gurgelnden Schrei aus, der den Anfall ankündigte. Es klang, als ertrinke sie in ihrem Bett. Wie auf Kommando drängten die Männer vor, um an Guinon vorbeizusehen und einen Blick auf das Gesicht der Patientin zu erhaschen. Man hatte sie ihrer Sicht genau in dem Moment beraubt, als der Anfall ausgelöst wurde. Das war zwar ein Ärger, erregte aber auch die Spannung, schließlich wollten sie die Krämpfe beobachten, die man ihnen versprochen hatte: den verzogenen Mund, die gespenstischen Augen, die zuckende Masse der 50 Muskeln, die sich nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen unter der Gesichtshaut verbargen. Jori sah die Gier in Pauls Augen, legte die Hand auf die Schulter des Kameraden und brachte den Mund nahe an sein Ohr.
»Wenn dir das gefällt, mein Freund, dann warte erst mal die Leçon ab!«
Paul nickte abwesend. Er drehte sich nicht zu Jori um.
Seit 1823 hieß die Salpêtrière offiziell »Hospice de la Vieillesse-Femmes«, das Altershospiz für Frauen. Doch obwohl es tatsächlich mehr ein Hospiz als ein Krankenhaus war, da man in den meisten Fällen nicht herkam, um zu genesen, sondern um zu sterben, bildeten den Großteil der Insassen noch immer die Nervenkranken und Verrückten. Paul staunte über die Größe der Klinik, über die Parks, Gärten und Springbrunnen, die zwischen den einzelnen Gebäuden lagen. Er staunte über die Modernität des Fotostudios, in dem ebenjene Aufnahmen der Hysterikerinnen gemacht wurden, die man in allen medizinischen Fachzeitschriften fand. Und er staunte über den Raum, den Charcot extra für die Anfertigung von Gipsabdrücken eingerichtet hatte. Dort ließ er lebensgroße Figuren herstellen, Kopien der Kranken, die dann in seinem Museum ausgestellt wurden. Es glich einem kuriosem Wachsfigurenkabinett, dieses Museum, und seit Charcot es vor neun Jahren im Keller der Division Pariset eingerichtet hatte, war es sein erklärtes Ziel, es jeden Tag um eine neue anatomische Absonderlichkeit zu bereichern, um einen Gipsabguss, eine Fotografie, ein Skelett, einen deformierten Knochen oder eine Zeichnung. Es war das tote Pendant zu dem lebenden Museum, das Charcot bei seiner Ankunft an der Salpêtrière vorgefunden hatte – und doch wirkte es überhaupt nicht tot. Links neben der Eingangstür lag eine alte Syphiliskranke auf einer Matratze, nackt und abgemagert bis auf die Knochen, die unter der matt glänzenden Haut hervorstachen. Die eine Hand ruhte abgeknickt auf dem Bett, die andere auf ihrem Schambein. Und man musste schon nahe genug herantreten, um zu sehen, dass es sich nur um eine Wachsfigur handelte. Selbst der halb geöffnete Mund und die kurz geschnittenen Haare wirkten so echt, dass man meinte, es hafte noch ein Geruch nach Krankheit an ihr.
Hinter der Alten stand die Büste einer weiteren Frau, deren Gesicht durch eine halbseitige Lähmung entstellt war. Sie hielt ein Taschentuch in der rechten Hand und sah aus, als sei sie erschrocken über die Gruppe der Männer, die da in den Raum trat.
Erst dort, wo die Frauen nicht mehr aus Wachs waren, endete Pauls Begeisterung. Er konnte mit dem Leid nicht umgehen, das sich in den Schlafsälen anhäufte. Die Räume stanken trotz der verbesserten Belüftungssysteme. Und das Klagen und Schreien der Gefesselten in den Betten machten ihm zu schaffen. Eine Frau, die man nicht festgebunden hatte, warf sich plötzlich vor den Männern auf den Boden. Sie simulierte einen Anfall, und drei kräftige Wärterinnen waren nötig, um sie festzuhalten und fortzubringen.
Jori bemerkte, wie Paul sich dichter bei der Gruppe hielt, wenn er solche Dinge mit ansah, und wie sein Gesicht sich veränderte. Die Eindrücke drangen in ihn, mehr als dass er sie freiwillig in sich aufnahm, und sie würden sich dort festsetzen und ihn nie wieder verlassen, das wusste Jori aus Erfahrung. Doch Paul würde sich daran gewöhnen, dachte er, er würde sich daran gewöhnen, wie alle hier.
Nach der Rundführung machten sie sich auf den Weg zum Auditorium, in dem es bereits von Ärzten, Studenten, Schriftstellern, Journalisten und Schauspielern wimmelte. Wie immer hatte sich tout Paris vor der Bühne des großen Jean-Martin Charcot versammelt.
Paul und Jori gesellten sich zu einer Gruppe junger Männer, die am Eingang standen und sich unterhielten. Zwei der vier Gesichter in der Runde kamen Jori bekannt vor, wobei es eigentlich nur ein Gesicht in doppelter Ausführung war. Es gehörte zwei dicklichen Brüdern, die als Praktikanten in der Apotheke aushalfen und bis hin zu einer breiten Lücke zwischen den Schneidezähnen so exakt gleich aussahen, dass Jori sie insgeheim Chang und Eng Bunker taufte, nach dem ersten Siam-Zwillingspärchen, das jemals wissenschaftlich beschrieben worden war.
Außer Chang und Eng war noch ein Medizinabsolvent aus Südfrankreich unter den Männern, der wie Jori an die Salpêtrière gekommen war, um von dem berühmten Jean-Martin Charcot in die Geheimnisse der Hysterie eingeführt zu werden, sowie zwei Intellektuelle aus Montmartre, denen man ansah, dass ihnen eine Einführung in die Frauen selbst wohl am liebsten gewesen wäre. Seit das Gerücht die Runde gemacht hatte, im Auditorium der Salpêtrière ginge es dienstagabends nicht weniger zügellos zu als im Moulin Rouge, war ein Besuch von Charcots Vorlesungen für die Boheme ebenso obligatorisch wie der offene Mantel und die Zigarre, die sie leger im Mundwinkel trugen.
»Man munkelt, dass Charcot die Frauen durch das Aktivieren bestimmter Druckpunkte auf ihrer Gebärmutter zum Tanzen bringt«, sagte einer der Zigarrenträger gerade. »Man sagt, er habe ein Werkzeug, das Sex Bâton heiße. Und mit dem kann man die Weiber dazu bringen, zu kreischen und Verrenkungen zu machen, bis das eine oder andere Kleid verrutscht. Ein guter Bekannter von mir war vor zwei Wochen hier und hat mir von einer erzählt, bei der der Kittel bis zum Bauchnabel hochgerutscht ist.« Er zeigte die Höhe mit der Hand, wohl für den Fall, dass die Medizinstudenten vergessen hatten, wo der Bauchnabel sich befand. Neid blitzte in allen Augen. »Haben Sie davon gehört, Eugén?«
Alle Blicke wandten sich Paul zu. Solange Jori denken konnte, hatte dieser sich immer mit Eugen Bleuler vorgestellt. Jori war der Einzige, der den Freund bei seinem ersten Vornamen nannte: Paul, der Bruder von Pauline. Es machte die Beziehung zwischen Paul und Jori zu etwas Besonderem, und dennoch störte ihn die Art und Weise, wie der Franzose den Namen aussprach: Eugén, mit der Betonung auf der letzten Silbe und das »g« halb verschluckt, als hätte man den Namen bereits ins Französische integriert und Paul gleich mit. Paul zuckte die Schultern.
»Ich habe nicht gewusst, dass man einen Sex Bâton braucht, um die Frauen zum Kreischen zu bringen«, sagte er in seiner steifen Art und seinem ungelenken Französisch, dessentwegen der Zigarrenträger wohl einen Moment länger brauchte, um den Scherz zu verstehen. Dann brachen er und sein Freund in ein geradezu unintellektuelles Gewieher aus, und Chang und Eng schoben ihre speckigen Wangen zur Seite, um ihre Zahnlücken zu zeigen. Andere Männer im Raum blickten zu der Gruppe hinüber, neugierig und zugleich enttäuscht, einen guten Witz verpasst zu haben. Oder einen schlechten, wie Jori fand.
Paul hatte bislang herzlich wenig Frauen zum Kreischen gebracht, Jori wusste es, und Paul wusste es auch. Obwohl sein Freund früher immer der beliebtere Kamerad in der Schule und im studentischen Bierverein gewesen war, immer der mit dem größeren Portemonnaie und den besseren Sprüchen, hatten sich die Mädchen jedes Mal eher für den stilleren Jori interessiert. Nicht, dass der sich etwas daraus gemacht hätte. Für Jori gab es nur ein Mädchen, und das war Pauline. Er hätte gut in einer Welt glücklich werden können, die nur aus der Familie Bleuler bestand, dann hätte er einen besten Freund gehabt und ein Mädchen, das er heiraten wollte.
Doch was Jori vollkommen unangebracht fand, war, dass Paul sich über Charcots Erfindungen lustig machte, keine zwei Stunden nach seiner Ankunft in Paris. Der Sex Bâton war großartig, Jori hatte ihn schon oft in Aktion gesehen, und zudem war er unabdinglich im Einsatz gegen die Hysterie. Hätte Charcot ihn nicht entwickelt, müsste man die hysterogenen Punkte noch immer mit der Faust bearbeiten.
Er war froh, als die Glocke schellte und den Beginn der Vorstellung ankündigte. Charcots neues Auditorium bot Platz für 400 Personen, und die meisten Männer beeilten sich, eine Sitzgelegenheit in den vorderen Reihen zu ergattern. Jori steuerte seinen Lieblingsplatz links außen an, von wo er und Paul einen tadellosen Ausblick genießen würden, ohne sich an den Beinen der anderen Zuschauer vorbeidrängeln zu müssen. Krampfhaft aufrechterhaltene Gespräche verebbten. Das Stimmengewirr wich einem mehrkehligen Gemurmel und Hüsteln. Eine Stimmung wie in der Kirche – das Spektakel konnte beginnen.
Charcot betrat den Raum durch einen Vorhang, gefolgt von Guinon, der sich sofort in den Schatten des Nervenarztes drückte. An der Seite seines Herrn hatte der Assistent zur alten Borniertheit zurückgefunden und zückte gewissenhaft Stift und Notizblock, um den Ablauf der Vorlesung zu dokumentieren. Die Mitschrift würde dafür sorgen, dass die Genialität von Charcots Inszenierungen auch für die Nachwelt erhalten blieb.