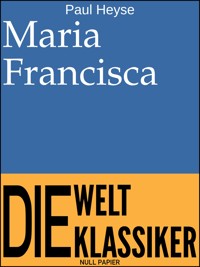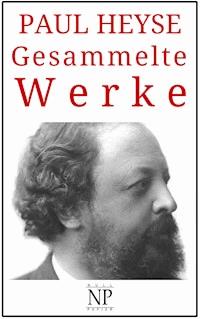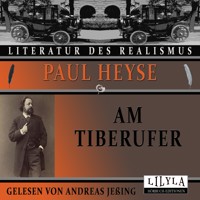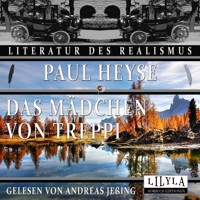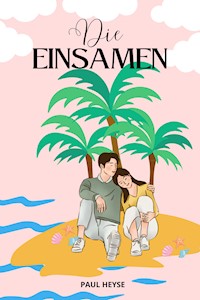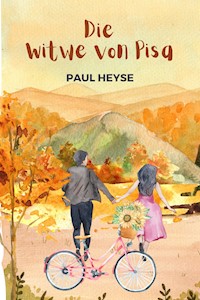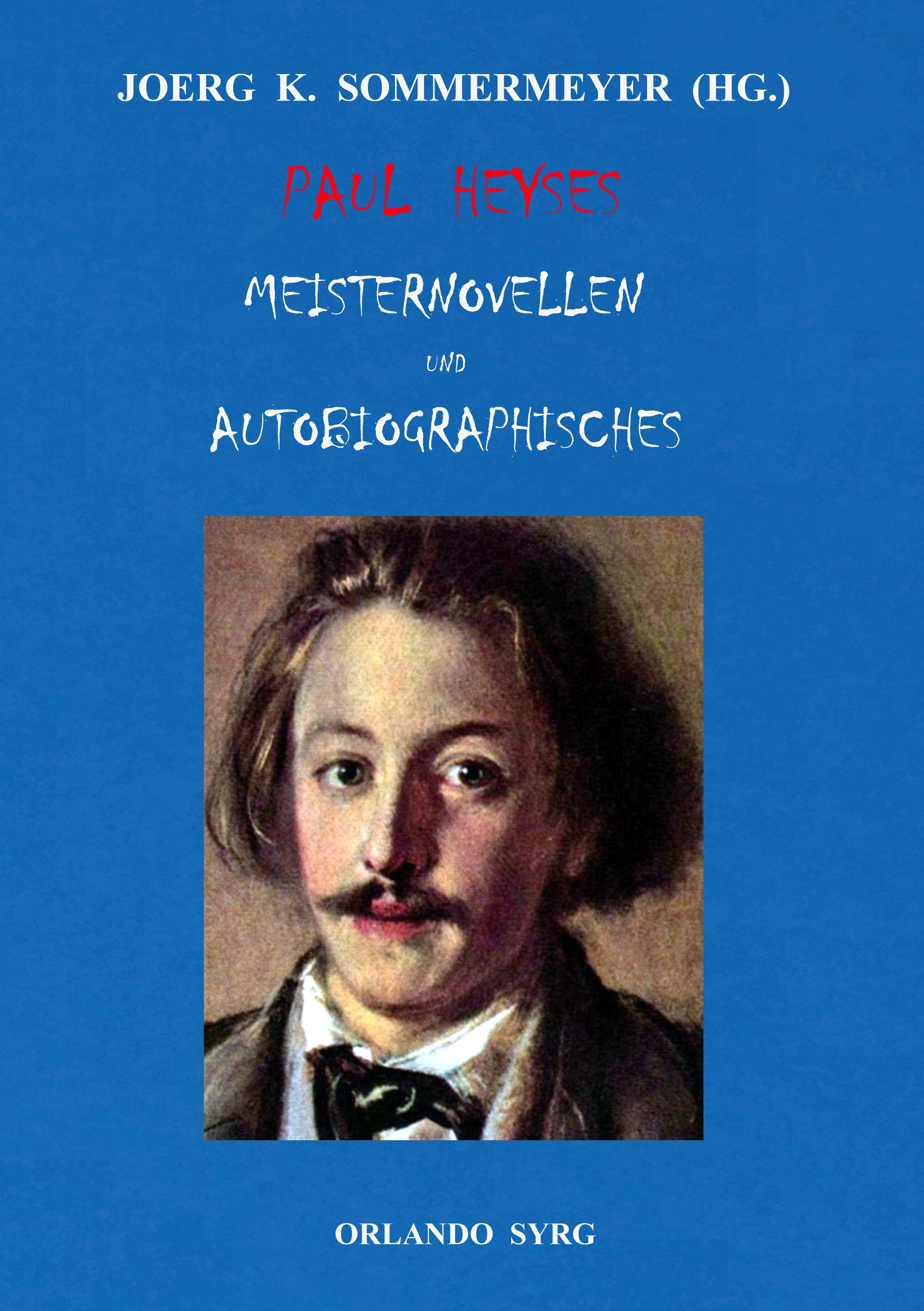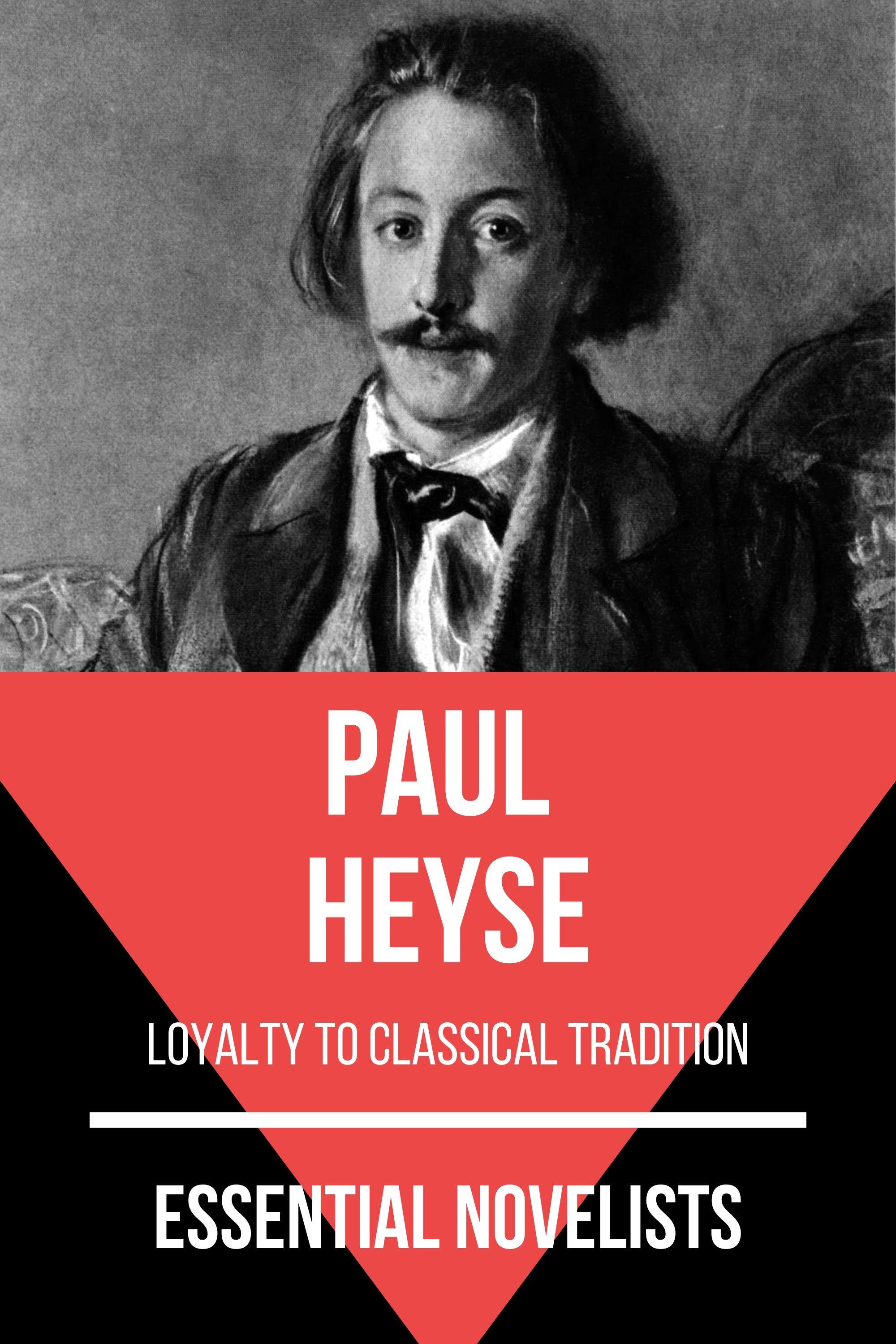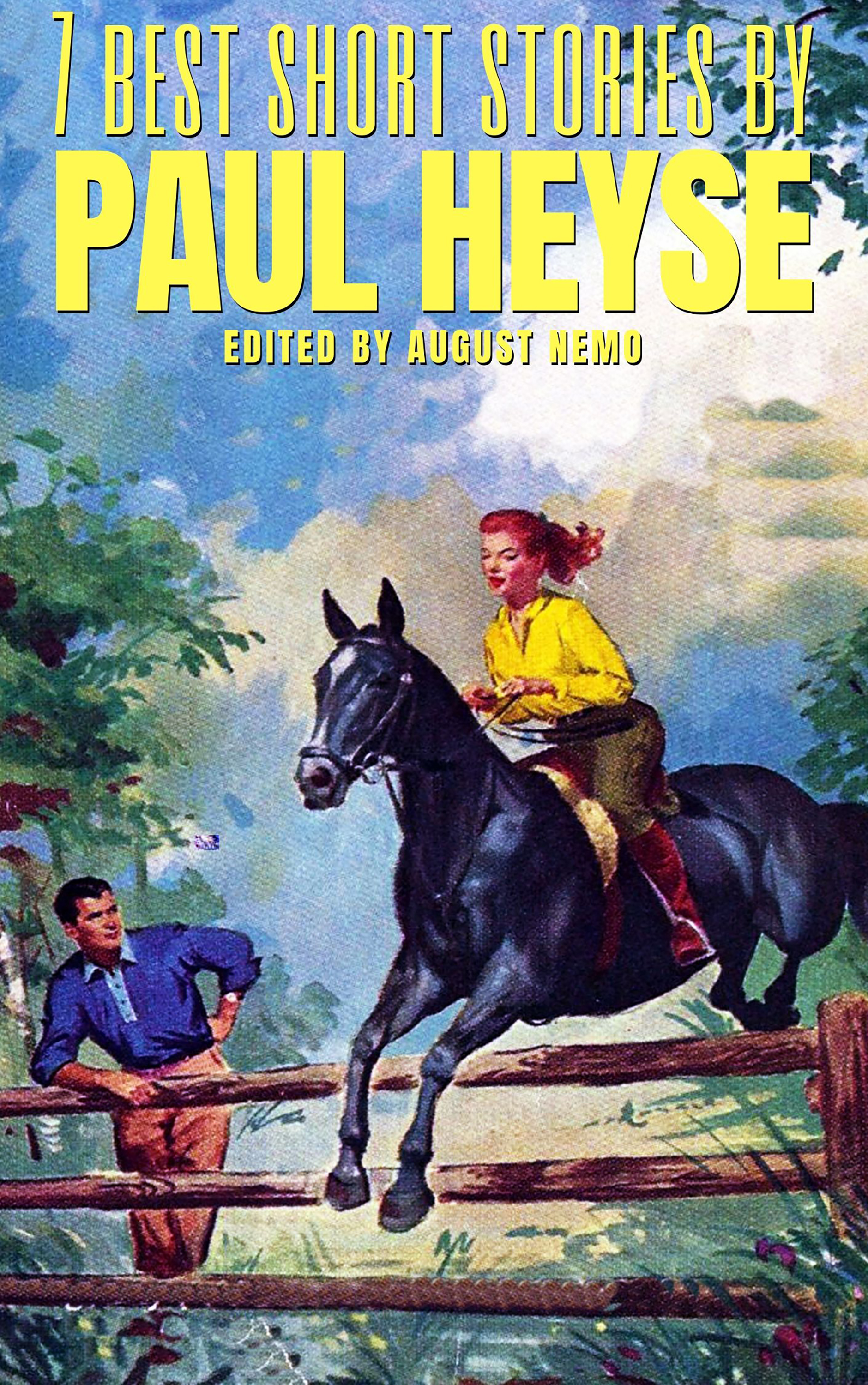Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Das Bild der Mutter
Novelle
Paul Heyse
Das Bild der Mutter
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-19-8
null-papier.de/neu
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Bild der Mutter
Seit vielen Jahren schon lebte in der Stadt die Witwe eines reichen Mannes, der in hohem Alter gestorben war und seiner jungen Frau Haus und Garten und ihre Freiheit hinterlassen hatte. Die schöne Anna zeigte wenig Lust, diese drei sicheren Güter, zu denen sich im Laufe der Zeit mehr als Ein Liebhaber meldete, gegen das ungewisse Gut einer neuen Ehe zu vertauschen. Sie zog es vor, ihre eigene Herrin zu bleiben, von ihrem Reichtum einen sinnigen und wohltätigen Gebrauch zu machen, in den schönen Gemächern ihres Hauses dann und wann die Freunde ihres verstorbenen Gemahls zu bewirten und sich die einsamen Stunden mit Musik, Blumenzucht und Lektüre zu vertreiben. Man sah sie oft im Theater und Konzert, nicht selten auch in der Kirche, überall ohne Scheinsucht und Gepränge, eine völlig anmutige Gestalt, deren Anblick einem jeden erfreulich war. Niemand fühlte sich veranlasst, auf ihre Kosten einige jener halblauten Geschichtchen herumzubringen, wie man sie jungen Witwen aus Missgunst auf die mancherlei Rechte ihrer freien Stellung anzuhängen pflegt. Auch näherte sie sich mehr und mehr der kühleren Zone des Frauenlebens, und die ernsthaften Gespräche, die sie mit ihrem Freunde, dem Domprediger, pflog, klangen aus ihrem Munde nicht drollig mehr, obwohl dieselben roten Lippen zu anderer Zeit im traulichen Kreise aufs Beste zu scherzen wussten, und ein kindlich träumerischer Zug die verständigen Augen noch oft umschwebte. Sie hatte mit ihrem alten Manne, der von kranken Launen vielfach heimgesucht war, eine friedliche Ehe geführt und mit ihrer gleichmäßigen Heiterkeit sein Haus durchwärmt. Ob sie selbst unerfüllte Wünsche dabei im Herzen niederkämpfte, vertraute sie Niemand, wie denn auch unter Allen, die später ihr Haus betraten, nicht Einer sich rühmen konnte, einen Vorzug zu genießen. Es war stillschweigend zum Gesetz geworden, dass die kleine Gesellschaft, die sich oft auch ungeladen um ihren Teetisch einfand, nie später als um Elf auseinanderging, und dass Alle zugleich aufbrachen. Wenn die alte Margot die Haustür hinter ihnen zuschloss, dachte wohl mancher bei sich, wie sehr es ihm behagen möchte, hier zu Hause und des Heimwegs überhoben zu sein. Nachgerade aber hielt man es für geratener, dergleichen fromme Wünsche nicht mehr bei der obersten Behörde vorzutragen, da zehn Jahre hindurch immer nur derselbe Bescheid erfolgt war.
In einer Nacht jedoch war es den Freunden der seltenen Frau unmöglich, den Zauber, der ihnen angetan worden war, stumm und geduldig von dannen zu tragen. Man befand sich mitten im Hochsommer, die Nachtluft empfing die Herren, die aus dem Hause traten, dunkel und weich, und in die finstere Straße hinunter leuchteten nur die offenen Fenster des kleinen Gemachs, in dem sie so eben noch bei kühlem Wein und herrlichen Sommerfrüchten gesessen hatten. Ein Jeder fühlte das Bedürfnis, den Anderen gegenüber sich Luft zu machen und zu gestehen, dass ihm ihre Wirtin nie reizender, jünger, unwiderstehlicher vorgekommen sei, als eben heut. Auf- und abwandelnd, dem Hause entlang, rühmte man um die Wette den Geist und die Tugenden dieses unvergleichlichen Wesens und schonte dabei die Stimme nicht, damit sich ein oder das andere überschwängliche Wort durch die Fenster hinauf an Ohr und Herz der gestrengen Herrin stehlen und dort für seinen Urheber sprechen möchte. Der Domprediger versäumte nicht, alles Lob, das die Andern mit vollen Händen ausstreuten, durch die Bemerkung zu überbieten, dass der Wandel der schönen Frau ihren Vorzügen erst die wahre Krone aufsetze und sie ein glorreiches Beispiel sei, dass alle anderen Mittel, Schönheit und Jugend zu erhalten, hinter der Kraft der Tugend weit zurückstehen müssten. Mancher, obwohl er nicht zu widersprechen wagte, vernahm dies mit einem stillen Seufzer. Doch das plötzliche Erlöschen der Lichter oben im Haus schien dem würdigen Redner Recht zu geben. Es war offenbar der Gepriesenen des Weihrauchs zu viel geworden, und sie deutete ihren Freunden an, dass sie ihren Namen weder im Guten noch im Bösen zu laut in der horchsamen Nacht zu vernehmen wünschte. Man verstand ihren Wunsch und trennte sich unverzüglich.
Aber das Licht, das an dieser Seite des Hauses verlöscht wurde, erglomm alsbald auf der anderen, die in den Garten sah, und brannte noch fort, als die Mitternacht längst vorübergegangen war und ein abnehmender Mond am feuchten Himmel stand. Es brannte hinter dunkelroten Vorhängen im Schlafzimmer der schönen Frau, und man musste genau hinsehen, um von der schmalen Gasse aus, die hinter der Gartentür hundert Schritt vom Hause entfernt vorbeilief, überhaupt einen Schimmer zu entdecken. Gleichwohl war alle Aufmerksamkeit eines Mannes, der in der Gasse stand, nur auf dieses Licht geheftet. Was mochte ihm daran merkwürdig sein? Er war offenbar über die schwärmerischen Jahre hinaus, in welchen eine große Flamme in unserem Busen sich ruhelos zu dem kleinen Licht im Gemach eines schönen Weibes hingezogen fühlt. Räuberische Absichten anderer Art konnte man ihm ebenso wenig zutrauen. Ein schmerzlicher Zug um den kräftigen, sehr ausdrucksvollen Mund zeigte, dass ihm der Posten, den er hier eingenommen hatte, nicht geringe Sorge machte. Die entschlossenen Augen sahen unter dem schwarzen Hut bald zornig, bald kummervoll, immer aber auf das eine Fenster. Und Niemand kam, ihn in seiner Wache zu stören; denn das Haus der Frau Anna lag am Rande der Stadt, und die verfallene, alte Ringmauer begrenzte die öde Gasse, auf der man die Gärten umging.
Eine graue Dämmerung lagerte um diese Stätte, bei der es dem Mann auf der Wacht nicht gelang, die Zeiger auf seiner Uhr zu erkennen. Dennoch zog er sie alle zehn Minuten heraus und steckte sie unmutig wieder ein, um von neuem das Licht im Hause zu bewachen. Der Wind machte sich auf und trug ihm den Schall der Turmglocke zu. Eins – Zwei – ein Viertel darüber! Zum hundertsten Male wechselte der Einsame seinen Platz. Er fand jetzt erst eine Art Nische in der Mauer, wo es möglich war, sich – wie unbequem auch immer – niederzusetzen. Er lehnte den Kopf, der ihm von Gedanken schwer war, an die Mauer zurück und betrachtete einen Augenblick den Mond, der sich mehr und mehr umwölkte. Jeder Andere hätte Gefahr gelaufen, durch das langsame Verdunkeln des Himmels allmählich um seine wache Besinnung zu kommen. Unser Mann war vor dem Schlaf nur allzu sicher.
Eine Katze, die von der Gartenmauer in die Gasse sprang, schreckte ihn auf von seinem Sitz. In demselben Augenblick schlug die Turmuhr Drei. Der Mann drückte sich unwillkürlich den Hut tiefer in die Stirn und fasste zuerst das Fenster, dann die Tür des Gartens mit gespannterer Ungeduld ins Auge. Noch eine Weile blieb Alles still, dann hörte er behutsame Schritte jenseits der Gartenmauer durch den mittleren Weg herankommen. Hinter der Tür hielten sie an, vorsichtig, ob auch die Gasse sicher sei. Ein Schlüssel drehte sich kaum hörbar im Schloss, und die dunkle Gestalt eines Jünglings glitt aus der Tür. Nach einem raschen Blick, der den Mann an der Mauer jenseits nicht entdecken konnte, entfernte sich der Jüngling mit eiligen Schritten und schlug einen Weg ein, der in die innere Stadt zurückführte.
Als er weit genug vom Hause der Witwe entfernt war, blieb er stehen, wie um Atem zu schöpfen. Er sah umher auf der menschenleeren Straße und hinauf in die nun ganz umdunkelte Luft, aus der einzelne Tropfen zu fallen begannen. Als wäre es ihm unter dem leichten Studentenmützchen zu warm, schob er es weit auf die dichten Locken zurück und gab seine Stirn dem sprühenden Regen preis. Über den Dächern zuckte jetzt das Leuchten eines fernen Gewitters herauf, und plötzlich prasselte ein Regensturz in die Straße nieder, der den Jüngling zwang, unter den Vorsprung einer Haustür zu flüchten. Hier stand er in die Ecke gedrückt, die Augen geschlossen, die Stirn gegen den Steinpfeiler gelehnt, und hing während des Rauschens seinen Träumen nach. Er seufzte tief, da mitten in dem Lärm des Ungewitters eine Nachtigall im Käfig zu schlagen anfing. Sein Mund war halb geöffnet, als sauge er die heranwehende Kühle verschmachtet ein. So stand er eine geraume Zeit.
Erst als der Gewitterguss nachließ und das Rauschen sanfter wurde, sah er auf, und ein heftiger Schreck, der ihn durchfuhr, verscheuchte im Nu die selige Geistesabwesenheit, in der er sich befunden hatte. Am andern Pfeiler des Torwegs, ruhig vor sich hinsehend, stand der Mann, der an der Gartenmauer die Nachtwache gehalten. Er hatte die Hände in die Taschen seines leichten Sommerüberrocks gesteckt und schien geduldig das Aufhören des Regens abzuwarten, ohne den Andern im Geringsten zu beachten.
Borromäus! rief der Jüngling, du bist’s? Wie kommst du hieher?
Auf demselben Wege wie du, Detlef. Der Regen trieb mich unter Dach.
Aber es ist spät.
Ja wohl; eine Stunde noch, so haben wir den Tag.
Der Jüngling schwieg und eine peinliche Unruhe zeigte sich in seinen Gebärden. Er trat ins Freie hinaus, prüfte mit emporgewendetem Gesicht das Wetter, schob die Mütze zurecht und sagte dann abgewendet: Was hat dich nur in der Nacht durch die Stadt getrieben, ganz gegen deine Gewohnheit?
Geschäfte, Kind, Geschäfte. Jeder hat die seinigen. Indessen, mein’ ich, der Regen ist vorüber, und wir können uns nach Hause begeben.
Detlef nickte, und sie gingen neben einander die Straße hin. Keiner sprach ein Wort. Der Weg war noch weit, aber der Mond leuchtete ihnen wieder, und ein erquicklicher Geruch strömte von dem durchnässten Boden aus. Ein Glockenspiel auf einem der Stadttürme begann, und jeder einzelne Ton wurde durch die gereinigte Luft voll und klar dahingetragen.
Sie kamen bei dem Hause an, wo sie wohnten. Schließ auf, Detlef, sagte der Mann.
Hastig griff der Jüngling in seine Tasche, wühlte darin, ohne den Schlüssel zu finden, und sagte endlich: Ich muss ihn zu Hause gelassen – oder – in der Kneipe verloren haben.
Da ist der meine, erwiderte der Mann gleichgültig. Schließ auf! Ich werde morgen hinschicken und fragen lassen, ob ihn vielleicht der Gärtner der Frau Anna oder ihre Zofe gefunden hat.
Borromäus!
Du könntest ihn freilich selbst abholen, fuhr der Andere fort. Aber aus mancherlei Gründen wünsche ich nicht, dass du jenes Haus und jenen Garten wieder betrittst. Schließ auf! Es ist Zeit zu Bett zu gehen. Wir können morgen noch darüber reden.
Wie versteinert sah der Jüngling ihn an. Wer hat es dir gesagt? brach endlich aus seiner beklommenen Brust hervor. Hast du meine Papiere –?
Pfui, Detlef! Du solltest mich kennen. Es ist übrigens gleichgültig, woher ich es weiß. Genug, ich weiß es und wollte dir meine Ansicht darüber nicht vorenthalten.
Du wirst mir erlauben, sie nicht zu teilen.
Nicht? Wir werden sehen, Kind, wir werden sehen; dein Kopf ist heute nicht ganz klar. Wenn du den Rausch ausgeschlafen hast, wollen wir die Sache noch einmal mit Vernunft bedenken.
Er nahm dem völlig Vernichteten den Schlüssel wieder aus der Hand und führte ihn die dunkle Treppe hinauf in ihre Wohnung. Bei dem geringen Schein des Mondes kleideten sie sich aus, denn keiner wünschte dem andern deutlicher ins Gesicht zu sehen. Ihre Betten standen in dem gemeinschaftlichen Schlafzimmer einander gegenüber, das Fenster war dazwischen. An der Seite des Jünglings war die Wand mit Silhouetten seiner Freunde bedeckt, ein paar Schläger und doppelläufige Pistolen bekrönten, mit Bändern und Handschuhen zu einer Trophäe gruppiert, die vielen kleinen Bildnisse. Über Borromäus’ Bett hing nur ein weibliches Porträt, ein Mädchen in weißem Kleide, um die jugendlichen Schultern einen reihen Shawl geschlungen. Die Ähnlichkeit mit Detlef war auffallend; Jedermann hielt sie für seine Schwester.