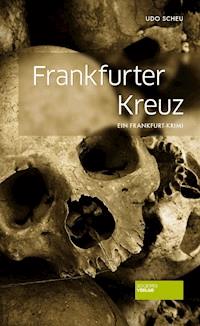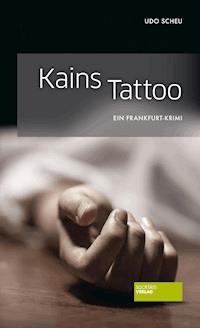Udo Scheu
Das blaue Licht
Ein Frankfurt-Krimi
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2007 Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH
Umschlaggestaltung: Katja Holst, Frankfurt
Satz: Nicole Proba, Societäts-Verlag
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
ISBN 978-3-95542-136-6
Es hatte aufgehört zu regnen. Nach wie vor blies ein kräftiger Wind und trieb eine dunkle Wolkenfront vor sich her. Am westlichen Horizont zeigte sich für kurze Zeit ein aufkommender hellblauer Streifen fahlen Lichts, der wie von schwefelgelben Fäden durchzogen war. Nach wenigen Augenblicken schluckte die einbrechende Dunkelheit nahezu alle Konturen und hinterließ einen sternlosen Himmel. Irgendwo schlug eine Kirchturmuhr sieben Mal.
Manfred Hübner war auf die Terrasse seiner Wohnung herausgetreten. Er mochte diese Lichtverhältnisse, die ihn stark an seine Kindheit in Norddeutschland erinnerten. Noch heute verspürte er gelegentlich Heimweh, obwohl er dort keine Verwandte oder Freunde mehr hatte. Aber in ihm war die Überzeugung wach geblieben, dass er dort hingehörte. Vielleicht hätte er doch vor Jahrzehnten seine Freundin und spätere Frau überreden sollen, zu ihm nach Husum zu kommen. Aber er hatte sich nicht durchsetzen können und war ihr nach Frankfurt gefolgt. Dort war er dann geblieben, auch nachdem sie vor sechs Jahren plötzlich gestorben war.
Als er das Läuten der Kirchenuhr hörte, griff er in die Brusttasche seines dunkelroten Flanellhemdes und zog eine rot-weiße Packung Zigaretten heraus. Sein Blick huschte über die Aufschrift, die besagte, dass Rauchen tödlich sein könne. Aber seine Gedanken waren noch bei seiner verstorbenen Frau. Was sie wohl sagen würde, wenn sie ihn wieder rauchen sehen würde? Wie viel Kraft hatte sie vor Jahren darauf verwendet, ihn davon abzubringen! Unzählige Argumente hatte sie angeführt, die alle mehr oder weniger zutrafen. Aber das Aufhören mit dem Rauchen war nicht nur eine Sache des Kopfes. Das hatte er ihr immer gesagt. Und dann hatte er schließlich doch aufgehört. Sie war so glücklich darüber, dass sie ihm eine Uhr zum Geschenk gemacht hatte. Als Erinnerung an gewonnene Lebenszeit, hatte sie auf einem Begleitkärtchen vermerkt.
Und nun sah er auf eben diese Uhr, verglich die Zeit mit dem Schlag der Kirchturmuhr und nahm langsam eine Zigarette aus der Schachtel. Er setzte sich auf einen der beiden Holzstühle, die er sich vor zwei Wochen im Sonderangebot zusammen mit einem passenden Tischchen gekauft hatte. Warum er zwei Stühle erworben hatte, wusste er nicht mehr. Einer hätte genügt. Schließlich lebte er allein, und mit seinen siebenundsechzig Jahren sollte sich dies nicht mehr ändern. Er hatte keine Freunde oder Bekannte. Gerade deshalb liebte er diese Wohnung so sehr. In den Wohnungen über ihm lebten ein Flugbegleiter und ein Handelsvertreter, die beide so gut wie nie zu Hause waren. Außerdem wohnte im Dachgeschoss noch ein junges Paar mit einem quirligen Rauhaardackel, der den Tag über gelegentlich jaulte.
Gegenüber von seinem Garten schloss sich ein weiteres kleines Wohnhaus an. Dort sah er ständig einen Mann aus dem Fenster schauen, der offensichtlich die Vögel beobachtete oder vor sich hin träumte.
Er nahm einen Lappen vom Fensterbrett, wischte einige Regentropfen vom Stuhl und legte sich ein Sitzkissen unter. Aus seiner Hosentasche kramte er ein Wegwerffeuerzeug hervor und zündete sich eine Zigarette an.
Nachdem er aufgehört hatte, als Sicherheitsbeauftragter zu arbeiten, hatten sich mehrere Vertreter von Sicherheitsunternehmen bei ihm gemeldet, um ihm einen Job anzubieten. Darüber hatte er sich sehr gewundert. Ihm war nicht klar, welchen Vorteil sie aus seiner Beschäftigung ziehen konnten. Seine Leistungsfähigkeit schätzte er nicht sehr hoch ein. Sein erworbenes Fachwissen enthielt nach seiner Einschätzung keine unverzichtbaren oder wichtigen Informationen.
Seit zwei Jahren war Manfred Hübner nun Rentner, und er kam gut damit zurecht. Anfangs hatte ihn die Sorge beschlichen, dass er nicht wissen würde, wie er den Tag ausfüllen sollte. Aber er hatte sich endlich den Traum erfüllt, eine leistungsstarke Kamera mit allem nur vorstellbaren Zubehör zu kaufen. Die ständige Motivsuche, insbesondere nach ungewöhnlichen Szenen im Bereich des Frankfurter Flughafens, machte ihm Spaß. Er konnte selbst entwickeln und Abzüge herstellen, sogar in Farbe. So hatte er immer gleich die Ergebnisse seiner Ideen vor Augen und freute sich daran. Vom Kauf einer dieser modernen Kameras, deren Bilder man sofort auf dem Computer betrachten konnte, hatte er bewusst abgesehen. Das war nichts für ihn.
Manfred Hübner zog an seiner Zigarette, etwas missmutig, weil er sah, dass sie schon fast bis zur Hälfte heruntergebrannt war. Er hatte sich gestattet, jede Stunde zwei Zigaretten hintereinander zu rauchen. Und manchmal wurden aus den zwei Zigaretten drei. Dabei war es gar nicht immer so genussvoll, wie er sich das erhoffte. Am meisten liebte er die ersten Züge, die ihm, wie er das nannte, den Kopf leer machten. Manchmal wurde ihm dabei schwindlig. Gerade dieses Gefühl liebte er. Doch oft waren die restlichen Züge eher von einem trockenen Hals begleitet. Und auch die Tasse Kaffee, die er sich gelegentlich mit in den Garten nahm, änderte daran nicht viel.
Die Glut seiner Zigarette hatte jetzt fast den Filter erreicht. Er drückte sie aus und griff automatisch wieder nach der Schachtel. Sie war leer.
Auf der Schwelle der Terrassentür fiel ihm ein, dass er nach dem Einkaufen die neue Zigarettenstange entgegen seiner Gewohnheit nicht im Küchenschrank abgelegt hatte. Er hatte sie gleich im Flur deponiert.
Als er durch das Wohnzimmer ging und vor der Tür zum Flur stand, klingelte das Telefon. Zwischen dem Zweisitzer und dem Dreisitzer hatte er einen Beistelltisch aus Acrylharz aufgestellt, auf dem er den Telefonhörer abgelegt hatte. Er nahm ihn rasch an sich, da der Anrufer nach dem vierten Klingeln schon auf die Mailbox umgeleitet würde und er nicht wusste, wie er sich dann in das Gespräch einschalten konnte. Er drückte den grünen Knopf.
„Hier Hübner“, meldete er sich.
Am anderen Ende der Leitung folgte keine Reaktion.
„Hallo“, rief er in den Hörer. Wieder nichts. Er wollte schon auflegen, als plötzlich eine stakkatoartige Abfolge von Tönen in sein Ohr drang, die ihn an Morsezeichen erinnerte.
„Hallo!“, rief er erneut. Schließlich drückte er entnervt den roten Knopf zur Beendigung des Telefonats und legte den Hörer zurück auf den Beistelltisch.
Seit einigen Wochen ging das nun schon so. Manchmal mehrmals am Tag. Aber irgendetwas war heute anders gewesen.
Die Tonfolge war in der Vergangenheit eine andere gewesen. Immer hatte es sich um lang gezogene Töne gehandelt. Heute war es nun zum ersten Mal eine Kurztonfolge.
Am Anfang hatte er noch an eine versehentliche Umstellung der Technik auf ein Faxgerät geglaubt. Aber dann wiederholten sich die Anrufe zu oft und waren zu gleichförmig, als dass man von einem Zufall hätte ausgehen können. Auch einen Defekt seines Anschlusses schloss er aus.
Er ging wieder in den Flur, holte sich eine neue Schachtel Zigaretten und öffnete sie. Vorsichtig nahm er eine Kippe heraus, steckte die Schachtel in die Brusttasche seines Hemdes und zog das Feuerzeug aus der Hosentasche. Noch im Zimmer, aber auf der Schwelle zur Terrassentür, zündete er sich die Zigarette an. Dann warf er einen Blick auf das gegenüberliegende kleine Haus. Es war etwa zwanzig Meter weit entfernt, von einem Jägerzaun von den anschließenden Grundstücken abgetrennt, dazwischen ein schmaler Kiesweg. Der Weg war zwar öffentlich zugänglich, aber nur selten verirrte sich dorthin ein Spaziergänger. Im linken Fenster der Erdgeschosswohnung brannte Licht. Ein unangenehmes gleißendes Licht. Es erinnerte ihn an das Flutlicht in Sportstadien.
Er setzte sich wieder auf seinen Lieblingsplatz und streckte die Beine aus. Von hier konnte er über große Teile des Gartens schauen. Den im Dunkel liegenden linken Teil behielt er dabei im Rücken. Gierig sog er an der Zigarette.
Wie mochte es jetzt mit ihm weitergehen, dachte er. Er hatte keine Vorstellung. Was war das für ein Lebensabschnitt, in dem er sich nun schon seit zwei Jahren befand? Würde es noch einmal Veränderungen geben? Oder wenigstens über den Alltag hinausgehende Neuigkeiten? Er war sich gar nicht sicher, ob er das überhaupt wollte. Solange es nichts Neues gab, gab es auch nichts Schlechtes. Aber war das nicht trostlos? Wenn jeder Tag in seinem Verlauf absehbar war, war das dann wirklich eine erlebenswerte Zukunft? Es war der letzte Lebensabschnitt!
Sollte er reisen? Aber das war teuer. Gut, er hätte sich in einem einfachen Rahmen die eine oder andere Reise leisten können. Aber ob dies die immer wieder auftretende Leere in seiner Gefühlswelt schließen und ihm rundum das Bewusstsein der Zufriedenheit geben würde?
Er würde diese ganzen Fragen auch heute Abend nicht abschließend beantworten können. Zu oft schon waren seine Gedanken um diese Themen gekreist und immer wieder war er dabei an seine Grenzen gestoßen. Er war nicht das, was man im Geschäftsleben einen Entscheider nannte.
Immer hatte dies versteckt in seinen Zeugnissen und Beurteilungen gestanden: Dass er zu wenig Selbstvertrauen habe, zu zögerlich sei, um rasch gebotene Entscheidungen zu treffen. Nur einmal war ihm dieser Charakterzug positiv ausgelegt worden. Das hatte seine frühere Freundin und spätere Frau so schön formuliert. Gerade seine besonnene, differenzierte und abwägende Art sei es, die sie so sehr an ihm liebe.
Er drückte seine zweite Zigarette aus und überlegte, ob er sich noch eine dritte gönnen sollte. Der Wind hatte etwas nachgelassen, und er liebte diese Stimmung der Stille, die beruhigende Dunkelheit.
Unverhofft fiel ihm etwas auf, kroch in seine Gedanken – das Fenster in der gegenüberliegenden Erdgeschosswohnung war leer gewesen, als er nach dem Telefonat wieder in den Garten gegangen war. Dort, wo sonst immer dieser Mann gestanden und emotionslos in seine Richtung geschaut hatte, war der Fensterrahmen unausgefüllt gewesen.
Manchmal glaubte Hübner sogar, dass sein Nachbar seinetwegen am Fenster stand und ihn beobachtete.
Aber warum sollte er das tun? War er möglicherweise ein wenig eigenwillig oder schrullig, vielleicht sogar etwas impertinent? Oder war er nur neugierig?
Hübner stutzte. War da nicht ein Geräusch gewesen, seitlich von ihm?
Er lauschte in die Stille.
Nichts. Kein Laut.
Oder? Vielleicht war es nur eine streunende Katze oder eine Maus?
Da! Wieder war es ihm, als ob sich in der Hecke zum linken Nachbargrundstück etwas bewegt hätte.
Als Manfred Hübner zum dritten Mal aufhorchte, hatte er das Gefühl, dass sich irgendetwas unmittelbar hinter ihm mit rascher Geschwindigkeit auf ihn zu bewegte. Plötzlich spürte er einen Schlag auf dem Kopf – oder im Kopf! Er fühlte, wie eine grelle weiße Rakete in seinem Schädel gezündet wurde, die in seinem gesamten Gehirn hellweiße Sterne versprühte. Vor seinem geistigen Auge sah er stakkatoartige Morsezeichen, bevor sich alles in einem weißen Licht auflöste. Unvermittelt kippte Manfred Hübner vom Stuhl.
Als er auf dem Boden aufschlug, war er schon tot.
Langsam frischte der Wind wieder auf. Der Regen setzte erneut ein. In dem Aschenbecher auf dem Terrassentisch sammelte sich schnell das Wasser. Von der Kirchturmuhr schlug es zur halben Stunde.
Es war Montag, der 15. März 2004, 19.30 Uhr.
***
Hanspeter Schultz saß gemütlich in seinem mit braunem Leder ausgeschlagenen Ohrensessel, dem Geschenk seiner Frau zur vergangenen Weihnacht. Ordnungsliebend, wie er war, hatte er sämtliche Gegenstände, die er innerhalb der nächsten zwei Stunden für unentbehrlich hielt, auf den kreisrunden kleinen Holztisch neben sich gelegt. Nachdem er einen nachdenklichen Blick auf die Übergardinen geworfen hatte, strich er sich bedächtig über seinen grau melierten Vollbart, sein ganzer Stolz und ständiges Objekt seiner aufmerksamen Pflege. Sein Bart war üppig, ebenso wie sein Haar, das er als Bürste geschnitten trug.
Seine rechte Hand fuhr langsam über seinen unter der dunkelblauen Weste kugelförmig gespannten Bauch und entnahm der kleinen Seitentasche eine goldene Uhr, deren Kette sich irgendwo unter der Weste verlor. Er klappte den Deckel auf und stellte mit befriedigtem Grunzen fest, dass es erst 21.47 Uhr war. Er nahm es immer genau mit der Feststellung der Uhrzeit. Das glaubte er seinem Image als Staatsanwalt schuldig zu sein.
Vorsichtig schloss Schultz den Uhrendeckel wieder und schob die Uhr zurück in seine Westentasche.
Tatsächlich war er bei einer Körpergröße von 1,72 Meter mit seinen 98 Kilo einfach zu dick. Aber es störte ihn nicht wirklich. Nur die 100-Kilogramm-Marke wollte er nicht überschreiten. Sonst würde es Ärger mit seiner Frau geben. Und den fürchtete er wie der Teufel das Weihwasser. Seine Frau war resolut und durchsetzungsfähig. Sie war in der Ehe wohl das, was man in Karikaturen gelegentlich als den eigentlichen Mann im Haus darstellte.
Und nun war sie, wie so oft, nicht zu Hause. Als einzige Tochter eines lange und gut eingeführten Frankfurter Kaufhauses hatte sie Volks- und Betriebswirtschaft studiert, um irgendwann das Unternehmen weiterzuführen. Da aber ihre Eltern noch vergleichsweise jung waren und sie wiederum keine Lust hatte, unter deren Oberhoheit in dem Geschäft zu arbeiten, hatte sie sich um eine Stelle in der Abteilung Geldhandel einer Frankfurter Großbank beworben. Dort hatte sie eine herausragende Karriere gemacht. Dies führte aber immer wieder zu Auslands- und anderen Ortsabwesenheiten.
Mit andächtigem Lächeln dachte Hanspeter Schultz, dass er seine Frau nach wie vor liebe.
Er warf seinen Blick auf das runde Holztischchen neben sich und stellte zufrieden fest, dass er an alles gedacht hatte. Dort befanden sich seine goldgefasste Lesebrille mit halben Gläsern, das Magazin „Der Spiegel“ von dieser Woche, die Fernbedienung für den Fernseher, eine Teetasse mit japanischem Muster samt der dazugehörigen kleinen Teekanne, aus deren Ausguss es leicht dampfte, eine bleistiftlange metallene Hülse, in der sich eine Zigarre befand, eine Schachtel Streichhölzer und seine geliebten belgischen Pralinen.
Auf den Abend hatte er sich besonders gefreut, weil um 22.20 Uhr ein klassischer Wildwestfilm im Fernsehen lief. Er liebte dieses Genre. Schon als kleiner Junge hatte er gerne nach den Karl-May-Bänden gegriffen. Bevorzugt hatte er die aus seiner heutigen Sicht vielleicht etwas romantisierten Indianergeschichten gelesen. Zu gerne hatte er sich an Karneval als Cowboy kostümiert, obwohl er ein Indianerkostüm noch vorgezogen hätte. Doch mit seiner schon damals merklichen Pummeligkeit und seinem trotz seiner dunkelbraunen Haare sehr hellen Teint hätte er keinen überzeugenden Indianer abgegeben.
Er griff nach der Metallhülse und entnahm ihr die Zigarre. Natürlich war es eine „Partagas“. Diese Sorte schätzte er am meisten.
Aus der Hosentasche zog er ein kleines Taschenmesser und kerbte das Mundstück der Zigarre sorgfältig ein. Dann riss er ein Streichholz an, entzündete feierlich die Zigarre und paffte die ersten Rauchschwaden in das Zimmer. Die Schwaden bewegten sich langsam auf den gewichtigen Kristalllüster an der Decke zu und umkreisten ihn wie schwere Wolken. Er beobachtete es für einen kleinen Moment ganz gefällig, bevor er nach der Teekanne griff und sich seinen Lieblingstee, einen Jasmintee, eingoss.
Der siebentägige Sonderdienst verlangte Tag und Nacht die telefonische Erreichbarkeit. Insbesondere in Fällen von besonderer Bedeutung, wie es in Amtsdeutsch hieß, war sicherzustellen, dass die Beamten der Polizei auf einen staatsanwaltschaftlichen Dienst zurückgreifen konnten. Das war beispielsweise dann der Fall, wenn nach einer gerade begangenen Straftat Haftbefehle zu beantragen oder etwa Durchsuchungs-, Telefonüberwachungs- oder Beschlagnahmebeschlüsse bei Gericht zu erwirken waren. Derartige Aufgaben waren vom Gesetz her der Staatsanwaltschaft und nicht der Polizei zugewiesen. Auch ansonsten hatte die Polizei bei wichtigen Straftaten die Staatsanwaltschaft zu unterrichten, da dieser gesetzlich die Führung von Ermittlungsverfahren übertragen war und die Polizei ihren Weisungen unterstand.
Jede Woche waren zwei Staatsanwälte zum Bereitschaftsdienst eingeteilt, um auf jeden Fall die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Da Schultz an erster Stelle auf der Liste stand, würde man sich wohl in dieser Woche im Bedarfsfall zuerst an ihn wenden.
Er schlürfte genüsslich seinen Tee. Die letzten Wochen waren ruhig gewesen. Warum sollte sich das also gerade jetzt ändern?
In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Schultz verfluchte sich. Mit seinen Gedanken über die ruhige Vergangenheit hatte er am Ende einen Anruf heraufbeschworen. Verärgert stellte er fest, dass er vergessen hatte, den Telefonhörer zu den Gegenständen auf das Tischchen zu legen. Er stand auf, ging über den schweren handgeknüpften Perserteppich zur Bibliothek und nahm von der dort angebrachten Basisstation den Hörer ab.
„Schultz“, meldete er sich knapp, mit kräftiger Stimme.
„Gott sei Dank sind Sie zu Hause“, schallte es ihm im nicht minder lauten Tonfall entgegen. „Hier ist Schreiner vom K 11. Es gibt Arbeit.“
Staatsanwalt Schultz mochte Schreiner, der dem für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariat des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main seit vielen Jahren angehörte. Er hatte seine fantasievolle Ermittlungsarbeit in einem früheren Verfahren kennengelernt und schätzte seitdem seine große Erfahrung.
„Was, Herr Kriminaloberkommissar Schreiner, veranlasst Sie zu der Bemerkung, dass ich ›Gott sei Dank‹ zu Hause bin? Wo soll ich sonst sein, wenn ich Dienst habe? Was hatten Sie denn befürchtet?“
„Na ja“, druckste Schreiner herum. „Ich hatte gesehen, dass an zweiter Stelle der Liste eine Dame steht. Deshalb hatte ich gebetet, dass Sie da sind.“
„Sollte das wieder der Beginn einer Ihrer gerichtsbekannten frauenfeindlichen Äußerungen sein?“, fragte Schultz. „Sie sollten zur Kenntnis nehmen, mein Lieber, dass im einundzwanzigsten Jahrhundert Frauen längst ihren Einzug in die Amtsstuben genommen haben und bei gleicher Qualität wie die Männer Leistung bringen. Oder zweifeln Sie daran?“ Schultz wusste, dass Schreiner mit diesem Thema Probleme hatte.
„Nein, nein“, gab Schreiner kleinlaut bei. „Aber Spaß beiseite! Ich glaube, dass Sie sich das ansehen müssen.“
„Dann schießen Sie mal los!“
„Also, wir haben einen Mord in Frankfurt-Praunheim, im Messelweg.“
„Tötungsdelikt sollten Sie sagen, Verehrtester“, meinte Schultz. „Ob es ein Mord ist, wird sich zeigen. Das ist eine juristische Bewertung!“
„Dann eben Tötungsdelikt“, fuhr Schreiner unbeeindruckt fort. „An dem Umstand, dass wir einen Toten haben, ändert das erst einmal nichts! Zum Sachverhalt: Der Messelweg ist eine reine Wohnstraße mit kleineren Wohneinheiten, meistens kleine Einfamilienhäuser oder vermietete Objekte mit jeweils bis zu vier Partien. Tatort ist vermutlich die Terrasse oder der Garten hinter dem Wohngebäude Nummer 117, das von vier Mietparteien bewohnt wird.“
„Ich kenne die Gegend“, unterbrach Schultz und überlegte, ob er den Hinweis geben sollte, dass die Terrasse oder der Garten wahrscheinlich noch gar nicht als Tatort feststanden, sondern Schreiner wohl eher den Ort der Auffindung der erwähnten Leiche meinte. Dann entschied er sich aber, die neuerliche Belehrung zu unterdrücken und sagte schlicht: „Machen Sie weiter!“
„Die oberste Wohnung des Hauses Nummer 117 hat ein jüngeres Pärchen mit einem Hund gemietet. Sie waren den ganzen Tag außer Haus, arbeiten. Als sie nach Hause kamen, sind sie erst einmal mit dem Hund spazieren und unmittelbar im Anschluss daran in eine nahe gelegene Pizzeria gegangen, um etwas zu essen. Wieder zu Hause angekommen, machten sie wie gewöhnlich vor der Haustür den Hund von der Leine ab. Der schoss dann in den Garten davon, bellte wie verrückt und kam auch auf mehrfaches Zurufen nicht wieder. Als die beiden jungen Leute ihren Hund schließlich im Garten einfangen wollten, sahen sie die Bescherung.“
„Falls Sie mit ›Bescherung‹ das Vorhandensein einer Leiche meinen, wäre es angebrachter, Ihren Formulierungen dem Ernst der Lage entsprechend etwas mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden.“
„Na schön, im Garten trafen die beiden jungen Leute auf den am Boden liegenden Mieter der Erdgeschosswohnung“, fuhr Schreiner fort. „Sie müssen furchtbar erschrocken sein. Sie stellten erhebliche Kopfverletzungen bei dem Mann fest und riefen uns sofort an. Das ist erst einmal alles.“
„Wie, alles?“, fragte Schultz. „Wo bleiben denn Ihre Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine nicht natürliche Todesursache handelt?“
„Ich hatte schon gesagt, dass es sich um ein Tötungsdelikt oder einen Mord handelt“, gab Schreiner schroff zurück.
„Woraus schließen Sie das denn? Gibt es dafür Erkenntnisse? Gibt es eine Tatwaffe, oder ist das Opfer erwürgt worden?“
„Er hat, wie bereits erwähnt, eine schwere Kopfwunde. Es sieht nicht so aus, als hätte er sich die selbst beigebracht. Er ist erschossen worden“, führte Schreiner geduldig weiter aus. „Den Rest erzähle ich Ihnen, sobald Sie hier sind.“
„Wann sind Sie unterrichtet worden?“, fragte Schultz.
„Das muss so gegen 21.00 Uhr gewesen sein. Genauer wird das im Bericht festgehalten.“
Schultz ärgerte sich ein bisschen über die unpräzise Zeitangabe, bemängelte dies aber nicht. Stattdessen sagte er: „Gut, ich komme.“
„Soll ich Ihnen einen Streifenwagen vorbeischicken, oder kommen Sie mit Ihrem eigenen Auto?“
„Um Gottes Willen“, wehrte Schultz ab, „nur keinen Streifenwagen. Bis Sie Ihre uniformierten Kollegen mobilisiert und die mich aufgenommen und nach Praunheim gefahren haben, ist niemand mehr am Tatort.“
„Gut. Geben Sie mir bitte noch Ihren Wagentyp und Ihr Kennzeichen durch. Ich gebe es dann den Kollegen vor der Tür weiter, die zurzeit ein Stück der Straße absperren. Dann werden Sie problemlos durchgelassen.“
„Das würde mir sicher auch mit dem Dienstausweis gelingen, aber Sie haben recht. So ist es einfacher. Übrigens, ist denn schon Presse vor Ort?“
„Bis jetzt noch nicht. Also, bis gleich.“
„Bis gleich.“
***
Von seinem Haus auf dem vornehmen Lerchesberg im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen zum mutmaßlichen Tatort in Praunheim benötigte Hanspeter Schultz mit seinem schwarzen Mercedes 230 E eine knappe halbe Stunde. Praunheim lag fast am anderen Ende Frankfurts, und er achtete grundsätzlich peinlich auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbestimmungen.
Als er in den Messelweg einbog, glitt sein Blick auf der Suche nach den Hausnummern an den wie aneinandergereihte Schuhkartons dastehenden Reihenhäusern entlang. Kurz bevor er die dreistelligen Hausnummern erreichte, griff er noch einmal nach dem Knoten seiner Krawatte, um zu prüfen, ob sie richtig saß. Es war für ihn selbstverständlich gewesen, dass er sich rasch in einen Anzug gekleidet hatte, bevor er losgefahren war. Dienst verband er mit Korrektheit und dazu gehörte für ihn ein gepflegtes Äußeres.
Das Haus mit der Nummer 117 musste er nicht lange suchen. Schon bald hatte er die blinkenden Blaulichter gesehen und war direkt darauf zugefahren. Seinen Dienstausweis hatte er bereits vor Fahrtantritt griffbereit neben sich gelegt, um nicht in seinen Taschen herumhantieren zu müssen. Schließlich wusste er, dass die Polizeibeamten im Anschluss an die Terroranschläge vom 11. September 2001 zu erhöhter Eigensicherung aufgefordert worden waren. Dazu gehörte, dass Kontrollen nur noch mit der Hand an der Schusswaffe durchgeführt wurden.
Kriminaloberkommissar Schreiner hatte jedoch ganze Arbeit geleistet. Seine Kollegen waren über das Eintreffen des Staatsanwalts, seinen Kraftfahrzeugtyp und dessen Kennzeichen informiert. Ein junger Beamter wies ihn auf eine Parkmöglichkeit hin, holte ihn mit geöffnetem Regenschirm von seinem Fahrzeug ab und begleitete ihn dann in das Haus bis zur angelehnten Wohnungstür.
„Herr Schreiner ist in der Wohnung oder im Garten. Wenn Sie am Ende des Flurs durch die rechte Tür gehen, gelangen Sie ins Wohnzimmer. Von dort geht es auch nach draußen.“
„Vielen Dank!“, sagte Schultz und folgte dem beschriebenen Weg.
Als er das Wohnzimmer betrat, traf er auf ein großes Aufgebot an Menschen, die sich überall zu schaffen machten. Das sah auf den ersten Blick planlos aus. Schultz wusste aber, dass in der vermeintlichen Unordnung eine beruhigende Routine steckte. Als sein Blick in Richtung der geöffneten Terrassentür wanderte, hellte sich seine Miene auf. Schnurstracks ging er auf einen dort mit einem buchähnlichen Gegenstand befassten, kräftigen Mann zu.
Der Mann hatte dunkle, nach hinten gekämmte, etwas ölig wirkende Haare und rötlich leuchtende Pausbäckchen. Gekleidet war er mit einem dunkelgrauen Rollkragenpulli und einer blauen Tuchhose.
„Guten Abend, Herr Köhler“, rief Schultz ihm zu. „Ich freue mich, dass Sie auch hier sind.“
Köhler war aus Schultz’ Sicht ein Beamter von eher konservativer Grundhaltung. Er war ein besonnener strenger Analytiker, während Schreiner mehr den progressiven Typ verkörperte und von spontanen Einfällen und seiner Pfiffigkeit lebte. Zusammen gaben Schreiner und Köhler ein Paar ab, das in der Lage war, auch ungewöhnliche Problemfälle zu enträtseln.
„Grüß Gott, Herr Schultz“, entgegnete Köhler. „Finde ich gut, dass Sie gekommen sind.“
„Bei so einer Sache kann die Staatsanwaltschaft die Polizei nicht alleine lassen“, gab Schultz jovial zurück.
„Sie suchen sicher Herrn Schreiner, mit dem Sie vorhin gesprochen haben. Soll ich Sie gleich zu ihm bringen?“
„Nein, nein, lassen Sie nur. Sie sind mir erst einmal genau so lieb. Wie sieht es denn aus? Gibt es schon Erkenntnisse über den Tatverlauf?“
„Sehr wenige“, antwortete Köhler. „Aber bevor Sie jetzt vielleicht von verschiedenen Seiten mehrfach dieselbe Geschichte hören, gehen wir am besten nach draußen. Dort sind unter anderem Herr Schreiner und auch Frau Dr. Lubitsch vom gerichtsmedizinischen Institut. Die haben den aktuellsten Stand. Wir haben die Markise ausgefahren und die Terrasse so abgeschirmt und ausgeleuchtet, dass wir trotz der miesen Witterungsverhältnisse die Leiche und den mutmaßlichen Tatort untersuchen können.“
Draußen auf der Terrasse erblickte Schultz sofort Schreiner. Schreiner war ein zierlicher Mann mit schwarz gelocktem Haar und schwarzem Vollbart, dessen Gesicht eine Vielzahl kleiner Narben trug. Er hatte ihn nie gefragt, woher diese Narben stammten, ob sie vielleicht von einer starken Akne im jugendlichen Alter zurückgeblieben waren. Für Schultz sah es aus, als habe Schreiner einmal an den Pocken gelitten. Schreiner steckte wie üblich in blauen Jeans und einer farblich nicht ganz dazu abgestimmten Jeansjacke. Darunter trug er ein knallrotes T-Shirt.
Neben Schreiner stand eine auffällig kleine Frau mit rötlichen hochgesteckten Haaren. Bestenfalls mochte sie knapp 1,60 Meter groß sein. Sie war salopp gekleidet, trug braune Cordhosen und einen weit geschnittenen olivgrünen Pullover. Schultz kannte sie von einer Reihe von gemeinsam bestrittenen Obduktionen. Er war dankbar, dass gerade Frau Dr. Lubitsch hier war. Vor allem bewunderte er an ihr, dass sie nahezu immer feste und belastbare Ergebnisse ihrer Arbeit präsentierte.
„Guten Abend allseits“, sagte Schultz und schüttelte Hände. „Ich bin neugierig. Wie sieht es aus? Was wissen wir bisher?“
Schreiner und Köhler schauten zugleich Frau Dr. Lubitsch an.
„Erst einmal hallo, Herr Schultz!“, sagte Frau Dr. Lubitsch. „Tja, wir haben eine männliche Leiche. Nach meiner ersten Untersuchung handelt es sich um einen älteren Mann, der im Laufe des Nachmittags oder frühen Abends offensichtlich an den Folgen eines Kopfschusses mit großem Kaliber verstorben ist. Sie können ihn sich gleich anschauen. Wir haben ihn noch nicht weggebracht. Nach meinen Feststellungen dürfte es sich fast um einen aufgesetzten Schuss gehandelt haben. Die Täterin oder der Täter hat die Waffe so dicht an seinen Kopf herangeführt, dass starke Schmauchspuren auf der Kopfhaut anzutreffen sind. Natürlich schlage ich Ihnen die Obduktion der Leiche vor.“
Aufgrund der aufgebauten Scheinwerfer brauchte Schultz nicht lange nach der Leiche zu suchen. Bisher hatte man sie nicht einmal abgedeckt, da die Spurensuche noch in vollem Gange war. Schultz schaute sich den verkrümmten Körper kurz an, bevor sein Blick eine Weile auf dem stark mit Blut behafteten Kopf haften blieb. Dann fragte er Frau Dr. Lubitsch:
„Wir sollten so schnell wie möglich obduzieren. Wann können Sie?“
„Ich habe schon mit Professor Wagenknecht telefoniert. Wir haben unterstellt, dass Ihnen an einer eiligen Untersuchung gelegen ist. Professor Wagenknecht hat die Obduktion deshalb auf morgen früh, 11.00 Uhr angesetzt“, antwortete Frau Dr. Lubitsch und fügte fast entschuldigend hinzu: „Früher kann Herr Professor Wagenknecht nicht.“
„Ich werde da sein“, bemerkte Schultz knapp, aber freundlich und sah zu Schreiner hinüber. „Herr Schreiner, was haben Sie mir bis jetzt zu bieten. Ich höre aber auch gerne Ihnen zu, Herr Köhler, wer von Ihnen beiden gerade will“, ergänzte er und schaute dabei zu Köhler hin.
Schreiner und Köhler wechselten kurz einen Blick, aus dem deutlich wurde, dass sie sich ohne große Absprachen verstanden. Beide hatten denselben Dienstgrad. Sie hatten zur gleichen Zeit bei der Polizei angefangen, denselben Werdegang genommen, hatten gemeinsam die Ausbildungsjahre auf der Fachhochschule zugebracht und waren fast immer auf denselben Tag genau befördert worden. In ihrem Kollegenkreis war bekannt, dass die persönliche Freundschaft so weit ging, auch gemeinsam die anstehenden Fälle lösen zu wollen. Dementsprechend war es ihnen bisher fast immer gelungen, in derselben Organisationseinheit Dienst zu verrichten. Ihre Vorgesetzten hatten dem bisher nach Möglichkeit Rechnung getragen, weil sie wussten, dass der eine ohne den anderen oft nicht die volle Leistung brachte.
„Viel mehr, als ich Ihnen am Telefon gesagt habe, wissen wir noch nicht“, begann Schreiner. „Immerhin kennen wir das Opfer. Es heißt Manfred Hübner, 67 Jahre. Hübner war Rentner und arbeitete früher bei der Flugsicherung. Er wohnte alleine hier. Seine Frau ist vor ein paar Jahren verstorben, Kinder gibt es wohl keine. Das konnten wir alles aus den persönlichen Unterlagen entnehmen, die er in einem Ordner im Wohnzimmerschrank aufbewahrte.“
Wie in einem bis zur Perfektion geübten Rollenspiel schaltete sich an dieser Stelle ohne erkennbare Absprache Köhler ein:
„Wir konnten wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit natürlich bisher nur eine kursorische Durchsuchung der Wohnung und Sichtung der vorhandenen Unterlagen vornehmen. Das muss alles noch nachgeholt werden. Natürlich konnten wir auch noch nicht die Nachbarn befragen, feststellen, welche Freunde oder mögliche Feinde es gibt, und wo ein Motiv für die Tat liegen könnte.“
Schultz war klar, was Köhler mit seinen Ausführungen deutlich machen wollte. Darin lag der versteckte Hinweis, dass es ermittlungsleitender Hinweise durch die Staatsanwaltschaft an dieser Stelle nicht bedürfe, da man über genügend eigene polizeiliche Sachkunde verfüge.
„Es gibt bisher keine Tatwaffe. Wir wissen hierzu nur, was Frau Dr. Lubitsch vorhin festgestellt hat“, erläuterte Schreiner weiter. „Auch das Projektil haben wir noch nicht finden können. Vielleicht befindet es sich noch im Kopf. Das wird spätestens morgen die Obduktion ergeben.“
„Vom Täter oder der Täterin fehlt uns noch jede Spur“, ergänzte Köhler. „Das junge Paar von oben haben wir informell angehört. Mit der Frau ist nichts anzufangen. Die ist völlig verstört. Und der Mann ist zwar sachlich und ruhig, hat aber nach seinen Angaben nichts gesehen. Das hat Ihnen ja Kollege Schreiner schon am Telefon berichtet.“
„Wir haben allerdings so etwas wie Fußspuren am Rand der einen Hecke auf dem Gras gefunden“, übernahm Schreiner. „Die Kollegen schauen sich das zurzeit noch genauer auf eine beweisfähige Verwendung hin an. Aber es sieht nicht gut aus. Das Wetter hat nahezu alles an Spuren vernichtet. Seltsam ist nur, dass unser Kollege von der Spurensicherung meint, der Täter oder die Täterin könnte barfuß gewesen sein. Fest dürfte aber bisher nur stehen, dass es sich dabei um die Spur von nur einer Person handeln dürfte.“
„Barfuß“, sagte Schultz. „Warum sollte jemand bei diesem Wetter barfuß laufen?“
„Das wissen wir natürlich nicht. Wir sind uns ja noch nicht einmal sicher, ob es überhaupt so war“, sagte Schreiner.
„Frau Dr. Lubitsch, meine Herren, ich danke Ihnen erst einmal. Geben Sie diesen Dank bitte auch an die anwesenden Kolleginnen und Kollegen weiter. Herr Schreiner, Herr Köhler, ich wäre dankbar, wenn einer von Ihnen morgen bei der Obduktion dabei wäre. Bitte unterrichten Sie auch möglichst umgehend Ihre Presseabteilung, damit sie sich mit dem Pressesprecher meiner Behörde über die notwendige Pressearbeit abstimmt. Spätestens morgen früh wird eine gemeinsame Presseerklärung erfolgen müssen. Ach, und dann habe ich noch eine Bitte. Vermerken Sie bitte in den Akten, bevor Sie diese an den zuständigen Abteilungsleiter in der Staatsanwaltschaft abgeben, dass ich bereit bin, den Fall zu bearbeiten.“
„Machen wir“, sagte Schreiner, bevor sich Schultz von allen förmlich verabschiedete und zu seinem Wagen ging.
Auf der Heimfahrt überlegte Schultz, ob nicht Schreiner und Köhler seinen letzten Hinweis falsch verstanden haben konnten. Vielleicht nahmen sie an, dass er mit seinem Bearbeitungswunsch des Falles seine Beförderungsmöglichkeiten verbessern wollte und gar kein wirkliches Interesse an der Lösung habe.
Natürlich waren die Beförderungschancen bei der Staatsanwaltschaft schlecht, viel schlechter als bei der Polizei. Dort wurden manchmal im Jahr mehrere tausend Beamte befördert. Das lag an der Einführung der zweigeteilten Laufbahn bei der Polizei. Alle wurden gleich als Kommissare eingestellt, nicht mehr wie früher als Polizeimeister in weit niedrigeren Gehaltsstufen.
Schultz ärgerte sich über die trotzdem anhaltende schlechte Stimmung bei der Polizei. Was wollten die denn noch? Die sollten sich einmal die Verhältnisse in der Justiz anschauen. Die war im Vergleich zur Polizei ein Armenhaus mit weit geringerer politischer Durchsetzungsfähigkeit. Als aufmerksamer Beobachter seines beruflichen Umfelds wusste Schultz, dass bei der Staatsanwaltschaft zum Beispiel nur ein Fünftel der Kollegen ein einziges Mal in ihrem Berufsleben befördert wurden. Und dort sprach man nie von Demotivation.
Die formale Voraussetzung, sich auf eine offene Oberstaatsanwaltsstelle bewerben zu können, hatte Schultz vor einiger Zeit erfüllt. Da war er für sechs Monate an die vorgesetzte Behörde, die Generalstaatsanwaltschaft, abgeordnet worden. Allerdings war seine Beurteilung, die er am Ende erhalten hatte, nicht sehr gut ausgefallen. Das hatte ihn geärgert. Aber er hatte sein Selbstbewusstsein rasch mit der gewachsenen Überzeugung zurückgewonnen, dass er wohl zu wenig devot aufgetreten war.
Von daher hatte er natürlich schon ein persönliches Interesse an herausgehobenen Verfahren, weil er damit positiv auf sich aufmerksam machen konnte. Schließlich wollte er nicht, dass nur immer seine Frau auf der Karriereleiter voranschritt.
Aber diese persönlichen Interessen mussten Schreiner und Köhler nicht wissen. Ihnen würde er bei passender Gelegenheit vorsorglich die fachlichen Gründe erläutern, warum sie in dem Vorgang auf sein Bearbeitungsinteresse hinweisen sollten. Das könnte schon morgen früh bei der Obduktion geschehen.
***
Es war genau 10.48 Uhr, als Hanspeter Schultz am nächsten Morgen an der Kennedyallee auf dem Parkplatz vor einer eindrucksvoll stilecht renovierten Villa aus der Gründerzeit im westlichen Teil von Frankfurt seinen PKW abstellte.
Als er aus seinem Fahrzeug stieg, ging ihm durch den Kopf, dass wohl niemand ohne nähere Kenntnis der Örtlichkeiten hinter diesen Mauern das gerichtsmedizinische Institut vermuten würde. Noch während er auf das Haus zuging, überlegte er, wie oft er in den letzten Jahren schon hierher gegangen war. Im Durchschnitt hatten seine Kollegen und er etwa alle sechs Wochen den Obduktionsdienst wahrzunehmen. Manchmal wurden dabei drei oder auch noch mehr Leichen seziert. Am Anfang hatte er Probleme gehabt, das Geschehen mit der Menschenwürde in Einklang zu bringen. Oft war es einfach zu grässlich, in welchem Zustand sich die Leichen befanden und welche Untersuchungen an ihnen vorzunehmen waren.
Übel war ihm dabei glücklicherweise von Anfang an nicht geworden. Vielen seiner Kollegen und vornehmlich auch den Teilnehmern von Studentengruppen, die im Rahmen des Jurastudiums auch mit dieser Arbeit vertraut gemacht wurden, war es schlechter ergangen. Einige hatten sich sogar übergeben müssen.
Was hatte Schultz nicht schon alles im Rahmen des Obduktionsdienstes mit angesehen. Besonders scheußlich hatte sich für ihn die Sektion einer Leiche dargestellt, die im Taunus aufgefunden worden war, nachdem sie dort im Sommer etwa sechs Wochen mit dem Gesicht auf der Erde gelegen hatte. Die Sektionsgehilfen hatten den Toten auf die Edelstahloberfläche des Sektionstischs gehoben und zu einem Spülbecken gerollt. Als die diensttuenden Ärzte die Reinigung der Leiche mit einer Wasserdusche veranlasst hatten, war der Abfluss durch die abgespülten Maden verstopft worden.
Dieser Vorfall war ihm nächtelang nachgegangen. Zahlreiche Albträume, die er in der Folgezeit hatte, führte er hierauf zurück.
Es war allerdings eine andere Obduktion gewesen, die Sektion eines Säuglings, die ihn bis heute am meisten belastete. Jedes Mal, wenn er hierher kam, musste er daran denken. Als die Schädeldecke des Kindes vorschriftsmäßig mit einem medizinischen Gerät, das einer Geflügelschere glich, geöffnet wurde, hatte er fest die Zähne zusammenbeißen und mit den Tränen kämpfen müssen.
Kurz vor diesem Obduktionsdienst hatte Hanspeter Schultz erfahren, dass seine einzige Tochter an Leukämie erkrankt war. Ständig hatte er deshalb sein eigenes Kind vor Augen. Schon zum damaligen Zeitpunkt hatten ihm die Ärzte, von denen seine Tochter behandelt wurde, wenig Hoffnung auf ein Überleben gelassen. Tatsächlich war das einzige Kind, das seine Frau und er hatten, einige Monate später an den Folgen der Krankheit gestorben.
Die anschließende Zeit war die fürchterlichste seines Lebens gewesen. Monatelang war seine Frau kaum zu beruhigen gewesen und immer wieder kurz vorm Durchdrehen. Durch die Gnade des Zeitablaufs hatte sie dann irgendwann wieder zu ihrer früheren Kraft und Durchsetzungsfähigkeit zurückgefunden. Obwohl sie es sich sehr gewünscht hatten, war sie nie mehr schwanger geworden.
Schultz öffnete die angelehnte Haustür. Unmittelbar hinter dieser führten rötliche Sandsteinstufen in ein durchgängig weiß gekacheltes Untergeschoss. Vorbei an einigen Edelstahlbahren, auf denen die Konturen von mit Tüchern abgedeckten menschlichen Körpern zu erahnen waren, ging er auf den Obduktionsraum zu. Von dort hörte er Stimmen. Als er eintrat, sah er im Neonlicht um den Obduktionstisch herum Frau Dr. Lubitsch im weißen Kittel und Herrn Köhler, dessen rote Pausbäckchen durch den Lichteinfall wie Weihnachtsäpfel leuchteten. Auf dem Tisch lag die entkleidete Leiche von Manfred Hübner.
Am Fußende des Obduktionstisches stand ein weiterer Mann, der ebenfalls in weiß gekleidet war. Der Mann hatte braunes streng gescheiteltes Haar, das offenbar mit Pomade fest auf die Kopfhaut gedrückt war. Seinem rötlichen und etwas aufgedunsenen Gesicht nach litt er unter Bluthochdruck. Vielleicht kam auch manchmal etwas viel Alkoholgenuss hinzu. Er war mittelgroß und blickte nachdenklich auf seine weißen Birkenstocksandalen herunter. In der rechten Hand hielt er ein Stück Kreide, mit dem er offenbar schon die persönlichen Daten von Manfred Hübner auf die Tafel geschrieben hatte.
Bei dem Mann handelte es sich um einen der beiden im Wechsel als Sektionsgehilfe tätigen Bediensteten des Instituts, Herr Teilhaber. Teilhaber war ein unauffälliger Mann, mit dem Schultz in all den Jahren noch keine drei Sätze über die übliche Begrüßung hinaus gewechselt hatte. Anfangs hatte sich Schultz über dessen Verschlossenheit gewundert. Er hatte geglaubt, dass ein Mensch, der jeden Tag eine derart belastende Tätigkeit ausübe, sein Ventil im Gespräch suchen müsse. Einmal war Schultz in den Obduktionsraum gekommen und hatte Teilhaber bei den Vorbereitungen einer Sektion angetroffen, während er gleichzeitig ein Käsebrot gegessen hatte. Teller, Serviette und eine Kaffeetasse hatte er auf der Heizungskonsole abgestellt. Schultz war zunächst völlig verblüfft gewesen. Dann war ihm aber aufgegangen, dass Teilhaber offensichtlich auf diese Weise Normalität in seine Arbeit einbrachte.
„Was gibt’s Neues?“, fragte Schultz, ohne jemanden konkret zu fixieren.
„Eigentlich nicht viel“, sagte Frau Dr. Lubitsch. „Nach der Kopfverletzung zu urteilen, wie sie sich nach der spurenschonenden Reinigung des Opfers darstellt, dürfte der Schuss von oben nach unten abgegeben worden sein. Ich will aber nicht Herrn Professor Wagenknecht vorgreifen. Wir werden das gleich gemeinsam erörtern. Ich will damit nur sagen, dass ich zuversichtlich bin, das Projektil im Kopf vorzufinden.“
„Das wäre ein kleiner Schritt nach vorn“, bemerkte Schultz, brach dann aber ab, weil Professor Wagenknecht hinzukam.
Schon rein äußerlich erfüllte Professor Wagenknecht alle klischeehaften Vorstellungen über einen Halbgott in Weiß. Sein scharf geschnittenes Gesicht erweckte den Eindruck, als komme er von einer kosmetischen Behandlung, so weich und gepflegt erschien seine Haut. Es wurde von halb über den Ohren liegenden grau-schwarzen, gewellten Haaren umrahmt. Weit vorne auf der Nase trug er eine randlose Brille. Unter dem halb geöffneten weißen Kittel schaute eine magentarote Krawatte mit kleinen grauen Punkten hervor.
Professor Wagenknecht bewegte sich gemessenen Schrittes in den Raum hinein und stellte sich an das Kopfende des Obduktionstisches. Ebenso kurz wie ersichtlich desinteressiert betrachtete er die Anwesenden.
„Guten Morgen“, sagte er, nahm das winzige Mikrophon eines mitgeführten Diktiergeräts aus der Tasche seines Kittels, schaute wechselweise nach den Aufzeichnungen auf der Schiefertafel und zur Leiche und diktierte einen Abschnitt zu den Ergebnissen der äußeren Besichtigung des Opfers.
„Wie ich sehe, sind wir komplett“, sagte er anschließend. „Würden Sie bitte anfangen, Frau Kollegin!“
Frau Dr. Lubitsch fasste knapp den Sachverhalt zusammen und begann routiniert mit der Öffnung des Körpers der Leiche, der Brust- und Bauchhöhle, wobei ihr Teilhaber jeweils die notwendigen Instrumente reichte und die Angaben auf der Schiefertafel um die getroffenen Feststellungen, wie beispielsweise zum Gewicht der Organe, ergänzte. Währenddessen beobachteten Schultz und Köhler interessiert das Geschehen. Professor Wagenknecht diktierte die Teilergebnisse der Obduktion in sein Mikrophon.
Als sich Frau Dr. Lubitsch dem Kopf der Leiche zuwandte, trat Professor Wagenknecht näher heran.
„Das möchte ich jetzt schulmäßig ganz vorsichtig untersucht haben“, sagte Professor Wagenknecht mit leiser Stimme.
Schultz beobachtete, wie Frau Dr. Lubitsch sich von Teilhaber ein langes Instrument reichen ließ, das wie eine Stricknadel aussah. Vorsichtig führte sie es an der Stelle in den Kopfbereich ein, wo die Schädeldecke verletzt war. Dann sagte sie an Professor Wagenknecht gewandt:
„Der Schuss dürfte im linken Oberbereich des Schädels angesetzt worden sein. Der Schusskanal verläuft nach unten in den rechten Kieferraum. Der Täter muss sich von hinten ganz nahe an das Opfer herangeschlichen haben, während es auf dem Gartenstuhl saß. Den Schmauchspuren nach zu urteilen muss der Täter die Schusswaffe nahezu am Kopf des Opfers aufgesetzt haben.“
Professor Wagenknecht trat näher heran, nahm Frau Dr. Lubitsch das Instrument aus der Hand und führte es noch einmal selbst vorsichtig in die Öffnung der Schädeldecke ein. Er prüfte noch einmal genau, wie tief das Instrument sich ohne Widerstand versenken ließ. Dann lächelte er kaum wahrnehmbar.
„Ich stimme Ihnen zu, Frau Kollegin. Sie können jetzt fortfahren und die Schädeldecke öffnen.“
Nachdem Frau Dr. Lubitsch entsprechend verfahren war, wurde das Gehirn Stück für Stück untersucht, um den Schussverlauf in dem zu erstellenden Gutachten genau dokumentieren zu können. Im Knochenbereich unterhalb der Nasenwurzel stieß Frau Dr. Lubitsch auf fühlbaren Widerstand. Millimeter für Millimeter arbeitete sie sich weiter vor. Dabei ließ sie sich von Teilhaber immer wieder Tupfer zur Entfernung der austretenden Körperflüssigkeiten geben und zog schließlich mit einer länglichen Pinzette ein Projektil hervor.
„Da haben wir das Ding“, sagte sie. „Es ist leicht deformiert, weil es auf Knochen geprallt ist …“
„Wir stellen fest, dass als Todesursache eine Schussverletzung angenommen werden muss“, unterbrach sie Wagenknecht. „Alles andere, wie etwa die Fragen, um welche Waffe und welche Munition es sich handelte, ist Sache dieser beiden Herren.“
Selbstbewusst rieb sich in diesem Augenblick Köhler die Hände und richtete das Wort an Professor Wagenknecht:
„Das Kaliber ist neun Millimeter. Das sieht man auf den ersten Blick. Den Rest werden wir noch ermitteln. Nicht wahr, Herr Schultz, da sind wir doch sicher einer Meinung!“
Da Schultz der Anlass nicht bedeutungsvoll genug erschien, um mit Köhler in eine Diskussion über die Rollenverteilung zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei einzutreten, nickte er fast unmerklich. Zu mehr blieb auch keine Zeit, da Professor Wagenknecht wieder das Wort ergriff:
„Nun meine Herren, dann haben wir ja jetzt ein medizinisches Ergebnis, mit dem sie weiterarbeiten können. Das Gutachten lasse ich Ihnen umgehend zukommen. Sie können natürlich gerne noch hier bleiben, bis die restlichen Arbeiten abgeschlossen sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen arbeitsreichen Tag.“
Schultz wusste, dass jetzt die untersuchten Leichenteile wieder in den Körper eingelegt werden würden, um die Leiche in einen angemessenen Zustand zu versetzen. Manchmal kam es vor, dass Angehörige die Leiche sehen wollten, manchmal mussten sich auch Zeugen die Leiche zum Zwecke einer Wiedererkennung anschauen.
Draußen wandte sich Schultz an Köhler:
„Bevor wir gleich besprechen, wie wir weiter vorgehen, darf ich Sie noch einmal darum bitten, in dem Aktenstück nicht den Hinweis auf meinen Bearbeitungswunsch zu vergessen. Ich bin zwar für den Buchstaben ,H‘ nicht zuständig, aber dem entsprechenden Kollegen möchte ich dieses Verfahren noch nicht zumuten, da er erst ein paar Monate Berufserfahrung hat. Mein Abteilungsleiter, mit dem ich darüber heute Morgen schon gesprochen habe, teilt meine Meinung.“