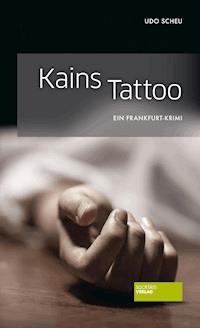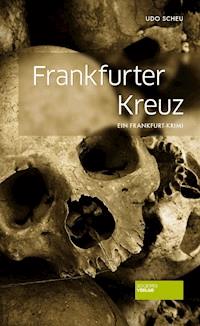Udo Scheu
Kains Tattoo
Ein Frankfurt-Krimi
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2013 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Satz: Nicole Ehrlich, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Nicole Ehrlich, Societäts-Verlag
Umschlagabbildungen: © Artem Furman - fotolia.com
eBook: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
ISBN 978-3-95542-063-5
Die Romanfiguren sind ausnahmslos Geschöpfe des Autors, die gesamte Handlung ist seiner Fantasie entsprungen. Jede Übereinstimmung mit lebenden Personen oder tatsächlichen Geschehnissen wäre rein zufällig.
„Ich stell mir einfach vor, es (Anm.: das zerbrochene gläserne Einhorn) hat eine Operation gehabt. Das Horn wurde ihm abgenommen, damit es sich nicht mehr vorkommt – wie eine Missgeburt! (...) Jetzt wird es sich bei den anderen Pferden wohler fühlen …“
(Tennessee Williams, Die Glasmenagerie)
Der Herr machte dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wer immer ihn finde.
(Die Bibel, Altes Testament, 1. Buch Moses, 4, 15)
Prolog
Der kleine Junge schrak aus dem Schlaf auf. Er schaute sich um. Sein neues Zimmer war ihm noch nicht vertraut. Erst vor zehn Tagen hatten seine Eltern das elegante Haus im Dichterviertel des Frankfurter Stadtteils Eschersheim bezogen. Die herrschaftliche Villa war zuvor noch monatelang renoviert und den Ausstattungsansprüchen der heutigen Zeit angepasst worden.
Das Kind rieb sich die Augen. Es musste schlecht geträumt haben. Da war dieses hämmernde Ticken gewesen, das sich mehr und mehr und immer lauter in seinem Kopf eingenistet hatte. Irgendwann hatte dann seine jüngere Schwester in das Konzert eingestimmt und begonnen, pausenlos zu heulen. Nur, dass ihm ihr Gejammer nicht fremd war. Sie schrie vielmehr ständig. Tag und Nacht. Das war ihm zur Gewohnheit geworden.
Ärgerlich schaute der Junge auf seinen Wecker neben dem Bett. Es war erst kurz vor sechs Uhr. Von draußen fielen die ersten Sonnenstrahlen auf die Fensterscheiben. Mit beiden Händen schlang sich der Junge sein Kopfkissen um die Ohren. Er wollte noch schlafen. Darauf hatte er sich mächtig gefreut, als er vor wenigen Tagen sein glänzendes Versetzungszeugnis in die vierte Klasse erhalten hatte und in die Sommerferien verabschiedet worden war.
Das Ticken hörte nicht auf. Mit penetrantem Rhythmus bohrte es sich durch die Daunen. Also doch kein Traum!
Der Junge nahm sich vor, nicht hinzuhören. Es gelang ihm nicht. Er warf sein Kissen zu Boden, setzte sich im Bett auf und lauschte. Ein heller Doppelton, danach eine kurze Pause. Dann wieder der Doppelton. Was mochte das sein? Es hörte sich wie sein kleines Radio an, wenn er an den Knöpfen herumdrehte und keinen Sender fand.
Das Kind knöpfte seine rot-weiß gestreifte Schlafanzugjacke zu und stand auf. Es zog die Hosen hoch, streifte mit dem Zeigefinger unterhalb der feuchten Nase entlang und ging auf den Flur. Das Geräusch verstärkte sich. Es kam offenbar aus dem Erdgeschoss. Mit seinen nackten Füßen lief der Junge die geschwungene Holztreppe hinunter. Weil der geblümte Teppichläufer die Treppenränder aussparte, blieb er auf der Mitte der Stufen. Die äußeren Holzdielen vermied er sorgfältig, weil sie ihm zu kalt waren.
Am Ende der Treppe blieb er stehen. Sein Atem ging schnell. Er sah sich nach allen Seiten um und horchte. Da war es wieder. Tick, tick. Pause. Tick, tick. Er suchte nach Erklärungen, um sich zu beruhigen. Vielleicht hatten Vater oder Mutter vergessen, ein elektrisches Gerät auszuschalten.
Es kam von rechts. Der Junge wandte sich den dortigen Türen zu, die alle geschlossen waren. Er marschierte von Tür zu Tür und legte jeweils sein Ohr an die Füllung. Da sie erst ein paar Tage hier wohnten und nicht alles fertig eingerichtet war, fehlte ihm noch die Vorstellung, wie die Räume im Einzelnen genutzt wurden.
Als er sein Ohr gegen die dritte Tür presste, stockte er. Dies musste das Zimmer sein. Er konzentrierte sich. Obwohl das fortwährende Kreischen seiner Schwester ihn störte, war er sicher, dass das Ticken hier am stärksten zu hören war.
Sein Herz klopfte. Die Stimme klang zaghaft und brüchig. „Mama?“
Nichts! Keine Antwort. Er holte tief Luft und straffte seinen Oberkörper. Behutsam legte er seine kleine Hand auf die Türklinke. Fast verließ ihn der Mut, in das angrenzende Zimmer zu schauen.
Mit einem Mal schämte er sich. Was sollte das? Es gab hier nichts, was ihm hätte gefährlich werden können. Sollte er den Angsthasen spielen, sich heimlich wieder zurückziehen und das ganze Haus zusammenrufen und aufwecken? Sein Vater würde ihn mit Sicherheit auslachen. Und wenn er, wie so häufig, noch übermüdet wäre, würde er ihn überdies noch mit irgendeinem Verbot bestrafen. Oder sich über ihn lustig und ihn zum Gespött machen. So, wie er es gerne vor allen Leuten tat.
Nein, er wollte sich nicht blamieren und dem Vater den Triumph gönnen. Diesem Spielverderber, der sonst bei allem einen Rückzieher machte, weil er längst zu alt für Kinderspäße war.
Mit sachtem Griff öffnete der kleine Junge einen Spaltbreit die Tür. Er streckte den Kopf hindurch und musste zunächst seine Augen an das Dämmerlicht im Raum gewöhnen. Die Rollos waren bis zu den Fensterbänken heruntergezogen.
Nach und nach füllte sich der Raum mit Konturen. Sein Blick fiel auf ein breites Bett, über dem ein Wandregal angebracht war. Er begriff, dass er sich im Schlafzimmer seiner Mutter befand, die von seinem Vater getrennt schlief, weil sie schnarchte.
Genau von dem Holzbrett an der Wand kam das impertinente Geräusch, dieses infernalische Ticken. Der Junge strahlte übers ganze Gesicht. Na also! Sein Mut hatte sich gelohnt. Hier war die Quelle seiner Schlafstörung. Ein dämlicher Wecker, den seine Mutter offenbar vergessen hatte auszuschalten. Da, links auf dem Regal, stand das kleine silberne Ding. Ein Knopfdruck würde genügen, diesen nervigen Dauerton zu beenden.
Das Kind pfiff eine Melodie vor sich hin und bewegte sich Richtung Wandregal. Mit einem Mal zuckte es zusammen und blieb wie angewurzelt stehen. Warum brachte seine Mutter den Wecker nicht selbst zum Schweigen? Wo war sie überhaupt? Das Bett sah zerwühlt aus. Wie nach einem bösen Traum. Oder gar einem Kampf?
Wieder stieg Angst in dem Jungen auf. Er musste mehrmals hart schlucken. Verlegen fuhr er sich durch das Haar. Dann ging er auf Zehenspitzen weiter, als habe er Furcht, eine lauernde Gefahr würde über ihn hereinbrechen. Sein Rufen war kaum hörbar. Nur ein Hauch. „Mama?“
Stille! Bis auf das Ticken. Aufdringlich und unbarmherzig.
Er ballte die Fäuste als Mittel gegen die Angst und schlich näher, bis er vor dem Bett stand. So hätten die furchtlosen Helden, die er in Comics und Fernsehserien ständig bewunderte, auch gehandelt.
Alles unverändert. Doch um an den Wecker zu kommen, musste er zur Längsseite des Bettes gehen.
Er bog um das Bettende und blieb wie auf Knopfdruck stehen. Was er jetzt sah, ließ ihn seinen eigenen Zustand nicht mehr spüren. Sein ganzer Körper zitterte. Der Schweiß, der auf seiner Stirn ausbrach, vermischte sich mit dicken, kullernden Tränen und rann in Strömen über die Wangen. Dann tropfte er von der Kinnspitze auf die Schlafanzugjacke und hinterließ dort feuchte, dunkle Flecken. Die Zähne klapperten unkontrolliert in einem Rhythmus, der groteskerweise dem Ticken des Weckers glich. Tick, tick. Pause. Tick, tick.
Seine Fingernägel bohrten sich in die Handballen, bevor er die Hände zum Mund führte. Dann erschütterte ein spitzer, langer Schrei die Villa.
Alles blieb still. Nur das unaufhörliche Ticken und das Greinen der Schwester legten sich als monotoner Dauerschall über die gespenstische Kulisse.
Der Blick des Jungen glitt wieder zu Boden. Dort lag eine nackte Frau, die zu Lebzeiten höchstens dreißig Jahre alt gewesen sein mochte. Ihre Augen standen offen. Sie zeigten diese gebrochene Starre, wie sie nur im Tod geboren wird. Die Haare waren verklebt, der Mund stand weit offen. Wie ein bläulicher, geschwollener Klumpen drückte die Zunge gegen den Gaumen. Die Arme waren ausgebreitet, die Hände völlig verkrampft. Sie bezeugten einen letzten schweren und schmerzhaften inneren Kampf.
Neben der Frau waren unzählige Tablettenschachteln und -röhrchen verstreut. Vor ihr lagen eine leere Wasserflasche und ein umgekipptes Glas. Eine Handbreit von ihrem Gesicht entfernt lag ein Briefbogen.
Der Junge wischte mit dem Ärmel über seine verweinten Augen und sah zur Tür hin. Sein Aufschrei hatte noch immer niemanden herbeigerufen. In seinem Kopf hämmerte es. Was sollte er weiter tun? Er schluchzte laut auf. „Mama?“
Seine Mutter gab keine Antwort mehr. Nie mehr!
Unter Aufbietung aller Kräfte fasste er den Entschluss, der Leiche näher zu kommen. Dazu kniete er sich zuerst auf den Boden und krabbelte dann auf allen Vieren. So fühlte er sich stabiler.
Dann fiel sein Blick wieder auf das Blatt Papier. Jetzt sah er, dass es beschrieben war. Es war die Schrift seiner Mutter. Er kannte sie von der Kontrolle der Hausaufgaben her. Im Zeitlupentempo näherte er sich. Er streckte seinen Arm weit aus, um dem Leichnam nicht zu nahe zu kommen. Endlich hielt er das Blatt in der Hand. Die Schrift seiner Mutter war ordentlich. Eine Schönschrift. Er konnte sie gut lesen. Schritt für Schritt gelang ihm die Entzifferung.
Seid mir nicht böse. Auch unser Herrgott wird mich verstehen und bei sich aufnehmen. Obwohl ich alle Schuld trage. Das hast Du, Harry, mir immer wieder vorgehalten. Ich sah keinen anderen Ausweg. Ich habe Euch alle lieb. Alle!
Eure Mama.
Der Junge ließ das Blatt fallen. Ein erneuter Weinkrampf überkam ihn. Was um Himmels willen bedeutete dieser Brief? Verstanden hatte er nur, dass mit Harry wohl sein Vater Harald gemeint war. Mutter hatte ihn immer Harry genannt. Aber warum war sie jetzt tot? Irgendetwas Furchtbares musste passiert sein. Den Vater zu fragen, würde er sich nicht trauen. Der war immer so streng zu ihm. Aber was sollte er tun?
„Mama?“ Keine Antwort. Noch immer kniete er. Er betrachtete das entstellte Gesicht der Mutter und begann unter Tränen zu beten. War das ein Lächeln, das sie ihm eben geschenkt hatte? Plötzlich war er ganz ruhig. Ihm war kalt. Er wollte wieder ins Bett gehen. Das Ticken des Weckers und das Schreien der Schwester waren ihm auf einmal gleichgültig. Er fühlte sich unsagbar einsam und verlassen.
Mutterseelenallein.
1
Die Presse im Rhein-Main-Gebiet sprach am Morgen von einer Sensation. Selbst überregionale Zeitungen brachten die Nachricht auf der ersten Seite. Die lokalen Radiosender meldeten den Fund der Skulptur als Jahrhundertereignis und überboten sich in den Interviews mit Archäologen und Historikern. Das hessische Regionalfernsehen kündigte für den Abend eine Sondersendung an.
Es war noch nicht lange her, seit der Erdboden im Nordwesten von Frankfurt dem Spaten der Bauarbeiter bei Ausschachtungsgrabungen Widerstand geleistet hatte. Genau dort, wo vor Jahrhunderten das Römerkastell und die Lagerstadt Nida gestanden hatten, stießen die Werkzeuge in gehöriger Tiefe auf ein unnachgiebiges Hindernis.
Der Grabungstechniker war zunächst von einem Stück Fels ausgegangen. Er hatte die Parole ausgegeben, die Umrisse abzuklären, um den Brocken mit geeignetem schweren Gerät heben und entfernen zu können. Bei näherer Prüfung war jedoch aufgefallen, dass der Stein in einer ungewöhnlich weißen Farbe leuchtete und offenbar behauen, geglättet und poliert war. Dies war Anlass genug gewesen, die weiteren Arbeiten sofort einzustellen.
In einem nächsten Schritt hatte der Vorarbeiter den Architekten verständigt. Dieser hatte sich mit dem Direktor des Liebieghauses, einem auf der Sachsenhäuser Seite am Mainufer gelegenen Skulpturenmuseum, in Verbindung gesetzt. Unter einigen Auflagen hatte der Museumschef vom Landesamt für Denkmalpflege die Nachforschungsgenehmigung erhalten. Zuvor war er zu der Baustelle gefahren und hatte den freigelegten Teil des Fundstücks besichtigt. Auf den ersten Blick war ihm klar, dass es sich um ein Kunstwerk aus Marmor handeln musste.
Die Archäologen und Kunsthistoriker hatten den heutigen Tag für den Abschluss der Ausgrabungs- und Freilegungsarbeiten festgesetzt und Kommunalpolitiker wie auch Medienvertreter für den Vormittag zu einer öffentlichen Präsentation der Fundstücke eingeladen. Das gesamte Gelände ähnelte in der Seitenansicht einem Blätterteig. Die Grabungsfläche, ein rechteckiges, aus der Umgebung herauspräpariertes Areal, war mit Kleinwerkzeug von jedem losen Sandkorn befreit worden, um die Bodenstrukturen besser ablesen zu können.
Bereits eine Stunde vor Beginn der Festreden glich die komplette Umgebung einem Tollhaus. Übertragungsfahrzeuge sämtlicher gängiger Fernseh- und Radiosender standen um die Absperrungen herum. Eine Unzahl von Reportern drängte sich durch den schmalen Zugang zur Baustelle und kämpfte vor dem provisorischen Rednerpult am Eingang eines dunkelbraunen Zeltes um die besten Plätze.
Ein kleinerer Kreis von Journalisten lief auf dem Ausgrabungsgelände herum, schoss Fotos und holte sich von dem Grabungstechniker und Entdecker ein paar Informationen. Eines der Teams bat sogar einen Mann mit einem gelben Schutzhelm auf dem Kopf, eine Spitzhacke in die Hand zu nehmen und die Szene nachzustellen, bei der ein Werkzeug auf die Marmorskulptur aufgeschlagen war. Die zwischenzeitlich aufgestellte Zeltstadt passte allerdings nicht mehr so recht zu diesem Motiv.
Pünktlich auf die Minute setzte die herbeigeeilte hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst zu einer Begrüßungs- und Dankesrede an. Vom Kreis der Zuhörer aus war ihr Gesicht kaum zu erkennen. Ein riesiger bunter Pulk von Mikrofonen streckte sich wie eine Ansammlung von Gummibällen ihrem Mund entgegen. Die vielfarbigen Ummantelungen hätte man aus einiger Entfernung für einen Strauß von Frühlingsblumen halten können.
Als weitere Redner folgten die Oberbürgermeisterin, der Landesarchäologe und der kommunale Kulturdezernent, alle unter dem sogleich gebrochenen Versprechen, sich kurz fassen zu wollen. Schließlich beseitigten einige umstehende Fachleute die Sichtblenden von einer überdachten Lafette, wobei die anwesenden Politiker mithalfen, solange sich die Reporter für diese Arbeiten interessierten. Kameras begannen zu surren. Ein Blitzlichtgewitter entlud sich auf der mannsgroßen weißen Marmorstatue eines Jünglings, einem römischen Kunstwerk von erlesener Schönheit. Das Gesicht zeigte weiche, mädchenhafte Züge. Die Schulter war leicht gedreht. Die Arme hingen herab. Mit dem rechten Bein deutete die Skulptur einen Schritt nach vorn an. Auf dem Sockel prangte in großen eingemeißelten Buchstaben der Name ANTINOOS.
Der Direktor des Liebieghauses, Doktor Jonas Stadelmann, sah sich unauffällig um und registrierte zufrieden, dass sich die Aufmerksamkeit der Reporter anderen Personen zugewandt hatte. Er zupfte den Landesarchäologen Moritz Haverkamp am Ärmel seines wollweißen Staubmantels und machte mit dem Kopf eine Bewegung zu einem weiter hinten gelegenen Zelt hin. Anschließend arbeitete er sich mit kleinen Schritten rückwärts aus der Hauptansammlung von Menschen heraus. Dabei nahm er eine gebückte Haltung ein, weil er befürchtete, mit seiner überdurchschnittlichen Körpergröße entdeckt und von seinem Vorhaben abgehalten zu werden. Er erreichte das Zelt fast zeitgleich mit Haverkamp, der seinen Rückzug aus der Menge aufgrund seines bemerkenswerten Bauchumfangs nur unter heftigem Drängen und mit einigen Entschuldigungsfloskeln erkämpfen konnte.
Stadelmann schob die Zeltplane vor dem Eingang zurück und trat ein. Bevor er sein maßgeschneidertes Sakko ablegte und sich auf einen der umstehenden Regiestühle setzte, warf er noch einen Blick in einen übergroßen Spiegel, der in ein Regal eingelassen war. Er ordnete sein gewelltes graues Haar und schob die randlose Brille von dem langen Nasenrücken zu den wasserblauen Augen. Es gehörte zu seinem Ritual, dass er dabei seine eingefallenen Wangen aufblies und ein unterdrücktes Grunzen von sich gab. Anschließend bot er mit einer ausholenden Handbewegung dem zwischenzeitlich eingetretenen Haverkamp einen Platz an.
Haverkamp ließ sich ungebremst in den Stuhl fallen. Er wischte sich mit dem Handrücken über seine faltige, schweißnasse Stirn und fuhr sich dann mit der feuchten Hand über seinen Ostfriesenbart. „Ich will nicht unverschämt sein. Hätten Sie vielleicht etwas zu trinken für mich? Solche Auftritte sind nichts für mich. Das schafft mich völlig. Ich bin mehr ein Kind der Wissenschaft.“
Kaum wahrnehmbar nickte Stadelmann mit dem Kopf und stand auf. Er drehte sich zu einem am Boden stehenden Kasten mit Mineralwasser, sodass sein spöttischer Blick für den Gast nicht sichtbar wurde. Es kostete ihn einige Anstrengung, bei dem Anblick des aufgelösten Schwergewichts nicht laut zu lachen. Vor einigen Tagen hatte er Haverkamp in dessen Büro in Wiesbaden besucht. Haverkamp hatte ihm gesagt, in welchem Umfang das Land Hessen seine Nachforschungen finanziell unterstützte. Außerdem hatte er ihm noch Spenden der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Aussicht gestellt. Dafür hatte Stadelmann auf sein Recht verzichtet, als Ausgräber zuerst die Ergebnisse veröffentlichen zu dürfen. Zugleich hatte er regelmäßige Berichte über die Grabungsfortschritte versprechen müssen. Am Ende des Gesprächs hatte er Haverkamps Bitte entsprochen, ihn in seinem Auto mit nach Frankfurt zu nehmen. Als er von der Bahnhofstraße nach rechts Richtung Autobahn abgebogen war und dabei leicht den Bordstein gestreift hatte, war sein Fahrzeug tatsächlich auf der Beifahrerseite leicht aufgesetzt. Mit einem unbeeindruckten Schmunzeln hatte er dies auf die imponierende Leibesfülle von Haverkamp zurückgeführt. Stadelmann gab sich einen Ruck, um wieder ernst zu werden. Er griff nach einem Glas, das wegen der Staubentwicklung umgedreht auf dem Regal stand, goss es voll und drückte es seinem Gast in die Hand. „Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Was heißt hier Kind? Man merkt Ihnen sofort an, dass Sie ein sehr gewichtiger Vertreter der Wissenschaft sind.“
In einem Zug leerte Haverkamp das Glas und nahm es von einer Hand in die andere. Sein Gesichtsausdruck offenbarte eine Mischung aus Verlegenheit und Ratlosigkeit. Während Stadelmann ihm das Glas abnahm, rutschte Haverkamp auf seinem Stuhl nach vorn und presste die Arme auf die Lehnen. „Lassen wir das mal so stehen. Sagen Sie mir lieber, warum Sie mich hier unter vier Augen sprechen wollten. Ich verstehe sowieso den ganzen Trubel nicht. Wieso haben Sie die Figur nicht, wie sonst üblich, erst geborgen und danach die Presse informiert? Dann hätten wir eine ordentliche Ausstellung gemacht und in Ihrem Büro einen schönen Sekt auf den Erfolg trinken können.“
Stadelmann winkte ab. „Das wäre mir auch lieber gewesen. Leider hatte jemand vom Ausgrabungsteam unsere Entdeckung frühzeitig an eine Boulevardzeitung verraten. Der Reporter war drauf und dran, den Fund umgehend als Schlagzeile zu präsentieren. Mit großer Überredungskunst versprach ich ihm einige exklusive Informationen und konnte ihn so davon abhalten, sein Vorhaben umzusetzen.“
Der erhobene Zeigefinger, die hochgezogenen Augenbrauen und die ratlose Miene Haverkamps verdeutlichten, dass er voller Sorgen und Bedenken war. „Damit haben Sie allerdings die Fundstelle und den Erfolg der Ausgrabungen einem erheblichen Risiko ausgesetzt. Stellen Sie sich einmal vor, diese Zeitungsleute wären heimlich auf das Gelände vorgedrungen, um Fotos zu machen. Was hätte da nicht alles zerstört werden können. Außerdem hätten sie etwas mitgehen lassen können. Hatten Sie mir nicht gesagt, dass Sie außer der Statue noch eine Reihe anderer Sachen ausgegraben haben?“
Der Rücken Stadelmanns versteifte sich. Dadurch überragte er sein Gegenüber selbst im Sitzen um mehr als einen halben Kopf. Er amüsierte sich, beherrschte jedoch sein Lächeln, um seine Verachtung für die Ängstlichkeit Haverkamps nicht allzu sichtbar werden zu lassen. Bei diesem Beamtentyp passte eben alles ins Bild. Das Wesen harmonierte nach Stadelmanns Ansicht prächtig mit dem billigen Konfektionsanzug, den Haverkamp heute trug. Wie jedes Mal, wenn sie sich trafen. „Alles der Reihe nach. Hätten Sie denn eine Idee gehabt, wie wir die Bewachung der Ausgrabungsstätte rund um die Uhr finanzieren sollen? Die Polizei würde dies kaum übernehmen. Ein privates Sicherheitsunternehmen kostet ein Vermögen. Also blieb nur übrig, mit dem Reporter zu verhandeln.“
Haverkamps Miene drückte Zweifel aus. „Belassen wir es dabei. Zum Glück ist weiter noch nichts passiert. Und heute wollen Sie ja die Statue und die anderen Fundstücke abtransportieren lassen. Können Sie in Ihrem Museum dafür garantieren, dass wir keine unangenehmen Überraschungen erleben?“
Die Stimme Stadelmanns klang nun gereizt. „Es ist nur noch die Skulptur auf dem Gelände. Alles Übrige haben wir längst weggeschafft. Darüber verlieren wir auch kein Wort gegenüber der Presse. Erst wollen wir alles sorgfältig auswerten und entschlüsseln.“
Das Gehabe und der Tonfall Haverkamps wurden plötzlich schulmeisterlich. „Ihnen ist aufgefallen, dass die Figur nicht ganz vollständig ist?“
„Natürlich. Ich habe sie immerhin mit ausgegraben.“
Eine steile Falte über der Nasenwurzel gab Haverkamps Gesicht ungewollt eine komische Note. „Ich sage Ihnen jetzt meine Ansicht zu der Sache: Da ist nichts abgebrochen. Dieser Defekt sollte so sein. Der Künstler hat die Teile mit Absicht weggelassen.“
Stadelmanns Lächeln kehrte zurück. Er nestelte an seiner Brille herum, setzte sie ab und putzte mit einem Taschentuch über die Gläser. Aus den Augenwinkeln beobachtete er dabei Haverkamp, der aufgeplustert im Regiestuhl thronte und sich mit den Fingernägeln über den Bart strich. Stadelmann fiel ein, dass Haverkamp sein Jahrgang sein musste, da er ihn im vergangenen Jahr anlässlich seines sechzigsten Geburtstags in seinem Wiesbadener Büro besucht hatte. Bei allem Respekt war er überzeugt davon, jünger als sein Gast auszusehen. Zwar hatte Haverkamp noch volles blondes Haar, während er selbst schon lange ergraut war. Aber vom übrigen Aussehen her und was die geistige Fitness anlangte, meinte er einen deutlichen Vorsprung zu haben. Mit zufriedenem Grunzen setzte er seine Brille wieder auf und sah sein schwitzendes Gegenüber an. „Ich gebe Ihnen recht.“
Ein leichtes Zucken der Augen ließ darauf schließen, dass Haverkamp von der widerspruchslosen Zustimmung überrascht war. Seine pausbäckigen Wangen zitterten. Das Spiel der Hände verriet Aufregung. „Haben Sie eine Erklärung dafür?“
„Nein. Noch nicht. Vielleicht geben uns die übrigen Fundstücke Aufklärung.“
Haverkamp faltete die Hände über dem Bauch. „Werden Sie bitte deutlicher. Was genau haben Sie sonst noch ausgegraben?“
Wieder setzte Stadelmann sein spitzbübisches Grinsen auf. „Jede Menge Münzen. Überwiegend aus der Regierungszeit des römischen Kaisers Hadrian und der Zeit davor. Spätere Münzen gibt es keine. Außerdem haben wir an der äußersten westlichen Grabungsstelle in unmittelbarer Nähe der Fundstelle der Statue Fundamente und Mauerreste gefunden, die zu einem Tempel gehören könnten. Wie wir wissen, ließ Hadrian seinen Lustknaben Antinoos nach dessen Tod als Gott verehren.“
Der Gesichtsausdruck und die Haltung von Haverkamp präsentierten erneut die Lehrerrolle. „Das mag alles sehr spannend sein, was Sie da erzählen. Was in aller Welt hat dies aber mit der Unvollständigkeit der Skulptur zu tun?“
Das laute Lachen von Stadelmann irritierte Haverkamp derart, dass er in sich zusammensackte und mit fahrigen Bewegungen an seinen Fingernägeln spielte. Stadelmann genoss es und zögerte noch mit seiner Antwort. In seiner Stimme schwang Belustigung mit. „Nichts. Gar nichts.“
Haverkamp schüttelte sich. „Ich begreife nicht. Haben Sie meine Frage nicht verstanden? Wo ist der Schlüssel zu den weggelassenen Körperteilen? Die betreffenden Stellen an der Skulptur sind poliert. Ich wiederhole, dass damit ein Beweis für die vom Künstler beabsichtigte Unvollständigkeit vorliegt.“
Sein Gefühl sagte Stadelmann, dass er Haverkamp jetzt lange genug hingehalten hatte. Er wollte sich die Sympathie des Mannes nicht verderben, zumal er nicht ausschließen konnte, ihn zu dem einen oder anderen Zweck noch als Partner zu benötigen. Gleichzeitig entschloss er sich, keinesfalls zuzugeben, dass er seine Antworten bisher überwiegend spaßhaft aufgezogen hatte. „Ich kann gar nicht so schnell antworten, wie Sie fragen. Noch habe ich keine sichere Erklärung dafür, warum der Figur sämtliche Finger fehlen. Vielleicht gibt es aber eine Chance, das herauszufinden.“
„Und wie?“
„Wir haben noch mehr Sachen gefunden. Vor allem eine Menge Amphoren.“
„Und die sollen uns Aufschluss geben?“
Stadelmann neigte den Kopf. Seine nahezu silbernen Haarlocken fielen ihm dabei in die Stirn. „Vielleicht. Eines der Gefäße war fast völlig unbeschädigt. Und es hatte einen außergewöhnlichen Inhalt.“
Haverkamp rieb sich die verschwitzten Hände. „Spannen Sie mich nicht dauernd auf die Folter. Reden Sie schon weiter.“
Als habe er nicht zugehört, sah Stadelmann plötzlich auf das leere Wasserglas neben Haverkamp. Sein Gesicht zeigte keine Regung, obwohl er innerlich sein Lachen kaum unterdrücken konnte. „Entschuldigen Sie bitte. Ich bin ein schlechter Gastgeber. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten?“
Die Miene von Haverkamp verfinsterte sich. Er winkte ab. „Hören Sie auf damit und erzählen Sie weiter. Sie merken doch, dass ich jetzt endlich wissen will, was los ist.“
Stadelmann gab sich überrascht. „Tut mir leid. Es geht sofort weiter.“ Er fuhr mit der Hand zur Stirn. „Wo war ich eben noch stehen geblieben? Ach so, ja. Bei diesem Gefäß. Es war mit einer noch ungeklärten Substanz verschlossen und enthielt einen fragmentarisch erhaltenen Papyrus. Das ist, wie Sie wissen, für unsere Breitengrade neu. In den ewig trockenen Wüstenregionen hat man schon den einen oder anderen lesbaren Papyrus gefunden. Bei uns hier waren bisher alle ein Opfer der feuchten Witterung geworden.“
Haverkamp rutschte so weit auf dem Regiestuhl nach vorn, dass er leicht kippte. Durch eine Gegenbewegung konnte er gerade noch verhindern, aus dem Stuhl zu fallen. „Und? Was steht darauf?“
„Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir haben das gute Stück erst einmal fachmännisch gesichert. Es wird jetzt vorschriftsmäßig präpariert. Danach können wir uns daranmachen, es zu lesen und auszuwerten. Wie Sie wissen, wollen wir in naher Zukunft eine große Ausstellung machen. Vielleicht sind wir bis dahin so weit. Vorläufig halten wir das alles noch geheim, um unsere Ruhe zu haben. Wenn wir unter Druck arbeiten müssen, kommt nichts dabei heraus.“
„Darin haben Sie meine Unterstützung. Ihnen ist allerdings klar, dass ich sofort Bescheid wissen will, wenn es etwas Neues gibt. Sind Sie jetzt fertig mit Ihren Entdeckungen?“
Der selbstgefällige Tonfall Haverkamps verführte Stadelmann dazu, ihn noch einmal herauszufordern. „Falls Sie keine Zeit mehr haben und nach Wiesbaden zurück müssen, können wir unser Informationsgespräch gerne an dieser Stelle abbrechen. Ich will Sie nicht aufhalten.“
Haverkamp winkte mit einer raschen Bewegung ab. Er schien unwirsch. Seine Stimme hob sich. „Manchmal glaube ich, dass Sie mich absichtlich missverstehen wollen. Selbstverständlich habe ich Zeit, sofern Sie mir noch etwas Wichtiges zu sagen haben. Nur so war meine letzte Frage zu verstehen.“
Stadelmann entschloss sich, wieder einzulenken. „Schön, dass Sie noch ein paar Minuten übrig haben. Wie so oft im Leben kommt das Beste zum Schluss. Wir haben einen weiteren Fund gemacht, der in seiner Bedeutung dieselbe Aufmerksamkeit verdient wie die Skulptur.“
„So kommen Sie doch endlich zur Sache.“
„In der Erde war noch ein merkwürdiges Gefäß, das ebenfalls nahezu unversehrt war. Es verbarg einen seltsamen Gegenstand.“
„Sie treiben meine Gelehrten-Neugier fast auf die Spitze. Weiter!“
„Der Topf war völlig verharzt. Hier gilt das Gleiche wie für den Papyrus. Wir müssen erst noch eine Reihe von Vorarbeiten leisten, damit der Fund nicht zerstört wird.“ Stadelmann konnte sich nicht zurückhalten, noch eine Kunstpause einzulegen, um den sichtlich nervösen Haverkamp einen weiteren Moment schmoren zu lassen. Er nahm seine Brille ab, hielt sie am ausgestreckten Arm von sich weg und beugte sich mit verschwörerischer Miene zu Haverkamp hin. Seine Stimme geriet zu einem Flüstern. „Trotzdem wissen wir schon, was sich in dem Harz verbirgt.“ Noch einmal zögerte er, bevor er fortfuhr. „Es dürfte sich um ein Knochenfragment handeln.“
Die Aufregung stand Haverkamp ins Gesicht geschrieben. Seine aufgedunsenen Wangen färbten sich rötlich. Dadurch trat eine Reihe von Pusteln hervor. „Was für ein Knochen? Von einem Menschen?“
Stadelmann setzte ein Pokerface auf, um seine Unschlüssigkeit zu verbergen. Seine Lebenserfahrung sagte ihm, dass niemand außer seiner Ehefrau Karina, mit der er seit Jahrzehnten verheiratet war, den inneren Zwiespalt bemerken würde, in dem er sich mit der Antwort auf die gestellte Frage befand. Und selbst seine Karina hatte in der Vergangenheit bei den zahllosen Ausreden, zu denen er wegen seiner vielen Liebschaften mit jüngeren Frauen hatte greifen müssen, niemals Verdacht geschöpft. Da war er sich sicher. Genüsslich machte er sich einmal mehr klar, was für ein gut aussehender, aber auch im positiven Sinne durchtriebener Typ er war. Warum also sollte gerade Haverkamp, dieser unbedarfte Landesarchäologe mit seiner schlichten Beamtenseele, seine Heimlichkeiten durchschauen? „Hier tappen wir noch im Dunkeln. Sobald wir mehr wissen, werde ich Sie umgehend anrufen.“
Haverkamp erhob sich. „Ich bitte sehr darum. Sie wissen, dass in Ihrer Nachforschungsgenehmigung die Auflage enthalten ist, regelmäßig an uns zu berichten. Falls Sie diese Verpflichtung nicht einhalten, entziehe ich Ihnen die Genehmigung.“
Die Verabschiedung der beiden Männer fiel förmlich aus. Stadelmann begleitete Haverkamp nur wenige Schritte, bevor er sich rasch wieder vor der immer noch palavernden Menschenmenge in das Zelt zurückzog. Er ließ sich in seinen Stuhl fallen und dachte nach. Es war mehr ein Gefühl gewesen, das ihn bewogen hatte, Haverkamp nicht alles zu erzählen, was er bereits wusste. Eine unerklärliche Warnung in seinem Inneren hatte ihn davon abgehalten. Den Papyrus hatte er selbstverständlich einer vorläufigen Sichtung unterzogen und dessen Botschaft ihrem wesentlichen Inhalt nach gelesen. Das war ihm deshalb gelungen, weil der römische Verfasser vorsorglich seine Botschaft auch bestens erhaltenen Bronzeplättchen anvertraut hatte, wie sie damals für Militärdiplome benutzt worden waren. Ein Abgleich mit den Schriftresten auf dem Papyrus hatte Stadelmann die Identität der Mitteilungen bestätigt. Er rieb sich die Hände und grunzte. Die Veröffentlichung würde alle bisherigen historischen Erkenntnisse zu dem Liebesverhältnis zwischen Kaiser Hadrian und seinem Lustknaben Antinoos auf den Kopf stellen. Und erst recht der offenbar mumifizierte Knochen, der eine schreckliche Bestätigung der Behauptung in dem Papyrus bedeuten konnte. Dieser Knochen hatte einmal zu einem Menschen gehört. Er stammte vom Finger einer menschlichen Hand.
Mit einem Ruck stand Stadelmann auf und holte aus dem Seitenfach seines Schreibtischs eine Flasche Cognac und einen Schwenker. Er goss sich das Glas zu einem Drittel voll und nahm einen kräftigen Schluck. Sofort begannen seine Wangen zu glühen. Alkohol am Morgen war er nicht gewohnt.
Nachdem er wieder in seinem Stuhl saß und mit sanften Drehbewegungen den Rest des Cognacs unter seine Nase hielt, beschlich ihn ein Gefühl der Unsicherheit. Ob es ihm nach Jahren endlich gelänge, sich mit den Entdeckungen um die Antinoos-Skulptur einen Platz in der Reihe der unsterblichen Historiker zu erkämpfen? Er schätzte, dass die Chancen gut für ihn standen. Ein Traum würde in Erfüllung gehen. Das erkaufte Recht seiner Geldgeber, die Grabungsergebnisse zuerst veröffentlichen zu dürfen, wollte er auf gar keinen Fall respektieren.
Als Stadelmann endlich seinen Arbeitsplatz auf dem Ausgrabungsgelände verließ, ahnte er noch nicht, dass bei seinen weiteren Planungen der Tod mit am Tisch sitzen würde. Und eine maßlose Kette von Verbrechen unfassbarer Kaltblütigkeit und unerhörter, eisiger Gleichgültigkeit bei der Schändung der Opfer auslösen würde.
2
Die Endhaltestelle der Straßenbahn in der Rheinlandstraße im Frankfurter Stadtteil Schwanheim lag in einem diffusen Licht. Das kleine dunkelrote Backsteinhaus glänzte noch feucht von den morgendlichen Nebelschwaden, die sich erst spät verzogen und aufgelöst hatten. Es glich jetzt der Vorlage für einen ländlichen Bahnhof zur Ausstattung einer Modelleisenbahnanlage. Nur mühsam setzte sich die Sonne durch. Die Bahnsteige am Waldrand waren fast menschenleer. Es war beinahe Mittagszeit. Die Berufstätigen würden erst in einigen Stunden aus der Frankfurter Innenstadt und dem Umland zurückkehren. Auch in den Seitenstraßen zeigten sich nur vereinzelt Menschen. Sie huschten eilig an den Häuserwänden entlang, bis sie von irgendeinem der kleinen Cafés und Läden aufgesaugt wurden. Die wenigen Fahrzeuggeräusche wurden vom angrenzenden Wald verschluckt.
Als der Straßenbahnzug der Linie 12 mit quietschenden Bremsen nach mehrmaligem Rucken zum Stehen kam, musste Benjamin Zanker beim Aussteigen seinem silbergrauen Husky den Vortritt lassen, der das bevorstehende tägliche Programm erwartete und durch ein unbändiges Ziehen an der Leine seine Freude darüber zeigte. Am Ende der ausgeklappten Stufen drehte sich der Hund um und wartete. Zanker ging langsam hinterher. Fast wäre er gestolpert, da seine ganze Aufmerksamkeit dem Gesicht seines Vierbeiners gehörte. Seit mehr als fünf Jahren hielt er nun dieses Tier. Nach wie vor konnte er sich an den wasserblauen Augen und der schwarzen Maske nicht sattsehen, die seinem Husky ein nahezu diabolisches Aussehen verliehen.
Sie umrundeten den Klinkerbau neben dem Gleiskörper und näherten sich in westlicher Richtung einem Waldstück. Nach dem Überqueren der Straße liefen sie in gemäßigtem Tempo auf die Reihe der öffentlichen Grillplätze zu. Zanker warf einen sehnsüchtigen Blick zurück zur Straße Alt Schwanheim hin. An deren Ende lag, wie er noch gut in Erinnerung hatte, der Frankfurter Hof, den die Einheimischen nur als Seppche kannten. Wie oft hatte er früher in dieser Apfelweingaststätte auf einer der langen Bänke gesessen und der Blaskapelle zugehört, die jeden Mittwochabend spielte. Anfangs hatte die etwa zwanzig Mann starke Gruppe immer bis in den späten Abend hinein gespielt. Dagegen hatte sich jedoch ausgerechnet ein Pfarrer gerichtlich gewehrt, der diese Form der Unterhaltung als Lärm ansah. Da er zum Leidwesen der Gäste auch noch Erfolg damit hatte, endeten die Darbietungen danach spätestens um 21 Uhr.
Die meisten Musiker waren im Rentenalter, was sie nicht hinderte, jeden spendierten Schnaps oder Schoppen mitzutrinken. Kein Wunder! Sie waren eben bis auf kleinere Wehwehchen immer noch gesund.
Zanker seufzte wehmutig. Das galt nicht für ihn. Jedenfalls nicht mehr, seit er im vergangenen Jahr kurz nach der Rückkehr aus einem erholsamen Urlaub diesen verdammten Schlaganfall erlitten hatte. Dies war jedenfalls die Diagnose der Ärzte in der Uniklinik gewesen. Zwar hatte er, wie durch ein Wunder, keine sichtbaren Folgen davongetragen. Keine schiefe Lippe, kein lahmer Arm. Aber er musste sich schonen. Und zwar auf Dauer. Vor allem sollte er auf unabsehbare Zeit die Finger vom Alkohol lassen. Damit war ihm der Spaß an der Blasmusik genommen.
Immerhin hatte die Krankheit seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand bewirkt. Darüber war er nicht böse, zumal er bei seinem Lebensalter und seiner Besoldungsstufe eine auskömmliche Pension empfing. Schon Jahre vorher hatte er sich ausgemalt, was er alles nach seiner Pensionierung tun wollte. Seine Tätigkeit im Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main hatte ihm nie richtig gelegen. Deshalb fehlte sie ihm nicht. Immerhin hatte er es bis zum Stellvertreter des Chefs gebracht. Das war nicht ganz leicht gewesen. Er gehörte keiner politischen Partei an, was nach seiner Ansicht einen Nachteil bei Bewerbungen um eine höher bezahlte Stelle ausmachte. Jedenfalls glaubte er, für einen Chefposten das passende Parteibuch haben zu müssen. Das tröstete ihn darüber hinweg, dass ihm der ganz große Sprung an die Spitze nicht gelungen war. Andererseits bereute er seine parteipolitische Abstinenz nicht. Politische Themen gehörten zu seinem hauptsächlichen Interessengebiet. Allerdings passten seine Auffassungen zu keiner der existenten Parteien. Das konnte damit zu tun haben, dass er bereit war, aufgrund eines besseren Arguments auch einmal seine bisherige Meinung zu ändern. Wo kam so etwas heute noch in der Politik vor? Wer sich dort nicht streng an die vorgegebenen Sichtweisen hielt, riskierte, als Umfaller ausgegrenzt und mundtot gemacht zu werden. Das war nichts für ihn.
Natürlich waren die ganz wichtigen Dinge im Büro immer hinter seinem Rücken entschieden worden. Aber damit konnte er leben. Mochte er auch ein bisschen ehrgeizig gewesen sein, eitel war er jedenfalls nie. Und er hatte nie an seinem Büro gehangen. Dafür gab es einfach zu viele andere interessante Dinge, mit denen man sich beschäftigen konnte.
Etwas wie Langeweile kannte er nicht. Er ging gerne in Kaffeehäuser, betrachtete dort die Menschen und dachte über sie nach. Warum etwa das ältere Paar am Fenster seit einer Ewigkeit vor sich hinstarrte, ohne ein Wort zu reden. Oder warum jene zwei jungen Leute am Eingang sich ihre Rollen während des ganzen Aufenthalts in eine Rednerin und einen Zuhörer aufgeteilt hatten. Immerhin wirkte der junge Mann so, als habe er diese Aufgabe nicht ganz freiwillig übernommen.
Sobald Zanker sich genug mit den Gästen beschäftigt hatte, griff er zur Zeitung. Oder zu einem Buch. Er las gerne. Neben politischen Themen lagen ihm historische Betrachtungen sehr. Außerdem gab es zu Hause noch das Fernsehen. Es waren vor allem die Kulturprogramme, die ihn anzogen. Viele Abende brachte er damit zu, sich die Berichte über fremde Völker und Sitten anzuschauen. Außerdem war da schließlich noch seine Frau. Gemeinsam kochten sie gerne und plauderten danach bei einem Glas Wein bis in die späte Nacht hinein.
Aber vor allem gab es da noch Yukon, seinen Husky, der nach und nach zu seinem wesentlichen Lebensinhalt geworden war. Zanker lächelte vor sich hin. Yukon zuliebe war er jetzt auch wieder hierher nach Schwanheim gefahren. Nur, damit sein Kumpel und Beschützer, wie er ihn nannte, auf seine Kosten kam. Diese Rasse brauchte viel Bewegung. Die musste er ihm bieten, koste es, was es wolle.
An den Grillplätzen war Hochbetrieb. Überwiegend ausländische Familien mit kleineren Kindern bevölkerten das Areal. Die Männer unterhielten die Feuer und legten Fleischstücke und Würste auf, während die Frauen auf bunten Wolldecken saßen und irgendwelche Salatzutaten verarbeiteten.
Einige Kinder kamen auf Zanker zugerannt und bestaunten in gebührendem Abstand den Husky. Lächelnd winkte er sie zu sich heran. „Kommt nur her. Yukon tut euch nichts. Er sieht nur ein bisschen gefährlich aus, ist aber ganz harmlos. Ihr dürft ihn sogar vorsichtig streicheln.“
Die Kinder trauten dem Frieden nicht. Sie forderten sich lautstark gegenseitig auf, voranzugehen, machten voreinander ein paar wilde Gesten und vollführten tollkühne Sprünge. Näher als auf eine Körperlänge kam jedoch niemand heran.
Yukon würdigte das Theater um ihn herum mit keinem Blick. Er legte sich mächtig in sein Geschirr und versuchte, den Blick nach vorn, seinen Herrn zu einer schnelleren Gangart zu bewegen. Zanker tat ihm den Gefallen und ließ die Kinder hinter sich zurück.
Hinter dem Grillplatz öffnete sich eine Wiese, um die sich die angrenzenden Waldstücke wie ein Bilderrahmen legten. Zanker ließ Yukon von der Leine und genoss die strahlende Sonne, die heute fast eine goldene Farbe hatte. Trotzdem blies ein fühlbarer Wind. Er traf Zanker von der Seite. Zanker hielt den Kopf schief, weil er spürte, wie seine sorgfältig gekämmten Haare in Unordnung gerieten. Seit langem hatte er die vorhandenen Strähnen über dem linken Ohr wachsen lassen, um sie über seine Halbglatze verteilen zu können. Vor einiger Zeit war ein guter Freund auf ihn zugegangen und hatte ihm einen Kurzhaarschnitt vorgeschlagen. Da er dunkle Haare habe, gleiche seine Frisur einem schlecht belegten Brötchen. Das sei unter aller Würde. Seine Würde sitze woanders, hatte Zanker geantwortet, und war bei seiner Frisur geblieben.
Mit der flachen Hand versuchte er jetzt vorsichtig, die Haare wieder in die Ausgangslage zu bringen. Es ärgerte ihn ein bisschen, dass er den Erfolg nicht überprüfen konnte. Ein wenig entmutigt stapfte er weiter. Yukon zerrte nun so stark an der Leine, dass er ihn losmachte. Der Hund nutzte die neu gewonnene Freiheit und jagte über die Wiese davon. Zanker folgte ihm in Gedanken verloren und wäre fast mit einer korpulenten älteren Dame zusammengestoßen, die ihm entgegenkam. Gerade noch rechtzeitig blieb er stehen und schüttelte über sich selbst den Kopf. „Entschuldigen Sie. Ich habe nicht aufgepasst.“
Die Dame winkte ab. „Lassen Sie es gut sein. Es ist ja nichts passiert.“ Sie drehte sich zur Seite und zeigte mit dem Finger auf die Wiese. „Schauen Sie nur, wie schön unsere beiden Hunde spielen. Ist Ihr Husky ein Rüde?“
„Ja. Dann muss Ihr Labrador wohl eine Hündin sein. Meiner verträgt sich nämlich nicht mit anderen Männchen.“
„Lena ist mein ganzes Leben, müssen Sie wissen. Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen. Da würde ein Vormittag nicht reichen.“
Zanker konnte sich eben noch beherrschen, mit den Augen zu rollen. Nichts ödete ihn mehr an als diese endlosen Monologe von Hundebesitzern über ihre Lieblinge. Er streifte seinen linken Ärmel nach oben und schaute auf seine Armbanduhr. „Ein anderes Mal gerne. Ich bin ein wenig unter Zeitdruck und muss rasch nach Hause, sobald mein Yukon sein Geschäft gemacht hat. Wir werden uns ja sicher noch häufiger begegnen.“
Dem Gesichtsausdruck der Dame war anzusehen, dass sie die Erklärung Zankers als Ausrede eingestuft hatte. Sie legte leicht den Kopf schief und spitzte den Mund. „Lassen Sie nur. Keine Sorge. Ich bin die Letzte, die aufdringlich sein will.“ Sie blies in ihre Büffelhornpfeife, die sie um den Hals hängen hatte, und schaute zu ihrem Hund. „Komm, Lena, wir gehen weiter.“
Als Zanker mit seinen Blicken verfolgte, wie sich die Dame mit ausgreifenden Schritten von ihm entfernte, überkam ihn ein Gefühl der Peinlichkeit. Er hätte durchaus die Zeit gehabt, noch ein paar Minuten zu schwätzen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte ihm seine innere Stimme davon abgeraten und ihn dadurch wie einen ertappten Schwindler aussehen lassen.
Die Auseinandersetzung mit sich selbst dauerte noch an, als Zanker den Waldrand auf der gegenüberliegenden Seite der Wiese erreichte. Sobald er in den Wald eintrat, fühlte er sich wohler. Hierhin verirrten sich keine Spaziergänger mehr, auch keine Hundebesitzer. An dieser Stelle begann die Einsamkeit, die er manchmal zum Ausgleich des Trubels in den Cafés der Innenstadt sehr mochte und brauchte. Ab diesem Punkt der Welt gehörte er sich. Er war allein mit der Natur. Sein Kopf wurde frei, er atmete kontrolliert tief ein und aus und konzentrierte sich auf die nahezu automatischen Bewegungen seiner Füße. Hier stapfte er gerne auch noch spätabends mit seinem Hund herum und lauschte auf die Stimmen der Vögel. Und genau hier hatte er vor ein paar Tagen einen Kauz dreimal hintereinander seinen klagenden Schrei ausstoßen hören. Kein gutes Omen. Seine Großmutter hatte ihn vor Jahren gelehrt, der dreifache Schrei eines Kauzes bedeute, dass es einen Toten geben werde.
Ein merkwürdiges Schnauben von Yukon ließ Zanker aufschauen. Diesen seltsamen Ton, mit dem sich der Husky bemerkbar machte, hatte er in den fünf Jahren, die er nun diesen Hund hielt, noch nie zuvor gehört. Etwas zwischen Grollen und Röcheln, das ihm Angst und Abwehrbereitschaft des Tieres zugleich signalisierte.
Zanker näherte sich dem Platz, wo Yukon wie angewurzelt stand. Es musste dort irgendetwas Ungewöhnliches geben. Yukon war kein Jagdhund. Normalerweise ignorierte er Spuren oder Ausscheidungen von Wild. Zanker bewegte sich mit dem Wind im Rücken auf die Stelle zu. Dennoch nahm er bereits einige Meter davor einen stechenden, abstoßenden Geruch wahr. In seinem früheren Beruf war es vorgekommen, dass er gelegentlich dem Tod begegnet war, hauptsächlich im Zusammenhang mit häuslichen Unfällen oder Opfern im Straßenverkehr. Und genau dieser Verwesungsgeruch lag jetzt über dem Platz, den Yukon beschnüffelte.
Als Zanker Yukon erreichte, musste er sich die Nase zuhalten und durch den Mund atmen. Anders war diese grauenhafte Dunstglocke nicht zu ertragen. Er hätte etwas darum gegeben, jetzt einen Schnaps trinken zu dürfen, um seinen aufkommenden Ekel und den sauren Geschmack, der in seinem Mund vom Magen her aufstieg, zu unterdrücken.
Auf dem Boden vor Yukon lag ein grauer Plastiksack, der ursprünglich wohl mit einem weißen Plastikband verschlossen worden war. Aus irgendeinem Grund war die Hülle des Müllsacks zerrissen. Zanker hielt es für möglich, dass sich ein Wildtier daran zu schaffen gemacht hatte. Der jetzige Zustand erinnerte ihn an die geöffnete Schublade eines Gefrierschranks. Zu seinem Bedauern war jedoch der Inhalt des Beutels nicht hart gefroren, was den unerträglichen Gestank sicher deutlich reduziert hätte. Vielmehr war er, mit allen Folgen, der Sonne ausgesetzt. Zanker war sofort klar, dass das Päckchen etwas Verderbliches enthalten musste. Vielleicht hatte es ein Jäger zurückgelassen, der ein Wild zerlegt und es aus ungeahnten Gründen nicht abtransportieren konnte. Jedenfalls roch es nach verwestem Fleisch. Ob es sich dabei um die Überreste eines Menschen handelte, vermochte er nicht zu erkennen.
Unschlüssig betrachtete Zanker die Tüte. Er war unsicher, wie er reagieren sollte. Natürlich waren ihm aus seiner Tätigkeit beim Ordnungsamt sämtliche Meldewege und Zuständigkeiten geläufig. Das war nicht der Punkt. Vielmehr bewegte ihn die Frage, ob er lieber das Forstamt oder gleich die Polizei verständigen sollte. Immerhin konnte er nicht verbindlich sagen, ob es sich um eine, wenn auch unappetitliche, Nachlässigkeit oder aber um ein Verbrechen handelte. Auf der anderen Seite würden sicherlich Spuren vernichtet werden, wenn er vor der Polizei noch weitere Menschen herbeirufen würde, damit sie sich eine Meinung bilden konnten.
Um dem Gestank zu entgehen und einen klaren Kopf zu bekommen, entfernte er sich einige Schritte gegen die Windrichtung. Er legte die Hände auf dem Rücken ineinander, schaute zu Boden, lief im Kreis herum und dachte nach. Schließlich entschied er sich dafür, es der Polizei zu überlassen, ob sie sich den Sack anschauen wollte. Er langte in seine Tasche, fischte nach seinem Handy und rief an.
Das Gespräch dauerte nicht lange. Jemand verband ihn mit einem Kriminalbeamten, der ihn nach einigen Fragen aufforderte, an der Fundstelle zu warten, und ankündigte, dass er umgehend erscheinen werde.
Zanker lief auf und ab und brütete. Was würde auf ihn zukommen, wenn jemand in der Plastiktüte lediglich ein paar Reste aus seiner Tiefkühltruhe entsorgt hatte, weil das Verfallsdatum überschritten war? Vielleicht hatte der Verantwortliche damit nur vermeiden wollen, dass sich der üble Geruch in seiner Mülltonne um das Haus herum ausbreitete. Die Polizei würde ihn sicher auslachen und ihn fragen, ob er schon alles aus seiner früheren Arbeit verlernt hätte. Was für eine Blamage!
Ein lang gezogenes Grunzen von Yukon schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Als er zu seinem Hund sah, stellte er fest, dass das Tier sich offenbar an dem Verschluss des grauen Müllsacks zu schaffen gemacht hatte. Oder war Yukon dabei, mit den Vorderpfoten im Boden vor der Tüte zu graben? Zanker wurde neugierig. Entweder hatte er sich inzwischen an den infernalischen Gestank gewöhnt, oder der Wind trieb die schlimmsten Ausdünstungen von ihm weg. Jedenfalls beschloss er, sich wieder seinem Hund zu nähern. Auf halber Strecke rief er ihn an und forderte ihn auf, zu ihm zu kommen. Das Tier gehorchte nicht. Offenbar war es so beschäftigt und abgelenkt, dass es den Befehl gar nicht aufgenommen hatte.
Als Zanker seinen Hund fast erreicht hatte, hob Yukon seinen Kopf und drehte sich zu ihm hin. Zanker schaute ihn an und erstarrte. Das war kein verkrümmter Ast, den der Hund quer im Maul hielt. Es war vielmehr ein längliches Stück Fleisch. Bräunlich gefärbt und teilweise zerfetzt. Zanker bückte sich, um besser zu sehen. Er streckte die Hand nach dem Maul des Hundes aus, zog sie jedoch sofort wieder zurück. Blankes Entsetzen stand ihm im Gesicht. Die Beute zwischen den Lefzen von Yukon war ein Arm. Der Arm eines Menschen. Oder vielmehr das, was nach dem mutmaßlichen Verbiss durch hungrige Tiere und einem mehrtägigen Verwesungsprozess davon übrig geblieben war.
Zanker lief eine Gänsehaut über den Rücken. Nur mit Mühe war er in der Lage, seine Gedanken und Bewegungen wieder unter Kontrolle zu bekommen. Spontan schoss ihm durch den Kopf, dass er jedenfalls die Polizei nicht ohne gewichtigen Anlass informiert hatte. Dann wandte er sich seinem Hund zu. „Aus, Yukon! Aus!“
Yukon legte den Arm ab, schaute zu seinem Herrn auf und wedelte mit dem Schwanz. Es war offensichtlich, dass er ein Lob und eine Belohnung erwartete. Zanker schüttelte den Kopf. Er war nicht in der Lage, mit Verständnis auf seinen Hund einzugehen. „Komm, Yukon! Weg hier!“
Der Hund legte den Kopf schief und sah kurz zu Zanker auf. Dann drehte er plötzlich den Kopf, verengte seine Augen und schaute in Richtung des geschotterten Weges, der am Waldrand entlang zur Wiese führte. Zanker folgte seinem Blick und sah, dass sich aus der Ferne mit hoher Geschwindigkeit ein Auto näherte. Obwohl es sich um ein Zivilfahrzeug handelte, nahm er an, dass es die Polizei sein würde. Er hob den Arm und winkte.
Nur wenige Sekunden später hielt das Auto neben ihm an. Die beiden Männer, die aus dem Vorläufermodell des Opel Vectra stiegen, hätten unterschiedlicher nicht aussehen können. Zwar waren beide mittleren Alters. Ansonsten schienen sie aber aus verschiedenen Welten zu kommen. Der Fahrer, ein dunkelhaariger Lockenkopf mit struppigem Vollbart und zahllosen kleinen Narben im gebräunten Gesicht, trug über einem roten T-Shirt einen hellblauen Jeansanzug. Sein Begleiter versteckte den leichten Ansatz zum Übergewicht in einer sportlichen Kombi mit geschmackvoll abgestimmter Krawatte. Seine auffällig roten Wangen waren glatt rasiert, die dunkelbraunen Haare gepflegt nach hinten gekämmt.
Als der Bärtige in gebührendem Abstand zu Yukon vor Zanker stand, griff er in seine Brusttasche und zog ein schwarzes Plastikmäppchen hervor. Dabei rutschte eine Karotte mit heraus und fiel zu Boden. Ungerührt hob er sie auf und steckte sie wieder ein. Beim Blick auf Yukon zuckte er mit den Schultern. „Die Möhre ist nicht für dich. Ich habe gerade aufgehört zu rauchen. Das ist meine Ersatzdroge.“
Er klappte das Mäppchen auf und hielt Zanker seinen Dienstausweis unter die Nase. „Kriminalpolizei. Kriminalhauptkommissar Schreiner.“ Er deutete auf seinen Beifahrer. „Das ist mein Kollege, Kriminalhauptkommissar Köhler.“ Mit einem Gesichtsausdruck zwischen Misstrauen und Schlitzohrigkeit fixierte er Zanker. „Sie haben uns vorhin angerufen?“
Zanker nickte. „Das trifft zu.“
„Sagen Sie uns bitte, wer Sie sind oder weisen Sie sich aus, und erzählen Sie ausführlich, weshalb Sie uns benachrichtigt haben.“ Schreiner hielt die Nase in die Luft und schnupperte. „Sie können sich wohl doch kurz fassen. Der wesentliche Anlass für Ihren Anruf bei uns sticht mir schon in die Nase.“
Mit wenigen Worten erzählte Zanker von den Entdeckungen seines Hundes, seinen eigenen Beobachtungen und erwähnte schließlich seine frühere Tätigkeit beim Ordnungsamt. Er lächelte. „Wir sind gewissermaßen Kollegen. Deshalb dürfen Sie versichert sein, dass ich keine Spuren zerstört habe.“
Auf den vielsagenden Blick von Schreiner hin, der sich genervt im Bart kratzte, griff Köhler in die Unterhaltung ein. „Dann wird Ihnen klar sein, dass in wenigen Minuten eine Armada von Kollegen hier alles wie mit einer Fräse durchkämmen und keinen Stein auf dem anderen lassen wird.“
Köhler hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als aus der Ferne ein Orchester von Martinshörnern zu hören war. Dann bog in mörderischem Tempo, wie an einer Perlenkette aufgezogen, eine Reihe von Polizeiautos auf den Waldweg ein. Schreiner musste trotz der ungewissen Situation laut lachen, als Yukon das martialische Hupkonzert mit einem anhaltenden Wolfsgeheul zu übertönen versuchte.
Ohne lange nach geeigneten Abstellplätzen zu suchen, ließen die Fahrer ihre Autos mitten im Gelände stehen. Eine Heerschar von Menschen stürzte herbei. Köhler gab einen Hinweis mit dem Kopf. Dann stürzten sich sämtliche Polizisten auf den Fundort. Es blieb dennoch kein Zweifel, dass hinter dem Einsatz Übung und Ordnung steckte und jeder seine Aufgabe kannte.
Schreiner grinste Köhler an und zeigte auf eine Gruppe von Kollegen, die von Kopf bis Fuß mit weißen Overalls verhüllt war und sich an dem grauen Plastiksack zu schaffen machte. „Sie sehen aus wie die Astronauten bei der ersten Mondlandung. Die Jungs machen in unseren Polizeiburkas eine richtig gute Figur.“
Mitten in dem Getümmel wieselte eine kleine rothaarige Frau in ziviler Kleidung herum. Sie schien überall zu sein, redete ständig halblaut vor sich hin und gestikulierte pausenlos. Auf den fragenden Blick Zankers, der sich noch immer in Mutmaßungen erging, winkte Schreiner ab. „Das ist Frau Doktor Lubitsch vom Institut für Gerichtsmedizin. Unsere Leute hatten das Glück, dass sie gerade mitkommen konnte. Eine patente Frau, die ihren Job versteht.“ Er wandte sich zu Köhler und senkte seine Stimme zu einem Flüstern. „Und sie sieht auch noch gut aus. Das hat man nicht oft.“
Köhler notierte sich die Personalien Zankers und bedeutete ihm, dass er jetzt gehen könne.
Zanker schien nicht zugehört zu haben. Ein fernes Lächeln umrahmte seine Gesichtszüge. Fasziniert schaute er dem Treiben der Polizisten zu. Dann blieb sein Blick auf der Rothaarigen haften, die gerade mit ausholenden Schritten herannahte. Frau Doktor Lubitsch trat auf die beiden Kriminalbeamten zu und schaute zu ihnen auf. Ihr unbeeindrucktes Erscheinungsbild verriet, dass sie schon viele Variationen menschlicher Tragödien erlebt hatte, und die gegenwärtige Herausforderung von ihr nicht als besonders außergewöhnlich empfunden wurde. Ihre spitzbübische Miene drückte Pfiffigkeit aus. „In aller Kürze. In der Plastiktüte ist der Rest von einem Menschen. Die Todesursache kann ich noch nicht angeben. Die Leiche ist stark verwest. Sie ist fast auseinandergefallen. Es könnte sich um Spuren von Tierfraß handeln. Dadurch sieht die Leiche verstümmelt aus. Aber das dürfte eher nicht vom Täter herrühren.“
Schreiner schüttelte den Kopf. „Was heißt überhaupt der Täter? Kann es keine Frau gewesen sein?“