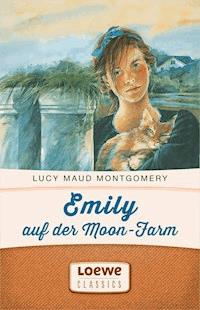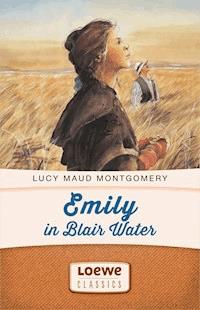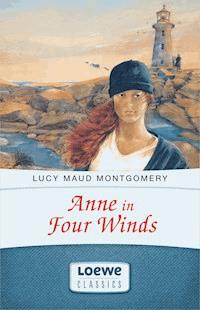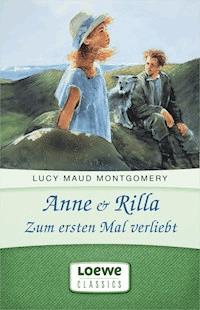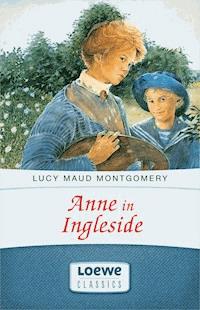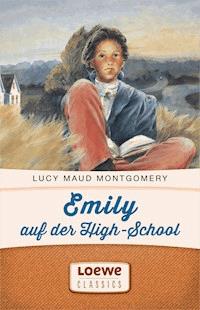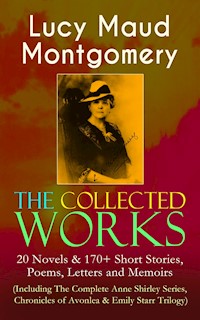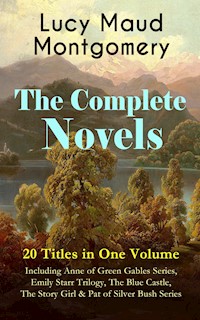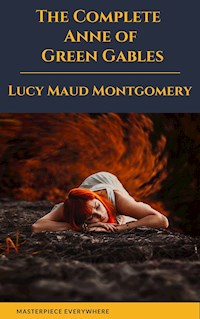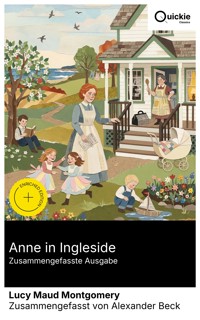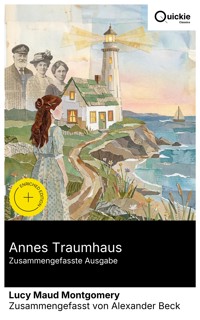3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Diese Ausgabe ist einzigartig;
- Die Übersetzung ist vollständig original und wurde für das Ale. Mar. SAS;
- Alle Rechte vorbehalten.
Das blaue Schloss ist ein Roman der kanadischen Autorin Lucy Maud Montgomery, der erstmals 1926 veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt des charmanten Romans steht Valancy Stirling, eine 29-jährige Frau, die ein tristes und bedrückendes Leben in einer kanadischen Kleinstadt zu Beginn des 20. Valancy wird von ihrer übermächtigen Familie beherrscht, die sie als alte Jungfer betrachtet, die nichts zu bieten hat. Ihr einziger Ausweg ist ihre Fantasie, in der sie von einem schönen „Blauen Schloss“ träumt, in dem sie frei und glücklich ist. Valancys Leben nimmt eine dramatische Wendung, als sie von ihrem Arzt eine schockierende Diagnose erhält: Sie ist herzkrank und hat weniger als ein Jahr zu leben. Angesichts dieser düsteren Prognose beschließt Valancy, sich von ihrem restriktiven Leben zu befreien und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie zieht aus dem Haus ihrer Familie aus, widersetzt sich den Erwartungen der Gesellschaft und beginnt, Entscheidungen zu treffen, die ihr Freude und Erfüllung bringen. Auf ihrer Suche nach einem sinnvolleren Leben findet Valancy die Liebe zu Barney Snaith, einem zurückgezogen lebenden Mann mit einer mysteriösen Vergangenheit. Gemeinsam bauen sie sich ein Leben voller Glück und Abenteuer in ihrer eigenen Version des Blauen Schlosses auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsübersicht
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Kapitel XL
Kapitel XLI
Kapitel XLII
Kapitel XLIII
Kapitel XLIV
Kapitel XLV
Das blaue Schloss Lucy Maud Montgomery
Kapitel I
Wenn es an einem bestimmten Maimorgen nicht geregnet hätte, wäre Valancy Stirlings ganzes Leben anders verlaufen. Sie wäre mit dem Rest ihrer Sippe zu Tante Wellingtons Verlobungspicknick gegangen und Dr. Trent wäre nach Montreal gefahren. Aber es hat geregnet, und Sie werden erfahren, was ihr deswegen widerfahren ist.
Valancy wachte früh auf, in der leblosen, hoffnungslosen Stunde kurz vor dem Morgengrauen. Sie hatte nicht sehr gut geschlafen. Manchmal schläft man nicht gut, wenn man am nächsten Morgen neunundzwanzig ist und unverheiratet, in einer Gemeinschaft und Verbindung, wo die Unverheirateten einfach diejenigen sind, die keinen Mann bekommen haben.
Deerwood und die Stirlings hatten Valancy schon lange in ein hoffnungsloses Jungferndasein verbannt. Aber Valancy selbst hatte eine gewisse mitleiderregende, beschämende, kleine Hoffnung nie ganz aufgegeben, dass ihr doch noch eine Romanze zuteil werden würde - bis zu diesem nassen, schrecklichen Morgen, an dem sie erwachte und feststellte, dass sie neunundzwanzig war und von keinem Mann begehrt wurde.
Ja, darin lag der Stachel. Valancy machte es nicht so viel aus, eine alte Jungfer zu sein. Schließlich dachte sie, eine alte Jungfer zu sein, konnte nicht so schrecklich sein, wie mit einem Onkel Wellington oder einem Onkel Benjamin oder gar einem Onkel Herbert verheiratet zu sein. Was sie schmerzte, war, dass sie nie die Chance gehabt hatte, etwas anderes als eine alte Jungfer zu sein. Kein Mann hatte sie je begehrt.
Die Tränen traten ihr in die Augen, als sie dort allein in der leicht ergrauten Dunkelheit lag. Sie traute sich nicht, so sehr zu weinen, wie sie es wollte, und zwar aus zwei Gründen. Sie befürchtete, dass das Weinen einen weiteren Anfall dieses Schmerzes in der Herzgegend auslösen könnte. Sie hatte einen Anfall davon gehabt, nachdem sie ins Bett gegangen war - viel schlimmer als alles, was sie bisher erlebt hatte. Und sie fürchtete, ihre Mutter würde beim Frühstück ihre roten Augen bemerken und sie mit winzigen, hartnäckigen, mückenartigen Fragen nach der Ursache dafür löchern.
"Stell dir vor", dachte Valancy mit einem grässlichen Grinsen, "ich würde mit der schlichten Wahrheit antworten: 'Ich weine, weil ich nicht heiraten kann'. Wie entsetzt wäre Mutter - obwohl sie sich jeden Tag ihres Lebens für ihre alte Jungfer Tochter schämt."
Aber natürlich sollte der Schein gewahrt werden. "Es ist nicht", hörte Valancy die strenge, diktatorische Stimme ihrer Mutter sagen, "es ist nicht mädchenhaft, an Männer zu denken."
Der Gedanke an den Gesichtsausdruck ihrer Mutter brachte Valancy zum Lachen - sie hatte einen Sinn für Humor, den niemand in ihrem Clan vermutete. Übrigens gab es eine ganze Menge Dinge an Valancy, die niemand vermutete. Aber ihr Lachen war sehr oberflächlich, und bald lag sie da, eine zusammengekauerte, nutzlose kleine Gestalt, lauschte dem Regen, der draußen niederprasselte, und betrachtete mit einem kranken Widerwillen das kalte, unbarmherzige Licht, das in ihr hässliches, schmutziges Zimmer kroch.
Sie kannte die Hässlichkeit dieses Zimmers auswendig - sie kannte sie und hasste sie. Der gelb gestrichene Fußboden mit dem hässlichen Hakenteppich neben dem Bett, auf dem ein grotesker Hund lag, der sie immer angrinste, wenn sie aufwachte; die verblichene, dunkelrote Tapete; die von alten Lecks verfärbte und von Rissen durchzogene Decke; das schmale, zusammengekniffene Waschbecken; das braune Papier-Lambrequin mit den violetten Rosen darauf; der fleckige alte Spiegel mit dem Riss quer darüber, der auf dem unzureichenden Schminktisch stand; das Glas mit altem Potpourri, das ihre Mutter in ihren mythischen Flitterwochen gemacht hatte; die mit Muscheln bedeckte Schachtel mit einer zerbrochenen Ecke, die Cousine Stickles in ihrer ebenso mythischen Mädchenzeit gemacht hatte; das perlenbesetzte Nadelkissen, bei dem die Hälfte der Perlenfransen verschwunden war; der eine steife, gelbe Stuhl; das verblasste alte Motto "Gegangen, aber nicht vergessen", das in bunten Fäden über Urgroßmutter Stirlings grimmigem alten Gesicht eingearbeitet war; die alten Fotografien von alten Verwandten, die schon lange aus den unteren Räumen verbannt waren. Es gab nur zwei Bilder, die nicht von Verwandten stammten. Das eine war eine alte Chromoaufnahme eines Welpen, der auf einer verregneten Türschwelle saß. Dieses Bild machte Valancy immer unglücklich. Dieser einsame kleine Hund, der im strömenden Regen auf der Türschwelle hockte! Warum öffnete nicht jemand die Tür und ließ ihn herein? Das andere Bild war ein verblasster Passepartout-Stich von Königin Louise, die eine Treppe herunterkommt, den Tante Wellington ihr zu ihrem zehnten Geburtstag geschenkt hatte. Neunzehn Jahre lang hatte sie es angeschaut und gehasst, die schöne, selbstgefällige und selbstzufriedene Königin Louise. Aber sie hatte es nie gewagt, es zu zerstören oder zu entfernen. Mutter und Cousine Stickles wären entsetzt gewesen, oder, wie Valancy es in ihren Gedanken respektlos ausdrückte, hätten einen Anfall bekommen.
Jedes Zimmer im Haus war natürlich hässlich. Aber im Erdgeschoss wurde der Schein einigermaßen gewahrt. Es gab kein Geld für Zimmer, die nie jemand sah. Valancy hatte manchmal das Gefühl, dass sie selbst etwas für ihr Zimmer hätte tun können, auch ohne Geld, wenn es ihr erlaubt gewesen wäre. Aber ihre Mutter hatte jeden zaghaften Vorschlag abgelehnt, und Valancy blieb nicht hartnäckig. Valancy war nie hartnäckig. Sie hatte Angst davor. Ihre Mutter konnte keinen Widerstand dulden. Mrs. Stirling schmollte tagelang, wenn sie beleidigt war, mit dem Gebaren einer beleidigten Herzogin.
Das Einzige, was Valancy an ihrem Zimmer mochte, war, dass sie dort nachts allein sein konnte, um zu weinen, wenn sie das wollte.
Aber was machte es schon, wenn ein Zimmer, das man nur zum Schlafen und Anziehen benutzte, hässlich war? Valancy war es nie erlaubt, zu einem anderen Zweck allein in ihrem Zimmer zu bleiben. Menschen, die allein sein wollten, so glaubten Mrs. Frederick Stirling und Cousine Stickles, konnten nur zu einem unheilvollen Zweck allein sein wollen. Aber ihr Zimmer im Blauen Schloss war alles, was ein Zimmer sein sollte.
Valancy, die im wirklichen Leben so eingeschüchtert und unterdrückt, überstimmt und brüskiert war, pflegte sich in ihren Tagträumen prächtig auszutoben. Niemand im Stirling-Clan oder seinen Verästelungen ahnte das, am wenigsten ihre Mutter und Cousine Stickles. Sie wussten nicht, dass Valancy zwei Häuser besaß - den hässlichen roten Backsteinkasten in der Elm Street und das Blaue Schloss in Spanien. Valancy lebte spirituell im Blauen Schloss, seit sie denken konnte. Sie war ein sehr kleines Kind gewesen, als sie von ihm Besitz ergriff. Immer, wenn sie die Augen schloss, konnte sie es deutlich sehen, mit seinen Türmen und Bannern auf der mit Kiefern bewachsenen Berghöhe, eingehüllt in seine schwache, blaue Lieblichkeit, gegen den Sonnenuntergangshimmel eines schönen und unbekannten Landes. Alles Wunderbare und Schöne befand sich in diesem Schloss. Juwelen, die Königinnen hätten tragen können; Gewänder aus Mondlicht und Feuer; Liegen aus Rosen und Gold; lange, flache Marmortreppen mit großen, weißen Urnen und schlanken, nebelverhangenen Mädchen, die sie hinauf- und hinuntergingen; Höfe mit Marmorsäulen, in denen schimmernde Brunnen plätscherten und Nachtigallen zwischen den Myrten sangen; Spiegelsäle, in denen sich nur schöne Ritter und schöne Frauen spiegelten - sie selbst war die schönste von allen, für deren Anblick Männer starben. Das Einzige, was sie durch die Langeweile ihrer Tage trug, war die Hoffnung, nachts auf eine Traumreise gehen zu können. Die meisten, wenn nicht alle Stirlings wären vor Entsetzen gestorben, wenn sie nur die Hälfte der Dinge gewusst hätten, die Valancy in ihrem Blauen Schloss tat.
Zum einen hatte sie eine ganze Reihe von Liebhabern darin. Oh, immer nur einen auf einmal. Einer, der sie mit der ganzen romantischen Glut des Ritterzeitalters umwarb und sie nach langer Hingabe und vielen Heldentaten für sich gewann und in der großen, bannerbehängten Kapelle des Blauen Schlosses mit Pomp und Umstand vermählt wurde.
Mit zwölf Jahren war dieser Liebhaber ein blonder Junge mit goldenen Locken und himmelblauen Augen. Mit fünfzehn war er groß und dunkel und blass, aber immer noch zwangsläufig gutaussehend. Mit zwanzig war er asketisch, verträumt, spirituell. Mit fünfundzwanzig hatte er ein glattes, leicht grimmiges Kinn und ein Gesicht, das eher stark und schroff als schön war. Valancy wurde in ihrem Blauen Schloss nie älter als fünfundzwanzig, aber vor kurzem - vor sehr kurzer Zeit - hatte ihr Held rötliches, bräunliches Haar, ein schiefes Lächeln und eine mysteriöse Vergangenheit gehabt.
Ich behaupte nicht, dass Valancy diese Liebhaber absichtlich ermordet hat, als sie ihnen entwachsen war. Einer verschwand einfach, als ein anderer kam. In dieser Hinsicht sind die Dinge in Blue Castles sehr bequem.
Aber an diesem Morgen ihres Schicksalstages konnte Valancy den Schlüssel zu ihrem Blauen Schloss nicht finden. Die Realität drückte zu sehr auf sie ein und bellte ihr auf den Fersen wie ein wahnsinniger kleiner Hund. Sie war neunundzwanzig, einsam, unerwünscht, missgünstig - das einzige unscheinbare Mädchen in einem stattlichen Clan, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Soweit sie zurückblicken konnte, war das Leben trist und farblos, ohne einen einzigen karmesinroten oder violetten Fleck. Soweit sie in die Zukunft blicken konnte, schien es sicher zu sein, dass es genauso sein würde, bis sie nichts weiter war als ein einsames, kleines, verdorrtes Blatt, das sich an einen winterlichen Ast klammerte. Der Moment, in dem eine Frau erkennt, dass sie nichts hat, wofür es sich zu leben lohnt - weder Liebe noch Pflicht, weder Ziel noch Hoffnung -, birgt für sie die Bitterkeit des Todes.
"Und ich muss einfach weiterleben, weil ich nicht aufhören kann. Vielleicht muss ich achtzig Jahre leben", dachte Valancy in einer Art Panik. "Wir sind alle furchtbar langlebig. Es macht mich krank, wenn ich daran denke."
Sie war froh, dass es regnete - oder besser gesagt, sie war trostlos zufrieden, dass es regnete. An diesem Tag würde es kein Picknick geben. Dieses jährliche Picknick, bei dem Tante und Onkel Wellington - man dachte immer in dieser Reihenfolge - zwangsläufig ihre Verlobung bei einem Picknick dreißig Jahre zuvor feierten, war in den letzten Jahren ein wahrer Albtraum für Valancy gewesen. Durch einen schelmischen Zufall war es derselbe Tag wie ihr Geburtstag, und nachdem sie fünfundzwanzig Jahre alt geworden war, ließ sie ihn nicht mehr vergessen.
So sehr sie es auch hasste, zum Picknick zu gehen, es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, dagegen zu rebellieren. Es schien nichts Revolutionäres in ihrem Wesen zu sein. Und sie wusste genau, was alle auf dem Picknick zu ihr sagen würden. Onkel Wellington, den sie nicht mochte und verachtete, obwohl er sich den höchsten Wunsch der Stirlings erfüllt hatte, nämlich "Geld zu heiraten", würde zu ihr mit dem Flüsterton eines Schweins sagen: "Du denkst doch nicht etwa daran, zu heiraten, meine Liebe?" und dann in das schallende Gelächter ausbrechen, mit dem er seine dumpfen Bemerkungen immer beendete. Tante Wellington, vor der Valancy große Ehrfurcht hatte, erzählte ihr von Olives neuem Chiffonkleid und Cecils letztem liebevollen Brief. Valancy musste so erfreut und interessiert aussehen, als ob das Kleid und der Brief von ihr gewesen wären, sonst wäre Tante Wellington beleidigt. Und Valancy hatte schon vor langer Zeit beschlossen, dass sie lieber Gott beleidigen würde als Tante Wellington, denn Gott würde ihr vielleicht verzeihen, aber Tante Wellington würde es nie tun.
Tante Alberta, enorm dick, mit der liebenswürdigen Angewohnheit, ihren Mann immer mit "er" anzusprechen, als wäre er das einzige männliche Wesen auf der Welt, die nie vergessen konnte, dass sie in ihrer Jugend eine große Schönheit gewesen war, kondolierte Valancy mit ihrer blassen Haut.
"Ich weiß nicht, warum die Mädchen von heute alle so einen Sonnenbrand haben. Als ich ein Mädchen war, war meine Haut rosig und cremefarben. Ich galt als das hübscheste Mädchen Kanadas, meine Liebe."
Vielleicht würde Onkel Herbert gar nichts sagen - oder er würde scherzhaft bemerken: "Wie dick du geworden bist, Doss!" Und dann würden alle lachen über die übermäßig lustige Vorstellung, dass der arme, dürre kleine Doss fett geworden ist.
Der gut aussehende, feierliche Onkel James, den Valancy zwar nicht mochte, aber respektierte, weil er als sehr klug galt und deshalb das Orakel des Clans war - Gehirne gab es in der Stirling-Connection nicht allzu viele -, würde wahrscheinlich mit dem eulenhaften Sarkasmus, der ihm seinen Ruf eingebracht hatte, anmerken: "Ich nehme an, du bist in diesen Tagen mit deiner Hoffnungstruhe beschäftigt?"
Und Onkel Benjamin stellte zwischen keuchendem Kichern einige seiner abscheulichen Rätsel und beantwortete sie selbst.
"Was ist der Unterschied zwischen Doss und einer Maus?
"Die Maus will dem Käse schaden und Doss will den Hacken verzaubern."
Valancy hatte ihn dieses Rätsel schon fünfzig Mal stellen hören, und jedes Mal wollte sie etwas nach ihm werfen. Aber sie tat es nie. Erstens warfen die Stirlings einfach nicht mit Dingen, und zweitens war Onkel Benjamin ein reicher und kinderloser alter Witwer, und Valancy war in der Furcht und Ermahnung vor seinem Geld aufgewachsen. Wenn sie ihn beleidigte, würde er sie aus seinem Testament streichen - vorausgesetzt, sie wäre darin enthalten. Valancy wollte nicht aus Onkel Benjamins Testament gestrichen werden. Sie war ihr ganzes Leben lang arm gewesen und kannte die Bitterkeit dieser Situation. Also ertrug sie seine Rätsel und lächelte sogar ein gequältes kleines Lächeln darüber.
Tante Isabel, unverblümt und unangenehm wie ein Ostwind, kritisierte sie auf irgendeine Art und Weise - Valancy konnte nicht vorhersehen, auf welche Weise, denn Tante Isabel wiederholte nie eine Kritik - sie fand jedes Mal etwas Neues, womit sie einem einen Schlag versetzte. Tante Isabel war stolz darauf, zu sagen, was sie dachte, aber sie mochte es nicht so sehr, wenn andere Leute ihr sagten, was sie dachten. Valancy sagte nie, was sie dachte.
Cousine Georgiana - benannt nach ihrer Ur-Ur-Großmutter, die nach Georg dem Vierten benannt worden war - zählte traurig die Namen aller Verwandten und Freunde auf, die seit dem letzten Picknick gestorben waren, und fragte sich, "wer von uns der Erste sein wird, der als Nächster stirbt".
Die erdrückend kompetente Tante Mildred erzählte Valancy endlos von ihrem Mann und ihren abscheulichen Wunderkindern, weil Valancy die einzige war, die sie finden konnte, um das zu ertragen. Aus demselben Grund schilderte Cousine Gladys - nach der strengen Art, mit der die Stirlings die Verwandtschaft registrierten, tatsächlich die Cousine ersten Grades -, eine große, schlanke Dame, die zugab, dass sie ein sensibles Gemüt hatte, minutiös die Qualen ihrer Nervenentzündung. Und Olive, das Wundermädchen des ganzen Stirling-Clans, die alles hatte, was Valancy nicht hatte - Schönheit, Beliebtheit, Liebe -, würde mit ihrer Schönheit angeben und sich ihrer Beliebtheit rühmen und ihre diamantenen Liebesinsignien in Valancys geblendeten, neidischen Augen zur Schau stellen.
All das würde es heute nicht mehr geben. Und es würden auch keine Teelöffel eingepackt werden. Das Einpacken überließ man immer Valancy und Cousine Stickles. Und einmal, vor sechs Jahren, war ein silberner Teelöffel aus Tante Wellingtons Hochzeitsset verloren gegangen. Valancy hörte nie wieder etwas von diesem silbernen Teelöffel. Sein Geist erschien banquoartig bei jedem folgenden Familienfest.
Oh ja, Valancy wusste genau, wie das Picknick aussehen würde, und sie segnete den Regen, der sie davor bewahrt hatte. Dieses Jahr würde es kein Picknick geben. Wenn Tante Wellington am heiligen Tag selbst nicht feiern konnte, würde sie überhaupt kein Fest haben. Den Göttern sei Dank, die es dafür gab.
Da es kein Picknick geben würde, beschloss Valancy, falls der Regen am Nachmittag anhielt, in die Bibliothek zu gehen und ein weiteres Buch von John Foster zu holen. Valancy durfte nie Romane lesen, aber die Bücher von John Foster waren keine Romane. Es waren "Naturbücher" - so sagte die Bibliothekarin zu Mrs. Frederick Stirling - "alles über den Wald und Vögel und Käfer und solche Dinge, weißt du." Valancy durfte sie also lesen - unter Protest, denn es war nur zu offensichtlich, dass sie sie zu sehr genoss. Es war erlaubt, ja sogar lobenswert, zu lesen, um seinen Geist und seine Religion zu verbessern, aber ein Buch, das Spaß machte, war gefährlich. Valancy wusste nicht, ob ihr Geist verbessert wurde oder nicht, aber sie hatte das vage Gefühl, dass ihr Leben vielleicht anders verlaufen wäre, wenn sie vor Jahren auf John Fosters Bücher gestoßen wäre. Sie schienen ihr Einblicke in eine Welt zu gewähren, in die sie einst hätte eintreten können, obwohl ihr die Tür jetzt für immer verschlossen war. John Fosters Bücher befanden sich erst seit einem Jahr in der Deerwood-Bibliothek, obwohl der Bibliothekar Valancy erzählt hatte, dass er schon seit einigen Jahren ein bekannter Schriftsteller war.
"Wo wohnt er?" hatte Valancy gefragt.
"Niemand weiß es. Nach seinen Büchern zu urteilen, muss er Kanadier sein, aber mehr Informationen sind nicht zu bekommen. Seine Verleger sagen kein Wort. Wahrscheinlich ist John Foster ein Pseudonym. Seine Bücher sind so beliebt, dass wir sie gar nicht behalten können, obwohl ich wirklich nicht weiß, was die Leute an ihnen so toll finden."
"Ich finde sie wunderbar", sagte Valancy zaghaft.
"Oh - nun -" Miss Clarkson lächelte auf eine herablassende Art, die Valancys Meinung in den Hintergrund drängte: "Ich kann nicht behaupten, dass ich mir viel aus Käfern mache. Aber Foster scheint wirklich alles über sie zu wissen, was es zu wissen gibt."
Valancy wusste nicht, ob sie sich überhaupt für Käfer interessierte. Es war nicht John Fosters unheimliches Wissen über wilde Kreaturen und das Insektenleben, das sie in seinen Bann zog. Sie konnte kaum sagen, was es war - eine verlockende Verlockung eines Geheimnisses, das nie gelüftet wurde - eine Andeutung eines großen Geheimnisses, das nur ein wenig weiter entfernt war - ein schwaches, schwer fassbares Echo schöner, vergessener Dinge - John Fosters Zauber war undefinierbar.
Ja, sie würde ein neues Foster-Buch bekommen. Es war einen Monat her, dass sie Distelernte hatte, also konnte Mutter sicher nichts dagegen haben. Valancy hatte es viermal gelesen - sie kannte ganze Passagen auswendig.
Und - fast dachte sie daran, Dr. Trent wegen dieser seltsamen Schmerzen in der Herzgegend aufzusuchen. Er war in letzter Zeit ziemlich oft aufgetreten, und das Herzklopfen wurde immer lästiger, ganz zu schweigen von gelegentlichen Schwindelanfällen und einer seltsamen Kurzatmigkeit. Aber konnte sie zu ihm gehen, ohne es jemandem zu sagen? Das war ein äußerst gewagter Gedanke. Keiner der Stirlings hatte jemals einen Arzt aufgesucht, ohne einen Familienrat abzuhalten und die Zustimmung von Onkel James einzuholen. Dann gingen sie zu Dr. Ambrose Marsh aus Port Lawrence, der die Cousine zweiten Grades Adelaide Stirling geheiratet hatte.
Aber Valancy mochte Dr. Ambrose Marsh nicht. Außerdem konnte sie das fünfzehn Meilen entfernte Port Lawrence nicht erreichen, ohne dorthin gebracht zu werden. Sie wollte nicht, dass irgendjemand von ihrem Herzen erfuhr. Es würde einen solchen Wirbel geben, und jedes Mitglied der Familie würde kommen und darüber reden und ihr Ratschläge geben und sie warnen und ihr schreckliche Geschichten von Großtanten und Cousinen vierzigfachen Grades erzählen, die "genau so" gewesen waren und "ohne Vorwarnung tot umgefallen sind, meine Liebe."
Tante Isabel würde sich daran erinnern, dass sie immer gesagt hatte, Doss sähe aus wie ein Mädchen, das Herzprobleme haben würde - "immer so verkniffen und spitz"; und Onkel Wellington würde es als persönliche Beleidigung auffassen, wenn "noch nie ein Stirling ein Herzleiden hatte"; und Georgiana würde in gut hörbaren Nebenbemerkungen ahnen, dass "die arme, liebe kleine Doss nicht mehr lange auf dieser Welt ist, fürchte ich"; und Cousine Gladys würde sagen: "Mein Herz ist schon seit Jahren so", in einem Tonfall, der andeutete, daß niemand sonst überhaupt ein Herz zu haben brauchte; und Olive-Olive würde einfach nur schön und überlegen und ekelhaft gesund aussehen, als wollte sie sagen: "Warum all dieses Getue um eine verblichene Überflüssigkeit wie Doss, wenn ihr mich habt?"
Valancy hatte das Gefühl, dass sie es niemandem sagen konnte, wenn sie es nicht musste. Sie war sich ziemlich sicher, dass mit ihrem Herzen nichts Ernsthaftes nicht in Ordnung war und dass sie sich den ganzen Ärger ersparen konnte, der entstehen würde, wenn sie es erwähnte. Sie würde einfach heimlich zu Dr. Trent gehen und ihn noch am selben Tag aufsuchen. Was seine Rechnung anging, so hatte sie die zweihundert Dollar, die ihr Vater am Tag ihrer Geburt für sie auf die Bank gelegt hatte. Sie durfte nicht einmal die Zinsen davon verwenden, aber sie würde heimlich genug abheben, um Dr. Trent zu bezahlen.
Dr. Trent war ein schroffer, unverblümter, zerstreuter alter Mann, aber er war eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Herzkrankheiten, auch wenn er nur ein Allgemeinmediziner im abgelegenen Deerwood war. Dr. Trent war über siebzig und es gab Gerüchte, dass er sich bald zur Ruhe setzen wollte. Keiner aus dem Stirling-Clan war je zu ihm gegangen, seit er Cousine Gladys vor zehn Jahren gesagt hatte, dass ihre Nervenentzündung nur Einbildung sei und dass sie es genieße. Man konnte keinen Arzt bevormunden, der die eigene Cousine ersten Grades so beleidigte - ganz zu schweigen davon, dass er Presbyterianer war, während alle Stirlings in die anglikanische Kirche gingen. Aber Valancy, die zwischen dem Teufel der Untreue gegenüber dem Clan und dem tiefen Meer des Getöses und der Ratschläge schwankte, dachte, sie würde es mit dem Teufel probieren.
Kapitel II
Als Cousine Stickles an ihre Tür klopfte, wusste Valancy, dass es halb acht war und sie aufstehen musste. Solange sie sich erinnern konnte, hatte Cousine Stickles um halb acht an ihre Tür geklopft. Cousine Stickles und Mrs. Frederick Stirling waren seit sieben Uhr auf, aber Valancy durfte noch eine halbe Stunde länger liegen bleiben, weil sie nach einer Familientradition empfindlich war. Valancy stand auf, obwohl sie das Aufstehen an diesem Morgen mehr hasste als jemals zuvor. Was gab es schon zu tun? Ein weiterer trostloser Tag wie all die Tage zuvor, voll von sinnlosen kleinen Aufgaben, freudlos und unwichtig, die niemandem etwas brachten. Aber wenn sie nicht sofort aufstand, würde sie nicht zum Frühstück um acht Uhr fertig sein. Im Haushalt von Mrs. Stirling herrschten feste und schnelle Essenszeiten. Frühstück um acht, Abendessen um eins, Abendbrot um sechs, und das jahrein, jahraus. Ausreden für Verspätungen wurden nicht geduldet. Also stand Valancy fröstelnd auf.
Der Raum war bitterkalt, mit der rauen, durchdringenden Kälte eines nassen Maimorgens. Das Haus würde den ganzen Tag über kalt sein. Es war eine der Regeln von Frau Frederick, dass nach dem vierundzwanzigsten Mai kein Feuer mehr gemacht werden musste. Die Mahlzeiten wurden auf dem kleinen Ölofen auf der hinteren Veranda gekocht. Und auch wenn der Mai eisig und der Oktober frostig war, wurde nach dem Kalender bis zum einundzwanzigsten Oktober kein Feuer angezündet. Am einundzwanzigsten Oktober begann Frau Frederick, auf dem Küchenherd zu kochen und abends ein Feuer im Wohnzimmerofen zu entfachen. In der Familie wurde geflüstert, dass der verstorbene Frederick Stirling sich die Erkältung zugezogen hatte, an der er in Valancys erstem Lebensjahr gestorben war, weil Frau Frederick am zwanzigsten Oktober kein Feuer machen wollte. Sie zündete es am nächsten Tag an - aber das war ein Tag zu spät für Frederick Stirling.
Valancy zog ihr Nachthemd aus grober, ungebleichter Baumwolle, mit hohem Halsausschnitt und langen, engen Ärmeln aus und hängte es in den Schrank. Sie zog Unterkleider ähnlicher Art an, ein Kleid aus brauner Gingham, dicke schwarze Strümpfe und Gummistiefel mit Absätzen. In den letzten Jahren hatte sie sich angewöhnt, ihr Haar bei heruntergezogener Jalousie des Fensters neben dem Spiegel zu frisieren. Die Falten in ihrem Gesicht waren dann nicht so deutlich zu sehen. Aber an diesem Morgen schob sie die Jalousie ganz nach oben und betrachtete sich in dem aussätzigen Spiegel mit der leidenschaftlichen Entschlossenheit, sich so zu sehen, wie die Welt sie sah.
Das Ergebnis war ziemlich furchtbar. Selbst eine Schönheit hätte dieses harte, ungeschwächte Seitenlicht als anstrengend empfunden. Valancy sah glattes, schwarzes Haar, kurz und dünn, immer glanzlos, obwohl sie es jeden Abend hundertmal mit der Bürste streichelte, nicht mehr und nicht weniger, und Redferns Hair Vigor treu in die Wurzeln einrieb, glanzloser denn je in seiner morgendlichen Rauheit; feine, gerade, schwarze Augenbrauen; eine Nase, die sie immer als viel zu klein empfunden hatte, selbst für ihr kleines, dreieckiges, weißes Gesicht; ein kleiner, blasser Mund, der immer ein wenig über den kleinen, spitzen, weißen Zähnen stand; eine schlanke, flachbrüstige Figur, eher unter dem Durchschnitt. Die hohen Wangenknochen der Familie waren ihr irgendwie entgangen, und ihre dunkelbraunen Augen, die zu weich und schattig waren, um schwarz zu sein, hatten einen Schrägblick, der fast orientalisch wirkte. Abgesehen von ihren Augen war sie weder hübsch noch hässlich - sie sah einfach nur unscheinbar aus, stellte sie verbittert fest. Wie deutlich die Linien um ihre Augen und ihren Mund in diesem unbarmherzigen Licht waren! Und noch nie hatte ihr schmales, weißes Gesicht so schmal und so weiß ausgesehen.
Sie trug ihr Haar zu einem Pompadour. Pompadours waren längst aus der Mode gekommen, aber sie waren in, als Valancy ihr Haar zum ersten Mal hochsteckte, und Tante Wellington hatte beschlossen, dass sie ihr Haar immer so tragen musste.
"Das ist die einzige Art, die zu dir passt. Dein Gesicht ist so klein, dass du es durch einen Pompadour-Effekt vergrößern musst", sagte Tante Wellington, die immer Gemeinplätze aussprach, als ob sie tiefe und wichtige Wahrheiten verkünden würde.
Valancy hatte sich danach gesehnt, ihr Haar tief in die Stirn gezogen zu tragen, mit Strähnen über den Ohren, wie Olive ihres trug. Aber Tante Wellingtons Diktum hatte eine solche Wirkung auf sie, dass sie nie wieder wagte, ihre Frisur zu ändern. Aber es gab so viele Dinge, die Valancy nie zu tun wagte.
Ihr ganzes Leben lang hatte sie Angst vor irgendetwas gehabt, dachte sie bitter. Seit sie sich erinnern konnte, hatte sie schreckliche Angst vor dem großen schwarzen Bären, der, wie Cousine Stickles ihr erzählte, in dem Schrank unter der Treppe lebte.
"Und ich werde es immer sein - ich weiß es - ich kann nicht anders. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich keine Angst vor etwas hätte."
Angst vor den Wutausbrüchen ihrer Mutter - Angst, Onkel Benjamin zu beleidigen - Angst, zur Zielscheibe von Tante Wellingtons Verachtung zu werden - Angst vor Tante Isabels bissigen Bemerkungen - Angst vor Onkel James' Missbilligung - Angst, die Meinungen und Vorurteile des ganzen Clans zu verletzen - Angst, den Schein nicht zu wahren - Angst, zu sagen, was sie wirklich dachte - Angst vor Altersarmut. Angst, Angst, Angst - sie konnte ihr nie entkommen. Sie fesselte sie und umspannte sie wie ein Spinnennetz aus Stahl. Nur in ihrem Blauen Schloss konnte sie vorübergehend Erleichterung finden. Und an diesem Morgen konnte Valancy nicht glauben, dass sie eine Blaue Burg hatte. Sie würde es nie wieder finden können. Neunundzwanzig, unverheiratet, ungewollt - was hatte sie mit der feenhaften Chatelaine des Blauen Schlosses zu tun? Sie würde solchen kindischen Unsinn für immer aus ihrem Leben streichen und der Realität unbeirrt ins Auge sehen.
Sie wandte sich von ihrem unfreundlichen Spiegel ab und schaute hinaus. Die Hässlichkeit des Anblicks traf sie immer wie ein Schlag: der zerlumpte Zaun, die baufällige alte Fuhrwerkstatt auf dem Nachbargrundstück, die mit kruden, heftig gefärbten Reklamen zugepflastert war, der schmutzige Bahnhof dahinter mit den schrecklichen Verwahrlosten, die sich selbst zu dieser frühen Stunde immer dort herumtrieben. Im strömenden Regen sah alles noch schlimmer aus als sonst, vor allem die scheußliche Werbung "Behalten Sie Ihren Schulmädchen-Teint". Valancy hatte ihren Schulmädchen-Teint behalten. Das war ja gerade das Problem. Nirgendwo gab es einen Schimmer von Schönheit - "genau wie in meinem Leben", dachte Valancy düster. Ihre kurze Verbitterung war verflogen. Sie akzeptierte die Tatsachen so resigniert, wie sie sie immer akzeptiert hatte. Sie gehörte zu den Menschen, an denen das Leben immer vorbeizieht. An dieser Tatsache ließ sich nichts ändern.
In dieser Stimmung ging Valancy zum Frühstück hinunter.
Kapitel III
Das Frühstück war immer dasselbe. Haferflockenbrei, den Valancy verabscheute, Toast und Tee und ein Teelöffel Marmelade. Frau Frederick hielt zwei Teelöffel für übertrieben, aber das machte Valancy nichts aus, denn auch sie hasste Marmelade. In dem kühlen, düsteren kleinen Esszimmer war es noch kälter und düsterer als sonst; der Regen strömte aus dem Fenster, und von den Wänden leuchteten verstorbene Stirlings in grässlichen, vergoldeten Rahmen, die breiter als die Bilder waren, herab. Und doch wünschte Cousin Stickles Valancy viele glückliche Wiederkehr des Tages!
"Setz dich aufrecht hin, Doss", war alles, was ihre Mutter sagte.
Valancy setzte sich aufrecht hin. Sie sprach mit ihrer Mutter und Cousine Stickles über die Dinge, über die sie immer sprachen. Sie fragte sich nie, was passieren würde, wenn sie versuchte, über etwas anderes zu sprechen. Sie wusste es. Deshalb tat sie es nie.
Frau Frederick ärgerte sich über die Vorsehung, die ihr einen Regentag schickte, wenn sie zum Picknick gehen wollte, und so aß sie ihr Frühstück in mürrischem Schweigen, wofür Valancy ziemlich dankbar war. Aber Christine Stickles jammerte wie immer unaufhörlich weiter und beklagte sich über alles Mögliche - das Wetter, das Leck in der Speisekammer, den Preis für Haferflocken und Butter - Valancy hatte sofort das Gefühl, dass sie ihr Toastbrot zu üppig gebuttert hatte - die Mumps-Epidemie in Deerwood.
"Doss wird sie sicher erwischen", ahnte sie.
"Doss darf nicht dorthin gehen, wo sie sich mit Mumps anstecken kann", sagte Frau Frederick kurz.
Valancy hatte nie Mumps oder Keuchhusten oder Windpocken oder Masern oder irgendetwas anderes gehabt, was sie hätte haben sollen - nichts außer schrecklichen Erkältungen jeden Winter. Doss' Erkältungen im Winter waren eine Art Tradition in der Familie. Es schien, als könne sie nichts daran hindern, sich anzustecken. Mrs. Frederick und Cousin Stickles taten ihr Bestes. In einem Winter sperrten sie Valancy von November bis Mai im warmen Wohnzimmer ein. Sie durfte nicht einmal in die Kirche gehen. Und Valancy bekam eine Erkältung nach der anderen und erkrankte schließlich im Juni an Bronchitis.
"Keiner in meiner Familie war jemals so", sagte Frau Frederick und deutete an, dass es sich um eine Tendenz der Stirlings handeln müsse.
"Die Stirlings erkälten sich selten", sagte Cousine Stickles verärgert. Sie war eine Stirling gewesen.
"Ich glaube", sagte Frau Frederick, "wenn man sich entschließt, keine Erkältung zu bekommen, wird man auch nicht erkältet.
Das war also das Problem. Es war alles Valancys eigene Schuld.
Aber an diesem Morgen war Valancys unerträglicher Kummer, dass sie Doss genannt wurde. Neunundzwanzig Jahre lang hatte sie diesen Namen ertragen, und auf einmal spürte sie, dass sie ihn nicht länger ertragen konnte. Ihr vollständiger Name war Valancy Jane. Valancy Jane war ziemlich schrecklich, aber sie mochte Valancy, mit seinem seltsamen, außerirdischen Beigeschmack. Es war für Valancy immer ein Wunder, dass die Stirlings ihr erlaubt hatten, so getauft zu werden. Man hatte ihr gesagt, dass ihr Großvater mütterlicherseits, der alte Amos Wansbarra, den Namen für sie ausgesucht hatte. Ihr Vater hatte das "Jane" angehängt, um ihn zu zivilisieren, und die ganze Verwandtschaft machte sich aus dem Staub, indem sie ihr den Spitznamen "Doss" gab. Valancy wurde sie nur von Außenstehenden genannt.
"Mutter", sagte sie zaghaft, "würdest du mich ab jetzt Valancy nennen? Doss scheint mir so... so... ich mag das nicht."
Frau Frederick sah ihre Tochter erstaunt an. Sie trug eine Brille mit enorm starken Gläsern, die ihren Augen ein besonders unangenehmes Aussehen verliehen.
"Was ist mit Doss los?"
"Es scheint so kindisch zu sein", zögerte Valancy.
"Oh!" Mrs. Frederick war eine Wansbarra gewesen, und das Wansbarra-Lächeln war kein Vorteil. "Ich verstehe. Nun, dann sollte es Ihnen recht sein. Du bist nach bestem Wissen und Gewissen kindisch genug, mein liebes Kind."
"Ich bin neunundzwanzig", sagte das liebe Kind verzweifelt.
"Ich würde es an deiner Stelle nicht in den höchsten Tönen verkünden", sagte Frau Frederick. "Neunundzwanzig! Ich war neun Jahre verheiratet, als ich neunundzwanzig war."
"Ich war mit siebzehn verheiratet", sagte Cousin Stickles stolz.
Valancy schaute sie verstohlen an. Frau Frederick sah, abgesehen von der schrecklichen Brille und der Hakennase, die sie mehr wie einen Papagei aussehen ließ, als ein Papagei überhaupt aussehen konnte, nicht schlecht aus. Mit zwanzig hätte sie vielleicht ganz hübsch sein können. Aber Cousine Stickles! Und doch war Christine Stickles einmal in den Augen eines Mannes begehrenswert gewesen. Valancy hatte das Gefühl, dass Cousine Stickles mit ihrem breiten, flachen, faltigen Gesicht, dem Leberfleck am Ende der plumpen Nase, den struppigen Haaren am Kinn, dem faltigen, gelben Hals, den blassen, hervortretenden Augen und dem dünnen, runzligen Mund ihr gegenüber diesen Vorteil hatte - dieses Recht, auf sie herabzusehen. Und doch war Cousine Stickles für Mrs. Frederick notwendig. Valancy fragte sich mitleidig, wie es wohl wäre, von jemandem gewollt zu werden, von jemandem gebraucht zu werden. Niemand auf der ganzen Welt brauchte sie oder würde etwas vom Leben vermissen, wenn sie plötzlich aus dem Leben fiel. Sie war eine Enttäuschung für ihre Mutter. Keiner liebte sie. Sie hatte nie auch nur eine Freundin gehabt.
"Ich habe nicht einmal die Gabe der Freundschaft", hatte sie sich einmal mitleidig eingestanden.
"Doss, du hast deine Krusten nicht aufgegessen", sagte Frau Frederick tadelnd.
Es regnete den ganzen Vormittag ohne Unterlass. Valancy nähte eine Steppdecke. Valancy hasste es, Quilts zu nähen. Und es war auch gar nicht nötig. Das Haus war voll von Steppdecken. Auf dem Dachboden standen drei große Truhen, vollgestopft mit Quilts. Frau Frederick hatte mit siebzehn Jahren begonnen, Quilts einzulagern, und sie lagerte sie immer weiter ein, obwohl es unwahrscheinlich schien, dass Valancy sie jemals brauchen würde. Aber Valancy musste arbeiten, und schicke Arbeitsmaterialien waren zu teuer. Müßiggang war eine Kardinalsünde im Haushalt der Stirlings. Als Valancy ein Kind gewesen war, hatte man sie gezwungen, jeden Abend in ein kleines, verhasstes, schwarzes Notizbuch all die Minuten einzutragen, die sie an diesem Tag untätig verbracht hatte. Sonntags ließ ihre Mutter sie diese aufschreiben und darüber beten.
An diesem besonderen Vormittag dieses Schicksalstages verbrachte Valancy nur zehn Minuten mit Müßiggang. Zumindest hätten Mrs. Frederick und Cousine Stickles es als Müßiggang bezeichnet. Sie ging in ihr Zimmer, um einen besseren Fingerhut zu holen, und öffnete schuldbewusst wahllos Thistle Harvest.
"Die Wälder sind so menschlich", schrieb John Foster, "dass man mit ihnen leben muss, um sie zu kennen. Ein gelegentlicher Spaziergang durch sie, der sich an die ausgetretenen Pfade hält, wird uns niemals zu ihrer Intimität führen. Wenn wir Freunde sein wollen, müssen wir sie aufsuchen und sie durch häufige, ehrfürchtige Besuche zu allen Stunden gewinnen; morgens, mittags und abends; und zu allen Jahreszeiten, im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Andernfalls können wir sie nie wirklich kennenlernen, und jede gegenteilige Behauptung wird sich ihnen nie aufdrängen. Sie haben ihre eigene wirksame Art, Fremde auf Distanz zu halten und ihr Herz vor zufälligen Besuchern zu verschließen. Es hat keinen Sinn, die Wälder aus irgendeinem anderen Grund als aus reiner Liebe zu ihnen aufzusuchen; sie werden uns sofort auf die Schliche kommen und alle ihre süßen Geheimnisse der alten Welt vor uns verbergen. Aber wenn sie wissen, dass wir aus Liebe zu ihnen kommen, werden sie sehr freundlich zu uns sein und uns solche Schätze der Schönheit und des Entzückens schenken, die man auf keinem Marktplatz kaufen oder verkaufen kann. Denn wenn die Wälder überhaupt etwas geben, dann geben sie es vorbehaltlos und halten nichts von ihren wahren Anbetern zurück. Wir müssen uns ihnen liebevoll, demütig, geduldig und wachsam nähern, und wir werden erfahren, welche ergreifende Schönheit in den wilden Plätzen und stillen Zwischenräumen lauert, die unter Sternenschein und Sonnenuntergang liegen, welche Kadenzen überirdischer Musik auf alten Kiefernzweigen erklingen oder in Tannenwäldchen gesungen werden, welche zarten Aromen Moose und Farne in sonnigen Ecken oder an feuchten Bachläufen verströmen, welche Träume und Mythen und Legenden aus einer älteren Zeit sie heimsuchen. Dann wird das unsterbliche Herz des Waldes gegen das unsere schlagen, und sein subtiles Leben wird sich in unsere Adern stehlen und uns für immer zu den Seinen machen, so dass wir, egal wohin wir gehen oder wie weit wir wandern, immer wieder zum Wald zurückkehren werden, um unsere dauerhafteste Verwandtschaft zu finden."
"Doss", rief ihre Mutter vom Flur aus, "was machst du denn so ganz allein in diesem Zimmer?"
Valancy ließ Distelernte wie eine heiße Kohle fallen und flüchtete nach unten zu ihren Flecken; aber sie fühlte die seltsame Erregung des Geistes, die sie immer kurz überkam, wenn sie in eines von John Fosters Büchern eintauchte. Valancy wusste nicht viel über Wälder - abgesehen von den verwunschenen Eichen- und Kiefernwäldern rund um ihr Blaues Schloss. Aber insgeheim hatte sie sich immer nach ihnen gesehnt, und ein Buch von Foster über Wälder war das Beste, was es gibt, außer den Wäldern selbst.
Am Mittag hörte es auf zu regnen, aber die Sonne kam erst um drei Uhr heraus. Dann sagte Valancy zaghaft, dass sie in die Stadt gehen wolle.
"Was willst du denn in der Stadt?", fragte ihre Mutter.
"Ich möchte ein Buch aus der Bibliothek holen."
"Du hast erst letzte Woche ein Buch aus der Bibliothek geholt."
"Nein, es waren vier Wochen."
"Vier Wochen. So ein Quatsch!"
"Das war es wirklich, Mutter."
"Sie irren sich. Es können unmöglich mehr als zwei Wochen gewesen sein. Ich mag keine Widersprüche. Und ich weiß sowieso nicht, wozu du dir ein Buch besorgen willst. Du verschwendest zu viel Zeit mit Lesen."
"Welchen Wert hat meine Zeit?", fragte Valancy verbittert.
"Doss! Sprich nicht in diesem Ton mit mir."
"Wir brauchen Tee", sagte Cousine Stickles. "Den kann sie sich holen, wenn sie spazieren gehen will - obwohl dieses feuchte Wetter schlecht für Erkältungen ist."
Sie diskutierten noch zehn Minuten darüber, und schließlich stimmte Frau Frederick eher widerwillig zu, dass Valancy gehen durfte.
Kapitel IV
"Hast du deine Gummis an?", rief Cousin Stickles, als Valancy das Haus verließ.
Christine Stickles hatte nicht ein einziges Mal vergessen, diese Frage zu stellen, wenn Valancy an einem feuchten Tag hinausging.
"Ja."
"Hast du deinen Flanellunterrock an?", fragte Frau Frederick.
"Nein."
"Doss, ich verstehe dich wirklich nicht. Willst du dir wieder den Tod durch Erkältung holen?" Ihre Stimme ließ darauf schließen, dass Valancy schon mehrmals an einer Erkältung gestorben war. "Geh sofort nach oben und zieh es an!"
"Mutter, ich brauche keinen Flanellunterrock. Mein Baumwollsatin ist warm genug."
"Doss, denk daran, dass du vor zwei Jahren eine Bronchitis hattest. Geh und tu, was man dir sagt!"
Valancy ging, obwohl niemand je erfahren wird, wie nahe sie daran war, die Gummipflanze auf die Straße zu schleudern, bevor sie ging. Sie hasste diesen grauen Flanellpetticoat mehr als jedes andere Kleidungsstück, das sie besaß. Olive musste nie Flanellunterröcke tragen. Olive trug gerüschte Seide und durchsichtigen Rasen und hauchdünne, geschnürte Volants. Aber Olives Vater hatte "Geld zum Heiraten" und Olive hatte nie eine Bronchitis. Das war's also.