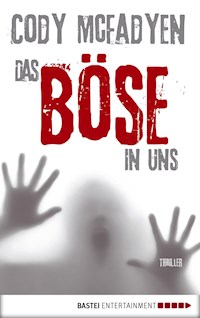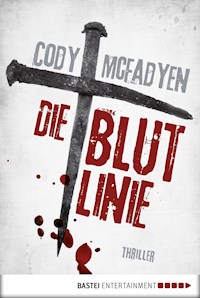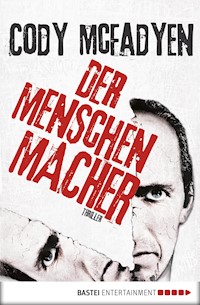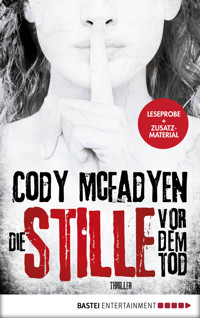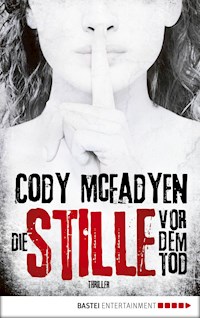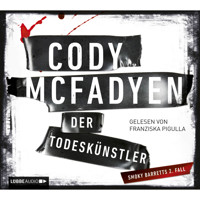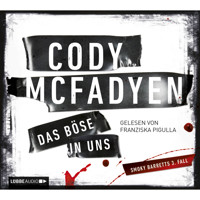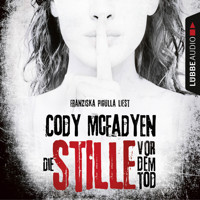9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Smoky Barrett Sammelband
- Sprache: Deutsch
Zwei hochspannende Fälle der FBI-Ermittlerin Smoky Barrett in einem e-Book:
In "Das Böse in uns" jagt FBI-Agentin Smoky Barrett einen Serienkiller, der Filme von seinen Taten online stellt. Anscheinend will der Mörder Rache nehmen, denn jedes Opfer hatte eine Sünde begangen. Smoky steht als Nächste auf seiner Liste.
Auch in "Ausgelöscht" hat Smoky es mit dem abgrundtief Bösen zu tun: Sie muss mit ansehen, wie eine blutverschmierte Frau aus einem fahrenden Auto gestoßen wird. Sie ist nur noch eine leblose Hülle: Jemand hat die zentralen Nervenbahnen ihres Gehirns durchschnitten. Und sie wird nicht die Letzte sein ...
Zwei Teile der erfolgreichen Thriller-Reihe von Bestseller-Autor Cody Mcfadyen in einem e-Book!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1196
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Das Böse in uns
Widmung
Danksagung
Teil 1: Die Ruhe vor dem Sturm
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Zwischenspiel: Der Tod der Rosemary Sonnenfeld
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil 2: Der Sturm
Kapitel 21
Die Sünde des Dexter Reid
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Die Sünden der Valerie Cavanaugh
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Die Sünden von Michael und Frances Murphy
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Eine letzte Sache: Die Sünden der Kirby Mitchell
Ausgelöscht
Widmung
Teil 1: Die Sonne
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Teil 2: Der Mond
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Danksagungen
Fallakte Smoky Barrett
Über dieses Buch
In »Das Böse in uns« jagt FBI-Agentin Smoky Barrett einen Serienkiller, der Filme von seinen Taten online stellt. Anscheinend will der Mörder Rache nehmen, denn jedes Opfer hatte eine Sünde begangen. Smoky steht als Nächste auf seiner Liste.
Auch in »Ausgelöscht« hat Smoky es mit dem abgrundtief Bösen zu tun: Sie muss mit ansehen, wie eine blutverschmierte Frau aus einem fahrenden Auto gestoßen wird. Sie ist nur noch eine leblose Hülle: Jemand hat die zentralen Nervenbahnen ihres Gehirns durchschnitten. Und sie wird nicht die Letzte sein …
Über den Autor
Cody Mcfadyen, geboren 1968, unternahm als junger Mann mehrere Weltreisen und arbeitete danach in den unterschiedlichsten Branchen. Er ist verheiratet, Vater einer Tochter und lebt mit seiner Familie in Kalifornien. DIE BLUTLINIE war sein erster Roman und sorgte weltweit für großes Aufsehen. Mit DER TODESKÜNSTLER, DAS BÖSE IN UNS und AUSGELÖSCHT hat er die außergewöhnliche Thriller-Reihe um Smoky Barrett fortgesetzt.
Cody Mcfadyen
Das Böse in uns
Ausgelöscht
Zwei Smoky-Barrett-Romane in einem E-Book
Aus dem Englischenvon Axel Merz (»Das Böse in uns«),Angela Koonen und Dietmar Schmidt (»Ausgelöscht«)
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch bei Lübbe Audio lieferbar
Copyright © 2008 (»Das Böse in uns«) und 2009 (»Ausgelöscht«) by Cody Mcfadyen
Titel der amerikanischen Originalausgaben:
»The Darker Side« und »Abandoned«
Copyright © 2008 (»Das Böse in uns«) und 2010 (»Ausgelöscht«) by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung vonIllustrationen © shutterstock: Korionov | Nella
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-1265-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Das Böse in uns
Thriller
Für Hyeri – für ihre Sanftmut
Danksagung
Mein Dank geht wie stets an Liza und Havis Dawson für die kompetente und begeisterte Repräsentation. Liza danke ich für das geduldige Zuhören, wenn ich wieder mal das Bedürfnis hatte, zu jammern oder zu schimpfen. Dank an Chandler Crawford, dass sie meine Werke übers Meer in andere Länder getragen und dort großes Interesse daran geweckt hat. Herzlichen Dank auch an Danielle Perez und Nick Sayers für ihre redaktionelle Arbeit. Und Dank an die vielen Leser, die mir geschrieben oder E-Mails geschickt haben. Ihr seid der Treibstoff für den Motor, Leute. Ich schreibe so lange weiter, wie ihr meine Bücher lest.
KAPITEL 1
Sterben ist eine einsame Sache.
Das Leben aber auch.
Wir alle verbringen unser Leben im tiefsten Innern einsam und allein. Ganz gleich, wie viel wir mit den Menschen teilen, die wir lieben, irgendetwas halten wir stets zurück. Manchmal ist es eine Kleinigkeit – zum Beispiel, wenn eine Frau sich an eine heimliche, längst vergangene Liebe erinnert. Sie erzählt ihrem Gatten, sie habe keinen Mann inniger geliebt als ihn, in ihrem ganzen Leben nicht, und das stimmt auch. Allerdings hat sie einen anderen Mann genauso sehr geliebt.
Manchmal ist das Geheimnis in unserem Innern etwas Riesiges und Düsteres – ein Ungeheuer, das direkt hinter uns lauert und dessen heißen Atem wir zwischen den Schulterblättern spüren. Ein Beispiel: Ein Student erlebt auf dem College, wie eine Frau von mehreren Kerlen nacheinander vergewaltigt wird, doch unser Student sagt kein Wort, zu keinem Menschen. Jahre später wird er Vater einer Tochter. Je mehr er sie liebt, desto größer werden seine Schuldgefühle. Trotzdem wird er seine inneren Qualen niemandem anvertrauen. Er wird eher Folter und Tod erleiden als die Wahrheit sagen.
In tiefster Nacht – in den Stunden, wenn jeder von uns alleine ist – kommen diese alten Geheimnisse und klopfen bei uns an. Einige klopfen lautstark, andere leise, kaum vernehmlich. Doch ob laut oder leise, sie kommen. Keine verschlossene Tür kann sie aufhalten. Sie haben den Schlüssel zu unserem Innersten. Wir reden mit ihnen, flehen sie an, wir verfluchen sie, schreien sie an. Wir wünschen uns, mit jemandem über diese Geheimnisse reden zu können, sie jemandem anvertrauen zu können, nur einem einzigen anderen Menschen, um ein klein wenig Erleichterung zu finden.
Wir wälzen uns im Bett hin und her oder gehen im Zimmer auf und ab oder nehmen Drogen oder heulen den Mond an, bis endlich der Morgen dämmert. Mit dem neuen Tag verstummt das Jaulen und Kreischen unserer dunklen Geheimnisse; sie kapseln sich wieder ein in unserem Innern, und wir tun unser Bestes, mit ihnen weiterzuleben. Der Erfolg bei diesem Unterfangen hängt von der Art und Größe des Geheimnisses ab und dem, der es in sich trägt. Nicht jeder ist dazu geschaffen, mit Schuld zu leben.
Jung oder Alt, Mann oder Frau, jeder hat Geheimnisse. Das habe ich gelernt. Das habe ich erfahren. Ich weiß es von mir selbst.
Jeder.
Ich blicke auf das tote Mädchen auf dem metallenen Untersuchungstisch und frage mich: Welche Geheimnisse hast du mitgenommen, von denen nie jemand erfahren wird?
Sie ist viel zu jung, um tot zu sein. Anfang zwanzig. Wunderschön. Langes, dunkles, glattes Haar. Ihre Haut hat die Farbe von hellem Kaffee; sogar im harten Licht der Leuchtstoffröhren sieht ihre Haut glatt und makellos aus. Hübsche, zarte Gesichtszüge. Eine Angloamerikanerin mit leichtem Latino-Einschlag. Ihre Lippen sind blass im Tod, doch sie sind voll, ohne dick zu sein. Ich stelle mir vor, wie diese Lippen bei einem Lächeln ausgesehen haben, das in ein Lachen übergeht – ein weiches, melodisches Lachen. Sie ist klein und schlank; das sehe ich durch das Laken hindurch, das sie vom Hals abwärts bedeckt.
Ich habe viele Ermordete gesehen, doch jedes Mal erschüttert es mich aufs Neue. Ob Täter oder Opfer, gut oder böse, jeder war ein Mensch mit Hoffnungen, Träumen und Lieben. Doch wir leben in einer Welt, in der die Karten gegen das Leben spielen. Die Welt gibt uns reichlich Gelegenheit zu sterben: Krebs, ein Unfall auf der Autobahn, ein Herzanfall mit einem Glas Wein in der Hand und einem erstickten Lächeln im Gesicht. Mörder betrügen dieses System. Sie helfen den Dingen auf die Sprünge, beschleunigen sie, nehmen ihren Opfern etwas, das auch so schwer genug zu behalten und deshalb umso kostbarer ist. Und das macht mich rasend. Ich habe es gehasst, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, und ich hasse es heute noch mehr.
Ich habe seit langem mit dem Tod zu tun. Ich arbeite beim FBI in Los Angeles und leite seit zwölf Jahren ein Team, dessen Aufgabe darin besteht, den schlimmsten Abschaum zu jagen. Serienkiller. Kinderschänder und -mörder. Männer, denen es Lust bereitet, Frauen zu Tode zu foltern, und die dann Sex mit den Leichen ihrer Opfer haben. Ich jage lebende Albträume, und es ist jedes Mal schrecklich. Doch es ist überall, und es ist unausweichlich.
Aus diesem Grund muss ich jetzt meine Frage stellen:
»Was machen wir hier, Sir?«
Assistant Director Jones ist mein langjähriger Mentor, mein Boss und der Verantwortliche für sämtliche Aktivitäten des FBI im Großraum Los Angeles. Nur haben wir jetzt ein Problem: Wir sind nicht in Los Angeles. Wir sind in Virginia, nicht weit von Washington D. C.
Das ist der Grund für meine gefühllose Frage, was wir hier eigentlich verloren hätten.
Diese arme Frau mag tot sein, und die Unumstößlichkeit ihres Todes geht mir nahe, doch ich bin nicht für sie zuständig. Sie ist keine von meinen Toten.
AD Jones mustert mich mit einem Seitenblick, teils nachdenklich, teils verärgert. Jones sieht genau wie der Mann aus, der er ist: ein erfahrener Cop, ein narbiger Veteran. Er sorgt für die Einhaltung der Gesetze, und er führt Menschen. Jones hat ein kantiges, ausdrucksstarkes Gesicht, müde, aber harte Augen und einen militärischen Haarschnitt ohne Rücksicht auf Mode oder irgendwelche Kinkerlitzchen. Jones ist auf seine Weise ein attraktiver Mann, dreimal geschieden; die Frauen stehen auf ihn. Doch hier steckt mehr dahinter. Ein Schatten in einer Stahlkassette.
»Eine Bitte von ganz oben, Smoky«, sagt Jones. »Von Director Rathbun persönlich.«
»Tatsächlich?«
Ich bin ehrlich überrascht. Warum hier? Warum ich? Und warum geht AD Jones auf diese unübliche Bitte ein? Er war nie ein bürokratischer Sesselfurzer, sondern hat Befehle unnachgiebig hinterfragt, wenn er das Gefühl hatte, fragen zu müssen. AD Jones mag zwar »Bitte von ganz oben« gesagt haben, doch wir wären trotzdem nicht hier, hätte er nicht den Eindruck, dass es einen guten Grund dafür gibt.
»Ja«, antwortet er. »Rathbun hat einen Namen fallen lassen, den ich nicht übergehen konnte.«
Die Tür zur Leichenhalle schwingt auf, ehe ich die naheliegende Frage stellen kann.
»Wenn man vom Teufel spricht«, murmelt AD Jones.
FBI Director Samuel Rathbun betritt den Raum allein – schon wieder etwas Ungewöhnliches. Leute seines Ranges reisen normalerweise mit Gefolge; das war schon vor dem elften September so. Nun kommt Rathbun zu uns und streckt zuerst mir die Hand entgegen. Ich ergreife sie, schüttle sie und schaue ihm verwirrt ins Gesicht.
Sieht so aus, als wäre ich hier die Ballkönigin, geht es mir durch den Kopf. Aber warum?
»Agentin Barrett«, sagt Rathbun in jenem Bariton, der sein Markenzeichen und politisch sehr vorteilhaft ist. »Danke, dass Sie so kurzfristig gekommen sind.«
Sam Rathbun, normalerweise »Sir« genannt, ist für einen FBI-Chef eine durchaus erträgliche Mischung äußerer und innerer Qualitäten. Er hat das erforderliche gute Aussehen und den politischen Durchblick, doch er verfügt auch über polizeiliche Fronterfahrung. Er hat als Cop angefangen, nebenbei ein Abendstudium in Jura absolviert und ist irgendwann beim FBI gelandet. Ich würde nicht so weit gehen, ihn »aufrichtig« zu nennen – sein hoher Rang verhindert diesen Luxus –, doch er lügt nur, wenn es unbedingt sein muss. Dem Vernehmen nach ist er ziemlich rücksichtslos, was mich nicht überraschen würde, und er soll ein Gesundheitsfanatiker sein. Er raucht nicht, trinkt nicht, verzichtet auf Kaffee und Cola und joggt jeden Morgen fünf Kilometer.
Tja, jeder hat so seine Fehler.
Ich muss den Kopf in den Nacken legen, um ihm in die Augen zu sehen. Ich bin nur knapp einsfünfzig; deswegen bin ich daran gewöhnt.
»Überhaupt kein Problem, Sir«, lüge ich, dass sich die Balken biegen.
Denn genau genommen war es ein Problem. Ein verdammt großes Problem sogar. Doch AD Jones ist derjenige, der die Nebenwirkungen zu spüren bekommt, wenn ich mich störrisch zeige.
Rathbun nickt AD Jones zu. »Guten Tag, David«, sagt er.
»Guten Tag, Sir.«
Ich vergleiche die beiden Männer mit einigem Interesse. Sie sind ungefähr gleich groß. AD Jones hat braunes Haar, kurz geschnitten auf eine Weise, die sagt: »Ich hab keine Zeit, mich mit Äußerlichkeiten aufzuhalten.« Rathbuns Haar ist schwarz, durchsetzt mit grauen Strähnen und sorgfältig frisiert. Ein sehr attraktiver Mann in den besten Jahren, ein Macher durch und durch. AD Jones ist vielleicht zehn Jahre älter als Rathbun und hat mehr Falten um die Augen, während Rathbun aussieht wie jemand, der morgens joggt und seinen Sport liebt. Jones hingegen sieht aus wie jemand, der morgens joggen könnte und es vorzieht, stattdessen eine Zigarette zu rauchen und eine Tasse Kaffee dazu zu trinken – und zum Teufel mit jedem, dem das nicht passt. Rathbuns Anzug sitzt besser, und er trägt eine Rolex am Handgelenk. Jones trägt eine Uhr, für die er wahrscheinlich nicht mehr als dreißig Dollar bezahlt hat – vor zehn Jahren. Die Unterschiede sind also deutlich. Doch was mich trotz allem viel mehr interessiert, sind die Ähnlichkeiten der beiden.
Jeder hat den gleichen müden Blick – einen Blick, den man bekommt, wenn man heimlich eine schwere Last zu tragen hat. Beide haben die Gesichter von Pokerspielern, die nie alles auf den Tisch legen.
Zwei Männer, mit denen das Leben für eine Frau nicht einfach wäre, überlege ich. Nicht, weil sie schlechte Kerle wären, sondern weil sie davon ausgehen, dass man um ihre Liebe weiß, und das muss reichen. Liebe ja, Blumen nein.
Director Rathbun wendet sich wieder zu mir. »Ich komme gleich zur Sache, Agentin Barrett«, sagt er. »Sie sind hier, weil ich gebeten wurde, Sie bei dieser Sache hinzuzuziehen. Von jemandem, dem ich diese Bitte nicht abschlagen kann.«
Ich werfe einen raschen Blick zu AD Jones. Ich muss an seine Worte denken, Director Rathbun habe »einen Namen fallen lassen«.
»Dürfte ich fragen von wem, Sir?«
»Gleich.« Er nickt in Richtung der Leiche. »Sagen Sie mir, was Sie sehen.«
Ich drehe mich zu der Toten um, konzentriere mich.
»Eine junge Frau, Anfang zwanzig. Wahrscheinlich Opfer eines Verbrechens.«
»Wie kommen Sie darauf?«
Ich deute auf mehrere Blutergüsse am linken Oberarm der Toten. »Die Hämatome sind rot bis dunkelrot, sodass sie sehr frisch sein müssen. Sehen Sie die Umrisse der Finger? Die Hämatome wurden durch die Hand eines Menschen verursacht. Man muss sehr fest zupacken, um derartige Blutergüsse zu verursachen. Andererseits ist der Leichnam kalt. Das bedeutet, dass die Frau seit wenigstens zwölf Stunden tot sein muss, angesichts der Blutergüsse eher zwanzig Stunden – allerdings weniger als sechsunddreißig Stunden, denn das Opfer befindet sich noch im Zustand der Leichenstarre.« Ich zucke die Schultern. »Sie war jung, und jemand hat sie kurz vor ihrem Tod so fest am Arm gepackt, dass Spuren zurückgeblieben sind. Sehr verdächtig.« Ich blicke Rathbun mit einem schiefen Grinsen an. »Oh, beinahe hätte ich es vergessen … aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Frau keines natürlichen Todes gestorben, sonst wäre ich nicht hier.«
»Gut beobachtet, wie ich es nicht anders erwartet habe«, sagt Rathbun. »Sie haben recht, Agentin Barrett. Die Frau wurde ermordet. An Bord eines Passagierflugzeugs auf dem Weg von Texas nach Virginia. Niemand hat bemerkt, dass sie tot war, bis sämtliche Passagiere die Maschine verlassen hatten und die Stewardess versucht hat, die Frau zu wecken.«
Ich starre ihn an. Ich bin sicher, dass er mich auf den Arm nimmt. »Ein Mord in zehntausend Metern Höhe? Das ist ein Witz, Sir, oder?«
»Leider nein.«
»Woher wissen wir, dass sie ermordet wurde?«
»Die Art und Weise, wie sie gefunden wurde, lässt keinen anderen Schluss zu. Doch ich möchte, dass Sie sich alles mit eigenen Augen anschauen, ohne Voreingenommenheit.«
Ich wende mich erneut der Leiche zu. Ich bin jetzt schon fasziniert von diesem Fall. »Wann ist es passiert? Wann genau wurde die Frau gefunden?«
»Ihr Leichnam wurde vor zwanzig Stunden entdeckt.«
»Haben wir bereits eine Todesursache?«
»Die Autopsie steht noch aus.« Director Rathbun blickt auf seine Uhr. »Der Gerichtsmediziner müsste bald hier sein. Wahrscheinlich wurde er aufgehalten, weil er zuvor eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben muss.«
Dieser außergewöhnliche Umstand bringt mich zu meiner ursprünglichen Frage zurück: »Warum ausgerechnet ich, Sir? Oder besser gefragt, warum Sie? Was ist so Besonderes mit dieser Frau, dass es die Einbindung des FBI-Chefs in die Ermittlungen erfordert?«
»Das werde ich Ihnen gleich sagen. Aber zuerst möchte ich, dass Sie sich etwas ansehen. Haben Sie Geduld, Agentin Barrett.«
Als hätte ich eine Wahl.
Rathbun geht zu der Leiche und hebt das Laken von der Brust der Toten. Er hält es hoch.
»Sehen Sie her«, sagt er.
AD Jones und ich treten zum Kopfende des Untersuchungstisches, sodass wir den Leichnam von oben nach unten betrachten können. Ich sehe kleine Brüste mit braunen Warzen, einen flachen Bauch, um den ich die Frau beneiden würde, wäre sie noch am Leben. Mein Blick gleitet tiefer und gelangt ungestraft zum Schambereich, eine der vielen Würdelosigkeiten, die Tote über sich ergehen lassen müssen.
Und dann halte ich schockiert inne.
»Sie hat einen Penis!«, sprudelt es aus mir hervor.
AD Jones sagt nichts.
Director Rathbun lässt das Laken zurückgleiten, langsam und behutsam, eine beinahe väterliche Geste.
»Das ist Lisa Reid, Agentin Barrett. Sagt Ihnen der Name etwas?«
Ich runzle die Stirn, während ich versuche, die Verbindung herzustellen. Ich kenne nur einen Namen, der die Anwesenheit von Director Rathbun rechtfertigen würde.
»Sie meinen … wie beim Kongressabgeordneten Reid aus Texas?«
»Ganz recht. Lisa wurde als Dexter Reid geboren. Mrs. Reid hat speziell Sie angefordert. Sie ist mit Ihrer … äh, Geschichte vertraut.«
Sein Unbehagen amüsiert mich, doch ich lasse mir nichts anmerken.
Vor drei Jahren haben mein Team und ich einen Serienkiller gejagt, einen Psychopathen namens Joseph Sands. Wir waren ihm ganz dicht auf den Fersen, als er eines Nachts in mein Haus einbrach. Er fesselte mich an mein Bett und vergewaltigte mich wieder und wieder. Dann zerschnitt er mit einem Jagdmesser meine linke Gesichtshälfte, raubte mir für immer meine Schönheit und ließ eine unauslöschliche Reliefkarte aus Schmerz und Narbengewebe zurück.
Die Narbe fängt an meinem Haaransatz an, mitten auf der Stirn. Von dort verläuft sie senkrecht nach unten und zwischen den Augenbrauen hindurch, ehe sie in einem nahezu perfekten Neunzig-Grad-Winkel nach links wegführt. Ich habe keine linke Augenbraue mehr – die Narbe hat sie ersetzt. Von dort aus verläuft sie weiter über meine Schläfe und beschreibt eine träge Schlangenlinie über meine Wange nach unten. Von dort führt sie messerscharf zu meiner Nase und über den Nasenrücken und zieht sich über den Nasenflügel zum Kieferknochen, um von dort aus am Hals entlang bis zum Schlüsselbein zu verlaufen, wo sie endet.
Ich habe eine weitere Narbe, perfekt und gerade, die unter meinen linken Auge anfängt und sich bis zum Mundwinkel zieht. Sie ist das Geschenk eines anderen Psychopathen, der mich gezwungen hat, mir diese Wunde eigenhändig zuzufügen, mit einem Messer, während er mir sabbernd und grinsend zuschaute.
Das aber sind nur die sichtbaren Narben. Unter dem Kragen meiner Bluse gibt es weitere, hinterlassen von Mr. Sands’ Jagdmesser und dem kirschroten Ende einer brennenden Zigarre. Ich verlor in jener Nacht mein Gesicht – doch das ist noch das Geringste, was Sands mir gestohlen hat. Er war ein hungriger Dieb und ein Feinschmecker, und er aß nur die kostbarsten Speisen.
Ich hatte einen Ehemann, einen wunderbaren Mann namens Matt. Sands fesselte ihn an einen Stuhl und ließ ihn dabei zuschauen, wie er mich vergewaltigte und mein Gesicht verstümmelte. Anschließend bekam ich den Logenplatz und durfte zusehen, wie er Matt folterte und tötete. Wir weinten beide, schrien beide – und dann war Matt nicht mehr da. Schreien war das Letzte auf dieser Welt, was wir gemeinsam taten.
Es gab noch einen letzten Diebstahl, den schlimmsten, allerschlimmsten von allen. Meine zehn Jahre alte Tochter Alexa. Ich hatte es irgendwie geschafft, mich zu befreien, und war mit meiner Waffe hinter Sands her gewesen. Er riss Alexa zu sich hoch, als ich auf den Abzug drückte, und die Kugel, die für ihn gedacht war, tötete meine eigene Tochter. Ich durchlöcherte Sands mit den restlichen Kugeln im Magazin und lud schreiend nach, um weiter auf ihn zu schießen. Ich hätte bis ans Ende aller Tage auf ihn gefeuert, wenn sie mich gelassen hätten.
Nach jener Nacht folgten sechs Monate, die ich am Rande des Suizids verbrachte, eingehüllt in Verzweiflung und Irrsinn. Ich wollte sterben, und ich wäre wohl auch gestorben. Doch ich wurde gerettet, weil vorher jemand anders starb.
Meine beste Freundin aus der Zeit an der Highschool, Annie King, wurde nur aus einem einzigen Grund von einem Irren ermordet: Er wollte, dass ich ihn jagte. Er vergewaltigte Annie auf brutalste Weise und schlitzte sie mit einem Fischmesser auf. Als er mit ihr fertig war, band er Annies zehn Jahre alte Tochter, Bonnie, mit ihrer Mutter zusammen. Bonnie war drei Tage lang an die Leiche ihrer Mutter gefesselt, bevor sie gefunden wurde. Drei Tage und Nächte Wange an Wange mit ihrer ausgeweideten, toten Mutter.
Ich erfüllte Annies Mörder seinen Wunsch: Ich jagte ihn und tötete ihn ohne jeden Skrupel.
Als es vorbei war, bekam mein Leben wieder einen Sinn: Annie hatte mir Bonnie anvertraut, wie sich herausstellte. Normalerweise wäre es eine zum Scheitern verurteilte Beziehung gewesen, denn ich war ein seelischer Krüppel, und Bonnie hatte das Grauen, das sie erlebt hatte, die Sprache geraubt. Doch das Schicksal kann sehr launisch sein. Aus Flüchen erwächst manchmal Segen. Wir waren beide zerbrochen, Bonnie und ich; zusammen aber halfen wir uns gegenseitig, wieder gesund zu werden. Bonnie fing zwei Jahre nach ihrem grauenerregenden Erlebnis wieder zu sprechen an, und ich habe meinen Lebenswillen zurück, ja, es kommt sogar vor, dass ich mich am Leben erfreue, was ich vor nicht allzu langer Zeit für ein Ding der Unmöglichkeit gehalten habe.
Ich habe gelernt, mit meiner körperlichen Entstellung zu leben. Ich habe mich selbst nie als schön empfunden, doch hübsch war ich. Ich bin klein und habe lockiges braunes Haar, das mir bis zu den Schultern reicht. Ich habe »mundgerechte Titten«, wie Matt sie zu nennen pflegte, und einen Hintern, der größer ist, als ich ihn gerne hätte, obwohl er für sich genommen anziehend scheint. Ich habe mich stets wohlgefühlt in meiner Haut und war mit meinem Aussehen ganz zufrieden. Sands’ Werk jedoch hatte zur Folge, dass ich jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaute, zitterte und Schweißausbrüche bekam. Nach jener Nacht bürstete ich mein Haar nach vorn, um die Narben zu verdecken. Heute binde ich es zu einem Pferdeschwanz nach hinten, dicht am Kopf anliegend, eine Herausforderung an die Welt: Schau hin! Und ich scheiß drauf, wenn es dir nicht gefällt, was du siehst.
Das alles – meine »äh, Geschichte«, wie Director Rathbun es nennt – ist in Zeitungen und Zeitschriften im ganzen Land breitgetreten worden und hat mich bei Gut und Böse zu einer Art gruseliger Berühmtheit gemacht.
Darüber hinaus hat meine Entstellung eine obere Karrieregrenze beim FBI für mich festgelegt. Es gab mal eine Zeit, da wurde ich als Nachfolgerin von AD Jones gehandelt. Das ist vorbei. Meine Narben verleihen mir ein gutes Gesicht für eine Jägerin – oder jemanden, der Jäger ausbildet (man hat mir tatsächlich einen entsprechenden Posten in Quantico angeboten, aber ich habe abgelehnt), doch was das administrative Gesicht des FBI angeht und Fotoshootings mit dem Präsidenten, wird es so weit nicht kommen.
Ich bin mit alledem im Reinen, schon seit geraumer Zeit. Ich würde nicht sagen, dass ich meine Arbeit genieße – genießen ist nicht das richtige Wort –, doch ich bin stolz darauf, einen guten Job zu machen.
»Ich verstehe«, antworte ich. »Warum haben Sie zugestimmt?«
»Der Kongressabgeordnete Reid ist mit dem Präsidenten befreundet, und dessen zweite Amtszeit neigt sich bekanntlich dem Ende zu. Reid ist Spitzenkandidat für die Nominierungswahlen der Demokraten, wie Sie sicherlich wissen.«
»Präsident Allens Partei«, spricht AD Jones das Offensichtliche aus.
Langsam kristallisiert sich ein Bild heraus. Der Name, den Rathbun hat fallen lassen – der Name, den AD Jones nicht ignorieren konnte –, ist der des Präsidenten. Und Dillon Reid ist nicht nur ein Freund des Präsidenten, er ist sein möglicher Nachfolger.
»Das wusste ich nicht«, sage ich leise.
Director Rathbun hebt die Augenbrauen. »Sie wussten nicht, dass Dillon Reid ein Kandidat der Demokraten ist? Schauen Sie sich denn keine Nachrichten an?«
»Nein. Die Nachrichten sind immer nur schlecht. Warum sollte ich mir da die Mühe machen?«
Rathbun starrt mich ungläubig an.
»Es ist nicht so, als würde ich nicht zur Wahl gehen«, füge ich hinzu. »Wenn die Zeit gekommen ist, sehe ich mir die Kandidaten und ihre Programme an. Es ist nur so, dass ich mich nicht für den Mist interessiere, der vorher passiert.«
AD Jones lächelt schwach. Director Rathbun schüttelt den Kopf.
»Nun, jetzt, wo Sie es wissen, hören Sie gut zu«, sagt er.
Die Vorreden sind vorbei; jetzt ist die Zeit gekommen, die Befehle auszugeben.
»Im Verlauf dieser Ermittlung werden Sie sich zu keinem Zeitpunkt von der Politik oder politischen Erwägungen hindern lassen, aufrichtig und ehrlich zu arbeiten. Außerdem erwartet man Rücksicht und Diskretion von Ihnen. Ich werde Sie mit ein paar wichtigen Fakten vertraut machen. Sie werden diese Informationen für sich behalten. Sie werden sie nicht schriftlich niederlegen, nicht in einer Notiz, nicht in einer E-Mail. Sie werden diese Fakten nur an jene Mitglieder Ihres Teams weitergeben, die darüber Bescheid wissen müssen, und Sie werden dafür Sorge tragen, dass diese Personen ebenfalls den Mund halten. Ist das so weit klar?«
»Jawohl, Sir«, antworte ich.
AD Jones nickt.
»Ein transsexuelles Kind ist politisches Dynamit für jeden, besonders für einen demokratischen Kongressabgeordneten in einem Bundesstaat mit überwiegend republikanischen Stammwählern. Die Reids haben dieses Problem dadurch gelöst, dass sie offiziell jegliche Verbindung zu ihrem Sohn abgebrochen haben. Er wurde zwar nicht enterbt, doch wann immer sie gefragt werden, lautet ihre Antwort, dass er zu Hause nicht willkommen sei, solange er sein transsexuelles Leben führe. Es war in den Schlagzeilen, und es verschwand wieder aus den Schlagzeilen, und damit war die Sache mehr oder weniger erledigt.«
»Aber es war gelogen, oder?«, fragt AD Jones.
Ich blicke ihn überrascht an.
Rathbun nickt. »Die Wahrheit ist, die Reids liebten ihren Sohn. Es war ihnen völlig egal, ob er schwul, transsexuell oder Marsianer war.«
Und jetzt verstehe ich. »Die Eltern haben geholfen, die Geschlechtsumwandlung zu finanzieren, habe ich recht?«
»So ist es. Nicht direkt, versteht sich, aber sie haben Dexter Geld gegeben, wann immer er etwas brauchte – in dem Wissen, dass er es für seine sexuelle Verwandlung benutzen würde. Abgesehen davon hat Dexter heimlich jedes Weihnachten bei seiner Familie verbracht.«
Ich schüttle ungläubig den Kopf. »Ist diese Lüge tatsächlich so bedeutsam?«
Rathbun schaut mich an und lächelt. Es ist das Lächeln eines Erwachsenen gegenüber einem Kind, das einen soeben mit seiner Naivität bezaubert hat. Ist sie nicht süß?
»Sehen Sie nicht den Kampf der Kulturen, der in diesem Land entbrannt ist? Nun, stellen Sie sich diesen Kampf zehnmal verbissener vor, und Sie wissen, wie es in Teilen des Südens aussieht. Es könnte den Ausschlag geben, ob man zum Präsidenten gewählt wird oder nicht. Ja, diese Lüge ist bedeutsam.«
Ich überdenke seine Worte. »Ich verstehe«, sage ich. »Aber das alles interessiert mich nicht.«
Rathbun runzelt die Stirn. »Agentin Barrett …«
»Moment bitte, Sir. Ich sage nicht, dass ich nicht bereit bin, Vertraulichkeit zu wahren. Ich sage nur, dass ich sie nicht wahren werde, nur weil der Kongressabgeordnete Reid gerne Präsident werden möchte. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Ich wahre die Vertraulichkeit, weil eine Familie, die ihren Sohn verloren hat, es so von mir möchte.« Ich nicke in Richtung von Lisas Leichnam. »Und weil Lisa den Anschein macht, als wäre es ihr ebenfalls lieber so.«
Rathbun starrt mich für einen Moment an. »Meinetwegen«, sagt er schließlich und fährt fort: »Mrs. Reid wird Ihre Kontaktperson zur Familie sein. Wenn Sie mit dem Abgeordneten sprechen müssen, wird sie einen Termin vereinbaren. Erforderliche Genehmigungen beispielsweise, was die Durchsuchung von Lisas Wohnung angeht. In allen diesen Dingen ist Mrs. Reid Ihre Ansprechpartnerin. Halten Sie sich vom Abgeordneten Reid fern, es sei denn, es ist absolut notwendig.«
»Und wenn am Ende alles darauf hindeutet, dass er der Täter ist?«, frage ich. »Was dann?«
Rathbuns Lächeln ist humorlos. »Dann zähle ich darauf, dass Sie sämtliche politischen Notwendigkeiten ignorieren.«
»Wer kümmert sich um die Medien?«, fragt AD Jones.
»Ich selbst. Ich möchte nicht, dass einer von Ihnen mit der Presse spricht. Kein Kommentar, basta.« Er sieht mich an. »Das gilt ganz besonders für Agentin Thorne.«
Er meint damit Callie, ein Mitglied meines Teams. Sie ist berüchtigt dafür, dass sie sagt, was sie will und wann sie es will.
Ich muss grinsen. »Keine Sorge, Sir. Sie hat Wichtigeres zu tun.«
»Wie das?«
»Sie heiratet nächsten Monat.«
Er stutzt. »Tatsächlich?«
Callie ist beim FBI als eingefleischte Junggesellin bekannt. Ich gewöhne mich allmählich an die ungläubigen Mienen, wenn ich die Neuigkeit verkünde, dass sie in den Stand der Ehe treten will.
»Ja, Sir.«
»Es geschehen tatsächlich noch Zeichen und Wunder. Bestellen Sie ihr meine besten Wünsche. Aber passen Sie auf, dass sie ihr Mundwerk im Zaum hält.« Er wirft einen Blick auf seine Rolex. »Ich werde Sie jetzt zu Mrs. Reid bringen. Der Gerichtsmediziner müsste in Kürze hier sein. Die Ergebnisse der Autopsie gehen an mich und an Ihr Team, an niemanden sonst. Noch Fragen?«
AD Jones schüttelt den Kopf.
»Nein, Sir«, sage ich. »Aber ich denke, ich sollte allein mit Mrs. Reid sprechen. Sozusagen von Mutter zu Mutter.«
Er runzelt die Stirn. »Erklären Sie mir bitte genauer, was Sie damit meinen.«
»Statistisch gesehen stören Männer sich stärker an Transsexuellen als Frauen. Ich sage nicht, dass der Kongressabgeordnete Reid seinen Sohn nicht geliebt hat, doch falls Lisa jemanden hatte, dem sie sich wirklich nahe gefühlt hat, dann wette ich, dass es ihre Mom war.« Ich zögere. »Außerdem wird es vermutlich noch einen weiteren Grund dafür geben, dass Mrs. Reid nach mir verlangt hat.«
»Und welchen?«
Ich blicke auf Lisas Leichnam. Lisa verkörpert ein neues Geheimnis – ein Geheimnis, das die Toten enthüllen, das die Alten kennen und das die Jungen stets aufs Neue ignorieren: Das Leben ist zu kurz, ganz gleich, wie lang es ist.
Mein Lächeln ist ohne jeden Humor, als ich Jones antworte. »Weil ich ebenfalls ein Kind verloren habe, Sir. Es ist ein Club, zu dem nur Mitglieder Zutritt haben.«
KAPITEL 2
Ich beobachte, wie der Wagen hinter dem Leichenschauhaus eintrifft. Er ist schwarz, wie nicht anders zu erwarten – die bevorzugte Farbe bei Regierungsfahrzeugen, ein beinahe tröstlicher Anblick in seiner Beständigkeit. Die hinteren Fenster sind dunkel getönt, sodass niemand von draußen hineinblicken kann.
Es ist halb fünf nachmittags, und die Dämmerung setzt allmählich ein in dieser Gegend von Virginia, die sich trotz ihrer Nähe zu Washington D. C. ihre eigene Identität bewahrt hat. Es ist hier stiller als in der Hauptstadt, und man fühlt sich irgendwie sicher, ob es nun wahr ist oder bloß Einbildung. Es ist eine Mischung aus Vorstadt und City, die eine Illusion von Komfort liefert. Wie so viele Städte im Osten hat sie ihr eigenes Gesicht, ihre ureigene Mischung aus Charakter und Geschichte.
Es ist Ende September, und ein solches Wetter wie hier habe ich an der Westküste noch nie erlebt. Die Luft ist beißend, eine Kälte, die einen Winter mit Schnee prophezeit. Keinen so schlimmen Winter wie beispielsweise in Buffalo, New York, aber auch keinen von diesen erbärmlichen kalifornischen Wintern.
Überall wachsen Bäume, junge und alte. Es sind so viele, dass unschwer zu erkennen ist, wie beliebt Bäume in dieser Stadt sind. Ich kann sogar den Grund dafür sehen. Der Herbst ist eine richtige, eine sichtbare Jahreszeit in Alexandria, Virginia. Eine Jahreszeit kräftiger, satter Farben. Die Blätter verfärben sich bunt – ein spektakulärer Anblick.
Der Wagen hält, die hintere Tür öffnet sich, und ich steige ein. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Grund meines Hierseins konzentriere.
Director Rathbun hat mir kurz und knapp das Wichtigste über Rosario Reid erzählt: »Sie ist achtundvierzig Jahre alt. Mit sechsundzwanzig bekam sie Dexter, ein Jahr, nachdem sie den Kongressabgeordneten geheiratet hatte. Die beiden kennen sich seit der Highschool, doch sie haben nach dem Collegeabschluss noch ein paar Jahre gewartet, bevor sie in den Stand der Ehe getreten sind.
Rosarios Urgroßvater kam aus Mexiko in die Vereinigten Staaten und errichtete ein kleines Rinder-Imperium in einer Zeit, als das für Mexikaner in Texas gar nicht einfach war. Der Mann scheint seinen Schneid vererbt zu haben: Mrs. Reid ist knallhart. Sie hat in Harvard Jura studiert und ist Anwältin, und sie geht ihren Gegnern gerne an die Kehle. Während Mr. Reid damit beschäftigt war, eine politische Karriere einzuschlagen, hat Mrs. Reid den Unterprivilegierten zu ihrem Recht verholfen. Sie hat eine ganze Reihe von aufsehenerregenden Fällen gewonnen, über die ich keine Einzelheiten weiß, außer dass mächtige Firmen regelmäßig den Kürzeren gezogen haben. Als Mr. Reid beschloss, für den Kongress zu kandidieren, brach seine Frau ihre Zelte als Anwältin ab und organisierte seinen Wahlkampf.« Rathbun schüttelte bewundernd den Kopf. »Wer sie in Washington kennt, hütet sich davor, sie wütend zu machen, Agentin Barrett. Sie ist eine der nettesten Frauen, die ich kenne, aber sie kann skrupellos zuschlagen, wenn man ihrem Mann in die Quere kommt.«
Ich finde das alles faszinierend, sogar bewundernswert. Doch Menschen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, neigen schnell dazu, sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben, wenn man sie lässt. Ich möchte selbst ein Gespür für Rosario Reid bekommen. Die Mutter zu verstehen wird mir helfen, das Kind zu verstehen. Ich muss herausfinden, ob und wie viel sie mir gegenüber lügt – und falls sie lügt, aus welchen Gründen. Aus Liebe zu ihrem Kind? Aus politischer Zweckdienlichkeit? Oder einfach so?
Mrs. Reid nickt mir zu, als ich die Wagentür von innen zuziehe. Sie klopft an die Trennscheibe und signalisiert dem Fahrer loszufahren; dann drückt sie auf einen Knopf, von dem ich annehme, dass er die Gegensprechanlage abschaltet. Der Wagen setzt sich in Bewegung, und wir nehmen uns einen Moment Zeit, um einander zu beschnuppern.
Rosario Reid ist unbestreitbar eine attraktive Frau. Sie besitzt die klassischen Züge einer Latino-Schönheit; sie wirkt sinnlich und kultiviert zugleich. Als Frau erkenne ich, dass sie Maßnahmen ergriffen hat, um diese Schönheit in Schranken zu halten. Ihre Haare sind kurz und streng geschnitten, und sie hat graue Strähnen, die nicht nachgetönt wurden. Kein Maskara hebt ihre Wimpern hervor. Ihr Sohn hat die vollen Lippen von ihr geerbt, doch sie hat Liner benutzt, um den Amorbogen ein wenig zu begradigen. Sie trägt eine schlichte weiße Bluse, eine marineblaue Jacke und dazu passende Hosen, alles perfekt maßgeschneidert und dazu angetan, ihre sinnliche Ausstrahlung zu dämpfen.
Diese oberflächlichen Attribute verraten mir eine Menge über ihre Loyalität gegenüber ihrem Ehemann. Rosario tut das Gegenteil von dem, was die meisten Frauen in ihrer Situation tun würden: Sie maskiert ihre angeborene Sinnlichkeit, und sie dämpft ihre Schönheit mit zurückhaltendem Professionalismus. Tweed anstatt Seide.
Warum? Damit sie für die weibliche Wählerschaft des Kongressabgeordneten akzeptabel ist. Mächtige Frauen dürfen attraktiv sein, doch niemals sinnlich oder gar sexy. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Selbst für mich. Ich vertraue einer Frau wie Rosario Reid in einer Machtposition mehr, als ich einer Frau vertrauen würde, die aussieht wie ein Model von Victoria’s Secret.
Überlegen Sie selbst.
Außerdem ist sie stark. Sie gibt sich äußerlich gefasst, doch die Intensität ihrer Trauer ist offensichtlich, als ich ihr in die Augen schaue. Sie weint nicht in der Öffentlichkeit. Trauer ist für diese Frau Privatsache – noch etwas, das wir neben unseren toten Kindern gemeinsam haben.
Sie bricht das Schweigen als Erste. »Danke, dass Sie gekommen sind, Agentin Barrett.« Ihre Stimme klingt gemessen und leise, weder zu hoch noch zu tief. »Ich weiß, dass dies eine ungewöhnliche Situation ist. Ich habe immer darauf geachtet, die politische Macht meiner Familie nicht für persönliche Dinge auszunutzen.« Sie zuckt die Schultern, und ihre Trauer verleiht der Geste eine schreckliche Eleganz. »Jetzt habe ich eine Ausnahme gemacht, weil mein Kind tot ist.«
»Ich würde an Ihrer Stelle das Gleiche tun, Mrs. Reid. Ich möchte Ihnen mein Mitgefühl aussprechen. Ich weiß, dass es sich wie ein Klischee anhört, und ich weiß, dass es unter diesen Umständen unangemessen sein mag, aber es tut mir wirklich leid. Dexter …« Ich unterbreche mich stirnrunzelnd und schaue sie an. »Ich bin mit solchen Dingen nicht vertraut, Ma’am. Soll ich ›er‹ oder ›sie‹ sagen? Soll ich von Dexter oder von Lisa sprechen?«
»Lisa wollte ihr Leben lang eine Frau sein. Also sollten wir sie auch so behandeln … jetzt, nachdem sie tot ist.«
»Ja, Ma’am.«
»Lassen wir die Förmlichkeit, wenn wir unter uns sind, einverstanden? Wir sind zwei Mütter zweier toter Kinder, Smoky. Weit und breit sind keine Männer mit ihrem Imponiergehabe und ihrer Wichtigtuerei.« Sie zögert, fixiert mich mit grimmigem Blick. »Wir müssen die Köpfe zusammenstecken und schmutzige Arbeit bewältigen, und das erfordert Vornamen und keine Floskeln, meinen Sie nicht auch?«
Wir Frauen sind es, die unsere Kinder begraben. Wir sind diejenigen, die den Saum unserer Kleider durch den Friedhofsdreck ziehen. Das will sie damit sagen.
»Okay, Rosario.«
»Gut.« Ich merke, wie sie meine Narben betrachtet. »Ich habe darüber gelesen, was Sie durchgemacht haben, Smoky. In den Zeitungen und Illustrierten. Ich muss gestehen, ich bewundere Sie seit Jahren.«
Ihr Blick ist fest, als sie diese Worte sagt. Sie zuckt nicht zurück vor den Narben in meinem Gesicht, keine Spur. Wenn sie Unbehagen in ihr wecken, versteckt sie es besser, als Director Rathbun es getan hat.
Ich nicke ihr zu, damit sie weiß, dass ich es zu schätzen weiß. »Danke. Aber es ist nichts Bewundernswertes daran, diejenige zu sein, die nicht getötet wurde.«
Sie runzelt die Stirn. »Das ist sehr hartherzig. Sie haben weitergemacht. Sie haben weiter diesen Job getan, der Sie derartigen Gefahren aussetzt. Und Sie machen Ihre Arbeit gut. Sie leben weiter in dem Haus, in dem das Schreckliche passiert ist – was ich im Übrigen gut verstehen kann. Ich bin sicher, vielen Leuten geht es anders, aber ich verstehe Sie.« Sie lächelt traurig. »Ihr Zuhause ist der Ort, wo Sie Ihre Wurzeln geschlagen haben. Wie ein Baum, den man nicht verrückt. Ihre Tochter wurde dort geboren, und diese Erinnerung ist mächtiger als all die schmerzlichen Dinge, die Sie dort erlebt haben, nicht wahr?«
»Ja«, gestehe ich leise.
Ich merke, wie diese Frau mich einnimmt. Ich mag sie. Sie ist ehrlich. Ihr Einfühlungsvermögen sagt viel über ihren Charakter aus. Sie ist eine Person, die weiß: Familie ist Zuhause, Familie ist das Dach, das vor der Welt schützt. Liebe mag der Leim sein, der alles zusammenhält, doch die Abfolge gemeinsamer Augenblicke ist die wahre Seele der Dinge.
Wir fahren mit gemächlicher Geschwindigkeit einen großen Kreis um das Leichenschauhaus herum. Ich merke, wie meine Blicke erneut von dem bunten Laub der Bäume angezogen werden. Es sieht aus, als würden sie brennen.
»Ich habe genau wie Sie den Mann geheiratet, den ich in der Schule geküsst habe«, sagt Rosario und blickt aus dem Fenster. »Haben Sie Bilder von meinem Dillon gesehen?«
»Ja. Er ist sehr attraktiv.«
»Das war er schon damals. Und so jung. Er war meine erste Liebe.« Sie wirft einen Seitenblick zu mir, zeigt ein leichtes Lächeln. Es lässt sie für einen Moment aussehen wie achtzehn – einen strahlenden, kurzen Moment lang. »Er war mein erster Mann in allem.«
Ich erwidere ihr Lächeln. »Wie Matt für mich.«
»Wir sind eine aussterbende Art, Smoky. Frauen, die ihre Highschool-Liebe heiraten, die ihre Liebhaber an den Fingern einer Hand abzählen können. Glauben Sie, dass wir besser dran sind? Oder schlechter?«
Ich zucke die Schultern. »Ich denke, Glück ist das Persönlichste, was es geben kann. Ich habe Matt nicht geheiratet, um Keuschheit oder Treue zu demonstrieren. Ich habe ihn geheiratet, weil ich ihn liebte. So einfach ist das.«
Etwas von dem, was ich soeben gesagt habe, lässt ihre Gefasstheit ein wenig ins Wanken geraten. Ihre Augen werden feucht, auch wenn keine Tränen fließen.
»Das haben Sie großartig ausgedrückt. Ja. Glück ist etwas Persönliches. Das traf mit Sicherheit auf meine Tochter zu.« Sie dreht sich im Sitz und sieht mich an. »Wussten Sie, dass es viel gefährlicher ist, transsexuell zu sein, als irgendeiner anderen diskriminierten Minderheit anzugehören? Die Wahrscheinlichkeit, dass eine transsexuelle Person einem Hassverbrechen zum Opfer fällt, ist viel größer als bei Schwulen, Muslimen, Juden oder Afroamerikanern.«
»Ja, das weiß ich.«
»Und die Transsexuellen wissen es ebenfalls, Smoky. Die Jungen und Männer, die zu Frauen werden, die Mädchen und Frauen, die zu Männern werden – sie wissen, dass man sie ausgrenzen und verunglimpfen wird, vielleicht schlagen, vielleicht sogar umbringen. Sie tun es trotzdem. Und wissen Sie warum?« Ihre Hände zittern, und sie verschränkt sie im Schoß. »Sie tun es, weil es für sie keine andere Möglichkeit gibt, glücklich zu werden.«
»Erzählen Sie mir von Lisa«, bitte ich sie.
Denn das ist es, was sie in Wirklichkeit möchte. Das ist der Grund für mein Hiersein. Sie will, dass ich Lisa sehe, dass ich Lisa kennenlerne. Sie will, dass ich verstehe, was sie verloren hat, dass ich es fühle.
Sie schließt für einen Moment die Augen. Als sie sie wieder öffnet, sehe ich die Liebe darin. Rosario Reid ist eine starke Frau, und sie hat ihr Kind mit all ihrer Kraft geliebt.
»Ich werde zuerst über Dexter sprechen, denn so kam er zur Welt – als Junge. Er war ein freundlicher, hübscher Junge. Ich weiß, alle Eltern denken, dass ihre Kinder übers Wasser wandeln können, doch Dexter hatte tatsächlich keinen einzigen bösen Wesenszug. Er war ein kleiner, zierlicher Junge, aber nicht schwach. Sanft, aber nicht naiv. Verstehen Sie?«
»Ja.«
»Ich nehme an, ›Muttersöhnchen‹ wäre das Stereotyp, um ihn zu beschreiben, und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Doch Dexter hat sich nie hinter meinem Rock versteckt. Er hat seine Zeit wie jeder andere Junge verbracht, draußen, an der frischen Luft, und er hat sich mehr als einmal Ärger eingefangen. Er hat in der Little League gespielt und fing mit zehn Jahren an, Gitarre zu lernen; er hatte die eine oder andere Prügelei mit anderen Jungs. Kein Grund zu der Annahme, dass er zu irgendetwas anderem als einem prächtigen jungen Mann heranwachsen könnte. Ich musste ihn nur ganz selten bei seinem vollen Namen rufen.«
Sie geht davon aus, dass ich weiß, wovon sie redet, und sie hat recht. Es ist die universelle Sprache aller Mütter. Jedes Kind weiß, dass es in Schwierigkeiten steckt, wenn Mom den Vor- und Nachnamen zusammen benutzt. In ernsten Schwierigkeiten. Volle Deckung, und immer hübsch kleinlaut.
Rosario blickt mich an. »Wie alt war Ihre Tochter, als sie starb?«
»Zehn.«
»Das ist ein wundervolles Alter. Die letzten zwei, drei Jahre, ehe sie anfangen, Geheimnisse vor der Mutter zu haben.« Sie seufzt, doch es ist mehr Melancholie als Trauer. »Ich dachte, ich würde Dexter in- und auswendig kennen, aber natürlich kennt keine Mutter ihren Sohn, sobald er in die Pubertät kommt. Sie fangen an, sich abzugrenzen. Entsetzt von der Vorstellung, die Mutter könnte erfahren, dass sie masturbieren und Frauen im Sinn haben – schließlich ist die Mutter eine Frau. Ich war darauf vorbereitet. So laufen die Dinge nun mal. Doch Dexters Geheimnisse waren ganz andere als das, was ich erwartet hatte.«
»Wie kam es heraus? Woran haben Sie erkannt, dass er ein Problem …« Ich unterbreche mich hastig. »Entschuldigung. Ist es falsch, es ein ›Problem‹ zu nennen?«
»Das kommt darauf an. Für diejenigen, die sich der Vorstellung widersetzen, dass es transsexuelle Menschen gibt, ist es die Veränderung an sich, die das Problem darstellt. Für die Transsexuellen besteht das Problem darin, dass ihr Körper und ihre innere sexuelle Identität nicht übereinstimmen. Wie dem auch sei – ich würde sagen, ›Problem‹ ist angemessen. Um Ihre Frage zu beantworten: Dexter hat sich als Knabe wahrscheinlich sehr lange unwohl in seiner Haut gefühlt. Er fing an zu … zu experimentieren, als er gerade vierzehn war.«
»Experimentieren? Inwiefern?«
Ihre Hände zittern wieder, suchen einander und finden sich im Schoß. Sie schweigt sekundenlang, und ich sehe, dass sie einen inneren Kampf austrägt.
»Es tut mir leid«, sagt sie schließlich. »Es ist nur, dass … Dexters Persönlichkeit, die Dinge, die ich so sehr an ihm geliebt habe, waren so unübersehbar in der Art und Weise, wie er seine ersten Ausflüge zur Erkundung seiner sexuellen Identität unternahm. Es waren BHs und Höschen, verstehen Sie?«
»Er hat Büstenhalter und Höschen getragen?«
»Ja. Ich fand sie eines Nachmittags ganz unten in der Schublade, in der seine Unterwäsche lag. Vergraben und versteckt. Zuerst dachte ich, es sei meine Wäsche, aber so war es nicht, verstehen Sie? Das meine ich damit, wenn ich von seiner Persönlichkeit spreche. Wir haben Dexter Taschengeld gegeben, natürlich, und er hat in der Nachbarschaft ein paar Jobs übernommen, Rasen gemäht und so weiter. Er hatte sein eigenes Geld, mit dem er sich seine eigene Unterwäsche gekauft hat. Verstehen Sie? Er war vierzehn, und er war voller Zweifel wegen dem, was mit ihm geschah. Ich weiß aus späteren Gesprächen, dass er sich schuldig fühlte, schmutzig. Doch er war auch überzeugt, dass es nicht richtig wäre, die Sachen von mir zu stehlen, sondern dass es nur eine ehrenhafte Möglichkeit gäbe, nämlich sein eigenes Geld zu nehmen und sich die Sachen selbst zu kaufen. Es war ihm unendlich peinlich, hat er mir später erzählt, doch er konnte ausgesprochen stur sein, wenn es um Richtig oder Falsch ging.«
Ich kann es mir vorstellen. Ein junger, zierlicher Knabe, der mit brennenden Wangen ein Höschen und einen BH kauft, weil es nicht richtig wäre, sie von seiner Mutter zu stehlen.
Ich stelle mir vor, wie ich selbst mit vierzehn war. Wäre ich so aufrecht gewesen an seiner Stelle? Hätte ich den Mumm gehabt, mich in eine so peinliche Lage zu begeben?
Verdammt, nein. Mom hätte eine Garnitur Unterwäsche verloren.
»Ich verstehe«, sage ich zu Rosario. »Was ist danach passiert?«
Sie verzieht das Gesicht. »O Gott. Drei furchtbare Jahre, das ist passiert. Wissen Sie, ich stamme aus einer mexikanischamerikanischen Familie. Katholisch und erzkonservativ. Auf der anderen Seite war ich Anwältin und an Gesetze und Strukturen gewöhnt – und daran, Geheimnisse zu bewahren. Und das tat ich denn auch. Die Sache blieb zwischen Dexter und mir.«
»Verständlich.«
»Ja. Es dauerte eine Weile, bis ich es aus ihm herausgeholt hatte, und um fair zu sein, Dexter war ziemlich konfus deswegen. Er wusste selbst nicht so recht, was mit ihm geschah. Er erzählte mir, dass er sich manchmal ›seltsam‹ fühle, zum Beispiel, wenn er in den Spiegel schaue und einen weiblichen Körper zu sehen erwarte, keinen männlichen. Ich war zutiefst schockiert. Ich schnappte mir die Unterwäsche und schickte ihn postwendend zu einem Psychologen.«
»Aber die Dinge nahmen ihren Gang.«
»Der Psychologe meinte, Dexter hätte eine Geschlechts-Dysphorie, auch bekannt als gestörte Geschlechtsidentität. Hochtrabende Worte, die nichts anderes aussagten, als dass Dexter sich stark mit dem anderen Geschlecht identifizierte.«
»Ich bin mit diesem Thema vertraut. Es kann von einer leichten Obsession bis hin zu der Gewissheit reichen, dass das Individuum im falschen Körper gefangen ist und eigentlich dem anderen Geschlecht angehört.«
»Ganz recht. Der Psychologe hat Dexter ›behandelt‹. Er wollte Psychopharmaka als Bestandteil seiner Therapie einsetzen, doch ich untersagte es. Dexter war ein kluger, aufmerksamer, freundlicher Junge, ein Einserschüler, der nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war – warum um alles in der Welt sollte ich zulassen, dass man ihn unter Drogen setzte?« Sie winkt ab. »Es war alles umsonst. Die Behandlung bestand mehr oder weniger darin, seinen Zustand zu benennen und mit ihm daran zu arbeiten, ›gegen den Zwang anzukämpfen‹. Aber es hat nichts verändert.«
»Wann hat er beschlossen, den Weg der sexuellen Umwandlung einzuschlagen?«
»Oh, das hat er mir erzählt, als er neunzehn war. Ich glaube allerdings, er hatte den Entschluss bereits früher gefasst. Er hatte bis dahin lediglich herauszufinden versucht, wie er es bewerkstelligen konnte, ohne dass es seinen Vater und seine Mutter allzu sehr schmerzte. Nicht, dass wir es ihm leicht gemacht hätten, trotz allem.« Sie schüttelt den Kopf. »Dillon ging an die Decke. Wir hatten es ihm viele Jahre vorenthalten, und er liebte das Spiel der Politik so sehr. Unsere Enthüllung traf ihn völlig unvorbereitet.«
»Wie kam Dexter damit zurecht?«
Sie lächelt. »Er blieb ruhig. Ruhig und gefasst und voll innerlicher Gewissheit.« Sie zuckte die Schultern. »Er hatte einen Entschluss gefasst, und er würde ihn durchsetzen. Die Stärke seines Vaters.«
Und deine, Rosario.
»Sprechen Sie weiter.«
»Er sagte, ihm wäre klar, dass diese Sache ein Problem für uns wäre, besonders für seinen Vater. Sein Lösungsvorschlag lautete, dass wir ihn öffentlich enterben sollten. Er sagte, es sei ihm wichtig, dass seine Entscheidung uns so wenig wie möglich beeinträchtigt. Können Sie sich das vorstellen?« Ihre Stimme ist voller Trauer und Erstaunen. »Ich erinnere mich noch genau, wie er gesagt hat: ›Dad, was du tust, ist wertvoll. Du hilfst vielen Menschen. Ich möchte nicht, dass du diese Arbeit wegen mir aufgeben musst. Aber ich werde das auch nicht für dich aufgeben. Das ist der beste Kompromiss.‹ Ich denke, das ist dann schließlich zu Dillon durchgedrungen … dass sein Sohn bereit war, sich öffentlich kasteien zu lassen, damit sein Vater in der Politik bleiben konnte. Ich sage nicht, dass es so glatt gelaufen ist, wie es sich jetzt vielleicht anhört, aber …«
»Dexter kam durch.«
»Ja.« Sie schaut mich an, und ich sehe nichts als tiefen Schmerz, durchsetzt mit Bedauern und vielleicht ein wenig Selbstvorwürfen. »Die Einzelheiten sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir als gute politische Familie, die wir geworden waren, genau das taten, was Dexter vorgeschlagen hatte. Wir errichteten einen Treuhandfonds, und Dexter zog aus. Als er dann tatsächlich als Frau zu leben anfing … wissen Sie Bescheid über diesen Teil des Prozesses?«
»Ja. Man muss ein Jahr als Mann oder Frau gelebt haben, bevor man eine Genehmigung zur Geschlechtsumwandlung erhält.«
»Genau. Es gibt keine chirurgischen Eingriffe, ehe man nicht das ganze Jahr überstanden hat. Für Dexter bedeutete das, als Frau gekleidet zur Arbeit zu gehen, als Frau auszugehen und so weiter. Die Wartezeit von einem Jahr soll dafür sorgen, dass man erkennt, ob man sich absolut sicher ist.«
»Das ergibt Sinn.«
»So sehe ich das auch. Und Dexter dachte ebenfalls so. Wie dem auch sei, als dieses Jahr begann, gaben wir unser perfekt formuliertes Statement ab. Dass wir unseren Sohn immer noch liebten, aber nicht mit seiner Entscheidung einverstanden wären. Es war ein Meisterstück der Täuschung.« Sie stockt, während sie nach Worten sucht. »Sie kommen nicht aus dem Süden, Smoky, oder? Darum können Sie wahrscheinlich auch nicht verstehen, wie groß die Unterschiede sind. Verstehen Sie mich nicht falsch – es gibt genügend liberale Intellektuelle in Texas, aber ich würde nicht gerade sagen, dass sie die Mehrheit bilden.«
»Verstehe.«
Rosario schüttelt den Kopf. »Nein. Sie haben eine Vorstellung, vielleicht ein Klischee. Aber Sie können nicht begreifen, wie es wirklich ist, wenn Sie nicht dort aufgewachsen sind. Sie stellen sich wahrscheinlich Tabak kauende Hinterwäldler mit Gewehrhalterungen in ihren Trucks vor. Die gibt es bei uns auch, zugegeben, aber das zutreffendere Bild ist das eines gebildeten, sehr intelligenten, sympathischen Individuums, das ohne mit der Wimper zu zucken predigt, dass Homosexualität eine Abscheulichkeit sondergleichen ist. Diese Person hat in der Regel einen Freund, eine Freundin, irgendjemanden, mit dem sie zusammen aufgewachsen ist – und dieser Jemand ist der Meinung, Schwule sollten mehr Rechte haben. Die beiden können trotz dieses trennenden Grabens Freunde sein, sehr gute Freunde sogar.« Sie hebt eine Augenbraue. »Aber wenn der liberale Freund der Schwule wäre? Oh nein. Und Transsexuelle? Ach du meine Güte! Missgeburten, Launen der Natur, vielleicht für beide Freunde in meinem Beispiel. Wir haben große Fortschritte gemacht im Süden, und ich liebe das Land. Es ist meine Heimat. Aber der Süden ist auch ein Gewohnheitstier, das sich großen Veränderungen mit aller Kraft widersetzt.«
»So langsam verstehe ich.«
»Dennoch kam Dexter, wie ich bereits sagte, immer noch an Weihnachten nach Hause«, fährt Rosario fort. »Allerdings stets heimlich.« Sie stockt. »Furchtbar, nicht wahr? Dass wir unser Kind wegen unseres politischen Ehrgeizes aufgegeben haben.«
Ich denke über ihre Worte nach. Diese Frau verdient eine ehrliche Antwort und keine abgedroschene, leere Floskel.
»Ich finde«, sage ich vorsichtig, »dass alles andere Dexter verletzt hätte. Er war überzeugt, das tun zu müssen, was er tat, doch er machte sich auch Sorgen, dass es die politische Karriere Ihres Mannes beeinträchtigen könnte. Ich meine, er hat ›öffentlich enterben‹ gesagt. Anscheinend hat er nicht erwartet, dass einer von Ihnen beiden ihn tatsächlich enterben würde, oder?«
Sie sieht mich verblüfft an. »Nein. Nein, ich glaube nicht.«
»Dann war er sicher, dass Sie und Ihr Mann ihn liebten. Ich sage nicht, dass es alles entschuldigt, doch es ist sehr viel mehr als nichts, Rosario.«
Trauer ist manchmal einfach, manchmal komplex. Sie umfasst Selbstzweifel, Unsicherheit, Was-wäre-wenn, Wenn-doch-nur. Sie ähnelt Bedauern, doch sie ist viel stärker als Bedauern. Sie kann in einem einzigen Augenblick verschwinden oder bis zum Tod anhalten. Ich sehe dies alles in Rosarios Gesicht, und ich bin froh darüber, denn es bedeutet, dass ich ihr etwas Wahres sagen konnte. Lügen schmerzen, die Wahrheit jedoch bewegt uns.
Rosario braucht einen Moment, bis sie sich wieder unter Kontrolle hat. Immer noch keine Tränen.
»Also schön. Unser Kind hat dieses Jahr überstanden, und das war das Ende von Dexter. Ein Sohn starb, und eine Tochter wurde geboren. Noch dazu eine schöne Tochter. Lisa erblühte, sowohl innerlich als auch nach außen hin. Sie war schon immer ein glückliches Kind gewesen, doch nun schien sie zu strahlen. Sie war … zufrieden. Und Zufriedenheit lässt sich nur schwer erreichen, Smoky.«
Mir fällt auf, wie leicht sie über die Geschlechtsumwandlung hinweggeht, wie locker ihr »Lisa« und »sie« über die Lippen kommen. Dexter wurde zu Lisa – nicht nur für sich selbst, auch für seine Mutter.
»Wie hat Ihr Mann sich verhalten?«
»Er hat sich nie recht wohlgefühlt mit der Vorstellung. Doch ich will nicht das Bild eines klischeebehafteten Intoleranten von ihm malen. Dillon liebte Dexter und gab sich alle Mühe, auch Lisa zu lieben. Er hielt es für sein eigenes Versagen, wenn es ihm nicht gelänge, nicht für ein Versagen Lisas.«
»Lisa hat das ebenfalls gesehen, nehme ich an.«
Rosario nickt und lächelt. »Sie hat es gesehen. Sie war … glücklich. Die Hormone schlugen sehr gut an, und sie traf eine kluge Entscheidung, was ihre Brustoperation anging. Sie entschied sich für Implantate, die zu ihrer Figur passten, nicht zu groß und nicht zu klein. Sie gewöhnte sich an Make-up wie ein Fisch ans Wasser, sie bewegte sich ohne sichtliche Anstrengung wie eine Frau, und sie hatte einen guten Geschmack. Selbst der Stimmunterricht, für manche das Schwierigste überhaupt, hat ihr keine Probleme bereitet.«
Männer haben tiefere Stimmen, weil ihre Stimmbänder während der Pubertät länger werden. Diese Verlängerung ist nicht reversibel, und sie erfordert, dass Männer, die sich in Frauen verwandeln wollen, lernen müssen, mit höherer Stimme zu reden.
»Hatte sie vor … wollte sie bis zur letzten Konsequenz gehen?«
Nicht alle Transsexuellen entscheiden sich für eine Operation ihrer Genitalien.
»Sie hatte sich noch nicht entschieden.«
»Warum war Lisa in Texas?«, frage ich. »Soweit ich informiert bin, lebte sie hier, in Virginia. War Sie bei Ihnen zu Besuch?«
»Sie kam zur Beerdigung ihrer Großmutter nach Texas«, sagt Rosario. »Dillons Mutter.«
»Waren Sie und der Kongressabgeordnete auf dieser Beerdigung?«
»Ja. Es war eine kleine, private Beisetzung, ohne Pressevertreter und Fernsehteams. Zum Glück befinden wir uns nicht in einem Wahlkampf. Wir feierten den Gottesdienst, und Lisa flog am nächsten Tag nach Hause. Sie hätte morgen eigentlich wieder arbeiten müssen.«
»Was hat sie beruflich gemacht?«
»Sie hatte ein eigenes Reisebüro. Einen Einmannbetrieb, aber die Geschäfte liefen gut. Lisa hatte eine profitable Nische gefunden. Urlaub speziell für Schwule, Lesben und Transsexuelle.«
»Wissen Sie, ob Lisa Feinde hatte? Hat sie erwähnt, dass sie von jemandem belästigt wird?«
»Nein. Ich will die Frage nicht einfach abtun, Smoky – es war das Erste, woran ich gedacht habe –, aber mir ist nichts dergleichen aufgefallen.«
Vielleicht wärst du überrascht, geht es mir durch den Kopf, doch ich sage nichts.
All diese nächtlichen Geheimnisse, die großen wie die kleinen, die anklopfen, wenn der Mond hinter einer Wolke verschwindet – auch Kinder haben sie schon, und die Eltern sind üblicherweise die Letzten, die davon erfahren.
»Was ist mit Ihnen oder Ihrem Mann? Ich nehme an, Sie beide haben Feinde – jeder Prominente hat Feinde. Aber gibt es etwas Besonderes, das erst kurze Zeit zurückliegt?«
»Etwas Besonderes? Ich wünschte, ich könnte diese Frage bejahen. Nun ja … Dillon bekommt hin und wieder verrückte Briefe. Ich lese sie alle, ehe ich sie an den Secret Service weiterleite. Der letzte Brief dieser Art kam vor sechs oder sieben Monaten. Irgendein Irrer drohte Dillon, ihn allein mittels der Kraft seiner Gedanken umzubringen. Aber im Moment gehen wir gerichtlich nicht gegen so etwas vor. Ehrlich gesagt, tun wir das kaum einmal. Deshalb konnte Dillon ja für die Demokraten einen Sitz im Kongress erringen – weil er diese Art von Konfrontation vermied.«
Ich überlege, was ich sie sonst noch fragen könnte, doch mir will im Moment nichts einfallen.
Meine nächsten Worte lege ich mir sorgfältig zurecht. »Rosario, ich möchte, dass Sie eines wissen: Ich werde alles tun, um denjenigen zu finden, der für Lisas Tod verantwortlich ist. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich ihn schnappe – ich habe vor langer Zeit gelernt, in dieser Hinsicht niemals Versprechungen zu machen –, aber mein Team und ich sind sehr, sehr gut. Wir brauchen Freiheiten, um unsere Arbeit zu tun. Ich bin bereit, gewisse Zugeständnisse zu machen, was politische Dinge angeht, doch letzten Endes arbeite ich weder für Sie noch für Ihren Mann, sondern für Lisa.«
»Lisa ist alles, was zählt.«
»Ich will nicht gefühllos erscheinen. Ich will lediglich sicher sein, dass ich meine Prioritäten deutlich gemacht habe.«
»Das haben Sie, und es klingt sehr vernünftig, Smoky.« Sie greift in ihre Jackentasche und reicht mir ein gefaltetes Blatt Papier. »Das sind meine sämtlichen Nummern. Sie können sich zu jeder Tages- und Nachtzeit bei mir melden, selbst wenn es um die kleinste Kleinigkeit geht.«
Ich nehme das Blatt entgegen. Sie klopft ein weiteres Mal gegen die Trennwand, das Signal, uns zum Leichenschauhaus zurückzubringen. Die Sonne geht unter, und der blutrote Himmel vermischt sich mit den feuerroten, brennenden Herbstbäumen.
Der Winter kommt. Der Winter ist immer noch hier. Wie der Tod.
»Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Smoky?«
»Sie können mir jede Frage stellen, die Ihnen auf dem Herzen liegt, Rosario.«
Sie schaut mich an, und endlich sehe ich ihre Tränen. Keine stille Trauer, keine schrille Hysterie, nur ein nasser Strom aus dem Augenwinkel.
»Sind Sie je darüber hinweggekommen?«
Diese Frau verdient die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit, also sage ich sie ihr.
»Niemals.«
KAPITEL 3
»Callie, Alan und James sind auf dem Weg hierher«, berichtet mir AD Jones. »Sie müssten in wenigen Stunden eintreffen.«
Wir sind draußen vor dem Autopsieraum und beobachten durch eine Glasscheibe, wie der Gerichtsmediziner den Leichnam von Lisa Reid öffnet, um uns bei der Suche nach dem Killer zu helfen. Es ist die letzte, die endgültige Entweihung. Eine Autopsie ist ein seelenloses Geschäft, die Reduktion eines menschlichen Wesens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Fleisch.
Inzwischen ist es nach neunzehn Uhr, und allmählich spüre ich die Trennung von zu Hause.
»Ziemlich eigenartig, hier zu sein«, bemerke ich.
»Ja«, pflichtet AD Jones mir bei und schweigt einen Moment. »Meine zweite Frau und ich haben vor ein paar Jahren einmal darüber gesprochen, hierher zu ziehen.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Hier gibt es noch richtige Jahreszeiten. Weiße Weihnachten, eine erwachende Natur im Frühling, und den Herbst … Sie haben ja die Bäume gesehen …« Er zuckt die Schultern. »Ich hatte nichts dagegen. Dann ging die Ehe den Bach hinunter, und ich hab’s offenbar vergessen.«
Er verstummt wieder. Das ist die Geschichte unserer Beziehung. In unerwarteten Augenblicken gibt Jones kleine Happen persönlicher Informationen preis. Häufig sind es bittersüße Erinnerungen, so wie jetzt. Er hat eine Frau geliebt, und sie haben darüber gesprochen, in eine Stadt zu ziehen, wo sie im Herbst das Laub zusammenharken und im Winter Schneemänner bauen können. Und jetzt ist er wegen einer Leiche hier. Träume entwickeln sich – aber nicht unbedingt zum Besseren.
»Dr. Johnston ist ein merkwürdiger Typ«, sage ich leise und wechsle das Thema.
»Ja.«
Dr. Johnston, der Gerichtsmediziner, ist Mitte vierzig und ein Riese. Kein Fett, sondern Muskeln. Seinen Bizeps könnte ich nicht mal mit beiden Händen umfassen. Seine Oberschenkel sind so dick, dass er seine Hosen wahrscheinlich maßschneidern lassen muss. Sein Haar ist wasserstoffblond und kurz geschoren. Sein Gesicht ist grobschlächtig und wirkt brutal. Seine große Nase ist mehrmals gebrochen und schief, und auf seiner Stirn pulst eine Ader wie ein lebendiges Metronom, ein faszinierender Anblick. Er könnte professioneller Bodybuilder sein oder ein Hufeisenverbieger vom Jahrmarkt.