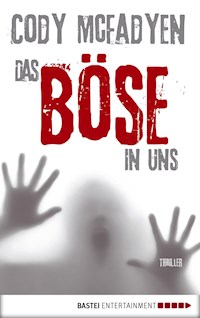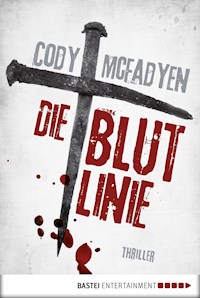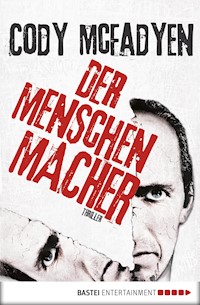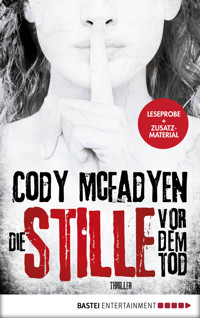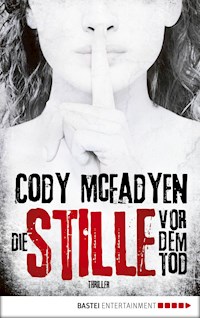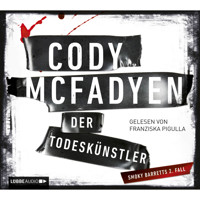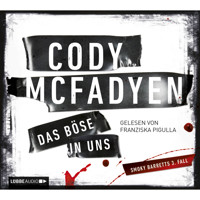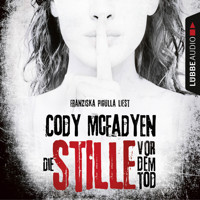9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Smoky Barrett
- Sprache: Deutsch
Das Grauen ist hier...
Smoky Barrett riecht den Tod, als sie die Tür öffnet. Der Boden und die Wände sind mit Blut getränkt. Auf dem Bett liegen zwei tote Körper - geschändet, entstellt, ausgeweidet. Neben ihnen kauert ein Mädchen. Der Todeskünstler hat sie besucht. Seit Jahren zerstört er ihr Leben, tötet jeden, der ihr lieb ist. Er will sie in den Wahnsinn treiben und nach seinem Bild neu erschaffen. Er wird wieder zu ihr kommen ...
Der zweite Teil der Reihe um FBI-Agentin Smoky Barrett - garantiertes Lesevergnügen für hartgesottene Psychothriller-Fans!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Danksagung
Teil 1 – Unten am Wasserloch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Sarahs Geschichte – Erster Teil
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Sarahs Geschichte – Zweiter Teil
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Teil 2 – Männer, die Kinder fressen
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Sarahs Geschichte – Dritter Teil
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Sarahs Geschichte – Vierter Teil
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Sarahs Geschichte – Das wahre Ende
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Am Ende – Die Dinge, die leuchten
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Fallakte Smoky Barrett
Cody Mcfadyen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»The Face of Death«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Cody Mcfadyen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2007 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Wolfgang Neuhaus und Jan Wielpütz
Titelillustration: Dewayne Flowers/shutterstock
Umschlaggestaltung: Rolf Hörner
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0320-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Brieanna, meine »Kleine B«
Danksagung
Mein Dank geht an Liza und Havis Dawson für die wie immer großartige Unterstützung, für Ratschläge und Ermunterungen. Dank auch an Danielle Perez und Nick Sayers, meine Lektoren bei Bantam und Hodder – es war ein schwieriges Buch, und sie wollten es erst als fertig betrachten, als es tatsächlich fertig war. Dank auch Chandler Crawford für ihre Repräsentation im Ausland. Und Dank an meine Familie und Freunde, dass sie mich ertragen haben, als ich an diesem Roman schrieb. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Schriftstellern ist, aber ich bin manchmal ungenießbar, wenn mir das Schreiben nicht glatt von der Hand geht.
KAPITEL 1
Ich träume vom Angesicht des Todes. Es ist ein Gesicht, das sich ständig verändert und das irgendwann jeder tragen wird, das viele aber zur falschen Zeit tragen. Ich habe in dieses Gesicht geblickt, immer wieder.
Das ist dein Job, Idiotin.
Sagt eine Stimme in meinem Traum.
Die Stimme hat recht. Ich bin Agentin beim FBI Los Angeles und verantwortlich für die Jagd auf den Abschaum des Abschaums. Kindesmörder, Serienkiller, Männer (und manchmal Frauen) ohne jedes Gewissen, ohne Skrupel, ohne Erbarmen. Das ist seit mehr als einem Jahrzehnt mein Job, und wenn ich den Tod auch noch nicht in all seinen Verkleidungen gesehen habe, so doch in den meisten. Der Tod ist stets gegenwärtig, und er ist gefräßig. Er frisst die Seele auf.
Heute Nacht ändert sich das Gesicht des Todes wie ein Stroboskoplicht im Nebel, wandert umher zwischen drei Menschen, die ich einst gekannt habe. Ehemann, Tochter und Freundin. Matt, Alexa und Annie.
Tot, tot und tot.
Ich finde mich vor einem Spiegel ohne Spiegelbild. Der Spiegel lacht mich aus. Er iaht wie ein Esel, muht wie eine Kuh. Ich schlage mit der Faust zu, und der Spiegel zerspringt. Ein roter Fleck erblüht auf meiner Wange wie eine Rose. Der Fleck ist wunderbar, ich kann ihn fühlen.
Mein Spiegelbild erscheint in den Scherben.
Die Stimme meldet sich wieder: Auch zerbrochene Dinge spiegeln das Licht.
Ich erwache aus meinem Traum, indem ich die Augen aufschlage. Es ist eigenartig – vom tiefsten Schlaf in helles Wachsein binnen eines Wimpernschlags.
Wenigstens erwache ich nicht mehr schreiend.
Ich drehe mich auf die Seite, um Bonnie anzuschauen. Ich bewege mich ganz vorsichtig, damit das Bett nicht knarzt. Ich sehe, dass Bonnie bereits wach ist und mir in die Augen starrt.
»Hab ich dich geweckt, Schatz?«, frage ich.
Sie schüttelt den Kopf. Nein.
Es ist spät, und es ist einer dieser Augenblicke, wo der Schlaf noch lockt. Wenn Bonnie und ich es zulassen, zieht er uns wieder hinunter in sein Reich. Ich breite die Arme aus, und meine Adoptivtochter kuschelt sich hinein. Ich halte sie fest, aber nicht zu fest. Ich rieche den Duft ihres Haares, und die Dunkelheit umfängt uns wie das Flüstern des Windes.
Als ich erwache, fühle ich mich großartig und so ausgeruht wie lange nicht mehr. Ich fühle mich im Gleichgewicht, friedlich. Es gibt nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste – und das ist eigenartig, denn Sorgen sind mein Phantomgliedmaß. Es ist, als wäre ich in einer Blase, oder im Mutterleib. Ich lasse mich treiben, eine Zeit lang wenigstens, und lausche auf mein eigenes weißes Rauschen.
Es ist Samstagmorgen, nicht nur vom Wochentag her, sondern als Seinszustand. Ich schaue dorthin, wo Bonnie sein sollte, und entdecke nur zerknitterte Laken. Ich spitze die Ohren, höre Bonnies leises Tappen: zehn Jahre alte Füße, die sich durchs Haus bewegen. Eine zehnjährige Tochter zu haben kann sich anfühlen, als würde man mit einer Fee zusammenleben. Magisch.
Ich recke mich, und es fühlt sich großartig an, katzenhaft. Nur eine Sache fehlt, um diesen Morgen perfekt zu machen. Während dieser Gedanke mir noch durch den Kopf geht, kitzelt es in meiner Nase.
Kaffee.
Ich schwinge mich aus dem Bett und steige die Treppe hinunter zur Küche, in meinem alten T-Shirt, einem meiner »Großmutter-Schlüpfer«, wie ich sie nenne, und albernen Plüschpantoffeln, die wie kleine Elefanten aussehen. Mein Haar ist wirr, als käme ich geradewegs aus einem Hurrikan. Nichts von alledem spielt eine Rolle, weil Samstag ist, denn da ist außer uns Mädchen niemand im Haus.
Bonnie empfängt mich am Fuß der Treppe mit einem Becher heißen Kaffees.
»Danke, Zwerg.« Ich trinke einen Schluck. »Hmmm, lecker.« Der Kaffee ist perfekt.
Ich setze mich an den Küchentisch. Bonnie trinkt ein Glas Milch, und wir sehen uns an. Es ist ein sehr behagliches Schweigen. Ich lächle Bonnie an.
»Ein super Morgen, nicht?«
Sie lächelt zurück, und dieses Lächeln raubt mir einmal mehr das Herz. Sie nickt.
Bonnie spricht nicht. Ihre Stummheit ist kein körperlicher Defekt, sondern rührt daher, dass ihre Mutter ermordet wurde, wobei Bonnie zuschauen musste. Anschließend hat der Killer sie Gesicht zu Gesicht an den Leichnam ihrer Mutter gefesselt. Drei Tage hat Bonnie so gelegen. Seither hat sie kein Wort mehr gesprochen.
Annie, Bonnies Mutter, war meine beste Freundin. Der Killer hatte sie zerfleischt, um mir weh zu tun. Manchmal ist mir bewusst, dass Annie sterben musste, weil sie meine Freundin war. Doch meist verdränge ich dieses Wissen, weil es eine Last ist, die ich nicht tragen kann, und weil es schrecklich ist und düster – ein Schatten so groß wie ein Wal. Würde ich diese Wahrheit zu oft sehen, würde sie mich kaputt machen.
Einmal, ich war vielleicht sechs Jahre alt, war ich wütend auf meine Mutter. Warum, weiß ich nicht mehr, aber ich hatte damals ein Kätzchen, das ich »Mr. Mittens« getauft hatte. Es kam zu mir, weil es spürte, dass ich wütend war. Tiere spüren so etwas. Das Kätzchen kam aus bedingungsloser Liebe zu mir – und ich versetzte ihm einen Tritt.
Es war nicht verletzt, nicht einmal vorübergehend. Doch von diesem Tag an war es kein Kätzchen mehr. Es zuckte jedes Mal zusammen, wenn ich es streicheln wollte. Ich habe bis zum heutigen Tag Schuldgefühle, wenn ich an Mr. Mittens denke. Es ist nicht bloß ein Stich des schlechten Gewissens, sondern ein scheußliches Gefühl, das einem die Seele verkrüppeln kann. Was ich dem Kätzchen angetan hatte, war aus reiner Bösartigkeit geschehen. Ich habe einem unschuldigen, zärtlichen Wesen Schmerz zugefügt. Ich habe nie jemandem erzählt, was ich Mr. Mittens angetan habe. Es ist ein Geheimnis, das ich mit ins Grab nehmen werde. Eine Sünde, für die ich lieber in der Hölle schmoren würde, als sie zu beichten.
Der Gedanke an meine ermordete Freundin Annie erweckt in mir ein Gefühl, als hätte ich Mr. Mittens totgetreten. Deswegen fühle ich mich besser, wenn ich nicht daran denke, die meiste Zeit jedenfalls.
Annie hat mir Bonnie zurückgelassen. Sie ist meine Buße. Aber es ist nicht fair, denn Bonnie ist ein Zauber, ein Wunder. Sie ist Licht, Heiterkeit und Freude. Buße aber sollte Leiden bedeuten.
»Was hältst du davon, ein paar Stunden herumzuhängen und gar nichts zu tun? Und anschließend gehen wir Shoppen.«
Bonnie überlegt kurz. Das ist eine ihrer Charaktereigenschaften. Sie antwortet selten spontan. Meist denkt sie zuerst nach und achtet darauf, dass sie die Wahrheit sagt, wenn sie antwortet. Ich weiß nicht, ob das eine Folgererscheinung ihrer unvorstellbar grauenhaften Erlebnisse ist, oder ob sie bereits mit diesem Tick geboren wurde.
Sie lässt mich ihre Entscheidung mit einem Lächeln und einem Nicken wissen. Ja.
»Cool. Möchtest du jetzt frühstücken?«
Diesmal muss sie nicht überlegen. Ja! Die Zustimmung ist augenblicklich und begeistert.
Ich mache mich in der Küche an die Arbeit, brate Schinken, Spiegeleier, mache Toast. Während wir essen, beschließe ich, mit Bonnie über die kommende Woche zu reden.
»Ich habe dir schon erzählt, dass ich mir zwei Wochen frei genommen habe, nicht wahr?«
Sie nickt.
»Ich habe es aus verschiedenen Gründen getan, aus einem ganz besonders. Ich wollte mit dir darüber sprechen, weil … na ja, weil es eine gute Sache ist, aber es könnte ein bisschen hart werden. Für mich, weißt du.«
Bonnie beugt sich vor, beobachtet mich geduldig mit fragendem Blick.
Ich trinke einen Schluck Kaffee. »Weißt du, Bonnie, es ist Zeit, ein paar Dinge wegzutun … Matts Sachen, seine Badezimmersachen. Ein paar von Alexas Spielsachen. Nicht die Fotos oder so. Ich will nicht die Erinnerung auslöschen. Es ist nur …«, ich suche nach Worten, »… es ist nur so, dass sie nicht mehr hier wohnen.«
Kurz und bündig. Ein einzelner Satz. Angefüllt mit all der Bedeutung und dem Wissen, der Angst und der Liebe, der Hoffnung und Verzweiflung der Welt. Ausgesprochen nach der Durchquerung einer Wüste aus Dunkelheit.
Die gegenwärtige Inkarnation meines Jobs beim FBI nennt sich NCVAC-koordinatorin. Das NCVAC ist das Bundesamt für die Analyse von Gewaltverbrechen. Die Zentrale des NCVAC ist in Washington, D.C., doch in jedem FBI-Büro gibt es einen lokalen Repräsentanten des NCVAC. In ruhigeren Gegenden ist ein Agent für mehrere Gebiete verantwortlich. Doch wir in L.A. sind etwas Besonderes. In unserer Stadt laufen die schlimmsten Psychopathen herum – noch dazu so viele, dass es eine Koordinatorin wie mich plus ein Team aus mehreren Agenten braucht.
Ich bin tüchtig in meinem Job – keine falsche Bescheidenheit. Ich führe ein Team von drei Leuten, alle von mir persönlich handverlesen, alle versierte Profis in der Verbrechensbekämpfung. Ich könnte jetzt bescheiden sein, aber warum sollte ich? Die Psychos, die von meinem Team gejagt werden, können sich ebenso gut gleich erschießen.
Vor einem Jahr haben wir einen Mann namens Joseph Sands gejagt. Ein netter Bursche, den die Nachbarn mochten, ein liebender Vater von zwei Kindern, der dem Hobby frönte, Menschen zu schlachten. Das hat ihm richtig Spaß gemacht. Die jungen Frauen, die er gefoltert und ermordet hat, haben das sicher ein bisschen anders gesehen.
Wir waren diesem Irren so dicht auf den Fersen, dass er schon unseren Atem im Nacken gespürt haben muss, als er meine Welt zum Einsturz brachte. Eines Nachts verschaffte er sich Zugang in mein Haus, und mit nichts weiter als einem Seil und einem Jagdmesser ließ er das leuchtende Universum, wie ich es kannte, in ewiger Dunkelheit versinken. Er tötete Matt, meinen Mann, vor meinen Augen. Er vergewaltigte mich. Entstellte mich. Er benutzte meine Tochter Alexa als menschlichen Schild, der die erste Kugel auffing, die ich auf ihn abfeuerte.
Aber nicht die zweite, und auch nicht die weiteren. Ich pumpte mein ganzes Magazin in ihn, lud nach und jagte ihm auch dieses Magazin in den Balg. Danach kämpfte ich sechs Monate um die Entscheidung, ob ich weiterleben oder mir das Hirn aus dem Kopf pusten sollte.
Dann wurde Annie ermordet, und Bonnie war da, und irgendwann mittendrin bekam das Leben mich wieder in den Griff.
Die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, wie es ist, an einem Ort zu sein, wo der Tod dem Leben vorzuziehen ist. Das Leben ist stark. Es hält einen auf verschiedenste Weise fest, mit dem Pochen des Herzens, mit der Sonne auf dem Gesicht und mit dem Gefühl des Bodens unter den Füßen. Es packt dich und hält dich entschlossen fest. Bei mir aber war der Griff des Lebens schwächlich, dünn wie ein Faden. Ein seidener Spinnenfaden, an dem ich scheinbar endlos über einem Abgrund hing. Dann waren es zwei Fäden. Dann fünf. Dann ein Seil. Der Abgrund wich unter mir zurück, und an irgendeinem Punkt erkannte ich, dass das Leben mich wieder fest im Griff hielt – und ich fing wieder an, mir etwas aus dem Leben zu machen. Der Abgrund war verschwunden, einem Horizont gewichen.
»Es wird Zeit, dieses Haus wieder zu einem richtigen Heim zu machen, Schatz. Verstehst du?«
Bonnie nickt. Ich kann sehen, dass sie mich in jeder Beziehung versteht.
»Und jetzt kommt etwas, das dir bestimmt gefällt.« Ich streichle ihr die Wange. »Tante Callie hat sich ein paar Tage freigenommen. Sie kommt her und hilft uns.« Meine Worte rufen ein Lächeln reinster Freude hervor. »Elaina kommt auch vorbei. Freust du dich?«
Sie nickt. Und wie!
Wir frühstücken weiter. Nach einiger Zeit träume ich vor mich hin, als mir plötzlich bewusst wird, dass Bonnie mich aufmerksam betrachtet, mit schief gelegtem Kopf. Auf ihrem Gesicht ist ein fragender Ausdruck.
»Du fragst dich, warum sie herkommen?«
Bonnie nickt.
»Weil …« Ich seufze. »Weil ich es alleine nicht schaffe.«
Ich bin felsenfest entschlossen, wieder voranzuschreiten. Doch ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, mich gehen zu lassen, dass ich misstrauisch bin gegenüber meinem jüngsten Anfall innerer Festigkeit. Ich möchte Freunde um mich haben, die mich stützen, falls ich wieder wacklig werde.
Bonnie steht von ihrem Stuhl auf und kommt zu mir. Ich spüre so viel Zärtlichkeit in diesem Kind. So viel Güte. Wenn meine Träume das Gesicht des Todes offenbaren, dann offenbart Bonnie das Gesicht der Liebe. Sie streckt die Hand aus, berührt ganz sanft das Narbengewebe, das die linke Seite meines Gesichts verunstaltet. Zerbrochene Scherben. Ich bin der Spiegel.
Mein Herz füllt und leert sich, füllt und leert sich.
»Ich hab dich auch lieb, mein Schatz.«
Eine rasche Umarmung, dann zurück zum Frühstück. Wir essen zu Ende, und ich seufze zufrieden. Bonnie rülpst, laut und heftig. Schockierte Stille – und dann brechen wir beide in Gelächter aus, bis uns die Tränen über die Wangen kullern und wir nur noch kichern können.
»Möchtest du dir Zeichentrickfilme ansehen, Zwerg?«, frage ich, als wir wieder zu Atem gekommen sind.
Ein strahlendes Lächeln, wie die Sonne über einem Feld voller Blumen.
Mir wird bewusst, dass dies der beste Tag ist, den ich seit einem ganzen Jahr gehabt habe. Der allerallerbeste.
KAPITEL 2
Bonnie und ich gehen durch die Glendale Galeria – die Mall aller Malls –, und der Tag ist sogar noch besser geworden. Wir sind in einem Sam Goody’s gewesen und haben uns die Auswahl an Musik angesehen. Ich habe mir ein CD-Set gekauft, Best of the 80’s, und Bonnie hat die neueste CD von Jewel bekommen. Ihr derzeitiges musikalisches Interesse passt zu ihr: voller Nachdenklichkeit und Schönheit, nicht unglücklich, aber ganz bestimmt nicht überschwänglich. Ich freue mich bereits auf den Tag, an dem sie mich bittet, ihr etwas zu kaufen, weil es sie zum Tanzen bringt, doch heute ist es mir egal. Bonnie ist glücklich. Das ist alles, was zählt.
Wir kaufen uns riesige Salzbrezeln und setzen uns auf eine Bank, um zu essen und Leute zu beobachten. Zwei Teenager schlendern vorbei, ohne Augen für irgendetwas außer füreinander. Das Mädchen ist fünfzehn oder sechzehn, brünett, reizlos, mit kleiner Oberweite und dickem Hintern, und es trägt eine tief auf den Hüften sitzende Jeans und ein Trägertop. Der Junge ist ungefähr im gleichen Alter und bewundernswert uncool. Groß, dünn, schlaksig, mit dicker Brille, jeder Menge Akne und Haaren bis über die Schultern. Er hat seine Hand in der Gesäßtasche ihrer Jeans, und sie hat den Arm um seine Taille geschlungen. Beide sind jung und dumm, unbeholfen und glücklich. Sie passen zusammen wie die Faust aufs Auge, und ich muss lächeln.
Ich bemerke einen Mann mittleren Alters, der eine hübsche Zwanzigjährige angafft. Sie ist wie ein ungezähmtes Pferd, erfüllt von müheloser Vitalität. Üppiges pechschwarzes Haar, das ihr bis tief in den Rücken reicht. Makellose gebräunte Haut. Ein keckes Lächeln, kecke Stupsnase – einfach alles an ihr ist keck, einschließlich ihres Selbstvertrauens und einer Sinnlichkeit, von der ich glaube, dass sie mehr unterbewusst als absichtlich ist. Sie geht an dem Mann vorbei. Er fängt weiter Fliegen mit offenem Mund. Sie nimmt nicht einmal Notiz von ihm. Wie das eben so ist.
War ich auch mal so?, überlege ich. Schön genug, um den männlichen IQ in den Keller rutschen zu lassen?
Wahrscheinlich. Tja, die Zeiten ändern sich.
Heute bekomme ich ebenfalls Blicke. Doch es sind keine Blicke mehr, die Begehren ausdrücken. Es sind Blicke, die von Neugier bis Abscheu reichen. Es fällt mir schwer, jemandem einen Vorwurf daraus zu machen. Sands hat ganze Arbeit geleistet, als er mir das Gesicht zerschnitten hat.
Die rechte Seite ist makellos und unberührt. Das Grauen ist links. Die Narbe fängt mitten auf der Stirn an, am Haaransatz, zieht sich zwischen den Augenbrauen nach unten und dann in einem nahezu perfekten rechten Winkel nach links. Ich besitze keine linke Augenbraue mehr; dort verläuft jetzt die Narbe. Die holprige Bahn setzt sich fort über meine Schläfe, dann in einer trägen Achterbahn über meine Wange. Von dort geht sie über meinen Nasenrücken zur Nasenwurzel, bevor sie wieder kehrtmacht, eine Diagonale über meinen linken Nasenflügel zeichnet und ein letztes Mal über meinen Kiefer hinunter bis zum Schlüsselbein läuft.
Ich habe eine weitere Narbe, perfekt und gerade, die unter der Mitte meines linken Auges anfängt und bis zum Mundwinkel reicht. Sie ist neuer als die anderen. Der Mann, der Annie getötet hat, hatte mich gezwungen, mir diese Wunde selbst zuzufügen, mit einem Messer, während er mir geifernd und mit gierigen Blicken zuschaute. Es gefiel ihm offensichtlich, mich bluten zu sehen. Ich konnte die Erregung in seinen Augen lesen, ehe ich ihm kurze Zeit später das Hirn aus dem Schädel gepustet habe.
Das alles sind nur die Narben, die jeder sehen kann. Unter dem Halsausschnitt meiner Bluse befinden sich noch mehr. Hervorgerufen von einer Messerklinge und dem kirschroten Ende einer brennenden Zigarre.
Lange Zeit habe ich mich meines Gesichts geschämt. Ich habe die Haare auf der linken Seite lang getragen und zu verbergen versucht, was Joseph Sands mir angetan hat. Doch das Leben hat mein Herz wieder in den Griff bekommen, und inzwischen denke ich anders über diese Narben. Heute bürste ich mein Haar zurück und binde es zu einem Pferdeschwanz zusammen. Soll die Welt ruhig hinsehen.
Der Rest von mir ist gar nicht mal so übel. Ich bin eher klein, sportliche Figur, habe »mundgerechte Titten«, wie Matt sie genannt hat, und eher einen Birnen- als Apfelhintern. Matt liebte meinen Hintern. Manchmal, wenn ich vor dem mannshohen Spiegel stand, fiel Matt hinter mir auf die Knie, packte mein Hinterteil und sah zu mir auf, um mit seiner besten Gollum-Stimme »Mein Schaaatz …« zu röcheln.
Bonnie zupft an meinem Ärmel und reißt mich aus meinen müßigen Erinnerungen. Ich blicke zu der Stelle, die sie mir zeigt. »Möchtest du ins Claire’s?«, frage ich.
Sie nickt.
»Kein Problem, Zwerg.« Das Claire’s ist eines von den Modegeschäften, die sich auf den Mutter / Tochter-Stil spezialisiert haben. Billiger, jedoch angesagter Schmuck für die Jungen und Alten, Haargummis, Bürsten mit Glitzer.
Wir betreten das Geschäft, und eine knapp über Zwanzigjährige gibt sich als eine der Verkäuferinnen zu erkennen. Sie begrüßt uns mit patentiertem Einzelhandelslächeln, hilfsbereit und verkaufstüchtig. Ihre Augen weiten sich, als sie meine linke Gesichtshälfte sieht. Das Lächeln gefriert und verschwindet.
Ich hebe eine Augenbraue. »Ist was?«
»Nein, ich …« Sie starrt weiter auf meine Narben, verlegen und entsetzt zugleich. Ich habe beinahe Mitgefühl. Ihre Göttin ist die Schönheit, und mein Gesicht muss für sie aussehen, als hätte der Teufel den Sieg davongetragen.
»Helfen Sie den anderen Mädchen da drüben, Barbara.« Die Stimme ist scharf wie eine Ohrfeige. Ich wende mich um und erblicke eine Frau in den Vierzigern, eine reife Schönheit mit grau meliertem Haar und den verblüffendsten blauen Augen, die ich je gesehen habe. »Barbara!«, sagt sie noch einmal.
Die junge Verkäuferin erwacht aus ihrer Starre, stößt ein knappes »Ja, Ma’am«, hervor und entfernt sich so schnell, wie ihre perfekt pedikürten Füße sie zu tragen vermögen.
»Mach dir nichts draus«, sagt die Frau. »Sie hat ein nettes Lächeln, aber nicht viel im Kopf.« Die Stimme klingt freundlich, und ich öffne den Mund zu einer Antwort, als mir klar wird, dass die Frau nicht zu mir, sondern zu Bonnie gesprochen hat.
Ich schaue auf Bonnie und bemerke, dass ihre Blicke die junge Verkäuferin von hinten durchbohren. Bonnie hat einen Beschützerinstinkt mir gegenüber und ist jetzt stocksauer auf das Mädchen. Dann reagiert Bonnie auf die Stimme der Frau, wendet sich ihr zu und mustert sie mit einem unverhohlen abschätzenden Blick. Die finstere Miene weicht einem scheuen Lächeln. Sie mag die grau melierte Dame.
»Ich bin Judith, und das hier ist mein kleiner Laden. Womit kann ich den beiden Ladys helfen?«
Jetzt spricht sie zu mir. Diesmal mustere ich sie abschätzend und kann keine Falschheit entdecken. Ihre Freundlichkeit ist ungezwungen und echt. Sie ist dieser Frau angeboren. Ich weiß selbst nicht, warum ich frage; die Worte kommen über meine Lippen, bevor ich es verhindern kann: »Warum sind Sie nicht so erschrocken wie die junge Verkäuferin, Judith?«
Judith sieht mich aus ihren klugen, so erstaunlich blauen Augen an und lächelt sanft. »Ach, Kindchen, ich habe erst letztes Jahr den Krebs besiegt. Man hat mir beide Brüste amputieren müssen. Als mein Mann zum ersten Mal das Ergebnis gesehen hat, hat er nicht einmal geblinzelt. Er hat einfach nur gesagt, dass er mich liebt. Schönheit wird hoffnungslos überbewertet.« Sie zwinkert mir zu. »Also, womit kann ich behilflich sein?«
»Smoky«, stelle ich mich vor. »Smoky Barrett. Und das hier ist Bonnie. Wir wollten uns nur ein wenig umsehen. Sie haben uns bereits sehr geholfen, danke.«
»Dann wünsche ich viel Vergnügen, und lassen Sie mich wissen, wenn Sie mich brauchen.«
Ein letztes Lächeln, ein Zwinkern, und weg ist sie. Ihre Freundlichkeit leuchtet ihr nach wie das Glitzern einer Zauberfee.
Wir verbringen gut zwanzig Minuten in dem Geschäft und beladen uns mit Firlefanz. Die Hälfte werden wir wahrscheinlich niemals benutzen, aber das Einkaufen hat Riesenspaß gemacht. Judith bedient uns an der Kasse, und ich sage: »Wiedersehen«, und wir stolpern mit unserer Beute nach draußen. Vor dem Laden werfe ich einen Blick auf die Uhr.
»Wir sollten nach Hause, Schatz. Tante Callie kommt in einer Stunde.«
Bonnie lächelt, nickt und nimmt meine Hand. Wir verlassen die Mall und gehen hinaus in einen perfekten Tag und den kalifornischen Sonnenschein. Es ist, als würden wir eine Postkarte betreten. Ich muss an Judith denken und schaue auf Bonnie hinunter. Sie bemerkt es nicht. Sie scheint frei von Sorgen, so wie ein Kind sein sollte.
Es ist wirklich ein großartiger Tag. Der beste seit langer, langer Zeit. Vielleicht ist es ein gutes Omen. Ich befreie das Haus von Geistern, und das Leben wird besser. Es gibt mir die Gewissheit, das Richtige zu tun.
Doch ich weiß, woran ich mich sofort erinnern werde, wenn ich wieder ins Büro zurückkehre: Da draußen lauern Raubtiere. Vergewaltiger, Mörder und Schlimmeres. Sie wandeln unter dem gleichen blauen Himmel wie wir, baden sich in der Wärme der gleichen gelben Sonne, stets auf der Lauer, stets aufmerksam beobachtend, während sie sich an uns reiben und dabei erschauern und zittern wie finstere Stimmgabeln.
Doch für den Augenblick soll die Sonne einfach nur die Sonne sein. Wie die Stimme in meinem Traum gesagt hat: Auch zerbrochene Dinge spiegeln das Licht.
KAPITEL 3
Die Wohnzimmercouch hält uns in ihrem weichen, entspannenden Griff. Es ist eine alte, ein wenig heruntergekommene Couch, hellbeige Mikrofaser, stellenweise fleckig von der Vergangenheit. Ich sehe Weintropfen, die nicht herausgehen wollen, und Essensreste, die wahrscheinlich Jahre alt sind. Unsere Beute aus der Mall wartet in Einkaufstüten auf dem Wohnzimmertisch, der ebenfalls Spuren von vergangenem Missbrauch aufweist. Das Walnussholz war glänzend, als Matt und ich diesen Tisch gekauft haben; heute ist seine Oberfläche zerkratzt und stumpf.
Ich sollte beides auswechseln, doch ich kann nicht, noch nicht. Diese Möbel waren robust, gemütlich und ehrlich, und ich bin noch nicht bereit, sie in den Möbelhimmel zu schicken.
»Ich möchte mit dir über etwas reden, Bonnie«, sage ich ernst.
Sie wendet sich mir zu und schenkt mir ihre volle Aufmerksamkeit. Sie spürt das Zögern in meiner Stimme, den Konflikt in mir. Schieß los, sagt dieser Blick. Keine Bange, es ist okay.
Das ist auch so eine Sache, die ich eines Tages hinter uns zu bringen hoffe: Zu häufig ist Bonnie diejenige, die mich beruhigt, die mir Sicherheit gibt. Ich sollte diejenige sein, die Bonnie führt, nicht umgekehrt.
»Ich möchte mit dir darüber reden, dass du nicht redest.«
Ihr Blick verändert sich, wechselt von Verständnis zu Beunruhigung.
Nein, sagen ihre Augen. Nein, darüber will ich nicht sprechen.
»Schatz …« Ich berühre ihren Arm. »Ich mache mir Sorgen. Ich habe mit einigen Ärzten gesprochen, und sie haben mir gesagt, du könntest irgendwann für immer stumm bleiben, wenn du zu lange nicht sprichst.«
Sie verschränkt die Arme. Ich kann den Widerstreit sehen, den sie innerlich austrägt, doch ich begreife nicht, was sie mir sagen will.
Dann kapiere ich.
»Überlegst du, wie du mir etwas sagen möchtest?«, frage ich.
Sie nickt. Ja. Sie hebt einen Finger. Ich habe herausgefunden, dass es warte oder aber heißt.
»Aber?«
Sie deutet auf ihren Kopf. Macht eine nachdenkliche Miene.
Wieder brauche ich ein paar Sekunden.
»Du weißt nicht, warum du nicht sprichst, aber du denkst darüber nach, ja? Du versuchst, den Grund dafür herauszufinden?«
Ich sehe an ihrer Erleichterung, dass ich ins Schwarze getroffen habe. Nun bin ich an der Reihe, besorgt zu sein.
»Willst du denn nicht, dass jemand dir dabei hilft? Ich könnte dich zu einem Therapeuten bringen …«
Sie springt erschrocken vom Sofa auf. Macht eine hektische, abwehrende Handbewegung.
Auf gar keinen Fall! Niemals!
Diese Bewegung bedarf keiner Erklärung. Ich begreife augenblicklich.
»Okay, schon gut. Keinen Therapeuten.« Ich lege die Hand aufs Herz. »Versprochen.«
Das ist ein weiterer Grund, den Mann zu hassen, der Bonnies Mutter ermordet hat, mag er nun tot sein oder nicht. Er war Therapeut, und Bonnie weiß es. Sie musste hilflos mit ansehen, wie er ihre Mutter umbrachte – und mit ihr Bonnies Vertrauen in seinen gesamten Berufsstand.
Ich strecke die Hand nach ihr aus und ziehe sie an mich. Ich fühle mich unbeholfen und verlegen, doch sie leistet keinen Widerstand.
»Es tut mir leid, Schatz. Es ist nur … ich mache mir Sorgen um dich. Ich liebe dich. Ich habe Angst, dass du vielleicht nie wieder sprechen kannst.«
Sie deutet auf sich und nickt.
Ich auch, sagt sie mir damit.
Zeigt auf ihren Kopf.
Aber ich arbeite daran.
»Also schön«, sage ich. »Für den Augenblick.«
Bonnie erwidert meine Umarmung, zeigt mir, dass alles in Ordnung ist, der Tag nicht ruiniert, kein Schaden angerichtet. Schon wieder ist sie es, die mich beruhigt.
Nimm es hin. Sie ist glücklich – so, wie es ist. Lass sie in Ruhe.
»Komm, wir sehen uns die coolen Sachen an, die wir gekauft haben. Was meinst du?«
Ein Lächeln. Ein begeistertes Kopfnicken. Au ja.
Fünf Minuten später hat der Firlefanz dafür gesorgt, dass Bonnie unsere Diskussion vergessen hat.
Bei mir ist es nicht so. Ich bin die Erwachsene. Ich vergesse meine Sorgen und Ängste nicht über einem Fläschchen Nagellack.
Es gibt eine Reihe von Dingen, die ich Bonnie über meinen zweiwöchigen Urlaub nicht erzählt habe. Auslassungen, keine Lügen. Das Recht einer Mutter: Sie lässt etwas aus, damit ihr Kind ein Kind bleiben kann. Kinder werden früh genug groß und müssen sich mit der Last eines ganzen Erwachsenenlebens herumschlagen.
Ich muss ein paar Entscheidungen treffen, was mein Leben angeht, und ich habe zwei Wochen, um herauszufinden, was ich tun möchte. Diese Frist habe ich mir selbst auferlegt. Ich muss eine Entscheidung fällen, nicht nur für mich, auch für Bonnie. Wir brauchen beide Festigkeit, Sicherheit und ein einigermaßen geregeltes Leben.
Es fing damit an, dass Assistant Director Jones mich vor zehn Tagen in sein Büro hat rufen lassen.
Ich kenne AD Jones, seit ich beim FBI bin. Er war ursprünglich mein Mentor und Rabbi, und er hat meine Karriere gefördert. Jetzt ist er mein Chef. Er ist nicht durch Speichellecken oder Ränkeschmieden auf seinem jetzigen Posten gelandet, sondern weil er ein außergewöhnlicher Agent ist. Mit anderen Worten, er ist echt. Ich respektiere ihn.
AD Jones’ Büro ist fensterlos und nüchtern. Er hätte sich ein Eckbüro mit großartiger Aussicht nehmen können, doch als ich ihn einmal deswegen gefragt habe, lautete seine Antwort sinngemäß: »Ein guter Chef sollte nicht allzu viel Zeit im Büro verbringen.«
Jedenfalls saß AD Jones bei meinem Eintreten hinter seinem Schreibtisch, einem großen, schweren Anachronismus aus grauem Metall, den er bereits besitzt, seit ich ihn kenne. Wie der Mann selbst scheint dieser Schreibtisch zu rufen: Rühr mich nicht an, solange ich noch zu etwas gut bin! Die Tischplatte war wie immer übersät mit Stapeln von Akten und Unterlagen. Ein altes Schild aus Holz und Messing verkündet Jones’ Dienstrang. Keine Auszeichnungen oder Urkunden schmücken die Wände, obwohl ich weiß, dass er davon mehr als genug hat.
»Setzen Sie sich, Smoky«, sagte er und deutete auf einen der beiden Ledersessel, die vor seinem Schreibtisch stehen.
AD Jones ist Anfang fünfzig und seit 1977 beim FBI. Er fing hier in Kalifornien an und arbeitete sich in der Hierarchie nach oben. Er war zweimal verheiratet und ist zweimal geschieden. Jones ist ein auf derbe Weise gut aussehender Mann. Er neigt dazu, wortkarg zu sein, und manchmal ist er schroff, sogar gefühllos. Aber er ist ein unglaublich guter Ermittler. Ich hatte Glück, dass ich so früh in meiner Karriere mit ihm zusammenarbeiten durfte.
»Was gibt’s, Sir?«, fragte ich.
Er nahm sich einen Moment Zeit, bevor er antwortete.
»Ich bin kein besonders taktvoller Mensch, Smoky, also lege ich die Fakten auf den Tisch. Man hat Ihnen einen Job als Ausbilderin in Quantico angeboten. Sie müssen nicht annehmen, aber ich muss Sie darüber informieren.«
Ich konnte es kaum glauben. »Warum?«, stellte ich die offensichtliche Frage.
»Weil Sie die Beste sind.«
Irgendetwas an seinem Verhalten verriet mir, dass mehr dahintersteckte.
»Aber?«
Er seufzte. »Es gibt kein Aber«, sagte er. »Es gibt nur ein Und. Sie sind die Beste. Sie sind mehr als qualifiziert, und Sie hätten den Job in Quantico aufgrund Ihrer Leistungen mehr als verdient.«
»Und was bedeutet dieses Und?«
»Irgendjemand ganz oben in der Chefetage scheint der Ansicht zu sein, dass man es Ihnen schuldig ist.«
»Mir schuldig, Sir?«
»Wegen dem, was Sie geopfert haben.« Seine Stimme war ganz leise geworden. »Sie haben dem FBI Ihre Familie geopfert.« Er strich sich über die Wange. Ich konnte nicht sagen, ob es eine unbewusste Geste war oder eine Anspielung auf meine Narben. »Sie haben eine Menge durchgemacht wegen Ihres Berufs.«
»Na und?«, fragte ich verärgert. »Tue ich denen da oben leid? Oder haben sie Angst, ich könnte irgendwann schlappmachen?«
Er überraschte mich mit einem Grinsen. »Unter normalen Umständen würde ich mich diesem Gedankengang anschließen, Smoky. Aber nein. Ich habe mit dem Direktor gesprochen, und er hat mir klargemacht, dass es keine politische Entscheidung ist. Es soll eine Belohnung sein. Eine Anerkennung.« Er sah mich abschätzend an. »Sind Sie Director Rathbun eigentlich noch nie begegnet?«
»Einmal. Scheint mir ein geradliniger Mann zu sein.«
»Er ist geradlinig. Er ist hart, er ist aufrichtig – so aufrichtig, wie sein Rang es ihm erlaubt –, und er sagt, was er meint. Und er meint, Sie wären perfekt für diesen Job. Sie würden eine Gehaltserhöhung bekommen, Sie hätten einen geregelten Tagesablauf für Bonnie, und Sie wären aus der Schusslinie.« Eine Pause. »Er hat mir gesagt, es wäre das Beste, was das Bureau für Sie tun kann.«
»Ich verstehe nicht …«
»Wir wissen beide, dass es eine Zeit gab, als man Sie als Assistant Director in Betracht gezogen hat. Als meine Nachfolgerin.«
»Ja, ich weiß.«
»Das ist vom Tisch, ein für alle Mal.«
Der Schock fuhr durch mich hindurch wie eine Messerklinge.
»Wieso? Weil ich eine Zeit lang von der Rolle war, nachdem Matt und Alexa ermordet wurden?«
»Nein, nichts dergleichen. Viel oberflächlicher. Denken Sie an das Naheliegende, Smoky.«
Ich dachte nach, und dann dämmerte es mir. Auf der einen Seite wollte ich es nicht glauben. Auf der anderen war es typisch für das FBI, durch und durch.
»Es ist wegen meiner Narben, nicht wahr? Es ist ein Problem mit meinem Äußeren.«
Eine Mischung aus Zorn und Schmerz flammte in seinen Augen auf und erstarb dann zu müder Resignation.
»Ich habe Ihnen gesagt, dass er geradeheraus ist, Smoky. Wir leben in einem von Medien beherrschten Zeitalter. Es gibt kein Problem mit Ihrem Aussehen, solange Sie nur Ihr Team leiten.« Seine Lippen verzogen sich zu einem verkrampften Lächeln. »Aber die allgemeine Meinung geht offensichtlich dahin, dass es nicht funktionieren würde, sollten Sie meine Stelle einnehmen. Romantisch, solange Sie die Jägerin sind, schlecht für Rekrutierungsaufgaben, wenn Sie Assistant Director sind. Ich halte das für ausgemachten Blödsinn, genau wie Rathbun, aber so ist es nun mal.«
Eigentlich hätte ich verärgert sein müssen, doch zu meiner Verwunderung empfand ich keinen Zorn. Bloß Gleichgültigkeit.
Es hat eine Zeit gegeben, da war ich genauso ehrgeizig wie jeder andere Agent. Matt und ich hatten darüber gesprochen, hatten sogar für diesen Zeitpunkt geplant. Wir hatten es als selbstverständlich genommen, dass ich die Karriereleiter hinaufklettern würde. Doch die Dinge hatten sich anders entwickelt.
Doch abgesehen von meinen verletzten Gefühlen: Die Bosse hatten recht. Ich war tatsächlich nicht mehr geeignet, das administrative Gesicht des FBI zu werden. Mit meinen Narben war ich furchteinflößend – die kampferprobte Soldatin. Und ich verstand es, andere auszubilden – die hartgesottene Veteranin. Aber auf Fotos zusammen mit dem Präsidenten? Eher nicht.
Andererseits bedeutete der Job als Ausbilderin in Quantico gute Bezahlung, regelmäßige Arbeitszeiten und weniger Stress. Ein Job, nach dem andere sich die Finger lecken. Schüler schießen nicht auf ihre Ausbilder. Sie brechen nicht in deren Wohnungen ein. Sie bringen keine Familien um.
Das alles ging mir binnen weniger Augenblicke durch den Kopf.
»Wie lange habe ich, um über eine Antwort nachzudenken?«
»Einen Monat. Wenn Sie Ja sagen, bleibt Ihnen reichlich Zeit, um die Versetzung anzugehen.«
Einen Monat, dachte ich. Jede Menge Zeit und doch nicht genug.
»Was sollte ich Ihrer Meinung nach tun, Sir?«
Mein Mentor hatte nicht eine Sekunde gezögert: »Sie sind die beste Agentin, mit der ich jemals gearbeitet habe, Smoky. Sie sind kaum zu ersetzen. Aber Sie sollten tun, was für Sie am besten ist.«
Und nun sitze ich hier und schaue Bonnie an. Sie ist in ihre Zeichentrickfilme vertieft. Ich denke an den heutigen Tag, den entspannten Morgen, die Rülpser beim Frühstück und die Ausflüge zu Claire’s.
Was ist am besten für mich? Was ist am besten für Bonnie? Soll ich sie fragen?
Ja, das sollte ich. Aber nicht jetzt.
Ich beschließe, zunächst einmal mit meinem Plan weiterzumachen und Matts und Alexas Hinterlassenschaften wegzupacken. Von uns gegangen, aber nicht vergessen.
Warten wir ab, wie die Dinge hinterher aussehen.
Dass ich mich irgendwann entscheiden muss, macht mir keinen Stress. Ich habe Möglichkeiten, und Möglichkeiten bedeuten Zukunft, hier oder in Quantico. Alles bewegt sich vorwärts, und das Vorwärts ist Leben. Alles ist viel besser als noch vor sechs Monaten.
Das sagst du dir andauernd. Aber es ist nicht so einfach, und das weißt du. Hinter dieser Gleichgültigkeit verbirgt sich etwas Dunkles und Hässliches.
Ich erschauere und verdränge jeden weiteren Gedanken daran, versuche es zumindest, kuschle mich näher an Bonnie, lasse den Samstag wieder Samstag sein.
»Zeichentrickfilme sind Klasse, nicht wahr?«
Bonnie nickt, ohne den Blick vom Fernseher zu nehmen.
KAPITEL 4
»Steht nicht so faul und selbstzufrieden da herum!«, sagt Callie.
Mit strenger Miene steht sie in der Küche. Burgunderrot lackierte Fingernägel trommeln auf die Arbeitsfläche aus schwarzem Granit. Ihr kupferrotes Haar bildet einen lebhaften Kontrast zu den Möbelfronten aus Weißeiche hinter ihr. Missbilligend hebt sie eine perfekt geschwungene Augenbraue.
Bonnie und ich lächeln einander an.
Gäbe es eine Schutzheilige der Respektlosigkeit, es wäre Callie. Sie ist schroff und scharfzüngig und hat die Angewohnheit, alles und jeden »Zuckerschnäuzchen« zu nennen. Gerüchte besagen, dass sie eine Abmahnung in ihrer Personalakte hat, weil sie den Direktor des FBI auch so genannt hat. Ich zweifle keine Sekunde daran. Das ist durch und durch Callie.
Außerdem ist sie wunderschön – auf eine Art und Weise, um die alle sie beneiden, die über zwanzig sind, weil es eine bleibende Schönheit ist, eine Filmstar-Schönheit, der das Alter nichts anhaben kann. Ich habe Fotos von Callie mit zwanzig gesehen, und ich muss ehrlich sagen, dass sie heute, mit achtunddreißig, schöner ist als damals. Sie hat flammend rotes Haar, volle Lippen, lange Beine – sie hätte eine Karriere als Model machen können. Doch statt einer Haarbürste trägt sie eine Kanone in der Handtasche. Ich glaube, gerade durch ihr völliges Desinteresse an der eigenen körperlichen Perfektion wirkt sie noch schöner, als sie ohnehin schon ist. Es ist nicht so, als hätte sie ein schlechtes Bild von sich (weit gefehlt); es ist eher so, dass ihre Schönheit eine Eigenschaft ist, die ihr nichts bedeutet.
Callie ist hart wie Stahl, klüger als die Wissenschaftler bei der NASA und die treueste Freundin, die ich mir nur wünschen kann. Ich habe nie ein Geburtstagsgeschenk oder auch nur eine Grußkarte von ihr bekommen – ihre Liebe offenbart sich durch ihr Tun.
Es war Callie, die mich gefunden hat, im eigenen Blut, neben der Leiche von Joseph Sands. Es war Callie, die mir die Waffe aus der Hand genommen hat, selbst als ich damit auf sie gezielt und den Abzug betätigt habe. Zum Glück war das Magazin leer, klick, klick, klick.
Callie gehört zu meinem Team; wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen. Sie hat einen Master-Abschluss in Forensik und einen Verstand, der wie geschaffen ist für unseren Job. Außerdem legt Callie eine gewisse Brutalität an den Tag, wenn es um das Ermitteln geht. Beweise und Wahrheiten sind höhere Mächte für sie. Wenn die Beweislage klar ist, rollt sie stur wie ein Panzer los und walzt dabei alles platt, was ihr im Weg ist – auch Freunde und Bekannte, ganz gleich, wie gut man vorher mit ihr zurechtgekommen sein mag. Sie fühlt sich nicht einmal schuldig deswegen. Die einfachste Lösung ist, kein Verbrecher zu sein; dann kommt man prima mit ihr aus.
Callie ist nicht perfekt. Sie trägt ihre Narben nur besser als wir anderen. Sie wurde mit fünfzehn schwanger, und ihre Eltern haben sie gezwungen, das Kind zur Adoption freizugeben. Callie hat dieses Geheimnis vor jedem verborgen, sogar vor mir – bis vor sechs Monaten. Ein Killer hat es ans Tageslicht gezerrt. Die Leute mögen Callie um ihre Schönheit beneiden, doch sie hat hart gekämpft und gelitten, bis sie der Mensch wurde, der sie heute ist.
»Wir freuen uns.« Ich lächle sie an. »Danke, dass du gekommen bist.«
Sie winkt ab, als wäre das nichts Besonderes. »Ich bin wegen der kostenlosen Mahlzeiten da.« Sie mustert mich finster. »Es gibt doch kostenlose Mahlzeiten?«
Bonnie antwortet für mich. Sie geht zum Kühlschrank, öffnet die Tür und kehrt mit einer Lieblingsspeise von Callie zurück, einer Schachtel mit Schokoladendonuts.
Callie tut, als würde sie eine Träne abwischen. »Gott segne dich, Zuckerschnäuzchen.« Sie lächelt Bonnie an. »Möchtest du mir helfen, ein paar davon zu verputzen?«
Bonnie erwiderte ihr Lächeln. Sie holen sich Milch, eine wichtige Zutat. Ich beobachte sie dabei, wie sie Donuts verschlingen. Dieses Bild, dieser Moment rufen einen Glücksausbruch in mir hervor. Alles ist beinahe so perfekt, wie es nur sein kann. Freunde und Donuts und freudestrahlende Töchter, das Elixier von Lachen und Leben.
»Nein, Zuckerschnäuzchen«, höre ich Callie sagen. »Niemals herunterschlingen, ohne sie vorher in Milch zu tunken. Es sei denn, du hast keine Milch. Das ist die erste Regel des Lebens, vergiss sie niemals: Der Donut ist wichtiger als die Milch.«
Ich blicke meine Freundin voller Staunen an. Sie bemerkt es nicht, ist ganz vertieft darin, ihre Donut-Geschichten zum Besten zu geben. Das alles macht Callie zu einem der mir liebsten Menschen. Ihre Bereitwilligkeit, Spaß zu haben. Unschuldig nach den niedrig hängenden Früchten der Freude zu greifen.
»Ich bin gleich wieder da«, sage ich.
Ich steige die teppichbedeckten Stufen zu meinem Schlafzimmer hinauf und sehe mich um. Es ist ein großzügiges Elternschlafzimmer. Die Schlagläden entlang der Vorderfront können so eingestellt werden, dass sie den Sonnenschein nur teilweise oder mit voller Kraft ins Innere lassen. Die Wände sind in Weißtönen gehalten, die Bettdecke ein hellblauer Farbtupfer. Das Bett beherrscht das Zimmer, ein breites, riesiges, himmlisches Ding mit einer teuren Matratze. Jede Menge Kissen, ganze Berge von Kissen. Ich liebe Kissen.
Es gibt zwei gleiche Schubladenkommoden, eine für Matt und eine für mich, beide in dunklem Kirschholz. An der Decke dreht sich leise ein Ventilator; sein dunkles Brummen ist seit langem der Begleiter meines Schlafs.
Ich setze mich aufs Bett und schaue mich um, nehme das Zimmer in mich auf.
Ich brauche diesen Augenblick, bevor es losgeht. Ein paar Sekunden, um das zu sehen, was war. Nicht das, was werden wird.
Großartige Dinge, schreckliche Dinge und ganz banale Dinge, sie alle haben sich hier ereignet, auf diesem Bett. Sie gehen durch mich hindurch wie Regentropfen durch ein Blätterdach. Ein leises Donnern auf dem Dach meiner Welt.
Irgendwann verlieren Erinnerungen ihre Schärfe. Sie lassen dich nicht mehr bluten. Sie schneiden nicht mehr ins Fleisch; stattdessen wühlen sie dich auf. So ist es auch mit den Erinnerungen an meine Familie, und ich bin froh darüber. Es gab eine Zeit, als jeder Gedanke an Matt oder Alexa mich dazu gebracht hat, mich vor Schmerz zu krümmen. Heute kann ich an sie denken und lächeln.
Es geht weiter, Baby, immer weiter.
Doch Matt spricht noch von Zeit zu Zeit zu mir. Er war mein bester Freund; ich bin noch nicht bereit, seine Stimme aus meinem Innern zu verdrängen.
Ich schließe die Augen und denke daran, wie wir das Bett in dieses Zimmer gebracht haben, nachdem Matt und ich es gekauft hatten. Es war unser erstes Haus. Wir hatten unsere Bankkonten für die Anzahlung leergeräumt und gehofft, einen verständnisvollen Kreditgeber zu finden. Wir hatten ein Haus in einer aufblühenden Gegend von Pasadena gekauft, ein zweistöckiges, neueres Gebäude (eines von den wunderschönen, hundert Jahre alten Häusern konnten wir uns nicht leisen, auch wenn wir es liebend gern getan hätten). Es war ziemlich weit weg von unseren Arbeitstellen, aber keiner von uns wollte in Los Angeles wohnen. Wir wollten eine Familie, und da war Pasadena sicherer. Das Haus sah aus wie alle anderen ringsum. Es besaß keine Identität, doch es war unser Haus.
»Das ist unser Zuhause«, hatte Matt im Vorgarten zu mir gesagt und mich von hinten umarmt, als wir beide zu dem Haus hinaufgeschaut hatten. »Ich finde, dazu passt ein neues Bett. Es ist ein Symbol.«
Das war natürlich albern. Und ich war natürlich einverstanden. Also kauften wir das Bett und mühten uns ab, es die Treppe hinaufzuwuchten. Beim Zusammenbau des Kopfteils, des Rahmens und des Fußteils kamen wir ganz schön ins Schwitzen, und wir ächzten beim Montieren des Federrahmens. Dann saßen wir schwer atmend auf dem Fußboden des Schlafzimmers.
Matt sah mich an und lächelte. Ruckartig hob und senkte er die Augenbrauen. »Was sagst du dazu, wenn wir ein paar Laken aufs Bett werfen und ein bisschen horizontalen Mambo tanzen?«
Ich musste kichern wegen seiner gespielten Plumpheit. »Du weißt, wie man ein Mädchen umgarnt, so viel steht fest.«
Er setzte eine ernste Miene auf, legte sich eine Hand aufs Herz und hob die andere. »Mein Vater hat mich die Regeln gelehrt, wie man ein Weib ins Bett kriegt. Ich habe versprochen, mich immer daran zu halten.«
»Und was sind das für Regeln?«
»Du sollst beim Sex nie deine Socken tragen. Du sollst wissen, wo die Klitoris ist. Du sollst das Weib in den Armen halten, bis es eingeschlafen ist, bevor du selbst einschläfst. Und Furzen im Bett ist verboten.«
Ich nickte. »Dein Vater war ein kluger Mann. Ich stimme seinen Regeln zu.«
Wir tanzten den ganzen Nachmittag horizontalen Mambo, bis in die Abenddämmerung.
Und nun schaue ich auf das Bett. Fühle es mehr, als dass ich es sehe.
Alexa wurde auf diesem Bett empfangen, in einem verschwitzten, zärtlichen Augenblick, oder vielleicht auch in einem raueren, akrobatischen Moment, wer weiß das noch. Matt und ich kamen zusammen, eins, lösten uns voneinander, zwei, und Alexa war entstanden, drei.
Ich verbrachte schlaflose Nächte in diesem Bett, als ich schwanger war. Die Knöchel geschwollen, der Rücken schmerzend. Ich gab Matt für alles die Schuld – mit einer Bitterkeit, die man nur um drei Uhr morgens aufzubringen imstande ist, während 210 Tagen. Und ich liebte Matt für alles. Eine unermessliche Liebe, die eine Mischung war aus reiner Freude und verrückt spielenden Hormonen.
Die meisten Paare sind am Anfang zu selbstsüchtig für eine Ehe. Eine Schwangerschaft vertreibt die Selbstsucht gründlich.
Am Tag, nachdem wir Alexa nach Hause gebracht hatten, legten Matt und ich sie in die Mitte dieses Bettes. Wir legten uns rechts und links daneben und bestaunten ihr Dasein.
Alexa wurde in diesem Bett gezeugt. Sie weinte in diesem Bett. Sie lachte in diesem Bett. Sie war wütend in diesem Bett. Sie hat sich in diesem Bett sogar einmal übergeben, als Matt sie zu viel Eis essen ließ. Ich machte das Bett sauber, und Matt schlief auf der Couch.
Ich habe Lektionen in diesem Bett gelernt. Einmal liebten Matt und ich uns hier. Es war kein Sex, es war Liebe. Wein und Kerzen waren vorausgegangen. Wir hatten eine perfekte CD in der perfekten Lautstärke – laut genug, um Atmosphäre zu schaffen, leise genug, um nicht abzulenken. Der Mond schien hell, und die Nacht war lau. Wir schwitzten gerade ausreichend, um auf eine erotische, aber nicht klebrige Weise feucht zu bleiben. Es war die Definition von Sinnlichkeit.
Und dann furzte ich.
Es war ein damenhafter, leiser Furz, doch nichtsdestotrotz ein Furz. Wir erstarrten. Alles schien in einem langen, peinlichen, verlegenen Moment zu verharren.
Und dann fing das Kichern an. Gefolgt von Lachen. Gefolgt von einem Johlen, das wir mit Kissen erstickten, bis uns einfiel, dass Alexa bei einer Freundin übernachtete, woraufhin wir noch einmal Sex machten, noch sanfter und aufrichtiger.
Man kann Stolz haben, man kann Liebe haben, aber man kann nicht immer beides haben. In diesem Bett lernte ich, dass Liebe besser ist.
Es waren nicht nur Fürze und Gelächter. Matt und ich kämpften auch in diesem Bett. Mein Gott, wir hatten ein paar gute Kämpfe. So nannten wir sie: gute Kämpfe. Wir waren überzeugt, dass eine erfolgreiche Ehe hin und wieder einen ordentlichen Kampf, eine handfeste Auseinandersetzung erfordert. Wir waren sehr stolz auf einige unserer »besseren Kämpfe« – im Nachhinein betrachtet natürlich.
Und dann wurde ich in diesem Bett vergewaltigt, und ich musste zusehen, wie Matt starb, während ich an dieses Bett gefesselt war. Schlimme Dinge.
Ich atme ein, atme aus. Die Regentropfen fallen durchs Blätterdach, leise und unerbittlich. Die grundlegende Wahrheit: Du wirst nass, wenn es regnet. Daran führt kein Weg vorbei.
Ich betrachte das Bett und denke an die Zukunft. An all die guten Dinge, die immer noch hier passieren könnten, sollte ich entscheiden, nicht nach Quantico zu gehen. Ich habe keinen Matt mehr, ich habe keine Alexa mehr, aber ich habe Bonnie, und ich habe mich.
Leben, wie es früher war, das ist die Milch. Aber das Leben im Allgemeinen, das war der Schokoladendonut, und der Donut ist wichtiger als die Milch.
»Das also ist der magische Ort.«
Callies Stimme reißt mich aus meinen Erinnerungen. Sie steht in der Tür und sieht mich grüblerisch an.
»Hey«, sage ich. »Danke, dass du gekommen bist. Dass du mir helfen willst.«
Sie betritt das Zimmer, und ihre Blicke schweifen umher. »Ich hatte zwei Dinge zur Auswahl. Das hier oder Wiederholungen von Drei Engel für Charlie. Ich habe mich für das hier entschieden. Abgesehen davon gibt Bonnie mir zu essen.«
Ich muss lächeln. »Wie man eine wilde Callie fängt: mit Schokoladendonuts und einer richtig großen Mausefalle.«
Sie kommt zu mir, lässt sich neben mir auf das Bett fallen. Hüpft ein paar Mal auf und ab. »Sehr hübsch.«
»Ja. Ich habe eine Menge schöner Erinnerungen an dieses Bett.«
»Ich hab mich immer gefragt …« Sie zögert.
»Was?«
»Warum hast du es behalten, Zuckerschnäuzchen? Das ist das gleiche Bett, oder? Wo es passiert ist?«
»Das gleiche Bett, ja.« Ich streiche mit einer Hand über die Steppdecke. »Ich habe darüber nachgedacht, es wegschaffen zu lassen. In den ersten Wochen, nachdem ich wieder zu Hause war, hätte ich in diesem Bett kein Auge zu bekommen und habe deshalb auf dem Sofa geschlafen. Als ich schließlich den Mut fand, es zu versuchen, fühlte das Bett sich richtig an. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Ich konnte es nicht ertragen, woanders zu schlafen. In diesem Zimmer, auf diesem Bett sind schlimme Dinge geschehen. Aber ich wollte nicht zulassen, dass diese Dinge stärker sind als all das Schöne. Ich habe die Menschen hier geliebt. Meine Familie. Ich lasse mir das nicht von Joseph Sands wegnehmen.«
Ich kann den Ausdruck in Callies Augen nicht deuten. Traurigkeit. Schuld. Sehnsucht?
»Das ist der Unterschied zwischen uns, Smoky«, sagte sie. »Ich hatte einen einzigen schlimmen Augenblick als Teenager. Ich schlafe ein einziges Mal mit dem falschen Jungen, werde schwanger und muss mein Kind aufgeben. Danach achte ich peinlich darauf, nie wieder eine leidenschaftliche Beziehung einzugehen. Du wirst in diesem Bett vergewaltigt, doch die stärksten Erinnerungen für dich sind die Augenblicke, die du hier mit Matt und Alexa geteilt hast. Ich bewundere deinen Optimismus. Ich bewundere ihn wirklich.« Ihr Lächeln ist melancholisch.
Ich antworte nicht, denn ich kenne meine Freundin. Tröstende Worte wären nur peinlich, beinahe so etwas wie Verrat. Ich bin hier, damit sie diese Dinge sagen kann und weiß, dass jemand sie gehört hat. Nicht mehr und nicht weniger.
»Weißt du, was ich vermisse?«, fragt sie. »Matts Tacos.«
Ich sehe sie überrascht an und muss lachen.
»Die waren lecker, nicht wahr?«
»Ich träume manchmal von diesen Tacos«, sagt Callie mit einem melodramatischen Ausdruck von Sehnsucht in den Augen.
Ich könnte nicht einmal dann kochen, wenn mir jemand eine Pistole an den Kopf hält. Ich würde sogar Wasser anbrennen lassen, wie man so sagt. Wie bei allen Dingen, war Matt auch auf diesem Gebiet der Gründliche. Er kaufte Kochbücher, probierte und experimentierte, und in neun von zehn Fällen waren die Ergebnisse erstaunlich gut.
Er hatte gelernt – ich weiß nicht mehr, von wem –, wie man Tacos selber macht. Nicht das klebrige Zeug, das man zum Fertigbacken im Laden kaufen kann, sondern richtige Selbstgemachte. Man fängt mit einer Tortilla an und verwandelt sie nach und nach in eine halbmondförmige Köstlichkeit. Matt hatte irgendein Gewürz für das Hackfleisch, das mir das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.
Callie ebenfalls. Sie isst für ihr Leben gern, und sie hatte sich drei- oder viermal im Monat zu uns zum Abendessen eingeladen. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie Tacos in sich hineinstopft und mit vollem Mund redet. Ich höre noch, wie sie etwas sagt, das Alexa zum Kichern bringt, bis sie sich an ihrer Milch verschluckt und alles aus der Nase prustet, was der absolute Höhepunkt der Albernheiten war.
»Danke«, sage ich.
Sie weiß, was ich meine. Danke für diese Erinnerung, dieses vergessene Stück bittersüßer Vergangenheit, diesen Schlag in den Unterleib, der weh tut und sich zugleich wunderbar anfühlt.
Das ist Callie. Sie wirbelt ganz nah an mich heran, umarmt meine Seele, und dann wirbelt sie wieder davon, geht hochmütig auf Distanz.
Sie steht von meinem Bett auf, geht zur Tür, blickt zu mir zurück und lächelt ein spitzbübisches Lächeln.
»Weißt du was? Du brauchst keine Mausefalle. Du musst nur die Donuts mit irgendetwas präparieren. Ich esse die Donuts immer.«
KAPITEL 5
»Wie geht es dir, Smoky?«
Elaina stellte mir diese Frage. Sie ist vor ungefähr zwanzig Minuten erschienen, und nachdem die erforderlichen Umarmungen mit Bonnie abgeschlossen sind, hat sie mich beiseite genommen. Jetzt sitzen wir allein in meinem Wohnzimmer. Elaina sieht mich fest an, durchbohrt mich förmlich mit dem Blick aus ihren braunen Augen. »Und ich will eine ernsthafte Antwort«, sagt dieser Blick.
»Meistens gut, manchmal schlecht«, sage ich ohne zu zögern. Es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, Elaina gegenüber unaufrichtig zu sein. Sie ist einer jener seltenen Menschen, die warmherzig und stark zugleich sind.
Ihr Blick wird weicher. »Erzähl mir von dem Schlechten«, sagt sie.
Ich versuche Worte zu finden für meinen neuen Dämon, jenen Teufel, der durch meine Träume tobt, während ich schlafe. Früher habe ich von Joseph Sands geträumt, der mich kichernd und glucksend wieder und wieder vergewaltigt und meine Familie lächelnd und augenzwinkernd ermordet. Doch Sands ist verblasst; heute drehen die Albträume sich um Bonnie. Ich sehe sie auf dem Schoß eines Irren, ein Messer an der Kehle. Ich sehe sie auf einem weißen Teppich, ein Kugelloch in der Stirn, und unter ihr breitet sich ein purpurner Engel aus.
»Angst. Es ist die Angst.«
»Weswegen?«
»Wegen Bonnie.«
Elainas Stirn glättet sich. »Du machst dir Sorgen, ihr könnte etwas zustoßen.«
»Es sind keine Sorgen. Es ist Angst. Ich habe Angst, dass sie nie wieder sprechen könnte und irgendwann den Verstand verliert. Dass ich nicht da sein könnte, wenn sie mich braucht.«
»Und?«, hakt Elaina nach. Sie drängt mich, das wahre Entsetzen in Worte zu fassen, den Dämon in der dunklen Grube beim Namen zu nennen.
»Dass sie sterben könnte, kapierst du denn nicht?«, sage ich ungewollt schnippisch und bedaure es beinahe sofort. »Entschuldige.«
Elaina lächelt, um mir zu zeigen, dass alles in Ordnung ist. »Ich kann deine Angst verstehen, Smoky. Du hast ein Kind verloren. Du weißt, dass es passieren kann. Herrgott, Bonnie wäre fast vor deinen Augen gestorben.« Eine sanfte Berührung, ihre Hand auf meiner. »Ich kann deine Angst sehr gut verstehen.«
»Aber sie macht mich schwach«, sage ich kläglich. »Angst ist Schwäche. Aber Bonnie braucht eine starke Beschützerin.«
Ich schlafe mit einer durchgeladenen Pistole in meinem Nachttisch. Das Haus ist bis unter die Decke voll mit Alarmanlagen. Und um den massiven Riegel an der Eingangstür zu durchtrennen, würde ein Eindringling eine ganze Stunde benötigen. Das alles hilft zwar ein wenig, kann die Angst aber nicht verbannen.
Elaina mustert mich mit einem scharfen Blick und schüttelt den Kopf. »Nein. Bonnie braucht deine Anwesenheit. Deine Liebe. Sie braucht eine Mutter, keine Superheldin. Die wirklichen Menschen sind nun mal kompliziert und im Allgemeinen nicht so, wie wir es uns wünschen, aber wenigstens sind sie da.«
Elaina ist die Frau von Alan, einem Mitglied meines FBI-Teams. Sie ist eine wunderschöne Latina mit melancholischen Augen und sanft geschwungenen Kurven. Doch ihre wahre Schönheit kommt aus dem Herzen. Sie besitzt eine resolute Sanftheit, die einem Schutz und Sicherheit, Liebe und Hingabe verspricht, alles zur gleichen Zeit.
Letztes Jahr haben die Ärzte bei ihr Dickdarmkrebs im zweiten Stadium diagnostiziert. Sie wurde operiert, der Tumor entfernt, gefolgt von Bestrahlungen und Chemotherapie. Sie hält sich tapfer, doch sie hat ihre Haare verloren, ihr dichtes, prachtvolles Haar. Sie trägt diesen Schicksalsschlag auf die gleiche Weise, wie ich meine Narben zu tragen gelernt habe: unverhüllt und für alle sichtbar. Ihr Kopf ist kahl, doch sie versteckt ihn nicht unter einer Bandana oder einem Hut. Doch ich frage mich, ob der Schmerz über diesen Verlust sie trotz ihrer Stärke manchmal aus heiterem Himmel trifft, so wie die Abwesenheit von Matt und Alexa mich bisweilen trifft.
Wahrscheinlich nicht. Für Elaina ist der Verlust ihrer Haare zweitrangig im Vergleich zu der Freude am Leben. Das macht einen Teil ihrer Stärke aus.
Elaina kam mich besuchen, nachdem Sands mir meine Familie genommen hatte. Sie platzte in mein Krankenzimmer, schob die Schwester beiseite und warf sich mit ausgebreiteten Armen über mich. Diese Arme umfingen mich und hielten mich wie Engelsflügel. Ich zersprang in diesen Armen, weinte Ewigkeiten an ihrer Brust. Sie war in diesem Moment meine Mutter und meine Retterin, und dafür werde ich sie immer lieben.
Sie drückt meine Hand. »Ich kann verstehen, dass du so empfindest, Smoky«, sagt sie. »Du könntest nur dann frei von Angst sein, würdest du Bonnie nicht so lieben, aber dazu ist es längst zu spät.«
Meine Kehle schnürt sich zusammen, und meine Augen brennen. Elaina hat recht. Diese Wahrheit ist hässlich und wunderbar und unabwendbar zugleich: Ich muss mit meiner Angst leben, weil ich Bonnie liebe. Ich müsste nur aufhören, sie zu lieben, und die Angst würde verschwinden.
So weit wird es nie kommen.
»Wird es irgendwann besser?«, frage ich sie und stoße einen entmutigten Seufzer aus. »Ich will nicht, dass Bonnie etwas davon merkt.«
Elaina nimmt meine Hände und betrachtet mich mit ihrem unerschütterlichen Blick. »Wusstest du eigentlich, dass ich ein Waisenkind war, Smoky?«
Ich blicke sie erstaunt an.
»Nein.«
Sie nickt. »Ich war Waise. Mein Bruder Manuel und ich, wir waren beide Waisenkinder. Mama und Papa starben bei einem Autounfall. Wir wurden von Abuela aufgezogen, meiner Großmutter. Eine großartige Frau. Ich meine das buchstäblich. Sie hatte wahre Größe. Sie hat sich nie beschwert, kein einziges Mal.« Ihr Lächeln wird melancholisch. »Und Manuel … er war ein wunderbarer Junge. Gutherzig und warm. Doch er war auch schwach. Er war immer der Erste, der sich eine Erkältung oder Grippe eingefangen hat und der Letzte, der wieder gesund wurde. Eines Tages im Sommer nahm Großmutter Abuela uns mit nach Santa Monica Beach. Manuel geriet in eine Unterströmung. Er starb.«
Ihre Worte sind schlicht und offen, doch ich kann den Schmerz dahinter spüren. Stiller Schmerz. Sie fährt fort: »Ich habe meine Eltern ohne jeden Grund verloren. Ich habe meinen Bruder an einem wunderschönen Sommertag verloren, und seine einzige Sünde bestand darin, dass er nicht kräftig genug strampeln konnte, um zurück an den Strand zu kommen.« Sie zuckt die Schultern. »Worauf ich hinauswill, Smoky … ich kenne deine Angst. Das Entsetzen, jemanden verlieren zu können, den man liebt.« Sie zieht die Hand weg und lächelt. »Und was tue ich? Ich verliebe mich in einen wunderbaren Mann, der eine gefährliche Arbeit macht, und liege nächtelang wach und habe Angst, nichts als Angst. Manchmal habe ich es an Alan ausgelassen. Ungerechtfertigt.«
»Ehrlich?« Es fällt mir schwer, das mit der Elaina in Einklang zu bringen, die ich kenne.
»Ehrlich. Manchmal denke ich nicht mal daran, dass ich Alan verlieren könnte, und schlafe wunderbar. Doch die Angst um ihn kommt immer wieder.«
»Warum hast du mir nie davon erzählt, dass du ein Waisenkind warst und deinen Bruder verloren hast?«
Sie zuckt die Schultern.
»Ich weiß nicht. Ich wollte es dir erzählen, damals, als du im Krankenhaus gelegen hast, habe es dann aber doch nicht getan.«
»Warum?«
»Du liebst mich, Smoky. Es hätte deinen Schmerz schlimmer gemacht, anstatt dir zu helfen.«
Sie hat recht.
Elaina lächelt. Es ist ein Lächeln, das viele Farben hat. Das Lächeln einer Frau, die weiß, dass sie das Glück hat, mit einem Mann verheiratet zu sein, den sie liebt, das Lächeln einer Mutter, die niemals eigene Kinder hatte, das Lächeln eines kahlen Rapunzels, das glücklich ist, am Leben zu sein.
Callie erscheint mit Bonnie an ihrer Seite. Beide mustern mich abschätzend.
»Sind wir bereit?«, fragt Callie. »können wir endlich anfangen?«
Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Na klar.«
»Erklär uns, was wir machen«, sagt Elaina.
»Also. Es ist ein Jahr her, seit Matt und Alexa gestorben sind. Seitdem ist viel passiert.« Ich schaue Bonnie an und lächle. »Nicht nur in meinem Leben. Ich vermisse sie immer noch,