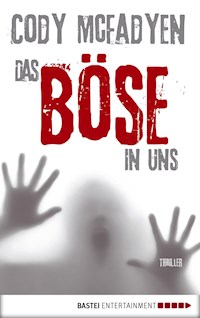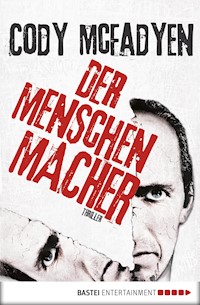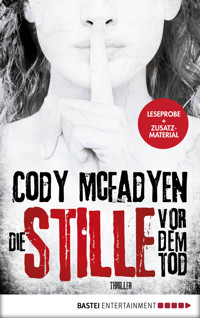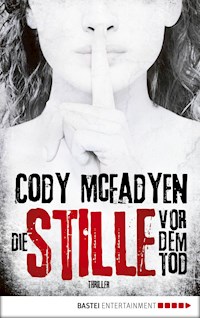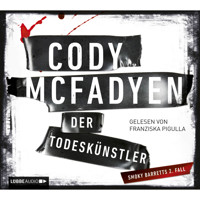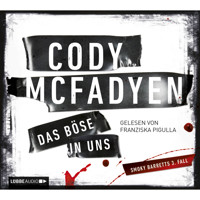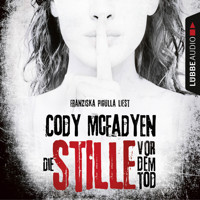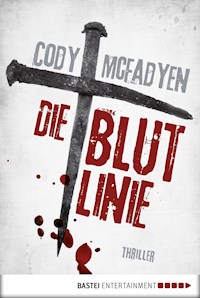
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Smoky Barrett
- Sprache: Deutsch
Er bezeichnet sich selbst als Nachfahren von Jack the Ripper ...
Nach dem Mord an einer Freundin folgt FBI-Agentin Smoky Barrett der Fährte des Killers. Doch die Spuren, die der eiskalte Serienmörder hinterlässt, sind so blutig, dass ihr ganzes Können gefragt ist. Die Zeit arbeitet gegen sie, und mit jedem neuen Verbrechen gelangt Smoky zu einer erschreckenden Erkenntnis: Der Mörder möchte sich einen Traum erfüllen - ein Traum, der für viele zum Albtraum werden könnte ...
Der erste Fall für Ermittlerin Smoky Barrett!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Danksagung
Teil I: Träume und Schatten
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil II: Träume und Konsequenzen
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Epilog
Fallakte Smoky Barrett
Über den Autor
Cody Mcfadyen, geboren 1968, unternahm als junger Mann mehrere Weltreisen und arbeitete danach in den unterschiedlichsten Branchen. Er ist verheiratet, Vater einer Tochter und lebt mit seiner Familie in Kalifornien. Die Blutlinie war sein erster Roman und sorgte weltweit für großes Aufsehen. Mit den Bestsellern »Der Todeskünstler«, »Das Böse in uns« und »Ausgelöscht« hat er die außergewöhnliche Thriller-Reihe um Smoky Barrett fortgesetzt. Weitere Romane mit der Protagonistin werden folgen.
Cody Mcfadyen
Die Blutlinie
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Shadowman«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2006 by Cody Mcfadyen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2006 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anita Krätzer
Umschlagmotiv: Shutterstock/Richard Griffin
Umschlaggestaltung: Manuela Städele; Christin Wilhelm
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0319-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Eltern, die mich ermutigten, in unbekannte
Gefilde aufzubrechen. Für meine Tochter, die mir das
Geschenk der Vaterschaft bereitete. Für meine Frau, der ich
für ihren unerschütterlichen Glauben, ihre fortwährende
Inspiration und ihre nie endende Liebe danke.
Danksagung
Diane O’ Connell sei herzlich für ihre redaktionelle Hilfe und ihre ständige Ermutigung gedankt; ferner Frederica Friedman für ihre unschätzbaren redaktionellen Ratschläge; Liza und Havis Dawson für ihren nimmermüden Einsatz für mich, zu dem einige großartige redaktionelle Hilfestellungen sowie tausend andere Dinge gehörten; Bill Massey, meinem Lektor bei Bantam Books; Nick Sayers, meinem Lektor bei Hodder; meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden, die mich in meinem Wunsch unterstützt haben, etwas zu schreiben. Und schließlich bedanke ich mich bei Stephen King für sein Buch Das Leben und das Schreiben. Es war sehr wichtig für mich und hat mir entscheidend dabei geholfen, meinen Schreibplan in die Tat umzusetzen.
Teil ITräume und Schatten
KAPITEL 1
Ich habe einen meiner Träume. Insgesamt sind es nur drei; zwei sind wunderschön, der dritte ist voller Gewalt. Alle drei lassen mich zitternd und allein zurück.
Der Traum heute Nacht handelt von meinem Mann. Er geht ungefähr so:
Ich könnte sagen, er küsst meinen Hals, und es dabei belassen, der Einfachheit halber. Doch das wäre eine Lüge, im grundlegendsten Sinn des Wortes.
Es wäre ehrlicher zu sagen, dass ich mich mit jeder Faser meines Wesens, mit jedem letzten, brennenden Zentimeter meines Selbst danach sehne, von ihm auf den Hals geküsst zu werden, und als er es tut, sind seine Lippen die eines Engels, gesandt vom Himmel, um meine fiebrigen Gebete zu erhören.
Ich war damals siebzehn, genau wie er. Es war eine Zeit, in der es noch keine Verbindlichkeit und keine Dunkelheit gab. Nur Leidenschaft, scharfe Kanten und ein Licht, das so hell brannte, dass es die Seele schmerzte.
Er beugte sich vor im Dämmerlicht des Kinos, und (o Gott) er zögerte für einen kurzen Moment, und (o Gott) ich erschauerte wie am Rand eines Abgrunds, obwohl ich tat, als wäre ich ruhig, und o Gott o Gott o Gott er küsste meinen Hals, und es war der Himmel, und ich wusste gleich dort und damals, dass ich für immer mit ihm zusammen sein wollte.
Er war der Eine für mich. Die meisten Leute, ich weiß, finden den Ihren nie. Sie lesen darüber, träumen davon oder spotten über die Vorstellung. Doch ich hatte den Meinen gefunden. Ich hatte ihn gefunden, als ich siebzehn war, und ich ließ ihn nie wieder gehen, nicht einmal an dem Tag, an dem er sterbend in meinen Armen lag, nicht einmal, als der Tod ihn mir entriss, während ich schrie und weinte, nicht einmal heute.
Gottes Name in diesen Tagen bedeutet Leiden. O Gott o Gott o Gott – ich vermisse ihn so.
Ich erwache mit der Präsenz jenes Kusses auf meiner siebzehn Jahre alten Haut und begreife, dass ich nicht siebzehn bin und dass er überhaupt nicht mehr altert. Der Tod hat ihn im Alter von fünfunddreißig Jahren konserviert, auf ewig. Für mich aber ist er immer siebzehn, beugt sich immer vor, berührt immer meinen Hals in jenem einen, vollkommenen Augenblick.
Ich strecke die Hand nach der Stelle aus, wo er eigentlich schlafen sollte, und ein Schmerz durchbohrt mich so plötzlich und schneidend, dass ich bete, während ich erzittere, um den Tod bete, um ein Ende der Schmerzen. Natürlich atme ich weiter, und bald lässt der Schmerz wieder nach.
Ich vermisse einfach alles von ihm in meinem Leben. Nicht nur die guten Dinge. Ich vermisse seine Fehler genauso schmerzhaft wie seine wunderbaren Seiten. Ich vermisse seine Ungeduld, seinen Ärger. Ich vermisse den herablassenden Blick, mit dem er mich manchmal angesehen hat, wenn ich wütend war auf ihn. Ich vermisse es, mich darüber zu ärgern, dass er ständig vergessen hat zu tanken und dass das Benzin immer fast aufgebraucht war, wenn ich irgendwohin wollte.
Das ist es, denke ich häufig, was einem nie in den Sinn kommt, wenn man darüber nachdenkt, wie es wäre, jemanden zu verlieren, den man liebt. Dass man nicht nur die Blumen und die Küsse vermisst, sondern die Gesamtheit der Erfahrungen. Man vermisst die Fehlschläge und die kleinen Missgeschicke mit genau der gleichen Verzweiflung, wie man es vermisst, mitten in der Nacht in den Armen gehalten zu werden. Ich wünschte, er wäre jetzt hier und ich könnte ihn küssen. Ich wünschte, er wäre jetzt hier und ich könnte ihn betrügen. Alles wäre mir recht, sehr recht, wenn er nur da wäre.
Manchmal, wenn sie den Mut aufbringen, fragen die Leute, wie es ist, jemanden zu verlieren, den man liebt. Ich antworte ihnen, dass es schwer ist, und belasse es dabei.
Ich könnte zu ihnen sagen, dass es wie eine innerliche Kreuzigung ist. Ich könnte ihnen erzählen, dass ich in den Tagen danach fast ohne Unterbrechung geweint habe, selbst während ich in der Stadt unterwegs war – auch wenn ich den Mund geschlossen hielt und kein Geräusch von mir gab. Ich könnte ihnen berichten, dass ich diesen Traum habe, jede Nacht, und dass ich ihn erneut verliere, jeden Morgen.
Aber warum sollte ich ihnen den Tag verderben? Also sage ich ihnen nur, dass es schwer ist. Das scheint sie in der Regel zufrieden zu stellen.
Es ist bloß einer von diesen Träumen, und er treibt mich aus dem Bett. Zitternd.
Ich starre in das leere Zimmer. Dann wende ich mich dem Spiegel zu. Ich habe begonnen, ihn zu hassen. Manche würden sagen, das ist normal. Dass wir uns alle unter das Mikroskop unserer Selbstbetrachtung legen und uns auf die Fehler konzentrieren. Wunderschöne Frauen schaffen sich Ärger- und Sorgenfalten, weil sie genau danach suchen. Teenager mit wunderschönen Augen und Figuren, für die manch einer sterben würde, weinen, weil ihr Haar die falsche Farbe hat oder weil sie glauben, ihre Nase sei zu groß. Diesen Preis zahlen wir, weil wir uns durch die Augen anderer richten, einer der Flüche der menschlichen Rasse. Und ich bin damit einverstanden.
Trotzdem sehen die meisten Menschen nicht das, was ich sehe, wenn sie in den Spiegel blicken. Wenn ich mich selbst betrachte, dann sehe ich das:
Ich habe eine zerklüftete Narbe, ungefähr einen Zentimeter breit, die mitten auf der Stirn an meinem Haaransatz beginnt. Sie verläuft senkrecht nach unten, dann biegt sie in einem nahezu perfekten 45°-Winkel nach links ab. Ich habe keine linke Augenbraue; die Narbe hat ihren Platz eingenommen. Sie überquert meine Schläfe, von wo aus sie in einer trägen Schleife hinunter zu meiner Wange verläuft. Von dort zieht sie sich zu meiner Nase, tippt an ihren Rücken und kehrt wieder um, läuft diagonal über meinen linken Nasenflügel, dann an meinem Kiefer vorbei am Hals nach unten und endet auf meinem Schlüsselbein.
Die Wirkung ist beachtlich. Wenn man mich nur von rechts sieht, scheint alles ganz normal. Man muss mich von vorn ansehen, um den Gesamteindruck zu erhalten.
Jeder schaut sich wenigstens einmal am Tag im Spiegel an. Oder er sieht den Eindruck von sich in den Blicken anderer. Und er weiß, womit er zu rechnen hat. Er weiß, was andere sehen werden, was wahrgenommen wird. Ich aber sehe nicht länger das, was ich zu sehen erwarte, sondern das Spiegelbild einer Fremden, die mich hinter einer Maske hervor anstarrt. Einer Maske, die ich nicht abnehmen kann.
Wenn ich nackt vor dem Spiegel stehe, wie jetzt, dann sehe ich auch den Rest. Ich trage eine Art Halsband aus runden, zigarrengroßen Narben, das sich von einem Schlüsselbein zum anderen zieht. Weitere gleichartige Narben bedecken meine Brüste und führen von dort hinunter über mein Brustbein und meinen Bauch bis zum Ansatz meiner Schamhaare.
Die Narben sind zigarrengroß, weil sie von einer Zigarre stammen.
Wenn man all das beiseite lassen würde, sähe es gar nicht so schlecht aus. Ich bin klein, eins fünfzig groß. Ich bin nicht dünn, aber in Form. Mein Mann nannte meine Figur immer »verlockend«. Außer wegen meines Wesens, meines Herzens und meiner Seele, so sagte er immer, habe er mich wegen meiner »mundgroßen Brüste und meines herzförmigen Hinterns« geheiratet. Und ich habe langes, dichtes, dunkles lockiges Haar, das bis unmittelbar über besagten Hintern reicht. Auch mein Haar mochte er.
Es fällt mir schwer, an diesen Narben vorbeizublicken. Ich habe sie hundertmal gesehen, vielleicht tausendmal. Sie sind immer noch alles, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel blicke. Sie stammen von dem Mann, der meinen Mann und meine Tochter getötet hat. Den später ich getötet habe.
Ich fühle eine überwältigende Leere in mich hineinströmen, wenn ich daran denke. Sie ist riesig, dunkel und absolut empfindungslos. Es ist, als würde man in ein betäubendes Gelee sinken.
Keine große Sache. Ich bin daran gewöhnt. So ist mein Leben heute eben.
Ich schlafe nicht länger als zehn Minuten, und ich weiß, dass ich heute Nacht nicht wieder einschlafen werde.
Ich erinnere mich, wie ich vor ein paar Monaten tief in der Nacht aufgewacht bin, einfach so. Diese Zeit zwischen halb vier und sechs Uhr morgens, wenn man sich fühlt, als wäre man der einzige Mensch auf der Erde – falls man zufällig auf ist. Ich hatte, wie immer, einen von meinen Träumen geträumt, und wusste, dass ich nicht wieder einschlafen würde.
Ich zog ein T-Shirt an und eine Jogginghose, schlüpfte in meine alten Turnschuhe und ging nach draußen. Ich rannte und rannte durch die Nacht, rannte, bis mein Körper nass war vor Schweiß, bis der Schweiß meine Kleidung durchtränkte und die Turnschuhe füllte, und rannte weiter. Ich schonte meine Kräfte nicht, und mein Atem ging schnell. Meine Lungen fühlten sich an wie vereist durch die Kühle der morgendlichen Luft. Aber ich hielt nicht an. Ich rannte schneller. Arme und Ellbogen pumpten, und ich rannte, so schnell ich konnte, ohne mich um irgendetwas zu kümmern.
Ich landete vor einem jener Bedarfsartikelläden, die das Tal füllen, am Straßenrand, wo ich Magensäure hochwürgte und nach Luft rang. Zwei andere morgendliche Geister starrten zu mir herüber, dann wandten sie die Blicke ab. Ich richtete mich auf, wischte mir über den Mund und stieß die Tür zum Laden auf.
»Eine Packung Zigaretten bitte«, sagte ich zu dem Inhaber, noch immer völlig außer Atem. Er war Mitte fünfzig, vermutlich ein Inder.
»Welche Marke möchten Sie?«
Die Frage verblüffte mich. Ich hatte seit Jahren nicht mehr geraucht. Ich starrte auf die Reihen hinter ihm, und mein Blick blieb an den früher geliebten Marlboros hängen.
»Marlboros. Rote.«
Er legte eine Packung vor mir auf den Tresen und tippte den Preis in seine Registrierkasse. In diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich in Joggingsachen unterwegs war und kein Geld bei mir hatte. Statt verlegen zu sein, reagierte ich wütend.
»Ich hab meinen Geldbeutel vergessen«, sagte ich mit trotzig vorgerecktem Kinn. Provozierend. Ich forderte ihn heraus, mir die Zigaretten nicht zu geben oder mich auf irgendeine Weise lächerlich zu machen.
Er musterte mich einen Moment lang. Es war wohl das, was Schriftsteller eine »prägnante Pause« nennen. Dann entspannte er sich.
»Sie waren laufen?«, fragte er.
»Ja. Bin davongelaufen vor meinem toten Mann. Vermutlich besser, als mich umzubringen, ha-ha.«
Die Worte klangen merkwürdig in meinen Ohren. Ein wenig laut, ein wenig erstickt. Ich nehme an, ich war ein wenig verrückt. Doch statt zusammenzuzucken oder mir einen unbehaglichen Blick zuzuwerfen, den ich mir so sehr wünschte in jenem Moment, wurden seine Augen weich. Nicht vor Mitleid, sondern vor Verständnis. Er nickte und reichte mir die Packung Zigaretten über den Tresen, damit ich sie nahm.
»Meine Frau in Indien gestorben. Eine Woche, bevor wir nach Amerika gehen. Sie nehmen Zigaretten, bezahlen nächste Mal.«
Ich stand kurz da und starrte ihn an. Dann schnappte ich die Zigaretten, drehte mich um und rannte nach draußen, so schnell ich konnte, bevor die Tränen über meine Wangen liefen. Ich umklammerte die Packung Zigaretten und rannte weinend nach Hause.
Der Laden liegt ein wenig abseits für mich, aber ich gehe nie mehr irgendwo anders hin, wenn ich Zigaretten haben will.
Ich setze mich auf und lächle schwach, als ich die Schachtel Zigaretten auf dem Nachttisch sehe. Ich muss an den Typ im Laden denken, während ich mir eine anstecke. Ich schätze, ein Teil von mir liebt diesen kleinen Mann – auf die Weise, wie man nur einen Fremden lieben kann, der einem eine wunderbare Freundlichkeit erweist in genau dem Augenblick, in dem man sie am dringendsten braucht. Es ist eine tiefe Zuneigung, ein Stich im Herzen, und ich weiß, dass ich mich bis zu meinem Tod an ihn erinnern werde, auch wenn ich seinen Namen niemals erfahre.
Ich inhaliere einen hübschen tiefen Zug und betrachte die Zigarette, die perfekte kirschrote Spitze, die im Dunkel meines Schlafzimmers leuchtet. Das, denke ich, ist das Heimtückische an all den verbotenen Dingen. Nicht die Nikotinsucht, obwohl sie schon schlimm genug ist. Eher die Art und Weise, wie eine Zigarette in bestimmten Momenten einfach passt. Morgendämmerung mit einer dampfenden Tasse Kaffee. Oder einsame Nächte in einem Haus voller Geister. Ich weiß, dass ich wieder aufhören sollte damit, bevor sie ihre Klauen ein weiteres Mal tief in mich versenken. Doch ich weiß auch, dass ich das nicht tun werde. Sie sind alles, was ich im Moment noch habe. Eine Erinnerung an Freundlichkeit und Trost und ein Quell der Kraft, alles in einem kleinen weißen Stängel zusammengerollt.
Ich atme den Rauch aus und beobachte, wie er nach oben steigt, hier und da von winzigen Luftströmungen erfasst, bevor er immer dünner wird und schließlich verschwindet. Wie das Leben, denke ich. Leben ist wie Rauch. Wir machen uns nur etwas vor, wenn wir glauben, dass es anders ist. Es genügt eine kräftige Böe, und wir schweben davon und lösen uns auf, und zurück bleibt nichts außer einem Hauch unserer Existenz in Form von Erinnerungen.
Ich huste unvermittelt und lache angesichts all der Assoziationen. Ich rauche. Das Leben ist Rauch, und mein Name ist Smoky. Smoky Barrett. Das ist tatsächlich mein Name. Meine Mutter hat ihn mir gegeben, weil sie fand, er klinge »cool«. Ich muss kichern in der Dunkelheit, in meinem leeren Haus. Und während ich lache, denke ich (wie schon früher), wie verrückt Lachen klingt, wenn man ganz allein lacht.
Das gibt mir für die nächsten drei oder vier Stunden etwas zum Nachdenken. Die Frage, ob ich verrückt bin, meine ich. Schließlich ist morgen der Tag.
Der Tag, an dem ich entscheide, ob ich wieder zu meiner Arbeit beim FBI zurückkehre oder ob ich nach Hause gehe, mir eine Pistole in den Mund stecke und mir das Gehirn wegblase.
KAPITEL 2
»Haben Sie immer noch die gleichen drei Träume?«
Das ist einer der Gründe, warum ich meinem Seelenklempner vertraue, den man mir verordnet hat. Er macht keine Gedankenspielchen, tanzt nicht um die Dinge herum und versucht nicht, sich an mich heranzuschleichen und mich in die Enge zu treiben. Er geht geradewegs auf den Kern des Problems zu, ein direkter Angriff. So sehr ich mich beschwere und mich gegen seine Heilungsversuche wehre, das respektiere ich.
Er heißt Peter Hillstead und ist vom Aussehen her so ziemlich das genaue Gegenteil vom Freud’schen Stereotyp. Er ist ungefähr eins achtzig groß, hat dunkles Haar, ein attraktives Model-Gesicht und einen Körper, der mich bereits bei unserer ersten Begegnung erstaunt hat. Am beeindruckendsten sind jedoch seine Augen. Sie sind von einem derart leuchtenden Blau, wie ich es vorher noch nie bei jemand Brünettem gesehen habe.
Doch obwohl er wie ein Filmschauspieler aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei diesem Mann zu einer Übertragung kommt. Wenn man bei ihm ist, denkt man nicht an Sex. Man denkt an sich selbst. Er ist einer von jenen seltenen Menschen, die sich wirklich um diejenigen kümmern, mit denen sie es zu tun haben. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel, wenn man bei ihm ist. Wenn man ihm etwas erzählt, hat man nie das Gefühl, dass er mit den Gedanken woanders ist. Er schenkt einem seine volle Aufmerksamkeit. Er gibt einem das Gefühl, dass man das Einzige ist, was in seiner kleinen Praxis zählt. Das ist es, was es mir unmöglich macht, mich in diesen wunderbaren Therapeuten zu verlieben. Wenn man bei ihm ist, sieht man ihn nicht als Mann, sondern als etwas sehr viel Wertvolleres: als Spiegel der Seele.
»Die gleichen drei«, antworte ich.
»Welchen hatten Sie gestern Nacht?«
Ich rutsche ein wenig unbehaglich auf meinem Stuhl hin und her. Ich weiß, dass er es bemerkt, und ich frage mich, was es seiner Meinung nach über mich verrät. Ich bin ständig am kalkulieren und abwägen. Ich kann nichts dagegen tun.
»Den, in dem Matt mich küsst.«
Er nickt. »Konnten Sie hinterher wieder einschlafen?«, will er wissen.
»Nein.« Ich starre ihn an und sage nichts weiter, während er wartet. Heute ist keiner meiner kooperativen Tage.
Dr. Hillstead sieht mich an, das Kinn in der Hand. Er scheint über irgendetwas nachzudenken, wie ein Mann an einer Weggabelung. Welchen Weg auch immer er von hier aus einschlägt, es gibt keinen Weg zurück. Fast eine Minute vergeht, bevor er sich seufzend zurücklehnt und seinen Nasenrücken massiert.
»Smoky, wussten Sie, dass ich unter meinen Kollegen keinen besonderen Ruf als Therapeut genieße?«
Ich zucke zusammen bei seinen Worten, sowohl wegen der Vorstellung als auch wegen der Tatsache, dass er mir überhaupt davon erzählt. »Äh, nein. Das wusste ich nicht.«
Er lächelt. »Es stimmt. Ich vertrete einige kritische Standpunkte gegenüber meinem Berufsstand. Der wichtigste ist der, dass wir meiner Meinung nach über keine wirklich wissenschaftliche Lösung für die Probleme der menschlichen Seele verfügen.«
Was zur Hölle soll ich darauf erwidern? Mein Seelenklempner erzählt mir, dass der von ihm gewählte Beruf keine wirklichen Lösungen für psychische Probleme bereithält? Das klingt nicht gerade vertrauenerweckend. »Ich kann mir vorstellen, dass solch eine Ansicht auf Widerstand stößt«, sage ich. Es ist die beste Antwort, die mir auf die Schnelle einfällt.
»Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass ich denke, wir hätten überhaupt keine Lösungen für psychische Probleme.«
Und das, glaube ich, ist ein weiterer der Gründe, warum ich meinem Therapeuten vertraue. Er besitzt einen rasiermesserscharfen Verstand, bis hin zu dem Punkt des Hellsehens. Es schüchtert mich nicht ein. Ich verstehe es. Jeder wirklich begabte Verhörspezialist besitzt diese Fähigkeit. Vorauszuahnen, was sein Gegenüber über das denkt, was man zu ihm sagt.
»Nein. Was ich meine, ist Folgendes: Wissenschaft ist Wissenschaft. Sie ist exakt. Gravitation bedeutet, wenn Sie etwas fallen lassen, dann fällt es auch. Immer. Zwei plus zwei ist immer vier. Nicht-Varianz ist das Wesen jeder Wissenschaft.«
Ich denke darüber nach und nicke.
»Und was macht mein Berufsstand angesichts dieser Tatsache?« Er gestikuliert. »Welche Haltung nehmen wir gegenüber der Seele und ihren Problemen ein? Keine wissenschaftliche – zumindest noch nicht. Wir sind noch nicht bei zwei plus zwei angekommen. Wären wir das, würde ich jeden Patienten heilen, der durch diese Tür hereinkommt. Ich würde wissen, dass ich im Fall von Depressionen gemäß A, B und C vorgehen muss, und es würde immer funktionieren. Es würde Gesetzmäßigkeiten geben, die sich niemals ändern, und das wäre Wissenschaft.« Er lächelt nun; es ist ein ironisches Lächeln. Vielleicht ein wenig traurig. »Doch ich heile nicht jeden Patienten. Nicht einmal die Hälfte.« Er verstummt kurz, dann schüttelt er den Kopf. »Was ich tue, meine Arbeit, ist keine Wissenschaft. Es ist eine Ansammlung von Methoden, die man ausprobieren kann und von denen die meisten auch in früheren Fällen schon mehr als einmal funktioniert haben. Und weil das so ist, lohnt es sich, sie erneut anzuwenden. Das ist allerdings auch schon alles. Ich habe begonnen, diese Meinung in der Öffentlichkeit zu vertreten, und daher … genieße ich bei vielen meiner Standeskollegen nicht den besten Ruf.«
Ich denke eine Weile über seine Worte nach, während er wartet. »Ich glaube, ich verstehe den Grund«, sage ich. »In einigen Bereichen des FBI geht es heutzutage mehr um das Image und weniger um die Resultate. Wahrscheinlich ist es bei Ihren Kollegen, die Sie nicht mögen, genauso.«
Er lächelt erneut, diesmal ist es ein müdes Lächeln. »Pragmatisch gleich zum Kern der Sache, wie immer, Smoky. Zumindest bei den Dingen, die Sie nicht selbst betreffen.«
Ich zucke bei diesen Worten innerlich zusammen. Es ist eine von Dr. Hillsteads Lieblingstechniken, eine normale Unterhaltung als Deckmantel für die seelenenthüllenden Bemerkungen zu benutzen, die er so ganz nebenbei gegen einen abfeuert. Wie die kleine Scud-Rakete, die er soeben in meine Richtung geschossen hat. Du hast einen messerscharfen Verstand, Smoky, besagen seine Worte, aber du benutzt ihn nicht, um deine eigenen Probleme zu lösen. Autsch. Die Wahrheit schmerzt.
»Und doch bin ich hier, trotz allem, was andere von mir denken mögen. Einer der vertrauenswürdigsten Therapeuten, wenn es um Fälle geht, die FBI-Agents betreffen. Was glauben Sie, warum das so ist?«
Er sieht mich erneut an, abwartend. Ich weiß, dass er auf irgendetwas hinauswill. Dr. Hillstead sagt nie etwas Unüberlegtes. Also denke ich darüber nach.
»Wenn ich raten müsste«, erwidere ich, »dann würde ich raten, dass es so ist, weil Sie gut sind. Gut sein zählt immer mehr als gut wirken, jedenfalls bei meiner Sorte Arbeit.«
Erneut dieses leichte Lächeln.
»Das ist richtig. Ich bringe Resultate. Das ist nichts, womit ich hausieren gehe, und ich klopfe mir deswegen nicht jeden Abend vor dem Schlafengehen auf die Schulter. Doch es ist die Wahrheit.«
Er sagt das im einfachen, überhaupt nicht arroganten Tonfall eines vollendeten Profis. Ich verstehe ihn sehr gut. Es geht nicht um Bescheidenheit. In einer taktischen Situation, wenn man jemanden fragt, ob er gut umgehen kann mit einer Waffe, will man eine ehrliche Antwort. Wenn dein Partner schlecht schießt, dann willst du es wissen, und dein Partner will, dass du es weißt, weil eine Kugel den Lügner genauso schnell tötet wie den ehrlichen Mann. Wenn es hart auf hart geht, musst du die Wahrheit über die Stärken und Schwächen deiner Partner kennen. Ich nicke, und er fährt fort.
»Das ist es, worauf es in jeder militärischen Organisation ankommt. Ob man Resultate bringt. Halten Sie es für eigenartig, dass ich das FBI als militärische Organisation betrachte?«
»Nein. Wir sind im Krieg.«
»Wissen Sie, was das größte Problem jeder militärischen Organisation ist, immer?«
Ich fange an mich zu langweilen und werde unruhig. »Keine Ahnung.«
Er sieht mich missbilligend an. »Denken Sie nach, bevor Sie antworten, Smoky. Bitte verschwenden Sie nicht unnötig meine Zeit.«
Abgestraft gehorche ich. Ich spreche langsam, als ich endlich etwas sage. »Vermutlich … das Personal?«
Er richtet einen Finger auf mich. »Bingo! Und … warum?«
Die Antwort springt mich an, wie es manchmal passiert, wenn ich an einem Fall arbeite, wenn ich wirklich richtig nachdenke. »Wegen der Dinge, die wir sehen.«
»M-hm. Das gehört dazu. Ich nenne es Sehen-Handeln-Verlieren. Was man sieht, wie man handelt, was man verliert. Es ist ein Triumvirat.« Er zählt es an seinen Fingern ab. »Wenn man für das Gesetz arbeitet, sieht man die schlimmsten Dinge, zu denen menschliche Wesen fähig sind. Man tut Dinge, die kein Mensch tun müssen sollte, angefangen mit dem Anfassen verwesender Leichen bis – in einigen Fällen – hin zum Töten anderer Menschen. Und man verliert Dinge, ob sie unfassbar sind wie die Unschuld oder der Optimismus, oder ob sie real sind wie ein Partner oder … die Familie.«
Er mustert mich mit einem Blick, den ich nicht zu deuten vermag. »Und das ist der Punkt, an dem ich ins Spiel komme. Ich bin genau wegen dieses Problems hier. Und dieses Problem hindert mich auch daran, meine Arbeit so zu tun, wie sie getan werden sollte.«
Jetzt bin ich ebenso verwirrt wie interessiert. Ich sehe ihn an, um ihm zu signalisieren fortzufahren, und er seufzt. Es ist ein Seufzen, das sein eigenes »Sehen-Handeln-Verlieren« zu enthalten scheint, und ich frage mich, was für Leute sonst noch alles ihm gegenüber sitzen, hier auf diesem Stuhl. Welchen anderen Qualen er lauscht und mit zu sich nach Hause nimmt, wenn er geht.
Ich versuche mir das vorzustellen, während ich ihn ansehe. Dr. Hillstead, wie er zu Hause sitzt. Ich kenne die wichtigsten Daten, habe ihn flüchtig überprüft. Nie verheiratet, wohnt in einem zweistöckigen Fünfzimmerhaus in Pasadena. Fährt einen Audi Sport Kombi. – Der Doc mag es ein wenig schnell, ein Hinweis auf einen Teil seiner Persönlichkeit. Doch das sind alles nur leere Fakten. Nichts, das einem wirklich verraten könnte, was passiert, wenn er durch die Vordertür seines Hauses tritt und sie hinter sich schließt. Ist er ein Mikrowellen-Junggeselle? Oder brät er sich Steaks, trinkt Rotwein und sitzt allein an einem makellos gedeckten Tisch, während im Hintergrund Vivaldi spielt? Hey, vielleicht kommt er ja nach Hause, schlüpft in ein paar hochhackige Schuhe und trägt dazu nichts anderes und macht die Hausarbeit, mit haarigen Beinen und allem.
Ich erwärme mich an diesem Gedanken, ein wenig heimlicher Humor. Ich nehme mir meine Lacher, wo ich sie kriegen kann in diesen Tagen. Dann zwinge ich mich wieder zur Konzentration auf das, was er zu mir sagt.
»In einer normalen Welt würde jemand, der das Gleiche durchgemacht hat wie Sie, Smoky, niemals wieder zurückfinden. Wären Sie ein durchschnittlicher Mensch in einem durchschnittlichen Beruf, würden Sie sich in Zukunft von Waffen, Mördern und Leichen fern halten, und zwar für immer. Doch meine Aufgabe besteht darin herauszufinden, ob ich Ihnen dabei helfen kann, bereit zu sein, zu alldem zurückzukehren. Das wird von mir erwartet. Verwundete Seelen aufzufangen und wieder zurück in den Krieg zu schicken. Klingt vielleicht melodramatisch, ist aber wahr.«
Jetzt beugt er sich vor, und ich spüre, dass wir uns dem entscheidenden Punkt nähern, auf den er hinauswill.
»Wissen Sie, warum ich bereit bin, daran zu arbeiten? Obwohl ich weiß, dass ich jemanden in die gleiche Sache zurückschicke, die ihn so schwer verwundet hat?« Er zögert. »Weil es das ist, was neunundneunzig Prozent meiner Patienten wollen.«
Er massiert sich erneut den Nasenrücken und schüttelt den Kopf.
»Die Männer und Frauen, die ich sehe, ausnahmslos psychisch schwer verwundet, wollen von mir geheilt werden, damit sie wieder zurück in die Schlacht können. Und die Wahrheit ist, dass – was auch immer Leute wie Sie die meiste Zeit über antreiben mag – zurückzukehren genau das ist, was Sie brauchen. Wissen Sie, was mit den meisten von denen passiert, die nicht zurückkehren? Manchmal kommen sie ganz gut zurecht. Die meiste Zeit trinken sie. Und immer wieder bringt sich der eine oder andere um.«
Er sieht mich an, während er die letzten Worte spricht, und ich fühle mich plötzlich verfolgt und frage mich, ob er meine Gedanken lesen kann. Ich habe keine Ahnung, wohin das führen soll. Es bringt mich aus dem Gleichgewicht, irritiert mich und vermittelt mir ein ziemlich unbehagliches Gefühl. Und all das ärgert mich. Meine Antwort auf Unbehagen ist ganz und gar irisch, das stammt von meiner Mutter – ich werde sauer und gebe der anderen Person die Schuld dafür.
Er greift über seinen Schreibtisch nach links und nimmt einen dicken Ordner zur Hand, der mir vorher nicht aufgefallen ist. Er legt ihn vor sich hin und schlägt ihn auf. Ich blinzle angestrengt und erkenne überrascht, dass mein Name auf dem Einband steht.
»Das ist Ihre Personalakte, Smoky. Ich habe sie seit einiger Zeit hier liegen, und ich habe sie mehr als einmal gelesen.« Er blättert die Seiten um und fasst laut zusammen. »Smoky Barrett, geboren 1968. Weiblich. Abschluss in Kriminologie. 1990 ins FBI aufgenommen. Abschluss als Jahrgangsbeste in Quantico. 1991 dem Black-Angel-Fall in Virginia zugewiesen, administrative Fähigkeiten.« Er blickt auf und sieht mich an. »Aber Sie sind dort nicht am Spielfeldrand geblieben, nicht wahr?«
Ich denke zurück und schüttele den Kopf. Natürlich hab ich mich nicht zurückgehalten. Ich war zweiundzwanzig Jahre alt, grüner als grün. Aufgeregt darüber, endlich eine Agentin zu sein, und noch aufgeregter angesichts der Tatsache, an einem großen Fall mitzuarbeiten, selbst wenn ich hauptsächlich die Schreibtischarbeit erledigen musste. Während eines der Briefings war mir etwas zum Fall im Gedächtnis haften geblieben, ein Detail in einer Zeugenaussage, das nicht zu stimmen schien. Ich wälzte es immer noch im Kopf herum, als ich schlafen ging, und erwachte um vier Uhr morgens mit einer Erleuchtung – etwas, das mir im Laufe der Zeit vertraut werden sollte. Meine plötzliche Erkenntnis gab dem Fall eine ganz neue Wendung. Es ging darum, in welche Richtung sich ein bestimmtes Fenster öffnete. Ein winziges, übersehenes Detail war zur Erbse unter meiner Matratze geworden, und es führte dazu, dass ein Mörder hinter Schloss und Riegel kam.
Damals habe ich es als Glück bezeichnet und meinen Beitrag heruntergespielt. Echtes Glück war, dass der Leiter der Task Force, Special Agent Jones, einer von diesen ganz seltenen Chefs war. Einer, der nicht allen Ruhm an sich reißt, sondern ehrt, wem Ehre gebührt. Auch wenn es sich dabei um eine völlig unerfahrene Agentin handelt. Ich war immer noch neu, also bekam ich noch mehr Schreibtischarbeit, doch von diesem Zeitpunkt an war ich auf der Überholspur. Unter dem wachsamen Auge von Special Agent Jones wurde ich für das CASMIRC ausgebildet, für das Child Abduction and Serial Murder Investigative Ressources Center, das sich mit Kindesentführung und Serienmorden befasst.
»Drei Jahre später zum CASMIRC versetzt. Das ist ein ziemlicher Karrieresprung, nicht wahr?«
»Der durchschnittliche Agent beim CASMIRC hat vorher zehn Jahre lang fürs FBI gearbeitet.« Ich prahle nicht. Es stimmt. Er liest weiter.
»Eine Reihe weiterer Fälle gelöst, phantastische Beurteilungen. Und dann, 1996, wurden Sie zur Leiterin der CAS-MIRC-Zweigstelle in Los Angeles ernannt. Und da fingen Sie erst richtig an zu glänzen.«
Meine Gedanken wandern zurück zu jener Zeit. »Glänzen« ist genau das richtige Wort. 1996 war ein Jahr, wo nichts, aber auch überhaupt nichts schief ging. Ich hatte meine Tochter 1995 bekommen. Dann wurde ich zum L . A .-Büro versetzt, ein gewaltiger Karrieresprung. Und Matt und mir ging es gut, genauso gut wie immer. Es war eines von jenen Jahren, in denen ich jeden Morgen ausgeruht und voller Tatendrang aufwachte.
Das war damals, als ich meine Hand ausstrecken und ihn spüren konnte, dort, wo er sein sollte.
Es war alles so, wie es im Hier und Jetzt nicht ist, und ich merke, dass ich auf Dr. Hillstead zornig werde, weil er mich daran erinnert hat. Und weil er die Gegenwart noch leerer und schwärzer wirken lässt, als sie es ohnehin schon ist.
»Worauf wollen Sie hinaus?«
Er hebt eine Hand. »Einen Moment noch. Die Leistung des Büros in Los Angeles war nicht gut. Man gab Ihnen freie Hand, es personell neu zu besetzen, und Sie haben drei Agenten aus Abteilungen in unterschiedlichen Teilen der Vereinigten Staaten zu sich geholt. Damals fand man Ihre Wahl ungewöhnlich. Doch am Ende hat sie sich als gut erwiesen, stimmt’s?«
Das, denke ich, ist eine Untertreibung. Ich nicke nur, immer noch ägerlich.
»Tatsächlich ist Ihr Team eines der besten in der Geschichte des FBI, nicht wahr?«
»Es ist das beste.« Ich kann nicht anders. Ich bin stolz auf mein Team, und ich bin außerstande, mich bescheiden zu geben, wenn das Gespräch auf mein Team kommt. Außerdem ist es die Wahrheit.
»Richtig.« Er blättert ein paar Seiten weiter. »Jede Menge gelöster Fälle. Weitere hervorragende Beurteilungen. Einige Bemerkungen, dass Sie als erster weiblicher Acting Director überhaupt in Betracht gezogen wurden. Eine historische Sensation.«
All das entspricht der Wahrheit. Und es macht mich noch ärgerlicher. Den Grund dafür begreife ich nicht. Ich weiß nur, dass ich sauer bin, innerlich zu kochen beginne, und wenn das so weitergeht, dann werde ich explodieren.
»Noch etwas in Ihrer Akte hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Anmerkungen über Ihre Schießkunst.«
Er blickt zu mir hoch, und ich fühle mich, als wäre er mir von hinten in den Rücken gefallen, und ich habe nicht die geringste Ahnung, warum. Irgendetwas rührt sich in mir, und ich merke, dass es Angst ist. Ich umklammere die Lehnen meines Stuhls, während er fortfährt.
»In Ihrer Akte steht, dass Sie mit der Handfeuerwaffe wahrscheinlich zu den besten Schützen der Welt zählen. Stimmt das, Smoky?«
Ich starre meinen Therapeuten an und spüre, wie in mir alles taub wird. Die Wut verebbt.
Ich und die Pistolen. Alles, was er sagt, ist wahr. Ich kann eine Waffe nehmen und damit schießen, wie andere Leute ein Glas Wasser trinken oder Fahrrad fahren. Es ist instinktiv, und es war schon immer so. Es gibt keine Begründung dafür. Ich hatte keinen Vater, der eigentlich einen Sohn wollte und mir deswegen im Kindesalter beibrachte, wie man schießt. Im Gegenteil, Dad hasste Waffen. Ich konnte einfach schießen. Von Anfang an.
Ich war acht Jahre alt, und mein Dad hatte einen Freund, der als Green Beret in Vietnam gewesen war. Er war ein Waffennarr. Er wohnte in einer heruntergekommenen Eigentumswohnung in einer heruntergekommenen Gegend im San Fernando Valley – was zu ihm passte, weil auch er selbst heruntergekommen war. Trotzdem erinnere ich mich bis heute an seine Augen. Scharf und jung. Glitzernd.
Sein Name war Dave. Irgendwie gelang es ihm, meinen Vater zu einem Schießplatz in einer etwas anrüchigen Gegend im San Bernardino County mitzuschleppen, und mein Dad nahm mich mit – vielleicht in der Hoffnung, den Ausflug kurz zu halten. Dave brachte meinen Dad dazu, ein paar Magazine zu verschießen. Ich stand daneben und sah zu, mit Ohrenschützern, die zu groß waren für meinen kleinen Mädchenkopf. Ich beobachtete die beiden, wie sie die Waffen hielten, und war fasziniert. Hingerissen.
»Darf ich auch mal?«, fragte ich.
»Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Süße«, entgegnete mein Dad.
»Ach, komm schon, Rick. Ich gebe ihr eine kleine Kaliber zweiundzwanzig. Lass sie doch ein paar Schuss abfeuern.«
»Bitte, Daddy?« Ich blickte mit meinem flehendsten Blick zu meinem Vater auf, einem Blick, von dem ich sogar mit acht Jahren schon wusste, dass ich ihn damit rumkriegen konnte. Er schaute zu mir herab, und in seinem Gesicht spiegelten sich die widersprüchlichen Gefühle. Dann seufzte er.
»Also gut. Aber nur ein paar Schuss.«
Dave ging die Zweiundzwanzig holen, ein winzig kleines Ding, das in meine Hand passte, und sie organisierten einen Hocker für mich, auf dem ich stehen konnte. Dave lud die Waffe und drückte sie mir in die Hand. Dann trat er hinter mich, während mein Dad mich besorgt beobachtete.
»Siehst du die Zielscheibe da hinten?« Ich nickte. »Als Erstes musst du entscheiden, wo du treffen möchtest. Nimm dir Zeit. Wenn du abdrückst, mach es langsam. Nicht zucken, oder du schießt daneben. Bist du so weit?«
Ich nickte. In Wirklichkeit hatte ich ihm kaum zugehört. Ich hatte die Waffe in der Hand, und irgendetwas in mir klickte. Es fühlte sich gut an. Es passte. Ich blickte die Schießbahn hinunter auf die menschenförmige Zielscheibe, und sie schien überhaupt nicht weit weg zu sein. Sie wirkte sehr nah, erreichbar. Ich richtete die Waffe darauf, atmete einmal durch und drückte ab.
Ich war verblüfft und aufgepeitscht vom Rucken der kleinen Pistole in meinen Kinderhänden.
»Verdammt!«, hörte ich Dave jubeln.
Ich blinzelte erneut in Richtung Zielscheibe und sah, dass mitten im Kopf ein winziges Loch erschienen war, genau da, wo ich es hatte haben wollen.
»Vielleicht bist du ein Naturtalent, junge Lady«, sagte Dave zu mir. »Versuch noch ein paar.«
Die »noch ein paar« wurden zu einer eineinhalbstündigen Schießübung. Ich traf mehr als neunzig Prozent meiner Ziele, und als wir aufhörten, wusste ich, dass ich für den Rest meines Lebens schießen würde. Und dass ich gut darin war.
Mein Dad unterstützte mein Hobby in den folgenden Jahren, trotz seiner Abneigung gegen Waffen. Wahrscheinlich begriff er, dass es ein Teil von mir war; etwas, wovon er mich nicht würde abhalten können.
Die Wahrheit? Ich bin unheimlich gut. Ich behalte es für mich und gebe nicht öffentlich damit an. Doch wenn ich für mich bin? Ich bin eine Annie Oakley. Ich kann Kerzenflammen ausschießen und in die Luft geworfene Münzen durchlöchern. Einmal, auf einem Freiluft-Schießstand, habe ich mir einen Pingpongball auf den Rücken der Schusshand gelegt, die Hand, mit der ich auch die Waffe ziehe. Und dann habe ich gezogen und die Waffe abgefeuert und den Pingpongball getroffen, noch bevor er den Boden berühren konnte. Ein alberner Trick, sicher, aber es war eine sehr befriedigende Erfahrung.
All das geht mir durch den Kopf, während Dr. Hillstead mich beobachtet.
»Es stimmt«, antworte ich.
Er klappt die Akte zu. Verschränkt die Hände und sieht mich an. »Sie sind eine außergewöhnliche Agentin. Ganz sicher eine der besten Agentinnen in der Geschichte des FBI. Sie jagen die Schlimmsten der Schlimmen. Vor sechs Monaten hat sich ein Mann, den Sie gejagt haben, Joseph Sands, gegen Sie und Ihre Familie gewandt. Er hat Ihren Mann vor Ihren Augen erschossen, hat Sie vergewaltigt und gefoltert und Ihre Tochter umgebracht. Durch eine Anstrengung, die man nur als übermenschlich bezeichnen kann, haben Sie die Situation umgedreht und Sands getötet.«
Ich bin inzwischen ganz von Taubheit eingehüllt. Ich weiß nicht, worauf das alles hinauslaufen soll, und es ist mir auch gleichgültig.
»Und hier bin ich nun, mit einem Beruf, in dem zwei plus zwei nicht immer vier ergibt und die Dinge nicht immer zu Boden fallen, wenn man sie loslässt, und versuche, Ihnen dabei zu helfen, zu alledem zurückzukehren.«
Der Blick, mit dem er mich ansieht, ist so voll von aufrichtigem Mitgefühl, dass ich wegsehen muss; die Emotionen darin drohen mich zu verbrennen.
»Ich mache meine Arbeit schon seit langer Zeit, Smoky. Und Sie kommen nun schon seit einer ganzen Weile zu mir. Ich habe mit den Jahren ein Gefühl für bestimmte Dinge entwickelt. – Sie würden es wahrscheinlich als sechsten Sinn bezeichnen. Und wissen Sie, was mein sechster Sinn mir sagt? Ich glaube, dass Sie zu entscheiden versuchen, ob Sie wieder zurück zu Ihrer Arbeit gehen oder sich das Leben nehmen sollen.«
Ruckartig starre ich ihn an – ein unfreiwilliges Geständnis, das der Schock mir entlockt hat. Während die Taubheit mit einem Schrei von mir abfällt, erkenne ich, dass er mich manipuliert hat, mit großem Geschick manipuliert hat. Er hat um den heißen Brei herumgeredet, ist abgeschweift, hat sich hier und da vorgetastet und mich verunsichert und im Unklaren gelassen über sein eigentliches Ziel, um dann erbarmungslos zuzuschlagen. Direkt auf den Lebensnerv. Ohne zu zögern. Und es hat funktioniert.
»Ich kann Ihnen nicht helfen, Smoky, solange Sie mir gegenüber nicht rückhaltlos offen sind.«
Erneut dieser mitfühlende Blick, zu aufrichtig und ehrlich für mich in diesem Moment. Seine Augen sind wie zwei Hände, die mich an den psychischen Schultern nehmen und kräftig schütteln. Ich spüre, wie mir die Tränen kommen, und erwidere seinen Blick voller Zorn. Er will mich brechen, so wie ich zahllose Kriminelle in zahllosen Verhörzimmern gebrochen habe. Scheiße, verdammt.
Dr. Hillstead scheint meine Gedanken zu erraten und lächelt sanft.
»Okay, Smoky, es ist gut. Nur eine letzte Sache noch.«
Er öffnet eine Schreibtischschublade und nimmt einen Beweismittelbeutel aus Plastik hervor. Zuerst kann ich nicht erkennen, was er enthält, doch dann sehe ich es, und was ich sehe, lässt mich gleichzeitig zittern und schwitzen.
Es ist meine Pistole. Die Waffe, die ich seit Jahren getragen und mit der ich Joseph Sands erschossen habe.
Ich kann den Blick nicht davon lösen. Ich kenne sie wie mein eigenes Gesicht. Meine Glock. Tödlich. Schwarz. Ich weiß, wie viel sie wiegt und wie sie sich anfühlt – ich kann mich sogar an ihren Geruch erinnern. Dort liegt sie, in diesem Beutel, und ihr Anblick erfüllt mich mit einem überwältigenden Entsetzen.
Dr. Hillstead öffnet den Beutel und holt die Pistole hervor. Er legt sie zwischen uns auf den Schreibtisch. Dann sieht er mich wieder an, nur ist es diesmal ein harter Blick, keine Spur von Mitgefühl. Er hat mich an der Nase herumgeführt. Mir wird klar, dass das, was ich für einen Frontalangriff gehalten habe, nichts als ein Ablenkungsmanöver, eine Finte war. Aus Gründen, die ich nicht begreife und die er offensichtlich sehr gut versteht, ist es diese Waffe, die mich weit öffnen wird. Meine eigene Waffe wird mich brechen.
»Wie oft haben Sie diese Pistole in der Hand gehalten, Smoky?«, fragt er. »Tausend Mal? Zehntausend Mal?«
Ich lecke mir die Lippen, die trocken sind wie Staub. Ich antworte nicht. Ich kann nicht aufhören, diese Glock anzustarren.
»Nehmen Sie sie. Jetzt sofort, und ich schreibe Sie tauglich für den aktiven Dienst, wenn es das ist, was Sie wollen.«
Ich kann nicht antworten, und ich kann den Blick nicht von der Waffe lösen. Ein Teil von mir weiß, dass ich in Dr. Hillsteads Praxis sitze und er mir gegenüber, doch die Welt scheint auf zwei Dinge zusammengeschrumpft zu sein. Auf mich und die Pistole. Alle Geräusche sind gedämpft, und in meinem Kopf herrscht eine eigenartige, fremde Stille, nur durchbrochen durch das Hämmern meines Herzens. Ich kann hören, wie es hart und schnell schlägt.
Ich fahre mir erneut mit der Zunge über die trockenen Lippen. Greif zu und nimm sie, sage ich zu mir. Es ist, wie er gesagt hat – du hast es zehntausend Mal getan. Diese Pistole ist eine Verlängerung deiner Hand. Sie zu ergreifen ist etwas Instinktives, wie Atmen oder Blinzeln.
Sie liegt einfach dort, und meine Hände umklammern unverwandt und steif die Armlehnen meines Stuhls.
»Na los. Nehmen Sie sie.« Seine Stimme ist hart geworden. Nicht brutal, sondern unnachgiebig.
Es gelingt mir, eine Hand von der Armlehne zu lösen, und ich strecke sie unter Aufwendung all meiner Willenskraft aus. Sie weigert sich zu gehorchen, und ein Teil von mir, der ganz kleine Teil, der analytisch und ruhig bleibt, kann nicht glauben, was hier geschieht. Wie kann solch eine Handlung, die bei mir kaum mehr ist als ein Reflex, plötzlich zur schwersten Aufgabe überhaupt für mich werden?
Ich merke, wie mir der Schweiß über die Stirn rinnt. Ich zittere am ganzen Leib, und mein Sichtfeld hat sich an den Rändern verdunkelt. Ich habe Mühe zu atmen, und ich spüre, wie in mir Panik aufsteigt, ein klaustrophobisches, eingeengtes, erstickendes Gefühl. Mein Arm bebt wie ein Baum in einem Hurrikan. Meine Muskeln verkrampfen und entkrampfen sich unablässig wie ein Sack voll lebender Schlangen. Meine Hand nähert sich der Pistole Zentimeter um Zentimeter, bis sie unmittelbar über der Waffe schwebt, und jetzt ist das Zittern gewaltig, schüttelt meinen gesamten Körper, und der Schweiß bricht mir aus allen Poren.
Ich springe vom Stuhl auf, der nach hinten kippt, und schreie.
Ich schreie und schlage mir mit den Fäusten gegen den Kopf, und dann spüre ich, wie ich anfange zu schluchzen, und ich weiß, dass er es geschafft hat. Er hat mich geöffnet, mich aufgebrochen und mir die Eingeweide herausgerissen. Die Tatsache, dass er es getan hat, um mir zu helfen, ist kein Trost für mich, überhaupt nicht, weil ich im Augenblick nur einen ungeheuren Schmerz spüre. Schmerz, nichts als Schmerz.
Ich weiche von seinem Schreibtisch zurück, zur linken Wand, sinke dort zu Boden. Ich merke, dass ich dabei leise stöhne, eine Art Totenklage. Es ist ein grauenvolles Geräusch. Es schmerzt mich, dieses Geräusch zu hören; es hat mich schon immer geschmerzt. Es ist ein Geräusch, das ich schon viel zu oft gehört habe. Das Aufstöhnen eines Überlebenden, der erkannt hat, dass er als Einziger noch am Leben ist, während alles, was er liebt, nicht mehr existiert. Ich habe es von Müttern und Ehepartnern und Freunden gehört, habe es gehört, wenn sie Leichen identifiziert haben oder wenn ich ihnen die Todesnachricht überbrachte.
Ich wundere mich, dass ich mich nicht schämen kann; es ist einfach kein Platz für Scham in mir. Der Schmerz füllt mich vollständig aus.
Dr. Hillstead ist aufgestanden und zu mir gekommen. Er wird mich nicht halten, nicht einmal berühren – das wäre unklug für einen Therapeuten. Doch ich kann ihn spüren. Er ist ein kauerndes, verschwommenes Etwas vor mir, und mein Hass auf ihn ist in diesem Augenblick vollkommen.
»Reden Sie mit mir, Smoky«, sagt er. »Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Er spricht zu mir mit einer Stimme, die so aufrichtig freundlich ist, dass sie eine neue Woge der Qual in mir heraufbeschwört. Es gelingt mir zu reden, abgehackt, von zitternden Schluchzern unterbrochen.
»Ich kann so nicht leben, nicht so ohne Matt, ohne Alexa, ohne Liebe, ohne Leben, alle tot, alle sind tot, tot und …«
Mein Mund formt ein »O«. Ich kann es spüren. Ich blicke zur Decke hinauf, packe meine Haare, und es gelingt mir, zwei Büschel mit den Wurzeln auszureißen, bevor ich das Bewusstsein verliere.
KAPITEL 3
Es scheint eigenartig, dass ein Dämon mit einer Stimme wie dieser zu reden vermag. Er ist beinahe drei Meter groß, hat Augen wie Glas und einen Kopf voller weinender, zähneknirschender Münder. Die Schuppen, die seinen Leib bedecken, sind so schwarz wie etwas, das verbrannt wurde. Und die Stimme klingt scharf und nasal und erinnert an die Südstaaten, als er zu mir spricht.
»Ich fresse Seelen für mein Leben gern«, sagt er im Konversationston zu mir. »Es geht doch nichts darüber, etwas zu fressen, das eigentlich für den Himmel bestimmt war.«
Ich bin nackt an mein Bett gefesselt, gebunden mit silbernen Ketten, die unglaublich dünn und trotzdem unzerbrechlich sind. Ich fühle mich wie Dornröschen, das durch ein Missgeschick in eine Geschichte von H. P. Lovecraft geraten ist. Das unter der Berührung einer gespaltenen Zunge aufgewacht ist statt unter dem sanften Kuss seines Helden. Ich habe keine Stimme, ich bin mit einem Seidenschal geknebelt.
Der Dämon steht am Fußende meines Bettes und blickt auf mich herab, während er spricht. Er sieht selbstzufrieden und zugleich besitzergreifend aus und starrt mich an mit dem Stolz, mit dem ein Jäger den Rehbock betrachtet, den er auf die Motorhaube geschnallt hat.
Er schwenkt ein gezacktes Kampfmesser in der Hand. Es erscheint winzig in seiner riesigen Klauenhand.
»Aber ich mag meine Seelen am liebsten gut durch und anständig gewürzt! Deiner fehlt irgendwas … vielleicht eine Prise Todesqual und ein Schuss Schmerzen?«
Seine Augen werden leer, und schwarzer Speichel, der aussieht wie Eiter, trieft von seinen Fängen, läuft ihm über das Kinn und tropft auf seine mächtige geschuppte Brust. Der Dämon bemerkt es überhaupt nicht, und das macht mir furchtbare Angst. Dann grinst er lüstern, zeigt seine zahllosen spitzen Zähne und schüttelt neckisch eine Klaue in meine Richtung.
»Ich hab noch jemand hier bei mir, meine Liebe. Meine süße, liebe Smoky.«
Er tritt beiseite und gibt den Blick frei auf meinen Prinzen, auf ihn, dessen Kuss mich hätte erwecken sollen. Meinen Matt. Den Mann, den ich seit meinem siebzehnten Lebensjahr kenne. Den Mann, den ich so gut kenne, wie ein Mensch einen anderen nur kennen kann. Er ist nackt auf einen Stuhl gefesselt. Er ist geschlagen worden, furchtbar geschlagen. Die Sorte von Schlägen, die sehr wehtun, ohne zum Tod zu führen. Die Art von Schlägen, die sich anfühlen, als seien sie endlos. Die jede Hoffnung töten, während der Körper am Leben bleibt.
Ein Auge von Matt ist zugeschwollen, seine Nase ist gebrochen, Zähne sind ausgeschlagen hinter dem zerfetzten Fleisch seiner Lippen. Sein Unterkiefer ist zerschmettert und formlos. Sands hat sein Messer an Matt benutzt. Ich sehe kleine, tiefe Schnitte überall auf dem Gesicht, das ich geliebt und geküsst und zwischen den Händen gehalten habe. Tiefere, längere Schnitte auf der Brust und dem Bauch. Und Blut. So viel Blut überall. Blut, das läuft und tropft und schäumt, während Matt atmet. Der Dämon hat Matts Bauch mit Blut beschmiert und »Vier gewinnt« darauf gespielt. Ich bemerke, dass die O gewonnen haben.
Matts unversehrtes Auge begegnet meinem Blick, und die vollständige Verzweiflung, die ich darin erkenne, füllt meinen Verstand mit einem furchtbaren Aufheulen. Es ist ein Aufheulen aus den Eingeweiden, ein seelenzerschmetterndes Geräusch, nacktes, stimmgewordenes Entsetzen. Ein Hurrikan von einem Schrei, lang genug, um die Welt zu zerstören. Ich bin erfüllt von einer alles verzehrenden Wut, die so intensiv, so überwältigend ist, dass sie jeden klaren Gedanken mit der Wucht einer Bombenexplosion zerfetzt. Es ist die Wut des Wahnsinns, die totale Dunkelheit einer Höhle tief unter der Erde. Sie verfinstert die Seele.
Ich brülle durch meinen Knebel hindurch wie ein Tier, die Art Brüllen, das die Kehle blutig macht und Trommelfelle zerfetzt, und ich stemme mich so wütend gegen meine Fesseln, dass sie in meine Haut schneiden. Meine Augen treten hervor, als wollten sie aus den Höhlen platzen. Wäre ich ein Hund, ich hätte Schaum vor dem Maul. Ich will nur eines: diese Fesseln sprengen und diesen Dämon mit meinen bloßen Händen töten. Ich will nicht, dass er einfach nur stirbt – ich will ihn ausweiden. Ich will ihn zerreißen, bis er nicht mehr wiederzuerkennen ist. Ich will die Atome spalten, die diesen Dämon ausmachen, und sie in Gas verwandeln.
Doch die Ketten sind zu stark. Sie reißen nicht. Sie lockern sich nicht einmal. Und die ganze Zeit über beobachtet mich der Dämon mit nachdenklicher Faszination, eine Hand auf Matts Kopf, die monströse Parodie einer väterlichen Geste.
Der Dämon lacht und schüttelt den ungeheuerlichen Kopf, und seine zahllosen Münder kreischen protestierend. Dann spricht er erneut, mit dieser Stimme, die nicht zu seiner Gestalt passt.
»Also fangen wir an! Wolfeszahn und kamm des Drachen, Hexenmumie, Gaum und Rachen.« Er zwinkert. »Es geht doch nichts über ein wenig Verzweiflung, um Würze in eine heroische Seele zu bringen …« Eine kurze Pause, dann wird seine Stimme für einen kurzen Moment ernst, erfüllt von einer Art perversem Bedauern: »Mach dir keine Vorwürfe deswegen, Smoky. Selbst eine Heldin kann nicht immer gewinnen.«
Ich sehe erneut Matt an, und der Ausdruck in seinem Auge reicht aus, um mir zu wünschen, ich wäre tot. Es ist kein Ausdruck der Angst oder des Schmerzes oder des Entsetzens. Es ist ein Ausdruck von Liebe. Für einen kurzen Moment ist es ihm gelungen, den Dämon aus der Welt dieses Zimmers zu verdrängen, sodass nur Matt und ich existieren, und wir sehen uns an.
Eines der Geschenke einer langen Ehe ist die Fähigkeit, alles, einfach alles – angefangen von sanfter Missbilligung bis hin zum Sinn des Lebens – mit einem einzigen Blick zu kommunizieren. Es ist eine Fähigkeit, die man im Prozess der Verschmelzung der eigenen Seele mit der seines Partners erlangt – falls man willens ist, seine Seelen zu verschmelzen. Matt schenkt mir einen von jenen Blicken, und er sagt drei Dinge mit seinem einen, unverletzten, wunderschönen Auge: Es tut mir Leid, ich liebe dich und … Lebewohl.
Es ist, als beobachtete ich den Weltuntergang. Sie versinkt nicht in Flammen und Rauch, sondern in kalten, alles durchdringenden Schatten. Dunkelheit, die bis in alle Ewigkeit andauern wird.
Der Dämon scheint es ebenfalls zu spüren. Er lacht erneut und führt einen kleinen Freudentanz auf, wobei er mit dem Schwanz wedelt und Eiter aus seinen Poren tropft.
»Aaa-moreee. Wie süß das ist! Das ist die Kirsche auf meinem Smoky-Eisbecher. Der Tod der Liebe.«
Die Tür zum Zimmer öffnet sich und schließt sich wieder. Ich sehe niemanden eintreten … doch am Rand meines Blickfelds steht plötzlich eine kleine, dunkle Gestalt. Irgendetwas an diesem Anblick erfüllt mich mit Verzweiflung.
Matt schließt sein Auge, und in mir steigt erneut diese Wut auf. Ich stemme mich gegen meine Fesseln.
Das Messer fährt herab, und ich höre das nasse, schneidende Geräusch, und Matt schreit durch seinen Knebel hindurch, wie ich durch meinen schreie, und mein Prinz, mein Märchenprinz stirbt, mein Märchenprinz stirbt …
Schreiend wache ich auf.
Ich liege auf dem Sofa in Dr. Hillsteads Sprechzimmer. Er kniet neben mir, berührt mich mit Worten, nicht mit den Händen.
»Schhhh. Ist ja gut, ist alles gut. Es war nur ein Traum, Smoky. Sie sind hier. Sie sind in Sicherheit.«
Ich zittere am ganzen Leib und bin schweißgebadet. Ich spüre Tränen, die auf meinem Gesicht trocknen.
»Geht es Ihnen wieder besser?«, fragt Dr. Hillstead. »Sind Sie wieder da?«
Ich kann ihn nicht ansehen. Ich richte mich in eine sitzende Haltung auf.
»Warum haben Sie das getan?«, flüstere ich. Ich kann nicht länger so tun, als wäre ich stark, nicht vor meinem Therapeuten. Er hat mich zerschmettert, und jetzt hält er mein schlagendes Herz in den Händen.
Er antwortet nicht sofort, sondern steht auf, nimmt einen Sessel und stellt ihn dicht vor die Couch. Dann setzt er sich, und obwohl ich ihn immer noch nicht ansehen kann, fühle ich, dass er mich ansieht, wie ein Vogel, der mit den Flügeln ans Fenster schlägt. Zaghaft und beharrlich zugleich.
»Ich habe es getan … weil ich es tun musste.« Er schweigt für eine Sekunde. »Smoky, ich arbeite inzwischen seit zehn Jahren für das FBI und andere Vollzugsbehörden. Sie und Ihre Kollegen, Sie sind aus unglaublich hartem Holz geschnitzt. Ich habe die besten Eigenschaften der menschlichen Spezies in dieser Praxis gesehen. Hingabe. Tapferkeit. Ehre. Pflichterfüllung. Sicher, ich habe auch ein wenig Böses gesehen, einiges an Korrumpiertheit. Allerdings war das die Ausnahme, nicht die Regel. Hauptsächlich habe ich Stärke gesehen. Unglaubliche Stärke. Stärke des Charakters und der Seele.« Er zögert, zuckt die Schultern. »In meinem Beruf sprechen wir normalerweise nicht über die Seele. Wir glauben normalerweise nicht daran. Gut und Böse? Das sind doch nur allgemeine Konzepte, keine fest definierten Dinge.« Er blickt mich grimmig an. »Aber das ist ein Irrtum, nicht wahr? Es sind nicht nur Konzepte, habe ich Recht?«
Ich starre weiter auf meine Hände.
»Sie und Ihre Kollegen, Sie bewachen Ihre Stärke wie einen Talisman. Sie verhalten sich, als wären Ihre Vorräte begrenzt. Wie Samson und sein Haar. Sie scheinen zu denken, wenn Sie hier drin schwach werden und sich öffnen, wirklich öffnen, dann verlieren Sie all Ihre Stärke und bekommen sie niemals zurück.« Er schweigt erneut, diesmal für eine ziemlich lange Weile. Ich fühle mich leer und trostlos. »Ich arbeite nun seit einer Reihe von Jahren in diesem Beruf, Smoky, und Sie sind eine der stärksten Persönlichkeiten, denen ich je begegnet bin. Ich kann mit nahezu absoluter Sicherheit sagen, dass keine der Personen, die ich in der Vergangenheit behandelt habe, imstande gewesen wäre, das zu ertragen, was Sie ertragen mussten und immer noch ertragen. Nicht eine von ihnen.«
Es gelingt mir, den Blick zu heben und ihn anzusehen. Ich frage mich, ob er sich über mich lustig macht. Stark? Ich fühle mich nicht stark. Ich fühle mich schwach. Ich kann nicht einmal mehr meine Pistole halten. Ich sehe ihn an, er sieht zurück. – Es ist ein unerschrockener Blick, und als ich ihn erkenne, durchzuckt mich ein Schock. Ich habe blutbesudelte Verbrechensschauplätze mit diesem Blick betrachtet. Verstümmelte Leichen. Ich bin imstande, derartig Entsetzliches anzusehen, ohne den Blick abzuwenden. Dr. Hillstead betrachtet mich mit dem gleichen Blick, und mir wird bewusst, dass dies seine Begabung ist: Er ist imstande, das Entsetzen der Seele mit einem steten, unerschrockenen Blick zu ertragen. Ich bin sein Verbrechensschauplatz, und er wendet sich nicht angewidert oder distanziert ab.
»Doch ich weiß auch, dass Sie dicht vor der Grenze dessen stehen, was Sie zu ertragen imstande sind, Smoky. Und das bedeutet, ich kann eines von zwei Dingen tun. Ich kann zusehen, wie Sie zerbrechen, oder ich zwinge Sie, sich zu öffnen und meine Hilfe anzunehmen. Ich habe mich für Letzteres entschieden.«
Ich spüre die Aufrichtigkeit in seinen Worten, die Ernsthaftigkeit. Ich habe Hunderte verlogener Krimineller angesehen. Ich bilde mir ein, dass ich eine Lüge selbst im Schlaf durchschauen würde. Er sagt die Wahrheit. Er will mir helfen.
»So. Jetzt ist der Ball auf Ihrer Seite des Spielfelds. Sie können aufstehen und gehen, oder wir können von hier an weitermachen.« Er lächelt mich an, ein müdes Lächeln. »Ich kann Ihnen helfen, Smoky, ich kann es wirklich. Ich kann nicht ungeschehen machen, was passiert ist. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie nicht für den Rest Ihres Lebens unter dem Schmerz leiden. Doch ich kann Ihnen helfen. Wenn Sie mich lassen.«
Ich starre meinen Therapeuten an, und ich spüre den Widerstreit in mir. Er hat Recht. Ich bin ein weiblicher Samson, und er ist eine männliche Delila, nur dass er mir erzählt, es würde nicht wehtun, wenn ich mir die Haare schneide. Er bittet mich, ihm auf eine Weise zu vertrauen, wie ich niemandem vertraue. Außer mir selbst.
»Und?«, höre ich die leise Stimme in mir selbst fragen. Ich schließe zur Antwort die Augen. Ja. Und Matt.
»Okay, Dr. Hillstead. Sie haben gewonnen. Ich versuche es.«
In dem Moment, in dem ich es sage, weiß ich, dass es richtig ist, denn ich höre auf zu zittern.
Ich frage mich, ob das, was er zu mir gesagt hat, die Wahrheit ist. Was meine Stärke angeht, meine ich. Bin ich stark genug weiterzuleben?
KAPITEL 4
Ich stehe vor der Fassade der FBI-Büros in Wilshire, Los Angeles. Ich blicke an der Fassade hoch und versuche, etwas dabei zu empfinden.
Nichts.
Dies ist kein Ort, wo ich im Moment hingehöre. Stattdessen habe ich das Gefühl, abgeschätzt zu werden. Die Fassade blickt stirnrunzelnd auf mich herab mit ihrem Gesicht aus Beton, Glas und Stahl. Nehmen es Zivilisten so wahr?, frage ich mich. Als etwas Imposantes und vielleicht ein wenig Hungriges?
Ich bemerke mein Spiegelbild im Glas der Eingangstüren und winde mich innerlich. Ich wollte einen Anzug tragen, doch es hätte sich zu sehr nach Verpflichtung zum Erfolg angefühlt. Sportsachen wären zu lässig gewesen. Als Hinweis auf meine Unentschiedenheit hatte ich mich für Jeans und eine Buttondown-Bluse entschieden, einfache Halbschuhe und ein leichtes Make-up. Und jetzt fühlt sich alles unpassend an, und am liebsten würde ich rennen, rennen, rennen.
Emotionen überrollen mich in Wellen, in brechenden, krachenden Wellen. Angst, Aufregung, Zorn, Hoffnung.
Dr. Hillstead hat unsere Sitzung mit einer Aufgabe beendet. Gehen Sie, und besuchen Sie Ihr Team.
»Es war nicht nur ein Job für Sie, Smoky. Es war etwas, das Ihr Leben ausgemacht hat. Etwas, das zu dem gehört, was Sie sind. Wer Sie sind. Stimmen Sie mir zu?«
»Ja. Das ist richtig.«
»Und die Leute, mit denen Sie zusammenarbeiten – einige von ihnen sind Freunde?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Zwei von ihnen sind meine besten Freunde. Sie haben versucht, mir zu helfen, aber …«
Er hob eine Augenbraue; eine Frage, auf die er die Antwort bereits wusste. »… aber Sie haben sie seit Ihrem Krankenhausaufenthalt nicht mehr gesehen.«
Sie haben mich besucht, als ich wie eine Mumie in Gaze eingewickelt im Krankenhaus lag und mich fragte, warum ich noch am Leben bin. Als ich mir wünschte, tot zu sein. Sie wollten bleiben, doch ich bat sie zu gehen. Jede Menge Telefonanrufe folgten, die ich ausnahmslos auf meinen Anrufbeantworter auflaufen ließ. Ich habe nie zurückgerufen.
»Ich wollte damals niemanden sehen. Und nachdem …« Ich breche stockend ab.
»Nachdem was?«, bohrte er.
Ich seufzte und deutete auf mein Gesicht. »Ich wollte nicht, dass sie mich so sehen. Ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, wenn ich Mitleid in ihren Blicken erkenne. Es würde zu sehr wehtun.«
Wir sprachen noch ein wenig darüber, und dann sagte er zu mir, der erste Schritt auf dem Weg, meine Waffe wieder in die Hand nehmen zu können, bestehe darin, meinen Freunden gegenüberzutreten.
Und jetzt bin ich hier.
Ich beiße die Zähne zusammen, rufe mir meine irische Starrköpfigkeit ins Gedächtnis und schiebe mich durch die Türen.