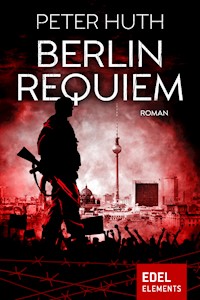1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ob groß oder klein, altmodisch oder hypermodern – das Büro ist die Heimat des modernen Menschen. Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben sind aufgehoben: Wir verlieben uns im Büro, unsere Kollegen ersetzen mitunter die Familie, und unsere Jobprobleme schleppen wir mit in den Feierabend. Eine ganz neue Spezies, der homo buerocensis, ist in diesem Lebensraum entstanden. Mit Witz und Ironie beschreibt Peter Huth dessen Ernährungs-, Territorial- und Balzverhalten. Er erforscht den Mikrokosmos Büro, seine Bewohner, ihre Rituale und die Gefahren, die zwischen Konferenzraum und Kopierer, Teeküche und Firmenparkplatz auf sie lauern. Welche Gattungen von Kollegen gibt es? Was passiert, wenn einer davon über Nacht zum härtesten Konkurrenten oder die Chefin zur Geliebten wird? Wie man in dieser manchmal fremden und doch so vertrauten Welt die Nerven behält, zeigt dieses Überlebenshandbuch. Und es macht deutlich, wie schön es trotz aller Widrigkeiten ist, täglich mit Menschen zusammenzuarbeiten – solange man weiß, worauf man dabei achten muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Ob groß oder klein, altmodisch oder hypermodern – das Büro ist die Heimat des modernen Menschen. Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben sind aufgehoben: Wir verlieben uns im Büro, unsere Kollegen ersetzen mitunter die Familie, und unsere Jobprobleme schleppen wir mit in den Feierabend. Eine ganz neue Spezies, der homo buerocensis, ist in diesem Lebensraum entstanden. Mit Witz und Ironie beschreibt Peter Huth dessen Ernährungs-, Territorial- und Balzverhalten. Er erforscht den Mikrokosmos Büro, seine Bewohner, ihre Rituale und die Gefahren, die zwischen Konferenzraum und Kopierer, Teeküche und Firmenparkplatz auf sie lauern. Welche Gattungen von Kollegen gibt es? Was passiert, wenn einer davon über Nacht zum härtesten Konkurrenten oder die Chefin zur Geliebten wird? Wie man in dieser manchmal fremden und doch so vertrauten Welt die Nerven behält, zeigt dieses Überlebenshandbuch. Und es macht deutlich, wie schön es trotz aller Widrigkeiten ist, täglich mit Menschen zusammenzuarbeiten – solange man weiß, worauf man dabei achten muss.
Peter Huth
Das Büro
Ein Überlebenshandbuch
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2007 by Peter Huth
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-068-6
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Babylon Büro.
Vom Sündenfall der Schreibtisch-Zivilisation
Teil I – Bestandsaufnahme
1. Ein Kral aus Glas und Beton.
Das Habitat des modernen Menschen
2. Timbuktu liegt im Keller.
Expedition zu mythischen Orten
3. Vom Territorialverhalten beim Homo buerocensis.
Reviere im Büro
4. Das Bestiarium wird betrachtet.
Menschen im Büro
5. Hurra, es brennt!
Alltag und Abwechslung im Büro
6. Vom Paarungsverhalten unter Kollegen.
Liebe im Büro
7. Risiko Mensch.
Kollegen, die uns fertigmachen
8. Höllenschlund Arbeitsplatz.
Angst im Büro
Teil II – Moral
9. Die sieben Todsünden im Büro.
Eine Reise zu den Dämonen (mit Rückfahrkarte)
10. Die sieben Kardinaltugenden im Büro.
Wie man die Dämonen besiegt
Teil III – Praxis
11. Was man im Büro darf/nicht darf.
Vierzehn Fragen, vierzehn Antworten
12. You can say you to me.
Sieben Möglichkeiten, Ihrem Chef das Du aufzuzwingen
13. Wenn du geschwiegen hättest …
88 Wörter, die man im Büro besser nicht verwenden sollte
14. Mahlzeit!
Was Ihnen die Kollegen wirklich sagen wollen
15. Nicht zur Nachahmung empfohlen.
Sechs klassische Intrigen
Nachwort
Das Böse und wir
Anhang
Schlüsselbegriffe der Bürosprache
Danke
Babylon Büro
Vom Sündenfall der Schreibtisch-Zivilisation
«Und was gibt’s heute in der Kantine?»
(Jedes Büro, weltweit, täglich um 9 Uhr)
Die Schlacht tobt jeden Tag von neun Uhr morgens bis sechs Uhr abends. Es geht um Existenz oder Untergang, Sein oder Nichtsein. Attackiert wird mit Worten, verletzt werden ausschließlich Gefühle. Die Kampftechnik: Verbreitung von Furcht, Angst, Panik. Und wenn auch die Wunden, die man einander damit zufügt, meist verheilen – nicht selten bleiben Narben.
In dieser Schlacht gibt es kaum Regeln und keine Gesetze. Erlaubt ist, was den Sieg verspricht: Intrigen, Missgunst, Verrat. Der Kampf ist unbarmherzig: Gefangene werden nicht gemacht, und am Ende gewinnen die Brutalsten. Jeder wird zum Kriegsdienst verpflichtet. Der Einberufungsbescheid ist der Hausausweis. Sie kennen die Kampfzone: Es ist Ihr Büro.
Als Heimat von Machtsucht und Hybris, Brutstätte von Lüge und Verrat ist das Büro heute das, was Babylon in der Zeit des Alten Testaments war: ein Hort menschlicher Schwächen. Die vier Mauern, die ihn begrenzen, sind Feigheit, Wankelmut, Dummheit und Angst. Sie sorgen dafür, dass niemand den Dämonen entkommt, die darin herrschen: Geltungssucht, Trotz, Neid und Gier. Die Kriegsverbrechen, die in diesem Kampf begangen werden, sind unzählbar. Und die Fronten wechseln täglich. Unschuldig bleibt kaum einer – ob es der Blick zur Seite ist, wenn einer der Kollegen ungerecht behandelt wird, oder ob man selbst für das Lob des Chefs lügt, denunziert, intrigiert.
Auch ich habe im Babylon Büro gesündigt. Mit knapp sechsundzwanzig Jahren war ich stellvertretender Nachrichtenchef der größten Berliner Zeitung. Ich war ehrgeizig, ich wollte nach oben, und das möglichst schnell. Für die Karriere hatte ich meine Freundin in Köln zurückgelassen, die meinetwegen gerade erst von Bayern an den Rhein gezogen war. Meine Chefin, die mir den neuen Job gegeben hatte, war gleichzeitig meine beste Freundin. In meinem ersten halben Jahr in Berlin gab es kaum einen Abend, an dem wir nicht bis in die Morgenstunden getrunken und uns über die Arbeit die Kehlen trockengeredet hätten. Wir waren das perfekte Job-Duo, ein Büro-Power-Team, dem niemand etwas anhaben konnte. Bis ich sie verraten habe.
Warum? Weil ich ihren Job angeboten bekam. Ich wollte ihn haben, und ich war bereit, den Preis dafür zu zahlen. Das fiel mir nicht leicht, ich war kein Monster. Aber ich war auch kein Engel. Meine Situation war so: Nach gerade mal sechs Monaten in Berlin bekam ich das Angebot, zurück nach Köln zu wechseln – in eine höhere Position. Nur darum ging es mir, das Geld war mir egal. Ich wollte Verantwortung und Einfluss. Und natürlich Macht, Prestige. Also unterschrieb ich einen Vorvertrag. Doch als ich in Berlin kündigen wollte, bot man mir den Posten meiner Freundin an.
Ich sagte zu, ohne zu zögern, bestand jedoch darauf, sie persönlich über die veränderte Situation zu informieren. Weil Feigheit die kleine Schwester des Verrats ist, wartete ich bis zu dem Morgen, an dem die Nachricht offiziell verkündet werden sollte. Ich bat meine Chefin um ein Gespräch in ihrem Büro, das schon in wenigen Minuten mir gehören würde. Sie, die immer so stark gewesen war, die mir alle Tricks und Kniffe, alle Strategien und Gegenstrategien verraten hatte, weinte. Sie sagte kein Wort, aber ich wusste: Schlimmer als der Verlust des Jobs, der ihr alles bedeutete, war der Verlust des Freundes. Sie verließ den Raum und trat einen mehrwöchigen Urlaub an. Ich, der Verräter, musste noch meinem zweiten Opfer beichten: dem Kölner Chefredakteur, der ja fest mit mir rechnete. Mein erster Anruf von meinem neuen Büro aus war also auch der schwerste – und diesmal fielen viele Worte, von denen «Sie Arschloch» noch das charmanteste war. Das Wechselgeld für den Preis meiner Beförderung war eine Kanonade von Schimpfwörtern.
Der Kölner Chefredakteur hat mir nie verziehen, und ich kann es ihm nicht verdenken. Noch fünf Jahre später beschimpfte er mich in einer Berliner Kneipe. Das letzte Mal haben wir uns in Polen gesehen, wo wir eine neu zu gründende Zeitung beraten sollten. Nach dem ersten gemeinsamen Arbeitstag reiste er ab. Meine Freundin Claudia aber hat mir verziehen. Auf einer Weihnachtsfeier kam sie auf mich zu und sprach nach mehr als drei Jahren wieder mit mir. Das war einer der bewegendsten Momente meines Lebens. Heute sind wir wieder befreundet. Und doch tragen wir beide Narben aus dieser Zeit. Sie haben Auswirkungen auf unsere Karriere, aber auch auf unser Leben gehabt.
Das Büro ist keine abgeschlossene Welt. Entscheidungen, die dort gefällt werden, prägen den Charakter, haben direkten Einfluss auf die Partnerschaft, die Freunde, die Familie – auf alle Bereiche des Lebens. Der Feierabend ist kein Heimaturlaub, sondern nur eine kurze Feuerpause.
Für viele ist der Arbeitsplatz (wenn auch nicht unbedingt die Arbeit!) wichtiger als der Partner. Bei jedem Italiener sieht man Paare, die sich vor Verlegenheit eine Gabel mit Antipasti nach der anderen in den Mund schaufeln, weil sie nichts mehr zu reden haben. Wie gern würden beide über ihre Jobs sprechen. Aber das geht nicht: Sosehr ihre Büros einander ähneln, so unterschiedlich sind sie in den Details. Das, was hier gerade eine Riesensache ist (neuer Chef, attraktive Praktikantin, Müller hat einen Parkplatz auf F4 bekommen, englischer Heuschreckenkonzern schluckt ganzen Betrieb), ist schon auf der anderen Straßenseite, im nächsten Büroturm, vollkommen uninteressant. So sitzt das moderne Double-income-no-kids-Paar wortlos vor Carpaccio und Insalata di frutti di mare und würde viel lieber mit den Kollegen ein paar Bier zischen.
Wie viele Leute kennen Sie, die noch ein wirkliches Hobby haben, dem sie sich ernsthaft widmen? Ich kenne einen: Es ist ein Kollege von mir, ein gelernter Schriftsetzer, durch das Aussterben seines Berufes ins Büro getrieben und heute Graphik-Layouter. Er sammelt Modelleisenbahnen, die Anlage ist mehrere zehntausend Euro wert – so viel, wie wir hobbylosen Bürobabylonier in wenigen Jahren für Flusskrebsschwänze an Rucola, Kurztrips nach Ibiza und anderen Kompensationskonsum verpulvern. Ich weiß, wovon ich spreche: Mit dem Geld, das ich in Restaurants allein für Fernet Branca, den Energydrink des mitternächtlichen Bürogelabers, ausgegeben habe, hätte ich in einem afrikanischen Zwergstaat eine Kathedrale stiften können.
Wie oft sehen Sie Ihre Familie? Können Sie sich daran erinnern, dass Sie Tanten und Onkel haben? Wussten Sie, dass Ihre jüngste Cousine nach Australien ausgewandert ist und Ihre Cousins Bauingenieure geworden sind? Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Mutter besucht? Das Büro ist schon lange die Familie des modernen Menschen geworden.
Wie aber konnte sich das Büro unserer Seelen bemächtigen – und warum muss es zwangsläufig zu Kampfhandlungen kommen? Drei Ängste sind es, die sie auslösen.
Die erste Angst: Gewimmel in der Petrischale
1900 kamen auf einhundert Industriearbeiter drei Büroangestellte. Es war nämlich so, dass die Besitzer der Firmen die Macht der Prokuristen mit dem gleichen Argwohn betrachteten wie der chinesische Kaiser die Schattenherrschaft der Eunuchen. «Das beste Büro kann man im Fond eines Autos unterbringen», sagte der amerikanische Ölmilliardär Jean Paul Getty, und da gibt es ja bekanntlich nur zwei Plätze sowie einen Notsitz. Heute kommen auf einen Industriearbeiter zwei Angestellte. Und wir sind erst am Anfang der bürokratischen Epoche. Auf dem Weg zur Komplett-Dienstleistungsgesellschaft werden typische Industrieberufe immer weiter verdrängt und durch Bürojobs ersetzt (oder gleich ganz gestrichen, was aber den prozentualen Anteil der Angestellten ebenfalls erhöht). Rund um den Hackeschen Markt in Berlin wird schon jetzt fast das gesamte Bruttosozialprodukt von Agenturen (Werbung, Event, Medien) erwirtschaftet. Den Rest verdienen die Schuhgeschäfte, in denen die Graphik-Designer, Art-Direktoren und Texter ihr Gehalt während der Mittagspause wieder ausgeben.
Seit dem Beginn des großen Sterbens der Industrieberufe landeten immer mehr Menschen aus diesen Branchen im Büro: versetzt, umgeschult und weitergebildet, wurden aus Arbeitern Angestellte. Sie brachten nicht nur einen sportplatzähnlichen Ton mit ins Büro, sondern auch die eher linken Ideen der Arbeiterklasse. Statt homogener Gruppen wie in den Werkhallen entstand im Büro eine Von-jedem-etwas-Mischung: Alte und Junge, Menschen aus wohlhabenden Familien und solche, die der ersten Generation eines neuen Mittelstands angehören. Einige Kollegen sind ausgezeichnet ausgebildet, andere ehemalige Hauptschüler. Hochschulabsolventen arbeiten Seite an Seite mit Nichtstudierten wie mir.
Das Büro ist die Petrischale der Gesellschaft. Es wimmelt, es wuchert, nur die Stärksten setzen sich durch. Die, die sich den besten Platz erkämpft haben, werden ihn verteidigen, und von den Rändern drängen ständig neue Konkurrenten in die Mitte, um die, die dort sind, zu verdrängen. Junge greifen nach den Positionen der Älteren. Frauen kämpfen um ihre Emanzipation, und Männer versuchen, das zu verhindern. Faule versuchen, ihre Trägheit zu verbergen, Fleißige streben nach Lob.
Die zweite Angst: Das Ende der Gemütlichkeit
Die Petrischale Büro wurde erhitzt. Das beschleunigte die Prozesse rasant. Der Brennstoff, mit dem sich die Flammen unter der Schale speisten, war der Fortschritt. In keiner Branche der Welt geht er so schnell vonstatten wie in der datenverarbeitenden. Am Kölner Dom wurde vom 13. bis ins 19. Jahrhundert praktisch ohne bahnbrechende Veränderung der Arbeitsweise gebaut. Die Büroarbeit aber, die heute erledigt wird, ist schon mit den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg kaum mehr zu vergleichen. Trotzdem blieb es im Büro bis in die achtziger Jahre relativ gemütlich. Zwar hatten Schreibmaschinen längst die Füllfederhalter, die ersten Kopiermaschinen das Durchschlagpapier ersetzt, doch die wichtigsten Instrumentarien des Büroarbeiters blieben aus heutiger Sicht vorsintflutlich: die Telekommunikationseinrichtungen.
Nachrichten aus der Außenwelt erreichten den Büromenschen auf zwei Wegen: postalisch oder fernmündlich. Beides machte das Büro zu einer Welt ohne Geschwindigkeit. Briefe konnten getrost liegengelassen werden – mit der Ausrede, die Post habe geschlampt. Anrufbeantworter und Mobiltelefone gab es noch nicht, ständige Erreichbarkeit war ein Fremdwort. Durch Gummibäume ausreichend mit Sauerstoff versorgt, lebten die Büromenschen dieser Epoche ein friedliches Leben in einer hermetisch abgeriegelten Welt, die der Pförtner so gut hütete wie Olli Kahn zu seinen besten Zeiten das Tor der Nationalmannschaft. Karriere war eine Sache des beharrlichen Abwartens, Gehaltserhöhungen gab es dank wirtschaftlicher Prosperität des Landes automatisch.
Umgepflügt wurde dieser Garten Eden Anfang der achtziger Jahre. Wie die vier apokalyptischen Reiter hielten Anrufbeantworter, Fotokopierer, Faxgerät und schließlich der Computer Einzug. Daten wurden sofort übermittelt und warteten auf Bearbeitung, der Anrufbeantworter zwang zum Rückruf. Dann kam das Internet und stellte die Bürouhren auf Echtzeit.
Die Karten wurden neu gemischt: Jahrzehntelange Erfahrung zählte nicht mehr, dafür angelerntes IT-Wissen. Gestandene Abteilungsleiter saßen ratlos vor dem Monitor und mussten sich von den Jüngeren zeigen lassen, wie der Cursor läuft – Munition im Generationenkampf. Langsame kamen nicht mehr mit, Faulheit war nicht länger zu kaschieren. Im Sekretariat lief die Flut an Daten dann zusammen – Dienstreisen, Spesen, Urlaubspläne, Personalverwaltung, das alles wurde jetzt elektronisch geregelt. Waren Sekretärinnen einst nach der Qualität ihres Kaffees beurteilt worden, schätzte man sie nun, wenn sie über EDV-Kenntnisse verfügten.
Eine digitale Welt (also: «an» oder «aus») hielt den analogen (also: «ja», «vielleicht», «nein», «weiß nicht») Menschen von nun an gefangen wie die Dornenhecke Dornröschen in seinem Schloss. Die Technisierung löste die erste Welle der Furcht im Büro aus. Und die wurde, als die Ersten die Büros verlassen mussten, immer größer.
Die dritte Angst: Wachstum frisst Wachstum
Der amerikanische Komiker Jerry Lewis hat das System schon in den siebziger Jahren begriffen: «Kleinlebewesen vermehren sich durch Zellteilung, Bürokraten durch Arbeitsteilung.» Nach diesem Prinzip funktionierte auch die Vermehrung der Büroarbeit: Aus einem Büro wurden zwei Abteilungen, aus zwei Abteilungen bald vier, acht, sechzehn und so weiter.
So wurden immer mehr Arbeitsplätze im Büro geschaffen, immer mehr neue Aufgaben erfunden und alte aufgeteilt. Die jüngste Evolutionsstufe ist mit den «Marketingabteilungen» erreicht, über die heute fast jedes Unternehmen verfügt. Sie erledigen Aufgaben, die früher nebenbei erledigt wurden, und haben ihrerseits einem (häufig ausgelagerten) System von Unterbüros zur Existenz verholfen: den «Werbeagenturen». Die wiederum übernehmen die Arbeit, die eigentlich die Marketingabteilungen machen sollten. Dieses Geschäft läuft ganz hervorragend.
Hier deutet sich der zweite mächtige Konflikt an: Was passiert, wenn die Petrischale voll ist? Als Ende des vergangenen Jahrtausends täglich Hunderte von «Think Tanks», «Web-Agenturen», «Brain-Factorys» und andere dot.com-Zulieferbetriebe schicke Lofts anmieteten und täglich mehr Mitarbeiter anstellten, hätte eigentlich allen klar sein müssen: Ein solches Wachstum konnte nicht von Dauer sein. Es war einfach zu schön, um wahr zu sein. Die, für die vorher ein Mountainbike im Wert von 500 DM unerschwinglich war, jonglierten plötzlich mit Millionen. Dementsprechend härtere Bandagen wurden angelegt.
Hank J., ein Freund von mir, ist das beste Beispiel: Als autodidaktischer Graphiker gründete er mit einem kaufmännisch begabten Freund eine Firma, die spezielle Internet-Applikationen programmierte. Noch bevor sie ein fertiges Produkt vorweisen konnte, wuchs sie auf beachtliche Größe, Geld gab es damals von den Banken gegen ein @-Zeichen im Firmennamen. Ein skandinavischer dot.com-Konzern schluckte die Firma. Mit einem Mal war mein Freund im Vorstand eines millionenschweren internationalen Unternehmens und mit nicht mal dreißig Jahren Aktienmillionär. Doch der Spaß war weg. Alles drehte sich um Personalmanagement, Bilanzprüfung, Outsourcing, Synergieeffizienz. Dann kam der Crash. Die ersten Entlassungen folgten. Von mehreren hundert Menschen blieben am Ende weniger als ein Dutzend. Erst war Hank noch derjenige, der die «Mitarbeitergespräche» führte, bald aber trennte man sich auch von ihm. Heute spricht er häufig, wenn auch nicht gerne, von seiner Zeit als Millionär. Was er jedoch immer wieder betont, ist die nahezu religiöse Solidarität, die in der Anfangsphase herrschte: das Büro als Sekte. Als die Blase dot.com platzte, wurde fast eine ganze Branche pulverisiert.
Wir leben in einem Land, in dem kaum ein Arbeitsplatz sicher ist. Gerade im Schreibtischsektor gibt es keine Garantien mehr, weil die Krise einen Dominoeffekt ausgelöst hat, bei dem der letzte Stein noch lange nicht gefallen ist. Wie abstrus/komplex das System funktioniert, hier nur in Kürze: Als die 9/11-Rezession einsetzte, wurden Stellen abgebaut oder zumindest nicht mehr neu besetzt. Folglich wurden so gut wie keine Stellenanzeigen mehr in den Zeitungen geschaltet. Überregionale Blätter traf das so hart, dass sie wegen des Rückgangs im Anzeigengeschäft sogar journalistische Spitzenkräfte entlassen mussten – und das in einer Zeit, in der das Bedürfnis nach guter Information größer war als jemals zuvor. Plötzlich fanden sich Leute in Job-Centern wieder, die zu einem Arbeitsamt den gleichen Bezug hatten wie ein Maulwurf zu den Monden des Jupiter. Mit den Ex-Leitenden Angestellten, die zurzeit in Deutschland auf der Straße stehen, könnte man locker die verwaisten Bürogebäude in Berlin füllen. Kein Wunder: Für sie wurden sie ja schließlich einst gebaut. Nur was sie dort machen sollen, wäre noch zu klären.
Die Arbeit war für Tennessee Williams «ein Rauschgift, das wie ein Medikament aussieht». Und wie alle Süchtigen brauchen auch die Büromenschen ihre tägliche Dosis. Ich kenne zwei Chefredakteure, die zur Zeit des tödlichen Diana-Unfalls keinen Job hatten. Dennoch konzipierten sie noch am Vormittag eine zweiunddreißigseitige Illustriertenstrecke, die natürlich nie erschien. Wenn so der Entzug aussieht, wie mächtig muss dann die Angst davor sein? Die Furcht vor dem Verlust der Droge verleiht Berserkerkräfte. Und diese Furcht ist fast noch stärker als die davor, kein Geld mehr zu verdienen.
Wenn beide Ängste in die ohnehin bis zum Rand gefüllte Petrischale tropfen, wird im Büro Babylon das Armageddon entfesselt.
Die Lage scheint also aussichtslos. Warum dann überhaupt dieses Buch?
Weil es nicht darum geht, den Krieg zu gewinnen. Das ist unmöglich. Selbst die kaltblütigsten Veteranen, die auf dem Weg an die Spitze Freunde, Partner, Familie, Gesundheit an die Arbeit verraten haben, enden letztlich als Verlierer. Denn so wichtig einem das Leben im Büro auch erscheint, so viele Schlachten man gewonnen haben mag, so fest, wie man die Macht in seinen Händen glaubt: spätestens in dem Moment, in dem man das Büro als Rentner verlässt, werden alte, einst hart erkämpfte Erfolge belanglos.
Was aber kann von einem Leben im Büro bleiben, außer den Narben auf der Seele?
Jedenfalls nicht die Triumphe. Aber das großartige Gefühl, sein Arbeitsleben in Anstand und Würde verbracht zu haben. Bin ich, der Sünder, dafür der richtige Ratgeber? Ja. Denn nur wer den Krieg kennt, weiß, wie wichtig der Frieden ist.
Ein guter Freund von mir, der Schriftsteller Helge Timmerberg, arbeitet mal in Berlin, mal in Wien, mal in Marrakesch und manchmal in Indien. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn dafür beneidet habe. Nur: Er beneidet mich noch viel mehr. Um mein Büro. Um diesen Mittelpunkt in meinem Leben, um die Konstanz und um die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Meine Kollegen.
Im Büro zu arbeiten heißt, mit Menschen zu arbeiten. Etwas Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Fast ein Paradies. Wir müssen es nur ein wenig aufräumen.
Fangen wir an.
Teil I
Bestandsaufnahme
1. Ein Kral aus Glas und Beton
Das Habitat des modernen Menschen
«Ein funktionierendes Büro soll aussehen wie ein Negerkral: Jeder hat seine Hütte, und dazwischen gibt es den Dorfplatz zur Kommunikation.»
So beschrieb, politisch total unkorrekt, der Braunschweiger Architekt Hans Struhk den Lebensraum des Menschen in der Dienstleistungsgesellschaft. Haben seine Kollegen sich daran gehalten?
Berlin, die Stadt, in der ich lebe, ist das ideale Studienobjekt. Nirgendwo in Deutschland findet man so viele Büros. Die meisten von ihnen stehen leer. Im optimistischen Rausch der Nachwendejahre wurde der Bedarf an Arbeitsplatz für Schreibtischmenschen grandios überschätzt. Nachts marschieren also einsame Hausmeister durch die leeren «Tower» und schalten in den oberen Etagen die Lichter an. Erstens, weil es den Immobilienfirmen peinlich ist, dass niemand ihre nach Feng-Shui-Kriterien ausgestatteten Glaspaläste mietet, und zweitens, damit keine Flugzeuge in ebendiese donnern.
Bei den Büros, die nicht leer stehen, gibt es zwei Extreme: Da sind zum einen die in mönchische Minizellen aufgeteilten Verwaltungstürme und zum anderen die Loftbüros, ehemalige Fabrikhallen, die im Grunde nach wie vor so aussehen, wie sie von den Industriearbeitern einst verlassen wurden: die Wände gesandstrahlte Klinker, die wuchtigen Heizungsrohre laufen in unüberschaubaren Mäandern an den Decken entlang und bieten Spinnen und anderen kulturfolgenden Insekten Heimstatt. Die Fenster sind riesig und schlecht isoliert, der Aufzug ein wenig vertrauenerweckendes Drahtgestell, ursprünglich vielleicht dazu gedacht, Motorblöcke von Etage zu Etage zu wuchten. Vor allem bei Werbeagenturen findet man es schick, in solchen Industriebrachen zu siedeln. Außerdem sind die Mietpreise für ein Loft meist ausgesprochen günstig, und die Flure sind so breit, dass der Agenturbesitzer am Tag vor dem Offenbarungseid alles brauchbare Technikmaterial bequem in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem Gebäude schaffen kann. Ich selbst war schon Zeuge solch einer Aktion: Gegenüber meiner Wohnung gibt es ein mit Glaskuppel aufwendig verziertes Loft. Tagaus, tagein herrschte dort hektische Betriebsamkeit, man trank Cappuccino und las die Tageszeitung «Welt Kompakt». Eines Abends aber brannte bis tief in die Nacht Licht, Menschen machten sich an den Geräten zu schaffen, und am nächsten Tag war das Loft so blank wie das Haupt des Agenturchefs.
Eine der wenigen Veränderungen, die normalerweise in einem Loft vorgenommen werden, ist das Ersetzen der Linoleumfußböden durch Parkett und das Aufstellen eines riesigen amerikanischen Kühlschranks mit Eiswürfelautomat. Außerdem werden ein paar Flachbildschirme an die Wände geschraubt, auf denen in Endlosschleife das MTV-Programm von 1992 läuft, und ein paar leere Blumenvasen im iPod-Stil verteilt. Anschließend ist das Büro einsatzbereit – und es hat durchaus Vorteile: Da die Räume sehr groß sind und es keine Einzelbüros gibt, ist die Kommunikation im Loft durchweg besser. Statt Akte X mit der Rohrpost auf eine ungewisse Reise durch das Gebäude zu schicken, schlendert man kurz zum Empfänger und kann sie im besten Fall gleich wieder mitnehmen. Die kurzen Wege machen die Arbeit effektiver, weil mehr miteinander gesprochen wird. Durch starre Raumaufteilung eingerostete Strukturen lösen sich auf, es entsteht automatisch eine stärkere Identifikation mit den Kollegen, der Firma und dem Produkt. Das Loft ist die perfekte, wenn auch häufig ein wenig überdrehte Umsetzung des Großraumbüros.
Sie kennen die Bilder vom Kontrollzentrum der NASA in Houston? Alle sitzen in einem Raum, sind hochkonzentriert, Entscheidungen werden getroffen und sofort umgesetzt. Wäre dieses Team auf klassische Einzelbüros aufgeteilt worden, voneinander abgeschottet und nur durch Telefone verbunden – Apollo 13 wäre wohl verloren gewesen. Dennoch sind die meisten Gebäude heute noch parzelliert wie eine Schrebergartenkolonie.
In den sechziger und siebziger Jahren, als der Bedarf an Büros immer größer, das Bauland aber immer teurer wurde, fanden auch deutsche Architekten heraus, dass Papier erstaunlich leicht ist und Bürogebäude daher – anders als Fabriken – in die Höhe wachsen können. So blieben die Grundflächen klein (und günstig), und die Büros wurden einfach übereinandergestapelt. Ein positiver Nebeneffekt war, dass die Chefs der Unternehmen sich in den oberen Etagen niederlassen konnten. Das verschaffte ihnen nicht nur einen phantastischen Blick über die Dächer ihrer Stadt, sondern gab auch dem soziologischen «Oben» und «Unten» eine architektonische Entsprechung. Aufstieg und Erfolg lassen sich auch in Stockwerken messen – ein zusätzlicher Anreiz, sich anzustrengen.
Doch die Firmen wuchsen schneller, als man es sich erträumt hatte. Der Platz reichte nicht mehr – es musste angebaut werden. Weil es aber schwer ist, zusätzliche Etagen auf ein Hochhaus zu setzen, entstanden rund um die Bürotürme metastasenartige Systeme von Nebengebäuden, von denen aus labyrinthische Wege zum Hauptgebäude führen. Der WDR etwa hat in Köln einen großen Teil der Innenstadt bebaut; durch unterirdische Gänge sind diese Bürokomplexe miteinander verbunden: Man kann ohne Probleme am Appelhofplatz in den öffentlich-rechtlichen Untergrund steigen, dort gefühlte zwei Kilometer zurücklegen und kurz vor dem Dom wieder ans Tageslicht kommen. In solchen Gebilden ist eine Orientierung ohne GPS unmöglich. Häufig stehen die einzelnen Trakte auf unterschiedlichen Bodenniveaus. Was hier Erdgeschoss ist, kann dort schon erster Stock sein. Fensterlose Flure geben keinerlei Ansatz zur Orientierung, man stößt auf die jetzt leer stehenden Bürozüge ehemals mächtiger und längst aufgelöster Abteilungen; in Momenten, in denen man ganz sicher ist, sein Ziel gefunden zu haben, endet der Weg in einer überdimensionierten Teeküche oder vor einer verriegelten Stahltür. Doch auch in Neubauten ist es unmöglich, problemlos von A nach B zu gelangen. Sackgassen, Flure, die ins Nichts führen, und verwinkelte Abzweige werden dort von Anfang an mit eingeplant. Dazu kommen kryptische Leitsysteme, erdacht von Menschen, die sich selbst wohl niemals in die fertigen Gebäude trauen würden: An jeder zweiten Säule ein Plan, auf dem Angaben wie «Fi2 nach G5j» stehen – der U-Bahn-Plan von Tokio ist leichter zu lesen.
Kein Wunder, dass die Bewohner dieser unwirtlichen und lebensfeindlichen Gebäude sich nach kräftigen Landmarken sehnen, die für eine klare Orientierung sorgen. Eine davon ist der Aufzug. Da die Zeit, die man in ihm verbringt, extrem begrenzt ist, sind verschiedene Dinge zu beachten. Als ausgesprochen unhöflich gilt es (zu Recht), den Blick starr auf die Tüte mit Bagels und den Coffee-to-go zu richten, die man auf dem Weg ins Büro gekauft hat. Für ein ausführliches Gespräch ist aber auch keine Zeit. Selbst mit Kollegen aus der gleichen Abteilung verbietet sich eine Konversation – Mitarbeiter aus anderen Stockwerken würden begierig die Ohren spitzen, alles missverstehen und das Gehörte brühwarm weitertratschen. Sagen Sie beispielsweise zu Ihrem Kollegen: «Mann, die neue SAP-4.5-Software ist echt happig», wird der Liftspion sofort die Meldung machen, dass man in Ihrer Abteilung unfähig ist, einen Computer einzuschalten. Persönliche Gespräche sind ebenfalls tabu. Ein Satz wie: «Das war eine Nacht gestern, meine Herren!», verwandelt sich beim nächsten Halt in die Erkenntnis: «In der Revision wird auch nur noch gesoffen.»
Häufig kommt es wegen Überfüllung eines Aufzugs zu einer gewissen physikalischen Dichte an Menschenkörpern – mit all den damit verbundenen Nachteilen. Einige Kollegen husten, andere riechen nach nassem Hund, weil sie sogar bei starkem Regen mit ihrem Mountainbike zur Arbeit fahren, wieder andere besitzen eine auffällig große, bestenfalls von innen und schlimmstenfalls von außen behaarte Nase, die sich nun direkt vor Ihren Augen befindet. Senken Sie verschämt den Blick, dann schauen Sie in das appetitliche Dekolleté der Sekretärin des Personalwesens – auch keine Alternative. Da in Stoßzeiten der Aufzug auf jedem Geschoss hält, kommt es unweigerlich zu Rempeleien.
Um den meisten dieser Probleme zu entgehen, sollten Sie bei Fahrtbeginn möglichst links oder rechts vorne vom Ausstieg einchecken. Dort können Sie die Aufgabe des Liftboys übernehmen. Sie bietet das so dringend benötigte Smalltalk-Thema: «Welchen Knopf soll ich drücken?», ist eine höfliche und zugleich praktische Frage. Man wird Sie als umsichtigen Kollegen schätzen und Sie mit Ihrer Aufgabe weitgehend in Ruhe lassen.
Von vorneherein vermeiden können Sie jene Probleme, wenn Sie zwischen dem ersten und dem dritten Stock arbeiten – dann sollten Sie grundsätzlich das Treppenhaus benutzen. So wird außerdem Ihre Kondition gestärkt, und Sie kommen einen Tick frischer und vitaler an Ihrem Schreibtisch an. Ganz zu schweigen davon, dass es eine Zumutung für die Reisenden in die höher gelegenen Stockwerke ist, schon auf der ersten Etappe mehrmals zu halten. Und Sie ersparen sich und Ihren Mitreisenden den Standardspruch der notorischen Liftspaßvögel: «Der hält auch wieder an jeder Milchkanne, haha.»
In einigen wenigen Bürogebäuden gibt es noch Paternoster. Ich würde absolut für die Pflichteinführung dieser Menschenschaufeln plädieren. Nicht nur weil sie wahnsinnig praktisch sind, man stets eine Kabine für sich alleine hat (man traut sich so wenig, zu einem Fremden in den Paternoster zu steigen, wie man einen Ankerlift beim Skifahren mit einem Unbekannten nutzt) und sie bei der Durchfahrt im Keller oder Dachgeschoss einen gewissen Thrill erzeugen. Sondern vor allem, weil der Paternoster ein Spiegelbild der Seele, ein Kompass für die eigene Befindlichkeit sein kann. Tagsüber unterdrückter Ärger äußert sich bei mir immer in Albträumen, in denen sich der Paternoster so schnell dreht, dass ich keine Chance habe, abzuspringen. Erst wenn ich das Problem gelöst habe, normalisiert sich im nächsten Traum die Geschwindigkeit des Gefährts.
So mancher Vater und so manche Mutter legen auf dem Weg zum Schreibtisch noch einen Zwischenstopp im Betriebskindergarten ein. Das ist eine Einrichtung, die vordergründig der Unterbringung des Nachwuchses dient, in Wirklichkeit aber spiegeln sich auch hier die Hierarchiestufen der Firma. Oder denken Sie im Ernst, dass Vierjährige keine Ahnung haben, was ihre Eltern beruflich tun und wer ihnen unterstellt ist? Möchten Sie, dass Ihr kleiner Dennis abends nach Hause kommt und Sie fragt: «Du, der Justin hat gesagt, wenn ich ihn nicht mit meinem Playmobil-Piratenschiff spielen lasse, schmeißt sein Papa dich raus!»? Doch, doch: Kinder wissen so was. Mir selbst drohte der neunjährige Sohn eines Vorgesetzten mit ernsthaften beruflichen Konsequenzen, nur weil ich behauptet hatte, dass Eminem ein blöder Poser ist.
Also: Wenn es irgend geht, schicken Sie den Nachwuchs in einen ganz normalen Kindergarten. Am besten in einen katholischen. Auch von dort wird Ihr Kind wahrscheinlich irgendwann mit einem schweren seelischen Schaden nach Hause kommen, doch immerhin wissen Sie, dass dann die ungehaltene Schwester Hanfriedia schuld war und nicht der Satansbraten der Kollegin, die Ihnen letzten Monat die sicher geglaubte Beförderung vor der Nase weggeschnappt hat.
In der Abteilung angekommen, führt der erste Weg in den Gemeinschaftsraum. Nach einem kurzen Blick aufs Schwarze Brett, an dem immer noch der Aufruf zur Betriebsratswahl von 1989 hängt – zwischen der Werbung für die Tischtennisgruppe der Betriebssportgemeinschaft («Kollegen sind Sportkameraden») und der Todesanzeige des verdienten Pensionärs Johannes Schlömer, der fünfunddreißig Jahre genau Ihren Job gemacht hat –, marschieren Sie zur Kaffeemaschine. Dieses Ritual wird auch dann nicht abgeschafft werden, wenn in allernächster Zukunft um die Bürogebäude herum nur noch Starbucks-Filialen stehen. An der Kaffeemaschine nämlich gilt es, sich über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen zwölf Feierabendstunden (Wie war «Wetten, dass …?»? Ist Rolf wieder bei seiner Frau eingezogen? Gibt es neue Praktikantinnen?) zu informieren. Hier treffen Sie die Herolde des Büro-Olymps. Dass der Kaffee ungenießbar ist, weil irgendjemand gestern wieder vergessen hat, die Maschine auszustellen, und der eingebrannte Bodensatz die Zweizentimetermarke überschritten hat, soll Sie nicht stören. Schnappen Sie sich einfach einen der Becher aus dem Schrank (und zwar möglichst nicht die private «Prinzessin-Diana-Gedächtnis»-Tasse der Chefsekretärin) und hören Sie sich ein bisschen um. Die eigene Zunge sollen Sie allerdings hüten. Ansonsten wird man, sobald Sie den Raum verlassen haben, über Sie reden. Und das wollen Sie ja wohl nicht – es sei denn, Sie waren maßgeblich am spektakulären Schmutke-Abschluss beteiligt (oder können halbwegs glaubhaft so tun, als seien Sie es gewesen).
Anschließend aber heißt es: An den Schreibtisch – wenn auch noch nicht an die Arbeit. Denn vorher muss der Kampf um das Raumklima ausgetragen werden.
Es ist eine Tatsache, dass unsere Umgebungsluft (jedenfalls bis zu einer Höhe von tausend Metern über dem Meeresspiegel) einen Sauerstoffgehalt von einundzwanzig Prozent aufweist. Selbst sogenannte verbrauchte Luft ist noch mit genügend O2 versetzt, um das Hirn in Gang zu halten – es sei denn, Sie lassen in Ihrem Papierkorb verräterische Akten in Flammen aufgehen, weil eine Finanzprüfung ins Haus steht und der Schredder gerade in der Chefetage dringender benötigt wird. Dennoch ist der Ruf «Ich brauche meinen Sauerstoff!» das Totschlagargument derjenigen, die meinen, dass sie nur bei offenem Fenster ihre ganze Produktivität entfalten können. Vielleicht gehören Sie ja selber zu denen, die es vollkommen normal finden, mit einem dicken Schal (bei Minusgraden auch mit Handschuhen und Pudelmütze) am Schreibtisch zu sitzen. Ich nicht! Mir ist das unheimlich. Für mich ist das geschlossene Fenster der Urzustand eines Raumes, denn um sie zu schließen, sind sie schließlich eingebaut worden. Lüften sollte also sparsam betrieben werden. Dreimal täglich einige Minuten halte ich für angemessen. Bei Regen und vor allem bei Sturm sollte man ganz darauf verzichten. Um das Gehirn mit einem Zusatzkick an Klarheit zu versorgen, ist beispielsweise die Mittagspause eine gute Gelegenheit. Statt in der Kantine in Frittierfettschwaden zu baden – laufen Sie einmal um den Block! Anschließend sind Sie frisch und erholt und haben vielleicht an einem Obststand einen Apfel aus regionalem Anbau erworben, der sicherlich gesünder ist als der übersüßte Obstsalat, den Ihre Kollegen zum Nachtisch hatten. Oder, wenn Sie unbedingt mögen, gehen Sie in den nächsten «Coffee-to-go»-Shop. Dort ist die Luft immer frisch, da man nicht rauchen darf, und es gibt außer gutem Kaffee jede Menge Getränke, die gesund sind oder zumindest den Preis von etwas außerordentlich Gesundem haben.
Genauso wenig verstanden haben die Idee des Fensters aber die Architekten, denen geschickte Händler die ersten Klimaanlagen verkauften. Um diese zu betreiben, dürfen die Fenster nämlich niemals geöffnet werden. Das ist in vielen Fällen technisch auch gar nicht möglich. Überhaupt sind Klimaanlagen eine unangenehme Erfindung, nichts anderes als Umwälzstationen für schlechte Luft. Sie stellen sicher, dass Sie am eigenen Leib erfahren können, mit welch seltenen Viren die Abteilung Immobilien-Controlling drei Stockwerke unter Ihnen derzeit kontaminiert ist. Klimaanlagen können den Lebensraum Büro schwer schädigen, indem sie ganze Abteilungen durch die Verbreitung eingeschleppter Krankheiten arbeitsunfähig machen.
Umgeben von Glas, das in eine Struktur aus Beton gesetzt wurde, und schlechter Luft – so verbringen wir also den Großteil unseres Lebens. Hans Struhks Kral-Ideal wurde nur selten umgesetzt. Das moderne Büro gleicht eher einem Aquarium. Manche sagen zu Recht: einem Haifischbecken. Doch bevor es um Jagen und Gejagtwerden geht, muss dieser Lebensraum genauer erkundet werden.
2. Timbuktu liegt im Keller
Expedition zu mythischen Orten
So wie der Globus unserer Welt weist auch die Landkarte einer Firma kaum noch Lücken auf. Spätestens nach vier Wochen im Betrieb weiß selbst der dümmliche Neffe des Besitzers, wo was zu finden ist. Dennoch gibt es sie, die weißen Flecken. Orte, von denen flüsternd, mit Respekt oder gar Angst berichtet wird. Mythische Orte, an denen angeblich Ungeheuerliches geschieht und die Geschicke der Firma gelenkt werden. Aber auch bekannte Orte können Geheimnisse und Gefahren bergen, mythisch verklärt werden. Allein das Wort «Kantine» lässt den meisten Kollegen einen wohligen Schauder über den Rücken laufen. Und um das Raucherzimmer werden die erbittertsten Kämpfe ausgetragen.
Das Vorzimmer
So unterschiedlich die Gründe sein können, derentwegen man zum Chef gerufen wird (Beförderung, Ärger, Entlassung) – man kann sicher sein, dass man eine gewisse Zeit im Vorzimmer zu warten hat. Hier herrscht, umgeben von großformatigen Wandgemälden moderner Künstler mittlerer Preisklasse, die Chefsekretärin. Sie wird den Wartenden bitten, auf einem der Stühle Platz zu nehmen, und sich im Übrigen nicht um ihn kümmern. So sitzt er da, die Hände auf den Schoß gelegt, und sieht zu, wie ein Fax nach dem anderen aus dem Gerät kriecht. Vielleicht ist ihm ein Kaffee angeboten worden, aber er hat abgelehnt. Der Blick aus dem Fenster ist phantastisch, in einer Ecke steht der einzige mit Akribie gepflegte Ficus benjamini des Betriebs, und der Zeitschriftenständer wird täglich aktualisiert, obwohl ihm offensichtlich nie jemand ein Heft entnimmt. Die Zeit vergeht zäh. Das hat Prinzip. Warten fördert Unsicherheit, und die versetzt den Chef beim anschließenden Gespräch in eine überlegene Position. Lob wird sogleich relativiert, Tadel verstärkt, die Wichtigkeit einer zugeteilten Aufgabe erhöht.
Warten mehrere Personen, vermeiden sie es in der Regel, miteinander zu sprechen. Falls sie es doch tun, sind die Scherze schal, und vorsichtig wird man versuchen herauszufinden, warum der jeweils andere da ist.
Das Vorzimmer folgt eigenen Regeln, die den Wartenden verwirren. Andere Personen werden aufgeregt den Raum betreten, in aller Vertrautheit mit der Sekretärin plauschen und vielleicht sogar ohne anzuklopfen in das Büro des Chefs stürmen. Auch das ständig klingelnde Telefon hat eindeutig Vorrang vor dem Häuflein Mensch, das mittlerweile sämtliche Löcher in seinen Budapester Schuhen durchgezählt hat. «Moment noch!», sagt die Sekretärin, und das «Ja, natürlich» bleibt in einem trockenen Hals stecken, lediglich ein halbtapferes Kopfnicken verrät, dass da noch Leben ist. Sobald die Tür sich jedoch einen Spalt weit öffnet, wird der Wartende mit allen Sinnen versuchen, einen Eindruck von dem zu bekommen, was ihn erwartet: Ist da eine gereizte Stimme zu hören? Läuft jemand hektisch auf und ab? Oder steht sogar ein Cognacschwenker auf dem Tisch? Selbst wer genau zu wissen glaubt, warum er hier ist, wird in dem Moment daran zweifeln, in dem es heißt: «Sie können jetzt hinein.»
Das Büro des Chefs
Im Büro des Chefs erlebt man Anfang und Ende des Berufslebens. Hier ist man eingestellt worden, hier werden Gehaltserhöhungen verhandelt, Beförderungen ausgesprochen, hier wird man einst entweder gefeuert oder mit einem launigen Spruch in den Ruhestand verabschiedet werden. Und so versuchen viele Vorgesetzte, die Einrichtung ihres Büros dessen besonderer Bedeutung anzupassen. Meistens geht das schief.
In Norddeutschland verwandelt die Chefität ihre Zimmer mit Vorliebe in die Replik eines Reederbüros aus dem 19. Jahrhundert. Da gibt es reichlich schweres, dunkles Holz, gerne ein Stehpult, im Hintergrund einen Ölschinken, der Szenen aus der Handelsschifffahrt zeigt – und das völlig unabhängig davon, in welcher Branche das Unternehmen tätig ist. Weiter im Süden dominieren folkloristische Elemente. Bilder von prächtigen Berglandschaften, Holzschnitzereien, einmal habe ich sogar einen ausgestopften Eichelhäher gesehen, der mich während des gesamten Gesprächs mit kalten Augen musterte.
Fremd wirkt in solchen Büros der Computer. Auf den mag freilich selbst der konservativste Vorgesetzte nicht verzichten. Was nicht bedeutet, dass er ihn auch benutzt. Der Rechner im Büro von Franz Josef Wagner, unter dem ich ein paar Jahre in Berlin arbeitete, wurde während seiner gesamten Dienstzeit kein einziges Mal eingeschaltet.