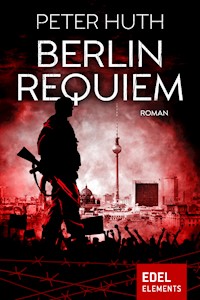9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Vorort wie aus dem Bilderbuch – doch was machen Vorzeigebürger*innen, wenn ihre hübsche Fassade bröckelt? In Peter Huths Roman ist ein Vorort von Berlin die perfekte heile Welt für Mittelschicht-Familien – bis ein unheilvolles Gerücht die Runde macht ... Für Fine und Tim ist das malerische Fischbach vor den Toren der Großstadt das Familienparadies, von dem sie geträumt haben. Unter den anderen Eigenheimbesitzern finden sie schnell Freunde für sich und ihre Tochter. Als ein älterer Herr einen kleinen Laden für Honig, Tee und Deko eröffnet, scheint er das letzte Mosaiksteinchen im Idyll zu sein: Immer hat er ein offenes Ohr für die Mütter und einen Kakao für die Kinder. Jeder in Fischbach liebt den Honigmann – bis ein schockierendes Gerücht über seine Vergangenheit die Runde macht. Plötzlich steht alles, das so sicher schien, zur Disposition: Freundschaften, Beziehungen, Wohlstand. Wie weit wird Fine gehen, um ihre Vorortidylle zu beschützen? So klug wie Dörte Hansen und so aktuell wie Juli Zeh: So sollte Gegenwartsliteratur sein. Der Journalist und Autor Peter Huth liefert Gesellschaftskritik und kluge deutsche Literatur in einem. Der Roman »Der Honigmann« erzählt pointiert von den Ängsten der Mittelschicht und dem Kampf um ihre scheinbar heile Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Peter Huth
Der Honigmann
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Für Fine und Tim ist das malerische Fischbach vor den Toren der Großstadt das Familienparadies, von dem sie geträumt haben. Unter den anderen Eigenheimbesitzern finden sie schnell Freunde für sich und ihre Tochter. Als ein älterer Herr einen kleinen Laden für Honig, Tee und Deko eröffnet, scheint er das letzte Mosaiksteinchen im Idyll zu sein: Immer hat er ein offenes Ohr für die Mütter und einen Kakao für die Kinder. Jeder in Fischbach liebt den Honigmann – bis ein schockierendes Gerücht über seine Vergangenheit die Runde macht. Plötzlich steht alles, das so sicher schien, zur Disposition: Freundschaften, Beziehungen, Wohlstand. Wie weit wird Fine gehen, um ihre Vorortidylle zu beschützen?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Erstes Kapitel
Grillen
Getränke
Der Eindringling I
Gutenachtgeschichten
Zweites Kapitel
Zucken
Männer
Der Brief
Lehrerzimmer
Hof
Drittes Kapitel
Das Gerücht
Recherche
Polizei
Fischbach-Mütter
Viertes Kapitel
Rückfallquote
Nachfragen
Vernissage
Neid
Fünftes Kapitel
Der Artikel
Demonstration
Das Schild
Konsequenzen
Sechstes Kapitel
Feuer
Verdacht
Elternversammlung
Verrat
Siebtes Kapitel
Geständnis
Wahrheit
Alibi
Der Eindringling II
Achtes Kapitel
Rückkehr
Väter
Verkauf
Idylle
Epilog
Danke
Für Julia
Prolog
Der Ort, an dem der Honigmann seiner Tätigkeit nachgehen wollte, war klein, geradezu winzig. Nur ein Raum, vielleicht 15 Quadratmeter für den Verkauf, aber angenehm hell durch die bodentiefen Schaufenster. Dahinter ein noch kleineres Zimmer und ein Bad, jedoch ohne Dusche. Aber die Lage war einfach zu ideal, um sich groß Gedanken darüber zu machen.
Eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, wo die Kinder nach dem Unterricht auf die Busse warten würden, der Schulparkplatz, auf dem die Mütter ihre SUV abstellten, ein paar Schritte entfernt. Auf der Straßenseite gegenüber ein Spielzeuggeschäft, der Ort für die schnelle Erfüllung kleiner Wünsche, einfach so, oder für eine gute Note, vielleicht auch als Ablenkung von einem Elternstreit zu Hause. Von seinem Laden aus sah der Honigmann, wie Jungen und Mädchen mit dem Selbstbewusstsein von Kindern, die ein regelmäßiges und üppiges Taschengeld bekommen und darüber frei verfügen können, in den Laden gingen und später mit bunten Papiertüten herauskamen.
Einmal, bevor er den Mietvertrag unterschrieben hatte, war er selbst dort gewesen, um zu sehen, was angeboten wird. Das war auch wichtig für sein Geschäft, er wollte kein Konkurrent sein; nichts, was es gegenüber gab, wollte er anbieten. Er würde das Angebot in Fischbach ergänzen und ausbauen. Im Marienkäfer gab es eine kleine Auswahl von teurer Kinderkleidung, vor allem für Mädchen, aber auch Spielzeug in allen Preisklassen: von Flummis über diese seltsamen Würmchen, die man hinter sich herzog, bis hin zu Treppensteigern, niedlichen kleinen Taschen, ein bisschen Naturspielzeug, Lupen und Botanisiertrommeln, die nie benutzt werden würden. Der Zauberwürfel in allen möglichen Varianten, in einem Regal Lego-Bausätze, Harry Potter und Star Wars. Auch Schleichfiguren, aber nur die pädagogisch wertvollen, nicht diese Fantasy-Feen auf grellbunten Einhörnern oder Eisdämonen und Feuerdrachen. Es war ein Laden für gute Kinder. Kinder, aus denen etwas werden würde.
Aber es war kein Laden für deren Mütter.
Die würden bei ihm einen Ort finden, der wie für sie gemacht war. Wegen seines Angebots in den Regalen, vor allem aber seinetwegen. Er war ein ausgezeichneter Zuhörer.
Der Honigmann, der nicht wusste, dass er eines Tages so genannt werden würde, arrangierte ein kleines Ensemble aus erdfarbenen Kerzen um einen mit einem Teelicht betriebenen Zerstäuber für Duftöle, die wiederum in einem hohen Regal in allen nur denkbaren Noten angeordnet waren: »Traumfänger«, »Tropennacht«, »Wüstenwind« und »Ozeanische Gefühle«. Das Geschäft des Honigmanns bestand auch aus Illusion.
Dann setzte er sich in den großen brokatbezogenen Sessel im hinteren Teil des Raums, von dem aus er einen guten Überblick hatte, ohne selbst gleich bemerkt zu werden. Seine Kunden würden kommen, um sich umzusehen, zu stöbern. Hastige Beratung oder ein aufdringliches Verkaufsgespräch würde nur verschrecken, die Mütter sollten ihn ansprechen, der Rest sich dann entwickeln. Er war ein verbindlicher Mensch, ohne aufdringlich zu sein, das war schon immer seine Kunst, eher ein Talent gewesen.
Der Honigmann sah sich noch einmal um, stand wieder auf, um in einem Regal Kleinigkeiten neu anzuordnen, hier und da mit einem Tuch einen Gegenstand zu polieren. Alles stand so eng beieinander, puppenstubenhaft, dass es viel Zeit kosten würde, alles in einem stets perfekten Zustand zu halten. Nachlässigkeiten konnte er sich nicht erlauben. Kein Dreck, kein Staub, nichts, was von seinem Platz verrückt war oder gar angeschlagen. Alles hatte heil und sauber zu sein, so als ob es genau dafür hergestellt worden wäre, genau dort zu stehen. Sein Laden musste ein Ort der Perfektion sein, denn Perfektion – oder eben die Illusion davon – schafft Vertrauen und vertreibt jeden Zweifel.
Schließlich entschloss er sich, die günstigeren Honigsorten, die der Junge ihm aus Rumänien geschickt hatte, auf Augenhöhe zu sortieren. Seine Bückware sollten nicht die einfachen Sorten, sondern die speziellen sein, die, auf die er seine Kundinnen hinweisen würde.
Nach zwei oder drei Stunden konzentrierter Arbeit war alles so, wie er es sich vorgestellt hatte. Er überprüfte die Espressomaschine, indem er einen Latte macchiato zubereitete, den er aber nicht trank, sondern gleich in das Waschbecken im hinteren Raum schüttete. Der Honigmann empfand Milch und alles, was daraus hergestellt wurde, als ungenießbar. Aber die Frauen, die zu ihm kommen würden, liebten Cappuccino und Latte. Er selbst trank nur Leitungswasser, stets stand eine Karaffe neben seinem Sessel. Nun füllte er sie und stellte sie neben das Bett im hinteren Zimmer. Der Vermieter hatte ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass er einen Laden und keine komplette Wohnung anbieten würde, aber erkennen lassen, dass es ihn nicht interessierte, wenn er hier auch übernachten würde.
Der Raum war karg möbliert, nur ein Bett und ein weißer Schrank an der Wand, in dem der Honigmann seine beigen Hosen und die schwarzen Hemden aufbewahrte. Er hatte mehrere davon, er trug nie etwas anderes. Auch Gleichförmigkeit schaffte Vertrauen, es ging darum, nicht aufzufallen und trotzdem präsent zu sein. Auf dem schmalen Bett lag teure Seidenbettwäsche, der einzige Luxus, den er sich gönnte. Keine seiner Kundinnen würde diesen Raum jemals betreten. Er zog sich aus, wusch sich und ging zu Bett. Er griff zu einem Buch, einer rumänischen Ausgabe des Don Quixote, legte es aber bald weg, weil er merkte, wie müde die Arbeit ihn gemacht hatte. Er löschte das Licht. Der letzte Gedanke des Honigmanns galt der Eröffnung am nächsten Morgen, und er verspürte ein angenehmes Gefühl leichter Aufregung. Er war sich sicher, alles richtig gemacht zu haben.
Erstes Kapitel
TIM
Ich selbst habe den Honigmann nie kennengelernt. Aus Honig mache ich mir nichts und noch weniger aus diesem Dekokram, den er in seinem Laden verkauft hat. Tassen, Vasen, Kerzen, Gläser, Duftöl, Tee in bunten Verpackungen. Solches Zeug. Staubfänger. Fine sieht das natürlich anders. Wir haben eine Regel: Für jedes neue Stehrumchen, das sie kauft, muss ein anderes weggeworfen werden. Wir ersticken sonst in diesem Krempel. Sie hat versucht, mich auszutricksen, und immer mehr Tee gekauft, »Tee der Hundertjährigen« beispielsweise. Keine Ahnung, was das war, Tee jedenfalls nicht. Lange, getrocknete Stiele von irgendeiner Wunderpflanze aus den Bergen von Rumänien, wo die Leute eben hundert Jahre alt werden. Man kennt ja diese Geschichten. Mal ist es Rumänien, mal Kreta, mal woanders: Mittelmeerdiät, auf Fisch basierende Ernährung bei den Japanern. Fine hat sich sogar eine Netflix-Doku darüber angesehen: »Die blauen Zonen«. Gut, man konnte ihn schon trinken, diesen Sud aus dem rumänischen Gestrüpp, er schmeckte zwar nach nichts, und viel besser habe ich mich nachher auch nicht gefühlt. Dabei habe ich sehr viel »Tee der Hundertjährigen« getrunken in den letzten Monaten.
Der Laden vom Honigmann war mir zum ersten Mal aufgefallen, als wir vom Italiener kamen, mit Carla. Das muss im November gewesen sein oder im Dezember, jedenfalls war es ziemlich kalt. Wir standen auf dem Schulparkplatz, ich wollte möglichst schnell zum Auto und meine Tochter auch. Doch Fine blieb vor dem Schaufenster stehen und war gar nicht mehr wegzubekommen. Alles war schon angeordnet und dekoriert, durchaus mit Geschmack, muss ich sagen. Dass der Laden ein Erfolg werden konnte, war mir gleich klar. Fine und die anderen Frauen hier, die mögen so etwas, sie müssen sich ja ständig Kleinigkeiten mitbringen. Zum Geburtstag, zu Ostern, zu Weihnachten, wenn sie sich besuchen oder zum Abendessen eingeladen sind. Und natürlich als Schuljahresendgeschenke für die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist hier so ein Brauch. Ich persönlich kann mich nicht erinnern, dass wir unseren Lehrern mal was geschenkt haben, aber das hat sich in den letzten zwanzig Jahren eben total verändert. Es gab einen Riesenbedarf für diese Mitbringsel bei uns in Fischbach, nicht zu teuer, nicht zu günstig, ganz und gar nutzlos, aber eben nett. Da hatte dieser Honigmann schon einen guten Riecher.
»Das ist genau, was uns hier noch gefehlt hat«, sagte Fine, als wir im regnerischen Halbdunkel vor dem Geschäft standen. »Die perfekte Frauenfalle«, sagte ich und weiß noch, dass eine ältere Frau, die ich gar nicht kannte, in diesem Moment an uns vorbeilief und laut lachte.
Wir sind vor über zehn Jahren nach Fischbach gezogen, und ich muss sagen, dass es die beste Entscheidung unseres Lebens war. Nicht nur für Carla, sie ist jetzt sieben, sondern auch für Fine und mich. Eigentlich ist es verrückt. Wir beide hatten ein Leben lang davon geträumt, raus aus der Provinz zu kommen und in die Großstadt zu ziehen. Wohnung mit Dachterrasse, Blick über die Stadt. Wir hätten uns nie Yuppies genannt, das war damals schon ein Schimpfwort, aber wir waren die klassischen Dinks: Double Income, no Kids. Fine hatte eine sehr gute Rolle in der Serie bekommen, viele Drehtage. Sicher nicht der Traum, den sie gehabt hatte, als sie auf der Ernst-Busch-Hochschule war, aber eine sichere Sache und fantastisch bezahlt. Ich selbst musste mehr Projekte ablehnen, als ich annehmen konnte. Es gab damals noch nicht so viele Programmierer wie heute. Also richtig gute. Und ich war richtig gut.
Da saßen wir also in unserer Terrassenwohnung in der Stadt und tranken Prosecco, rauchten jeden Abend zwei, drei Joints, hörten Radiohead und tanzten ein bisschen zu den Lichtern der Stadt. Die Staffelmiete war viel zu hoch, aber wir wussten unser Geld nicht besser auszugeben. Das exzessive Reisen hatten wir schon hinter uns, außerdem musste Fine sich nach dem engen Drehplan richten. Wir wollten jetzt erwachsen sein und das auch zeigen. Während alte Freunde von uns noch zu Ikea fuhren, waren wir jeden Samstag im »Stilhaus«. Dort gab es Möbel, die teuer waren und schäbig aussahen, gemacht für Terrassen wie unsere. Dazu Terrassengärtnerzeug für Terrassengärtner, speziellen Terrassengartendünger für Terrassenpflanzen, die uns am Ende doch egal waren. Es war eine gute Zeit. Zu unseren drei, vier Lieblingsrestaurants waren es nur ein paar Schritte, und egal, wie voll es war, wir bekamen immer einen Tisch. Natürlich wegen Fine. Sie war ein bisschen ein Star. Manchmal, wenn wir am Fenster saßen, kamen Fotografen und schossen Bilder von ihr durch die große Frontscheibe. Ihr war das unangenehmer als mir. Ich war nämlich ziemlich stolz auf meine Frau. Zugegeben auch darauf, dass sie meine Frau war.
Welche Jahreszeit war, merkte ich überhaupt nicht mehr. Ich stieg vor der Tür ins Taxi und ließ mich in die Firma fahren, für die ich gerade irgendein System entwarf. Auch da lief es richtig gut, das war noch vor free lunch und Kickertischen auf jeder Etage. Leistung war gefragt und wurde mehr als fair bezahlt. Die Twin Towers und den Irak hatten wir alle schon vergessen, und wir mussten Betroffenheit vorspielen, wenn unsere Freunde von ihren Zukunftsängsten erzählten.
Doch die Stadt veränderte sich. Die Sauftouristen kamen mit easyJet und Ryanair, und sie tobten die ganze Nacht durch die Straßen. Irgendwann hast du keine Lust mehr, jeden Morgen über irische Kotze zu stolpern. Fine hatte das noch mehr genervt als mich. Es ist auch vorgekommen, dass sie dumm angemacht wurde. Ihr erster Kinofilm war ein kleiner Erfolg, und die meisten können ja nicht zwischen Rolle und Darstellerin unterscheiden. Privat ist sie ganz anders als im Job, auf jeden Fall nicht diese Frau aus dem Kinofilm. Als ich das Ding zum ersten Mal sah, hatte ich sie gar nicht erkannt. Eindrucksvoll. Aber auch beängstigend.
Unsere geschützten Räume, die Läden, wo man uns kannte und die Kellner über Fine wachten, gingen verloren. Damals waren es nicht hohe Mieten oder explodierende Energiepreise, sondern Wirte, die den Unterschied zwischen brutto und netto nicht verstanden. Erst machte der Rabe zu, dann das Venti Tre, und irgendwann orderten wir unser Essen nur noch; es gab da diesen Lieferservice, der à la carte aus ausgewählten Restaurants brachte. Aber nicht lange, es rechnete sich nicht. Außerdem war es ziemlich mies von uns, dort zu bestellen, weil wir im sechsten Stock ohne Aufzug wohnten. Der einzige Nachteil der Wohnung. Uns war das egal, weil wir ja nichts schleppen mussten – die Lebensmitteleinkäufe erledigten wir online. Irgendwie konnte das alles nicht so weitergehen, das wurde uns mehr und mehr klar.
Mit dem Honigmann war es auf jeden Fall so, dass er schnell zu einem festen Bestandteil von Fischbach wurde, so wie der Bach, die »Mühle«, die Friedrichschule, der Kaiser’s-Kaffee-Supermarkt, der Marienkäfer und der Tennisverein.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen, die da jeden Tag gesessen haben, überhaupt wusste, wie der Inhaber hieß. Alle nannten ihn nur »den Honigmann«. Im Nachhinein ist das natürlich eine total kranke Ironie.
Wenn Fine von ihm erzählte, habe ich nie richtig zugehört. Sosehr ich Fischbach mochte, so wenig interessierte mich diese neue Gesellschaft mit all ihren komplizierten Regeln und Ritualen, die da gewachsen war. Für mich war schon die Eigentümerversammlung in der Siedlung oder ein Elternabend Horror. Mit den alten Fischbachern hatten wir nicht wirklich was zu tun, die saßen bei Kaiser’s an der Kasse oder waren Elektriker oder Klempner. Da sah man sich mal. Aber für sie war Fischbach einfach der Ort, an dem sie lebten, weil ihre Eltern schon hier gewohnt hatten. Der reichste Mann, bevor wir Familien kamen, soll übrigens der Bestatter gewesen sein. Schon verrückt. Die alten Fischbacher starben, die jungen zogen in die Stadt, wo wir herkamen. Für uns war es eine Oase.
Der Honigmann, sagte ich mal zu Robert, meinem Nachbarn und besten Freund, war schon ein guter Geschäftsmann. Die Kinder strömten gleich nach der Schule in seinen Laden, bekamen einen Kakao, und die Mütter holten sie dann bei ihm ab. Tranken noch einen Latte, plauderten mit dem Mann und untereinander und kauften dann das hundertste Honigglas oder den nächsten Tee der 100-jährigen Rumänen. Die Einzige, die das mit dem Honigmann auch kritisch sah, war Louisa, aber die hatte ja auch einen echten Hasso-Lohenstein-Knall, der mit seiner »Mühle« für sie das personifizierte Fischbach war. Und der Honigmann eine Bedrohung. »Nicht dass die Leute jetzt nicht mehr zu Hasso gehen, wenn der immer seinen Latte verschenkt«, hatte sie gesagt. »Fair enough«, meinte ich zu Robert, wenn das sein Geschäftsmodell ist. Aber mein Freund kam, seit er seinen Job beim Magazin verloren hatte, nicht mehr gut damit klar, wenn andere Erfolg hatten.
Mir war vor allem wichtig, dass Fine sich wohlfühlte. Sie war wegen ihres Berufes immer scheuer geworden. Zu viele Leute, die sie blöd anquatschen, man macht sich da keine Vorstellung. Die, die nur ein Selfie wollen, sind die harmlosesten. Aber es gibt auch die, die offenbar denken, dass jemand, der mal in einer Serie mitgespielt hat, so eine Art Allgemeingut ist. Die kommen an und nerven. Und lassen nicht locker. Das war der Grund, warum Fine vergangenes Jahr aus der Serie ausgestiegen ist. In der Rolle setzte sie – schwanger vom falschen Kerl, verzweifelt – ihren Porsche gegen eine Ampel und war so nach einer letzten Nahaufnahme Geschichte. Eine Woche später gab es eine neue Zickenblondine, Bettina Anden hieß die.
Fine spielte dann wieder Theater, eher leichte Sachen, aber auch schon mal was Ernstes. »Barfußrollen« nannten wir das, weil die Regisseure immer, wenn sie eine Figur besonders verletzlich darstellen wollten, sie ohne Schuhe auf die Bühne schickten. Ihre Kinohauptrolle war für sie eine Art Ritterschlag, auch wenn die Dreharbeiten auf Gozo eine dreimonatige Trennung bedeuteten – ich war die ganze Zeit mit Carla allein. Wir vermissten sie, aber fanden schnell unseren eigenen Rhythmus. Wegen Corona konnte Carla damals nicht in den Kindergarten gehen, und ich arbeitete schon im Homeoffice, als es nicht Pflicht, sondern noch ein Privileg war. Seit letzten Frühling sind mein Nachbar und ich die zwei Hausmänner hier, die den ganzen Tag in Fischbach sind. Robert nicht freiwillig, für ihn war das eine Katastrophe, klar. Für mich eine angenehme Abwechslung.
Als Fine von Gozo zurückgekommen war, waren unsere Nachbarn ziemlich stolz auf sie. Vorher, als sie noch Fernsehen gemacht hatte, war das nie ein Thema gewesen. Niemand schaute sich die Serie an, keiner interessierte sich dafür. Das war jetzt anders. Vor allem Louisa konnte nicht genug davon hören, wie das war mit dem Regisseur, der, wie alle Regisseure, einen ziemlich üblen Ruf hatte. Ach Quatsch, sagte Fine, der ist eigentlich total normal.
Ihr selbst hatte das Leben in Fischbach als Unprominente ganz gut gefallen. Sie stand nicht gern im Mittelpunkt. Großer Unterschied zu Louisa, der noch nicht entdeckten Künstlerin.
Trotzdem hatten wir uns, als wir eingezogen waren, gefragt: Wurde Fine tatsächlich von niemandem erkannt? Oder war es den Leuten einfach egal? Ich weiß noch, als Katja und Robert das Haus nebenan gekauft haben. Katja hat echt zu Fine gesagt: »Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind?« Dabei ist Katja vierzehn Jahre älter als sie. Robert hatte es ihr dann erklärt. Katja war vollkommen überrascht, dass er die Serie überhaupt kannte und dass er die Zeit fand, sich so etwas anzusehen. »So etwas?«, hatte ich gefragt, damit Fine es nicht tun musste, das war Katja dann peinlich, aber Fine war ganz locker und hat die beiden für den Abend eingeladen, weil sie ja noch auf den Umzugskisten saßen und ihre Küche erst in ein paar Wochen geliefert werden sollte. Es war unser erster Freundschaftsabend in Fischbach.
So ist es hier. Klar weiß jeder von jedem, was er macht, beruflich, aber es spielt keine Rolle. Es geht um die Kinder, vor allem um die Kinder, immer und immer wieder um die Kinder, um die Lehrer, die Erzieher, ob es wirklich gut ist, dass es an der Friedrichschule keine Noten gibt, und ob die Kinder später auf dem Gymnasium zurechtkommen. Dann um den Garten, dass Bambus zwar super aussieht, sich aber vermehrt wie Entengrütze und megaspitze Triebe hat, die einem die Crocs durchbohren. Wie teuer doch Rindenmulch geworden ist. Wer einen guten Handwerker kennt, der es mit der Rechnung nicht so genau nimmt. Neuerdings: was das mit den Wärmepumpen soll und ob das auch für uns gilt. Ob Schröders ihr Boot tatsächlich das ganze Jahr in der Einfahrt stehen lassen dürfen. Wer sein Haus wie zu welchem Zinssatz finanziert hat. Wie lange wer noch abzahlen muss. Ob die Immobilienpreise immer weiter steigen. Betongoldprobleme. Diese Sachen.
Vor allem aber sind wir damit beschäftigt, glücklich zu sein und uns das gegenseitig immer wieder zu versichern: Ob es irgendwo schöner sein könnte als hier? Nein! Unsere kleine Bullerbü-Siedlung, nur vier Doppelhaushälften. Nach hinten raus nur ein paar Schritte bis zum Bach. Die Kinder könnten es ja nicht besser haben! Ich glaube, jetzt lebt sogar ein Waschbär hinter dem Haus. Nachts hören wir jedenfalls diese komischen Geräusche. Ich hab das gegoogelt, es gab ein Soundfile. Hörte sich genauso an.
Fine und ich fragen uns oft, ob Carla das überhaupt zu schätzen wusste. Die kleinen Staudämme, die sie bauen, die Jagd nach den Forellen, die sie gottlob nie erwischen. Die Frösche, die nachts rufen. Die Freunde, bei denen man nicht anrufen muss, um sich zu verabreden, sondern einfach so vorbeigeht, in den Garten marschiert und immer jemanden zum Spielen findet. Ich hatte eine schöne Kindheit. Aber Fischbach ist das Paradies.
Auch für uns Erwachsene. Am Anfang, als ich noch in der Stadt gearbeitet habe, fiel jedes Mal der ganze Stress von mir ab, wenn ich über die Brücke in Potzow gefahren bin. Fischbach, das ist für uns eigentlich gar kein Wohnort, sondern eine Art Ferienresort, nur eben für das ganze Leben. Dachten wir. Hier ist alles gut. Der Duft von Gegrilltem, das ganze Jahr, auch im Winter. Die Abende in der Mühle, rotweintrunken, über alles schwadronierend, jeder wusste, dass wir hier keine Probleme lösten, sondern einfach nur schlaumeierten. Aber alle machten mit, weil es einfach ist, wunderbar. Ja, zugegeben. So richtig erstklassig essen wie im Berndstein kann man hier nicht, aber wer will schon einen Flammkuchen beim Sonnenuntergang über den roten Ziegeln des Mühlenhauses gegen ein Sternemenü in der Stadt tauschen? Selbst unsere Paketboten sind freundlich und geben die Sachen, wenn niemand da ist, bei den Nachbarn ab, statt sie in irgendeinem Handy-Laden abzuwerfen, in dem die Besitzer Shishas rauchen und kein Deutsch sprechen.
Das typische Problem, das wir hier in der Schule haben, lautet wie folgt: Fine überlegt, ob es okay ist, zum dritten Mal den gleichen Apfelkuchen mit zum Elternabend zu bringen, oder ob das so wirkt, als ob ihr nichts mehr einfiele. Wir haben keine Probleme mit Gewalt oder Mobbing, wir freuen uns, wenn die einzige türkische Mutter hier ihren Börek zum Sommerfest mitbringt. Die Nachrichten über die Schulen in der Stadt, gerade mal 20 Kilometer von Fischbach entfernt, kommen uns vor wie Meldungen aus einem anderen Land. Wenn Lehrer unsere Schule verlassen, dann weil sie in Rente gehen.
Wir waren alle so trunken vor Glück, hier zu sein, in Fischbach, dass wir überhaupt gar nicht auf die Idee kamen, dass diese Idylle von irgendetwas bedroht werden könnte. Und als es so weit war, wollten wir es einfach nicht wahrhaben. Es durfte nicht sein, was nicht sein sollte.
Ich selber habe den Honigmann nie kennengelernt. Der Mann, der unsere wunderbare Welt zerstört hat, hat für mich kein Gesicht.
Grillen
Obwohl er den Gag schon in allen möglichen Variationen gehört hatte, lachte Tim immer wieder.
»Hier, was ganz Besonderes. Sehr schwer zu bekommen. Muss in Frankreich bestellt werden, es gibt eine ewig lange Warteliste. Drei, vier Jahre. Mindestens«, sagte Robert und drückte seinem Nachbarn die Flasche in die Hand. »Ein Monsieur Rothschild de la Lac de Claqueur Albert et Louisa, Jahrgang 1999. Tiefenlage Chirac de Chereau.«
Tim nahm den Rotwein mit einem anerkennenden Kopfnicken und kennerhaft geschürzten Lippen entgegen, dann drehte er die Flasche in seinen Händen, so vorsichtig, als wäre sie ein Säugling. »Ihr seid einfach zu gut zu uns«, sagte er, umarmte erst Robert und dann Katja. Küsschen links, Küsschen rechts, auf das dritte, so hatte es sich ergeben, verzichteten sie. Den Wein stellte er dann beiläufig auf einem Terrassentisch ab. Es war ein durchschnittlicher Syrah, den er vor vielen Jahren bei ihrem ersten Besuch bei Robert und Katja mitgebracht hatte. Weder Robert noch er verstanden sonderlich viel von Wein, Tim kaufte nach Preis und Etikett, Robert macht es nicht anders. Das hatten sie sich, schon ziemlich angetrunken, an jenem ersten Abend gestanden und es sich seitdem leicht gemacht. Als Mitbringsel wurde immer diese eine Flasche Syrah mitgebracht, ein Wanderpokal, der die lästige Mitbringselpflicht erfüllte. Mittlerweile sahen sich die Nachbarn täglich, auf dem Hof, und mindestens einmal pro Woche zu einem Abendessen. Der Monsieur Rothschild, der auch mal ein besonders exquisiter Bordeaux, ein aus einem Wrack im Roten Meer geretteter Cabernet Sauvignon oder ein in einem Winzerkollektiv im armenischen Hochland gekelterter Primitivo war, ersparte viel kompliziertere Auswahl- und Angeberarbeit. Für Tim und Robert war ein Rotwein gut, wenn er schwer war und angenehm betrunken machte.
Wenn Albert und Louisa gleich da wären, würde echte Weinkennerschaftssimulation gefragt sein. Albert war Controller bei einer großen Firma, deren Namen aus einer komplizierten Abfolge von Buchstaben und &-Zeichen bestand. Tim hatte, bevor er Albert kennengelernt hatte, nie von der Firma gehört, genauso wenig wusste er, was ein Controller überhaupt machte – beides nicht so schlimm, hatte Albert mit einem feinen Lächeln gesagt. Er kannte sich gut mit Wein aus, auf jeden Fall so sehr, wie man es in einem Wochenendseminar in der Toskana eben lernen konnte, lästerte Tim. Für Albert, bless him, der viel netter war, als es ihm möglich war aufzutreten – da waren sich die Freunde einig –, waren solche Sachen wichtig. Auch beruflich, wie Albert stets beteuerte. Warum auch immer, dachte Tim.
Der Wein jedenfalls, den er mitbrachte, war immer so gut, dass er keinesfalls auf einem Beistelltisch landete, sondern gleich geöffnet wurde, als Ouvertüre des Abends.
»Die besten Weine immer zuerst«, sagte der gutmütige Albert, der wusste, dass er, wenn die beiden anderen Paare bei ihnen eingeladen waren, nichts zu erwarten hatte. »Anschließend ist es ja nur noch Wirkung.«
Louisa, auch das war klar, würde entgegen allen Absprachen eine Kleinigkeit mitbringen. Und schon sah Tim aus dem hinteren Teil des Gartens, wo er den Grill vorbereitet hatte, wie Louisa Fine mit großer Geste einen kleinen Tiegel überreichte, mit einem gekreppten Papier über dem Deckel. Natürlich vom Honigmann, wahrscheinlich ein Oregano-Zimt-Honig aus dem südlichen Siebengebirge. Wenn es um kleine Geschenke ging, vergaß sie ihre Loyalität zu Hasso Lohenstein und seiner Mühle. Fine bedankte sich mit Küsschen und hielt das kleine Glas gegen die Sonne, begutachtete und drehte es und lachte dann so laut, dass Tim es bis zum Grill hören konnte.
Links von ihm, wo es zum Bach ging, spielte Carla mit den anderen Kindern: Nick und Justus, den Söhnen von Robert und Katja, die gut genug erzogen waren, um sich gegenüber den Jüngeren nicht aufzuspielen. Juno, Merle und Kitta (»Wer denkt sich um Gottes willen solche Namen aus?«, fragte sich Fine immer und hatte natürlich recht), den drei Kindern von Albert und Louisa. Die Kinder spielten schon den ganzen Tag zusammen, in dem Gebiet, von dem nicht klar war, ob es überhaupt noch zum Grundstück von Tim und Fine gehörte. Laut der Flurkarte, die sie vom Notar bekommen hatten, war das nicht eindeutig geregelt. Aber der Makler hatte ihnen allen beim Kauf der Häuser versichert, dass sie »unverbaubare Wassergrundstücke« erwerben würden. Das war auch so ein Running Gag unter den Siedlern – so nannten sich die Familien auf dem Hof –, denn das Wasser war der keine zwei Meter breite Fischbach, der von Nord nach Süd durch die Ortschaft floss. Hier, bei den Häusern, war der eigentliche Wasserlauf sogar noch schmaler, aber er überflutete die meiste Zeit des Jahres die längliche Nasswiese, die zwischen den kartografierten Grundstücken und dem Bach lag. Das war der Spielplatz ihrer Kinder, ein Barfuß- oder Gummistiefelparadies, je nach Jahreszeit. Frösche und Molche und im Bach auch ein paar Forellen. Keine 20 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt, wuchsen Carla und ihre Freunde hier wie in einem Buch von Astrid Lindgren auf. Wenn in den Giftspritzen-Medien die alternativen Viertel der Stadt spöttisch als »Bullerbü« tituliert wurden, musste Tim lachen. Hier, und nirgendwo anders, war Bullerbü.
Es gab keine Zäune zwischen den Grundstücken. Darauf hatten sich die vier Familien, die Land im hinteren, dem Bach-Teil der Siedlung gekauft hatten, geeinigt. Die beiden Doppelhäuser vorne waren durch einen gepflasterten Fahrhof von den hinteren Häusern getrennt. Das war der Ort, an dem sich die Erwachsenen trafen. Jeder sah, wer die schmale Einfahrt zur Siedlung herein- oder herausfuhr. Vor allem Tim, dessen Arbeitszimmer im ersten Stock perfekte Übersicht bot. Seit aber Robert seinen Job verloren hatte, verbrachte Tim viel Zeit damit, seinen Freund zu beobachten, wie er Arbeiten im Garten begann, ohne sie zu Ende zu bringen, und stattdessen schon am Vormittag Bier trank, weil er dachte, dass ihm niemand dabei zusah. Manchmal ging er zu ihm rüber und fragte nach einem Latte aus der eindrucksvollen Espressomaschine, die Katja und er sich in besseren Zeiten geleistet hatten; oder er bot großzügig an, mit Robert einen Joint zu teilen. Aber meistens wandte er sich seinen Programmierarbeiten zu. Spätestens um sechs füllte sich die Siedlung wieder mit Leben. Dann kamen die Mütter, die nach ihren Jobs in der Stadt die Kinder von der Schule abgeholt hatten. Die Friedrichschule ging bis 15.30 Uhr, eine Ganztagsschule, abgewandeltes Montessori, Fine hatte zuerst damit gefremdelt, aber Tim, der ehemalige Waldorfschüler, fand das Konzept gut. Nach der Schule wurden die Kinder zum Tennis, zum Karate, zum Klavierunterricht gefahren, das Angebot in Fischbach war mittlerweile ganz beachtlich. Mit den Siedlern hier und einem größeren Doppelhauspark jenseits der Hauptstraße und den anderen Neueinwohnern war das Angebot an Freizeitaktivitäten für die Kinder ständig gewachsen.
Gegen sieben kamen dann die Väter, auch Robert, als er noch arbeitete, und zu dieser Zeit, so hatte er es sich angewöhnt, schaltete Tim seinen Rechner aus und schlenderte auf den Hof, um zu erfahren, wie es den anderen in der Stadt ergangen war. Nichts davon interessierte Tim ernsthaft, aber er hatte nach einem Tag voller Zahlenkolonnen Lust auf Menschen.
Tim ging nun barfuß durch das nicht zu tief gemähte, von einem kurzen Schauer am Mittag noch feuchte Gras zwischen seinem Grillplatz an der hinteren Grundstücksgrenze und dem Haus, wo er das Fleisch abholen und Albert und Louisa mit Getränken versorgen würde. Dann wollte er schnell wieder zurück zu seinem Grill, ein Heineken in der Hand, ein zweites in der Hosentasche, um alles Weitere erst einmal aus der Distanz zu beobachten. Robert würde dann dazukommen, Albert auch, während die Frauen drinnen aufwendige Salate machten und sich gegenseitig für die Rezepte aus Kochbüchern von Tim Mälzer oder diesem israelischen Koch lobten. Er nahm einen Schluck Bier und war der festen Überzeugung, sich noch nie besser gefühlt zu haben als in diesem Moment. Alles war wie immer, und genau das war perfekt so.
»Na, gute Anreise gehabt?«, fragte er Albert, der eine White-Sox-Baseballkappe trug, um seinen schütteren Haarwuchs zu kaschieren. »Ja, wir haben es ja nicht weit«, antwortete er, auch das ein alter und bewährter Gag. Albert konnte darüber lachen, Louisa hingegen, die nun in einem Batikkleid, das sie mit ziemlicher Sicherheit bei Hasso Lohenstein in der Mühle gekauft hatte, zu den Männern trat, nicht. »Hör doch endlich mal damit auf, Tim«, sagte sie, nun schon ein Glas Aperol in der Hand. »Es sind gerade mal zweihundert Meter.«
»Aber eben auf der anderen Straßenseite«, erwiderte Tim. »Das ist, Louisa, ich will da ganz ehrlich sein, ein gewaltiger Unterschied.« Er wusste genau, wie er sie ärgern konnte. Louisa und Albert waren zwei Jahre nach ihnen nach Fischbach gekommen, als alle Häuser in der Bachsiedlung schon verkauft waren. Sie hatten ein viel größeres Haus jenseits der Straße bezogen, aber nur zur Miete. So gehörten sie, obwohl sie ständig in der Siedlung waren, nicht wirklich dazu. Dachte Louisa.
Als ihr Mann mit Robert und Tim die Küche verlassen hatte und zum Grillplatz abgezogen war, sagte Fine zu Louisa: »Lass dich von ihm nicht ärgern. Du weißt, wie er ist, wenn er gute Laune hat.« Louisa schüttelte den Kopf, ließ ihre roten Locken fliegen. Sie hielt Fine das Glas hin, die sofort nachschenkte, um ihre Freundin bei Laune zu halten. Andererseits galt es, alkoholmäßig die Balance zu wahren. Eine betrunkene Louisa war unberechenbar. »Ach, Quatsch«, sagte sie, nahm einen großen Schluck und hielt das Glas Fine gleich wieder hin. »Nur etwas Eis noch, bitte.« Aber ihr Grinsen verriet, dass es dabei nicht bleiben würde. »Ihr habt echt Glück gehabt mit den Häusern.« Und fügte leicht spitz an: »Und vor allem zu den Preisen. Wir waren zu spät dran, zwei, drei Jahre.« Sie zuckte mit den Schultern. »Vielleicht ergibt sich ja hier was, irgendwann.«
Louisa stellte ihr Glas auf dem Tresen in der offenen Küche ab. Sie war schon leicht beschwipst, und einen Moment überlegte sie, in welchem Haus sie überhaupt war. Alle acht Doppelhaushälften hatten exakt den gleichen Schnitt. Bei Fine sah es aus wie bei Katja und Robert. Selbst die Küchen waren identisch. Solide Qualität, aber kein Miele, wie bei ihr.
Katja, in einem Jeansrock und Ralph-Lauren-Polo, sehr sportlich, wie Fine bemerkte, trat zu den Frauen. Sie hatte nur die letzten Worte der Unterhaltung mitbekommen, als sie ohne Ankündigung oder Aufforderung zur Terrassentür hereingekommen war, wie sie es immer tat.
»Vor allem, wenn man bedenkt, wie schwer es war, die Häuser überhaupt an den Mann zu bringen. Weißt du noch, Fine, der Makler in diesem schäbigen Container, praktisch zwischen den Baugruben? Monatelang hat er dagesessen und auf Käufer gewartet.«
»Na ja, ganz so war es auch nicht«, sagte Fine, um das Thema zu beenden. »Eigentlich war es nicht mehr als ein paar Wochen.«
»Nein, nein, schon gut«, sagte Louisa. »Fine, alles in Ordnung. Wir waren eben einfach zu spät. Schicksal.«
Fine wusste, dass sie log. Also nahm sie den Tiegel mit dem Honig, Louisas Mitbringsel, in die Hand und drehte es noch einmal ausgiebig, studierte das Etikett. »Von Louisa«, sagte sie zu Katja, als ob es daran Zweifel gegeben hätte. »Rumänischer Hibiskus.«
»Interessant«, sagte Katja und ärgerte sich ein bisschen, weil sie der unausgesprochenen Regel gefolgt waren und nur den Wechselwein mitgebracht hatten. »Vom Honigmann, nehme ich an?«
»Bin heute nur kurz da gewesen, als ich die Jungs abgeholt habe. Diesen Honig hat er heute erst bekommen, es gibt ihn nur jetzt im Spätsommer«, sagte Louisa in gespielter Bescheidenheit. »Am besten isst man ihn auf Brot, ganz einfach ohne Butter. Hat er jedenfalls so empfohlen.« Sie kramte einen Zettel aus ihrer Prada-Clutch. »Und mir ein Rezept für ein rumänisches Schwarzbrot aufgeschrieben. Er ist wirklich ein irrsinnig netter Mann.«
Katja nickte. Sie selbst war heute Nachmittag im Laden gewesen, um Justus dort abzuholen. Der Junge verstand sich ganz besonders gut mit dem Honigmann. »Da sagst du was. Für Justus ist er ein größeres Idol als Ronaldo oder Messi. Jeden Abend hält er uns beim Essen Referate über Honigsorten und Bienen und über Rumänien.«
»Justus, der Honigmann-Lehrling«, sagte Louisa. »Vor den Ferien bin ich in den Laden gegangen, da war er ganz allein da und hat mich bedient. Hat er richtig gut gemacht. Ein kleiner Honigjunge, sozusagen.«
Katja nickte. »Das ist für ihn das Größte, wenn er aushelfen darf. Justus ist dann so stolz. Überhaupt, wie der Honigmann mit Kindern umgeht, ist ganz toll. Eigentlich hätte er Erzieher werden sollen.«
Fine stellte das Glas auf das Bord über der Arbeitsfläche zu all den anderen Honigen.
»Wer hilft mir mit den Salaten?«, fragte sie fröhlich.
»Gas«, sagte Robert. »Schon praktisch.«
Mit einer geübten Verrenkung hatte sich Tim hinter den Grill geschwungen, dort die Flasche aufgedreht und dann die Flamme mit einem klickenden Knopfdruck entzündet. Er nickte. Das Gas- oder Holzkohle-Thema war ein Dauerbrenner zwischen ihm und Robert. Als er seinen alten Rundgrill vor ein paar Jahren durch den teuren Weber ersetzt hatte, war das für seinen Freund, als habe er sich dem IS angeschlossen.
»Mir würde ja diese typische Holzkohlenote fehlen. Und das Ritual. Die Glut anzuheizen, zu sehen, wie die Kohlen erst rot und dann weiß leuchten – eben das Grillen am Grillen. Verstehst du, was ich meine?«
»Ja«, sagte Tim. »Das hast du schon erwähnt. Jedes Mal, wenn wir hier grillen, um genau zu sein.«
»Aber praktisch ist es schon, dein Gasdings«, wiederholte Robert versöhnlich. Er musste diesen Punkt einfach jedes Mal zur Sprache bringen, es ging nicht anders.
Albert begutachtete die beiden Platten mit den Würstchen für die Kinder, Fleisch und Scampi für die Erwachsenen. Die Zeiten der Grillexperimente und des Aufrüstens um die exotischsten Spezialitäten hatten sie alle lange hinter sich gelassen. Bei Tim gab es immer Entrecote, dazu ein paar Scampi mit einer sehr scharfen Knoblauch-Öl-Tunke, die er seine Spezialsoße nannte. Robert, der Holzkohlegriller, war der Mann für Rumpsteak am Stück, das er unter fachmännischem Messen der Temperatur und allerlei komplizierten Einstellungen der Belüftung an einer kleinen Lochscheibe, die viel zu heiß wurde, als dass man sie vernünftig bedienen konnte, zubereitete und zum Finale in daumendicke Scheiben schnitt.
»Vielleicht solltet ihr einfach die Grills tauschen«, sagte Albert, bei dessen Abendeinladungen es immer Sushi von einem besonders hochgelobten Restaurant in der Stadt gab. »Mit dem Gasgrill wäre dein Filet viel besser zuzubereiten, Robert. Weil man bei Tims Grill verschiedene Garzonen einstellen und die Temperatur besser bedienen kann. Versteht ihr, was ich meine?«
»Nein«, log Robert, und auch Tim schüttelte den Kopf.
»Du verstehst das nicht mit dem Grillen, Albert«, sagte Robert, während Tim die zweite Runde Bier eröffnete.
Albert rückte sich seine Baseballkappe zurück, zuckte mit den Schultern und stieß mit seinen Freunden an. Es gab Dinge, die würde er bei ihnen nie verstehen. Es wäre einfach logischer, wenn sie die Grills tauschen würden.
Es war Anfang September, und zu dieser Zeit des Jahres waren nicht mehr die Mücken das Problem der Draußenesser, sondern die Wespen. Die Tiere stürzten sich auf alles, was nach Fleisch roch. Auch jetzt saßen sie schon auf den Steaks. Albert versuchte, sie zu verscheuchen.
»Lass sie doch«, sagte Tim. »Die fressen sich nur für den Winter fett. Wenn sie jetzt nichts Vernünftiges essen, müssen sie sterben.« So hatten sie es Carla erklärt, nachdem sie auf der Wiese von einer Wespe gestochen worden war und es, wie Kinder eben sind, persönlich genommen hatte.
Nach einem heißen Juni war der Juli ziemlich verregnet, doch nun gaben die letzten Hochsommerwochen alles, was sie zu bieten hatten. Ausgerechnet mit Beginn des neuen Schuljahres war das Wetter wieder sommerferienheiß geworden. Zum Spielen blieben den Kindern nur noch die Abendstunden, die aber nutzten sie bis weit nach der Dämmerung in der Feuchtwiese und am Bach. Ihre Urlaubsreisen hatten sie schon fast vergessen. Carla trug eine bunte Strähne, die ihr eine Frau auf Mallorca geflochten hatte, Katjas Kinder hatten noch ihre Ostseecampingplatzbräune, und die drei Geschwister aus dem Haus auf der anderen Straßenseite erzählten von der seltsamen Tropeninsel mit Flughunden und bunten Fischen, auf der sie mit Albert und Louisa zwei Wochen verbracht hatten. Ferien waren Ferien, sechs Wochen, in denen man sich kaum gesehen hatte. Aber als alle wieder zurückgekommen waren, schien es so, als ob man nie getrennt gewesen wäre. Als hätte es die Pause nie gegeben, nahmen sie ihre Spielroutinen am Bach wieder auf. Nur Justus, der schon vor den Ferien irgendwie seltsam gewirkt hatte, war noch stiller und ruhiger geworden. Das war Fine aufgefallen, und sie hatte Tim darauf angesprochen. »Er ist jetzt zehn. Da ändern sich die Kinder eben. Warte mal ab, bis es mit Carla so weit ist.«
Carla roch einen vertrauten Duft und sah ihren Vater mit den beiden anderen Papas auf der hinteren Terrasse und den Rauch vom Grill in die Luft steigen. Obwohl sie die Zweitjüngste war, nahm sie ihre Rolle als Tochter der Gastgeber sehr ernst.
»Der Grill ist an«, rief sie ihren Freunden zu. »Gleich geht es los. Ich hab Hunger.« Die Kleinsten schien das nicht zu interessieren. Kitta schlug mit einem Stock immer wieder in den Bach, Merle und Justus standen bis zu den Knien im Wasser, auf der Suche nach Muscheln.
»Okay«, rief Juno, mit elf Jahren der Älteste in der Gruppe, und segnete so Carlas Vorschlag ab. »Let’s go. Wer hat Hunger auf Würstchen?« In breiter Formation stürmten die Kinder in Richtung Haus, um dort ihre nassen Hosen und T-Shirts gegen trockene Ersatzwäsche auszutauschen, die ihre Mütter in großen Taschen mitgebracht hatten. Auf halbem Weg kamen sie an Louisa vorbei.
Na ja, dachte Louisa. So großartig sind die Häuser auch nicht. Sie war nicht so blöd, an den Maklerspruch, dass formalarchitektonisch jede Doppelhaushälfte theoretisch ein eigenes Haus war, weil es eine wenige Zentimeter breite Brandmauer zwischen den Hälften gab, zu glauben. Am Ende waren es Doppelhäuser, wie es sie in anderen Neubaugebieten im Umland hundertfach gab. Hier in der Fischbach-Siedlung war einfach nur zu wenig Platz gewesen, eine weitere große Trabantenstadt aus diesen Ziegelklötzen zu bauen, die einander wie eineiige Zwillinge glichen. Alle zweistöckig plus Dachgeschoss, alle mit dem gleichen Schnitt, den gleichen Stürzen, Türen, Terrassen, Regenrinnen, in den gleichen Farben, standen sie als Klone dies- und jenseits des Hofes. Natürlich hatte sich in den fünfzehn Jahren, seit die sieben Familien (in einem Haus wohnte nur eine ältere Rechtsanwältin mit ihrem zänkischen erwachsenen Sohn) eingezogen waren, allerlei getan. Mittlerweile war durch die individuelle Gestaltung der Gärten und dem, was man so an den Häusern ändern konnte – Anstrich, Türen, Fenster, Außenleuchten, Schuppen –, wenigstens der Anschein entstanden, dass es sich nicht um eine Siedlung aus dem 3-D-Drucker handelte.
Louisa ging es auch gar nicht um das Haus. Ihres war viel schöner, eine Villa aus den Zwanzigerjahren, die man fast schon als herrschaftlich bezeichnen konnte. Dahinter ein großer Garten, leider durch die hohen Kiefern verschattet und ohne jede Chance, dort einen vernünftigen Rasen anzulegen. Aber immerhin: Es war ein Haus mit einer kleinen Geschichte. Sicher, keine sonderlich erwähnenswerte, das Haus war von keinem bekannten Stararchitekten der Weimarer Republik erbaut, aber es war eben nicht innerhalb von drei Monaten von einer holländischen Baufirma auf den sandigen Boden gesetzt worden. Teurer war es auch. Sie zahlten bestimmt mehr, als die anderen an Tilgung und Zinsen aufbringen mussten. Was Louisa als Schatten auf ihrem Fischbach-Herzen lag, war das, was Tim immer wieder ansprach. Er wusste genau, wie sehr er sie damit in Rage bringen konnte, und tat es doch immer wieder, Louisa hatte keine Ahnung, warum das so war. Jedenfalls fühlte sie sich den anderen auf eine seltsame Weise als Mieterin unterlegen. Erst wenn ihr Name im Grundbuch stehen würde, wenn sie hier amtlich ein Stück Boden besitzen würde, wäre sie eine echte Fischbacherin. Das wäre auch die Garantie, nicht durch eine Laune ihres Vermieters, den sie zweimal im Leben gesehen hatte, aus dem Paradies verjagt werden zu können. Wegen Eigenbedarf beispielsweise. Man hörte da ja die wildesten Geschichten.
Sosehr sie sich, offensichtlich als Einzige hier, nach den Theatern und Opern und Galerien in der Stadt sehnte und die halb betrunkenen Gespräche in den Bars vermisste – obwohl sie mit fast 49 Jahren nicht mehr ganz das Boheme-Leben führte, von dem sie immer geträumt und an dem sie einige Jahre, vor Albert, vor den Kindern, gekratzt hatte –, so sehr war sie sich sicher, für Juno, Merle und Kitta das ideale Zuhause gefunden zu haben. Juno war noch in der Stadt geboren worden, wuchs aber als Dorfkind oder besser gesagt Vorortkind auf. Mit all den wilden Spielen, der Unbesorgtheit und der Lust an der Natur, die Louisa selbst als Kind nie erlebt hatte. Fischbach war, dies- und jenseits der Straße, der Ort, der für ihre Familie am besten war. Hier wollte sie alt werden.
»Jungs!«, rief sie den Männern zu, als sie am Grillplatz ankam. Sie nahm Tim in den Arm, Louisa wollte zeigen, dass da nichts war zwischen ihm und ihr, keine schlechten Gefühle. Später wollte sie noch ihre große Überraschung verkünden, ihren Erfolg. Da konnte sie keine schlechte Laune gebrauchen.
Sie streckte ihr Glas in die Höhe, sagte »Prost!« und leerte es in einem Zug. Tim lachte laut, ebenso Robert. Männer mochten Frauen, die tranken, weil sie ihnen keine Vorwürfe machten, wenn sie selbst tranken. Albert sah das anders, aber er war ja auch Louisas Ehemann.
»Ich hab hier was für dich«, sagte Tim versöhnlich. Er öffnete die Tür seines Outdoorkühlschranks und holte eine Flasche Prosecco hervor, die er sofort öffnete und aus der er Louisas Glas füllte.
»Soll ich dir den Aperol und Eis holen?«, fragte Albert und erhob sich pflichtbewusst von dem asiatischen Bootstisch, der so hieß, weil der Verkäufer in der »Gartenakademie« – im Grunde nichts anderes als ein sehr teures Pflanzencenter – Fine und Tim erzählt hatte, die es wiederum allen Nachbarn berichtet hatten, dass er aus den originalen Teakplanken eines original indonesischen Fischerbootes gemacht war. Was niemand glaubte, die Geschichte war einfach zu gut.
»Gerne, Schatz. Das wäre nett von dir«, sagte Louisa, und Albert ging in Richtung Haus. Während er unterwegs war, trank sie weiter, auch ohne Likör und Eis. Sie wollte den Rausch, nicht die Erfrischung. Tim und Robert standen beieinander, die Flaschen in den Händen. Louisa setzte sich in den Hängekorb, der an einer großen Weide angebracht war, ließ ihre Flipflops von den Füßen gleiten, stieß sich ab und schaukelte ein bisschen.
»Alles gut?«, fragte Tim und zwinkerte Louisa zu.
In all den Jahren war sie aus ihm am wenigsten schlau geworden. Er war sieben Jahre älter als Fine, die mit vierunddreißig Jahren die Jüngste im Fischbacher Freundeskreis war. Das war schon ein ziemlich gewaltiger Unterschied, jedenfalls in Louisas Welt. Sie selbst war 48, Albert schon 54. Tim war 41, lag altersmäßig also zwischen Fine und ihnen, aber er war sowieso eine ganz andere Art Mensch. Programmierer. Was er wohl den ganzen Tag machte, wenn er in seinem Büro saß? Endlose Zahlenreihen in den Computer tippen? Konnte er Programmiersprachen so sprechen wie sie Französisch? Und warum sah er nicht aus, wie man sich einen Computernerd normalerweise vorstellte? Tim trug nie eine Mütze oder eine Kappe oder ein T-Shirt mit Einsteinzunge. Er arbeitete tagsüber, nicht nachts, und über seinen Beruf sprach er nie. Louisa kam es so vor, als würde er überhaupt gar kein Interesse daran haben. Nicht dass Louisa auf ein Gespräch über Computerkram aus gewesen wäre, das war nun wirklich nicht ihr Ding. Aber Tim war ein Rätsel. Er sah aus wie ein typischer Vorstadtvater: untersetzt, mit mittlerweile gar nicht mehr so kleinem Bauch, bravem Seitenscheitel, zügig voranschreitenden Geheimratsecken. Genauso unverständlich war Louisa, was Fine an Tim fand. Sie war eine Schönheit – deswegen hatte sie ja wohl auch den Job in der Soap bekommen: blondes Haar, strahlend blaue Augen, schlank. Und eine Zahnlücke wie die von dieser französischen Sängerin, Vanessa Paradis, der Ex-Frau von Johnny Depp. So einen Mann hätte sich Fine schnappen können. Einen anderen Schauspieler. Stattdessen war sie mit Tim verheiratet.
Von allen Fischbachern, mit Ausnahme von Hasso Lohenstein, aber der gehörte in eine andere Kategorie, mochte Louisa Fine am meisten. Nicht wegen ihres Aussehens, Louisa wusste, dass sie selbst einmal attraktiv gewesen war, aber nie mehr schön sein würde. Sie hatte es mit 48 Jahren nicht mehr nötig, im Glanz einer anderen Frau auf einen Abstrahleffekt hoffen zu müssen. Nein, von Anfang an hatte Louisa eine besondere Verbindung zu Fine gefühlt. Schließlich kamen sie beide aus der Welt der Kunst. Louisa war die Einzige hier, die Fine schon in der Serie wirklich bewundert hatte. Obwohl die Rolle, die bösartige Blonde, nicht sonderlich komplex war, spielte Fine sie auf eine ganz außergewöhnliche Art – wenn man denn die Antennen hatte, so etwas zu bemerken.
Louisa hatte mit Fine nie darüber sprechen müssen. Ihre Verbindung beruhte auf einem stillen Erkennen, da war sich Louisa sicher. Fine war oft in ihr Atelier gekommen und hatte sich ihre Arbeiten angesehen und gelobt – und zwar nicht nur aus Höflichkeit, wie Albert, dem leider jedes Verständnis für Schönheit und Tiefsinniges abging. Gut, Fines Erfolg, die Serie, der Kinofilm, das Theater – das war alles nicht mit dem, was Louisa erreicht hatte, zu vergleichen. Früher, auch noch nach der Uni, hatte sie mehr gearbeitet und auch an ein paar Sammelausstellungen teilgenommen.
Gleich würde sie den Freunden davon erzählen, dass Hasso nun endlich zugesagt hatte, ihre Werke in der Galerie zu zeigen. Nur zwei der Gäste an diesem Abend wussten Bescheid. Fine hatte sie natürlich eingeweiht, aber zu Stillschweigen verpflichtet. Genauso wie Juno, ihren Ältesten, der ihr auf die Schliche gekommen war, als sie einige der Bilder heimlich zum Auto getragen hatte. Er war schon zu alt, um ihn zu belügen. Und hoffentlich alt genug, um gegenüber seinem Vater und den Geschwistern dichtzuhalten. Seit Wochen hatte sie ansonsten spätnachts, wenn die Kinder und Albert schliefen, im Atelier gesessen und vorab kuratiert, dazu ein paar neue Bilder gemalt. Die Geheimnistuerei war ihr nicht schwergefallen. Albert war in den letzten zehn Jahren höchstens fünfmal im Atelier gewesen. Für ihn war Louisas Kunst nichts weiter als ein Hobby – doch er würde sich noch wundern! Vor allem, wenn sie ihre Bilder verkaufen würde.
Sie liebte ihren Mann, natürlich. Aber es hatte sich alles verändert in den Jahren. Sie hatten schon lange keinen Sex mehr. Er beklagte sich nicht, und sie war klug genug, dies auch nicht zu tun, weil es nur zu unschönen und unnützen Diskussionen geführt hätte, die im Streit endeten. In einem Streit, in dem sie sich die Wahrheit sagen würden. Sie waren seit fast zwanzig Jahren verheiratet und ein gutes, eingespieltes Team. Er sorgte für das Geld, sie für alles andere. Jeder der beiden war gut in seinem Job. Kompromisse waren die Grundpfeiler ihrer Ehe.
In der Küche kümmerten sich Fine und Katja um die Beilagen. Im Ofen buken die Kartoffeln. Keine große Sache, Fine drittelte sie einfach, träufelte etwas Olivenöl darüber, dazu ein bisschen Rosmarin und Thymian, den Rest erledigte das Gerät. Darunter, in einer Glasschale, Fines Spezialgericht: gebackene Cherrytomaten, ebenfalls in Öl und Gewürzen aus dem Garten, »ein Gedicht«, wie Katja meinte. Wie üblich würde sie nach dem Rezept fragen, das Fine ihr schon dutzendmal gegeben hatte und das Katja doch nie nachkochte. Die Tomaten waren Fines Spezialität, sie selbst, Katja, war für ihren Wassermelonen-Feta-Salat bekannt, den sie in einer großen Tupperschale mitgebracht hatte und nun in kleine Vorspeisenschalen verteilte.