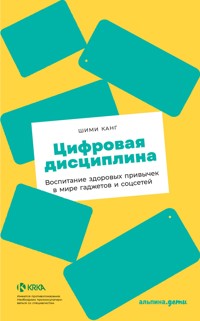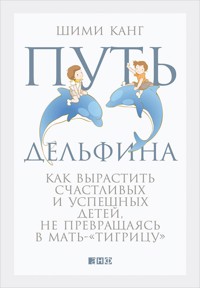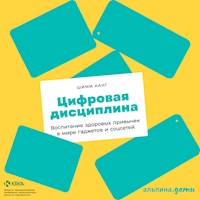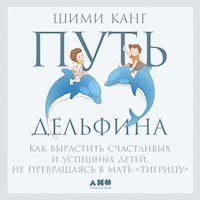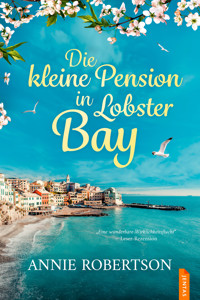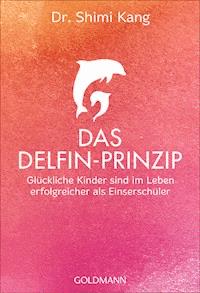
8,99 €
Mehr erfahren.
Ein Muss zum Trendthema: Starke Kinder - ohne Leistungszwang
Die kanadische Pädagogin Dr. Shimi Kang leistet mit ihrem Buch einen wertvollen Beitrag zur aktuellen Erziehungsdebatte. Ihr Ziel sind glückliche, neugierige, lebendige, kooperative Kinder, die ganz nebenbei auch sehr erfolgreich sind. Die derzeit oft propagierte Fixierung auf Erfolg und Leistung lehnt sie ab, denn ehrgeizige Tigermütter und neurotische Helikoptereltern schaffen Druck, Angst und Kontrolle – kein Klima, in dem sich Kinder optimal entwickeln können. Dagegen setzt Shimi Kang das Delfin-Modell: Delfine sind intelligent, sozial, voller Lebensfreude und dienen ihr als anschauliches Bild dafür, wie Erziehung heute gelingen kann. Mit vielen Beispielen aus der Praxis und persönlichen Geschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Ähnliche
Buch
Die kanadische Pädagogin Dr. Shimi Kang leistet mit ihrem Buch einen wertvollen Beitrag zur aktuellen Erziehungsdebatte. Ihr Ziel sind glückliche, neugierige, lebendige, kooperative Kinder, die ganz nebenbei auch sehr erfolgreich sind. Die derzeit oft propagierte Fixierung auf Erfolg und Leistung lehnt sie ab, denn ehrgeizige Tigermütter und neurotische Helikoptereltern schaffen Druck, Angst und Kontrolle – kein Klima, in dem sich Kinder optimal entwickeln können. Dagegen setzt Shimi Kang das Delfin-Modell: Delfine sind intelligent, sozial, voller Lebensfreude und dienen ihr als anschauliches Bild dafür, wie Erziehung heute gelingen kann. Mit vielen Beispielen aus der Praxis und persönlichen Geschichten.
Autorin
Shimi Kang, M.D., ist medizinische Leiterin des Programms »Child and Youth Mental Health« in Vancouver und außerordentliche klinische Professorin an der University of British Columbia. Dr. Kang hat Hunderten von Kindern, Jugendlichen und Eltern geholfen, den Weg zu positivem Verhalten und einer stabileren psychischen Gesundheit zu finden.
Dr. Shimi Kang
Das Delfin-Prinzip
Glückliche Kinder sind im Leben erfolgreicher als Einserschüler
Die Ratschläge in diesem Buch wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Links im Buch zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten hat der Verlag keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich der Verlag hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden und übernimmt für diese keine Haftung.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe November 2014
© 2014 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
© 2014 der Originalausgabe: Copyright © 2014 by Shimi Kang
Originaltitel: The Dolphin Way. A Parent’s Guide to Raising Healthy, Happy, and Motivated Kids – Without Turning into a Tiger
Originalverlag: Jeremy P. Tarcher/Penguin. Published by the Penguin Group (USA) LLC
Übersetzung: Karin Wirth
Redaktion: Sylvi Schlichter
Covergestaltung: UNO Werbeagentur
Coverillustration: Delfine: shutterstock/Cjwhitewine;
Hintergrund: shutterstock/pun photo
Satz und Layout: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling/Kim Winzen
CH · Herstellung: IH
ISBN: 978-3-641-12163-1V002
www.mosaik-verlag.de
Inhalt
Einleitung
Teil Eins – Das Dilemma
Die Herrschaft des Tigers
Defizite von Tiger-Kindern
Teil Zwei – Die Lösung
Das 21. Jahrhundert – Zeitalter des Delfins
Das Erfolgsgeheimnis der Delfine
Teil Drei – Aktiv werden
Leben nach dem Delfin-Prinzip: Die Grundlagen
Spielen liegt in unserer Natur
Menschen sind soziale Wesen
Das Handwerkszeug für Delfin-Eltern
Teil Vier – Die Wandlung
Eigenmotivation ist von Dauer
Delfin-Kinder auf dem Weg zu Glück und Erfolg
Zurück zum Menschen
Register
Einleitung
Die Tigerin in mir
Ich war wieder mal zu spät dran. Irgendwie war ich immer zu spät dran, wenn ich meine Kinder zum Klavierunterricht, zum Fußball- oder Schwimmtraining brachte oder sie von dort abholte. In meinem Kopf wirbelten all die Dinge herum, die ich erledigen musste: E-Mails abarbeiten, Termine wahrnehmen, Lebensmittel einkaufen … Die Liste schien nie ein Ende zu nehmen. Ich brauchte Koffein! Während meine Anspannung wuchs, wurde ich zunehmend nervös und bekam Kopfschmerzen. Beides würde nach einer Tasse Kaffee schlimmer werden, aber darüber dachte ich nicht nach. Ich dachte nur daran, wie unglaublich verlockend ein kurzer Mittagsschlaf wäre.
Beim Spurwechsel schaute ich in den Rückspiegel und sah meinen Sohn auf dem Rücksitz. Er sah so kraftlos, leer und verloren aus, dass es mir zu Herzen ging.
»Was ist los, Schatz?«, fragte ich ihn.
»Mama«, seufzte er matt und kaum hörbar, »ich will nicht zum Klavierunterricht. Ich will einfach nur nach Hause und spielen.«
Diese einfachen Sätze gingen mir noch mehr zu Herzen. Mein Sohn wollte einfach nur spielen und Kind sein, wie ich es sein durfte. Es traf mich wie ein Donnerschlag: Mit all den Aktivitäten und Programmen, die ich für ihn organisiert habe, machte ich aus meinem sechsjährigen Jungen einen überarbeiteten Mann mittleren Alters. Was war nur los mit mir? Warum hatte ich mich in letzter Zeit so sehr zur Tiger-Mutter entwickelt?
Den strikt autoritären Tiger-Erziehungsstil hat Amy Chua mit ihrer Biographie »Die Mutter des Erfolgs: Wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte« weltweitberühmt gemacht. In diesem Buch berichtet die »Tiger Mom« stolz, dass sie ihren Kindern keine Spielverabredungen, keinerlei eigene Entscheidungen, ja, nicht einmal Toilettenpausen während des Klavierübens zugestanden hat. Es schien, als hätte ich diesen Erziehungsstil übernommen, obwohl er allem zuwiderläuft, das ich wertschätze und woran ich glaube. Damals im Auto, in einem kostbaren Augenblick der Klarheit, nahm ich mir vor, ein paar wichtige Veränderungen vorzunehmen. Ich würde meinen Sohn wieder Kind sein lassen. Ich wollte wieder ein Mensch voller Vitalität und Freude sein, statt im Automatikmodus zu funktionieren. Also ließen wir den Klavierunterricht sausen. Ich muss zugeben, dass ich von diesem Ausflug in die Freiheit genauso begeistert war wie mein Sohn.
Aber um meinem Sohn die Freude am Spielen zurückzugeben, war es nicht damit getan, einfach nur den Klavierunterricht abzusagen. Ich hatte mir immer gewünscht, mit ihm ausgiebig LEGO zu spielen, aber nie die Zeit dafür gefunden. Nun gingen wir endlich in ein Spielwarengeschäft, um LEGO-Steine zu kaufen. Als Kind hatte ich mit diesen Steinen stundenlang Häuser, Tiere und alle möglichen wilden Fantasiekreationen gebaut. Aber als wir im Laden standen, fand ich das LEGO meiner Kindheit nicht mehr. Es gab nur noch LEGO-Kästen zu speziellen Themen, mit eigens gefertigten Teilen und detaillierten Anleitungen, die zeigten, wie das fertige Modell aussehen sollte. Zudem basieren viele der Sets auf knallhartem Merchandising: Disney, Star Wars, Ninja Turtles … Ein Kasten mit einfachen Bausteinen in mehreren Größen und Farben ist fast schon Mangelware.
Die weltbekannte Firma LEGO produzierte ab den 1930er-Jahren zunächst Holzspielzeug, bevor 1949 die Herstellung der berühmten Plastikbausteine startete. Diese Steine gaben Kindern vielfältige Möglichkeiten zu bauen, zu erschaffen, sich etwas auszudenken – Raumschiffe, Häuser, Autos, Tiere, Bahnhöfe, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Im Lauf der Jahre wurden einige Requisiten, wie Räder (1961) oder menschliche Figuren (1978), eingeführt, um die Spielmöglichkeiten noch zu erweitern.
Anfang der 1990er-Jahre begann LEGO dann, Themenkästen zu verkaufen, die meist vor Weihnachten auf den Markt kamen und im neuen Jahr bald wieder ausliefen. Diese Kästen waren teuer und kurzlebig. Allein 2011 erschienen zehn neue, nur für begrenzte Zeit erhältliche LEGO-Themenkästen.
Auch mein Sohn entschied sich letztendlich für solch einen Kasten. Doch als wir ihn zu Hause öffneten, hatten wir beide Schwierigkeiten mit dem Zusammensetzen des Modells. Frustriert schickte ich meinen Sohn zu seinem Vater. Dann sahen wir beide zu, wie mein Mann mit den Anweisungen kämpfte. Statt sich zu freuen, dass die Kinder mit LEGO spielen, muss man heute eher sagen, dass sie Anweisungen ausführen – oder ihren Eltern dabei zusehen, wie diese sich mit der Anleitung abmühen. Natürlich spielen Kinder dann hin und wieder mit ihrem fertigen LEGO-Star-Wars-Raumschiff, aber dafür täte es ein einfaches Plastikraumschiff vom Wühltisch wahrscheinlich genauso.
Das LEGO meiner Kindheit war kreativ, anregend und garantierte stundenlangen Spielspaß. Es ließ uns die Freiheit zu erschaffen, was wir wollten, ohne Baupläne oder elterliche Unterstützung. Was ist passiert? Warum unterstützen wir als Eltern diesen Wandel vom kreativen zum passiven Spielzeug und kaufen die teuren Themenkästen?
Am Ende des Tages wurde mir klar, dass mein Sohn teure LEGO-Sets ebenso wenig brauchte wie Klavierstunden. Draußen sein, im Matsch buddeln, Würmer ausgraben, das war es, was ich ihn tun lassen sollte.
Was ich von meinen Eltern gelernt habe
Ich bin froh, dass wir an jenem Tag den Klavierunterricht gestrichen haben. In dem Augenblick, den ich brauchte, um diese Entscheidung zu treffen, dachte ich natürlich an meinen Sohn, aber auch an meine Patienten und an meine Eltern. Ich hatte den deprimierten Gesichtsausdruck meines Kindes zuvor schon bei vielen meiner Patienten gesehen – talentierten jungen Pianisten, begabten Sportlern und Mathematikgenies, die erschöpft, zerbrechlich und innerlich leer waren. Nun erinnerte ich mich an einen bekannten Spruch, den meine eigenen Eltern gern zitiert hatten: »Unsere Kinder sind nicht unser Eigentum; sie sind Reisende, die nach dem Weg fragen, und wir wollen ihnen gute Begleiter sein.« Endlich verstand ich, was diese Worte bedeuteten – mein Sohn war nicht mein Besitz, und es war nicht meine Aufgabe, ihn zu steuern und zu programmieren, sondern ihm seinen eigenen Weg zu zeigen. Und trotz all meiner beruflichen Erfahrungen erledigte ich diese Aufgabe gerade furchtbar schlecht. Dieser Gedanke brachte mich zu der Erkenntnis, wie sehr ich meine Eltern wertschätze und wie mein Leben in vielen Punkten ihrem früheren ähnelt und sich doch so sehr unterscheidet.
Meine Eltern kamen aus einem kleinen indischen Dorf nach Kanada – arm, allein und ohne irgendwelche Sicherheiten. Meine Mutter hat nie eine Schule besucht – ich wurde in einigen der besten Einrichtungen der Welt ausgebildet. Mein Vater schaffte den Balanceakt, tagsüber zur Schule zu gehen und nachts Taxi zu fahren, um seine Familie zu ernähren – ich mühe mich ab, um meine drei Kinder, meine alten Eltern, meine Ehe, mein Zuhause, meinen Vollzeitjob, gemeinnützige Arbeit, Familie, Freunde, aber auch eine Vielzahl anderer, oft unnötiger Ablenkungen unter einen Hut zu bringen. Ich überwache die Mathehausaufgaben meines Sohnes für die erste Klasse, während meine Eltern an meiner Zulassung für das Medizinstudium völlig unbeteiligt waren. Nicht die Anweisungen meiner Eltern gaben mir innere Motivation, sondern die Werte, die sie mir mitgegeben hatten. »Denk auch an andere«, bewegte mich dazu, mit 21 Jahren bei örtlichen Veranstaltungen Reden zu halten, um Geld für meine eigene Stiftung aufzutreiben. »Sorge für eine bessere Welt« war mein Antrieb dafür, mit 22 ein Praktikum bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf zu absolvieren. »Setze deinen kreativen Geist ein« animierte mich, ein innovatives neues Programm für Jugendliche mit psychischen Problemen und Drogenproblemen (eines von nur wenigen Programmen dieser Art weltweit) ins Leben zu rufen. »Gehe mit gutem Beispiel voran« ließ mich die Funktion der beratenden ärztlichen Direktorin bei den Child and Youth Mental Health Programs in Vancouver übernehmen, während ich als Teilzeitforscherin bei einem aufstrebenden Biotechnologieunternehmen in Boston arbeitete.
Was im Leben wirklich wichtig ist, habe ich von meinen Eltern gelernt. Als Heranwachsende erlebte ich ihre tiefe Arbeitsmoral sowie ihre Anpassungs- und Innovationsfähigkeit und ihr unermüdliches Engagement für Familie und Gemeinwesen. Unser Zuhause war nicht immer glücklich – bei Weitem nicht. Wie in jeder Familie gab es auch bei uns Stress und Zerwürfnisse, einschließlich vieler ernster Probleme. Trotzdem spürte ich als Kind immer die Liebe meiner Familie. Ich war mir ihrer hohen Erwartungen an meinen Erfolg in allen Lebensbereichen bewusst. Am wichtigsten war ihre Erwartung, dass ich über meinen eigenen Tellerrand hinaussehen und einen positiven Beitrag in der Welt leisten würde. Die Botschaft war klar: »Sei optimistisch und voller Lebensfreude und inspiriere auch andere dazu, damit wir alle in einer besseren Welt leben können.« Diese Aussage stammte nicht aus Strategiesitzungen meiner Eltern und auch nicht von externen Beratern, für die ohnehin weder Zeit noch Geld vorhanden war. Sie ergab sich einfach aus ihren individuellen Persönlichkeiten und Werten.
Eine Kindheit wie meine würden moderne Eltern kaum spontan gutheißen (sofern sie nicht eine ähnliche hatten). Ich kannte keine Terminpläne, Nachhilfe- oder Trainingsstunden oder auch nur Hausaufgabenbetreuung. Als jüngstes Kind einer großen Familie war ich oft mir selbst überlassen. Meine Mutter konnte mir nicht bei den Hausaufgaben helfen, weil sie Analphabetin war. Mein Vater übte mit mir Mathematik, indem er mich auf seine nächtlichen Taxifahrten mitnahm. Ich saß vorne, und er zeigte mir, wie man das Wechselgeld zählte. Ich meldete mich selbst in der Schule an (unter dem Namen Vicky, weil ich nicht auffallen wollte, was meine Eltern leider herausfanden, als sie mein Halbjahreszeugnis sahen). Meine Zeit verbrachte ich größtenteils mit Lesen und Spielen im Sand oder Schnee. Wenn keine anderen Kinder oder Spielsachen in der Nähe waren, spielte ich mit imaginären Freunden. Während meine Eltern damit beschäftigt waren, in einem sehr fremden Land Wurzeln zu schlagen, hatte ich viel Muße, um meine blühende Fantasie zu nähren. Ich erfand in meinem Kopf zahllose Geschichten.
Meine Kindheit war zwar sorgenfrei, aber nicht ohne Verantwortung. Gemeinsam mit meinen älteren Geschwistern lernte ich, mich um Dinge zu kümmern, die mich selbst betrafen, im Haushalt zu helfen, einkaufen zu gehen, sparsam zu sein und für Verwandte, die kein Englisch konnten, Rechnungen und Dokumente zu übersetzen. Ich war beschäftigt, aber nicht mit geplanten Aktivitäten, sondern im wirklichen Leben. Man erwartete von mir, dass ich gute schulische Leistungen zeigte, ein gutes Verhältnis zu meiner Familie hatte, für meine Freunde da war und mich fürs Gemeinwesen engagierte. Mit zwölf fragte ich einmal freitags meine Mutter, ob ich am Sonntag die Mithilfe in der Gemeindeküche ausfallen lassen könne. Da mein Cousin am Samstag Geburtstag hatte und ich am Montag eine Mathearbeit schrieb, schien es mir richtig, am Sonntag zu Hause zu bleiben und zu lernen. »Ich bin sicher, dass du einen Weg finden wirst, allem, was dir wichtig ist, gerecht zu werden«, antwortete meine Mutter. Die Botschaft war klar. Und sie hatte Recht. Ich fand einen Weg.
Als Kind hatte ich eine Leidenschaft für Geschichten und träumte davon, eines Tages Schriftstellerin zu werden. Allerdings schien mir eine Tätigkeit im künstlerischen Bereich ein Luxus außerhalb der Reichweite unterprivilegierter Immigrantenkinder. Glücklicherweise fand ich eine andere Leidenschaft – das menschliche Gehirn und wie es von sozialen Interaktionen beeinflusst wird. Ich wurde zuerst Studentin, dann Ärztin, dann Psychiaterin und schließlich Motivationslehrerin. Ich bin davon überzeugt, dass ich ohne die Freiheit und Verantwortung, die meine Kindheit prägten, diesen Weg wohl kaum hätte gehen können.
Weshalb beraubte ich dann meine Kinder der einfachen Dinge – der freien Zeit, der Verantwortung, der Erfahrungen im wahren Leben, die mir als Kind die größte Freude bereiteten und mir als Erwachsene so große Vorteile brachten?
Kindererziehung im 21. Jahrhundert und der menschliche Irrsinn
Ich habe mit Tausenden von Menschen im Zusammenhang mit Problemen wie Stress, familiären Konflikten, Work-Life-Balance, Depression, Ängsten, Sucht, Psychose und Suizid gearbeitet. Dabei habe ich gelernt, zwischen echten psychischen Problemen und dem allgemeinen menschlichen Irrsinn zu unterscheiden. Psychische Probleme sind ernste, weit verbreitete (jeder Vierte ist davon betroffen) und behandelbare Gesundheitsstörungen. Allgemeiner menschlicher Irrsinn umfasst hingegen all die nicht besonders schlauen Dinge, die wir wider besseres Wissen jeden Tag tun: beim Autofahren simsen, mehr Kaffee trinken statt zu schlafen, mit unserem Partner streiten (und gewinnen wollen) und unsere Kinder anbrüllen, dass sie ruhig sein sollen (um ihnen anschließend, von schlechtem Gewissen getrieben, ein Geschenk zu kaufen). In mancher Hinsicht können diese Dinge ebenso belastend sein wie eine psychische Erkrankung – und viel schwerer zu ändern. In meiner mehr als zehnjährigen Berufspraxis habe ich gelernt zu erkennen, ob jemand ein Gehirn-CT, eine Medikation, eine Therapie braucht – oder aber einfach ein wenig Unterstützung, mehr Schlaf und eine andere Sicht auf die Dinge.
Was mich erstaunt, ist die Tatsache, dass von all den Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen, mit denen ich zu tun habe (von Kindern bis zu Senioren, von Obdachlosen bis zu Prominenten), keine Gruppe mehr menschlichen Irrsinn und gedankenloses Funktionieren an den Tag legt als die Eltern des 21. Jahrhunderts. Manchmal möchte ich mir fast das Zitat von Samuel Butler – »Eltern sind die Letzten, die Kinder haben sollten« – auf die Stirn tätowieren lassen, oder, noch besser, in die Handfläche, damit ich es immer sehen kann, denn ich bin auch eine von denen.
Eltern können aus einem sehr guten Grund vom menschlichen Irrsinn befallen werden. Das menschliche Gehirn ist das komplexeste Gebilde im Universum. Mit seinen mehr als einhundert Milliarden verbundenen Neuronen verarbeitet es alle unsere Gedanken, Aktionen und Reaktionen. Aber das Gehirn menschlicher Eltern ist noch einmal komplexer. Der Grund? Es ist besonders sensibel für alles, was das Kind betrifft. Eltern sind komplett auf Stimme, Geruch, Gesichtsausdruck, Körpersprache und Berührung ihres Kindes eingestimmt. Neuere neurowissenschaftliche Forschungen haben gezeigt, dass sich das Gehirn einer Mutter während ihrer ersten Schwangerschaft dramatisch verändert. Das Ausmaß der Neuronenverschaltung und -neuverknüpfung ist mit dem während der Pubertät vergleichbar. Eine frischgebackene Mutter hat nach der Geburt eines Kindes buchstäblich ein anderes Gehirn als zu dem Zeitpunkt, als sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt.[1]
Der Vater durchläuft ähnliche, wenn auch weniger dramatische Gehirnveränderungen, die durch die Pheromone (Hormone, die unbewusst über die Nase wahrgenommen werden) der Mutter sowie des Neugeborenen ausgelöst werden. Es gibt Hinweise darauf, dass ähnliche Veränderungen auch bei Adoptiveltern stattfinden. Es ist fast so, als ob frischgebackene Eltern noch einmal die Pubertät durchlaufen würden, und nach meiner Ansicht geht Elternschaft oft genug mit ebenso vielen, wenn nicht sogar mehr, emotionalen Höhen und Tiefen einher. Meiner Meinung nach ist diese große Sensibilität für unsere Kinder zum Teil dafür verantwortlich, dass Kindererziehung so schwer ist. Nichts aktiviert das menschliche Gehirn mehr oder lässt es schneller in den Panikmodus wechseln als das Schicksal unserer Kinder. Als ob das noch nicht reichen würde, verändert sich auch das Gehirn unserer Kinder ständig und ist extrem empfänglich für unser Mienenspiel, unseren Tonfall, unsere Körpersprache und unsere verbalen Äußerungen. Diese eng verwobene Interaktion zwischen Eltern und Kindern beschert uns die schönsten und schwierigsten Augenblicke unseres Lebens.
Chancen und Grenzen der Kindererziehung
Wissenschaftliche Erkenntnisse zu der Frage, wie sich die Erziehung unserer Kinder positiv und negativ auf ihre Entwicklung auswirken kann, faszinieren mich. Sobald ich meine Tiger-Tendenzen erkannt hatte, wollte ich wissen, ob Erziehung nach dem Tiger-Prinzip funktioniert und was Funktionieren in diesem Zusammenhang eigentlich bedeutet. Sollten wichtige Entscheidungen über Bildung und Erziehung der nächsten Generation auf etablierten Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen oder auf Biographien von »Tiger-Müttern« und anderen Eltern, die ihren Erziehungsstil für den einzig wahren halten? Ich musste mich nicht nur intensiver mit den Neurowissenschaften, gesundem Verhalten und der klinischen Praxis, sondern auch mit meiner eigenen Intuition und meinen tief verwurzelten Werten beschäftigen, um Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Man sollte meinen, dass ich mit all meinen Kenntnissen einen klaren Plan für die Erziehung meiner Kinder haben müsste. Aber wie so viele andere Eltern stehe auch ich oft im Konflikt zwischen meiner Intuition und meinen Ängsten. Als ich erfuhr, dass ein Mitschüler meines Sohnes einen Buchstabierwettbewerb gewonnen hatte, fehlte nicht viel und ich hätte mein eigenes Kind vom Matschbuddeln weggeholt und sofort mit Übungen und Hausaufgaben überschüttet – obwohl meine Intuition mir ausdrücklich davon abriet! Glücklicherweise half mir meine Arbeit als Psychiaterin, meine Verunsicherung zu überwinden.
Stress und psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch, und junge Menschen zwischen 15 und 24 sind am häufigsten davon betroffen.[2] Die Depression ist auf dem besten Weg, bis 2020 die zweithäufigste Krankheitsursache (nach Herzerkrankungen) in den Industrieländern zu werden.[3] Medikamentenmissbrauch gehört zu den gravierendsten Gesundheitsproblemen in den Industrieländern, und Studenten sind dabei die am schnellsten wachsende Untergruppe.[4] Es sterben mehr junge Menschen durch Selbstmord als durch Kriminalität und Krieg zusammengenommen.[5] Auf der ganzen Welt steigt die Zahl der Kinder, die unter Stress, Ängsten, Schlafmangel und Schlaflosigkeit leiden. Auch die Zahl der Kinder mit Sportverletzungen sowie mit durch exzessives Lernen verursachten Problemen wie Übergewicht und sogar Kurzsichtigkeit nimmt zu.[6] Ich weiß das alles, weil ich täglich damit konfrontiert bin, und ich weiß, dass es aufhören muss. Wir bringen unsere Kinder buchstäblich um.
Ich glaube inzwischen, dass die mit der Erziehung nach dem Tiger-Prinzip verbundenen Prinzipien – das übertriebene Durchplanen, Belehren, Kontrollieren, Antreiben und Wegebnen – kein Zuviel an Erziehung darstellen, wie es manchmal in Bezug auf diesen Erziehungsstil heißt, sondern im Gegenteil ein ernstes Zuwenig. Wenn Erziehung bedeutet, Kinder auf ein reiches, lohnenswertes Leben vorzubereiten, dann tun Tiger-Eltern bei Weitem nicht genug. Bei der Erziehung nach dem Tiger-Prinzip geht es nicht darum, die Lektionen des Lebens zu lernen, sondern für die nächste Prüfung zu büffeln. Sie ignoriert die Dinge, für die wir unseren Eltern, Großeltern und anderen Mentoren oft ein Leben lang dankbar sind; die Werte, die dafür sorgen, dass unsere Kinder, unsere Gesellschaft und unsere Welt stark sind und gedeihen.
Es geht mir nicht darum, Eltern ihr Fehlverhalten vorzuwerfen (meine eigenen Tiger-Tendenzen gebe ich jederzeit zu). Vielmehr möchte ich Ihnen etwas Erfreuliches sagen: Kinder können in dieser sehr aus dem Gleichgewicht geratenen Welt eine Balance finden – sie können klug und glücklich, wettbewerbsorientiert und prinzipientreu, praktisch veranlagt und leidenschaftlich, begabt und geerdet, sicher und unabhängig, ausdauernd und innovativ, Sieger auf ihrem Gebiet und ein Teil der Gemeinschaft, ehrgeizig und altruistisch sein.
Wie viele Eltern wünsche ich mir, dass meine Kinder Musik und Sport genießen, beruflich erfolgreich und zufrieden sind. Aber dafür müssen Kinder an Körper, Geist und Seele gesund sein. Die Hauptvoraussetzungen dafür sind Kreativität, kritisches Denken, ausgeprägte soziale Kompetenzen, eine positive Persönlichkeit und die Fähigkeit, sich anzupassen, ohne unterzugehen. Ich glaube, dass wir viel mehr Kinder zu ausgeglichenen Erwachsenen heranwachsen sehen könnten, wenn wir sie nur auf die richtige Art erziehen würden.
Angesichts des Zustands der Welt und der Aufgaben, die auf die nächste Generation warten, ist das Überleben auf diesem Planeten davon abhängig, wie wir jetzt mit unseren Kindern umgehen. Nur Innovatoren mit einer dem 21. Jahrhundert angemessenen Denkweise können die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen – aber dazu müssen sie gesund und engagiert genug sein. Wie Albert Einstein schon sagte: »Die wichtigen Probleme, mit denen wir es zu tun haben, lassen sich nicht mit der Art von Denken lösen, das vorherrschte, als wir sie verursacht haben.«
Wie Ihnen dieses Buch helfen kann
Maße ich mir an zu behaupten, dass ich das Geheimnis der Kindererziehung kenne? Meine Antwort lautet: Ja! Ich kenne es – und Sie kennen es auch! Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Wenn Sie glauben, den Weg gefunden zu haben, dann warten Sie mal ein paar Jahre: Ihr Kind verändert sich, oder Sie bekommen ein weiteres Kind, das eine völlig andere Erziehung braucht.
Und dass Sie theoretisch wissen, wie man Kinder erzieht, heißt noch lange nicht, dass Sie Ihre Kinder auch tatsächlich auf diese Weise anleiten und führen. Beispielsweise wissen die meisten Menschen sehr genau, wie man abnimmt – durch gesündere Ernährung und mehr Sport. Einfach, nicht wahr? Warum breitet sich dann Fettleibigkeit in den Industrieländern aus? Warum gibt es eine milliardenschwere Abnehmindustrie? Das liegt daran, dass einfach nicht dasselbe wie leicht ist und denken nicht tun bedeutet. Die einfachste Methode, ein Problem zu lösen, besteht darin, das Verhalten zu ändern, das zum Fortbestehen des Problems führt. Doch menschliches Verhalten zu ändern ist nicht leicht. Die meisten Eltern könnten die Frage beantworten, welche Erziehungsansätze bei ihren Kindern und bei ihnen selbst am besten funktioniert haben. Sie haben in der Kindererziehung friedliche, glückliche und »erfolgreiche« Augenblicke erlebt und wissen genau, wie diese Augenblicke zustande kamen. Die Schwierigkeit liegt nicht darin zu wissen, was zu tun ist, sondern darin, sich tagtäglich entsprechend zu verhalten.
Wie kann dieses Buch Ihnen dabei helfen? Die Antwort lautet: nicht durch Anweisungen, sondern indem es Ihnen eine Leitlinie gibt. Es ist nicht darauf ausgerichtet, Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen, sondern Sie dazu zu bewegen, das, was Sie tun wollen, in die Tat umzusetzen.
Ich bin keine »Erziehungsexpertin« und glaube auch nicht, dass es so etwas gibt, denn jedes Kind, jede Mutter, jeder Vater ist anders. Aber ich besitze fundierte Kenntnisse in Bezug auf menschliche Motivation, und die beste Art, jemanden zu motivieren, besteht darin, ihm den Weg zu zeigen. Niemand lässt sich gern sagen, was er tun soll, besonders, wenn es um persönliche Dinge geht. Niemand, kein Experte – nicht einmal Eltern – kann jemals Motivation von außen aufzwingen. Motivation muss von innen kommen. Wie viel Sachkenntnis der Experte auch haben mag, wie beeindruckend das Forschungsergebnis sein mag oder wie fundiert das Buch – all das spielt keine Rolle, wenn Sie sich nicht persönlich davon angesprochen und zur Änderung angeregt fühlen.
Der einzige Experte für alle Aspekte Ihres Lebens sind Sie. Ich werde Ihnen uralte Weisheiten, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und sich abzeichnende globale Trends sowie Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt, von meinen Patienten und aus meinem eigenen Leben präsentieren. Was Sie damit anfangen, liegt ganz bei Ihnen.
Dieses Buch basiert auf einem vierstufigen Modell der Verhaltensänderung – es bewegt sich vom Dilemma über Hoffnung und Methodik hin zur Wandlung. Auch wenn Sie davon überzeugt sind, dass Erziehung nach dem Tiger-Prinzip nichts für Sie ist und gleich zum Delfin-Teil weiterblättern wollen, empfehle ich Ihnen wegen der stärkeren Wirkung dennoch, mit dem Kapitel »Die Herrschaft des Tigers« anzufangen. Sie könnten das Kapitel »Defizite von Tiger-Kindern« mit seinen Argumenten gegen die Tiger-Erziehung nur überfliegen. Aber wenn Sie die Phasen des Dilemmas, der Hoffnung und der Methodik systematisch durchlaufen, sind Sie besser auf die Wandlung am Ende des Buches vorbereitet.
Ich fange mit den Grundlagen eines gesunden Lebens an, weil weder Zufriedenheit noch Motivation ohne Gesundheit möglich sind. Anschließend widme ich mich den drei Erziehungsaspekten, die meiner Meinung nach völlig unterschätzt werden, aber für Erfolg und Glück im 21. Jahrhundert unerlässlich sind: der Welt des Spielens und Erforschens, der Bedeutung von Gemeinschaft und gesellschaftlichem Engagement und der Notwendigkeit der (von innen kommenden) Eigenmotivation anstelle von externer Motivation (beispielsweise Preise oder Geld). Und schließlich befasse ich mich mit den Kompetenzen, die sich von diesen für das 21. Jahrhundert so wichtigen Faktoren ableiten lassen und die Grundlage einer Kindererziehung im Hinblick auf ein gesundes, glückliches, erfolgreiches Leben darstellen.
Ich gebe in diesem Buch auch ganz altmodische praktische Tipps zu Dingen, die man tun oder lassen sollte, um Ihnen viele Werkzeuge zu präsentieren, die Sie sofort anwenden können. Dabei werde ich immer wieder die Tiger- und Delfin-Metapher verwenden. Die Tiger-Metapher gehört inzwischen zum Wortschatz vieler Eltern. Ich möchte mit diesem Buch nun dem Delfin zu der ihm gebührenden Beachtung verhelfen, denn wir können von Delfinen viel lernen.
Ich hoffe, durch Aktivierung unseres inneren Delfins und Eliminierung unseres inneren Tigers Eltern auf der ganzen Welt dazu anregen zu können, eine Balance zwischen strukturierten Aktivitäten und unstrukturiertem Spiel, zwischen Wettstreit und Gemeinschaftssinn, zwischen einem beschützten Dasein und Unabhängigkeit anzustreben. Ich möchte auch Eltern, die ihre Kinder von außen antreiben, dazu ermutigen, ihren Sprösslingen die Chance zu geben, eine eigene starke, gesunde Eigenmotivation zu entwickeln. Wenn Sie also je in den Rückspiegel geschaut und in Ihrem Herzen gewusst haben, dass es Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter besser ginge, wenn er oder sie einfach nur spielen könnte, statt zu einer weiteren Unterrichtsstunde gefahren zu werden, dann lesen Sie weiter. Es ist nie zu spät, das Auto zu wenden.
[1] C. H. Kinsley und R. A. Fransen: »The Pregnant Brain as a Revving Race Car«, Scientific American, January 19, 2010, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=pregnant-brain-as-racecar
[2] The National Alliance on Mental Illness: »NAMI on Campus«, abgerufen am 15. Januar 2014, http://www.nami.org/Template.cfm?Section=NAMI_on_Campus
[3] World Health Organization: »Mental Health: A Call for Action by World Health Ministers«, 2001, http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/Call_for_Action_MoH_Intro.pdf
[4] National Counsel on Patient Information and Education: »’Get the Facts’ Prescription Drug Abuse on College Campuses«, abgerufen am 15. Januar 2014, http://www.talkaboutrx.org/documents/GetTheFacts.pdf; The NSDUH Report: »State Estimates of Nonmedical Use of Prescription Pain Relievers«, 8.Januar 2013, http://www.samhsa.gov/data/2k12/NSDUH115/sr115-nonmedical-use-pain-relievers.htm
[5] World Health Organization: »Suicide Huge but Preventable Public Health Problem, Says WHO«, Pressemitteilung, 8. September 2004, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr61/ en/
[6] M. Quigley: »Educational Baggage: The Case For Homework«, REACT 22 (Juni 2003), http://repository.nie.edu.sg/jspui/bitstream/10497/4088 /1/2003Issue1.pdf#page=7
Teil Eins – Das Dilemma
»Es fühlt sich falsch an, aber alle machen es so.«
Die Herrschaft des Tigers
Durch meine Arbeit werde ich häufig in das ganz persönliche Leben der Familien eingeladen, mit denen ich arbeite. Manchmal kommt diese Einladung allerdings nicht direkt von den Patienten. Eines Morgens bat mich ein Kollege, ihn bei einer Adresse in der Nähe meiner Wohnung zu treffen, wo schon ein Polizeiauto wartete. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist in einer Kinder- und Jugendpraxis an der Tagesordnung, aber dieser Fall war ungewöhnlich: Ich sollte mir einen vierzehnjährigen chinesischen Junge namens Albert ansehen, der in Obhut genommen worden war, weil er eine Frau in ihrem Keller eingesperrt hatte. Und zwar nicht irgendeine Frau, sondern seine eigene Mutter, ein ganzes Wochenende lang. Sie war nicht in Gefahr und hatte die ganze Zeit Zugang zu Nahrung und zu einer Toilette. Aber als ihr Mann aus dem Ausland anrief und weder Frau noch Sohn erreichen konnte, machte er sich Sorgen und verständigte die örtliche Polizei. Die Polizisten fanden Albert schlafend im Bett vor; im ganzen Haus waren Fastfood-Verpackungen verstreut und Computerspiele aufgestapelt. Mit einer merkwürdigen Mischung aus Scham und Trotz erklärte er den Polizisten, warum er seine Mutter eingeschlossen hatte.
»Ich brauchte einfach mal eine Pause von ihr, sonst wäre ich unter dem Druck explodiert. Sie drängt mich ständig, meine Hausaufgaben zu machen und Klavier zu üben. Und wenn ich damit fertig bin, will sie, dass ich noch zusätzlich Klavier übe und Extra-Hausaufgaben mache. Ich weiß, dass es dumm war, sie einzusperren, aber wenn ich es nicht getan hätte, wäre ich entweder weggelaufen oder von einer Brücke gesprungen.«
Klingt schrecklich, nicht wahr? Und es erweckt den Eindruck, als ob Alberts Mutter eine skrupellose, kaltherzige Tiger-Mutter sei. Aber wie jede Geschichte hat auch diese zwei Seiten. Als ich Winnie, Alberts Mutter, befragte, erfuhr ich Folgendes:
»Schon bevor Albert zur Welt kam, stand ich unter enormem Druck, dafür zu sorgen, dass unser Kind es zu etwas bringen würde. Wie viele Kinder trägt Albert die Last aller unserer Erwartungen. Wenn man in China nicht in die richtige Grundschule kommt, kommt man nicht in die richtige Mittelschule und dann nicht in die richtige Oberschule und dann nicht ins richtige College oder an die richtige Universität, und dann bekommt man nicht den richtigen Job und endet als nutzloser Niemand. Der Druck begann schon vor meiner Schwangerschaft – ich sollte immer bestimmte Nahrungsmittel essen, um die Gehirnentwicklung meines Kindes zu fördern.
Als Albert sechs Monate alt war, bereitete ich ihn für die Aufnahme in die Vorschule vor. Als er ein Jahr alt war, fragte ich ihn über Körperteile, Farben, einfache Rechenaufgaben und Vokabeln ab. Die Konzentration auf Albert beherrschte mein ganzes Leben. Ich plante seine Ernährung, seine Aktivitäten, seinen Unterricht und unterrichtete ihn auch selbst. Dazu engagierte ich mich in Elternräten und recherchierte, wie ich unsere Pläne für ihn noch verbessern konnte. Wir haben inzwischen fast unsere gesamten Ersparnisse für seine Ausbildung und für Spenden an seine Schulen ausgegeben. Wegen all dieser Investitionen sind Alberts Leistungen enorm wichtig.
Wir wissen, dass er unter großem Druck steht, und wir wollen nicht, dass er traurig oder gestresst ist. Darum kaufen wir ihm immer die neuesten Spiele und Elektronikgeräte, viele Süßigkeiten und Fast Food, um ihn glücklich zu machen. Aber ich glaube, dass das seiner seelischen und körperlichen Gesundheit geschadet hat. Er hat keine Disziplin. Er hat gelernt, meinen Mann, mich und seine Großeltern zu manipulieren, indem er einfach ausrastet, wenn er nicht das bekommt, was er will. Er ist süchtig nach Computerspielen und erledigt seine Hausaufgaben und sein Übungspensum jetzt hastig, damit er spielen kann. Er sagt, das sei das einzig Entspannende in seinem Leben.
Ja, ich verstehe, dass er mich eingesperrt hat, weil er eine Pause von den Hausaufgaben und vom Klavierüben brauchte. Aber ich glaube auch, dass er einfach das neueste Computerspiel testen wollte, das an diesem Wochenende rausgekommen ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er ist jetzt noch gut in der Schule, weil er erst vierzehn ist, aber bei seiner Einstellung wird das nicht mehr lange anhalten.
Er hat offensichtlich keinen Respekt mehr vor mir, und wir können ihn nicht immer nur bestechen, damit er bestimmte Dinge tut. Er verliert seine Motivation. Ich mache mir Sorgen um seine Zukunft – niemand mag Leute wie Albert. Nicht einmal ich mag ihn mehr. Wir sind vor einem Jahr aus China weggegangen, weil wir von all dem genug hatten und ihm die Möglichkeit geben wollten, andere Erfahrungen zu machen. Vielleicht ist es dafür schon zu spät. Es gefällt mir nicht, was aus ihm und aus mir geworden ist. Ich hoffe wirklich, dass Sie mir helfen können.«
Wenn ich Leuten die Geschichte von Albert und Winnie erzähle, nicken sie entweder verständnisvoll oder schütteln missbilligend den Kopf. Einige meiner Patienten im Teenageralter haben mir gestanden, dass auch sie sich in ihrer Fantasie schon ausgemalt haben, ihre Eltern für ein Wochenende wegzusperren! Der Fall der jungen Amerikanerin, die 2012 eine Unterlassungsklage gegen ihre Eltern einreichte (und vor Gericht gewann!), weil diese ihr heimlich auf dem Universitätsgelände nachgeschlichen waren, ist einfach nur eine andere Version derselben Geschichte.[7]
Damit wir uns richtig verstehen: Erziehung nach dem Tiger-Prinzip ist nicht auf eine bestimmte ethnische Gruppe beschränkt. Amy Chuas Buch hat viel dazu beigetragen, Erziehung nach dem Tiger-Prinzip mit asiatischen Familien in Verbindung zu bringen, aber in Wirklichkeit laufen Kinder aus allen Kulturkreisen Gefahr, Opfer des wohlmeinenden, aber letztlich schädlichen autoritären Regimes ihrer Tiger-Eltern zu werden. Ich habe eine ganze Reihe dieser Kinder in meiner Praxis gesehen.
Im Lauf der Zeit kamen Albert und Winnie besser zurecht. Glücklicherweise begriffen sie, dass sie beide Opfer der Tiger-Erziehung geworden waren. Winnie hatte schon seit einiger Zeit kein gutes Gefühl in ihrem Umgang mit Albert mehr gehabt, hatte aber nicht gewusst, was sie ändern sollte, weil sie dachte, »dass alle anderen es auch so machten«. Sobald sie aufhörte, nach außen zu schauen, und ihre Aufmerksamkeit nach innen auf das richtete, was nach ihrem Gefühl gut für ihre Familie war, traf sie bessere Entscheidungen. Sie glich das Herumkommandieren und gluckenhafte Benehmen durch Nähe und durch das Auftreten als Vorbild und Wegbegleiter aus und trug so dazu bei, Albert auf den Weg zu Gesundheit, Zufriedenheit und Eigenmotivation zu bringen.
Neue Zwänge für Eltern im 21. Jahrhundert
Viele Eltern sind heute mit einem wahren Ansturm verschiedener Realitäten konfrontiert, durch die sowohl sie selbst als auch ihre Kinder unter viel zu starken Druck geraten. Manche Realitäten waren schon vor Urzeiten vorhanden, während andere Erscheinungen des 21. Jahrhunderts sind.
Die schulischen Anforderungen sind heute höher denn je. Standardisierte Testverfahren, die Bedeutung des Abiturdurchschnitts, verkürzte Schulzeiten – all das belastet Eltern und Kinder. In eine gute Ausbildung ist die gesamte Familie einbezogen. In den Jahren, bevor Studenten erstmals den (von ihren Eltern?) erträumten Campus betreten, fließen jede Menge Zeit, Energie, Geld und andere Ressourcen, um den Weg dorthin zu ebnen. Bereits in der Grundschule beginnt der Wettkampf um die begehrte Gymnasialempfehlung. Ist der Schritt aufs Gymnasium geschafft, überwachen viele Eltern die Leistungen, unterstützen das Kind beim Lernen, bezahlen bei Bedarf teure Nachhilfestunden.
Und dann gibt es da noch die Globalisierung, die zu stärkerem Wettbewerb zwischen Jugendlichen aus Industrieländern und Jugendlichen aus großen Schwellenländern wie China und Indien führt. Unsere Sprösslinge treffen in der Schule, im Studium und im Beruf nicht mehr nur auf die Nachbarskinder, sondern auch auf Kinder aus London und Moskau, aus Peking und Buenos Aires. Das bedeutet, dass sie mit Verhaltensnormen, Denkweisen und Leistungsniveaus konkurrieren, über die wir wenig wissen. Werden unsere Kinder mit den stereotypen Arbeitsbienen, Rechengenies und Buchstabiermeistern aus anderen Ländern Schritt halten können?
Die Technik öffnet neue Türen und schlägt viele andere zu. In vielen Bereichen, wie der Automobilproduktion, der Landwirtschaft und sogar dem Gesundheitswesen, werden vielleicht Roboter bald eine große Rolle spielen. Gleichzeitig nutzen unsere Kinder ganz selbstverständlich modernste Technik, um sich zu informieren, um zu kommunizieren und zu entspannen. Wird die Technik im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts unseren Kindern Chancen eröffnen oder eher verbauen? Sicher ist nur, dass sie sich – und uns – ständig verändern wird.
Technik bringt verstärkte Kommunikation mit sich. Dass Eltern und Kinder über ein Handy Kontakt halten können, ist ein Vorteil (sofern das Handy nicht zur Unterdrückung der Unabhängigkeit eines Kindes genutzt wird). Außerdem haben Studien gezeigt, dass die sozialen Medien Kindern mit eingeschränkter sozialer Kompetenz helfen, sich mit anderen verbunden zu fühlen.[8] Pauschal verteufeln lassen sich die neuen Technologien also nicht. Aber unsere Aufgabe als Eltern und Erzieher besteht zum größten Teil immer noch darin, unseren Kindern zu helfen, die reale Welt zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden. Und schon ein kurzer Blick in soziale Medien zeigt, dass diese kein realistisches Bild der Wirklichkeit liefern. Niemand stellt Bilder ins Internet, auf denen er erschöpft oder wütend aussieht, auf denen er einfach nur lernt oder schläft oder mit der Familie zu Abend isst. Das Alltagsleben wird weitgehend ausgeblendet, was Betrachter stattdessen sehen, ist eine Fantasiewelt, in der wir uns so darstellen, wie wir von anderen gern gesehen werden wollen.
Die intensive Auseinandersetzung mit den idealisierten Lebensdarstellungen anderer ist ein sicherer Weg zum Unglücklichsein. Eine 2013 in Michigan durchgeführte Studie analysierte, wie sich die Nutzung von Facebook auf Zufriedenheit und Wohlbefinden auswirkt.[9] Sie kam zu dem Schluss, dass Menschen, die Facebook nutzten, sowohl ihr aktuelles Befinden als auch die Zufriedenheit mit ihrem Leben negativer bewerteten. Je länger sich Facebook-Nutzer auf der Website aufgehalten hatten, desto schlechter fühlten sie sich bei der nächsten Kontaktaufnahme. Direkte Kommunikation mit anderen Menschen führte hingegen nicht zu negativen Bewertungen. Wollen wir wirklich unsere kostbare Zeit damit verbringen, uns online unglücklich zu machen?
Und dann sind da noch die Medien. Die allgegenwärtigen Berichterstattungen sind unentrinnbare Quellen der Beunruhigung. Wir werden ständig mit Nachrichten konfrontiert, die nichts mit unserem Leben zu tun haben. Besonders ausgiebig wird über dramatische Kriminalfälle wie z.B. Kindesentführungen berichtet – nicht, weil diese häufiger als vor zwanzig Jahren auftreten, sondern weil es die Quoten steigert. Und der Vergleich des eigenen Lebens mit dem, was Filme, Doku-Soaps und Serien als normal und alltäglich suggerieren, führt schnell zum oben beschriebenen Facebook-Phänomen. Es ist nicht leicht, angesichts dieser Flut von flüchtigen Eindrücken und Bildern einfach nur man selbst zu sein.
Die Werbung erobert täglich neue Bereiche und nutzt subtilere Taktiken als je zuvor, um uns zu erreichen. Wir sind durchschnittlich täglich mehr als 3000 Werbebotschaften (über Radio, Fernsehen, Plakate, Internet, Geschäfte und Product Placement in verschiedenen Medien) ausgesetzt.[10] Werbung und Marketing haben auch zu einer »Expertisierung« der Kindererziehung geführt (seit wann brauchen Eltern eigentlich Experten!?). Ein Beispiel dafür ist »Baby Einstein«, eine Reihe von Filmen, die als Grundbildung und Intelligenzförderung für die Kleinsten angepriesen wurden. Dank gutem Marketing und elterlichem Hype erfuhren die Baby-Einstein-Filme Anfang der 2000er Jahre in den USA riesigen Zuspruch. Aber bald stellte sich heraus, dass »Baby Einstein« und andere »Bildungsfilme« für Kleinstkinder möglicherweise mehr Schaden als Nutzen bringen. Eine Studie zeigte beispielsweise, dass Babys, die diese Filme anschauten, im Schnitt sieben Wörter weniger pro Tag lernten als Babys, die das nicht taten.[11] Aber auch diese Erkenntnisse hielten Millionen von Eltern nicht davon ab, die Produkte, die doch »das Beste« für ihr Kind versprachen, zu kaufen. In Deutschland waren die Baby-Einstein-Produkte zwar nicht so erfolgreich wie in den USA, aber Beispiele für geschicktes Marketing, das gezielt Eltern anspricht, finden sich ebenfalls zuhauf.
Auch Familienstrukturen und die Arbeitswelt haben sich deutlich verändert. Etwa 30 Prozent der Familienhaushalte in den USA (in Deutschland etwa 20 Prozent) werden von alleinerziehenden Elternteilen geführt.[12] Ein-Eltern-Familien, getrennt lebende Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht und Kindererziehung ohne die Unterstützung der erweiterten Familie haben an Häufigkeit zugenommen, aber unsere gesellschaftlichen Strukturen sind nicht darauf abgestimmt, diese Familien zu unterstützen. Auch das Arbeitsleben hat sich dramatisch verändert: Wir haben eine ständige Verbindung zum Arbeitsplatz – viele Menschen mit einer Bürotätigkeit bringen regelmäßig Arbeit mit nach Hause.[13] Oft sind wir Eltern so mit unserem eigenen Terminplan beschäftigt, dass wir uns gezwungen sehen, unsere Kinder aus dem Weg zu organisieren. Mittlerweile leben 50 Prozent der Weltbevölkerung in städtischen Zentren, meist in kleineren Häusern und Wohnungen[14] mit wenig offenen Flächen. Die Urbanisierung bringt Ängste mit sich. Die Nachbarn kennen sich nicht mehr untereinander und somit werden Kindern außerhalb der eigenen vier Wände weniger Freiheiten eingeräumt. Gegen all diese Dinge können wir nichts tun – oder doch?
Hinzu kommt die enorme, technologisch bedingte Generationskluft zwischen uns und unseren Kindern. Eine Generationskluft wird definitionsgemäß auf »schnellen kulturellen Wandel« zurückgeführt. Mir fällt kein größerer kultureller Wandel in der Menschheitsgeschichte ein als das, was wir derzeit auf dem Gebiet der schnellen Technologien und der globalen Vernetzung erleben. Wenn Twitter ein Land wäre, wäre es eines der bevölkerungsreichsten der Welt. Viele Eltern wären darin völlig verloren, würden die Sitten nicht verstehen und die Sprache nicht sprechen. Die meisten Kinder können besser mit unseren Smartphones umgehen als wir selbst. Vorbei ist die Zeit, in der die Generationskluft im unterschiedlichen Musik- und Modegeschmack oder abweichenden politischen Überzeugungen zum Ausdruck kam. Wir sind wahrscheinlich die rückständigsten Eltern aller Zeiten. Darum können wir unmöglich unsere elterliche Autorität aufrechterhalten – oder doch?
Vielleicht eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist der Weg zur finanziellen Sicherheit – für uns selbst und für unsere Kinder. Früher lag vor Kindern ein ziemlich klar definierter Weg. Die Eltern sorgten für eine gute Ausbildung, die zu einem Beruf und einer Arbeitsstelle führte, die man oft bis zum Renteneintritt behielt. Heutzutage ist nichts mehr klar definiert, eine gute Ausbildung legt zwar einen Grundstein, gibt aber keine Garantien, und lebenslange Arbeitsverhältnisse gehören schon längst der Vergangenheit an. Die jungen Erwachsenen von heute werden als »Generation Bumerang« bezeichnet, weil sie häufig lange Ausbildungszeiten und einen schwierigen Berufseinstieg haben und lange von ihren Eltern abhängig sind.[15] Selbst Hochschulabsolventen haben zunehmend Schwierigkeiten, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Heutzutage geht es nicht mehr so sehr darum, einen klar definierten Beruf zu lernen – wichtiger ist es, die richtigen Kompetenzen für Jobs zu haben, die in einer sich ständig wandelnden Welt verfügbar sein werden. Aber wie können wir unsere Kinder auf die Berufswelt in zwanzig Jahren vorbereiten, wenn wir nicht einmal wissen, was die nächsten fünf bringen werden? Diese Unsicherheiten nehmen uns den Halt und führen dazu, dass wir Grundwahrheiten infrage stellen, nach denen wir unser Leben ausgerichtet haben.
Darum funktionieren viele Eltern im 21. Jahrhundert im Angstmodus. Versuchen Sie, sich an die letzten fünf Erziehungsentscheidungen zu erinnern, die Sie gegen Ihren eigenen Instinkt getroffen haben. Ich vermute, dass alle diese Entscheidungen durch Ängste motiviert waren.
Viele Eltern, die ich kenne, wurden von einem meiner Lieblingsbücher – »Überflieger – Warum manche Menschen erfolgreich sind und andere nicht« von Malcolm Gladwell – beeinflusst. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, dass mit der »10000-Stunden-Üben«-Regel elterliches Tiger-Verhalten begründet wurde. Aber dem liegt ein Missverständnis zugrunde, denn Gladwell spricht von 10000 Stunden Üben im Kontext eines von Leidenschaft und Neugier geprägten Lernens in der realen Welt – nicht von erzwungenen und überwachten strukturierten Aktivitäten. Die Beatles kamen nicht im Musikunterricht auf ihre 10000 Übungsstunden, sondern beim freien Jammen und Improvisieren, auf Konzerten und bei Plattenaufnahmen. Bill Gates übte nicht etwa 10000 Stunden mit einem Privatlehrer Softwareprogrammierung, sondern er forschte, tüftelte und schraubte auf eigene Faust an Computern herum. Außerdem sind die viel beschworenen 10000 Stunden nur ein Faktor in der komplexen »Überflieger-Gleichung«. Viele Menschen haben bestimmte Dinge 10000 Stunden lang geübt, ohne damit Erfolg zu haben – wenn man Freude, neue Erkenntnisse, Ausdauer und Leidenschaft nicht ebenfalls als Erfolg definieren will!
Elterntypen und Erziehungsstile
Kindererziehung nach dem Tiger-Prinzip wird oft mit asiatischen Familien in Verbindung gebracht, die extreme Ansichten in puncto Autorität, Gehorsam und Bildung haben. Doch so einfach ist Tiger-Benehmen nicht zu definieren! Es ist vielmehr ein Lebens- und Erziehungsstil, der zu viel Zwang, Bevormundung, Planung und Überwachung beinhaltet.
Die schiere Zahl der Metaphern, die bestimmte Erziehungsstile beschreiben, lässt darauf schließen, dass es ein Problem gibt.
»Helikopter-Eltern« kreisen in ständiger Überwachung über ihren Kindern und warten nur darauf herabzustoßen, um bei Problemen oder Konflikten einzugreifen.
»Schneepflug-Eltern« sind ihren Kindern immer einen Schritt voraus, um alle eventuellen Hindernisse für sie aus dem Weg zu räumen.
»In-Watte-Packer« sehen ihre Rolle darin, ihre Kinder vor jeglicher Enttäuschung und Anstrengung im Leben zu bewahren. Eine Mutter erzählte mir, dass sie alle Schulbücher in doppelter Ausführung kaufe, damit ihr (1,80 Meter großer) Junge sie nicht von der Schule nach Hause tragen müsse. Wie wird er wohl an der Universität zurechtkommen, wenn er bis dato stets vor der unerträglichen Zumutung bewahrt wurde, seine Bücher selbst tragen zu müssen?
Die vier Haupterziehungsstile nach Maccoby und Martin (1983) sind: autoritär (diktatorisch), permissiv (nachgiebig), vernachlässigend (distanziert, nicht kontrollierend) und autoritativ (auf Autorität beruhend). Vielen Menschen ist nicht klar, dass sowohl Tiger-Eltern im Stil von Amy Chua als auch Schneepflüge, Helikopter und In-Watte-Packer autoritäre Eltern sind. Ob man zu viel herumkommandiert oder massiv überbehütet – es ist immer ein Zuwenig an Erziehung. Viele Eltern wenden eine Mischung aus autoritärem und behütendem Verhalten an, aber das fällt ebenfalls unter den autoritären Stil, weil sie ihre Kinder des Gefühls berauben, die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben.
Autoritäre Eltern sind der Meinung, dass sie alles am besten wissen. Sie legen die Regeln fest und sagen, was zulässig ist – keine Wahl und keine Diskussionen. Sie glauben, Erfolg verordnen zu können und wollen ihre Kinder durch Zwang, Bestechung oder extreme Beeinflussung dazu bringen, einen vorgeplanten Weg einzuschlagen.
Viele der wohlmeinendsten Eltern wenden heute eine Mischung aus vorschreibendem und überbehütendem autoritären Verhalten an. Vielleicht trifft das auch auf Sie zu. Die engmaschige Überwachung kann später dazu führen, dass sich Eltern massiv in die Hausaufgaben, das soziale Leben und die Berufswahl einmischen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Überbehütende Eltern sind engagierte, liebende Eltern. Aber durch ihre vorschnelle Einmischung verhindern sie, dass ihre Kinder aus Fehlern lernen – eine Grundkompetenz, um Anpassung und Umgang mit Enttäuschungen zu erlernen. Durch zu häufiges Einmischen lassen sie nicht zu, dass ihre Kinder Eigenmotivation entwickeln – eine wesentliche Voraussetzung für Unabhängigkeit.
Am anderen Ende des Erziehungsspektrums stehen nachgiebige Eltern, die ebenso unausgeglichen wie autoritäre Eltern sind, aber auf eine andere Art. Ich bezeichne solche permissiven Eltern als »Quallen-Eltern«, weil sie kein Rückgrat haben. Sie gehen Konflikten aus dem Weg und stellen kaum klare Regeln auf. Manche nachgiebigen Eltern schauen weg, wenn sie erziehen müssten, und manche lassen potenziell schädliche Verhaltensweisen zu, weil sie ja der Freund ihres Kindes sein wollen. Quallen-Eltern definieren keinerlei Erwartungen beim Respektieren von Autorität, sozialen Umgangsformen oder persönlichen Werten. Kinder von Quallen-Eltern sind oft verantwortungslos, impulsiv, sozial inkompetent und wenig geneigt, Autoritätspersonen zu respektieren. Sie zeigen in der Schule und am Arbeitsplatz oft schlechte Leistungen. Sie neigen zu Suchtverhalten und kommen oft für längere Zeit komplett vom Weg ab.[16] Sie driften häufig ziellos durchs Leben und zeigen im Vergleich zu Gleichaltrigen einen Mangel an Selbstkontrolle, ein geringes Selbstwertgefühl, kaum Kompetenzen und ein mangelndes Selbstvertrauen.
Ebenfalls in aller Munde ist das »Attachment Parenting« (bindungsorientierte Kindererziehung). Es ist zwar in der Theorie nicht permissiv, kann aber leicht falsch interpretiert werden und zur Erziehung nach dem Quallenprinzip führen. Ich stimme den Grundsätzen des Attachment Parenting und der Notwendigkeit einer starken emotionalen Bindung zwischen Eltern und Kind uneingeschränkt zu. Aber dieser Erziehungsstil hat eindeutige Grenzen und Nachteile. Im Hinblick auf das hehre Ziel, selbstsichere und mitfühlende Erwachsene hervorzubringen, fordert das Attachment Parenting, dass Eltern stets emotional verfügbar sind und schnell auf die Bedürfnisse ihrer Kinder reagieren. Viele Anhänger dieses Erziehungsstils berichten davon, dass er viel »Arbeit« (vor allem für Mütter) mit sich bringt und das Risiko starker Schuldgefühle und eines Burnouts in sich trägt. Nach meiner Erfahrung werden aus strikten Anhängern des Attachment Parenting oft die schlimmsten Quallen-Eltern. In der realen Welt, wo emotionale Bedürfnisse nicht immer befriedigt werden, können solchermaßen erzogene Kinder verwöhnt sein, eine Anspruchshaltung entwickeln oder äußerst dünnhäutig reagieren. Oft sind die Eltern selbst starken Stimmungsschwankungen unterworfen. Weil sie sich so große Mühe geben, jederzeit auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzugehen, fühlen sie sich manchmal überfordert oder zu wenig wertgeschätzt, was wiederum zu inkonsequentem und unberechenbarem Verhalten führt.
Viele nachgiebige und autoritäre Eltern haben eines gemeinsam: Sie geben ihren Kindern zu viel vom Falschen. Unabhängig von unserem sozioökonomischen Status wollen wir alle nur das Beste für unsere Kinder. Leider wird das Beste oft fehlinterpretiert als mehr, und das bedeutet sehr schnell zu viel. Ein anderer Begriff, den wir für Kinder verwenden, die zu viel bekommen, ist verwöhnt. Manchmal sagen wir beiläufig, unsere Kinder seien ja so verwöhnt, und verdrehen dabei scherzhaft die Augen. Aber Kinder zu verwöhnen ist eine schreckliche Vorstellung. Verwöhnen bedeutet im Grunde nicht, zu viel zu geben, sondern zu wenig von dem zu geben, was wirklich nötig ist. Das heißt, Verwöhnen ist eine Art von Vernachlässigung.