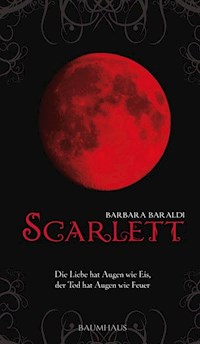14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Aurora Scalviati ist die beste Profilerin der italienischen Polizei. Doch seit sie bei einem Einsatz lebensgefährlich verletzt wurde, ist sie nur noch bedingt arbeitsfähig. Man versetzt sie daher in ein kleines Dorf in der Emilia Romagna, doch Ruhe findet Aurora auch dort nicht: Bereits in der Nacht nach ihrer Ankunft wird eine Frau in ihrem eigenen Haus brutal ermordet. An eine Wand hat der Täter mit Blut geschrieben: »Du wirst keinen Schaden tun.« Psychopathische Mörder sind Auroras Spezialgebiet. Doch sie kämpft nicht nur gegen einen gefährlichen Killer, sondern auch gegen ihre eigenen Dämonen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Aurora Scalviati ist die beste Profilerin der italienischen Polizei. Doch seit sie bei einem Einsatz lebensgefährlich verletzt wurde, ist sie nur noch bedingt arbeitsfähig. Man versetzt sie daher in einen abgelegenen Ort in der Emilia Romagna, doch Ruhe findet Aurora auch dort nicht: Bereits in der Nacht ihrer Ankunft wird eine Frau in ihrem eigenen Haus brutal ermordet. An eine Wand hat der Täter mit Blut geschrieben: »Du wirst keinen Schaden tun.« Psychopathische Mörder sind Auroras Spezialgebiet. Doch sie kämpft nicht nur gegen einen gefährlichen Killer, sondern auch gegen ihre eigenen Dämonen …
Informationen zu Barbara Baraldi
finden Sie am Ende des Buches.
Barbara Baraldi
Das Dorf der Toten
Thriller
Aus dem Italienischen
von Julika Brandestini
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Aurora nel buio« bei Giunti editori, Florenz und Mailand.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung April 2019
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Barbara Baraldi
This edition published in agreement with Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency (PNLA)
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: gettyimages / gaffera
Redaktion: Viktoria von Schirach
BH · Herstellung: kw
Satz: Kompetenzcenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-22647-3V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
»There is a crack in everything
That’s how the light gets in.«
Leonard Cohen, Anthem
Prolog
Es gibt Geschichten über heimgesuchte Orte, über Häuser, in denen sich das Böse tief eingegraben hat durch die Tragödien, die dort geschehen sind, und über Orte, die diesem Bösen eine Bühne gaben. Volkstümliche Legenden erzählen von seltsamen Geräuschen in leer stehenden Häusern, von dünnen Stimmen und Klagen im Wind.
Die Casa Ranuzzi war einer dieser Orte.
Ein Haus am Ortsrand, umgeben von einem kleinen Hof, mit einem üppigen Granatapfelbaum im hinteren Teil. Doch schon lange gab es niemanden, der die Früchte erntete.
Die Casa Ranuzzi stand seit über zwanzig Jahren leer. Die Dorfbewohner mieden es, und die meisten hatten es vorgezogen, die Geschichte seines Besitzers zu vergessen. Anders als in den Geschichten über Spukhäuser drang jedoch kein Laut heraus. Es herrschte ein konstantes, ohrenbetäubendes Schweigen. Und in manchen Nächten war der Nebel so dicht, dass er das Haus vollständig verschluckte. Als hätte es nie existiert.
Man sagt, besonders brutale Ereignisse hinterlassen Spuren an den Orten, an denen sie geschehen. Die Geister der Casa Ranuzzi waren die Wörter an den Wänden.
Wörter, die Obessionen herausschrien. Wörter, die die Alpträume der wenigen bevölkerten, denen es nicht gelungen war, die Geschichte vom »Bösen Wolf« zu vergessen. Dem Monster mit dem Beil, das eine ganze Familie niedergemetzelt hatte, die Inkarnation des Bösen, das von irgendwoher wie ein Todesengel in die Stadt gekommen war.
In manchen Orten nistet sich das Böse ein wie ein ungebetener Gast. Wie ein lautloses Raubtier.
Wie eine Spinne im Netz hatte das Böse in der Casa Ranuzzi auf seine Beute gelauert.
Bis heute.
1
Drei Monate vor dem Wiedererwachen
Das Auto fuhr langsam den Weg entlang, der zu dem Einfamilienhaus führte. Es hielt neben einem schwarzen Geländewagen, dem einzigen anderen Wagen auf dem kleinen Vorplatz. Die junge Frau blickte sich um, dann strich sie sich eine Haarsträhne hinters Ohr, wodurch eine lange Narbe an der Schläfe sichtbar wurde.
Sie befand sich an einem abgelegenen Ort, doch das war es nicht, was sie unruhig machte. Sie griff nach dem wattierten Umschlag auf dem Beifahrersitz, und dabei merkte sie, dass ihre Hände zitterten. Ihr Herz klopfte schnell und unregelmäßig.
Aurora spürte ein leichtes Kribbeln an der Stirn und hob die Hand, um mögliche Insekten fortzuscheuchen. Sie stellte sich vor, wie sie in Scharen über ihr Gesicht krabbelten, ihr in Augen und Ohren krochen, durch den Mund in die Kehle drangen. Sie betastete sich vorsichtig, doch es waren nur kleine Tropfen von eiskaltem Schweiß.
Sie nahm einige tiefe Atemzüge, saugte so viel Luft ein, wie sie konnte, doch ihr Herz schien verrücktzuspielen. Sie wusste, was gleich geschehen würde. Sie kannte dieses Gefühl der Beklemmung nur zu gut. Es war das Gefühl, das einer Panikattacke vorausging.
Sie war versucht, den Motor wieder anzulassen und wegzufahren. Mehrmals legte sie den Umschlag zurück auf den Sitz und nahm ihn wieder hoch, dann hielt sie inne, lehnte sich gegen die Rückenlehne und hieb mit der Faust aufs Lenkrad.
Nein, sie würde sich nicht überwältigen lassen. Diesmal würde sie sich wehren.
Mit zitternden Händen zog sie den Anhänger, den sie um den Hals trug, aus ihrer Bluse. Es war ein Pillendöschen aus Silber. Sie öffnete es, holte eine kleine weiße Tablette heraus und würgte sie hinunter. Sie kniff die Augen zusammen. Irgendwie gelang es ihr, die Atmung zu beruhigen. Sie wartete einige Minuten, schließlich beschloss sie, aus dem Auto zu steigen.
Im Slalom um die Pfützen, die der letzte Regenguss hinterlassen hatte, erreichte sie die Eingangstür. Sie streifte mehrfach ihre Stiefel an der Fußmatte ab, um den Schlamm von den Sohlen zu putzen. Sie drückte die Klingel an der Sprechanlage und wartete, den Blick fest auf die kleine Kamera geheftet, die darüber hing, bis eine männliche Stimme sie aufforderte hereinzukommen.
Aurora trat in ein kleines Wartezimmer, von dessen Wänden der Putz bröckelte, mit einer Stuhlreihe an einer Wand. Die grün gestrichene Tür gegenüber der Eingangstür war geschlossen.
»Professor Mascarelli?«, rief sie.
Als sie keine Antwort bekam, drückte sie die Klinke herunter und öffnete die Tür. Sie betrat einen großen quadratischen Raum mit Holzfußboden und hohen Regalen, vollgestopft mit Büchern. Ein breites Panoramafenster gab den Blick auf die üppige Vegetation des Waldes frei, der die kleine Villa umgab. Ein Schreibtisch stand in der Mitte des Raumes auf einem staubig wirkenden Teppich.
Ein untersetzter Mann trat durch die Schiebetür an einer Seite des Raumes. Er war um die sechzig, mit schütterem Haar, und seine hervorstehenden Augen verliehen ihm das Aussehen eines riesigen Lurchs. Er trug ein kariertes Hemd und ein Paar abgewetzte, ausgebeulte Jeans.
»Sie müssen Aurora Scalviati sein«, sagte er mit leicht amüsiertem Lächeln. »Entschuldigen Sie bitte, dass Sie warten mussten, aber die Leute, mit denen ich für gewöhnlich zu tun habe, sind nicht allzu wild darauf, mich zu sehen.«
»Ich dachte, ich hätte mich am Telefon deutlich ausgedrückt. Sie dürfen mich niemals beim Namen nennen«, antwortete sie.
Der Mann strich sich nachdenklich über das Kinn. »Stimmt. Das hatte ich vergessen«, murmelte er. Dann räusperte er sich, bemüht, einen professionellen Eindruck zu machen. »Haben Sie die Krankenakte dabei?«
Aurora reichte ihm den Umschlag. »Da drin finden Sie auch das vereinbarte Honorar.«
Der Mann blätterte den Inhalt des Umschlags flüchtig durch. Nachdem er das Bündel Scheine eingesteckt hatte, zog er einige bedruckte Blätter heraus, die von einer Büroklammer zusammengehalten wurden.
»Sie haben … Ihren Namen aus den Berichten gelöscht?«, fragte er überrascht.
»Ich glaube, alles in allem ist das auch in Ihrem Interesse«, antwortete Aurora. »Falls irgendetwas schiefgeht, wollen Sie bestimmt nicht mit meinem Namen in Verbindung gebracht werden.«
»Vielleicht ist es auch andersherum«, antwortete der Mann ironisch.
»Niemand darf wissen, dass ich hier war«, fuhr sie mit betont fester Stimme fort. Doch ihr Blick verriet eine leichte Unsicherheit, die sich schwer verbergen ließ. Ihre Augen waren unruhig, untermalt von tiefen Ringen, und ihr Blick huschte ständig prüfend von einer Ecke des Zimmers zur anderen.
»Sie sind ziemlich blass«, sagte der Mann. »Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht?«
»Wenn es mir gut ginge, wäre ich nicht hier, meinen Sie nicht?«
Der Mann murmelte etwas vor sich hin, nahm dann eine Brille vom Schreibtisch und setzte sie auf. Er las, was auf den Blättern stand.
»Sie waren in einer Klinik, die auf diese Art von Fällen spezialisiert ist«, murmelte er. »Was führt Sie zu der Annahme, dass ich Ihr Problem lösen kann, wenn die Ärzte dort es nicht konnten?«
»Die Pharmakotherapien dort haben nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Und die Ärzte meinten, es sei zu riskant, mich einer EKT zu unterziehen.«
»Elektrokonvulsionstherapie. Das klingt viel harmloser als das Wort Elektroschock, nicht wahr?«
»Sie finden es zu riskant wegen meines … Gesamtzustandes.«
»Sie wurden ziemlich schwer verletzt«, sagte der Mann. »Darf ich fragen, wie das passiert ist?«
»Ich habe keinerlei Absicht, darüber zu sprechen.«
Es folgte ein langer Moment des Schweigens, in dem der Mann eine defensive Körperhaltung einnahm. »Sie sind bei der Polizei, richtig?«
»Nicht mehr«, antwortete Aurora ausweichend.
»Darf ich fragen, woher Sie meinen Namen haben?«, versuchte er es noch einmal.
Aurora hob leicht die Schultern. »In meiner Position ist es nicht schwierig, gewisse Informationen zu erhalten.«
Der Mann seufzte. »Ich nehme an, Sie kennen bereits die Kontraindikationen für die Behandlung. Man hat Sie sicher über die möglichen kardiovaskulären Komplikationen, die Krampfanfälle, die stechenden Kopfschmerzen, den möglichen Erinnerungsverlust informiert.«
»Erinnerungsverlust wäre mein geringstes Problem«, sagte Aurora bitter.
Der Mann breitete die Arme aus als Zeichen seiner Kapitulation. »Meinetwegen«, seufzte er. »Ich habe ein Zimmer vorbereitet, in dem Sie sich nach der ersten Sitzung etwas ausruhen können. Gibt es jemanden, der sich danach um Sie kümmert?«
Aurora blickte nervös um sich. »W-was meinen Sie?«
Aus ihrer Reaktion schloss er, wie unpassend seine Frage gewesen war. Es genügte vollkommen, sie anzusehen. Diese Frau war der einsamste Mensch, dem er je begegnet war.
»Auch wenn die Wirkung der Betäubung nachgelassen hat, können Sie auf keinen Fall Auto fahren«, erklärte er. »Wie werden Sie nach Hause kommen?«
»Keine Betäubung«, unterbrach ihn Aurora.
»Die Dosierung des Methohexital ist sehr niedrig, so dass Sie nach der Behandlung sehr schnell wieder bei Bewusstsein sind.«
»Keine Betäubung«, wiederholte sie. »Ich muss die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein bleiben.«
»Na gut«, antwortete der Mann und setzte sich an seinen Schreibtisch. Eine allgemein verbreitete These ging davon aus, dass depressive Menschen sich schuldig fühlen, und die EKT erfüllte ihr Bedürfnis nach Strafe.
Er holte einen Formularblock aus einer Schublade. »Ich habe noch einige Rezepte aus meiner Zeit als praktizierender Arzt.« Er füllte drei Zettel aus, riss sie heraus und reichte sie Aurora.
»Zwischen einer Behandlung und der nächsten könnte sich Ihr Zustand verschlechtern. Diese Medikamente werden Ihnen dabei helfen, die Angstzustände unter Kontrolle zu halten.«
»Gefälschte Rezepte«, sagte Aurora.
»Ich denke nicht, dass Sie mich anzeigen wollen.«
Aurora nahm die Blätter und steckte sie in die Innentasche ihrer Jacke.
»Bitte folgen Sie mir.« Der Mann ging voraus durch einen schwach beleuchteten Korridor, an dessen Wänden Reproduktionen berühmter Renaissancegemälde hingen. Die Dielen knarrten bei jedem seiner Schritte. »Wussten Sie, dass die ersten Experimente mit Elektroschocks von der Praxis eines römischen Schlachthauses in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts inspiriert waren? Sie betäubten damit die Schweine vor der Schlachtung. Eine Geste der Barmherzigkeit gegenüber diesen armen Tieren …«
»Ich bin nicht für eine Geschichtsstunde hergekommen, Professore.«
»Bitte, lassen Sie die akademischen Titel«, winkte der Professor ab. »Die haben für mich keine Bedeutung mehr, seit ich von der Kammer suspendiert wurde.«
Er öffnete die Tür zu einem spartanisch möblierten Zimmer. Ein Medizinschrank, ein Fenster mit verschlossenen Läden. In der Mitte des Raumes befand sich eine Liege, daneben ein Infusionsständer und ein Rollwagen mit einem Computer, dem Apparat für die EKT und verschiedenen medizinischen Gerätschaften. An einer Sauerstoffflasche baumelte eine Sauerstoffmaske. Das Licht kam von einer nackten Glühbirne an der Decke.
»Haben Sie Medikamente genommen, bevor Sie hergekommen sind?«
»Nein«, log Aurora und hängte ihren Mantel an die Garderobe am Eingang.
Nachdem sie sich auf der Liege ausgestreckt hatte, setzte der Mann ihr die Sauerstoffmaske auf und öffnete das Versorgungsventil.
»Sie müssen das Gas ein paar Minuten lang einatmen, um das Gewebe gut mit Sauerstoff aufzufüllen.«
Er schnürte eine Binde um ihren rechten Oberschenkel, schob den Ärmel ihrer Bluse hoch und nahm eine Spritze von dem Wagen.
»Was ist das für Zeug?«, fragte sie erschrocken. Durch die Maske klang ihre Stimme dumpf.
»Succinylcholin«, antwortete er. »Ein Mittel zur Muskelentspannung. Es dient dazu, die Muskelaktivität einzuschränken, um den Effekt der Kontraktionen abzumildern.«
»Ein Lähmungsmittel«, präzisierte sie.
»Keine Sorge, Sie werden trotzdem die ganze Zeit bei Bewusstsein bleiben. Nach wenigen Minuten lässt die Wirkung des Succinylcholins wieder nach. Die Konvulsionen dauern zwischen dreißig und neunzig Sekunden, und die Injektionen sind notwendig, um zu verhindern, dass Sie sich die Rippen oder die Wirbelsäule brechen. Der Abklemmschlauch dient dazu, einen Teil Ihres Körpers zu isolieren, damit ich sicher sein kann, dass Sie keinen Infarkt erleiden.« Er machte eine Pause. »Bevor wir anfangen, injiziere ich Ihnen zur Sicherheit eine Flüssigkeit auf Sauerstoffbasis, denn Sie werden nicht in der Lage sein, selbständig zu atmen.«
Nachdem er ihr beide Injektionen verabreicht hatte, rieb der Mann Auroras Schläfen mit einem Wattebausch ein und befestigte die Elektroden. Dann schob er ihr ein Stück Gummi in den Mund. »Damit Sie sich nicht die Zähne zersplittern oder die Zunge abbeißen.« Schließlich griff er nach dem Regler der EKT-Maschine. »Sind Sie bereit?«
Aurora blinzelte als Zeichen ihrer Zustimmung.
Der Mann drehte entschlossen den Knopf.
Der Körper der jungen Frau wurde von heftigen Krämpfen geschüttelt, als eine Ladung von vierhundertachtzig Volt durch ihr Gehirn jagte. Ihre Augen rollten nach hinten. In ihrem Kopf explodierten Erinnerungsfetzen, unzusammenhängende Bilder aus anderen Zeiten, von anderen Orten.
Für einen Augenblick war sie nicht mehr da.
Sondern wieder in dem alten Schlachthaus, wo alles begonnen hatte.
Sie hörte die Schreie, dann die Schüsse.
Und alles versank in Dunkelheit.
2
Bononia, 20. September 1349
Ausgestoßene.
Dieses Wort ging Padre Egidio Galuzzi, Prior der Dominikanermönche von Bononia, nicht mehr aus dem Kopf, während er zusah, wie sich die Morgenröte auf die Stadt vor seinem kleinen Zellenfenster legte. Ein eiskalter Schauer überlief ihn; was er einstmals für ein Zeichen göttlicher Kraft gehalten hätte, erschien ihm heute wie ein schlechtes Omen.
Seit über einem Jahr suchte eine heimtückische, unaufhaltsame Seuche die Bevölkerung heim, die die Gelehrten nach dem lateinischen Wort für »das Schlimmste«, pestem, die Pest, getauft hatten.
Die Pest hatte sich schnell in ganz Europa ausgebreitet und Männer, Frauen und Kinder dahingerafft, ganz gleich ob Adelige, Priester, Bauern oder Handelsleute, immer mehr Ländereien lagen brach, die Bevölkerung der Stadt war dezimiert, und die Sitten verrohten.
Die Krankheit verschlang zwei Menschen von fünfen, und es hieß, sie komme aus dem fernen Orient, wo mehrere Tage lang ein Regen aus Würmern, später aus Schlangen herabgekommen sei, die groß genug waren, einen Mann in einem einzigen Bissen zu verschlingen, schließlich seien Feuerbälle gefolgt, deren Rauch so giftig war, dass jeder, der ihn einatmete, innerhalb von zwölf Stunden starb.
Im Glauben an dieses Gerede hatte der Ältestenrat, die weltliche Institution, die Bononia regierte, verfügt, dass in den Häusern alle nach Osten gehenden Fenster verschlossen bleiben mussten, um den giftigen Pesthauch nicht einzulassen, der mit den Winden aus dem Orient hereinwehte.
»Ausgestoßene« waren diejenigen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Isoliert, sich selbst überlassen. Wie die Pestkranken. Aber nicht nur die.
Manch einer hielt die Pest für eine Strafe des Allmächtigen für die Toleranz der Regierenden gegenüber Juden und Ungläubigen, und das hatte für ein Wiederaufflammen der Verfolgung von Minderheiten gesorgt. Auch wenn es sich dabei häufig nur um eine billige Rechtfertigung handelte, um sich die Reichtümer der Verdammten anzueignen.
Padre Egidio hielt nichts von solcherlei Aberglauben, und als Inquisitor spürte er die Verantwortung, die Stadt vor allem zu bewahren, was ihr Volk von Gottes Gnade entfernte.
Er war überzeugt, es bedürfe eines Glaubensaktes, um die Pest zu bekämpfen, und er hatte sich für härtere Strafen für der Häresie oder der Hexerei Verdächtige eingesetzt. Die Irrlehre gehörte ausgemerzt, und die beste Art, das zu tun, war, einen Prozess nach dem anderen zu führen. Täglich gab es Exekutionen, und sie durften kein Ende finden, bis nicht der Glauben des Volkes an Gott und die Männer der Kirche vollständig wiederhergestellt wäre.
Padre Egidio schüttelte die Gedanken ab und zog seinen schwarzen Umhang über den weißen Habit der Dominikanermönche. Sein noch vom Schlaf verschleierter Blick glitt für einen Augenblick durch die Zelle. Sie war schlicht möbliert, wie es die Regeln Domingo de Guzmáns, des heiligen Dominikus vorschrieben: Neben dem Bett stand eine Sitztruhe und auf der gegenüberliegenden Seite ein kleiner Schreibtisch. Padre Egidio kniete vor dem Kruzifix an der Wand nieder und sprach mit leiser Stimme das Vaterunser.
Dann verließ er den Raum und ging mit sicheren Schritten den langen Korridor hinunter, der die Zellen miteinander verband, bis in den vorderen Teil der Basilika. Hier wurden normalerweise die öffentlichen Andachten abgehalten, während der Laudes war er jedoch für die Mönche reserviert. Er gesellte sich für das Morgengebet zu seinen Mitbrüdern an der Arca di San Domenico, dem eindrucksvollen Grabmal des Ordensgründers.
Nach dem Gebet trat Padre Baldassarre Fey, der alte Abt, zu ihm. »Macht Euch etwas Sorgen, Padre Egidio?«
Padre Egidio runzelte die Stirn, überrascht von so viel Eifer. »Warum fragt Ihr?«
»Ich kenne Euch seit Eurer Zeit als gottesfürchtiger Ordensanwärter«, sagte Padre Baldassarre. »Vergesst nicht, dass ich derjenige war, der sich beim Bischof für Eure Ernennung zum Inquisitor eingesetzt hat. Euch hat stets ein flammender Glaube beflügelt, eine Seltenheit in dieser Zeit. Und doch habe ich seit einiger Zeit das Gefühl, dass Euch eine große Sorge plagt.«
Padre Egidio breitete die Arme aus. Es stimmte, sein alter Freund kannte ihn besser als jeder andere. Er fühlte tiefes Unbehagen in sich aufsteigen, was von dem körperlichen Unwohlsein, das ihn bereits seit Tagen plagte, noch verschlimmert wurde. Er kannte die Symptome der Krankheit gut, und das anhaltende Fieber, das ihm zusetzte, war sicherlich eines von ihnen, ebenso wie die eiförmige Ausbeulung an seiner Leiste. Doch es war noch nicht der richtige Zeitpunkt, seinen Mitbruder über die Erkrankung zu informieren. Im Augenblick forderte eine dringende Angelegenheit seine ganze Aufmerksamkeit. Und das Wort »Ausgestoßene« hallte in seinem Kopf wider wie eine Drohung.
»Meine einzige Sorge ist die Rettung unseres Volkes«, lautete darum seine ganze Antwort.
Ein ironisches Lächeln breitete sich daraufhin unter dem üppigen Bart Padre Baldassarres aus. »Manchmal frage ich mich, ob da noch viel zu retten ist«, sagte er bitter. »Im Volk machen sich Verzweiflung und Elend breit. Der Gottesglaube wird auf eine harte Probe gestellt und mit ihm unsere Autorität.«
»Genau deshalb sind entschiedene Schritte erforderlich, um das Böse auszmerzen«, schloss Padre Egidio, dann verabschiedete er sich mit einem Nicken, auf das der andere mit einer angedeuteten Verbeugung antwortete.
Als Padre Egidio aus der Basilika trat, peitschte die heiße, feuchte Luft sein Gesicht. Nichts an dem Klima dieser Tage deutete auf die bevorstehende Ankunft des Herbstes hin. Der glühende Wind wehte von den Küsten her Salzgeruch in die Straßen der Stadt, unter den sich der ekelhafte Gestank des Straßenschlamms mischte, der ständig von den Karren der Händler durchgepflügt wurde.
Padre Egidio stieg über einen Bettler hinweg, der auf dem Pflaster vor der Basilika schlief. Mit einem Seitenblick auf einen Mann in zerlumpter Kleidung, der einen Karren voller Pestleichen zum vor der Stadt eigens eingerichteten Massengrab brachte, setzte er seinen Weg fort.
Ein Zug Geißler zog laut betend durch die Straße. Sie waren barfuß, trugen weiße Mäntel mit scharlachroten Kreuzen, heruntergelassene Kapuzen und Peitschen in der Hand.
Zu ihnen trat eine Frau mit vor Wahnsinn verzerrtem Gesicht, im Arm ein Bündel mit einer Kinderleiche. Sie sank vor ihnen auf die Knie und bettelte um eine Segnung.
Beim Anblick der Szene konnte Padre Egidio eine Grimasse des Abscheus nicht unterdrücken. Er hatte sich entschieden gegen den Fanatismus der Geißler gestellt, doch gegen die starke politische Unterstützung der Bruderschaft war er machtlos gewesen. Die Geißelbrüder hielten sich für heilig, und sie weigerten sich strikt, sich der Kirchenhierarchie zu unterwerfen. Sie waren streitbare Antisemiten, und obwohl der Papst die Judenverfolgung mit aller Härte verurteilt hatte, hatten sie nicht gezögert, ganze Familien jüdischer Herkunft auszulöschen. Sie betrachteten sie als »Ausgestoßene«.
Padre Egidio erreichte den Hauptplatz der Stadt, wo sich eine bunte, lärmende Menschenmenge vor dem Haus des Bürgermeisters versammelt hatte, wo sie auf die Vollstreckung der Todesstrafe einiger Verurteilter wartete.
Drei Tage zuvor hatte ein Bauer, ein gewisser Mattia da Parma, beim Pflügen ein paar grauenhaft zugerichtete Verstümmelte entdeckt. Sie waren in Holzkisten gequetscht, in für die christliche Tradition sehr ungewöhnlichen Posen. Einige Skelette lagen auf dem Bauch, den Oberkörper oder die Arme an die Holzkisten genagelt, andere hatten gebrochene Knochen an Beinen und Becken, und in einigen Fällen waren die Schädel mit langen rostigen Nägeln gespickt.
Niemand wusste, zu wem diese Überreste gehörten. Jemand hatte die Gräber »Friedhof der Ausgestoßenen« getauft.
Als die Obrigkeit informiert worden war, hatte sie nicht gezögert, den Bauern und seine Kinder wegen Hexerei zu verhaften. Der Prozess, den Padre Egidio eilig abhielt, war sehr oberflächlich gewesen und das Todesurteil unausweichlich. Nachdem er mittels Folter ein vollständiges Geständnis des Bauern und seiner Kinder erhalten hatte, war die Verurteilung zum Tode automatisch. Nach Meinung des Inquisitors hätten die Überreste der Ausgestoßenen niemals ans Licht kommen dürfen. Es war eindeutig ein Zeichen dafür, dass der Teufel die Stadt verflucht hatte. Es wurde verfügt, dass die Überreste erneut an dem Ort begraben werden sollten, an dem sie gefunden worden waren, und dass es forthin jedem streng untersagt war, das Feld zu betreten.
Padre Egidio bahnte sich einen Weg durch die Menge bis zur Bühne, die für die Würdenträger reserviert war, geschützt durch einen Trupp Stadtwachen. Bei seinem Vorübergehen deuteten die Anwesenden eine Verbeugung an, auf die der Inquisitor mit einem leichten Kopfnicken antwortete. Im gleichen Augenblick verkündigten die Schläge vom höchsten Glockenturm der Stadt den Beginn der Hinrichtung.
Als der Scharfrichter die großen Fenster des Hauses öffnete, explodierte die Menge in ein anfeuerndes Gebrüll.
Die Ersten, die mit eng um den Hals gebundenen Stricken aus dem Fenster geworfen wurden, waren die beiden Kinder des Bauern, der kleine Pietro mit seinen neun und die kleine Matilde mit sieben Jahren. Ein Jahr zuvor hatte die Pest ihre Mutter geholt, und vielleicht war das gut so. Auf die Weise musste sie nicht mit ansehen, welchen Qualen ihre geliebten Kinder ausgesetzt waren. Als ihre Körper aus dem Palastfenster baumelten, wurde die Menge von immer wilderen Begeisterungsstürmen erfasst.
Mattia da Parma war so stämmig und korpulent, dass der Scharfrichter, nachdem er das Seil um seinen Hals geknotet hatte, einige Zeit brauchte, bis er ihn auf das Fensterbrett gehievt hatte. Dann schubste er ihn mit entschiedener Geste hinunter.
Das Seil spannte sich mit einem solchen Ruck, dass der Kopf des Bauern wie von einem unsichtbaren Beilschlag vom Rumpf getrennt wurde.
Der Körper Mattia da Parmas zerschellte am Boden, während der Kopf in die versammelte Menschenmenge auf der Piazza plumpste. Bei diesem Anblick wandten viele der Anwesenden den Blick ab und bekreuzigten sich schnell.
Padre Egidio betrachtete den Körper des Verurteilten, der von einer Reihe wilder Zuckungen durchlaufen wurde. Er richtete den Blick auf das Blut, das aus dem Hals strömte und sich auf dem Pflaster ausbreitete wie ein dunkler Schatten.
Unruhe befiel ihn, während das Wort »Ausgestoßene« sich wie ein langer Nagel in seine Gedanken bohrte.
Und in dem Blut des Verurteilten erkannte er dasselbe Rot wie das des Sonnenaufgangs, den er am Morgen betrachtet hatte.
3
Fünf Tage vor dem Wiedererwachen
Some girls wander by mistake, summte Aurora Scalviati leise vor sich hin, während sie die Landstraße Nummer 43 entlangfuhr. Sie hatte den Eindruck, ihr Wagen bewege sich durch einen Ort außerhalb der Zeit, den die Scheinwerfer nicht erhellen konnten. Die Landschaft um sie herum lag unsichtbar, versteckt von Nebel und vom Dunkel der Nacht, Ziel einer Reise, die ihr unendlich schien. Laut Navigationsgerät musste sie noch eine halbe Stunde fahren, bis sie Sparvara erreichte, jene Stadt der Emilia Romagna, wo sie bei der örtlichen Polizeidienststelle ihren Dienst antreten sollte.
»Herzliche Leute, diese Emilianer«, hatten ihre Kollegen von der Kripo in Turin immer wieder betont, nachdem sie erfahren hatten, welche ihre neue Dienststelle nach achtzehn Monaten Beurlaubung sein würde.
Die Emilia Romagna ist wie eine einzige große Stadt; die Viertel sind die über die Ebene verstreuten Dörfer, die sich vom Fuß des Apennins entlang dem Strom des Flusses Po in Richtung Adria ausbreiten.
»Da unten passiert nie was, genau das Richtige für dich zur Erholung«, hatte der Polizeichef zu ihr gesagt, als er ihr die Versetzung mitteilte. Diese Worte waren vermutlich dazu gedacht, sie zu beruhigen, doch sie hatten den gegenteiligen Effekt gehabt.
Aurora strich sich nervös eine Haarsträhne hinter das Ohr. Dabei berührten ihre Finger die Narbe an ihrer Schläfe. Sie zog sie eilig zurück.
Der Refrain eines alten Liedes ging ihr nicht mehr aus dem Kopf, und sie merkte, dass sie Teachers von Leonard Cohen vor sich hin summte.
Some girls wander by mistake, into the mess that scalpels make. Are you the teacher of my heart?
Automatisch griff sie nach ihrem Handy und suchte im Telefonbuch nach Flavios Nummer. Einen Augenblick starrte sie auf den Bildschirm, ohne auf das Anrufzeichen zu drücken. Dann legte sie das Telefon zurück und schaute wieder hinaus durch die Windschutzscheibe. Den Anweisungen des Navis folgend bog sie in eine gewundene Straße ein, die hinter einem Deich entlangführte. Sie überquerte eine kleine Brücke mit rostigem Geländer und bog noch einmal ab in ein kleines Sträßchen voller Schlaglöcher, das von skelettartigen Bäumen gesäumt war.
Einige Blaulichter in der Ferne weckten ihre Aufmerksamkeit. Die Sicht war so schlecht, dass es aussah, als wären dort Streifen- und Notarztwagen mitten im Nirgendwo versammelt.
Als Aurora wieder nach vorn blickte, fuhr sie zusammen. Die Silhouette eines Mannes war am Straßenrand aus dem Nebel aufgetaucht, und sie musste scharf bremsen, um ihn nicht zu überfahren. Die Reifen rutschten auf dem nassen Asphalt, und Auroras Wagen kam vor einem Dienstwagen der Carabinieri zum Stehen, der mit eingeschaltetem Blaulicht quer über der Straße stand. Es handelte sich um eine veritable Straßensperre.
Der uniformierte Mann trat an das Wagenfenster und bedeutete Aurora, es herunterzulassen.
»Haben Sie das Blaulicht nicht gesehen?«, fragte er.
»Entschuldigen Sie, Agente«, antwortete Aurora. »Aber bei diesem Nebel …«
Der Carabiniere ließ sie den Satz nicht zu Ende sprechen. »Da vorn ist die Straße gesperrt«, sagte er. »Sie können hier nicht weiter.«
Aurora riss die Augen auf. »W-wie bitte?«, stammelte sie. »Aber ich muss nach Sparvara, und ich bin schon spät dran.«
»Tja, Sie sind fast da, das Stadttor ist noch etwa zwei Kilometer entfernt, aber hier kann ich Sie leider nicht durchlassen.«
»Hat es einen Unfall gegeben?«
Der Carabinere wandte den Blick ab. »Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Ich bin Beamtin der Kriminalpolizei«, erklärte Aurora und wühlte in der Tasche auf ihrem Beifahrersitz. Sie zog ihre Marke und ein bedrucktes Blatt heraus. »Aurora Scalviati, vom Kommissariat Sparvara.«
Der Carabiniere warf einen Blick auf das Dokument. »Hier steht, dass Sie erst morgen Ihren Dienst antreten.«
»Ich weiß, aber …«
»Glauben Sie mir, Signorina«, sagte der Carabiniere ruhig. »Es ist besser, wenn Sie umdrehen und die alte Landstraße ›Provinciale del Duca‹ nehmen.«
»Besser für wen?«
»Für Sie. Das da vorn ist kein schöner Anblick.«
»Kann ich wenigstens erfahren, was los ist?«
»Ich darf nicht darüber sprechen«, antwortete der Carabiniere. »Anweisung des Staatsanwalts.«
»Der Staatsanwalt ist hier? Gab es einen Mord?«
Der Carabiniere straffte die Schultern.
»Ach, kommen Sie«, sagte Aurora, »morgen erzählen mir die Kollegen sowieso davon!«
»Ja, sprechen Sie morgen mit den Kollegen. Ich darf Ihre Fragen nicht beantworten. Das verstehen Sie doch sicher.«
»Na gut«, seufzte Aurora mit einem gezwungenen Lächeln. Dann legte sie den Rückwärtsgang ein, um den Wagen zu wenden.
Im Wegfahren behielt sie den Carabiniere im Rückspiegel im Auge und beobachtete, wie seine Umrisse im Nebel verschwanden. Sie schaltete die Scheinwerfer aus und brachte den Wagen vor der Einfahrt eines Landhauses zum Stehen. Sie stieg aus dem Auto und schloss vorsichtig die Tür, um keinen Lärm zu machen.
»Die alte Landstraße, was?«, murmelte sie vor sich hin, während sie durch die Baumreihe am Straßenrand schlüpfte.
Mit schnellen Schritten lief Aurora über das unbestellte Feld in Richtung der Lichter. Nach wenigen Metern waren ihre Stiefel voller Schlamm. Sie sprang über einen Graben und ging weiter, bis sie nahe genug an die Stelle herangekommen war, wo zwei Streifenwagen geparkt waren, dazu ein blaues Auto, ein Feuerwehrauto und ein Rettungswagen. Sie war verblüfft. Was konnte geschehen sein, das ein solches Aufgebot erklärte?
Inzwischen war sie sicher, dass es einen Mord gegeben haben musste. Im Bruchteil von Sekunden vergaß Aurora, dass sie Hunderte Kilometer von ihrem Zuhause und ihren Exkollegen entfernt war, dass sie erschöpft war und es das einzig Sinnvolle wäre, in den Gasthof zu fahren und sich auszuruhen.
Denn das war es, was sie bewogen hatte, bei der Polizei zu bleiben, trotz allem. Es gab nur einen einzigen Ort auf der Welt, von dem sie sich nie würde fernhalten können, und das war ein Tatort.
4
Aurora stieg über einen Zaun und fand sich im Garten eines mit gelbem Absperrband umzäunten Landhauses wieder. Zwei uniformierte Polizisten unterhielten sich bei einem der Streifenwagen mit einem der Sanitäter. Einer der Polizisten bemerkte sie und löste sich von der Gruppe. Er kam mit erhobener Hand auf sie zu, um sie zum Stehenbleiben zu bewegen.
»Halt!«, rief er. »Hier dürfen Sie nicht rein!«
»Ich bin eine Kollegin«, antwortete Aurora nervös und hielt ihre Erkennungsmarke hoch. »Aurora Scalviati, vom Kommissariat Sparvara.«
Der Polizist betrachtete sie misstrauisch. Dann studierte er eingehend die Polizeimarke. »Tut mir leid, Kommissarin Scalviati«, antwortete er, wenig überzeugt. »Aber ich habe die Anweisung, niemanden vorbeizulassen.«
Aurora konnte nicht länger an sich halten. »Ich bin deine Vorgesetzte, verdammt, und jetzt lass mich bitte durch!«
»Was ist denn da los?«, unterbrach sie eine autoritäre Stimme in ihrem Rücken. Sie gehörte einem kleinen Mann um die fünfzig, mit kantigem Gesicht und weit auseinanderstehenden Augen. Er trug eine kleine Mappe unter dem Arm und trat aus dem Haupteingang des Landhauses, in Begleitung eines zweiten Mannes, dem Aurora im Augenblick keine Beachtung schenkte.
»Kommissar Piovani, gerade wollte ich …«, nuschelte der Polizist.
»Wer ist diese Frau?«, fragte Piovani, ohne Aurora eines Blickes zu würdigen.
»Kommissarin Scalviati«, mischte sie sich ein und streckte ihm die Hand hin. »Ich bin gerade aus Turin gekommen.«
Piovani musterte sie von Kopf bis Fuß, als wäre sie ein seltenes Exemplar von Tiefseefisch. »Ich habe Sie erst morgen früh in meinem Büro erwartet«, sagte er.
Aurora zog verlegen die Hand zurück. »Ich habe die Blaulichter von der Straße aus gesehen und gedacht, es handle sich vielleicht um einen Notfall.«
»Wir haben hier alles unter Kontrolle, Scalviati. Ihre Anwesenheit ist nicht weiter vonnöten. Sie können gehen.«
Aurora räusperte sich. »Bei allem Respekt, Commissario, darf ich Sie daran erinnern, dass ich drei Jahre lang beim Mobilen Einsatzkommando war und Expertin bei der Tatortanalyse von Gewaltverbrechen bin? Auch wenn ich offiziell erst morgen den Dienst antrete, möchte ich meinen Beitrag zu den Ermittlungen in einem Mordfall leisten.«
»Wer hat etwas von einem Mord gesagt?«
»Niemand … aber der Carabiniere da hinten hat mir gesagt, dass der Staatsanwalt hier war, und ich glaube nicht, dass er sich wegen einer Katze im Baum herbemühen würde.«
»Was ist los, Scalviati, können Sie es nicht erwarten, wieder mitzumischen? Dabei möchte man meinen, Sie hätten Ihre Lektion gelernt, nach dem, was Sie ausgelöst haben.«
Aurora spürte, wie der Druck hinter den Schläfen zunahm, und einen Knoten, der ihr den Hals zuschnürte. »Es gab eine Untersuchung«, sagte sie mit leicht zitternder Stimme. »Und Sie wissen sicherlich, dass ich sauber daraus hervorgegangen bin.«
»Das müssen Sie mit Ihrem Gewissen ausmachen«, antwortete Piovani mit herausforderndem Blick. »Ich kenne Ihre Geschichte gut. Wollen Sie wissen, wie einige Kollegen Sie nennen?« Nach einer effektvollen Pause fuhr er fort: »Bullenkiller.«
Aurora zwang sich, die Provokation zu ignorieren. Sie erwiderte Piovanis Blick und schluckte die aufsteigende Galle hinunter. »Lassen Sie mich rein, Commissario«, sagte sie. »Ich werde nur als Beobachterin da sein und mich ganz am Rand halten. Aber wenn das ein Mordschauplatz ist, können zwei zusätzliche Augen sicher nicht schaden.«
Piovani deutete auf Auroras schlammverschmierte Stiefel. »Glauben Sie wirklich, in dem Aufzug würde ich Sie da reinlassen? Der Tatort ist schon genug beeinträchtigt worden, bei dem ganzen Kommen und Gehen von Sanitätern und Polizisten heute Abend. Da mögen Sie noch so lange beim Mobilen Einsatzkommando gewesen sein, das Protokoll …«
»Ich kenne das Protokoll«, sagte Aurora und bückte sich, um ihre Stiefel aufzuschnüren. »Wenn meine schmutzigen Stiefel das Problem sind, voilà.« Nachdem sie sie abgestreift hatte, schlug sie einen Haken um Piovani und schlüpfte durch die Haustür.
»Colasanti!«, hörte sie den Commissario rufen. »Halt sie auf!«
Aurora hörte hinter sich schnelle Schritte. Doch sie war bereits im Haus. Und was sie sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren.
Sie blieb wie angewurzelt stehen, unfähig, den Blick abzuwenden, und für einen Augenblick vergaß sie sogar zu atmen.
5
Der Körper der Frau lag rücklings auf der hölzernen Treppe, in einer unnatürlichen Haltung, mit zur Seite gebeugtem Kopf. Ihr geblümtes Kleid war blutgetränkt. Der Oberkörper war verdreht, und man ahnte eine große Wunde seitlich am Rücken. Sie musste mit einer Hiebwaffe mit breiter, stumpfer Klinge wie die einer Axt oder eines Beils getroffen worden sein. Die Beine waren so verdreht, dass sie gebrochen sein mussten.
Der linke Arm lag auf einer Treppenstufe, während der andere in die Luft zeigte, an eine Seite des Geländers gestützt. Es sah aus, als hielte die Frau etwas in die Höhe, als wäre sie bei dem Versuch unterbrochen worden, einen Gegenstand in die Luft zu heben. Als Aurora den Grund für diese unnatürliche Haltung des Leichnams erkannte, wäre sie beinahe zurückgeschreckt: Die Hand war mit einem langen rostigen Nagel an einer Strebe des Geländers fixiert. Zwei weitere lange, dicke Nägel ragten aus ihrem Kopf. Sie waren benutzt worden, um beide Augen zu durchbohren. Über die Wangen liefen zwei Rinnsale geronnenen Blutes, die aussahen wie Tränen.
Um die Leiche herum machten sich zwei Forensiker in weißen Anzügen zu schaffen, beschäftigt, Spuren zu sammeln. Auf der ersten Stufe saß ein Polizist in Uniform, mit einer Spiegelreflexkamera um den Hals, der etwas in ein Notizbuch schrieb.
Auf der Wand entlang der Treppe leuchtete ein Schriftzug, wie ein pulsierendes purpurnes Geflecht, das sich nach unten zu bewegen schien. Vermutlich war er mit dem Blut des Opfers geschrieben.
»Du wirst keinen Schaden tun.«
Aurora spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog und wie Übelkeit aufstieg. Sie atmete tief und zwang sich, den Brechreiz zu unterdrücken. Sie hatte nicht erwartet, auf ein solch schreckliches Beispiel menschlicher Grausamkeit zu stoßen. Und sie war nicht mehr an derart rohe Anblicke gewöhnt.
Ihre Beine wurden weich, und jemand packte sie von hinten.
Sie schnellte nach vorn und versuchte instinktiv, sich zu befreien. »Aber was …«
Alle Anwesenden drehten sich zu ihr um und bedachten sie mit schweigenden Blicken.
Ihre Bemühungen, sich zu befreien, erwiesen sich als wirkungslos, der Griff war wie aus Eisen. »Lass mich los!«, knurrte sie, während sie rückwärts aus dem Haus gezogen wurde.
»Beruhige dich«, murmelte eine männliche Stimme, die versuchte, freundlich zu klingen.
Mit einem Ruck nach vorn gelang es Aurora, sich aus dem Griff zu befreien, und sie tat einen unsicheren Schritt, um sich von ihrem Angreifer zu entfernen.
Der Mann, der sie um etwa zwanzig Zentimeter überragte, hatte breite Schultern und Arme wie ein Rugbyspieler. Dazu ein Gesicht mit ausgeprägten Zügen und einem energischen Kiefer und zerzauste kurze Haare. Die Ausdrucksfalten in seinem Gesicht bewiesen, dass er die dreißig schon vor einer Weile überschritten hatte, doch es war unmöglich, sein genaues Alter zu schätzen. Der seit zwei oder drei Tagen nicht rasierte Bart wirkte etwas nachlässig, doch alles in allem war er recht attraktiv. Aurora betrachtete die Augenschlitze, durch die eine petrolgrüne Iris sichtbar war, und die vollen Lippen, die von zu vielen bis auf den Filter heruntergerauchten Zigaretten verbrannt schienen.
»Tut mir leid, aber du kannst hier nicht bleiben«, sagte er versöhnlich.
»Fass mich nie mehr an, verstanden?«, zischte Aurora. Dann warf sie den Forensikern und dem Polizisten mit dem Fotoapparat, die sie immer noch anstarrten, einen raschen Blick zu. Mit einem »Und was habt ihr zu glotzen?« verließ sie das Haus.
Der Mann folgte Aurora nach draußen und brachte ihr ihre Stiefel. »Das müssen deine sein. Zieh sie wieder an und nimm dich zusammen, der Commissario beobachtet uns.«
Aurora riss ihm die Stiefel aus der Hand und bückte sich, um sie anzuziehen.
Piovani trat zu ihnen. »Versuchen Sie, nicht noch mehr Probleme zu machen, Scalviati. Die Situation ist schon angespannt genug. Wo haben Sie Ihr Auto?«
Aurora deutete in Richtung der Straßensperre. »Da hinten.«
»Hauptkommissar Colasanti, begleite sie nach Hause. Wir sehen uns später in der Dienststelle«, sagte Piovani kühl zu dem Mann. Dann sah er Aurora an. »Bis morgen also.«
6
»Ganz herzliche Leute, diese Emilianer, was?«, brummte Aurora.
»Entschuldige wegen vorhin. Ich hoffe, ich habe dir nicht allzu sehr wehgetan?«
»Lass gut sein, Colasanti, ich bin nicht so zerbrechlich.«
»Du kannst mich Bruno nennen. Schließlich werden wir Kollegen sein, oder?«
»Es sei denn, Piovani fände einen Weg, mich loszuwerden.«
Bruno straffte die Schultern. »Sparvara ist nicht gerade eine Metropole. Es ist ein kleines Provinznest, in dem jeder jeden kennt, ob es einem gefällt oder nicht. Ein bisschen Misstrauen gegenüber neuen Gesichtern ist normal, und Piovani macht da keine Ausnahme. Aber er ist ein guter Polizist und alles in allem auch ein guter Mensch.«
Während sie nebeneinander hergingen, konnte Bruno es nicht lassen, Aurora verstohlene Seitenblicke zuzuwerfen. Sie war schlank, aber mit wohlgeformten Hüften. Sie wirkte zerbrechlich in der Männerkleidung, die sie trug. Ihre helle Haut leuchtete in der Dunkelheit, und ihre Handgelenke waren schmal wie die Zweige einer Eberesche. Insgesamt erinnerte sie an eine kleine Porzellanfigur, die kurz davor war zu zerspringen. Sie hatte einen entschlossenen Ausdruck im Gesicht, und auf dem Grund ihrer großen haselnussfarbenen Augen meinte Bruno einen tiefen Kummer auszumachen, aber auch unendlich große Zärtlichkeit. Immer wieder fingerte sie an ihrem kastanienbraunen Haarschopf herum, klemmte eine rebellische Haarsträhne hinter das Ohr, die stets von Neuem über den leicht vorstehenden Wangenknochen fiel. Bruno sah die lange Narbe an der Schläfe und dachte an die Geschichte, die man sich seit Auroras Versetzung im Kommissariat erzählte. Eine Geschichte, an die sie zweifellos jedes Mal dachte, wenn sie in den Spiegel sah.
»Das war kein Misstrauen, sondern echte Feindseligkeit«, antwortete Aurora.
»Nimm es ihm nicht übel. Ich glaube, die Gerüchte über dich haben sein Verhalten beeinflusst. Und er hat eine höllische Nacht hinter sich. Er kannte die Frau gut, die umgebracht wurde. Sie hieß Rossella Gualtieri und war die Frau eines Exkollegen.«
Aurora hob eine Augenbraue. »Eines Exkollegen?«
»Carlo Gualtieri war früher Polizist, bevor er in den … privaten Sektor gewechselt hat.«
»GPG?«, sagte Aurora, die Abkürzung eines Sicherheitsdienstes, der Guardia Particolara Giurata.
Bruno nickte nur.
»Wo ist er jetzt?«, fragte Aurora.
»Wir suchen ihn, aber er ist unauffindbar. Er ist zusammen mit seiner Tochter verschwunden, und wir konnten sie bisher nicht erreichen. Das Auto ist nicht in der Garage, und sein Handy ist ausgeschaltet. Die Kleine heißt Aprile, sie ist erst neun.«
»O mein Gott«, seufzte Aurora. »Glaubt ihr, dass Carlo Gualtieri seine Frau im Affekt umgebracht und dann die Tochter entführt hat?«
»Du weißt ebenso wie ich, dass in neunzig Prozent der Fälle der Morde an Frauen der Partner der Schuldige ist. Wir verbreiten sein Foto und das von Aprile. Du kannst dir vorstellen, wie erschütternd so ein Ereignis für eine Provinzstadt wie diese sein kann. Piovani und der ermittelnde Staatsanwalt sind dabei, die größte Verfolgungsjagd zu organisieren, die es in diesen Breiten je gegeben hat, auch wenn sie befürchten, dass die Chancen, sie lebend zu finden, äußerst gering sind.«
»Mord und Selbstmord«, sagte Aurora wenig überzeugt. Sie dachte einige Augenblicke nach. »Wer hat die Leiche gefunden?«, fragte sie dann.
»Heute Abend um zehn ging in der Zentrale ein Anruf ein. Ein Nachbar der Gualtieris war in den Garten rausgegangen, um den Hund zu beruhigen, der nicht aufhören wollte zu bellen. Kurz darauf hörte er Schreie aus dem Haus. Der Nebel und die Tatsache, dass die diensthabende Streife bereits wegen eines Vorfalls außerhalb der Stadt beschäftigt war, haben ein schnelles Eingreifen verhindert. Als die Polizei kam, stand die Eingangstür halb offen, und es bot sich der Anblick, den du eben selbst gesehen hast.«
Aurora unterdrückte ein Schaudern. Die Bilder waren noch deutlich in ihrem Kopf. Und es gab ein Detail am Tatort, das sie noch nicht richtig einordnen konnte, das ihr analytisches Gehirn aber registriert hatte.
»Es sieht nicht aus wie ein Fall von Mord und Selbstmord, viel eher wie ein Ritualmord«, dachte sie laut.
Bruno zündete sich eine Zigarette an, mit einem verchromten Feuerzeug mit einem kleinen eingravierten Löwenkopf. »Ein Ritual? Wie bei einem Serienmörder? Komm, Aurora, wir sind hier in der Po-Ebene. Hier gibt es so etwas nicht.«
»Die Nägel in der Hand und in den Augen, die Inschrift an der Wand … das sind klare Zeichen eines Geisteskranken.«
»Daran besteht kein Zweifel. Aber es gibt gute Gründe zu glauben, dass tatsächlich Carlo Gualtieri selbst diesen Satz an die Wand geschrieben hat.«
»Meinst du damit, dass Carlo Gualtieri psychisch krank war?«
»Das habe ich nicht gesagt«, antwortete Bruno nur und stieß eine Rauchwolke aus. »Und überhaupt kenne ich ihn nicht gut.«
»Und was wären dann seine Motive?«
»Das ist eine alte Geschichte«, beendete Bruno die Unterhaltung.
Aurora begann nervös an dem Anhänger zu spielen, den sie um den Hals trug. Sie merkte, dass es keinen Sinn hatte, weiter zu insistieren. Brunos Miene hatte sich plötzlich verfinstert, und es war offensichtlich, dass er keine Absicht hatte, das Gespräch fortzusetzen.
Als sie beim Auto angelangt waren, fragte Bruno: »Also, wo soll ich dich hinbringen?«, und streckte die Hand nach dem Autoschlüssel aus.
»Ich kann selbst fahren«, protestierte sie.
»Das bezweifle ich nicht«, antwortete Bruno. »Aber du bist bestimmt erschöpft von der Reise. Der Nebel hier ist tödlicher als … ein Serienmörder.«
Aurora ignorierte die Stichelei. »Meinetwegen«, lenkte sie schließlich ein und reichte Bruno die Schlüssel.
Die beiden schwiegen die ganze Fahrt über. Als sie das Ortsschild »Sparvara« passierten, fiel ihnen der graue Pick-up nicht auf, der mit ausgeschalteten Scheinwerfern am Straßenrand stand, und ebenso wenig der Mann im Inneren des Wagens, der im Schutz der Dunkelheit die vorbeifahrenden Autos beobachtete.
Bruno parkte vor dem B&B, das Aurora ihm genannt hatte. Es hieß »La Piccola Fattoria«, »Die kleine Farm«, ein ungewöhnlicher Name für eine Unterkunft mitten im Stadtzentrum.
Dass das Gebäude absolut nichts mit einer Farm gemein hatte, war offensichtlich. Es handelte sich um ein altes Jugendstilhaus mit einem Türmchen, dessen Fensterbögen mit Monden und Sternen geschmückt waren. Das Haus befand sich in der Allee, die an den Bahngleisen entlangführte, beleuchtet von Laternen, die ein gespenstisches orangefarbenes Licht auf die Bäume warfen. Die Stille, die über allem lag, erinnerte an eine Geisterstadt.
Die beiden verabschiedeten sich kühl mit einem Kopfnicken.
Während sie auf den Eingang zuschritt, kehrten Auroras Gedanken zu dem zurück, was sie im Inneren des Hauses gesehen hatte. Sie war sicher, dass der Mörder die Szene mit methodischer Genauigkeit arrangiert hatte, doch überwältigt von Entsetzen war es ihr nicht gelungen zu erkennen, welches Detail darin eine Disharmonie verursachte. Sie war immer überzeugter, dass sich hinter dem Offensichtlichen eine andere Wahrheit verbarg, und während sie versuchte, diesen Gedanken beiseitezuschieben, kam ihr der Satz des Polizeidirektors in den Sinn, den er vor ihrer Abfahrt zu ihr gesagt hatte: »Da unten passiert nie was, genau das Richtige für dich zur Erholung.«
7
Aprile hatte sich gegen die kalte Metallwand gekauert. Seit sie aufgewacht war, zitterte sie am ganzen Körper und klapperte mit den Zähnen. Sie hatte gedacht, sie würde niemals mit dem Weinen aufhören, doch dann war der Tränenstrom getrocknet, und jetzt taten ihr die Augen weh, als hätte sie damit zu lange in die Sonne geschaut.
»Mama«, murmelte sie, wohl wissend, dass sie keine Antwort bekommen würde. Während des Gewaltakts hatte sie sich unter ihrem Bett versteckt und die Schreie gehört.
Schreie, die noch immer in ihrem Kopf widerhallten, auch wenn die darauffolgende Stille noch schlimmer gewesen war.
Aprile zwang sich zu dem Glauben, dass ihre Mama nicht tot war, nur verletzt, dass die Rettungswagen mit Blaulicht herbeieilen und ein netter Arzt rechtzeitig kommen würde, um ihr das Leben zu retten. Einer wie der, der ihr gut zugeredet hatte, als sie wegen einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus war. Aprile erinnerte sich, dass ihr Großvater Corrado ihr am Tag der Operation ein Geschenk versprochen, ihr aber auch gesagt hatte, dass sie es erst bekommen könne, wenn sie wieder gesund sei.
Vor lauter Neugier hatte Aprile alles darangesetzt, in Rekordzeit zu genesen, sie hatte sogar brav ihren Reis, das Kompott und den Bananenbrei gegessen, die es im Krankenhaus gab. Und so hatte der Großvater sie nur eine knappe Woche später auf den Kleintiermarkt mitgenommen, und sie hatte sich staunend zwischen Gänsen und Hühnern der verschiedensten Sorten, Präriehunden, Frettchen und Papageien wiedergefunden und sich dann auf den ersten Blick in einen Wurf Kaninchen in einer Pappschachtel verliebt.
Sie hatte sich Pepe ausgesucht, den Kleinsten und Ängstlichsten, der abseits saß, während die anderen ständig durcheinanderhüpften.
Pepe war wie die kleinen Feldhasen, die sie auf den Feldern nach der Mahd gesehen hatte. Er hatte graues Fell und blaue Augen, dazu einen schwarzen Fleck auf der Nase, der an ein Pfefferkorn erinnerte.
Und schnell wie ein Feldhase war Pepe dann eines Nachmittags beim Spielen im Hof entwischt. Aprile hatte sehr gelitten und geglaubt, sein Verschwinden sei ihre Schuld, weil sie ihn vielleicht nicht genug geliebt hatte.
Die Sommernachmittage waren manchmal so lang, dass die Zeit überhaupt nicht zu vergehen schien. Papa war häufig unterwegs wegen seiner Arbeit, und Mama war immer zu beschäftigt, um sich mit ihr zu befassen. Unendlich viele Nachmittage hatte sie damit verbracht, Großvaters Geschichten zu lauschen. Einmal hatte er ihr von der Zeit erzählt, als er Zuckerrüben sammelte und zu der alten Zuckerfabrik brachte, ein Gebäude, das jetzt nur noch ein Gerippe aus Zement und zerbrochenen Fensterscheiben war, doch seinerzeit Hunderten von Menschen Arbeit gab.
Aprile konnte nicht glauben, dass der Zucker etwas war, was in der Erde wuchs. So hatte der Großvater sie am ersten warmen Sommertag bei einem Fahrradausflug eine Zuckerrübe kosten lassen. Sie hatten die Fahrräder am Straßenrand zurückgelassen und waren über den Graben geklettert, der das Feld begrenzte. Aprile war wie verzaubert gewesen von der hochgewachsenen Gestalt ihres Großvaters, eine Silhouette gegen den hellen Himmel, wie er eine Zuckerrübe für sie zerschnitt und ihr eine Scheibe zum Kosten reichte.
Sie hatte mit angewidertem Gesicht abgelehnt. Doch nachdem der Großvater nicht lockerließ, hatte sie schließlich doch probiert, und es war wie eine Offenbarung; sie fühlte sich zurückversetzt in die Zeit, als ihre Eltern sie nach der Sonntagsmesse mit ins Café nahmen und sie der Mama ihre Zuckertüte stibitzte, um sie sich direkt in ihren Mund zu schütten. Von diesem Tag an würde der Beginn des Sommers für sie immer den Geruch sonnengewärmter Haut und den süßen Geschmack der Zuckerrübe haben.
Wie sehr ihr der Großvater fehlte. Er war schon vor längerer Zeit gestorben, aber ihr gefiel der Gedanke, dass er von oben weiter über sie wachte. Sie hoffte, dass er auch jetzt bei ihr war, denn jetzt brauchte sie ihn wirklich.
Aprile fragte sich immer wieder, warum der Mann ausgerechnet sie ausgesucht hatte, ausgerechnet in ihr Haus eingedrungen war wie der böse Wolf, als der er maskiert war. Vielleicht hatte er sie so ausgewählt wie sie damals ihr kleines Kaninchen, denn genau so fühlte sie sich in diesem Augenblick: wie ein verschrecktes Tierkind.
Sie hörte seine Schritte. Der Mann mit der Wolfsmaske kam zurück.
Was hätte ihr Großvater ihr in diesem Augenblick geraten?
Wegzulaufen, dachte Aprile.
Sie musste nur ruhig bleiben und den richtigen Moment abwarten, um zu fliehen. Sie schloss die Augen und tat, als schliefe sie. Im geeigneten Augenblick würde sie aufspringen und losrennen.
Wie Pepe würde sie so schnell rennen wie nie zuvor, genau wie die Hasen im Sommer über die Stoppelfelder flitzen.
8
Vier Tage vor dem Wiedererwachen
Aurora klopfte mehrmals, ohne eine Antwort zu bekommen. Auf dem Namensschild an der Tür stand »Commissario Capo Piovani Gianfranco«.
»Er ist nicht da«, sagte eine Stimme hinter ihr.
»Bruno«, murmelte Aurora und drehte sich um.
Er wich ihr aus und betrat das Büro des Kommissars. Der Nebel draußen hatte sich aufgelöst, und blasses Licht drang durch die Fensterläden. Bruno legte eine Akte auf den Schreibtisch und wollte wieder gehen, doch Aurora stellte sich ihm in den Weg.
»Piovani kommt bald zurück«, sagte er. »Er ist im Morgengrauen nach Hause gefahren, um sich ein paar Stunden auszuruhen.«
Aurora bemerkte, dass Bruno matt aussah und tiefe Augenringe hatte. »Und du, wann machst du Feierabend?«
Bruno hob leicht eine Schulter. »Heute Abend. Vielleicht.«
Aurora schlug die Akte auf, ohne sich um den missbilligenden Blick zu kümmern, den Bruno ihr zuwarf. Darin lagen einige Computerausdrucke und Fotografien auf Hochglanzpapier.
Aurora blätterte schnell die Bilder vom Leichnam Rossella Gualtieris durch. Die Nägel in den Augen und in der Hand, die Wunde am Rücken, die blutige Inschrift an der Wand.
»Du wirst keinen Schaden tun«, murmelte sie vor sich hin. »Das ist paradox an einem Mordschauplatz, aber es klingt fast wie eine … Drohung.«
Bruno sah sie wortlos an.
Auroras Blick blieb an einem Foto hängen, das die kleine Aprile zeigte. Es schien an einem Sommernachmittag aufgenommen. Das Kind hatte lange blonde Haare und einen dicken Pony, der ihre großen blauen Augen zum Teil verdeckte. Die Nase war voller Sommersprossen und die Lippen zu einem Lächeln geöffnet. Im Hintergrund ein endloses Sonnenblumenfeld unter einem leuchtend blauen Himmel, an dem kleine weiße Wölkchen standen.
»Aprile«, seufzte sie, »die in einer Novembernacht verschwand.«
»Eine ziemlich poetische Beschreibung dieses Verbrechens.« Bruno legte seine Hand auf die Auroras, um sie dazu zu bewegen, die Akte zuzuklappen.
Aurora zuckte vor der Berührung zurück. »Mein Vater pflegte zu sagen, die Melodramatik liegt mir im Blut.« Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Meine Mutter war Theaterschauspielerin.«
»Ein Richter und eine Schauspielerin? Ungewöhnliche Kombination.«
Aurora straffte die Schultern. »In meiner Familie war nichts gewöhnlich.« Ihr Blick bekam einen melancholischen Schimmer. Sie räusperte sich. Dann sagte sie: »Gibt es was Neues?«
»Leider nein«, antwortete Bruno. »Ist dir aufgefallen, dass das Kommissariat so gut wie ausgestorben ist? Sie sind alle auf der Suche nach Gualtieri und seiner Tochter, sogar die Verwaltungsbeamten. Die Telefone klingeln andauernd, und es gibt nicht genug Personal, um alle Anrufe entgegenzunehmen.«
»Irgendwelche Hinweise?«
»Bisher nichts Konkretes. Es rufen hauptsächlich Neugierige und Journalisten an.«
»Und du? Spielst den Wachhund vor Piovanis Büro?«
»Gewissermaßen.«
»Müsste ein braver Spürhund nicht draußen auf dem Feld sein und nach Fährten schnüffeln?«
»Kann sein«, murmelte Bruno mit einem schiefen Lächeln. »Vor allem brauche ich jetzt einen Kaffee. Hast du schon gefrühstückt?«
»Nein, ich bin gleich nach dem Aufstehen hergekommen.«
»Du hast wohl in deinen Anziehsachen geschlafen?«
»Ich bin nicht die Einzige, die die Kleidung von gestern trägt.«
»Wenigstens hast du ein bisschen geschlafen.«
Aurora kniff die Lippen zusammen. »Die Besitzerin des Bed and Breakfast hat eine halbe Stunde gebraucht, bis sie mir endlich aufgemacht hat. Sie ist eine sehr freundliche alte Dame, aber sie hatte geschlafen, und bevor sie öffnete, wollte sie sich etwas zurechtmachen.«
Bruno hob eine Augenbraue. »Eine altmodische Dame.«
»Sie kam schließlich tadellos frisiert und geschminkt heraus. Ich war so erschöpft, dass ich auf dem Sofa am Eingang eingeschlafen bin, während sie meinen Zimmerschlüssel holte. Falls sie mich rauswirft, muss ich schnell eine andere Bleibe finden, fürchte ich.«
»Ich würde dir ja mein Sofa anbieten, aber da schlafe ich selbst.«
»Es existiert eine Erfindung namens Bett. Du solltest das mal ausprobieren.«
Bruno straffte die Schultern. »Ich mache häufig Sonderschichten, und Elena, meine Lebensgefährtin, schläft seit einer Weile mit ihrer Tochter in unserem Schlafzimmer.«
»Sie ist wohl nicht sehr einverstanden mit deinen Arbeitszeiten.«
Bruno sah sie ungeduldig an. »Los, gehen wir, Piovani wird jeden Augenblick hier sein.«
Aurora verzog das Gesicht. »Ich würde lieber hierbleiben und mich an die Arbeit machen.«
»Woran? Das ist nicht dein Fall.«
»Ich weiß«, sagte Aurora, »aber seit gestern Nacht grüble ich über ein Detail am Tatort nach, das ich nicht richtig zu fassen kriege. Ich bin sicher, dass es wichtig ist. Vielleicht kann die Akte meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen.«
»Du willst ausgerechnet mit einem Bericht anfangen, der für den Commissario bestimmt ist? Hast du eine Vorstellung, wie Piovani darauf reagieren wird? Wenn du wirklich an den Ermittlungen beteiligt werden willst, ist es keine gute Idee, ihn gleich zu verärgern.«
»Was zum Teufel tut ihr beiden hier in meinem Büro?«, donnerte Piovanis Stimme in ihrem Rücken. Die Worte hallten in dem kleinen Zimmer nach wie eine Explosion. Bruno und Aurora fuhren gleichzeitig herum. Der Commissario stand mit finsterer Miene auf der Schwelle.
»Da haben wir’s«, seufzte Bruno.
»Ich habe … Sie gesucht«, stammelte Aurora.
»Raus hier«, gebot Piovani.
Bruno und Aurora marschierten zum Ausgang.
»Sie nicht, Scalviati«, präzisierte Piovani, »wir müssen uns unterhalten.«
Aurora blieb reglos in der Mitte des Raumes stehen, den Blick auf die Fußspitzen gerichtet. Bruno warf ihr einen Blick zu, bevor er die Schwelle überschritt. Er bemerkte, dass sie nervös mit dem Silberring spielte, den sie am Daumen trug.
»Setzen Sie sich«, sagte Piovani.
Der Commissario nahm seinen Platz am Schreibtisch ein, und Aurora setzte sich ihm gegenüber.
Piovani begann, mit den Fingerspitzen auf die Tischplatte zu trommeln, und betrachtete sie schweigend. Dann warf er einen Blick auf die Gualtieri-Akte. »Ich sehe, dass Sie in meinen Dokumenten geschnüffelt haben.«
»Ich wollte nicht …«
Piovani hob die Hand, um sie zu unterbrechen. Er öffnete eine Schublade und zog eine kleine blaue Mappe heraus.
»Wissen Sie, was das ist?«
Aurora schüttelte den Kopf.
»Das ist das psychiatrische Gutachten über Ihre Verfassung anlässlich Ihrer Rückkehr in den Dienst.«
»Verstehe«, nuschelte Aurora.
Piovani musterte sie schweigend.
»Das ist die übliche Prozedur«, erklärte sie. »Jeder, der im Dienst besonderen emotionalen Belastungen ausgesetzt ist, muss sich einer Therapie unterziehen. Sie haben doch sicher gelesen, dass man mich für diensttauglich befunden hat.«
Piovani lächelte sarkastisch. »O ja. Ihre Bewertung ist positiv.«
»Na sehen Sie … Wenn das nicht so wäre, wäre ich wohl nicht wieder eingesetzt worden.«
Piovani lehnte sich gegen die Stuhllehne, die leise knarzend nachgab. »Sie glauben, Sie wären über alle Regeln erhaben, nicht wahr, Scalviati?«
Aurora versuchte, tief Luft zu holen, doch ihre Lunge schien nicht in der Lage, die Luft aufzunehmen. Sie spürte einen Druck auf Höhe des Zwerchfells und zwang sich zu schlucken. Sie musste ruhig bleiben. Das Letzte, was sie jetzt brauchen konnte, war eine Panikattacke vor den Augen ihres Vorgesetzten. »Wenn es darum geht, Vorschriften zu befolgen, bin ich für gewöhnlich sehr gewissenhaft«, brachte sie heraus.
»Genau das ist der Punkt. Wann, denken Sie, ist es denn in unserem Beruf nötig, die Vorschriften zu befolgen?«, fragte Piovani. »Nehmen wir einmal den Silvestereinsatz im ehemaligen Schlachthaus. Können Sie zweifelsfrei behaupten, dass in dem Fall alle Dienstvorschriften befolgt worden sind?«
Aurora spürte, wie der Schweiß an ihren Schläfen zunahm. Es war, als wäre die Temperatur im Zimmer plötzlich sprunghaft angestiegen, doch ihre Hände waren eiskalt. Sie senkte die Augen.
»Ich habe getan … was ich für richtig hielt.«
»Auf diesen Vorfall folgte ein Disziplinarverfahren gegen Sie. Und soweit ich den Protokollen des Staatsanwalts entnehmen konnte, bin ich nicht der Einzige, der Zweifel an Ihrem Vorgehen an jenem Tag hegt. Sie wurden gerichtlich belangt wegen grober Fahrlässigkeit im Dienst. Eine Fahrlässigkeit, die den Polizeihauptmeister Flavio Anversa das Leben gekostet hat.«
Als sie Flavios Namen hörte, klopfte Auroras Herz schneller. Wie dumm hatte sie sich gefühlt, jedes Mal, wenn sie seinen Namen in ihrem Handy-Verzeichnis suchte und nur knapp der Versuchung widerstehen konnte, die Nummer zu wählen, als wäre nichts geschehen. Denn Flavio würde ihre Anrufe nicht entgegennehmen können, nie mehr. Flavio war tot.
»Ich wurde freigesprochen«, sagte sie mit erstickter Stimme.
»Die Disziplinarkommission hat Sie freigesprochen, richtig. Aber was sagen Sie mir? Können Sie sich selbst freisprechen, Scalviati?«
Aurora antwortete nicht. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Ring zu, den sie am Finger trug.
»Ich bin ein ehrlicher Mensch, und ich sage gerne offen, was ich denke«, fuhr Piovani fort. »Und was Sie betrifft, habe ich das Gefühl, dass Sie von der Zuneigung und dem Respekt profitiert haben, den die Institutionen Ihrem Vater entgegenbrachten. Die Vorzugsbehandlung, die Ihnen im Rahmen dieser Untersuchung zuteilwurde, war vielleicht eine Art Wiedergutmachung für den Tod eines integeren Staatsdieners, den sein Staat nicht schützen konnte.«
Aurora ballte die Fäuste. Sie erinnerte sich gut daran, wie sie mit siebzehn Jahren bei der Beerdigung ihres Vaters aus der ersten Reihe der Kirchenbänke ihre Mutter beobachtet hatte, wie sie die Autoritäten anflehte, nicht zuzulassen, dass der Mörder ungestraft davonkam. Ermittlungsrichter Francesco Scalviati war von einem Auftragsmörder mit vier Pistolenschüssen in den Rücken getötet worden. Er leitete eine Untersuchung über die Aktivitäten der Camorra in Norditalien, und es hieß, er habe kurz vor einer wichtigen Festnahme gestanden. Doch nach seinem Tod versandeten die Ermittlungen. Und trotz der großen Worte, die die hohen Tiere bei der Beerdigung spuckten, war für seine Ermordung nie jemand angeklagt worden.
Deshalb hatte Aurora beschlossen, zur Polizei zu gehen. Um die Arbeit ihres Vaters fortzuführen, damit er stolz auf sie wäre, vielleicht um ihre Rechnung mit dem Schicksal zu begleichen.
Sie zwang sich, Piovanis Blick zu begegnen. »Lassen Sie meinen Vater da raus«, sagte sie mit zitternder Stimme.
»Kein Grund, nervös zu werden. Auch ich war ein großer Bewunderer der Arbeit Ihres Vaters. Doch ich kann nicht umhin mich zu fragen, wie das Verfahren wohl ausgegangen wäre, wenn Sie nicht seinen Nachnamen trügen.«
Aurora zögerte einen Augenblick. »Was hat das mit meinem psychiatrischen Gutachten zu tun?«
»Richtig. Kommen wir zum Kern unseres Gespräches zurück. Wegen der Verletzungen, die Sie während der Razzia im Schlachthaus erlitten, mussten Sie sich mehreren chirurgischen Eingriffen am Kopf unterziehen. Soviel ich gelesen habe, war es nicht möglich, den Splitter eines Projektils aus dem Schädel zu entfernen. Danach wurden Persönlichkeitsstörungen bei Ihnen diagnostiziert. Ich lese auch, dass Ihre Ablehnung, die geeigneten Therapien wahrzunehmen, den Zeitraum Ihrer Beurlaubung weit über das erwartete Maß hinaus verlängert hat.«
Das Projektil in ihrem Kopf war für Aurora wie eine unangenehme Erinnerung, die sie niemals ablegen konnte. Es erinnerte durch plötzliche, stechende Migräneanfälle an seine Anwesenheit, und es machte ihr Nervensystem anfällig. Nach dem, was in der Silvesternacht vor beinahe zwei Jahren geschehen war, hatten viele mit ihrem Abschied von der Polizei gerechnet. Sie selbst hatte daran gezweifelt, ob sie den Dienst je wieder würde antreten können. Und doch hatte sie es schließlich geschafft. Mit Verbissenheit und Kampfgeist hatte Aurora überlebt. Und jetzt hatte sie die Chance, neu anzufangen. Auch wenn sie sich tief im Inneren fühlte wie beschädigte Ware, wie ein Überbleibsel einer strahlenden Existenz, die wie ein Komet davongeflogen war.
»Ganz so war es nicht«, wandte sie ein.
»Wie auch immer, es ist nicht schwer, an diese Akten zu kommen. Es genügen ein paar Telefonate und der Zugang zu einem E-Mail-Account. Und was können Sie mir über Ihre erbliche Disposition sagen? Es ist ja allgemein bekannt, dass solche Störungen häufig in der Familie liegen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ihre Krankenhausakte öffentlich wird.«
»Die Krankheit meiner Mutter hatte nichts mit dem zu tun, was mir geschehen ist.«
»Darüber erlaube ich mir kein Urteil, ich bin schließlich kein Arzt«, sagte Piovani. »Aber Ihre Ankunft hier fällt zusammen mit einem unheilvollen Verbrechen, das eine Menge Staub aufgewirbelt hat, und ich möchte vermeiden, dass Ihre Anwesenheit … Grund für Peinlichkeiten bietet.«
»Peinlichkeiten für wen?«
»Für dieselben Institutionen, die Sie vor den Anschuldigungen wegen Fahrlässigkeit beschützt haben. Für das Kommissariat. Für die Staatsanwaltschaft. Der Fall Gualtieri hat die Presse bereits in helle Aufregung versetzt, und wenn Sie Teil der Untersuchungen sind, drohen Sie im medialen Fleischwolf zu enden.«
»Ich … möchte nur gerne meinen Beitrag leisten, dass das Mädchen gerettet wird.«
»Wir wissen beide, dass wir für die arme Aprile nichts mehr tun können«, sagte Piovani ruhig. »In diesem Augenblick haben die Froschmänner ihre Suchaktion im Cavo Napoleonico aufgenommen, wo wir die Leichen des Vaters und des Mädchens zu finden hoffen.«
»Im Cavo Napoleonico?«