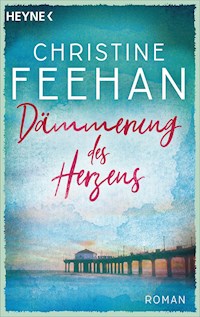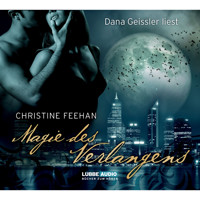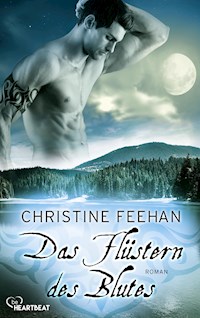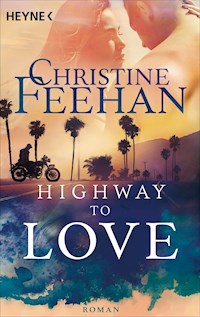9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Karpatianer
- Sprache: Deutsch
Auch wenn alles verloren scheint, gibt es noch immer eine Hoffnung: die Liebe!
Drachensucher Dominic und Jaguarfrau Sangria sind Krieger, die ihr Leben in Einsamkeit verbracht haben. Nun sehen sie nur noch einen Ausweg: den Tod. Doch vorher wollen sie sich ihrer größten Herausforderung stellen und sich in das Lager ihrer Feinde einschleichen. Dort sollen sie wichtige Informationen stehlen - eine Mission, die ihnen wahrscheinlich den Tod bringen wird.
Womit jedoch keiner der beiden gerechnet hat: Kurz bevor sie sich in diese Gefahr begeben, entdecken sie ihre leidenschaftliche Liebe zueinander. Nun gehen sie mit einer Hoffnung in den Kampf, die sie nicht ignorieren können. Der Hoffnung zu überleben und den Geliebten nach dem letzten Gefecht wieder in die Arme schließen zu dürfen ...
Dunkel, gefährlich und extrem heiß - Das dunkle Feuer der Nacht ist der 21. Band der umfangreichen NEW YORK TIMES und SPIEGEL-Bestsellerserie Die Karpatianer.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Danksagungen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Auch wenn alles verloren scheint, gibt es noch immer eine Hoffnung: die Liebe!
Drachensucher Dominic und Jaguarfrau Sangria sind Krieger, die ihr Leben in Einsamkeit verbracht haben. Nun sehen sie nur noch einen Ausweg: den Tod. Doch vorher wollen sie sich ihrer größten Herausforderung stellen und sich in das Lager ihrer Feinde einschleichen. Dort sollen sie wichtige Informationen stehlen – eine Mission, die ihnen wahrscheinlich den Tod bringen wird.Womit jedoch keiner der beiden gerechnet hat: Kurz bevor sie sich in diese Gefahr begeben, entdecken sie ihre leidenschaftliche Liebe zueinander. Nun gehen sie mit einer Hoffnung in den Kampf, die sie nicht ignorieren können. Der Hoffnung zu überleben und den Geliebten nach dem letzten Gefecht wieder in die Arme schließen zu dürfen …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
CHRISTINE FEEHAN
Das dunkle Feuerder Nacht
Aus dem amerikanischen Englischvon Ulrike Moreno
Für Alexa Bridgesmit viel Liebe
Danksagungen
Ich hätte dieses Buch nie schreiben können ohne die Hilfe von zwei wundervollen Männern. Dr. Christopher Tong ist immer wieder ganz erstaunlich mit seiner kontinuierlichen Unterstützung. Sein Lied ist wunderschön und genau das richtige für Dominic und Solange. Wie jedes Mal danke ich Ihnen für die Hilfe mit der Sprache; dem Himmel sei Dank, dass Sie stets einen Weg finden, alles so gut zu richten.
Brian Feehan hat sich wie immer sehr eingesetzt, als ich ihn brauchte, und bis in die Nacht hinein mit mir gearbeitet, um unsere Zerstörung der Hochburg der Vampire auszuarbeiten.
Meinen herzlichsten Dank an Cheryl White und Kathie Firzlaff, die mir buchstäblich im letzten Moment noch ein unschätzbares Feedback gaben und ohne die ich das Buch nicht hätte fertigstellen können.
Und Domini – was soll ich sagen? Du machst Überstunden und arbeitest bis weit ins Wochenende, damit das Buch so gut wie nur möglich wird. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen!
1. Kapitel
Ich war tausend Jahre lang nur halb am Lebenund hatte die Hoffnung aufgegeben,dass wir uns in dieser Zeit begegnen würden.Zu viele waren die Jahrhunderte.Alles verschwindet, wenn Zeit und Dunkelheitdie Farbe und die Verse stehlen.
Dominic an Solange
Karpatianische Männer ohne eine Seelengefährtin träumen nicht. Sie sehen keine Farben und verspüren keine Emotionen. Schmerz, den ja, aber keine Emotionen. Warum hatte er also in den letzten drei Jahren immer wieder nach einem Traum gesucht? Er war ein alter, erfahrener Krieger und hatte keine Zeit für Fantasien oder Illusionen. Seine Welt war kalt und öde; das war eine notwendige Voraussetzung, um einen Feind zu bekämpfen, der zwangsläufig einmal ein Freund oder ein Familienmitglied gewesen war.
In den ersten hundert Jahren nach dem Verlust seiner Emotionen hatte Dominic nicht aufgehört zu hoffen. Als die Jahrhunderte jedoch vergingen, war die Hoffnung verblasst, seine Seelengefährtin zu finden. Er hatte sich damit abgefunden, dass er ihr im nächsten Leben begegnen würde, und hielt sich an den Vorsatz, seine letzte Pflicht seinem Volk gegenüber zu erfüllen. Doch da lag er – einer der Ältesten von großer Erfahrung, Dominic aus der Linie der Drachensucher, eines Geschlechts so alt wie die Zeit selbst, ein Mann von Weisheit und ein berühmter und gefürchteter Krieger – in der heilenden schwarzen Erde und träumte vor sich hin.
Träume hätten sich gegenstandslos anfühlen müssen – und zu Anfang war der seine es auch gewesen. Dominic sah eine Frau, hatte aber nur eine vage Vorstellung ihrer Erscheinung. Sie war sehr jung im Vergleich zu ihm, doch bereits eine Kriegerin. Sie hatte nicht seiner Vorstellung von der Frau entsprochen, die eine Beziehung zu ihm eingehen würde, aber als er sie mit den Jahren besser kennenlernte, erkannte er, wie gut sie zu ihm passte.
Dominic hatte viel zu lange gekämpft, um sein Schwert je ablegen zu können; er kannte keine andere Lebensweise. Pflichtbewusstsein und Opferbereitschaft waren ihm schon in die Wiege gelegt worden, und er brauchte eine Frau, die ihn in diesem Punkt verstand.
Vielleicht war es das, was Träume ausmachten. Bis vor ein paar Jahren hatte Dominic nie geträumt. Niemals. Weil Träume Emotionen waren, die er schon vor langer Zeit verloren hatte. Und sie waren Farben, wenn auch nicht die seinen. Aber sie begannen, sich wie Farben anzufühlen, als die Jahre die Frau formten. Sie war ein Rätsel; wenn sie kämpfte, strahlte sie pures Selbstvertrauen aus. Oft hatte sie frische Prellungen und Verwundungen, die Narben auf ihrer zarten Haut zurückließen. Dominic hatte sich angewöhnt, sie jedes Mal, wenn sie sich im Traum begegneten, zu untersuchen – sie zu heilen, war zu einer Art Begrüßungsritual bei ihnen geworden. Er ertappte sich dabei, dass er lächelte bei dem Gedanken, welch genaues Gegenteil von selbstbewusst sie war, wenn es darum ging, sich selbst als Frau zu sehen.
Für eine Weile überlegte er, wieso er eigentlich lächelte. Lächeln war gleichzusetzen mit Glück, und ihm fehlte die Fähigkeit, dergleichen zu empfinden. Aber statt noch mehr zu verblassen, wie er eigentlich erwartet hatte, verschärften sich seine Erinnerungen an Gefühle, jetzt, da er auf das Ende seines Lebens zuging. Denn wann immer er den Traum heraufbeschwor, verspürte er ein Gefühl des Trostes, der Behaglichkeit und des Glücks.
Mit den Jahren war sie durchschaubarer für ihn geworden. Sie gehörte zu den Jaguarmenschen, war eine tapfere Kämpferin und hatte genau die gleichen Wertvorstellungen wie er, was Loyalität, Familie und Verantwortung anging. Nie würde er die Nacht vor etwa einer Woche vergessen, in der er ihre Augen in Farbe gesehen hatte. Einen Moment hatte er nicht atmen können, sondern sie nur staunend angesehen, verblüfft darüber, dass er sich noch lebhaft genug an Farben erinnern konnte, um ihren Katzenaugen einen ganz konkreten Farbton zuzuschreiben.
Ihre schönen Augen waren von einem leuchtenden Grün, mit goldenen und bernsteinfarbenen Sprenkeln. Sie verdunkelten sich, wenn er es schaffte, ihr ein Lachen abzuringen. Die Frau lachte nicht leicht oder oft, und wenn es ihm gelang, sie dazu zu bringen, erschien es Dominic wie ein größerer Sieg als alle Kämpfe, die er in seinem langen Leben gewonnen hatte.
Die Träume, die sich nur dann einstellten, wenn er wach war, waren immer ein bisschen unscharf, doch er freute sich darauf, die Frau zu sehen. Er fühlte sich so fürsorglich ihr gegenüber, als gehörte der Frau aus seinen Träumen bereits seine ganze Loyalität. Er schrieb ihr Liebeslieder, in denen er ihr alles sagte, was er seiner Seelengefährtin erzählen wollte. Und wenn sie nicht schlafen wollte, bettete er ihren Kopf auf seinen Schoß, streichelte ihr dichtes Haar und sang ihr in seiner Sprache etwas vor. Nie hatte er sich zufriedener – oder vollständiger – gefühlt.
Dominic bewegte sich und brachte die fruchtbare Erde um ihn durcheinander. Und wann immer er sich regte, überfiel ihn der Schmerz wie Tausende von Messern, die ihn von innen heraus zerfetzten. Das verdorbene Vampirblut, das er ganz bewusst zu sich genommen hatte, war voller Parasiten gewesen, und die bewegten sich nun in ihm, vermehrten sich und versuchten, die Herrschaft über seinen Körper zu übernehmen und jede Zelle und jedes Organ zu überschwemmen. Und wenn er einige beseitigte, um ihre Anzahl niedrig zu halten, schienen sie nur noch fleißiger bemüht zu sein, sich zu vermehren.
Er stieß zischend den Atem aus und biss die Zähne zusammen, als er sich zwang, die schützende Erde zu verlassen. Es war noch nicht ganz dunkel, und er war ein uralter Karpatianer, der auf viele Kämpfe und Tötungen zurückblickte. In der Regel erhoben sich die Alten nicht, bevor die Sonne unterging, aber er brauchte die zusätzliche Zeit, um seinen Feind aufzuspüren und sich in diesem Land der wandelnden Mythen und Legenden zurechtzufinden.
Tief im Inneren der Höhle, die er sich im Amazonasurwald gesucht hatte, bewegte er sanft das Erdreich und strich es glatt, weil er den Bereich so unverändert wie möglich hinterlassen wollte. Er bewegte sich nur bei Nacht, wie es für seine Spezies typisch war, und lauschte dem Gewisper des Bösen, das ihn auf die Spur eines der fünf Meistervampire gebracht hatte, der mit Sicherheit Kenntnis von den Plänen hatte, die karpatianische Rasse ein für alle Mal auszulöschen. Dominics Leute wussten, dass die Vampire sich unter der Herrschaft der Fünf vereinigten. Anfangs waren die Gruppen der Feinde so klein und verstreut gewesen, dass ihre Angriffe leicht abzuwehren gewesen waren. In letzter Zeit jedoch war das Verschwörungsgeflüster zu einem Brüllen angeschwollen, und die Gruppen waren größer, besser organisiert und weiter verbreitet als ursprünglich gedacht. Dominic war sicher, dass die Parasiten in dem verdorbenen Blut der Schlüssel waren, um die Vampire zu identifizieren, die ein Bündnis mit den fünf Meistern eingegangen waren.
Das zumindest hatte er während seiner tagelangen Reisen schon herausgefunden. Er hatte die Theorie mehrfach überprüft, als er drei Vampiren begegnet war. Zwei waren relativ jung, trugen beide nicht die Parasiten in sich und waren für einen erfahrenen Jäger leicht zu töten gewesen. Der dritte jedoch hatte seine Fragen zur Genüge beantwortet. Sowie Dominic in unmittelbare Nähe des Vampirs gekommen war, waren die Parasiten in einen Rausch des Erkennens verfallen. Dominic hatte den größten Teil der Nacht den Prahlereien des Vampirs gelauscht, der ihn für seinesgleichen gehalten und ihm von ihren wachsenden Scharen und den Abgesandten erzählt hatte, die sich am Amazonas trafen. Dort hatten sie Verbündete in den Jaguarmenschen und einer menschlichen Gesellschaft, die nicht ahnten, dass sie sich ausgerechnet mit jenen einließen, die sie zu vernichten suchten. Die Meister benutzten sowohl Menschen als auch Jaguarmänner, um Karpatianer zu jagen und zu töten. Dominic hatte den Vampir umgebracht, indem er ihm das Herz herausgerissen hatte, und dann den Blitz herabgerufen, um die abscheuliche Kreatur zu verbrennen. Bevor er das Gebiet verlassen hatte, hatte Dominic sorgfältig darauf geachtet, jede Spur seiner Anwesenheit zu beseitigen.
Er wusste, dass die Zeit knapp wurde. Die Parasiten waren eifrig am Werk, raunten, wisperten und murmelten dunkle Lockungen in ihrem unerbittlichen Streben, ihn dazu zu bringen, sich den Meistern anzuschließen. Er war ein uralter Karpatianer ohne Gefährtin, und die Dunkelheit war ohnehin schon stark in ihm. Seine geliebte Schwester war vor Hunderten von Jahren verschwunden – heute wusste er, dass sie tot war und ihre Kinder wohlbehütet bei den Karpatianern aufwuchsen. Er konnte diese eine letzte Aufgabe noch erfüllen und dann in Ehren seine öde Existenz beenden.
Verjüngt, soweit dies überhaupt noch möglich war für jemanden mit Parasiten im Blut, erhob er sich aus dem fruchtbaren Erdreich. Die Dunkelheit der Höhle tief unter der Erde verhinderte, dass die Sonne seine Haut berührte, aber er spürte sie trotzdem und wusste, dass sie gleich dort draußen vor dem Eingang war und nur darauf wartete, ihn zu versengen. Seine Haut prickelte und brannte bereits in Erwartung dessen. Mit absoluter Sicherheit und dem natürlichen Selbstbewusstsein eines Kriegers durchquerte Dominic die Höhle und schwebte im Dunkeln über den unebenen Grund hinweg.
Als er den Aufstieg zur Erdoberfläche begann, dachte er an sie – an seine Seelengefährtin, die Frau in seinen Träumen. Sie war natürlich nicht seine wahre Seelengefährtin, denn wäre sie es, würde er überall und nicht nur in ihren Augen Farben sehen. Er würde die verschiedenen Schattierungen des Grüns im Dschungel erkennen, aber alles um ihn herum blieb grau. War die Hoffnung, bei ihr Trost zu finden, also wieder nur eine Illusion? Eine Selbsttäuschung, wie ihr von der Liebe zu seiner Seelengefährtin vorzusingen? Dominic sehnte sich nach ihr und musste sie ab und zu heraufbeschwören, um die Nacht zu überstehen, wenn sein Blut raste und er von innen heraus bei lebendigem Leibe aufgefressen wurde. Er dachte an ihre weiche Haut, die zu berühren ein ganz erstaunliches Gefühl war für einen wie ihn, der selbst so hart wie Eiche und dessen Haut so zäh wie Leder war.
Als er sich dem Ausgang der Höhle näherte, konnte er Licht in den Tunnel fallen sehen und schrak zusammen, was eine völlig natürliche Reaktion war nach Jahrhunderten des Lebens in der Nacht. Er liebte die Nacht, egal, wo er war oder auf welchem Kontinent er sich befand. Der Mond war ein Freund, die Sterne oft Leitbilder, von denen er sich führen ließ. Er befand sich auf unbekanntem Terrain, doch er wusste, dass die Brüder de la Cruz den Regenwald überwachten, obwohl sie nur zu fünft waren, um ein sehr ausgedehntes Gebiet abzudecken, und sich dazu sehr weit verteilen mussten. Dominic hatte das Gefühl, dass die fünf Meistervampire, die ihre weniger mächtigen Artgenossen gegen die Karpatianer rekrutierten, ganz bewusst das Territorium der Familie de la Cruz als Hauptquartier gewählt hatten.
Die Brüder Malinov und de la Cruz waren miteinander aufgewachsen. Sie waren früher mehr als Freunde gewesen und behaupteten sogar, verwandt zu sein. Das karpatianische Volk hatte sie als zwei der mächtigsten Familien betrachtet. Dominic dachte über ihre Persönlichkeiten und die Kameradschaft nach, die dann irgendwann zur Rivalität geworden war. Es machte Sinn, dass die Brüder Malinov ihr Hauptquartier direkt unter den Augen derjenigen errichtet hatten, die einst mit ihnen im Bunde gewesen waren. In ihrer Jugend hatten sie gemeinsam – wenn auch nur theoretisch – nach Wegen gesucht, um die Dubrinskys als Regenten des karpatianischen Volkes abzusetzen. Am Ende hatten die Brüder de la Cruz dann aber doch dem Prinzen Loyalität geschworen. Daraufhin waren die Malinov-Brüder zu den erbittertsten und gnadenlosesten Feinden der Brüder de la Cruz geworden.
Dominics logische Schlussfolgerungen waren von dem Vampir bestätigt worden, den er in den Karpaten getötet hatte, einem sehr redseligen, geringeren Vampir, der sich mit seinem Wissen hatte brüsten wollen. Dominic war weitergezogen, ohne Gefangene zu nehmen, überrascht, welch fabelhaftes Warnsystem die Parasiten waren. Es wäre den Brüdern Malinov natürlich nie in den Sinn gekommen, dass ein Karpatianer es wagen würde, das verseuchte Blut zu sich zu nehmen und in ihr Lager einzudringen.
Als er sich jetzt dem Höhleneingang näherte, schlug ihm zuerst der Lärm entgegen, die Geräusche von Vögeln, Affen und, trotz des Regens, das unaufhörliche Summen der Insekten. Es war so heiß, dass die allgegenwärtige Feuchtigkeit regelrecht Dampf vom Boden vor der Höhle aufsteigen ließ. Über den Ufern des angeschwollenen Flusses hingen Bäume mit Wurzelgeflechten. Sie waren wie große knorrige Käfige, aus denen sich Ranken über den Boden schlängelten, die wie hölzerne Flossen aussahen.
Dominic war unempfindlich gegen Regen oder Hitze; er konnte seine Körpertemperatur so regulieren, dass er sich nicht unwohl fühlte. Aber die etwa dreißig Fuß vom Eingang seiner Höhle bis zu der verhältnismäßigen Sicherheit unter dem dichten Blätterdach würden die Hölle sein, und darauf freute er sich nicht. Sich in der Sonne aufzuhalten, selbst in anderer Form, war immer schmerzhaft, und er hatte schon genug zu kämpfen mit dem Gefühl, dass ihm die Eingeweide wie von Glasscherben zerrissen wurden.
Deshalb war es schwer, nicht nach dem Traum zu greifen. In ihrer Gesellschaft verblasste der Schmerz, und das Gewisper in seinem Kopf verstummte. Das unaufhörliche Gemurmel der Parasiten, die an seiner Akzeptanz der Meister und ihrer Pläne arbeiteten, war ermüdend. Der Traum war Dominic ein Trost, obwohl er wusste, dass seine Seelengefährtin, die er darin sah, nicht wirklich existierte.
Ihm war klar, dass er sich seine Gefährtin im Geiste langsam selbst gestaltet hatte – nicht ihr Aussehen, aber die Charaktereigenschaften, die ihm wichtig waren. Er brauchte eine Frau, die vor allen Dingen loyal war, die ihre Kinder umsorgen und beschützen und zu ihm stehen würde, egal, was kam. Eine Frau, die fest an seiner Seite stand und die in der Lage war, sich selbst und ihre Kinder zu beschützen.
Er brauchte eine Gefährtin, die sich ihm, wenn sie unter sich waren, fügen würde, die feminin und sensibel war – alles das, was sie nicht sein konnte in den Zeiten, in denen sie würden kämpfen müssen. Und diese Seite von ihr wollte Dominic ganz für sich allein. Das mochte egoistisch sein, aber er hatte noch nie etwas für sich selbst gehabt, und diese Frau war ganz allein für ihn bestimmt. Nur er sollte sie so sehen, wie sie war. Und er wollte nicht, dass sie andere Männer ansah. Vielleicht erschien sie ihm gerade deshalb in seinen Träumen: die perfekte Frau, die man niemals haben konnte.
Dominic war sich ihrer kriegerischen Fähigkeiten sehr wohl bewusst. Er respektierte und bewunderte sie, wenn sie bei ihm war, doch er konnte ihr Bild nicht lange festhalten. In Träumen erschien sie ihm meist wie verhüllt von einem dichten Schleier, und ihr Austausch fand mehr in Bildern als in Worten statt. Es hatte lange gedauert, bis sie beide einander einen anderen Wesenszug als den des Kriegers offenbart hatten. Nur langsam hatte sich Vertrauen zwischen ihnen entwickelt – und auch das gefiel Dominic sehr an ihr. Sie verschenkte ihre Loyalität nicht leicht, aber wenn sie sich dafür entschied, dann vergab sie sie voll und ganz. Und in diesem Fall an ihn.
Wieder merkte er, dass er lächeln musste über eine solch absurde Fantasie in seinem Alter. Wahrscheinlich war er schon senil. Aber er vermisste seine Gefährtin so sehr, wenn er sie nicht zu sich holen konnte. Hier draußen in der Hitze des Urwaldes, wo in silbrig schimmernden Schwaden der Regen fiel, schien sie ihm näher zu sein als in der Höhle. Der feuchte Dunstschleier erinnerte ihn an das erste Mal, an dem es ihm gelungen war, durch diesen Dunst in seinem Traum hindurchzublicken und ihr Gesicht zu sehen. Sie hatte seinen Atem stocken lassen, weil sie so ängstlich ausgesehen hatte – als zeigte sie sich ihm mit voller Absicht, als hätte sie es endlich riskiert, aber als zitterte sie nun vor seinem Urteil über sie.
In dem Moment hatte er das Gefühl gehabt, der Liebe näher zu sein als je zuvor in seinem Leben. Er versuchte, das Gefühl mit jenem zu vergleichen, das er damals für seine Schwester Rhiannon empfunden hatte, als sie alle noch glücklich gewesen waren und er etwas hatte empfinden können. Dominic hatte all diese Jahrhunderte an der Erinnerung an diese Liebe festgehalten, doch nun war es ein gänzlich anderes Gefühl.
Hm, Gefühl … Er überlegte hin und her, was dieses Wort bedeuten könnte. Erinnerungen? Oder bezog es sich auf etwas ganz Reales? Und warum waren seine Erinnerungen hier im Wald plötzlich so klar? Dominic roch den Regen, atmete seinen sauberen Duft ein und empfand dabei sogar so etwas wie Vergnügen. Es war frustrierend, dass das Gefühl zum Greifen nahe war, es sich ihm aber trotzdem noch entzog. Es war nicht einfach nur eine Nebenwirkung des Vampirblutes, das er eingenommen hatte, denn er hatte schon viel früher zu »träumen« begonnen. Und die Träume stellten sich immer nur dann ein, wenn er wach war.
Dominic misstraute allem, was keinen Sinn ergab. Er war kein Mann, der zu Träumen oder Fantasien neigte, und diese geheimnisvolle Frau wurde schon zu sehr zu einem Bestandteil seines Lebens – und seiner selbst. Sie ließ ihn glauben, sie sei seine Seelengefährtin – eine Realität, kein Mythos. Aber hier in diesem Land, wo Mythen und Legenden zum Leben erwachten, konnte Dominic sich beinahe weismachen, sie sei real. Doch selbst wenn sie es war, war es schon viel zu spät. Der unaufhörliche Schmerz in seinem Bauch sagte Dominic, dass seine Zeit ablief. Dabei musste er noch den Auftrag ausführen, das feindliche Lager zu infiltrieren und die Pläne der Vampire aufzudecken, die Information an Zacarias de la Cruz zu senden und dann so viele Vampire zu töten wie nur möglich, bevor er selbst fiel. Und deshalb beschloss er, sich unverzüglich aufzumachen, um für das Weiterbestehen seines Volkes zu kämpfen.
Schnell verwandelte er sich und nahm die Gestalt des Herrn der Lüfte an – die der Harpyie, des Haubenadlers Südamerikas. Dieses Tier jedoch war noch größer, als es normalerweise der Fall war, obwohl Harpyien ohnehin schon riesige Vögel waren. Seine Flügelspannweite betrug gute sieben Fuß, seine Krallen waren gewaltig. Die Adlergestalt würde dazu beitragen, Dominic zu schützen, wenn er in die Sonne hinaustrat und eine freie Fläche überqueren musste, bevor er den relativen Schutz der dicht belaubten Baumkronen erreichte.
Er hüpfte auf den Boden und ins Licht. Trotz des starken Regens überschwemmte ihn die Helligkeit. Rauch stieg von den dunklen Federn auf und hüllte bald den ganzen Vogel ein. Dominic hatte schon oft Verbrennungen erfahren, sein Körper war von ihren Narben überzogen, auch wenn sie mit der Zeit zurückgegangen waren. Aber er würde nie den Schmerz vergessen. Er hatte sich in seine Knochen eingebrannt.
Dominic holte tief Luft und zwang sich, die Flügel auszubreiten und sich zu dieser scheußlich brennenden Hitzemasse zu erheben. Der Regen peitschte ihn, fauchte und zischte wie eine erboste Katze, als der große Vogel sich in die Lüfte schwang und hart mit den Flügeln schlug, um schnell an Höhe zu gewinnen und die Bäume zu erreichen. Das Licht blendete ihn, und selbst in Adlergestalt schrak Dominic vor den Strahlen zurück, auch wenn sie durch den Regen verschwommen waren. Es schien ewig zu dauern, die dreißig Fuß zu überwinden. Und auch dann brauchte Dominic ein paar Momente, um zu erkennen, dass die Sonne ihm nicht mehr direkt auf die Federn schien. Die zischenden und fauchenden Geräusche wichen wieder dem Geschrei der Vögel und Affen, das diesmal jedoch sehr beunruhigt klang.
Unter ihm ließ ein Stachelschwein die Feige fallen, die es sich gerade hatte einverleiben wollen, als der Schatten des Adlers über ihm hinweggezogen war. Zwei weibliche, von fermentiertem Obst berauschte Klammeraffen starrten zu ihm auf. Der Amazonasurwald verlief über acht Grenzen und erstreckte sich mit seinen ganz eigenen, unterschiedlichen Lebensformen über die jeweiligen Länder. Ein seidig glänzender Ameisenbär, der in den Ästen eines Baumes herumkletterte, verharrte, um ihn misstrauisch zu beäugen. Leuchtend rote und blaue Aras kreischten warnend, als der Adler über sie hinwegflog, aber Dominic beachtete sie nicht und zog immer weitere Kreise, um noch mehr von dem Gebiet in Augenschein zu nehmen.
So hoch die Baumkronen es erlaubten, bewegte der Adler sich lautlos durch den Dschungel und brachte Meile um Meile hinter sich. Dabei blieb er immer unter den Kronen, denn er brauchte den Schutz der knorrigen Äste und des dichten Blätterdachs, um vor dem Licht geschützt zu sein. Mit den scharfen Augen des Adlers konnte er selbst Dinge, die nicht größer als ein Zentimeter waren, aus großer Höhe sehen. Er konnte mit Geschwindigkeiten bis zu fünfzig Meilen in der Stunde fliegen, wenn er sich in offenem Gelände befand, und, falls nötig, mit schwindelerregendem Tempo zur Erde hinunterschießen.
Im Moment war es in erster Linie jedoch die exzellente Sicht des Adlers, derentwegen er sich für diese Tiergestalt entschieden hatte. Im Vorbeirauschen entdeckte er Hunderte von Fröschen und Eidechsen auf Zweigen und Baumstämmen. Schlangen lagen um Äste geschlungen, als wären sie ein Teil davon, und verbargen sich unter vom Regen stark durchnässten Blüten. Ein Baumozelot, der mit großen Augen nach Beute Ausschau hielt, zog sich noch tiefer in das Blattwerk eines hohen Kapokbaumes zurück. Der Adler ließ sich tiefer sinken, um die üppige Vegetation am Boden zu inspizieren. Kalksteinblöcke lagen halb begraben unter Trümmern, als wären sie von einer resoluten Hand verstreut worden. Ein blau schimmerndes Wasserloch wies auf das Vorhandensein eines unterirdischen Wasserlaufes hin.
Der Adler erweiterte seine Kreise und legte mehr und mehr Meilen zurück, bis er fand, wonach er suchte. Am Rande einer von Menschen gerodeten Lichtung ließ sich der große Vogel in den Ästen eines hohen Baumes nieder. Ein riesiges stählernes Gebäude mit Bolzen war Teil für Teil hierhergebracht und irgendwann im letzten Jahr errichtet worden. Die dicht wuchernde Vegetation ringsherum war nie beschnitten worden, wahrscheinlich mit der Absicht, das Gebäude zu verbergen, aber der Dschungel hatte noch nicht genug Zeit gehabt, sich das verlorene Terrain zurückzuerobern.
Irgendetwas hatte von außen ein Loch in das Metall gerissen, und ein Feuer war in dem Gebäude ausgebrochen. Der Rauchgeruch vermochte jedoch nicht den Gestank verwesenden Fleisches zu überdecken, der Dominic, selbst in der Gestalt des Vogels, einen Schauder über den Rücken jagte. Vampire. Der üble Geruch war da, wenn auch verblasst, als wären viele Tage vergangen, seit die Untoten an diesem Ort gewesen waren. Und noch immer erhob sich das Geheul der Toten aus dem umliegenden Boden.
Die rechte Seite des Gebäudes war geschwärzt, und das Loch gewährte Einblicke ins Innere. Erst kürzlich, vielleicht sogar vor ein paar Stunden erst, hatte ein Kampf hier stattgefunden. Die scharfen Augen des Adlers konnten die umgekippten Möbel im Innern des Gebäudes sehen, einen Schreibtisch und zwei Käfige. Eine Gestalt lag reglos auf dem Boden.
Zwei Männer – Dominic war sicher, dass es Menschen waren – standen in Kampfanzügen und mit großen Gewehren vor dem Gebäude. Einer hob eine Flasche Wasser an den Mund und trat dann in den relativen Schutz des Eingangs, um dem unaufhörlichen Regen zu entgehen. Der zweite blieb stoisch stehen, obwohl der Regen ihn bis auf die Haut durchnässte, und sagte ein paar Worte zu dem ersten Posten. Dann setzte er sich in Bewegung, um eine Runde um das Gebäude zu drehen. Beide wirkten sehr wachsam, und der Posten im Eingang schonte sein linkes Bein, als wäre er verletzt.
Der Adler beobachtete sie, regungslos und gut versteckt zwischen den dichten, knorrigen Ästen und dem Blätterdach über der Lichtung. Es dauerte nicht lange, bis ein dritter Mann aus dem Wald trat. Er war nackt, hatte eine breite Brust, stämmige Beine und muskelbepackte Arme und trug einen weiteren Mann über der Schulter. Blut strömte über den nackten Rücken, aber es war nicht zu sagen, ob es von dem Bewusstlosen oder von dem Mann selbst stammte. Er schwankte, kurz bevor er die Tür erreichte, doch der Posten im Eingang half ihm nicht, sondern trat nur zur Seite und hob ein wenig den Gewehrlauf an, gerade so viel, um die Neuankömmlinge im Visier zu haben.
Sie waren Jaguarmenschen. Gestaltwandler. Dominic war sich dessen völlig sicher. Irgendjemand hatte diese Einrichtung angegriffen und ihr beträchtlichen Schaden zugefügt. Offensichtlich misstraute der menschliche Posten den Jaguarmenschen, doch er ließ sie immerhin herein. Die zweite Wache war zurückgeblieben und behielt die beiden Jaguarmenschen, den Finger am Abzug seiner Waffe, scharf im Auge. Dies alles sah nicht nach einem entspannten Waffenstillstand zwischen den beiden Spezies aus.
Dominic wusste, dass die Jaguarmenschen vom Aussterben bedroht waren; er hatte den Verfall ihrer Rasse schon seit einigen Jahrhunderten beobachtet und wusste, dass er unvermeidlich war. Damals hatten die Karpatianer versucht, sie vor dem, was kam, zu warnen. Die Zeiten änderten sich, und eine Spezies musste sich weiterentwickeln, um überleben zu können, aber die Jaguarmänner hatten den Rat nicht hören wollen. Sie wollten an ihren alten Sitten festhalten, tief in den Wäldern leben, ein Weibchen finden, es decken und dann weiterziehen. Sie waren wild und übellaunig, Nomaden, die nicht sesshaft werden konnten.
Die wenigen Jaguarmänner, mit denen Dominic zu tun gehabt hatte, waren sehr anmaßend und prätentiös. Sie wähnten sich allen anderen Spezies überlegen, und ihre Frauen waren in ihren Augen kaum mehr als Zuchttiere. Die königliche Familie der Jaguare hatte eine lange Geschichte der Grausamkeit und des Missbrauchs ihren Frauen und Töchtern gegenüber, woran die anderen männlichen Jaguare sich ein Beispiel nahmen und es ihnen nachtaten. Es gab nur einige wenige männliche Jaguarmenschen, die versucht hatten, den anderen klarzumachen, dass sie ihre Frauen und Kinder schätzen müssten, anstatt sie wie Besitztümer zu behandeln. Doch diese wenigen Ausnahmen waren als Verräter betrachtet, gemieden und lächerlich gemacht worden – oder, schlimmer noch, getötet worden.
Am Ende hatten die Karpatianer die Jaguarmenschen sich selbst überlassen, wohl wissend, dass die Spezies letztendlich zum Untergang verurteilt war. Brodrick X., ein seltener schwarzer Jaguar oder Panther, führte die Männer nicht anders, als sein Vater und dessen Vorfahren sie angeführt hatten. Er war als schwieriger, brutaler Mann bekannt, der verantwortlich war für das Auslöschen ganzer Dörfer, deren Einwohner, sogenannte »Mischlinge«, er als nicht lebenswert erachtete. Es ging das Gerücht, er habe nicht nur ein Bündnis mit den Brüdern Malinov geschlossen, sondern auch mit der Gesellschaft von Menschen, die sich der Ausrottung der Vampire verschrieben hatte.
Dominic schüttelte den Kopf über die Ironie des Ganzen. Menschen vermochten nicht zwischen Karpatianern und Vampiren zu unterscheiden, und ihr geheimer Bund »zur Vernichtung der Vampire« war ausgerechnet von denjenigen unterwandert worden, die sie zum Verschwinden bringen wollten. Die Brüder Malinov benutzten beide Spezies in ihrem Krieg gegen die Karpatianer. Die Werwölfe hatten sich bisher noch keiner Seite angeschlossen, sondern waren strikt neutral geblieben, aber sie existierten, wie Manolito de la Cruz durch seine Seelengefährtin herausgefunden hatte.
Dominic breitete die Flügel aus, um näher heranzufliegen, und stellte sein scharfes Gehör darauf ein, das Gespräch in dem Gebäude aufzufangen.
»Die Frau ist tot, Brodrick. Sie hat sich von den Klippen gestürzt. Wir konnten sie nicht aufhalten.« Überdruss und Abscheu lagen in der Stimme.
Eine zweite, schmerzerfüllte Stimme fügte hinzu: »Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Frauen zu verlieren.«
Die dritte Stimme war leiser, ein Knurren, das Macht und eine verblüffende Autorität verriet. »Was sagtest du, Brad?« Die Stimme vermittelte eine eindeutige Drohung, als machte die bloße Vorstellung, dass einer seiner Untertanen eigene Ideen haben könnte, diesen in gewisser Weise schon zu einem Verräter.
»Er braucht einen Arzt, Brodrick«, warf die erste Stimme hastig ein.
Dominic sah einen hochgewachsenen Mann in locker sitzenden Jeans und offenem Hemd aus dem Gebäude treten. Sein Haar war lang, sehr dicht und strubbelig. Dominic wusste sofort, dass er Brodrick, den Herrscher der Jaguarmenschen, vor sich hatte. Hätte sein eigener Prinz, Mikhail Dubrinsky, den Karpatianern nicht befohlen, die Spezies der Jaguarmenschen ihrem Schicksal zu überlassen, wäre Dominic versucht gewesen, den Mann auf der Stelle umzubringen. Brodrick war unmittelbar verantwortlich für den Tod unzähliger Männer, Frauen und Kinder. Er war getrieben vom Bösen, trunken von seiner eigenen Macht und dem Glauben, allen anderen überlegen zu sein.
Brodrick sah die beiden Wachposten verächtlich an. »Was fällt euch ein, hier im Eingang herumzulungern? Ihr sollt eure Arbeit tun, verdammt noch mal!«
Der zweite Posten hielt die Waffe selbst dann noch auf Brodrick gerichtet, als die beiden Menschen in entgegengesetzter Richtung um das Haus herumgingen. Das Hinken des einen, der im Eingang Schutz gesucht hatte, bestätigte Dominics Annahme, dass er verletzt war. Brodrick indessen blickte mit finsterer Miene zum Regen auf und ließ ihn auf sein Gesicht herniederprasseln. Dann spuckte er angewidert aus und ging zu der Seite des Gebäudes, an der das Feuer offenbar ausgebrochen war, kauerte sich nieder und begann, sehr gründlich den Boden abzusuchen. Brodrick beugte sich vor, um die Asche zu beschnuppern, und setzte alle Sinne ein, um die Spur seines Feindes aufzuspüren.
Plötzlich hockte er sich auf die Fersen und versteifte sich. »Kevin, komm mal her!«, rief er.
Der Jaguarmensch, der den Verwundeten getragen hatte, kam herbeigeeilt, barfuß, aber in Jeans. Noch im Laufen streifte er sich ein T-Shirt über, das sich über der breiten Brust des Mannes spannte. »Was ist?«
»Hast du dir den, der hier eingebrochen ist und Annabelle befreit hat, angesehen?«
Kevin schüttelte den Kopf. »Er ist ein teuflisch guter Schütze. Er hat zwei Wachen ausgeschaltet, und die Kugeln lagen so dicht nebeneinander, dass alle dachten, nur ein Schuss wäre abgegeben worden.«
»Es gibt keine Spuren. Überhaupt keine. Wo zum Teufel war der Kerl? Und woher kannte er die genaue Stelle, um das Gebäude in die Luft zu jagen und Annabelle zu befreien? Es hat doch nicht mal Fenster, verdammt noch mal!«
Kevin blickte in die Richtung der beiden Posten. »Du denkst, dass jemand ihm geholfen hat?«
»Was ist da draußen los gewesen?« Brodrick zeigte auf den Wald.
Kevin zuckte mit den Schultern. »Wir folgten Annabelle, die durch den Wald auf den Fluss zurannte. Wir dachten, es sei vielleicht ihr Mann, der Mensch, von dem sie sprach, der gekommen war, um sie zu retten. Für den Kampf mit ihm brauchten wir keine Waffen, also verwandelten wir uns beide. Wir dachten, so würden wir im Dschungel schneller vorankommen als Annabelle, selbst wenn sie sich auch verwandelte.«
Das war gut gedacht, gab Dominic von seinem hohen Platz aus zu, doch sie hatten die Frau trotzdem verloren.
Brodrick schüttelte den Kopf. »Wie wurde Brad angeschossen? Und wo ist Tonio?«
Kevin seufzte. »Wir fanden seine Leiche jenseits der Höhlen. Er hatte sich mit einer anderen Katze angelegt. Brad kniete neben ihm, und das Nächste, was ich weiß, ist, dass er auf dem Boden lag und irgendwer uns niederhielt. Ich hatte keine Waffe. Deshalb verwandelte ich mich, um mich im näheren Umkreis umzusehen, aber ich konnte keine Spuren finden.«
Brodrick fluchte. »Sie war’s. Sie ist dafür verantwortlich. Ich weiß, dass sie es war. Deshalb hast du keine Spuren gefunden. Sie hat sich in die Bäume verzogen.«
Keiner präzisierte, wer sie war, aber Dominic wollte wissen, wer diese mysteriöse Frau war, die sie offensichtlich hassten – und fürchteten. Bestimmt jemand, den er gern kennenlernen würde. Vier der fünf Brüder de la Cruz hatten Seelengefährtinnen. Könnte die Unbekannte eine dieser Frauen sein? Möglich war es, doch Dominic glaubte nicht so recht daran. Die Brüder de la Cruz würden nicht zulassen, dass ihre Gefährtinnen kämpften. Sie waren Männer mit sehr fürsorglichem, beschützerischem Wesen, und in diese Welt zu kommen, hatte ihre dominierenden Tendenzen höchstens noch verstärkt. Sie hatten acht Länder zu überwachen, und die Brüder Malinov würden wissen, wie unmöglich es war, jeden Quadratmeter des Regenwaldes zu kontrollieren. Nein, die Brüder de la Cruz würden niemals, unter gar keinen Umständen ihre Gefährtinnen allein hinausschicken. Diese geheimnisvolle Frau, von der die Rede war, musste jemand anderes sein.
Der Adler breitete seine gewaltigen Schwingen aus und erhob sich in die Luft. In der nachlassenden Sonne fühlte er sich ein wenig besser, aber das Gewisper der Parasiten wurde lauter, verführerischer und steigerte seinen Hunger zu einer regelrechten Gier, bis er kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte. Es war nur die Gestalt des Vogels, die ihm half, nicht den Verstand zu verlieren, als er sich an das zunehmende Maß an Qual zu gewöhnen versuchte. Wenn die Nacht näher rückte, wurden die tagsüber eher schwerfälligen Parasiten aktiv und stachen in seine inneren Organe, und das Vampirblut brannte ihm wie Säure in den Adern. Dominic musste Nahrung suchen, aber er befürchtete immer mehr, dass er langsam den Verstand verlor und nicht die Kraft finden würde, der Versuchung zu widerstehen, während der Nahrungsaufnahme zu töten.
Zur Abenddämmerung erwachte er stets mit einem unbändigen Hunger, und wann immer er Nahrung aufnahm, wurden die Parasiten lauter, drängten ihn, zu töten und den Rausch der Macht zu spüren, den legitimen Rausch der Macht. Sie versprachen ihm süße Kühle in seinem Blut und ein Gefühl der Euphorie, das allen Schmerz aus seinem müden Körper nehmen würde.
Dominic hielt sich im Schatten des Blätterdaches, erweiterte seine Erkundung auf den Schauplatz des Kampfes und hoffte, dass der Adler etwas entdeckte, was den Männern entgangen war. Und tatsächlich fand er Eingänge zu Höhlen, die sehr klein und aus Kalkstein waren, aber nicht tief genug unter die Erde zu reichen schienen, um das Labyrinth von Tunneln zu erzeugen, wie das meilenweit entfernte Höhlensystem es erschuf. Es gab nur drei kleine Kammern, und in jeder von ihnen entdeckte Dominic Maya-Kunstwerke an den Wänden. Alle drei Höhlen ließen Anzeichen erkennen, dass sie einmal bewohnt gewesen waren, doch sie zeugten auch von Gewalt, denn in allen fand er Flecken getrockneten Blutes auf Fußböden und Wänden.
Als er sich wieder in die Lüfte aufschwang, verspürte er ein ungutes Gefühl im Magen, das ihn sehr beunruhigte. Er hatte furchtbare Kampfschauplätze, Folter und Tod gesehen. Dominic war ein karpatianischer Krieger, und sein Mangel an Emotionen leistete ihm normalerweise gute Dienste. Ohne eine Seelengefährtin, um die Düsternis in ihm auszugleichen, brauchte er diesen Mangel an Empfindungen, um nach über tausend Jahren der Grausamkeit und Verderbtheit, die er mit angesehen hatte, bei Verstand zu bleiben. Der Anblick des Blutes in dieser Höhle und das Wissen, dass Frauen dorthin gebracht worden waren, um von Jaguarmännern missbraucht zu werden, verursachte ihm jedoch Übelkeit. Und das dürfte eigentlich nicht so sein. Auf intellektueller Ebene vielleicht schon, denn eine geistige Reaktion war akzeptabel, und das Ehrgefühl in ihm würde sich erheben, um ein solches Verhalten zu verabscheuen und zu verdammen. Aber eine körperliche Reaktion war völlig inakzeptabel – und zudem noch ausgeschlossen. Und dennoch …
Beunruhigt erweiterte Dominic die Suche auf die Klippen über dem Fluss. Der Regen hielt an, nahm an Stärke sogar noch zu und verwandelte die Welt in Silbergrau. Selbst im Schutz der Wolken über sich spürte Dominic die Hitze in sich eindringen, als er über dem Fluss ins Freie kam. Zwischen den Felsen verfangen, zerschlagen und vergessen trieb ein lebloser Körper im Wasser. Langes, dichtes Haar lag wie Algen auf der Wasseroberfläche, und ein Arm war in einem Spalt zwischen zwei großen Felsen eingeklemmt. Die Frau trieb mit dem Gesicht nach oben, ihre toten Augen starrten zum Himmel auf, und der Regen prasselte auf sie herab und lief an ihrem Gesicht hinab wie eine Flut von Tränen.
Fluchend kreiste Dominic über ihr und ließ sich dann herabsinken. Er konnte sie nicht einfach so liegen lassen, egal, wie viele Tote er schon gesehen hatte. Er würde sie nicht dort zurücklassen wie eine zerbrochene Puppe, ohne Respekt oder Ehrerbietung für die Frau, die sie gewesen war. Dem Gespräch zwischen Brodrick und Kevin nach zu urteilen, hatte sie eine Familie und einen Ehemann, die sie liebten.
Sie – und ihre Familie – verdienten mehr, als dass ihre zerschlagene Leiche der Zersetzung im Wasser überlassen wurde und als Futter für Fische und andere Fleischfresser diente, die sich an ihr gütlich tun würden.
Der Adler ließ sich auf dem Felsen direkt über ihrem Körper nieder, verwandelte sich und hüllte sich in einen schweren Umhang, dessen Kapuze seinen Nacken und sein Gesicht schützte, als er sich hinkauerte und ihr Handgelenk ergriff. Dominic war stark und hatte keine Mühe, sie aus dem Wasser und in seine Arme zu ziehen. Ihr Kopf fiel zurück, und er sah die blauen Flecke an ihrer Haut und die Fingerspuren um ihren Nacken. Auch um ihre Handgelenke und Knöchel sah er schwarz und blau verfärbte Kreise. Wieder war er erschüttert von seiner Reaktion. Kummer mischte sich mit Zorn, doch die Traurigkeit in seinem Herzen war so schwer, dass er den Zorn langsam verdrängte.
Dominic holte tief Luft und ließ sie wieder entweichen. Waren es die Empfindungen eines anderen, die er verspürte? Verstärkten die Parasiten die Emotionen um ihn herum und erhöhten den Kick, den der Vampir aus dem Entsetzen seines Opfers und dessen vom Adrenalin aufgeputschten Blut bezog? Das war eine Möglichkeit, aber Dominic konnte sich nicht vorstellen, dass ein Vampir Trauer zu empfinden vermochte.
Er trug die Frau in den Wald, und mit jedem Schritt wurde ihm das Herz noch schwerer. Kaum erreichte er die Bäume, witterte er Blut. Hier musste der zweite Kampf stattgefunden haben und Brad verwundet worden sein. Dominic fand die Stelle, an der der Jaguarmann seine Kleider abgelegt und auf die Jagd gegangen war, in der Hoffnung, sich in einem Bogen an den Schützen heranzuschleichen und ihn zu überrumpeln.
Es gab kaum eine Fährte, die den Weg des Jaguars bezeichnete, nur ein Stückchen Fell und einige vom Regen halb zerstörte Fußspuren, und trotzdem dauerte es nicht lange, bis Dominic die tote Katze fand. Auch hier hatte es einen Kampf gegeben, und es war eindeutig einer zwischen zwei Raubkatzen gewesen. Die Fußabdrücke der toten Katze waren tiefer und befanden sich in größerem Abstand voneinander, was darauf schließen ließ, dass das Tier größer und schwerer gewesen war. Aber die kleinere Katze war offensichtlich ein erfahrener Kämpfer gewesen, weil sie die andere nach einem wilden Kampf mit einem Biss in den Schädel getötet hatte. Blattwerk und Zweige waren blutdurchtränkt, und das Gleiche galt auch für den Boden. Dominic prägte sich die Abdrücke der siegreichen Raubkatze genau ein.
Er wusste, dass die Jaguare zurückkehren würden, um die tote Katze zu verbrennen, und so brachte er die Frau zu der mit üppigstem Pflanzenwuchs bestandenen Stelle, die er finden konnte. Eine von Blütenranken überwachsene Kalksteingrotte würde ihr einziger Grabstein sein, doch er öffnete tief die Erde und gab ihr eine anständige letzte Ruhestätte. Als die Erde sich über der Frau schloss, murmelte er ein Gebet in seiner Sprache, betete um Frieden und Aufnahme ihrer Seele in der nächsten Welt und bat auch die Erde, ihren Körper freundlich zu empfangen.
Dominic blieb noch einen Moment, obwohl die Sonnenstrahlen ihn durch den Schutz des Blätterdachs und Regens trafen, sich durch seinen schweren Umhang hindurchbrannten und dicke Blasen auf seiner Haut hervorriefen. Die Parasiten reagierten umgehend und begannen, in seinem Kopf zu kreischen und sich zu winden, während sein Inneres eine Masse von Schnitten war, die bewirkte, dass er Blut spuckte. Einige der Parasiten verdrängte Dominic durch seine Poren aus dem Körper, wenn er merkte, dass das Geflüster lauter wurde und die Qualen sich nicht mehr ignorieren ließen. Das Einzige, das ihm dann Erleichterung verschaffte, war, ihre Anzahl zu verringern. Dominic musste die sich windenden, mutierten Blutegel verbrennen, bevor sie sich im Boden verkrochen und versuchten, den Weg zurück zu ihren Herren zu finden.
Er veränderte den Pflanzenbewuchs auf der Erde, um alle Anzeichen des Grabes zu verbergen. Die Jaguarmenschen würden zurückkommen, um sämtliche Spuren ihrer Spezies zu beseitigen, aber sie würden die Frau nicht finden, weil sie zu weit entfernt von ihrem Zugriff ruhte. Mehr konnte Dominic für sie nicht tun. Mit einem leisen Seufzen sah er sich ein letztes Mal um, überzeugte sich, dass die Stelle völlig unangetastet aussah, und verwandelte sich dann wieder in einen Adler. Er musste wissen, wohin der siegreiche Jaguar gegangen war.
Mit seinen scharfen Adleraugen brauchte er nicht lange, um die gesuchte Katze mehrere Meilen von der Kampfstätte entfernt zu entdecken. Er folgte einfach den Geräuschen des Dschungels, den Lauten der Tiere, die einander vor dem Nahen eines Raubtiers warnten. Der Adler glitt geräuschlos durch die Baumkronen und ließ sich auf einem dicken Ast hoch über dem Urwaldboden nieder. Die Affen kreischten aufgeregt und warfen hin und wieder Zweige auf die große gefleckte Katze hinunter, die durch das Unterholz auf irgendein unbekanntes Ziel zuschlich.
Der Jaguar war ein Weibchen, dunkle Flecken zierten das dichte Fell, das trotz des Regens blutig war. Das Tier hinkte und zog eines der Hinterbeine, das offenbar die schlimmsten Verletzungen davongetragen hatte, ein wenig nach. Die Katze hielt den Kopf gesenkt, sah aber trotzdem sehr gefährlich aus, als sie sich, getarnt durch ihre Flecken, so verstohlen durch das dichte Unterholz bewegte, dass es sogar für die außergewöhnlich gute Sicht des Adlers oft sehr schwierig war, sie zwischen der Vegetation des Dschungelbodens auszumachen.
Ohne die Affen und Vögel zu beachten, folgte Dominic der Raubkatze vollkommen lautlos und in gleichmäßigem Tempo. Er war so fasziniert von der zähen Beharrlichkeit, mit der sie trotz ihrer Verletzungen ihren Weg fortsetzte, dass es einige Minuten brauchte, bis ihm bewusst wurde, dass das scheußliche Geflüster in seinem Kopf beträchtlich nachgelassen hatte. Sooft er die Zahl der Parasiten auch schon verringert hatte, um sich ein wenig Erleichterung zu verschaffen, war es ihm doch nie gelungen, ihren beständigen Angriff auf sein Gehirn zu stoppen; aber jetzt waren sie fast völlig still.
Neugierig erhob er sich in die Lüfte, drehte seine Kreise und blieb jedoch innerhalb des Blätterdaches, um die letzten Sonnenstrahlen zu vermeiden. Je weiter er sich von dem Jaguar entfernte, desto lauter wurde wieder das Geflüster, merkte er. Die Parasiten hielten inne, je näher er dem Jaguarweibchen kam, sodass auch das Gefühl aufhörte, als zerrissen Glasscherben sein Innerstes, und er für kurze Zeit eine Erholungspause von dem brutalen Schmerz bekam.
Der Jaguar drang mit unverminderter Beharrlichkeit immer weiter in den Dschungel ein, weg vom Fluss und ins Innere des dichter werdenden Waldes. Es wurde Nacht, und die Raubkatze gönnte sich nach wie vor keine Pause. Dominic merkte, dass er sie nicht verlassen konnte, dass er einfach nicht den Wunsch verspürte, sie zu verlassen. Er verband nun das merkwürdige Beruhigen der Parasiten eindeutig mit ihr, und auch die sogar noch seltsameren Emotionen, die er empfand, mussten mit ihr in Zusammenhang stehen. Der Zorn war zu einem nicht nachlassenden Schmerz und Kummer abgeflaut; das Herz war ihm so schwer davon, dass er bei seiner Verfolgung kaum noch richtig funktionieren konnte.
Unter ihm erschienen große, halb in der Erde versunkene Kalksteinblöcke. Die Überreste eines großartigen Maya-Tempels lagen zerbrochen und vergessen da; sie waren überwuchert von Bäumen und Schlingpflanzen, die die Überreste des einst so eindrucksvollen Gebäudes fast vollständig verdeckten. Verteilt über die nächsten paar Meilen lagen die Reste einer uralten Zivilisation. Die Mayas waren Bauern gewesen, die ihren Mais mitten im Regenwald angepflanzt hatten, mit Ehrfurcht über den Jaguar gesprochen und Tempel errichtet hatten, um Himmel, Erde und die Unterwelt zusammenzubringen.
Dominic entdeckte den Krater und darunter das kühle Wasser des unterirdischen Flusses, das ihm schon früher am Abend aufgefallen war. Das Jaguarweibchen lief ohne Pause weiter, bis es zu einer anderen Maya-Stätte kam, die allerdings in jüngerer Zeit benutzt worden war. Das dichte Gestrüpp aus Ranken und Bäumen ließ auf einen Zeitpunkt von etwa zwanzig Jahren früher schließen, aber es war offensichtlich, dass hier modernere Häuser gestanden hatten. Sogar ein längst verrosteter, von dicken Lianen und grünen Schösslingen überwachsener Generator lag dort umgekippt auf einer Seite. Der Boden weinte von den Erinnerungen an den Kampf und das Massaker, die hier stattgefunden hatten. Der Kummer war jetzt so schwer zu ertragen, dass Dominic die Last verringern musste. Der riesige Haubenadler flog in einiger Entfernung von dem Jaguar durch das Blätterdach und beobachtete dann völlig reglos aus einer der Baumkronen, wie die Raubkatze das uralte Schlachtfeld überquerte, als wäre sie irgendwie verbunden mit den Toten, die dort klagten.
2. Kapitel
Mein Leben war eine Qual,meine Familie wurde mir genommen.Mein Zorn hat mich aufrechterhalten.Ich hatte die Hoffnung aufgegeben.Tränen fielen in den Regenwald,Herzblut in den blutdurchtränkten Boden.Mein Vater verriet mich.Ich konnte es kaum verkraften.
Solange zu Dominic
Es goss in Strömen; schwere, dichte Schauer fielen vom Himmel. Es war ein regelrechter Wolkenbruch, der die elende Hitze noch verschlimmerte. Die Vögel suchten Schutz zwischen den dicken, knorrigen Ästen und im Blätterdach der Bäume. Baumfrösche bevölkerten Stämme und Äste, während Eidechsen die Blätter als Regenschirme nutzten. Die Luft auf dem Urwaldboden blieb still und drückend, doch oben im Blätterdach schien der Regen fest entschlossen zu sein, die vielen Tiere, die dort lebten, zu ertränken.
Durch die grauen Regenschleier und feuchte Hitze lief der Jaguar lautlos weiter über die verfaulende Vegetation, die umgestürzten Bäume und riesigen Farnwedel, die aus allen nur erdenklichen Spalten und Sprüngen im Boden sprossen. Der schmale Strom, dem das Jaguarweibchen folgte, führte von dem breiten, reißenden Fluss am äußeren Rand des Dschungels in sein tiefstes Inneres. In den letzten zwanzig Jahren hatte die Raubkatze diesen Pfad jeweils zweimal im Jahr beschritten, war dorthin zurückgekehrt, wo alles begonnen hatte, in einer Art Pilgerreise, wenn sie alles satthatte und sich in Erinnerung bringen musste, warum sie handelte, wie sie handelte. Und ganz gleich, wie sich der Wald veränderte, egal, wie viel neue Vegetation entstanden war, sie fand den Weg mit untrüglicher Sicherheit.
Farbenfrohe Blumen mit tropfenden, durchnässten Blüten wanden sich an den dicken Baumstämmen hinauf, schlangen sich um Äste und erfüllten die unterschiedlichen Grünschattierungen des Regenwaldes mit Schönheit und Leben. Die Brettwurzeln der gigantischen Bäume, die das Blätterdach durchbrachen, beherrschten den Waldboden. Ihre geradezu kunstvoll verdrehten Formen versorgten die höchsten Bäume des Dschungels mit Nahrung und dienten ihnen auch als Stütze. Die Wurzelsysteme waren gewaltig, und sie erschienen in allen Formen: als Lamellen, Käfige und dunkle, verschlungene Labyrinthe, die Wesen Schutz boten, die verzweifelt genug waren, den Insekten in den vielen Schichten verrottenden Laubes zu trotzen, und die sich den Platz mit den kleinen Fledermäusen teilten, die in dem gigantischen Wurzelwerk des beeindruckenden Kapokbaumes lebten.
Hoch über der Raubkatze, die ihrer Route folgte, flog eine prächtige Harpyie, die viel größer war als normalerweise und mit ausgebreiteten Schwingen gute sieben Fuß maß. Der Haubenadler bewegte sich so lautlos wie die Katze, hielt sein Tempo in der Luft und schlängelte sich mühelos durch das Labyrinth von Ästen. Weil zwei Raubtiere auf Streifzug waren, hielten die anderen Tiere sich versteckt und zitterten vor Angst. Der Adler spähte herab und ignorierte den verlockenden Anblick eines Faultiers, um den Jaguar im dichten Unterholz des Waldbodens nicht zu verlieren.
Die Wurzeln, die sich auf der Suche nach Nahrung über den Boden schlängelten, machten ihn zu einer Masse manchmal unüberwindlicher Hindernisse. Tausende von Kletterpflanzen wanden sich um die mächtigen Baumstämme, die sie als Leiter zur Sonne hinauf benutzten. Kräftige Lianen und sogar Wurzeln von Kletterpflanzen hingen wie dicke Seile herab oder verflochten sich von Baum zu Baum und stellten ein großartiges, luftiges Straßennetz für Tiere dar. Die vollkommen verhedderten Lianen waren voller Spalten und Kerben, ideale Verstecke für die Tiere, die an den Stämmen und in den Ästen der Bäume Zuflucht suchten.
Die Raubkatze zögerte, als sie sich des großen Raubvogels über ihr bewusst wurde. Es wurde schnell dunkel, und trotzdem verfolgte der große Vogel sie immer noch. Manchmal zog er nur träge Kreise über ihr, dann wieder stürzte er plötzlich durch die Bäume hinunter und schreckte die Tiere auf, bis ein solch irrer Lärm ausbrach, dass die Katze versucht war, eine Warnung zu brüllen. Sie beschloss jedoch, den Adler zu ignorieren, ihrem Instinkt zu folgen und sich auf das Erreichen ihres Ziels zu konzentrieren.
Hügel und Hänge waren von Süßwasserströmen und -bächen durchzogen, die über Felsen und Pflanzen den größeren Flüssen entgegenflossen, in denen es so viele Ablagerungen gab, dass sie die Farbe von Milchkaffee zu haben schienen. Reich an Leben, waren diese Wildwasserflüsse auch die Heimat der seltenen Flussdelfine. Die Schwarzwasserflüsse sahen klar und vielleicht einladender aus, da sie frei von Sedimenten waren, aber sie waren nahezu leblos, unnatürlich klar und rötlichbraun verfärbt und vergiftet von den Gerbsäuren, die von der verfaulenden Vegetation in den Boden sickerten. Das Jaguarweibchen verstand sich auf die Jagd in den ergiebigen Wildwasserflüssen, wo es die Fische mühelos ans Ufer schnippte, wenn es hungrig war.
Zecken und Blutegel, die auf die Hitze und den Regen mit einer fieberhaften Blutgier reagierten, schwärmten aus und suchten nach einem warmblütigen Opfer. Die Raubkatze ignorierte die lästigen Blutsauger, die von ihrer Wärme und der offenen Wunde an ihrer linken Flanke angezogen wurden. Donner krachte und erschütterte die Bäume, was wie ein böses Omen wirkte. Ein Faultier bewegte sich unendlich langsam, sein von Algen bedecktes grünes Fell half ihm, mit den Blättern des Baumes zu verschmelzen, an denen es gerade tafelte. Aber die Katze war sich seiner Anwesenheit über ihr nur allzu gut bewusst, so wie sie sich aller Dinge im Wald bewusst war – vor allem jedoch des Haubenadlers, der sie weiterhin hartnäckig auf Schritt und Tritt verfolgte, obwohl die Nacht schon fast hereingebrochen war. Statt sie zu stören, tröstete seine ungewöhnliche Gegenwart sie jedoch und linderte ihre wachsende Furcht und ihre völlige Erschöpfung, und sie stapfte beharrlich weiter durch die nahezu undurchdringliche Vegetation.
Die Lianengeflechte wurden dichter. Die große Katze bewegte sich lautlos durch das Unterholz voran, über umgestürzte Bäume und unter schirmähnlichen Blättern hindurch, von denen das Wasser tropfte. Ihre Bewegungen verrieten vollkommenes Selbstvertrauen, ein eleganter, muskulöser Körper voller dunkler Flecken, der trotz des unübersehbaren Hinkens durch das schier undurchdringliche Gestrüpp geradezu zu schweben schien. Das Rauschen von Wasser wurde ohrenbetäubend, als der Jaguar sich den Hängen näherte, wo das Wasser durch das Ufer brach und in den Fluss darunter strömte.
Während die große Katze ihren Weg fortsetzte und der Raubvogel durch die Lüfte schwebte, warnten Affen und Vögel die Pekaris, Tapire und Pakas, die beiden Raubtieren als gutes Nachtmahl erscheinen könnten. Die Brüllaffen machten ihrem Namen alle Ehre und kreischten fürchterlich. Der Biss eines Jaguars konnte ihnen den Schädel zertrümmern, als wären sie eine Nuss. Da diese großen Katzen nicht nur sehr gute Kletterer, sondern auch hervorragende Schwimmer waren, konnten sie an Land, auf Bäumen oder auch im Wasser jagen. Die Harpyie konnte mühelos Beute von einem Ast herunterzerren oder sich lautlos von einem höheren Beobachtungspunkt hinunterfallen lassen, um ein argloses Opfer zu ergreifen.
Dicke Muskelstränge zeichneten sich unter dem glatten, gefleckten Fell der Raubkatze ab. Es war fleckiger als das des Leoparden, und da die Farbe ihres Fells sich sowohl den nächtlichen Schatten wie auch dem Tageslicht anpasste, konnte sie sich wie ein lautloses Phantom durch den Urwald bewegen. Manche betrachteten ihr goldbraunes, mit Rosetten versehenes Fell als Karte des Nachthimmels und jagten sie wegen dieses Schatzes.
Trotz ihrer offensichtlichen Verletzung wirkte sie anmutig und nötigte allen anderen Bewohnern des Urwaldes Respekt ab. Mit ihren einziehbaren Krallen und der sechsmal besseren Sicht, als Menschen sie hatten, war sie einer der gefährlichsten Jäger des Waldes und für Heimlichkeit und Hinterhalt gebaut. Die Tiere erschauderten, wenn sie vorbeikam, warnten einander und beobachteten sie misstrauisch, aber sie kletterte weiter, umging den schmalen Streifen Land, der kaum den Beginn des Wasserfalls bedeckte, weil sie von anderen Gelegenheiten wusste, dass die moosbedeckte schmale Brücke eine heimtückische Gefahr für den Ahnungslosen war, der auch nur einen einzigen falschen Schritt machte. Deshalb nahm sie die etwas weitere Umgehung und bahnte sich einen Weg durch das Gewirr von Schlingpflanzen und Wurzeln in das immer dunklere Innere des Dschungels.
Schieferschwarze Federn bedeckten die Schwingen und den Rücken der Harpyie. Der weiße Körper war im gleichen Schwarz gestreift und endete in einem schwarzen Band um den Hals des mächtigen Raubvogels, aus dem der graue Kopf mit dem doppelten Federbusch, der ihn krönte, hervorstand. Die schwarz-weiß gestreiften Beine endeten in gewaltigen Krallen, die fast die Größe von Bärenpranken hatten. Mit gespreizten Schwingen schien es nahezu unmöglich für den mächtigen Raubvogel zu sein, die schmalen Durchgänge des Blätterdachs mit seinen knorrigen Ästen und herabhängenden Lianen zu bewältigen, aber der Adler schaffte es mit majestätischer Leichtigkeit und hielt Schritt mit dem Raubtier auf dem Boden.
Der weibliche Jaguar lief weiter durch den Wald, und das Hinken wurde noch ausgeprägter, als die Katze versuchte, ihr Gewicht von der verletzten linken Flanke auf die rechte zu verlagern. Das Wasser in ihrem Fell löste das geronnene Blut dort auf, sodass es an ihrem Bein hinunterlief und auf den Boden tropfte. Aber das Jaguarweibchen behielt das gleiche Tempo bei, obwohl es den Kopf hängen ließ und seine Seiten zitterten, als es durch das Gewirr aus Schlingpflanzen und Wurzeln lief. Trotz der zunehmenden Schmerzen war es fest entschlossen, sein Ziel zu erreichen. Der Himmel über dem Blätterdach wurde dunkel, und schließlich ließ sogar der Regen ein wenig nach.
Fledermäuse erhoben sich in die Luft, und der Waldboden wurde lebendig von Millionen Insekten. Noch immer lief die Raubkatze weiter und schlängelte sich zwischen den Bäumen hindurch. Zweimal musste sie die luftige »Höhenstraße« nehmen und ihre Äste als Brücke über einen Wildwasserlauf benutzen. Sie konnte zwar schwimmen, doch sie war erschöpft, und der Regen hatte selbst die kleinsten Wasserläufe über die Ufer treten lassen, sodass der gesamte Waldboden buchstäblich zu bersten schien vor Wasser. Und die ganze Zeit leistete der Adler ihr Gesellschaft und gab ihr die Kraft, die Reise fortzusetzen.
Sie lief den größten Teil der Nacht, bis sie zu der ersten Wegmarkierung kam, die sie erkannte, den zerbröckelnden Überresten eines alten Tempels, eines trotz seines Verfalls beeindruckenden Bauwerks, das Himmel, Erde und Unterwelt miteinander verband. Die Jaguarstatue aus Kalkstein, die die Ruine bewachte, starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an, als versuchte sie abzuschätzen, was sie wert war. Im Moment, so müde und erschöpft, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, fühlte die Katze sich recht wertlos.
Mit gesenktem Kopf schlich sie an der Statue vorbei und vermied es, in die starren Augen zu sehen. Sie tappte lautlos über die uralten Steine und drang noch tiefer in das Dickicht ein. Ein paar Meilen weiter, und die Nacht schien noch dunkler zu sein, die Bäume noch dichter zusammenzustehen. Pflanzen krochen an jedem Stamm empor und nahmen allen verfügbaren Platz ein, sodass es die Raubkatze große Mühe kostete, sich zu den zerbrochenen Kalksteinblöcken vorzuarbeiten, die verstreut herumlagen und halb unter der dichten Vegetation begraben waren, die überwucherte, was einmal eine Lichtung gewesen war.
Bäume hatten schon lange die Stelle eingenommen, wo einst das Land gerodet worden war, um Platz für ein kleines Dorf und eine Farm zu schaffen. Der Mais war längst verschwunden, doch die Katze erinnerte sich noch gut an die Reihen hellgrüner Stängel, die mitten in dem umliegenden Dschungel ihre Köpfe in die Sonne und den Regen gestreckt hatten. Kürbisse und Bohnen hatten die Reihen gesäumt, da ihre Leute zu den alten Sitten zurückgekehrt waren und die gleiche Mischung aus Mais, Kalksteinpulver und Wasser für ihr Mehl benutzten wie schon ihre Vorfahren hier an genau demselben Ort.
Sie konnte das Blut spüren, das wie der mächtige Süßwasserfluss unter ihren Füßen dahinfloss und unaufhörlich in den Boden sickerte. Ihre Vorfahren waren hier gestorben – und dann, vor zwanzig Jahren, auch ihre Familie und Freunde. Nie würde sie ihre Schreie vergessen, das Entsetzen und die Furcht vor dem Bösen.
Über ihr ließ der Ruf des Adlers die aus dem Schlaf gerissenen Affen in ein schrilles Geheul ausbrechen, das sich wie eine Welle durch den ganzen Wald fortsetzte. Aber seltsamerweise beruhigte das Geräusch den Jaguar. Der Adler, der Herr der Lüfte, landete unterhalb der Baumkronen, legte die Flügel an und spähte zu der großen Katze hinunter. Sie nahm seine Anwesenheit mit einem Blick nach oben in das Blätterdach zu Kenntnis. Es war ungewöhnlich, dass dieser große Raubvogel bei Nacht auf die Jagd ging, und hätte sie eigentlich beunruhigen müssen. Alles Ungewöhnliche in diesem Wald, wo Legenden und Albträume zum Leben erwachten und bei Nacht umherstreiften, verursachte ihr Unbehagen, und dennoch verspürte sie ein seltsames Gefühl der Kameradschaft für den Vogel.
Der Jaguar und der Adler starrten einander eine ganze Weile an, beide ohne zu blinzeln oder auch nur sekundenlang den Blick zu senken. Der Jaguar musterte den Raubvogel und fragte sich flüchtig, was es bedeuten mochte, wenn ein normalerweise bei Tag jagendes Raubtier sich nachts im Regen herumtrieb. Die Raubkatze war jedoch zu müde, um großes Interesse für die Frage aufzubringen, und unterbrach als Erste den Blickkontakt. Hier, in den Ruinen zweier dem Erdboden gleichgemachter Dörfer, wo klagende Geister immer noch nach Rache schrien, war nicht der richtige Ort, um die Ruhe zu finden, die sie so dringend brauchte. Es war besser, die Reise fortzusetzen, und so lief sie zwischen den verfallenen Steinen und halb begrabenen Fundamenten zu dem großen Kapokbaum hinüber, auf dem der Adler hockte.
Majestätisch erhob sich der Vogel in die Luft, beschrieb einen Kreis über den Maya-Ruinen und ließ sich tiefer sinken, um sich die Überreste der anderen, vor noch gar nicht allzu langer Zeit zerstörten Fundamente anzusehen. Seine scharfen Augen untersuchten aus der Luft den Boden, dann sank der Vogel noch tiefer und streifte fast den Jaguar, bevor er abrupt wieder in die Höhe schoss und seine mächtigen Flügel ihn in den Schutz der Baumkronen hinauftrugen.
Das Jaguarweibchen spürte den Schlag dieser Flügel, als sie so nahe an ihm vorbeistrichen. Es hob den Kopf und beobachtete den Adler, bis er außer Sicht war. Dann kletterte die Katze mithilfe ihrer scharfen Krallen auf den Baum. Für einen Moment blieb sie dort stehen, blickte zum leeren Himmel auf und fühlte sich ganz und gar allein und schrecklich deprimiert von ihrem schweren Kummer. Sie konnte es sich jedoch nicht leisten, Traurigkeit zu verspüren, denn sie brauchte diese Reise, um Wut wiederaufleben zu lassen. Nein, keine Wut – die allein genügte nicht, um sie aufrechtzuerhalten, wenn sie allein, erschöpft und zudem auch noch verwundet war. Sie brauchte eine Quelle des Zorns, eine Waffe, die in den Jahren des Kampfes gegen das Böse geschärft worden war. Sie kämpfte für Frauen, die nicht in der Lage waren, für sich selbst einzutreten.