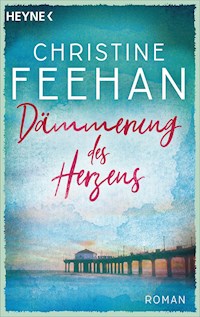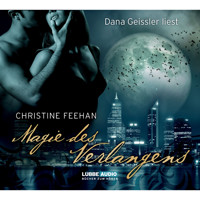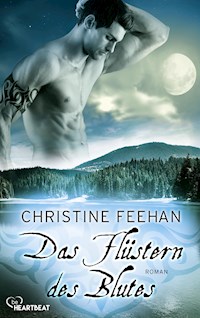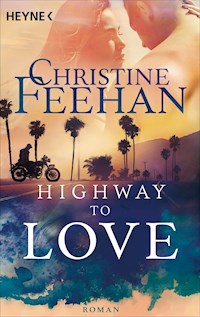11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Leopardenmenschen
- Sprache: Deutsch
Der vierte Teil der großen Saga um die Leopardenmenschen
Ein düsteres Geheimnis liegt über Sarias Familie: Ihre Brüder durchstreifen nachts als »Geisterkatzen« die Sümpfe von Louisiana. Und auch Sarias eigene Verwandlung steht kurz bevor – doch davon will Saria nichts wissen. Erst als sie dem charismatischen Drake begegnet, kann sie ihr Erbe nicht mehr länger leugnen. Denn er erkennt sofort die Gestaltwandlerin in ihr – und die ihm bestimmte Gefährtin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Christine Feehan
Feuer der Wildnis
ROMAN
Ins Deutsche übertragen von Ruth Sander
Titel der amerikanischen OriginalausgabeSAVAGE NATURE
Aus dem Amerikanischen von Ruth Sander
Redaktion: Sabine Kranzow
Copyright © 2011 by Christine Feehan
Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN: 978-3-641-07057-1
www.heyne-magische-bestseller.de
Für meine Mutter, Nancy King.
Es vergeht kein Tag, an dem ich sie nicht vermisse.
1
Der Sumpf kannte vier verschiedene Jahreszeiten undinnerhalb dieser Jahreszeiten wechselte seine Stimmung. In dieser Nacht trug die Natur ein Kleid aus Purpur mit den unterschiedlichsten Schattierungen, die von den dunklen Wirbeln am Himmel bis zum helleren Lavendel der Zypressen reichten. Der Mond beschien die Moosschleier, die auf das Wasser herunterhingen, und verlieh ihnen einen blassen silberblauen Schimmer. Dass die Farbe Purpur sich aus einer Mischung von Blutrot und Blau ergibt, bewiesen auch die dunkelroten Strahlen, die durch die Bäume drangen und auf die mit Entengrütze bedeckte Wasseroberfläche fielen.
Saria Boudreaux lächelte, als sie vorsichtig aus ihrem Propellerboot stieg und auf den Hochsitz kletterte, den sie sich langsam über Tage hinweg aufgebaut hatte, um die wilden Tiere ringsherum nicht zu stören. Sie war am Rande des Sumpfes aufgewachsen und nirgendwo war sie glücklicher. Der Hochsitz stand neben einem Eulennest, von dem ihr hoffentlich Nachtaufnahmen gelängen, denn solche Fotos waren heiß begehrt und brächten ihr womöglich noch mehr Geld ein. Nach und nach verschaffte ihr das Fotografieren eine wachsende Unabhängigkeit vom Familiengeschäft, wie sie das nie für möglich gehalten hatte.
In der Schule hatte sie ziemliche Probleme gehabt – für sie eine elende Zeit –, bis sie die Welt der Fotografie kennenlernte. Den größten Teil ihrer Kindheit hatte sie damit verbracht, sich unbeaufsichtigt im Sumpf herzumzutreiben, zu fischen, die Krebsreusen zu beobachten, ja sogar mit ihrem Vater Alligatoren zu jagen, wenn ihre Brüder gerade nicht da waren – und das war meistens der Fall. Sie war es nicht gewohnt, dass man sie gängelte, und die Schule empfand sie als zu strukturiert, zu reglementiert. Sie konnte nicht atmen, wenn so viele Menschen um sie herum waren. Um den vielen Vorschriften aus dem Wege zu gehen, wäre sie schon beinahe in die Wildnis abgetaucht, da hatte ein wohlmeinender Lehrer ihr eine Kamera in die Hand gedrückt und ihr vorgeschlagen, ein paar Fotos von ihrem geliebten Sumpf zu machen.
Heute Nacht gab es etwas Mondlicht, also würde sie den schwachen Scheinwerfer nicht brauchen, den sie in den letzten Nächten benutzt hatte, um die Aktivitäten im Nest sichtbar zu machen. Die Babys piepsten aufgeregt, als ein Elterntier angeflogen kam, und Saria drückte auf den Auslöser. Sofort zuckte der elektronische Blitz auf. An das gelegentliche grelle Aufleuchten gewöhnt ließen die Vögel sich nicht weiter stören.
Saria hatte genau den Moment erwischt, in dem die Eule auf dem Nest gelandet war und Krallen und Schnabel sich vor dem dunklen Himmel abzeichneten, und ihr Herz hüpfte vor Freude. Die Musik, die der Sumpf bei Nacht mit seinen Klängen dazu erzeugte, war völlig anders als bei Tag. Das Bellen der Alligatoren ließ buchstäblich die Erde erbeben. Um sie herum war alles in Bewegung – ob in der Luft, unter den Füßen, im Wasser oder in den Bäumen. Selbst der Rhythmus der Natur veränderte sich, sobald die Sonne unterging. In letzter Zeit dachte sie manchmal, dass sie vielleicht zu viel Zeit in den Sümpfen verbrachte, denn ihre Nachtsicht war so viel besser geworden, dass sie es hin und wieder auch ohne Kamerablitz bemerkte, wenn eins der Elterntiere mit seiner Beute zurückkehrte.
Plötzlich erregte ein flackerndes Licht ihre Aufmerksamkeit. Offensichtlich ein Wilderer, oder jemand, der in Fenton’s Marsh beim Nachtfischen war. Weite Teile des Sumpflands gehörten der Fenton Lumber Company. Sieben der Familien, die in der Gegend lebten, hatten jeweils mehrere Tausend Quadratmeilen gepachtet, auf denen sie jagten, Fallen stellten und fischten, sodass sie fast ausschließlich vom Sumpf leben konnten. Einige der Männer verdienten sich auch etwas Geld am Mississippi, so wie Sarias Brüder, doch im Grunde kreiste das Leben um den Sumpf.
Fenton’s Marsh galt bei den Leuten als Sperrgebiet und als tabu. Saria fiel ihre eigene finstere Miene bei der Vorstellung auf, dass irgendjemand dort wilderte. Jake Fenton, der ursprüngliche Eigentümer, genoss in der Gegend hohes Ansehen. Es war nicht leicht, das Vertrauen und den Respekt der Einheimischen zu gewinnen, doch alle Familien hatten den alten Mann gemocht und ihn oft zu sich eingeladen. So war er in den Sümpfen zu einer festen Größe geworden. Mehr als einmal hatten die Alligatorjäger ihn sogar mit auf die Jagd genommen, ein großes Privileg, denn die Arbeit war gefährlich und ein Laie war dabei nicht gern gesehen. Bei den Pachtverträgen war er sehr großzügig gewesen, deshalb hätte keiner hier seine Lebensgrundlage riskiert, indem er die Hand biss, die ihn fütterte. Fenton war mittlerweile tot, doch jeder wusste, dass es in der Marsch Öl gab und dass sein Urenkel Jake Bannaconni es eines Tages fördern würde. Deshalb hielt man sich aus Respekt vor Jake Fenton von der Marsch fern.
Die erwachsene Eule flog wieder davon, das Rascheln ihrer Flügel lenkte Saria kurz ab, doch von weiteren Fotos ließ sie lieber ab. Die Lichter im Sumpf machten sie nervös, und sie wollte nicht, dass der Kamerablitz sie verriet. Sie veränderte ihre Position, um die verkrampften Muskeln im Oberschenkel zu lockern, und fasste beinahe unbewusst nach ihrer Ausrüstung. Eigentlich hatte sie vorgehabt, die Nacht im Sumpf zu verbringen und erst frühmorgens wieder nach Hause zurückzukehren, aber aus ihrer leichten Nervosität war regelrecht Angst geworden, und es gab nicht viel, wovor sie Angst hatte.
Saria war gerade dabei, vom Hochsitz herunterzuklettern, als sie einen rauen Schrei hörte. Er kam von einem Menschen. Der Schrei eines Mannes, und er hörte sich grässlich an, ganz heiser – voller Entsetzen. Sofort wurde der Sumpf lebendig, Vögel zeterten, während Frösche und Insekten verstummten, und in dem rhythmischen Einklang, der normalerweise in dieser Welt herrschte, brach ein Chaos aus. Dann endete der qualvolle Schrei abrupt, wie abgeschnitten.
Kalte Schauer liefen über Sarias Rücken, und sie ließ sich leise in ihr Boot gleiten. Ob es einem Alligator gelungen war, den Mann, der ihn jagte, zu töten? Als sie sich in den Teppich aus Entengrütze hinausschob, dröhnte ein wütendes Gebrüll durch den Sumpf. Das zornige Schnauben und Fauchen hallte im Zypressenhain wider und die Welt um sie herum erstarrte, alle Wesen waren wie gelähmt. Sogar die Alligatoren schwiegen. Sarias Arm- und Nackenhaare richteten sich auf, eine Gänsehaut überlief sie und sie schnappte erschrocken nach Luft.
Ein Leopard. Sie kannte die Legenden und Mythen über Leoparden im Sumpf. Wenn Cajuns davon berichteten, wie sie eine der scheuen Kreaturen gesehen hatten, dann nannten sie sie »Geisterkatzen«. Einige Naturforscher bezweifelten ihre Existenz. Andere glaubten, es handele sich um Florida-Pumas aus den Everglades, die nach neuen Revieren suchten. Doch Saria kannte die Wahrheit und wusste, dass sie alle falschlagen.
Am ganzen Körper zitternd blieb sie einfach im Boot sitzen und fasste nach dem beruhigenden Messer an ihrem Gürtel. Dieses Messer trug sie seit ihrem zehnten Lebensjahr, dem Jahr, in dem sie die Wahrheit entdeckt hatte. Vorsichtig zog sie das Gewehr aus seiner Haltevorrichtung und vergewisserte sich, dass es einsatzbereit war. Mit zehn hatte sie mit dem Schießen begonnen und aus ihr war eine perfekte Schützin geworden – was für ihren Vater bei der Jagd unschätzbar wertvoll gewesen war. So war sie in der Lage, jenes kleine, nur centstückgroße Ziel im Nacken eines Alligators jedes Mal mit tödlicher Sicherheit zu treffen.
Saria befeuchtete die plötzlich trocken gewordenen Lippen, wartete mit klopfendem Herzen im Dunkeln und betete, dass die Bäume und Wurzeln sie verbargen. Der leichte Wind trug ihre Witterung weg von Fenton’s Marsh. Das Gebrüll verklang in der Nacht und das Schweigen schien stundenlang anzuhalten. Das große Raubtier musste noch in der Nähe sein – die Nacht war viel zu ruhig.
Jahrelang hatte sie versucht, sich einzureden, dass sie lediglich unter Alpträumen litt, und am Ende hätte sie das vielleicht sogar geglaubt, bis sie das hier gehört hatte – dieses Brüllen. Es folgte ein heiseres Krächzen, dann ein sägendes Husten. Saria schloss die Augen, presste die Finger an die Schläfen und biss sich fest auf die Unterlippe. Diese Laute waren unverkennbar. Man konnte sich vieles schönreden, aber das nicht. Wenn man sie einmal gehört hatte, konnte man sie nicht mehr vergessen. Und sie hatte diese Laute bereits gehört, als sie noch ein Kind war.
Remy, ihr ältester Bruder, war sechzehn gewesen, als sie zur Welt kam und galt als Mann. Als sie laufen konnte, arbeitete er schon am Fluss, genau wie Mahieu. Die Jungen gingen zur Schule und hinterher zur Arbeit, während ihre Mutter langsam von einer schleichenden Krankheit hinweggerafft wurde und ihr Vater sich immer weiter in die Welt des Alkohols zurückzog. Als sie zehn war, war ihre Mutter längst gestorben und ihr Vater gab kaum mehr ein Wort von sich. Remy, Mahieu und Dash waren mit der Armee in Übersee und auch Gage war gerade Soldat geworden. Lojos mit seinen achtzehn Jahren führte den Laden und die Bar praktisch allein und ihm blieb meist gerade mal Zeit, um sich auf dem Weg zur Arbeit hastig einen Happen Essen zu schnappen.
Für Haus und Angelleinen war sie verantwortlich gewesen und von dieser Zeit an stromerte sie auf eigene Faust im Bayou herum. Die Jungen waren für ein kurzes Wiedersehen nach Hause gekommen und schon wieder unterwegs, zurück zum Dienst. Dabei hatten sie Saria kaum wahrgenommen, sie aßen zwar das Essen, das sie ihnen hinstellte, schenkten der Tatsache, dass sie es gekocht hatte, jedoch keine weitere Beachtung. Sie hatte sich verzweifelt nach Aufmerksamkeit gesehnt und fühlte sich fremd und ausgeschlossen – eher traurig als verärgert, dass sie nicht richtig dazugehörte.
Die Nacht war warm und feucht gewesen, und sie hatte nicht schlafen können. Es kränkte sie, wie ihre Familie sie behandelte – so als ob sie gar nicht existierte, keine Beachtung verdiente. Sie hatte gekocht und geputzt und für ihren Vater gesorgt, doch wie er machten ihre Brüder sie anscheinend dafür verantwortlich, dass ihre Mutter immer tiefer in Depressionen gesunken und schließlich gestorben war. Sie hatte ihre Mutter nicht gekannt, als sie noch jene lebhafte Frau gewesen war, an die sich alle erinnerten; sie war zu jung gewesen, als ihre Mutter starb. Mit ihren zehn Jahren war sie neidisch auf den Zusammenhalt ihrer Brüder und fühlte sich irgendwie ausgegrenzt. Sie war aufgestanden und hatte das Fenster geöffnet, um die tröstenden Geräusche des Sumpfes hereinzulassen – eine Welt, auf die sie sich stets verlassen konnte, eine, die sie liebte. Für sie war es wie ein Lockruf.
Saria hatte eigentlich gar nicht gehört, wie ihre Brüder das Haus verließen, denn sie bewegten sich alle unheimlich leise – und das von klein an –, aber als sie in ihrer Enttäuschung und Verletztheit aus dem Fenster gestiegen war, um in der Natur Trost zu suchen, wie sie es in Hunderten von Nächten getan hatte, beobachtete sie, wie die Jungen im Wald verschwanden. Sie folgte ihnen in einiger Entfernung, damit sie sie nicht hörten, und fühlte sich dabei sehr mutig und ein wenig überlegen. Ihre Fähigkeiten im Sumpf waren schon damals beeindruckend, und sie war stolz darauf, dass es ihr gelang, ihre Brüder unbemerkt zu verfolgen.
Dann war die Nacht zu einem surrealen Alptraum geworden. Ihre Brüder hatten ihre Kleidung abgelegt. Sie hatte in einem Baum gesessen, mit den Händen vor dem Gesicht, und sich gefragt, was sie vorhaben mochten. Wer zog sich denn freiwillig im Sumpf seine Sachen aus? Als sie durch die Finger gespäht hatte, waren ihre Brüder schon mitten in der Verwandlung gewesen und ihre Muskeln hatten sich grotesk verzerrt, obwohl sie später zugeben musste, dass alles recht schnell und reibungslos vonstattengegangen war. Dann hatte Fell ihre Körper überzogen und schon waren sie zu entsetzlich echten Leoparden geworden. Es war einfach – es war schrecklich gewesen.
Damals hatten ihre Brüder dieselben Geräusche von sich gegeben, die sie heute Nacht gehört hatte. Dieses Schnauben. Und dieses heisere, krächzende Husten. Sie hatten sich auf die Hinterbeine gestellt und mit ihren Krallen die Bäume zerkratzt. Die zwei kleinsten hatten sich gestritten und sich in einen hitzigen Kampf gestürzt, bei dem sie sich mit den Pranken schlugen. Da hatte der größte Leopard wütend gebrüllt und jedem einen so heftigen Schlag versetzt, dass sie beide über den Boden rollten und mit dem Gezänk aufhörten. Das markerschütternde Brüllen hatte ihr das Blut in den Adern gefrieren lassen. Sie war den ganzen Weg zurück nach Hause gerannt und hatte sich mit klopfendem Herzen unter den Laken versteckt, voll Angst, dass sie möglicherweise dabei war, den Verstand zu verlieren.
Leoparden waren die scheuesten aller Großkatzen und Gestaltwandler waren noch scheuer, sie verheimlichten ihre Fähigkeiten sogar vor ihrer Familie, jedenfalls vor den Familienmitgliedern, die sich nicht verwandeln konnten – so wie Saria. Sie hatte versucht, etwas über Gestaltwandler in Erfahrung zu bringen, doch in der Bücherei stieß sie nur auf obskure Andeutungen. Also hatte sie sich eingeredet, dass sie sich das Ganze nur eingebildet hatte, aber es gab noch weitere Hinweise, die sie nun nicht mehr ignorieren konnte, jetzt, da sie ihre Brüder so gesehen hatte.
Wenn ihr Vater betrunken war, redete er oft wirres Zeug, und immer, wenn er seltsame Anspielungen auf Gestaltwandler machte, spitzte sie die Ohren. Sicher gab es so etwas gar nicht, aber manchmal erwähnte ihr Vater beiläufig, dass er sich eigentlich frei bewegen sollte, so wie es seine Bestimmung sei. Dann torkelte er ins Bett und am nächsten Morgen gab es an der Hauswand oder sogar in seinem Zimmer Kratzspuren. Bis Saria wach wurde, war er dann meist schon dabei, das Holz abzuschleifen und frisch zu versiegeln. Wenn sie ihn fragte, woher die Kratzer stammten, gab er ihr keine Antwort.
Und nun hockte sie mitten im Sumpf, die Dunkelheit als einzigen Schutz, in dem Wissen, dass so ein Leopard ein listiges Raubtier war, und nicht aufgeben würde, bis er sie erwischt hätte. Sie konnte nur hoffen, dass er die paar Blitze ihrer Kamera nicht bemerkt hatte und nicht kam, um nachzusehen. Es schien Stunden zu dauern, bis der natürliche Rhythmus des Sumpfes sich wieder einstellte, die Insekten erneut mit dem Summen begannen und jene beruhigenden, wenn auch nicht tröstenden Geräusche erklangen, zum Zeichen, dass das Leben weiterging.
Saria blieb ganz still sitzen und wartete, bis die schreckliche Anspannung nachgelassen hatte. Die Geisterkatze war fort. So viel war sicher. Sofort verließ sie den Schutz des Zypressenhains und fuhr hinüber zu Fenton’s Marsh. Ihr Mund war trocken, ihr Herz klopfte vor lauter Angst vor dem, was sie vorfinden mochte, doch sie konnte es einfach nicht lassen.
Der Tote lag halb im Wasser und halb an Land, gleich am Rande der Marsch. Sie kannte den Mann nicht. Er schien zwischen dreißig und vierzig zu sein, sein lebloser Körper war voller Blut. Er hatte eine Stichwunde im Bauch, doch gestorben war er an einem erstickenden Biss in die Kehle. Die Biss- und Kratzspuren waren deutlich zu erkennen. Das Wasser um ihn herum war blutgetränkt und lockte Insekten und Alligatoren an.
Saria schlug kurz die Hände vor die Augen, denn es machte sie ganz krank, dass sie keine Ahnung hatte, was sie tun sollte. Zur Polizei konnte sie nicht gehen. Remy arbeitete in der Mordkommission. Er war die Polizei. Sollte sie etwa ihre eigenen Brüder anzeigen? Würde man ihr überhaupt glauben? Vielleicht hatte der Tote irgendetwas Furchtbares getan, sodass einer ihrer Brüder keine andere Wahl gehabt hatte.
Langsam fuhr Saria nach Hause, machte beklommen ihr Boot fest und trat auf den Steg. Sie blieb einen Moment stehen und musterte das Anwesen. Die Bar war dunkel, das Haus und der Laden ebenso, aber ihre inneren Sensoren, die sie schon von klein auf wahrnehmen konnte, warnten sie, dass sie nicht allein war. Entschlossen, ihren Brüdern aus dem Wege zu gehen, lief sie um das Haus herum. Als sie gerade die Hintertür öffnen wollte, wurde diese plötzlich aufgerissen und ihr ältester Bruder stand breit im Rahmen, ein attraktiver, dunkelhaariger Mann mit ernsten, aufmerksamen grünen Augen. Vor lauter Schreck trat Saria unwillkürlich einen Schritt zurück. Sie wusste, dass er den Hauch von Angst in ihrem Blick gesehen hatte, ehe sie ihn verbergen konnte.
Remy kniff die Augen zusammen und atmete tief ein, als wollte er ihren Geruch analysieren. Dann schluckte er herunter, was immer ihm auf der Zunge gelegen hatte. Statt barscher Ungeduld lag Besorgnis in seiner Stimme: »Bist du verletzt?« Er streckte die Hand nach ihr aus, um sie ins Haus zu ziehen.
Mit klopfendem Herz wich Saria so weit zurück, dass sie außerhalb seiner Reichweite war. Remy runzelte die Stirn und rief laut: »Mahieu, Dash, kommt doch mal her.« Er sah sie unverwandt an, ohne auch nur einmal zu blinzeln. »Wo bist du gewesen, cher?« Sein Tonfall verriet, dass er eine Erklärung verlangte.
Er wirkte einfach riesig. Saria schluckte und weigerte sich, sich einschüchtern zu lassen. »Warum willst du das plötzlich wissen? Das hat dich doch sonst nicht interessiert.« Betont lässig zuckte sie die Achseln.
Sie hörte sie nicht kommen – ihre Brüder bewegten sich praktisch ohne jedes Geräusch –, doch mit einem Mal standen Mahieu und Dash Schulter an Schulter hinter Remy. Sie sah, wie die beiden sie musterten und jede Regung ihres zweifellos kreidebleichen Gesichts registrierten.
»Hast du dich mit jemandem getroffen, Saria?«, fragte Remy sanft – viel zu sanft. Da sie eine Bewegung machte, als ob sie davonlaufen wollte, fasste er sie beim Arm und hielt sie ebenso sanft fest.
Seine freundliche Ansprache hätte Saria beinah zum Weinen gebracht, doch sie wusste, dass Remy innerhalb von Sekunden von sanft auf gefährlich umschalten konnte. Schließlich hatte sie mehr als einmal mit angesehen, wie er Verdächtige verhörte. Die meisten waren auf seine sanfte Tour hereingefallen. Sie wünschte, er ginge wirklich so freundlich und fürsorglich mit ihr um, doch bis vor Kurzem hatte ja keiner ihrer Brüder sie überhaupt richtig zur Notiz genommen.
Saria machte ein finsteres Gesicht. »Das geht dich nichts an, Remy. Solange ich klein war, hat es euch nicht interessiert, was ich tue und lasse, und jetzt brauchen wir nicht so tun, als hätte sich daran etwas geändert.«
Remy war bestürzt. Sie sah es ihm an, ehe er sich gefasst hatte und wieder das ausdruckslose Remy-Gesicht aufsetzte. Seine Augen waren hart und kalt geworden, ein Anblick, der ihren Puls noch weiter in die Höhe trieb. »Was denkst du dir dabei, mir so etwas zu sagen, wo wir dich doch praktisch aufgezogen haben? Natürlich machen wir uns Sorgen, wenn du die halbe Nacht wegbleibst.«
»Ihr habt mich also aufgezogen?« Saria schüttelte den Kopf. »Das hat niemand getan, Remy. Du nicht, und Dad auch nicht. Und jetzt bin ich etwas zu alt dafür, sollte irgendeiner von euch plötzlich auf die Idee verfallen, sich darum zu sorgen, was ich tue. Nur zu deiner Information, da du ja so verdammt viel über mich weißt, ich gehe fast jede Nacht in den Sumpf, und zwar seit meiner Kindheit. Wie zum Teufel konnte dir das entgehen, bei all den Sorgen, die du dir um mich gemacht hast?«
Dash musterte ihr Gesicht. »Bist du da im Bayou auf irgendwas gestoßen, Saria – oder auf irgendjemand?«
Ihr Herz machte einen Satz. War das etwa eine Falle? Möglicherweise eine Fangfrage. Sie wich noch einen Schritt zurück. »Wenn mir jemand dumm kommt, kann ich mir schon selbst helfen, Dash. Warum interessiert ihr euch plötzlich alle so für mein Leben?«
Remy rieb sich den Nasenrücken. »Wir sind deine famille, cher. Wenn du Probleme hast …«
»Habe ich nicht«, unterbrach sie ihn. »Was soll das alles, Remy? Wirklich. Ihr habt mich nie gefragt, wo ich gewesen bin oder ob ich allein zurechtkomme. Manchmal war ich tagelang allein in der Bar. Keiner von euch hat jemals darüber nachgedacht, ob das gefährlich sein könnte, obwohl ich noch nicht volljährig war.«
Ihre drei Brüder wechselten lange, zerknirschte Blicke. Dann zuckte Remy die Achseln. »Mag sein, Saria, aber wir hätten es tun sollen. Ich war sechzehn, als du geboren wurdest, und da sticht einen eben der Hafer, cher, ich dachte nur an mein Vergnügen. Du warst noch ein Baby. Also habe ich wahrscheinlich nicht so auf dich geachtet, wie ich es hätte tun sollen, aber das heißt nicht, dass du mir egal wärst. Die Familie ist alles.«
»Während euch alle der Hafer gestochen hat, habe ich mich Nacht für Nacht um einen betrunkenen Vater gekümmert. Rechnungen bezahlt, den Laden geführt, gefischt. Und so weiter. Erwachsene Dinge getan. Alles am Laufen gehalten, damit ihr euren Spaß haben konntet.«
»Wir hätten dir mit Pere wirklich mehr helfen sollen«, gestand Remy.
Saria zwinkerte, denn erstaunlicherweise schossen ihr die Tränen in die Augen. Remy konnte so nett sein, wenn er wollte, aber warum gab er sich gerade jetzt so viel Mühe? Sie riskierte einen schnellen Blick auf die Gesichter ihrer anderen Brüder. Sie betrachteten sie sehr konzentriert. Völlig reglos. Ihre Augen waren beinahe bernsteinfarben geworden und die Pupillen weit geöffnet. Saria brauchte jedes Quäntchen Mut, das sie aufbringen konnte, um sich nicht auf dem Absatz umzudrehen und wegzulaufen.
»Jetzt bin ich erwachsen, Remy. Und es ist etwas zu spät, um damit anzufangen, dir über meine Lebensführung Gedanken zu machen. Außerdem bin ich müde und würde gern schlafen gehen. Ich sehe euch dann morgen früh.« Nur wenn sie es nicht vermeiden konnte.
Remy trat zur Seite. Saria bemerkte, wie alle tief einatmeten, als sie an ihnen vorbeiging, offenbar versuchten sie, aus den Duftspuren, die sie an sich hatte, schlau zu werden. Sie roch nach Sumpf, aber den Toten hatte sie nicht angerührt, sie war nur so nahe herangegangen, dass sie ihn im Licht ihrer Taschenlampe betrachten konnte.
»Schlaf gut, Saria«, wünschte Remy.
Sie schloss ganz kurz die Augen. Schon diese kleine Geste brachte ihre Nerven wieder zum Flattern.
Sechs Monate später
Der Wind seufzte leise, ein unheimlicher, klagender Laut. Eine Schlange glitt von den tief hängenden Ästen eines Tupelobaumes, klatschte auf das dunkle Wasser und schwamm, eine Wellenlinie hinter sich herziehend, davon. Am Himmel brodelten schwarze Wolken, schwer von Regen, in der Abendhitze.
Saria kletterte aus der Piroge auf den wackligen Steg und atmete tief ein, dabei schaute sie sich vorsichtig um und musterte das Ufer und das kleine Wäldchen, durch das sie gehen musste. Vor einigen Jahren hatte einer der Farmer hier eine Tannenschonung angelegt, doch das Weihnachtsbaumgeschäft war nie richtig gediehen, ganz im Gegensatz zu den Bäumen selber. Die Stadt, so klein sie auch war, war mittlerweile bis an die Grenze der Schonung herangewachsen, und die Mischung aus Zedern, Kiefern und Fichten war wunderschön, aber dabei so dicht gewachsen, dass hinter dem Zypressenhain am Ufer eine Art Wald entstanden war.
An den knorrigen Ästen der Zypressen am Fluss hingen lange silbrige Geflechte aus Moos, die sich sanft im Wind wiegten. Der Hain war recht groß, und in dem grauen Nebel, der ihn wie ein zarter Schleier durchzog, wirkten die Bäume am Ufer unheimlich und geisterhaft. Dahinter ragten die kräftigeren Tannen auf wie schweigsame, finstere Wächter. Saria lief es eiskalt über den Rücken, als sie so auf den hölzernen Planken stand – ein gutes Stück entfernt von der Zivilisation.
Am Fluss wurde es meistens schnell dunkel, und sie hatte mit der Fahrt zum Festland gewartet, bis ihre Brüder fort waren und zuvor hatte sie noch nach den Angelschnüren und Krebsreusen gesehen. Den ganzen Weg über kam es ihr schon so vor, als würde sie verfolgt. Sie war so nah wie möglich am Flussufer geblieben. Falls irgendjemand – oder etwas – hinter ihr her war, hätte er oder es mühelos Schritt halten und sie sogar überholen können. Ihre Brüder hatten das große Boot genommen und ihr nur die alte Piroge gelassen, was ihr in der Regel nichts ausmachte, doch irgendetwas Unsichtbares im Dunkeln trieb sie zur Eile.
In letzter Zeit fühlte sie sich unbehaglich und rastlos, wie gefangen in einer Hülle, die zu eng zu werden schien. Ein Juckreiz überfiel sie von Zeit zu Zeit, so als ob sich unter ihrer Haut etwas bewegte. Ihr Kopf erschien zu groß und Mund und Kiefer schmerzten. Alles fühlte sich irgendwie falsch an, und vielleicht trug das dazu bei, dass das ungute Gefühl, beobachtet zu werden, immer stärker wurde.
Saria seufzte, befeuchtete die trockenen Lippen und zwang sich, den ersten Schritt in Richtung Tannenschonung zu machen. Sie hätte auch um das Wäldchen herumgehen können, doch das kostete Zeit, die sie nicht hatte. Ihre Brüder würden bald zurückkehren und böse werden, wenn sie ihre Schwester schon wieder dabei erwischten, dass sie allein unterwegs gewesen war. Die Jungen waren in letzter Zeit genauso reizbar wie sie und hatten sich leider angewöhnt, sie ständig zu überwachen. In den letzten Wochen hatte das so schlimme Formen angenommen, dass Saria sich bald so fühlte, als wäre sie im eigenen Hause gefangen.
Sie ging los und griff zur Sicherheit nach dem Messer an ihrem Gürtel. Falls tatsächlich irgendjemand – oder etwas – sie verfolgte … sie war vorbereitet. Lautlos lief sie über den engen Pfad, der durch das Wäldchen zu der alten Kirche führte.
Hinter ihr, ein Stück weiter links, knackte ein Ast, ein Geräusch, das in der Stille des Waldes überlaut wirkte. Sarias Herz begann zu hämmern. Der Nebel wurde mit jeder Minute dichter und zog langsam einen Schleier vor die dunklen Wolken und den silbernen Mond, was seine Sichel in einem seltsamen, unheilschwangeren Rot leuchten ließ. Saria legte einen Zahn zu und lief hastig an den unterschiedlichen Bäumen vorbei.
Sobald sie aus der Schonung trat, stand sie auch schon auf dem Gehweg, der quer durch die kleine Stadt am Mississippi führte. Eine große Staumauer half, Überschwemmungen zu verhindern. Auch ein Großteil des Landes war aufgeschüttet worden, um vor Hochwasser sicher zu sein. Schnell passierte Saria den Uferpfad, während der Wind Wellen gegen die Mauern und Pfeiler trieb. Wieder sah sie sich vorsichtig um, ohne dabei langsamer zu werden. Die Kirche lag direkt vor ihr, und sie konnte es kaum erwarten hineinzukommen.
Obwohl es Abend war, war es sehr heiß und schwül, das hieß, dass es bald regnen würde. Saria spürte, wie Schweißperlen zwischen ihren Brüsten herunterrannen, wusste aber nicht, ob es an der drückenden Hitze oder nur an ihrer Angst lag. Als sie die Stufen, die zur Kirche führten, erreichte, stieß sie einen Seufzer der Erleichterung aus. Sie hielt am Treppenabsatz inne, um ihr Haar mit dem Spitzenschal zu bedecken, der ihrer Mutter gehört hatte, drehte sich um und überblickte die Straße. Malerische Gaslaternen, die im Nebel in einem seltsamen Gelb leuchteten, erhellten sie. Saria spürte, wie Augen auf ihr ruhten, konnte aber nirgends jemanden entdecken, dessen besonderes Interesse ihr galt.
Sie kehrte der Straße den Rücken und stieg die Stufen empor. Der stechende Blick, den sie zwischen ihren Schulterblättern spürte, sorgte dafür, dass sich ihre Nackenhaare aufstellten. Mit klopfendem Herzen zog sie die Tür auf und trat ein. Im Innern der Kirche herrschte nur schwaches Licht. Schatten hingen an den Wänden und bildeten dunkle Täler zwischen den verwaisten Bänken. Saria tauchte die Finger ins Weihwasser und bekreuzigte sich, dann ging sie langsam zum Beichtstuhl. Die Standbilder starrten mit traurigen, leeren Blicken auf sie herab. Seit sie die erste Leiche gefunden hatte, war sie mehrfach in der Kirche gewesen, doch sie schaffte es nicht, ihr Geheimnis zu verraten – nicht einmal Vater Gallagher –, und nicht einmal jetzt, nachdem sie noch zwei gefunden hatte.
Sie fühlte sich schuldig, natürlich, obwohl sie versucht hatte, Hilfe zu holen, doch das hatte sie nur in Gefahr gebracht. Nun war der Priester ihre einzige Hoffnung – falls sie diesmal den Mut fand, sich ihm anzuvertrauen. Saria wartete, bis sie an der Reihe war, schloss die Beichtstuhltür und kniete sich auf das bereitgestellte Polsterbänkchen. Dann senkte sie den Kopf.
Das Zwielicht und das Gitter in der Trennwand des düsteren Beichtstuhls hinderten Vater Gallagher daran, das Pfarrkind zu erkennen, das soeben in die kleine Kabine gekommen war. Ein Hauch von Lavendel und wildem Honig verriet ihm, dass es sich um eine Frau handelte. Der Duft war sehr schwach, doch in der drückenden Hitze des Beichtstuhls eine willkommene Abwechslung nach all dem Schweißgeruch, der manchmal fast Übelkeit erregend war.
»Vater«, wisperte eine Stimme.
Alarmiert von dem verzweifelten Unterton beugte der Pfarrer sich vor. Im Laufe der Jahre hatte er gelernt, echte Angst zu erkennen.
»Ich bin’s, Saria«, fuhr die Stimme fort.
Vater Gallagher kannte die junge Frau von Kindesbeinen an. Sie war klug und intelligent und neigte nicht zu Fantastereien. Er hatte sie immer als fröhliches, hart arbeitendes Mädchen gekannt, vielleicht zu hart arbeitend. Sie stammte aus einer großen Familie, wie viele der Cajuns, die in seine Kirche kamen, doch vor einigen Jahren hatte sie aufgehört, zum Gottesdienst und zum Beichten zu gehen. Seit ungefähr sechs Monaten kam sie nun wieder zur Beichte – aber nicht zur Messe –, und zwar regelmäßig einmal die Woche, jedoch ohne irgendetwas Wichtiges zu bekennen, das sie plötzlich dazu bewogen haben könnte, in den Schoß der Kirche zurückzukehren. Ihr Flüstern brachte ihn auf den Gedanken, dass es vielleicht einen anderen Grund gab, der sie zu ihm trieb.
»Alles in Ordnung, Saria?«
»Ich muss Ihnen einen Brief geben, Vater. Er darf nicht in dieser Gemeinde in die Post gelangen. Das habe ich schon versucht, und er ist abgefangen worden. Man hat mich bedroht. Können Sie ihn irgendwie anders hier herausbringen?«
Vater Gallagher war besorgt. Saria musste in großen Nöten sein, wenn sie ihn um etwas Derartiges bat. Aus seiner langjährigen Erfahrung wusste er, dass die Menschen im Bayou und an den Ufern des Flusses in großen Familien lebten, in denen man hart arbeitete und seine Sorgen meistens für sich behielt. Saria musste verzweifelt sein, wenn sie sich an ihn wandte.
»Bist du zur Polizei gegangen?«
»Ich kann nicht. Und Sie auch nicht. Bitte, Vater, tun Sie’s einfach und vergessen Sie’s dann wieder. Sagen Sie es nicht weiter. Sie können niemandem trauen.«
»Remy ist doch Polizist, nicht wahr?« Vater Gallagher wusste, dass Sarias ältester Bruder vor Jahren zur Polizei gegangen war. Er verstand ihr Zögern nicht, doch ihm schwante Böses. Seine Frage blieb unbeantwortet. Vater Gallagher seufzte. »Gib mir den Brief.«
»Ich brauche Ihr Wort als Mann Gottes, Vater.«
Der Priester runzelte die Stirn. Das Mädchen neigte auch nicht zum Übertreiben. Diese seltsame Unterhaltung war völlig untypisch für jemanden mit einem so sonnigen Naturell. Saria war nicht besonders furchtsam. Und sie hatte fünf sehr große Brüder, die wahrscheinlich jedem, der ihr zu nahetrat, bei lebendigem Leib die Haut abgezogen hätten. Aus den einstmals raubeinigen, kräftigen Halbstarken waren großartige Männer geworden. Vater Gallagher konnte sich nicht erklären, warum Saria sich nicht an Remy wandte, der seit dem Tod des Vaters vor ein paar Jahren das Familienoberhaupt war.
»Muss ich mir Sorgen um dich machen, Saria?«, fragte er noch leiser und presste das Ohr ans Gitter. Bei jedem anderen hätte er die Situation für absurd und lächerlich erklärt, doch Saria musste er ernst nehmen.
»Draußen im Bayou geht etwas Schlimmes vor, Vater, aber die Polizei kann ich nicht rufen. Wir brauchen jemand anders. Wenn Sie diesen Brief hier herausschmuggeln können, ohne dass einer davon erfährt, kann dieser Jemand sicher etwas unternehmen. Bitte, Vater Gallagher, tun Sie mir den Gefallen.«
»Ich verspreche, dass ich niemandem davon erzähle, es sei denn«, betonte der Pfarrer, »ich halte es für nötig, um dein Leben zu retten.«
Wieder blieb es eine Weile still. Dann raschelte Papier. »Das ist eine faire Abmachung. Bitte seien Sie vorsichtig, Vater«, flüsterte Saria und schob einen flachen Umschlag durch die Gitteröffnung. »Niemand darf Sie damit sehen. Weder in der Gemeinde noch in der Stadt. Sie müssen ihn weit wegbringen, ehe Sie ihn in die Post geben.«
Als Vater Gallagher den Brief entgegennahm, stellte er fest, dass der Umschlag versiegelt war. »Bete drei ›Gegrüßet seist du, Maria‹ und das Vaterunser«, trug er Saria leise auf, um sie daran zu erinnern, dass sie weiterhin so tun musste, als ob sie gebeichtet hätte, selbst wenn sie gar keine Sünden zu bekennen hatte. Dann wartete er, doch Saria sagte nichts mehr, also segnete er sie und steckte den Umschlag in seine Robe.
Saria bekreuzigte sich und verließ den Beichtstuhl, ging in die erste Reihe und kniete sich vor den Altar. Auch einige andere Mitglieder der Gemeinde hielten sich in der Kirche auf, und sie schaute sich verstohlen um, um zu sehen, ob jemand davon ihr gefolgt sein könnte. Aber niemand kam ihr verdächtig vor, auch wenn das nichts heißen wollte. Die meisten Menschen, die sie kannte, gingen zur Kirche und konnten ihren Besuch ähnlich begründen wie sie.
Ganz in der Nähe steckten die Lanoux-Zwillinge gerade Kerzen an. Dion und Robert hatten kürzlich ihre Großmutter verloren, was ihre Anwesenheit hinreichend erklärte. Beide hatten einen untersetzten, kräftigen Körperbau und dichte, schwarze Locken. Die attraktiven Männer galten in der Gemeinde als Frauenhelden, doch Saria hatte die Erfahrung gemacht, dass sich hinter den forschen Draufgängern echte Gentlemen verbargen, und sie mochte die zwei.
Armande Mercier saß neben seiner Schwester Charisse in der vorletzten Reihe und wartete unruhig, während Charisse andächtig betete. Ihr Kopf war gesenkt, ihre Augen geschlossen und ihre Lippen bewegten sich, doch zweimal, als Armande tief aufseufzte und sich den Hemdkragen lockerte, warf sie ihm einen scharfen Blick zu. Armande blickte zu Saria herüber und dann schnell wieder weg, was untypisch für ihn war, denn er war der wahrscheinlich größte Schürzenjäger weit und breit. Saria fand ihn selbstsüchtig, aber charmant, und er wachte fürsorglich über seine Schwester, der Saria sehr nahestand. Sarias Brüder spendierten Armande oft ein Bier, wenn er in ihre Bar kam; sie hatten Mitleid mit ihm, weil er sich um eine tyrannische Mutter und eine extrem scheue Schwester kümmern musste.
Die zwei älteren Damen weiter hinten waren Saria ebenso bekannt wie der ältere Mann, Amos Jeanmard, der in einer Ecke saß und seinen Spazierstock neben sich stehen hatte. Sie war mit seiner Tochter Danae zur Schule gegangen und kannte auch seinen Sohn Elie, der ein paar Jahre älter war. Sie kannte alle, so wie die anderen sie kannten. Alles Angehörige einer der sieben Familien, die am Rande des Sumpfes lebten, und sie waren immer gute Freunde und Nachbarn gewesen. Saria war in ihren Häusern ein und aus gegangen und zu Gast auf ihren Hochzeiten und Beerdigungen gewesen. Die anderen unterstützten sie, indem sie im Geschäft ihrer Familie ihre Angelausrüstung und ihre Lebensmittel kauften. Viele von ihnen waren Stammkunden in dem kleinen Laden und der Bar, die der Familie Boudreaux gehörten. Doch nun jagten sie ihr Angst ein. Sie war ja sogar schon so weit, dass sie Angst vor ihrer eigenen Familie hatte.
Saria machte das Kreuzzeichen und verließ die Kirche; sie wollte fort sein, ehe Vater Gallagher aus dem Beichtstuhl kam, denn sie wusste nicht, ob sie ihm gegenübertreten konnte, ohne alles zu verraten. Sie fühlte sich unter Druck, ganz aufgewühlt in der Magengegend. Leichtfüßig lief sie die Treppe hinunter und machte sich auf den Weg zum Steg, an dem sie ihr Boot vertäut hatte.
Die Nacht schien ihr noch dunkler zu sein, die Schatten länger und so als ob sie nach ihr haschten, während sie auf den kleinen Wald zueilte, um die Abkürzung zu nehmen. Als sie dem schmalen Pfad durch die dichte Schonung folgte, sträubten sich ihre Nackenhaare, eine Gänsehaut überzog ihre Arme und ihr schauderte. Leise fluchend zögerte Saria, fast hätte sie kehrtgemacht und wäre zu den nebelverhangenen Lichtern der Stadt zurückgelaufen. Doch wie auf Kommando setzte der Regen ein und im Nu hatten die warmen Tropfen sie völlig durchnässt. Der Wolkenbruch trieb Saria tiefer in den Wald, wo das Baumkronendach ihr möglicherweise etwas Schutz bot. Sie eilte über den Pfad, stets wachsam, ob ihr innerer Warnradar auf irgendetwas reagierte.
Plötzlich bewegte sich ein großer Schatten in den Bäumen. Saria schlug das Herz bis zum Hals. Irgendetwas in ihr schien sich zu rühren und für einen kurzen Moment nach außen zu drängen, sodass sie das Gefühl hatte, sich kratzen zu müssen. Ihre Haut spannte und der Kiefer schmerzte. Auch ihre Hände taten weh. Als sie an sich herunterschaute, sah sie, dass sie zu Fäusten geballt waren und ihre Nägel sich in die Handflächen bohrten. Da hörte sie hinter sich ein leises Schnaufen und ihr wurde eiskalt. Der Fluchtweg zurück zur Stadt war offenbar abgeschnitten. Ihr Puls raste derart, dass er in ihren Ohren dröhnte, und sie rang nach Luft.
Vorsichtig ging Saria weiter auf den Steg zu und zog das Messer aus ihrem Gürtel. Der Griff lag beruhigend in ihrer Hand und sie umklammerte ihn wie einen Talisman. Sie musste doch nicht die eigenen Brüder fürchten, oder? Ihr Mund wurde trocken.
Saria versuchte, auf jedes Geräusch zu hören, während sie weiterging, doch ihr eigener Herzschlag und ihr Keuchen veranstalteten einen so schrecklichen Lärm, dass er alles andere übertönte. Wehende Schleier aus Spanischem Moos schufen eine unheimliche, gespenstische Atmosphäre. Die verdrehten, knorrigen Äste der Bäume ragten wie Geisterhände in die Dunkelheit. Nie hatte sie sich in den Wäldern am Fluss gefürchtet, nie vor Alligatoren oder dem nächtlichen Sumpf Angst gehabt. Sie war stets vorsichtig, wie ihr Vater es sie gelehrt hatte, aber nun hatte sie das kalte Grausen gepackt.
Sie wusste, dass sie nicht rennen durfte, denn das hätte den Jagdinstinkt des Leoparden geweckt, doch unwillkürlich beschleunigte sie ihre Schritte und ging so schnell wie möglich durch den strömenden Regen, ohne tatsächlich zu laufen. Plötzlich hörte sie ein Geräusch wie von einem vorbeifahrenden Güterzug. Dann traf sie etwas von hinten, mit einer solchen Wucht, dass es sich anfühlte, als würden ihre Knochen zermalmt. Ein schweres Gewicht warf sie um und drückte sie so fest in den Boden, dass ihre Hände unter ihr begraben wurden und das Messer, das sie immer noch fest umklammert hielt, völlig nutzlos war. Sie spürte einen heißen Atem im Nacken und spannte kampfbereit die Muskeln an. Doch der Angreifer war viel zu schwer, um ihn einfach abzuschütteln. Sie bekam die Knie nicht angewinkelt, und in dem Moment, in dem sie sich zu wehren begann, bohrten sich Zähne in ihre Schulter.
Saria öffnete den Mund, um zu schreien, schluckte aber nur einen Haufen Dreck. Mit Tränen in den Augen wartete sie auf den Tod. Tatzen fassten sie fest an den Hüften, eine Warnung, sich nicht zu bewegen, deshalb hielt sie ganz still. Dann regte sich nichts mehr, also sah Saria sich ganz langsam um. Der Leopard schob sich vor und brachte seinen Kopf so nah an ihren heran, dass sie ihm direkt in die gelbgrünen Augen sehen konnte. Sein Blick war weit offen und starr, voll Intelligenz – und er warnte sie. Heißer Atem streifte ihre Haut.
Als der große Raubtierkopf immer näher rückte, schauderte Saria. Und als das Maul aufging, schloss sie die Augen, weil diese schrecklichen Zähne sich gleich um ihren Hals schließen würden. Da strich die raue Zunge über ihr Gesicht und leckte ihr die Tränen ab. Saria schnappte nach Luft, dann spürte sie ein Brennen den Rücken hinab, das ihr die Kleider aufschlitzte. Wieder schrie sie und versuchte, den Leoparden abzuschütteln. Doch er bohrte ihr seine Krallen in die Haut und zog vier tiefe Kratzer über ihren Rücken, von den Schulterblättern bis zur Taille.
Ihr war, als erwachte tief in ihr etwas Wildes. Ein Adrenalinstoß rauschte wie eine Droge durch ihre Adern und verlieh ihr Kraft und Energie, eine unglaubliche Stärke. Sie bäumte sich auf und schaffte es, die Beine so weit anzuziehen, dass sie gerade genug Platz hatte, um sich ein wenig zu drehen. Gleichzeitig riss sie das Messer hoch und zielte auf die Halsschlagader des Raubtiers.
Der Leopard riss die Vorderpfote hoch, drückte sie mit seinem schweren Körper zu Boden, packte mit den Fingern, die zu Sarias Entsetzen aus den großen Pranken kamen, nach ihrem Handgelenk und presste ihren Arm zurück in den Matsch. Diese menschliche Hand, die aus dem Leopardenkörper wuchs, machte ihr die größte Angst. Das war grotesk und falsch und alles andere als romantisch, wie sie als kleines Mädchen gedacht hatte. Doch gleichzeitig regte sich etwas in ihr, das ihre Angst beiseitefegte und sie zornig aufbegehren ließ.
Wütend starrte sie den Leoparden an. Irgendetwas in ihrem Innern war hell empört, dass er es wagte, sie anzufassen. Ihre Haut juckte und der Kiefer tat weh. Ihr ganzer Körper schmerzte, wahrscheinlich wegen des heftigen Stoßes, mit dem das Raubtier sie zu Boden gerissen hatte.
»Mach schon«, stieß sie hervor, und versuchte, nicht zu schluchzen, während sie vor Angst und Zorn bebte. »Tu’s einfach.«
Der Leopard hielt sie mit seinen dicken Pranken nieder und ließ seinen Atem wieder über ihren Nacken streifen. Saria schloss die Augen und wartete auf den tödlichen Biss. Anders als die meisten Großkatzen zogen Leoparden es vor, ihre Opfer bei der Kehle zu packen, bis die Beute erstickt war. Zögernd, beinahe widerwillig, gab das große Raubtier sie frei. Sie spähte unter ihren Wimpern hervor und sah, wie es sich langsam aufrichtete, eine leise Tatze nach der anderen, ohne sie auch nur eine Sekunde aus den gelbgrünen Augen zu lassen.
Saria wagte es nicht, sich zu rühren, sie hatte Angst, das Tier erneut zu reizen. Noch lange nachdem es im Nebel verschwunden war, lag sie zitternd am Boden und ließ ihren Tränen freien Lauf. Das Aufsetzen tat sehr weh, ihr Rücken stand in hellen Flammen, doch der Regen linderte den heißen Schmerz. Die Bisswunde an ihrer Schulter blutete. Im Sumpf waren Infektionen lebensbedrohlich. Einen Arzt konnte sie nicht aufsuchen, und wenn sie zur treateur ging, der Heilerin bei den Cajuns, was sollte sie dann sagen? Dass sie im Zypressenhain direkt vor der Stadt von einem Leoparden angefallen worden sei? Die Frau würde sie ins Irrenhaus schicken.
Saria saß im Regen und lauschte. Die normalen Geräusche der Nacht hatten schon wieder eingesetzt, und was immer sich in ihr geregt hatte, es hatte sich gelegt. Einige lange Minuten blieb sie noch im strömenden Regen sitzen und weinte. Plötzlich krampfte ihr Magen, sie erhob sich mühsam auf Hände und Knie und musste immer wieder würgen.
Sie war eine Boudreaux, von Geburt an hatte man ihr eingebläut, Außenstehenden nicht zu trauen. Ihre Familie hatte Geheimnisse, und sie war von der Welt abgeschnitten. Natürlich konnte sie den Fluss verlassen – aber ein anderes Leben kannte sie nicht. Wo sollte sie hingehen? An wen konnte man sich wenden? Langsam hob Saria den Kopf und sah sich um.
Dies war ihre Heimat: der wilde Fluss, die Bayous und Seen, die Sümpfe und Marschen. In der Stadt bekam sie keine Luft. Mit dem Ärmel wischte sie sich den Dreck aus dem Gesicht, und die Bewegung jagte eine Stichflamme über ihren Rücken, setzte ihre Schulter in Brand. Wieder spürte sie ihren Magen. Saria unterdrückte ein Schluchzen und schob sich mit zitternder Hand auf die Füße. Sie war erschöpft. Sie stolperte zurück zum Steg, jeder Schritt fiel ihr schwer. Sie sorgte sich, ob der Leopard irgendetwas in ihrem Rücken zerbrochen hatte.
Saria kam nur mit Mühe in die Piroge und holte mehrmals tief Luft, ehe sie nach der Stange griff, mit der sie das Boot abstoßen musste. Bei jeder Bewegung brannten ihre Rückenmuskeln wie Feuer. Als sie das flache Boot vom Steg wegschob, schaute sie zum Hain zurück und ihr Herz setzte einen Schlag lang aus. Rote Augen starrten durch den Nebel. Er beobachtete sie immer noch. Sie lenkte das Boot in die Strömung, ließ sich von ihr flussabwärts tragen und erwiderte den Blick trotzig. Plötzlich verschwanden die roten Augen und für einen Moment sah sie die große Katze in weiten Sprüngen durch die Bäume jagen, in den Sumpf.
Um eher zu Hause zu sein als sie? Glaubte sie wirklich, dass einer ihrer Brüder sie verletzen würde? Dass einer von ihnen ein Serienmörder war? Vor drei Monaten hatte sie eine zweite Leiche gefunden und nun eine dritte. Sie hatte versucht, den Brief selbst abzuschicken, doch er war am Boden ihrer Piroge wieder aufgetaucht, was sie beinahe zu Tode erschreckt hatte. Ihre Brüder waren harte Kerle, allesamt durchaus fähig zu töten, falls nötig. Aber mutwillig? Tötete einer von ihnen zum Spaß? Saria schüttelte den Kopf; sie wollte das nicht für möglich halten. Nur sprach alles dafür … Vielleicht sollte sie es einfach allen sagen, wenn sie zusammen waren, einfach damit herausplatzen, dass sie Leichen gefunden hatte, dann sah sie es womöglich an den Reaktionen.
Während des restlichen Heimweges schaffte sie es nicht mehr, weiter darüber nachzudenken. Zum Rudern und Staken brauchte man Rückenmuskeln und ihr Körper protestierte bei jeder Regung. Es interessierte sie nicht einmal mehr, ob der Leopard die Abkürzung durch die Sümpfe genommen hatte, um vor ihr zu Hause zu sein. Am Steg lagen mehrere Boote vertäut und Musik schallte über das Wasser. Ein paar Männer standen vor der Bar, doch keiner von ihnen bemerkte Saria, als sie mit ihrer Piroge anlegte.
Die Bar war geöffnet, das hieß, dass zumindest einer ihrer Brüder dort sein musste. Gern hätte sie kurz hineingeschaut, einfach um zu sehen, wer es war, weil derjenige dann aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen werden konnte, doch sie wollte das Risiko nicht eingehen, dass irgendjemand sie sah.
Das Wohnhaus lag versteckt in Bäumen, die es auf drei Seiten umgaben, etwas weiter hinten am Fluss. Früher hatten die Bäume Saria Trost gespendet, als Kind war sie oft hinaufgeklettert und hatte die Welt von oben betrachtet. Nun suchte sie die Äste hektisch nach Hinweisen auf eine Großkatze ab und ging um das Haus herum zur Hintertür, in der Hoffnung, keinem ihrer Brüder zu begegnen, falls noch welche zu Hause waren.
Es brannte kein Licht. Lauschend blieb Saria auf der Treppe stehen. Manchmal schien ihr Hörvermögen besser zu sein, so als würde ein Schalter umgelegt, genau wie bei ihrer Nachtsicht. Doch im Moment hörte sie nichts als ihr eigenes mühsames Atmen. Sie schlich sich ins dunkle Haus, ohne sich damit aufzuhalten, das Licht anzuknipsen, und versuchte kein Geräusch zu machen, während sie durch die kleinen Zimmer in ihr Bad ging.
Saria zog ihre zerrissene Jacke aus und untersuchte die klaffenden Risse, ehe sie sich aus ihrer blutgetränkten Bluse schälte. Dann hielt sie die traurigen Überreste in die Höhe und betrachtete die Zerstörung, die nur von den Krallen einer Raubkatze stammen konnte. Das viele Blut und das Weinen machten sie ganz krank. Saria knüllte die Bluse zusammen, warf sie ins Waschbecken und stellte sich rücklings vor den bodentiefen Spiegel. Das Glas war an einigen Stellen gesprungen, doch als sie über die Schulter schaute, sah sie die Kratzer, die ihre Haut überzogen. Sie wirkten sehr rot und entzündet – anscheinend war mit einer Infektion zu rechnen.
Saria berührte die Bisswunde an ihrer Schulter und brach in Tränen aus. Dann stieg sie zitternd in die Dusche, ließ das heiße Wasser über ihren Körper laufen und wusch sich das Blut ab, obwohl Rücken und Schulter fürchterlich brannten. Als ihr die Knie weich wurden, sank sie zusammen, weinte auf dem Boden der Duschkabine weiter und ließ ihre Tränen vom Wasser fortspülen.
Ohne Rücksicht auf die brennenden Rückenwunden zog sie die Knie an und umschlang sie. Warum hatte der Leopard sie nicht umgebracht? Mit Sicherheit wusste er, dass sie die Toten gefunden hatte. Sie holte tief Luft, um sich nicht übergeben zu müssen. Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte, ihr war nur klar, dass sie sich abschrubben musste, um sich von dem fremden Geruch zu befreien, und dass sie ihre Kleider loswerden musste. Leoparden hatten sehr feine Nasen, und sie wollte Fragen vermeiden.
Saria zwang sich wieder aufzustehen. Dann nahm sie zögernd etwas von der Flüssigseife, um es sich über den Rücken zu schütten, und bearbeitete ihre Wunden mit einer Scheuerbürste. Sie musste mehrmals innehalten und tief atmen, um nicht ohnmächtig zu werden. Der Schmerz war unvorstellbar. Dann duschte sie ihren Rücken ab und wiederholte die Prozedur an der Schulter. Schließlich trocknete sie sich ab und suchte im Medizinschrank nach dem Jod.
Als die beißende Flüssigkeit in die Wunden an Rücken und Schulter drang, musste sie einen Schrei unterdrücken und in die Hocke gehen, den Kopf zwischen den Knien. Sie atmete tief ein und aus. Alles verschwamm vor ihren Augen, und die Galle kam ihr hoch, doch sie unterdrückte den Brechreiz mit eisernem Willen.
»Fils de putain«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und gab sich alle Mühe, nicht kopfüber auf dem Boden zu landen, während die Welt um sie herum schwarz wurde und weiße Punkte vor ihren Augen tanzten.
Saria brauchte mehrere Minuten, bis sie sich wieder gefangen hatte und in der Lage war, aufzustehen, ohne dass ihre Beine einknickten, auch wenn ihr Rücken mit stechenden Schmerzen protestierte. Sie atmete dagegen an und verband die Bisswunden an ihrer Schulter mit großer Sorgfalt. Für ihren Rücken konnte sie nichts tun, und ihr war klar, dass alles, was sie anzog, ruiniert werden würde, daher streifte sie nur ein altes T-Shirt und eine weiche Jogginghose über.
Sie konnte nicht einfach ins Bett gehen und sich unter der Decke verkriechen, sie musste die zerfetzten Kleider loswerden. Saria hob ihre Jacke auf und stopfte sie zur Bluse ins Waschbecken. Ihre Brüder würden das Blut riechen, wenn sie vor dem Wegwerfen nichts dagegen unternahm. Das Einzige, was ihr einfiel, war Bleichmittel über die Sachen zu kippen, was sie auch tat. Sie ließ alles einweichen und ging währenddessen Wasser und Aspirin holen.
Als sie ins Bad zurückkehrte, roch es penetrant nach Bleiche und Blut. Das würde so nicht funktionieren. Die Bleiche konnte den Geruch an ihren Kleidern zwar überdecken, doch ihre Brüder würden trotzdem Verdacht schöpfen. Saria spülte Bluse und Jacke aus und säuberte das Becken. Sie würde die Sachen nach draußen bringen und sie dort verbrennen.
Sie ging zur Hintertür hinaus, schlich durch den dichten Wald in den Sumpf, und versuchte dabei, ihre wirren Gedanken lange genug zu ordnen, um ihre Lage zu überdenken. Warum hatte der Leopard sie nicht umgebracht? Er wusste doch, dass sie die Leichen gefunden hatte. Wäre es nicht einfacher gewesen, sie zu töten? – Es sei denn, der Killer war einer ihrer Brüder und brachte es nicht fertig, ein Familienmitglied umzubringen.
»Saria! Wo zum Teufel steckst du, cher?«
Sie zuckte zusammen, als sie Remy von der hinteren Veranda rufen hörte. In letzter Zeit hatte er jede Nacht mehrmals nachgesehen, ob sie in ihrem Zimmer war.
Leise vor sich hin fluchend grub Saria hastig ein Loch und schob die Überreste ihrer Kleidung hinein. Sie musste antworten. Bestimmt hatte Remy ihre Piroge am Steg gesehen und würde sie suchen kommen. »Ich bin gleich da«, rief sie, während sie die Beweisstücke verscharrte. »Ich habe nur etwas Luft geschnappt.«
»Beeil dich, Saria, du solltest nachts nicht allein unterwegs sein.« Remys Stimme klang sehr sanft, wie immer. Das war typisch für ihn, doch unter der weichen Schale befand sich ein stahlharter Kern. Saria wusste, dass er ihr nachgehen würde, wenn sie nicht zum Haus zurückkehrte.
Sie wischte sich die Hände ab und richtete sich auf. »Ich komme gleich. Keine Sorge. Heute Abend bin ich hundemüde.«
Als sie vor dem Haus Stimmen hörte, schlich sie rasch nach drinnen und schloss ihre Zimmertür extralaut. Dann legte sie sich hin, auf den Bauch, und lag fast die ganze Nacht wach. Sie lauschte ihren Brüdern, und als deren Stimmen verklungen waren, gab es nur noch die tröstenden Laute des Sumpfes.
2
Die Sonne versank wie ein schmelzender Feuerball undverwandelte die dunklen Wasser des Mississippi in ein grellrotes Flammenmeer. Die Luft war schwer, beinahe erdrückend vor Feuchtigkeit, genauso wie er es mochte. Drake Donovon stieg lässig, aber elegant vom Schiff, bedankte sich mit erhobener Hand bei den Männern an Bord und blieb einen Augenblick auf dem Holzsteg stehen, um den breiten Strom zu bewundern. Die Schatten der Dämmerung in den Wellentälern sorgten für hübsche Kontraste und verliehen dem dahinplätschernden Fluss einen geheimnisvollen Reiz, der dazu verlockte, die abgeschiedenen Plätze entlang seiner Bahn zu erkunden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!