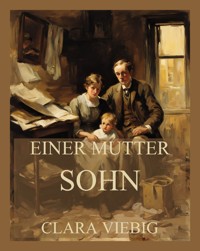Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anhand von Einzelschicksalen des klein- und mittelständischen Bürgertums wird die Berliner Geschichte zwischen 1848 und dem Beginn des Kriegs mit Österreich geschildert. –1848 gärt es in Berlin, es herrscht Unzufriedenheit im Volk, das vom König eine liberalere Verfassung fordert. Mittendrin der junge Schmied Hermann Henze, der sich auf die Seite der Aufständischen schlägt. Es kommt zu Aufruhr und Barrikadenbau, und am Ende hat die Märzrevolution viele Tote gekostet. Aber die Verhältnisse beruhigen sich wieder, und Henze übernimmt nach dem Tode des Meisters Schehle dessen Werkstatt und heiratet die verwitwete Meisterin, Johanna. Er etabliert sich als angesehener Handwerker seines Fachs, wird Hufschmied des Hofes. Wenn da nur nicht seine vielen Frauengeschichten und Saufgelage mit Kumpanen wären. Und im Hintergrund droht auch noch ein dunkles Familiengeheimnis.AutorenporträtClara Viebig (1860–1952) war eine deutsche Erzählerin, Dramatikerin und Feuilletonistin, die insbesondere der literarischen Strömung des Naturalismus zugerechnet wird. Aufgewachsen an der Mosel in Trier, verbrachte sie die meiste Zeit ihres Lebens in Berlin. Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre Werke zählten damals in den bürgerlichen Haushalten zur Standardbibliothek. Bekannt wurde die Autorin vor allem durch den Roman "Das Weiberdorf", der 1900 erschien. Die Stärke Viebigs liegt unter anderem in der äußerst komplexen, oft symbolhaft wirkenden Darstellung der spröden Landschaft und ihrer Bewohner. Ihre Werke wurden insbesondere ins Französische, Spanische, Englische, Italienische, Niederländische, Norwegische, Schwedische, Finnische, Tschechische, Ukrainische, Slowenische und ins Russische übersetzt, einige auch in Blindenschrift übertragen. Clara Viebig, die mit einem jüdischen Verleger verheiratet war und nach 1935 im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr publizieren durfte, geriet nach dem Krieg für lange Zeit in Vergessenheit und wird nun endlich wiederentdeckt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Das Eisen im Feuer
Roman
Saga
Von diesem Werk wurden dreissig Exemplare auf Büttenpapier gedruckt und von der Verfasserin gezeichnet
Erstes Kapitel
Um die Stadtmauer wehte der Frühling, und die Torwächter, die morgens die Tore aufschlossen: das Neue, das Oranienburger, das Hamburger, das Rosenthaler, Schönhauser, Prenzlauer, Königs- und Landsberger Tor, das Frankfurter, Stralauer, Schlesische, Köpenicker, Kottbusser, Wasser-Tor, das Hallische und Anhaltische, das Potsdamer und das Brandenburger Tor, wunderten sich, wie hübsch grün es schon draussen wurde. In der Stadt merkte man noch nichts vom Frühling. Die Rinnsteine freilich fingen an zu duften; aber das taten sie auch im Winter, wenn es gelinde Witterung war, unter den Rinnsteinbrücken das Eis schmolz und alles, was sich in Frosttagen da aufgestaut hatte an Abwässern und Unrat, überfloss auf den gepflasterten Bürgersteig.
Der Nachtwächter hatte die Nacht ausgepfiffen und war nach Hause gestolpert; die ersten Waschfrauen mit ihren Laternchen waren zur frühen Arbeit geeilt. Heute war Wochenmarkt. Die Torwächter mussten sich beeilen, dass sie die Bauern und Händler einliessen, die lange schon mit ihren Karren draussen gestanden hatten.
«Na, wird et nu bald?!» Die Harrenden, die gewohnt waren, geduldig zu warten, bis es den Torwächtern beliebte, fingen an zu murren.
Was, noch ungebärdig werden wollte so ein Kerl, so ein Mistfink? Was war denn seit einiger Zeit mit denen los?! Der Schlacht- und Mahlsteuerbeamte Piefke im grünen, blaukragigen Rock, dessen Amt am Halleschen darin bestand, wütend mit seinem Spiess auf geheimnisvolle Säcke loszustechen, zog verwundert die Brauen hoch. Nun ging’s gerade nicht eilig; er hätte ihnen am liebsten das Tor wieder vor der Nase zuschliessen lassen. Die Marienfelder, die Teltower, die Britzer, die fetten Tempelhofer besonders, die waren doch allemal die Unverschämtesten! Oder ob es an allen Toren so war? Weil sie jetzt solche Preise machen konnten, wurden sie frech. Sechs gute Groschen die Metze Kartoffeln, war so etwas schon dagewesen seit Menschengedenken? Denen schwoll der Kamm, und der arme Bürger musste zusehen, wie er sich und die Seinen sattkriegte!
In einer langen Reihe holperten die Karren durch die Tore ein. Die Hufe der kleinen Pferde klapperten, die Peitschen knallten; gesprochen wurde nicht viel. Durchs noch halb nächtlich-verschlafene Berlin zogen stumm-verdrossen die, die mit dem Morgengrauen hatten aufstehen müssen. Die Städter, die Berliner, die hatten’s gut, in den Federn lagen sie noch am hellichten Tag!
Die Läden der Fenster waren meist noch vorgelegt, die Haustüren geschlossen; kaum dass ein Bäckerjunge sich sehen liess, der, auf Lederpantinen faul schlorrend, die ersten Schrippen und Salzkuchen austrug und mit seinen schrillen Pfiffen unharmonisch die Morgenstille belebte. An dem hohen, graugestrichenen Holzkasten der Pumpe stand die Milchfrau; drei Blechkannen hatte sie auf dem niederen Ziehwägelchen, vor das zwei ruppige Hunde gespannt waren. Molly und Caro kannten das schon: hier machten sie immer Halt. Ihre Herrin nahm die zinnernen Deckel von den Kannen und liess aus der Pumpe Wasser hineinplätschern, bis so viel Milch in den Kannen war, wie sie für ihre Kunden brauchte.
An den meisten Strassenecken stand solch ein Brunnen, und er hatte immer Zuspruch: morgens die Milchfrauen, mittags die Lehrjungen, die ihrem Meister die Weisse tauften, abends die Mägde, die, anstatt Wasser in die Küchen zu tragen, sich hier mit ihren Liebsten verschwatzten. Und Hunderte und Hunderte von Sperlingen schwirrten stets mit lautem Geschilp um diese grauen Kästen, denn die Fuhrleute hielten hier an, um ihre Pferdeeimer zu füllen, und die Rosse liessen den ewig hungrigen Spatzen in ihren Äpfeln manches Körnlein zurück.
Und hungernd wie die Spatzen waren auch die Kinder der Strasse, denn es war eine Teuerung in der Stadt. Warum alles so teuer war, die Kartoffeln, das Brot, die allernötigsten Lebensmittel, das wusste eigentlich keiner zu sagen; die Ernte war doch ganz leidlich gewesen, wenigstens nicht viel schlechter als andere Jahre auch. Aber immer kleiner wurden die Brote, immer leichter von Gewicht; die Fünfgroschenschrippe wog längst ihre drei Pfund nicht mehr. Den ganzen Winter hatte man sich das so gefallen lassen, Mutter hatte den Kindern die Stullen eben kleiner geschnitten, Vater sich die tägliche Weisse abgewöhnt; man hatte gehofft, immer gehofft, mit dem Frühling musste es ja besser werden, dann würde es wieder mehr Arbeit geben.
Nun war es April. Auf dem Markt am Oranienburger Tor ging es lebhaft zu. Da standen die Kartoffelsäcke der Händler, gross und voll; und sie selber breit dahinter und zankten sich mit den feilschenden Weibern herum.
«Sechs Silber, keenen Sechser weniger!»
Was, noch immer sechs gute Groschen?! Man sah es den bleichen Gesichtern der Frauen an, dass ihnen daheim kein Huhn im Topfe kochte.
Die Weiber aus der Rosenthaler Vorstadt, dem ‚Voigtland‘, wo es schon zu fetteren Zeiten nicht üppig zuging, kauften hier. Von einem Stand zum andern irrten sie: war denn keiner billiger? Eine Metze Kartoffeln, das war ja so gut wie gar nichts. All die Mäuler! Der Mann, sechs Kinder, die grosse Tochter mit ihrem Balg auch noch, Grossvater, der nicht sterben konnte, aber noch essen wollte. Wenn das so weiterging, musste man sich hinlegen und verrecken, bezahlen konnte man die Kartoffeln nicht mehr!
In der Frühlingshelle des Marktplatzes schlich etwas umher, das sich sonst nur zeigt bei dunklen Nächten, in frostiger Kammer, wenn der Winterwind durch die Gassen faucht und die Wetterfahne des Kirchturms, rostig quietschend, angstvolle Musik macht.
Kartoffeln, Kartoffeln, man brauchte Kartoffeln! Der Mann prügelte, wenn er nicht satt wurde, die Kinder weinten. Die mageren Gesichter, die Arbeit und Entbehrung faltig gemacht hatten, legten sich in noch tiefere Falten. «Jotte doch, wie soll det noch werden!»
Eine legte sich aufs Bitten; sie hatte lange stumm dagestanden und ihr Geld gezählt: fünf Groschen mussten bleiben fürs Brot — aber dann hatte sie ja nur noch fünf für Kartoffeln! «Lasst Se mich doch für fünfe,» sagte sie leise, und es zuckte dabei wie Weinen um ihren Mund.
«Sechs Silber, keen Sechser jeht ab!» Der Händler blieb unerbittlich. «Unsereener will ooch leben!» Er war kurz angebunden. Und als sie noch immer stehen blieb, mit hungrigen Augen in den aufgebundenen Sack stierte, in dem die Kartoffeln, rund und rötlich, hochgetürmt lagen, und ganz obenauf ein paar schon gekochte, um zu zeigen, wie mehlig sie waren und schön aus der Schale geplatzt, da wurde er unruhig. «Jeht wo anders hin, da schenken se’t Euch!» Er lachte geärgert: was stand sie denn noch immer und versperrte anderen den Weg? «Macht Platz for die Herrschaften! Ankucken kost ooch ’n Sechser!» Er streckte die Hand aus, um sie beiseite zu schieben.
Da stiess sie seine Hand zurück. In ihrem eben noch so gedrückten Gesicht flammte etwas auf, sie hob den Fuss und trat mit aller Gewalt gegen den aufgebundenen Sack, dass er umstürzte, die Kartoffeln herauskollerten und sich wie ein Strom aufs Pflaster ergossen.
Der überraschte Händler bückte sich, er wusste nicht, sollte er mit beiden Armen seine stürzenden Kartoffeln auffangen oder die Freche packen. Er hatte nicht lange Zeit zum Überlegen. Seine Kartoffeln, seine teueren Kartoffeln!
Mit Gier hatten sich die Weiber darüber gestürzt; sie stiessen sich, sie pufften sich, sie sammelten auf. Was half ihm sein Schimpfen: «Bande verfluchte!», sein Schreien: «Pollezei! he, Pollezei!» — sie lachten ihn aus. Ein Johlen, ein Lärmen war plötzlich um ihn her, er fühlte sich von hinten gepackt, die Arme wurden ihm festgehalten, er kam von den Füssen, er wurde hingeworfen zu seinen Kartoffeln. Und ob er auch kämpfte, trat, spie, fluchte, brüllte, sich wieder aufraffte mit zerrissenem Kittel, mit blutender Nase, ein Dutzend Weiber hing an ihm. Mehr als ein Dutzend, weit mehr. ― ―
Wo waren sie nur alle so geschwind hergekommen? Es waren ihrer Hundert, viele Hunderte. Aus allen Strassenmündungen quoll es heraus, es überschwemmte den Platz. Weiber, Weiber, Weiber. Mit wehenden Haaren, mit verrutschten Hauben, mit klappernden Pantinen, mit flatternden Schürzen kam es geflogen wie Sturmwind, mit einem höllischen Lärm. Wer sich der brausenden Welle entgegenstemmte, wurde umgespült. Körbe voll Gemüse stürzten um, Kraut und Rüben lagen verstreut, mit Kartoffeln wurde geschleudert. Und Prügel gab’s. Dass Weiber so prügeln konnten!
«Kartoffeln, sechs Silber die Metze — siehste woll, jetzt kosten se jar nischt!» Mit Jauchzen und Lachen sammelten die Weiber ein. Keiner dachte mehr daran, sich zur Wehr zu setzen, man liess Säcke und Körbe im Stich, man rannte davon, um die Marktpolizei zu suchen.
Die Marktpolizei war nirgends zu sehen. Was sollte sie sich in so etwas mischen? So etwas war ungemütlich, und — wie sollte man sich denn dabei benehmen? Das beste war, man drückte ein Auge zu. Die Weiber würden sich schon wieder zufrieden geben; nur kein Aufhebens von so einer Sache gemacht, morgen duckten die Hauptschreierinnen wieder ruhig im Joch.
Es schlossen sich eine Menge Neugierige dem Weibertross an. Er hatte immer frischen Zuzug: Junge und Alte, Blonde und Weisshaarige, Frauen und Mädchen. Es waren auch manche ganz hübsche darunter, Mädchen mit schwenkenden Röcken und leichtem Gang, deren Augen noch Glanz hatten und Heiterkeit, die es nicht nötig gehabt hätten, nach Kartoffeln zu schreien: aber sie taten mit zum Spass. Die Sonne schien hell, die Luft war lind, es war angenehm, durch die Strassen zu streichen. —
Am Abend gaben die Weiber Ruhe. Die Polizei triumphierte: aha, jetzt waren sie’s müde! Es fiel zudem ein pladdernder Regen. Aber als am anderen Morgen die Sonne wieder lachte, ihre scharfen Strahlen den Matsch der Strassen aufleckten, da waren die Weiber auch wieder da. Und es waren ihrer noch viel mehr als am Tage zuvor.
Am Oranienburger Tor auf dem Markt gab’s keinen Sack, keinen Korb mehr, nicht Runk und nicht Strunk, da war reingefegt. Aber es gab ja noch andere Märkte, Berlin war gross. Und es wälzte sich schnell ein Haufe dahin, der andere dorthin. Rotten verteilten sich in die verschiedenen Stadtgegenden: Kartoffeln! Brot — ja, Brot, Brot!
Vor den Bäckerläden wurde Halt gemacht: Bäcker — Halunken! Ihre Brote schrumpften immer mehr ein, sie selber aber gingen immer mehr auf. «Wat, det soll ’ne Fünfjroschenschrippe sind? ’ne Zweejroschenschrippe höchstens. Legt ihr man uf de Wage, fix!»
«Dieb! Jierschlung! Bedrüjer!» Sie heulten laut auf, sie spuckten dem Bäcker ins erschrockene Gesicht, sie schnoben durch seinen Laden, sie langten sich die Brote von den Regalen und stopften sich die Taschen mit Semmeln voll.
Einen Widerstand hatte der Mann nicht gewagt, die Weiber waren ja nicht mehr allein, sie hatten sich Männer mitgebracht, Ehemänner, Liebste. Ein ganzer Schwanz zerlumpter Kerle hing an den Weiberröcken. Und mit Pfeifen lief muntere Strassenjugend vorauf, die mit Steinen Ladenfenster bombardierte und ein Vergnügen dran fand, wenn es recht klirrte.
Weh dem, dessen Brot zu leicht befunden ward! «Auf ihm!»«Haut ihm!» Und die Mehlkiste wurde aufgerissen, Sand und Asche hineingestreut, der Kot der Strasse hindurchgemengt. Der Bäcker musste noch Gott danken und stille sein, wenn sie ihm seine Ladeneinrichtung nicht zerschlugen, ihn nur sitzen liessen, ausgeräumt, ausgekratzt, so leer wie ausverkauft.
Aber wessen Brot richtig wog, vielleicht sogar noch ein halbes Lot mehr, der bekam ein Hurra. «Hoch, hoch, hoch!» Mit Kreide schrieb man’s an seine Tür: der hier war ein Ehrenmann. Und kein Haufe kam nach, der nicht diese Kreidebescheinigung respektiert hätte.
Es ging eigentlich ganz gemütlich zu. Wenn ein Polizist sich sehen liess, wurde er verulkt. Wenn er sagte: «Geht nach Hause, keinen Radau, oder ich schreibe euch auf,» dann lachte ihm ein keckes Weibsbild ins Gesicht: «Blauer, hab dir man nich!» Und wenn er nach ihr greifen wollte, husch, war sie weg. Die ganze Schar war auseinandergestoben. Nur irgend ein Knirps, dem noch der Hemdzipfel aus der Hose hing, blieb wohl zurück, stellte sich mitten auf die Strasse hin, legte die gespreizten fünf Finger an die schmierige Nase und zog das Maul breit in vergnügtem Grinsen.
Und doch fühlten die Bürger sich ungemütlich. Nicht nur Bäcker und Schlächter, nicht nur die ‚Materialisten‘ schlossen zu, legten vor ihre Ladenfenster die eiserne Querstange und verbarrikadierten von innen ihre Tür mit herangewälzten Fässern und aufgestapelten Kisten, auch der kleine Pfennigrentier, der weder auf Wucher lieh noch jemandem etwas schuldig war, der nichts zu verkaufen hatte als seine eigene Haut, fühlte geheimes Grausen. Er stöhnte und ächzte so im Schlaf, dass die besorgte Gattin ihn anstiess: «Krause, drückt dich die Leberwurst?»
«Nee, die nich!» Vor Angst schwitzend, zog sich Herr Krause die Nachtmütze tief über die Ohren. Horch, fiel da nicht ein Schuss?! Wenn die Canaille nun hier das Haus stürmte, ihn aus seinem guten Bette riss, sich selber hineinlegte neben Madame Krause?! Dann wurde er die Bande nur los, wenn er alles bot, was er an Bargeld im Hause hatte, und die zwei silbernen Kandelaber noch dazu, auf die er so lange gespart hatte, und die Alabasterschale unterm Trumeau, und die dicke Smaragdbrosche mit den passenden Ohrgehängen, die er Madame Krause zur silbernen Hochzeit verehrt hatte, und seinen Siegelring und ihren Longschal aus Persien!
Herr Krause verbrachte eine Nacht voller Schrecken, obgleich es auf der Strasse so still blieb, wie es alle Nächte in Berlin zu sein pflegte. —
Das war ja furchtbar, dagegen war das in Paris ja ein Kinderspiel gewesen! Herr Krause und Herr Schleefke, Herr Müller und Herr Pieseke, der Herr Geheime Kanzleisekretär Rosentreter und der Herr Kammergerichtsaktuarius Leisegang konnten gar nicht genug erzählen, was alles Entsetzliches geschehen war, als sie es gewagt hatten, am nächsten Tag in der Dämmerung mit ihren langen Pfeifen wieder am Stammtisch bei Pickenbach oder Clausing zur gewohnten Weissen zusammenzukommen.
Der ‚Beobachter an der Spree‘ brachte längst nicht alles, was sich zugetragen hatte in diesen Tagen; das ging ja auch gar nicht an, der Zensor hätte es nie passieren lassen. Und es war auch gut, dass man vertuschte, der Pöbel lernte sonst nur noch zu.
Eine Revolution, eine wirkliche Revolution! Die Pfeifen gingen ihnen darüber aus.
Der Herr Geheimsekretär wusste es ganz genau, man hatte einen Augenblick sogar daran gedacht, Kanonen auffahren zu lassen. Welches Glück, dass es den Kavallerie-Patrouillen, die endlich am vierten Tag der Polizei zu Hilfe kamen, gelungen war, die Empörer mit der flachen Klinge auseinander zu treiben. Aber an hundert Arrestanten sassen in der Hausvogtei, darunter siebzehn Frauenzimmer und ein Schlosserlehrling, ein Bengel, kaum sechzehn Jahre alt, der sich nicht entblödet hatte, das Militär Seiner Majestät, des Königs Militär mit Pflastersteinen zu werfen! Und — zu pfeifen!
Unter denen, die keine Angst gehabt hatten, die ruhig ihr Lädchen offen hielten und die kleine Schenkstube, die hinter dem Lädchen lag, war Christian Schulze. Es waren wohl johlende Burschen mit Weibern Arm in Arm durch die Schützenstrasse gekommen, aber im allgemeinen war das keine Laufgegend.
Fast wie Dorfhäuschen lagen die niedrigen Häuser hinter den beiden Reihen der Bäume, die jetzt eben anfingen, ihre Blattknospen zu schwellen, und um deren Stämme die Hühner, die aus den offenstehenden Türen der Höfe heraus auf die Strasse liefen, kratzten und scharrten. Stille Gegend. Freilich nur hundert Schritt, man brauchte nur um die Ecke zu biegen, und man war in der Friedrichstrasse, mitten drin im Leben der Stadt. Während in der Schützenstrasse nachmittags die Frauen einen Schemel herausholten, sich vor der Tür niederliessen mit ihrem Strickzeug oder für ihre Buben die Hosen flickten, eilte da die feine Welt von Berlin hin zu den Linden, her von den Linden. Feine Herren, in verschnürten Röcken, denen die Zeitungsverkäufer nachrannten und die zudringliche Schar der Blumenjungen: ‚Herr Baron, koofen Se mir doch ’n Bokett ab!‘ — ‚Herr Iraf, nee mir!‘ — Damen in Kiepenhüten, buntseidne Bindebänder unterm Kinn, am Arme des Gatten die Auslagen der Läden musternd — und am Abend jene, die sich selber mustern liessen.
Wenn Wilhelmine, Christian Schulzes Dritte, abends mit ihrer Freundin Luise Witte noch einen kleinen Spaziergang machte, guckte sie hier um die Ecke, und es schwindelte ihr fast: so viele Laternen! In der Schützenstrasse war es ganz dunkel; aber sie fühlte sich dort behaglicher. Die geputzten Damen erschreckten sie fast, und doch regte sich der Mädchenwunsch in ihr: wer sich doch auch einmal so fein machen könnte!
«Wenn du die Kledaschen anhättst, sähste noch tausendmal hübscher aus,» tröstete Luise. Luise war ganz verliebt in ihre Minne. Die schwarzbraunen Haare der Minne waren so viel glatter und glänzender, als ihre eigenen flachsblonden, und die sanften dunklen Augen so viel grösser als ihre eigenen hellgrauen. Von jeher hatte Luise Witte Wilhelmine Schulze bewundert. Sie waren zusammen in die Schule gegangen, zusammen eingesegnet worden. Nun hatte Minne noch Nähstunden und half der Mutter in der Wirtschaft, Luise aber ging morgens Kinder wickeln und nachmittags Windeln waschen. Sie war nicht sehr entzückt von dieser Beschäftigung, aber sie musste; ihre Mutter, die Witten, war eine gesuchte Persönlichkeit im Bezirk, sie hätte es nicht allein geschafft, den Neugeborenen, denen sie zum Licht verholfen hatte, auch noch weiter ihre Fürsorge angedeihen zu lassen.
Heute weinte Luise fast. «Ick jraule mir! Schonst wieder hat eine nach Muttern jeschickt. Die Frau von’n Tapezierer Hanke in de Kanonier. Ach, nu muss ich da morjen jewiss wieder wickeln jehn! Minne, ick sage dir, et is schauderhaft. Heirate du man ja nich! Denn verlierste deine schönen dicken Haare — se wer’n janz dünne — un die Zähne fallen dir aus. Nee, nur nich heiraten! Es laufen auch schonst viel zu viele Kinder in der Welt rum.» Sie seufzte. «Wenn’t ihrer weniger wären, würden die, die da sind, es besser haben!»
Minne wollte dagegen sprechen: warum nicht heiraten und Kinder kriegen? Ihre Mutter hatte sieben Töchter und hatte doch eine ganze Masse Haare unter der Haube, und hatte auch noch fast alle ihre Zähne. Aber als sie die Freundin seufzen hörte, schwieg sie und drückte nur teilnehmend deren Arm. Sie wusste es ja, gegenüber, bei Wittes, war das Glück nicht zu Haus: der Vater, der immer nur auf Gelegenheit zur Arbeit wartete, vertrank das meiste, was die Mutter verdiente, und wenn sie’s nicht hergab, drohte er mit Schlägen. Die Kinder hatten oft hungrig zur Schule gehen müssen. Und wenn die Luise sich mal verheiraten würde, wen sollte die da gross kriegen? Aber sie selber, Christian Schulzes Dritte?! Ihre älteste Schwester, die Male, hatte schon geheiratet mit siebzehn, den Kürschnermeister Siebert; die hatte nun einen dicken, strampelnden Jungen. Mieke, die dann an der Reihe war, war auch schon verlobt; ihr Bräutigam, August Lehmann, hatte eine Tischlerwerkstatt, sie würden bald heiraten. Und dann kam sie dran! Ein sanftes Rot zog über das hübsche Mädchengesicht. Was wohl Luise dazu sagen würde? Fast scheu sah Minne von der Seite die Freundin an: die war soviel klüger, soviel erfahrener, die kommandierte immer — aber, nein, in diesem Fall —!
Als ob Luise diese Gedanken erriete, sagte sie jetzt: «Die Männer taugen alle nischt. Du bist viel zu schade for die. Komm, ich wer dir was zeigen!» Und sie zog die Kleinere mit sich fort.
Arm in Arm huschten die Sechzehnjährigen an den Häusern entlang. Sie passierten ein Stückchen die hellerleuchtete Friedrichstrasse, aber geschwind bog die führende Luise dann in die Krausenstrasse ein; die war wieder dunkel und still. Und sie gingen sie links hinauf zum winkligen Plätzchen der Böhmischen Kirche.
«Nanu, was willste denn bei den Böhmackern?!» Minne zögerte: hier gingen sie doch sonst nie her, wenn sie spazierten. Es war hier besonders finster und still, fast unheimlich so am Abend.
Luise lachte leise in sich hinein, und dann zog sie die Freundin dicht an die Kirchwand heran und flüsterte, die Hand ausstreckend: «Siehste da? Stell dir man auf die Zehen, denn kannste ihr gut sehen!»
Im Schatten der Kirche, versteckt im Winkel, lag ein altes Haus. Es hatte ein niedriges Parterre. Und in einem der niedrigen Parterrefenster, das unverhängt war, sass ein Frauenzimmer. Alle anderen Fenster des Hauses waren nicht erleuchtet, dies eine war hell; es warf einen breiten Schein hinaus in die Nacht der Strasse. Auf dem Tischchen am Fenster stand eine Lampe, in ihrem vollen Licht sass eine Schöne und lächelte, und hinter ihr, an der verdämmernden Rückwand des tiefen Zimmers, zeigte sich deutlich ein rotgedecktes Bett.
«Det is der ‚Blechkopp,‘» flüsterte Luise.
Minne riss die Augen gross auf: wer? O, wie sah die aus!
Das metallisch schimmernde gelbe Haar trug die Person mit Schnüren von Wachsperlen durchwunden, lange gedrehte Locken und Troddeln von Perlen fielen ihr links und rechts auf den nackten Hals. Was sie für ein Kleid anhatte, sah man nicht; vielleicht sass sie im Unterrock da, man sah nur einen safrangelben alten Seidenschal, der die üppige Brust kaum zur Hälfte bedeckte.
«Siehste se?» wisperte Luise.
Minne nickte zitternd, eine Angst kam sie an, sie wusste nicht, vor was. «Was — was macht se denn da?» stotterte sie.
«Na,» erklärte Luise seelenruhig, «det siehste ja. Die sitzt da un wart’, bis die Männer zu ihr kommen.»
«Ob denn welche reinjehn zu ihr?» Der Kleinen stockte fast der Atem.
Die Freundin lachte auf. «Alle Dage, det kannste jlauben. Neulich hat ihr Mutter anjekriegt. ‚Na, Fräulein,‘ sagt se, hat se zu se jesagt, ‚Sie kriegen ja so ville Herrenbesuch, wat wollen die denn alle bei Sie?‘ Da hat se jesagt, janz dreiste: ‚Ick habe doch Joldfische zu verkaufen, det wissen Se noch nich?‘ Un hat jelacht, jelacht! Ja, so frech is die! Aber so sind die Männer!» Luise stiess einen wissenden Seufzer aus.
Minne seufzte nach. Sie wusste nicht, warum sie auf einmal traurig wurde, so traurig; es belastete etwas ihr sonst so leichtes Herz. Wie entsetzt starrte sie hin zu der, die da im Fenster sass und anlockte, und dann schlug sie die Augen nieder und senkte den Kopf tief.
«Komm nu,» sagte Luise und stiess die Versonnene an. «Nu wolln wir jehn. Was denkste denn?»
Aber Minne gab keine Antwort. Sie liess sich führen, die Augen schlug sie nicht auf.
Luise kicherte plötzlich, sie waren im Dunkel der Böhmischen Kirche mit jemandem zusammengerannt.
«Na!» sagte ungeduldig der grosse breitschulterige Mensch. Aber als er zwei junge Mädchengesichter erkannte, deren eines ihn ganz erschrocken ansah, bückte er sich ein wenig, um diese Gesichter genauer zu begutachten: die eine schien sommersprossig und hatte eine Himmelfahrtsnase, aber die andere —! «Pardon, die Mamsells,» sagte er plötzlich sehr höflich. «Verfluchte Finsternis! Beinah hätt’ ich Sie totgetreten. Entschuldigen Se!»
«Det wäre aber schade jewesen!» Luise war gleich bei der Hand. «Besonders um die Minne. Ich hätte schonst noch beizeiten jequietscht. Aber jut bei Fuss müssen Sie sein — alle Achtung — das ’s en Füsschen?»
Minne kniff die Ungezogene: wenn die doch still sein wollte! Aber der Mann lachte belustigt: «Sie haben ’n Mundwerk, Fräulein, potztausend!»
«Berliner Kind — mit’m Maul wie der Wind!»
Jetzt musste selbst Minne mitlachen, die Luise war doch zu komisch. Es machte sich wie von selber, dass der junge Mann neben ihnen herging.
Es war nicht schwer, miteinander bekannt zu werden, wenn Luise dabei war. Die führte das Wort. Und neugierig war sie, sie hatte es bald heraus, was das für einer war. Als sie zu der Laterne kamen, die an der Ecke der nächsten Strasse dunkelgelbliches Gaslicht spendete, sah sie, er trug einen blauen Leinenkittel, ein wenig angerusst und angefettet, und er selber war schwärzlich und baumstark und hatte Hände wie Schraubstöcke. Sie blinzelte ihn von der Seite an.
Er entschuldigte sich: sonst ging er nicht so am Feierabend, nicht so im Arbeitskittel, das brauchten die Mamsells nicht zu denken; aber er war heute erst spät in der Schlosserei fertig geworden, es hatte nicht mehr gelohnt, sich umzuziehen, er hatte nur mal eben noch einen kleinen Gang machen wollen, und für den — es kam eine leichte Verlegenheit in seine Stimme, aber mit einem lauten Auflachen schüttelte er diese Verlegenheit ab — für den Gang war der Kittel noch gut genug!
Eigentlich hatte er etwas Freches. Minne fand das: was lachte er denn so nichtsnutzig? Sie glaubte, ihn schon einmal gesehen zu haben, in der Zimmerstrasse, wie er da bei Schlosser Rummel in der Tür gestanden hatte, die Hände in den Hosentaschen. Er war so gross und stark! Verstohlen guckte sie zu ihm auf: er war aber doch ein gutmütiger Mensch! Er gefiel ihr besser als Males Kürschnermeister, auch besser als Miekes Tischler. Ein Schlosser also, ein Schlosser —?! Aber sie sprach kein Wort mit ihm, sie liess nur Luise mit ihm sprechen. Die schwatzte in einem fort.
Als sie mehrmals bis hin zur Schützenstrassenecke geschlendert waren und wieder zurück und die Mädchen dann endlich nach Hause mussten, weil von der Jerusalemer Kirche die Uhr dröhnte und des Nachtwächters dumpfe Stimme von ferne mahnte: «Zehn is die Glock!», wusste Wilhelmine Schulze, dass der grosse Schlosser Hermann hiess. Hermann Henze.
Und dass sie Schulzes Minne war, und dass man bei Christian Schulze hinterm Laden in der kleinen Stube ausser Weissbier auch Essen bekommen konnte, wenn man bescheidene Ansprüche machte, das wusste er nun auch.
Zweites Kapitel
Vater Schulze hatte heute auf seinem Plan, den er gleich vorm Tor, hinter der Mauer des Jerusalemer Kirchhofs, dicht am Upstall, wo die Tempelhofer Bauern ihr Vieh weiden, besass, den letzten Weisskohl geschnitten. Nun führte er den auf seiner Handkarre heim durchs Hallesche Tor, übers runde Loch des Belleallianceplatzes, an all den Kavallerieställen vorbei, die lange Friedrichstrasse hinunter.
Er hatte eine gute Ernte gehabt, schon vier alte Weinfässer voll Sauerkraut hatte seine Lene eingelegt; dies hier gab ein fünftes. Ja, sie verstand das ausgezeichnet, Schulzes Sauerkohl war beliebt und berühmt. Der Mann verzog schmunzelnd sein bäuerliches Gesicht. Auch die Schweinchen, die er hinten im Hof fettmachte, waren rund und versprachen so gute Schinken und Pökelfleisch, dass einem das Herz im Leibe lachen konnte. Aber er wurde doch gleich wieder ernst. Und wenn auch die Kartoffeln gut gelohnt hatten, und er sich besseren Erlös von Kraut und Kartoffeln versprechen durfte als Nachbar Schilling von seinem grösseren Stück, das er weit draussen bei Kriegersfelde mit Korn bebaute, es war doch keine erfreuliche Zeit, in der man jetzt lebte.
Seit der Krakeelerei im Frühjahr, seit dem Kartoffelkrieg, war’s nicht mehr so gemütlich in Berlin. Es wollte sich etwas vorbereiten, das fühlte selbst der einfache Bürgersmann, der sonst an nichts weiter gedacht hatte, als wie er seine Kinder grossziehen und in Ehren sein Stück Brot verdienen sollte. Aber was bereitete sich vor?!
Christian Schulze hielt einen Augenblick an; die Ladung war schwer, und der Gurt, den er, um besser mit seinem Karren das Gleichgewicht halten zu können, sich über den Nacken gelegt hatte, drückte ihn schmerzhaft. Er schlüpfte einen Augenblick aus dem Joch heraus, richtete den gebeugten Rücken gerade, pustete und nahm eine Prise.
Ja, ja, es war eine Zeit, ähnlich der von Anno dreizehn! Da hatte man auch so unter einem Druck hingelebt; aber das war doch ein anderer Druck gewesen, nicht so dumpf, man hatte gewusst, worunter man seufzte. Aber worunter seufzte man jetzt? Das war schwer zu sagen. Unter allerlei.
Christian Schulze hatte in seiner Wirtsstube einiges aufgeschnappt. Da war jetzt viel Zuspruch. Der grosse Schlosser, der Henze, der der Minne nachstieg, und August Lehmann, Mieken ihrer, die hatten Freunde, eine ganze Masse. Man musste es zugeben, feine waren darunter, es konnte einen wunder nehmen, dass einfache Handwerker solche Freunde hatten. Herren. Der eine von ihnen war ein Student mit langen Haaren. Und sie machten grossen Krach und räsonierten; man musste immer acht haben, dass die Tür vorn nach dem Laden geschlossen blieb, und die Ladentür nach der Strasse auch. Wenn einer da gerade vorbeigegangen wäre und hätte das gehört!
Schulze duckte sich und kroch wieder unter seinen Gurt. Langsam karrte er die schwere Last weiter. Ach, es war ihm gar nicht recht, dass der grosse Schlosser so oft kam! Der war ein Brausekopf, gleich mit der Faust aus der Tasche und mit dem Maul vorneweg. Das war kein Mann für die Minne. Überhaupt, wenn die auch was mitkriegte, so viel war es doch nicht, dass der Geselle sich hätte als Meister setzen können. Keine Versorgung! Verdriesslich runzelte Schulze die Stirn. Noch dazu jetzt bei solch unsicheren Zeiten! Und die Minne war überhaupt noch viel zu jung, und die dachte ja auch noch gar nicht an heiraten!
Das beruhigte den Vater von sieben Töchtern, seine Stirn glättete sich. Nun war er wieder der alte zufriedene Christian Schulze, der ein so behagliches Lachen hatte, ein Lachen, das ihn auch nicht verlassen hatte, als ihm die Witten ein kleines Mädchen nach dem andern hinhielt: «Ieses, Schulze, ick bin unschuldig dran, schonst wieder ’n Mädel!»
«Warum denn nich?! Bin ick janz zufrieden mit!» Und zu seiner Frau war er hineingegangen, die ein wenig ängstlich im Bette lag, und hatte ihren unsicher-fragenden Blick mit einem ganz strahlenden erwidert und hatte ihr die Wange geklopft: «Haste brav jemacht, Lene!»
War es denn nicht besser in diesen Zeiten, man hatte Mädels als Jungens? Wer weiss, was einem mit denen noch alles bevorstand?! Die Jugend von heute war ja ganz verrückt, die wollte sich nicht begnügen, wie es nun einmal war, die hatte lauter Sachen im Kopf, auf die ein ruhiger Bürgersmann von selber gar nicht gekommen wäre. Was sie nicht alles haben wollten! Der Student hielt immer Reden. Und sie regten sich auf dabei und kriegten rote Köpfe.
Schulze blieb auf einmal stehen, pustete und schlüpfte wieder vor unter dem drückenden Gurt. Recht hatten sie darin: der Bürger müsste auch einmal was sagen dürfen! Das Volk, das Steuern zahlt, sollte auch das Recht einer Stimme haben. Oho, der Untertanenverstand war lange nicht so beschränkt, wie die da oben meinten! Der ging nicht auf den Leim, wenn der König auch noch so schön redete und redete und immer was verhiess. Der Untertanenverstand wusste ganz genau: wer so viel redet, der gibt nicht. «Gnaden wollen wir nicht,» sagte der Student, «wir wollen Rechte!»
Mit einem Brummen schob Schulze seinen Karren wieder voran; aber unter den Gurt kroch er nicht mehr.
Es war noch recht drückend für diese Jahreszeit. Sich den Schweiss mit dem roten Sacktuch wischend, hielt Schulze endlich vor seinem Hoftor. Er wollte gerade abladen und nach einer seiner Töchter rufen, dass sie kam und half, da segelte die Witten querüber auf ihn zu.
Sie hatte es eilig wie immer, wie immer flogen ihre Haubenbänder, und wie immer trug sie am Arm die grosse schwarze Glanzledertasche, die etwas Geheimnisvolles an sich hatte mit ihrem weiten Bauch. Aber so eilig hatte sie es doch nicht, dass sie nicht bei dem Nachbar stehen geblieben wäre. «Schöne Kohlköppe. Seid froh bei die teure Zeit!»
«Bin ick ooch!» Er schmunzelte; aber dann machte er ein ernstes, etwas verlegenes Gesicht. Die Witten kam ihm gerade recht. Er hatte es sich schon immer vorgenommen und auch mit seiner Lene davon gesprochen, dass er ihr sagen wollte, sie sollte ihre Luise nicht so viel hinüberschicken. Nun wurde es ihm schwer. Die Luise war am Ende doch ein ganz fleissiges Mädel, eigentlich liess sich nichts gegen sie sagen, und sie hatte Minne auch so gern, aber, aber — sie war eben zu viel auf der Strasse, und sie kam mit Dingen in Berührung, von denen die Minne noch gar nichts zu wissen brauchte. Aber als er der Witte jetzt in das abgehetzte müde Gesicht sah, das er sich nie erinnerte, anders gesehen zu haben als abgehetzt und müde — die arme Frau kriegte zu wenig Schlaf, sie sass oft ganze Nächte auf dem Stuhl mit einer Tasse Kaffee, damit sie gleich bei der Hand war, wenn’s losging — fand er nicht den Mut, ihr das mit der Luise zu sagen. Es würde ihr wehtun. Und so fragte er denn nur nach den beiden Jungen — das waren rechte Tunichtgute — mussten die sich nicht bald stellen zum Militär?
Die Frau schnippte mit den Fingern, als wenn sie einen Faden durchschnitte, der sich schon zu lang gesponnen hatte.
«Meine Jungs ihre Zeit kommt ooch — aber nich, wie Sie vielleicht denken, Schulze!» Sie warf ihm einen forschenden Blick zu, und dann trat sie ihm näher und sagte leise, aber mit einer Stimme, in der es wie ungeduldige Erwartung bebte: «Wir jehn anderen Zeiten entjejen, Schulze, det sage ick Ihnen!»
Er sah sie ganz verdutzt an. Ihre Augen schwammen, ihr Gesicht war ganz rot geworden.
«Wir haben schonst viel zu lange in’n Käfig jesessen wie’n armselijer Piepmatz; nu fliejen wir aus. Passen Se uf, Sie fliejen ooch mit!»
«Nee, nee,» er schüttelte den Kopf, «dazu bin ich viel zu alt. Wenn et denn partu sein muss, lass die Jugend fliejen, man kann ihr leider nich dran hindern; aber ick habe Dreizehn un Vierzehn mitjemacht, ick habe det Meinige jedahn — ick flieje nich mit.»
«Aberst icke!» Die müden Augen der Frau bekamen lebendiges Feuer. Die kleine rundliche Gestalt der Witte reckte sich und wurde höher. «Ick habe mir jenug jequält in meinem Leben und abjeschuft’t, ick will nu, det et wenigstens meine Kinder besser jeht. Aus is’s mit dem Rejieren un dem Iottesjnadentum – nu wer’n wir mal von Iottes Inaden sind!»
«Witten, Sie sind verrückt!» Christian Schulze wurde grob: das Weibsbild war ja ganz und gar unvernünftig, was hatten denn ihre Wünsche, die Wünsche von so ein bisschen Armseligkeit, dabei zu tun?! «Sie haben ja keene Ahnung von Polletik!»Und damit drehte er ihr den Rücken und karrte seinen Kohl vollends durch den Torweg, schmiss ihn mit solchem Gepolter auf dem Hofe um, dass die Tauben, die dort Futter pickten, erschrocken sich in Sicherheit brachten auf ihren Schlag.
Die Witte aber schrie ihm nach — er hörte es wohl, aber er tat, als hätte er keine Ohren — «Sie olle Schlafmütze Sie! Aber warten Se man, wenn unsere Jungs erst die Jlocken läuten, denn wer’n Se wohl ooch ufwachen, Sie, Sie!»
Er schüttelte noch immer den Kopf, als sie schon längst mit ihrem schiebenden Gang, den sie sich angewöhnt hatte auf ihren eiligen Wegen, um die nächste Ecke verschwunden war. Konnte die rabiat sein — herrjeh, wenn die Weibsbilder erst anfingen! Gut, dass seine Lene nicht so war!
Es überkam ihn ein zärtliches Gefühl, als er nun, vom Hofe her, hinten in die Küche trat und seine Frau fand, wie sie mit aufgestreisten Ärmeln am Herde stand und Hammelfleisch mit Kümmel und Kartoffeln zum Abendbrot schmorte. Der kräftige Geruch umfing ihn wohltuend. «Mutter, jibt’s bald was?»
Sie nickte mit ihrem runden Gesicht freundlichbejahend, dann aber blinkte sie mit den Augen nach der Tür, die die Küche mit dem Wirtszimmer verband. «Er is schonst wieder da. Schonst über ’ne Stunde sitzt er drinne un trinkt eene Weisse nach der andern. Er hat auch schon jefragt, ob er zu’n Abend was zu essen kriejen könnte. Er lauert auf ihr. Aber ick habe zu ihr jesagt: ‚du unterstehst dich nich un jehst nach de Stube rin!‘ Nu sitzt se oben bei die Kinder und hört die ab. Rumzustricken hab ick ihr auch aufjejeben, fünfunddreissigmal rum, jrade mitten in de Wade; det is en janz Teil. Un Aujust hab ick mir auch jelangt; er is doch sein Freund. ‚Sag man deinen Freund,‘ hab ick jesagt, ‚det er sich keene Hoffnung machen soll auf Minnen, absolut keene. Jib du et ihm durch de Blume,‘ sagte ick, ‚aber deutlich. Denn wir können det nich so, wir sind die Wirte hier, un er is Iast!‘» —
In der kleinen Hinterstube, die sehr einfach eingerichtet war, mit zwei weissgescheuerten Tischen, ein paar Rohrstühlen und einem glanzledernen grünen Kanapee, über dem in der Mitte der König hing — links und rechts von ihm Friedrich Wilhelm III. und die schöne Königin Luise mit Diadem und Schleier — sassen Schlosser Henze und Tischler Lehmann. Sie hatten sich angefreundet an jenem Sonntag im Mai, an dem der Erklärte Miekes seine Braut zu einem Gewerkfest mitnehmen durfte und die jüngere Schwester sie des Anstands wegen begleitete. Da war der hübsche grosse Mensch herangekommen, hatte seinen Namen genannt und gefragt, ob er einmal mit dem Fräulein tanzen dürfe. Das war alles so, wie es sich gehörte, und August hatte gar nichts dagegen gehabt. Jetzt war es ihm freilich nicht angenehm, dass er damals sozusagen den Vermittler gespielt hatte.
«Schlag se dir aus’n Koppe,» bat er den Freund, der, den mächtigen Kopf in die Hand gestützt, ihm gegenüber am Tische sass, mit einem ein wenig spöttischen Gesicht, und kaum zuzuhören schien, was der andere sagte. «Se is man zart — arg dünne — und du mit deine jroben Poten!»
«Meinste?» Hermann lachte laut auf. Es war ein kräftiges, volltönendes Lachen, das aus dieser breiten Brust kam, als seien alle Register gezogen. Er legte seine beiden grossen Hände vor sich auf den Tisch: «Da, kuck se dir an — die halten fest!»
Der viel schmächtigere Tischler betrachtete den Grossen mit einer gewissen Bewunderung. «Ja, ja, aber —» er wurde bedenklich — «wenn die Ollen doch nu mal nich wollen!»
«Mit Minnen bin ich einig.»
«Donnerschock, det is aber schnell jejangen! Aber haste denn ooch ’ne Pfarre zu die Knarre?»
Ein Schatten flog über Henzes lebensfrohes Gesicht, aber der verschwand schnell. «Sie is ja noch so jung. Wir müssen eben noch warten.»
«Von wejen det ‚so jung‘» — August kratzte sich den Kopf — «älter wird se schonst. Aber du, du —!» Er schüttelte den Kopf. «Wenn ick mir det so ausmale, du un die kleene Minne!» Er fuhr plötzlich auf, als fiele ihm jetzt erst so recht die Einschärfung der Schwiegermutter ein. «Mensch, dir piekt et wohl?!»
Aber der Grosse lachte und lachte. So ein recht übermütiges, siegreiches Lachen, ein Lachen, dass auch der Bedenkliche nicht widerstehen konnte und mitlachte; ein Lachen, bei dem selbst Vater Schulze nebenan in der Küche ein Schmunzeln nicht unterdrücken konnte: schade, dass das mit dem Schlosser nichts werden konnte, ein Prachtkerl war’s doch! — — —
Als Hermann Henze diesen Abend nach Hause ging, war er unbefriedigt; er hatte gehofft, es durch Ausdauer durchzusetzen und das Mädchen doch noch zu sehen. Aber sie hatte sich nicht gezeigt. Nun schlenderte er missmutig durch die Friedrichstrasse; zu seiner Schlafstelle unten in der Junkerstrasse hätte er anderen Weg gehabt, aber nach schlafen war ihm nicht. In ihm war ein fieberndes Verlangen. Er nahm die Mütze ab und strich sich durch den buschigen schwarzen Haarschopf, der ihm mit einer Locke in die Stirn hing. Tief atmete er. Es war ihm, als sei die Strasse, die in einer dürren schwärzlichen Linie ihre Häuserfirste rechts und links gegen den Himmel streckte, zu eng. Der Mond schien irgendwo, aber man konnte ihn nicht sehen, noch stand er nicht hoch, die Dächer und Schlöte verdeckten sein bleiches Gesicht.
Da war es einstmals doch anders gewesen — in seiner Jugend, wie anders! Der Schlosser schnappte hastig nach Luft, als drohte er zu ersticken. Da hatten sie abends um diese Zeit, wenn der Vollmond emporgeschwebt war hinterm Kiefernrand, über unbegrenzten Äckern und Wiesen stand mit silbernem Licht, die Pferde in die Schwemme geritten. Er und die anderen Jungen des märkischen Dorfes. Nackt hatten sie auf den Pferden gesessen, splinterfasernackt; es war eine Lust gewesen, die lindwarme Luft um die Glieder zu spüren. Selbst die müden Ackergäule hatten diese Lust verspürt, sie waren wiehernd hineingestapft in den blinkenden Spiegel des kleinen Sees, dass das Wasser hochspritzte und den schimmernden Körper des Reiters wie mit Diamanten und Perlen besprühte. Die Dorfmädchen hatten zugesehen; sie hielten sich hinter den Büschen versteckt, aber ihr Lachen verriet sie. Wart du! ’runter vom Gaul, sich eine erhascht und dann — und dann —! Der einsam Daherschlendernde schnaufte wie ein Ross.
Jugendstreiche — wie lagen die so weit! Mit fünfzehn Jahren hatte ihn die Mutter nach Berlin in die Lehre gebracht; nun war er schon über zwölf Jahre in der Grossstadt. Es gefiel ihm gut hier, aber in die Schwemme hätte er doch einmal wieder reiten mögen, so wie ihn Gott geschaffen, und aufjuchzen hätte er dabei mögen, aufjuchzen. Was die Mutter wohl machen mochte?! Lange, sehr lange hatte er nicht an sie gedacht. Wenn man so weit von der Heimat fort ist, verliert man die Fühlung mit ihr und mit denen, die noch dort wohnen; Berlin wird einem Heimat. Aber an die Alte schreiben musste er nun doch einmal, seit mehr als einem Jahre hatte er nichts von ihr gehört. Lebte sie noch? I, wo würde sie nicht! Wenn sie tot wäre oder es ihr schlecht ginge, hätte er schon von ihr zu hören gekriegt! Er schüttelte die Erinnerung ab: wozu sich erinnern? Das war zu nichts nütze. Lieber an der Zukunft bauen, die gehörte ihm.
Er fing an zu pfeifen. Hell schrillte das durch die Strasse. Gleich würde der Nachtwächter auf seiner Runde kommen, ihm’s Pfeifen verbieten — wurde einem denn nicht alles verboten? Nächtliche Ruhestörung, mit nach der Wache in der Lindenstrasse oder nach der Stadtvogtei. Der sollte sich unterstehen! In den Rinnstein flog er mitsamt seiner Laterne, seinem Spiess und seinem Horn — ein Überbleibsel aus alter Zeit. Jetzt wurde aufgeräumt mit den Überbleibseln, mit all den Zöpfen von Anno dazumal; Berlin mauserte sich, schon morgen wurde es Weltstadt! Herausfordernd klang das Pfeifen des jungen Mannes. Einen mächtigen Schatten warf seine breite Gestalt.
Hermann Henze war wieder besserer Laune geworden. Die Luft der Strasse, die am Tage matt gewesen war und verbraucht, durchdünstek von allerlei Menschengerüchen und Staub und Rauch, war jetzt frischer. Vom runden Loch des Platzes herunter kam ein freierer Luftzug, ein Odem der Felder jenseits der Stadtmauer. Die waren ja noch nicht allzu weit; schimmernd von Tau, schlangen sie einen Gürtel noch rund um die ganze Stadt: Äcker, Wiesen, Sandhügel, auf denen Windmühlen sich drehten, Kiefern-, Akazienwäldchen, Schafgraben, die Panke, und die den Ausgüssen der Stadt entronnene, ihre Arme wieder vereinigende, breitflutende Spree.
Mit geblähten Nüstern, wie ein Renner, der Freiheit wittert, stand der Schlosser. Wohin jetzt? Die meisten Kneipen waren schon geschlossen. Aber dahin stand ihm auch nicht die Lust — nach was denn?!
Seine Sinne stürmten. Er hatte das Mädchen nicht zu sehen bekommen, das er liebte, Minnes Hand nicht gefühlt, ihr den Kuss nicht geraubt, nach dem es ihn drängte. Den vollen Mund aufgeworfen in Trotz und Begier, stand er zögernd; ihn grauste vor dem einsamen Bett. Wohin jetzt, wohin?! Unschlüssig stand er noch — weiss Gott, er konnte jetzt noch nicht nach Hause gehen — so nicht — das Blut klopfte in ihm, schon wollte er einbiegen in die Krausenstrasse, dem finsteren Plätzchen der Böhmischen Kirche zu, da streifte ein Mädchen an ihm vorbei, sah ihm scharf ins Gesicht, blieb dann stehen und lachte sich eins.
Das war die Luise — Minnes Freundin! Erfreut fasste er nach ihrem Arm: die liess er jetzt nicht.
Sie war atemlos; sie hatte der Mutter etwas nachbringen müssen, das die vergessen hatte, als sie eilends geholt wurde zu einer Frau.
«Komm ’n bisschen!» Er hielt ihren Arm fest.
«Jerne. Mutter is nich da — die andern kümmern sich nich um mich.»
Er wollte, er musste von Minne sprechen, dieses Mädchen kannte sie genau.
Und Luise hing sich willig an seinen Arm. Ihr vom Laufen erhitztes Gesicht wurde ganz blass, ein Glück schoss ihr zum Herzen: er, er führte sie! Und mitunter drückte er ihren Arm wie mit Zärtlichkeit fester an sich. Luise wusste ganz genau, ihr galt das nicht — aber warum es nicht auskosten, das Glück der Stunde?! Sie presste die Augen zu: ‚jetzt wenigstens gilt es mir‘. Schmiegsam passte sie ihren Schritt seinem grossen an. Immer von Minne reden, immer von Minne; dass er’s nur nicht müde wurde, dies Spazierengehen!
Sie erzählte ihm von der Freundin, als die noch klein gewesen war. Niedlich und immer lieb! Sie hatten zusammen auf der Strasse Triesel geschlagen, und Minneken hatte geweint, wenn er in den Rinnstein gesprungen war, Luise hatte ihn ihr mit den Fingern herausgelangt. Sie hatten auch Brückmänneken gespielt auf den Rinnsteinbrücken, und Schleichhexe und Räuber und Prinzessin mit anderen Kindern, aber Minne war immer ein bisschen bange gewesen. Und sie hatte sich so gefürchtet vor dem Neunaugenmann, der abends, wenn es schummerte, die Strasse hinunterschrie: ‚Neunoogen! Neun-oo-ogen!‘ Es klang schaurig, dumpf und hohl. Da hatte Minne sich immer verkrochen; man brauchte nur zu sagen: ‚der Mann mit den neun Oogen kommt‘, und husch war sie weg.
Luise lachte leise, sie hatte sich hineingezwungen in diese Erzählung, nun ward sie doch selbst davon übermannt. Ihre Stimme klang weich. Erinnerung nach Erinnerung tauchte ihr auf; es war ja auch alles noch nicht so lange her, sie hatte es nur vergessen gehabt beim Kinderwickeln und Windelnwaschen und bei all dem, was ihr Leben so hässlich machte. Fast mit Tränen der Rührung sprach sie von Minnes Güte. Die hatte so manchesmal ihre Stullen mit ihr geteilt, den letzten Happen, die war überhaupt so gut, so gut und so sanft, ein Engel war die!
Luise berauschte sich an den eigenen Worten; es klang so schön, was sie sprach. Wenn’s sich auch nicht alles ganz so verhielt, wie sie sagte, jetzt schien es ihr doch so. Und jetzt fühlte sie es nicht, dass sie sich selber einen Dornenkranz aufsetzte mit ihren Lobpreisungen.
Der Mann lauschte entzückt. Er hätte das Mädchen an seinem Arm schier zerdrücken mögen vor lauter Wonne. Das entzückte ihn am meisten, dass die kleine Minne sich so gefürchtet hatte vorm Neunaugenmann — die würde sich überhaupt vorm Manne fürchten, die Zarte, die Schwache! Ihn, den Starken, bezauberte das.
Sie gingen immer kreuz und quer, bogen bald in die Strasse ein, bald in jene. Lauter dunkle Strassen, in denen es jetzt so einsam war, wie im dichtesten Wald. Luise hielt die Augen geschlossen, willenlos liess sie sich führen, sie wollte nichts sehen. Sie redete nur; ihr Mund sprach wie von selber, es floss ihr von den Lippen, es war ein Glück, so sprechen zu können. Ach, immer so weiter, immer so weiter wie im Traum — wenn der doch nie zu Ende sein möchte! Sie litt es, dass des Mannes Arm sich um ihre Taille stahl.
Es war eine milde Nacht, eine Nacht, wie im Frühjahr, nein, wie im Sommer. Es war noch Hitze darin. Sie fühlten beide eine Glut.
Der Mond war untergegangen, sie tappten über einen dunklen Platz. Da waren Büsche, sie traten auf Rasen — da stand eine Bank, und sie setzten sich.
In dunklen Umrissen ragte das Palais des Prinzen am Wilhelmsplatz vor ihnen, die Schildwache ging auf und ab, man hörte nichts als deren gleichmässigen Tritt.
Duftete nicht Flieder, blühten nicht die hohen Büsche übervoll. süss, ganz berauschend?! Luise schmiegte sich enger an ihren Begleiter, er suchte ihren Mund. Er atmete hastig: warum denn nicht, war sie denn nicht ein Mädel? Ein ganz nettes Mädchen, ein ganz molliges Mädchen? Er drückte ihr einen Kuss nach dem andern auf.
Luise sprach nicht mehr, seine Küsse brannten sie; sie konnte auf einmal nichts mehr von Minne reden, sie wusste auf einmal nichts mehr von der, nicht ein einziges Wort. In ihrer Brust hob sich etwas, das beengte sie: ein Gefühl übergrosser Sehnsucht, ein Gefühl zärtlichen Verlangens, mit Mühe nur hielt sie an sich. Sie zitterte, sie schwieg.
Da sagte er: «Du erzählst ja gar nischt mehr? Nu weiter!»
«Ich weiss nischt mehr.»
Er stand plötzlich auf: «Na, denn gehn wir nach Haus!» Er liess den Arm, mit dem er sie fest umschlungen hatte, von ihr. Sie blieb noch einen Augenblick sitzen, wie erstarrt; dann stand auch sie auf.
Nun gingen sie die Wilhelmstrasse zurück, sie machten keine schlendernden Umwege mehr. An der Ecke der Zimmer- und Charlottenstrasse blieb er stehen. Er hatte es näher, wenn er weiter durchging bis zur Markgrafenstrasse; sie tat am besten, hier zu gehen. Auf einmal war er müde, er gähnte herzhaft. Und sie konnte ja auch gut die paar Schritte allein gehen.
Ja, das konnte sie. Sie hob die Augen zu ihm auf, in denen eine bittende Hingabe brannte, eine verlangende Sehnsucht. Ihre Lippen zuckten.
«’n Nacht,» sagte sie und hielt ihm die Hand hin.
Er schüttelte sie ihr freundschaftlich: «Na, schlaf wohl!»
«Danke!» Sie presste seine Hand: «Ich danke — danke!»
Wofür bedankte sie sich denn so?
Sie gab keine Antwort. Hastig sprang sie von ihm weg um die Ecke, ins Dunkel der Strasse hinein, und er eilte nun auch, dass er die Zimmerstrasse hinunterkam.
Aber nur wenige Schritte lief Luise, dann hielt sie an. Im tiefen Schatten stand sie und lehnte sich an eine Hauswand. In ein bitteres Schluchzen brach sie aus, hob ihre Hände und schlug sie immer wieder gegen die fühllose Mauer. In ihrer Seele war eine Empörung, ein wildes Sichauflehnen. Warum war sie so ein armes, geplagtes Tier, das kein Glück kannte und keine Freude? Warum hatte ihre Mutter ein Gewerbe, das ihr so wenig gefiel? Warum war trotz all deren Geschäftigkeit zu Hause kein Wohlstand? Warum war ihr Vater ein Trunkenbold, warum waren die Brüder Faulpelze? Warum hatte er sie nicht bis zu ihrer Tür begleitet, warum sie allein laufen lassen? Warum hatte er nicht gesagt, nicht ein einziges Mal gesagt: ‚Luise, erzähl auch was von dir‘ —?!
Sie weinte heftig.
Von der Kirchuhr schlug’s Mitternacht. Mochte es schlagen: zwölf Uhr, ein Uhr und noch viel mehr — nein, sie ging nicht nach Haus, sie mochte gar nicht mehr leben — so nicht mehr leben! Was war so ein Leben denn wert?!
Und doch entsprang sie eilends in grossen Sätzen und flüchtete ihrem Hause zu, als jetzt ein einsam Torkelnder sich nahte und auf sie zukam.
Drittes Kapitel
Im Viertel war noch eine Schlosserei, vielmehr eine Schmiede; mit der Schlosserei gab sich der Hof- und Kurschmied Heinrich Schehle, der geprüfte Hufbeschlagmeister, jetzt nicht mehr ab. Er stand sich besser beim Hufbeschlag. Seine Schmiede lag günstig. Nicht nur, dass sämtliche Bauern von Tempelhof, von Britz und Umgegend, und all die Fuhrleute, die von Süden her das Hallesche Tor passierten, bei ihm beschlagen liessen, die lange Markgrafenstrasse herauf, die Stille mit ihrem Hufschlag belebend, kamen auch die Pferde vom Königlichen Marstall. Und von der Wilhelmstrasse kam der Stallmeister mit den edlen Reitpferden, die sich der Prinz am Wilhelmsplatz hielt. Es ging alles in schnurgeraden Linien auf den Belleallianceplatz zu, und an ihm lag, da, wo die Lindenstrasse sich abzweigt, die Schmiede.
Da war’s oft wie auf einem Jahrmarkt. Mit Planen überdachte schwere Frachtwagen hielten vor der breiten Einfahrt, über der ein Hufeisen angenagelt war. Schief zwischen jene hatten sich Karren von Bauern eingezwängt: Holzfuhren, Kartoffelkarren, wohl auch eine altmodische Landkutsche; aber auch ein elegantes Kabriolett. Offiziersburschen führten das vorsichtig in Decken gehüllte Vollblut ihres Herrn heran, das, unruhig schnaubend die Ackergäule passierte, und ein glattrasierter Kutscher mit einer Krone auf den Knöpfen suchte vergebens durch Peitschenknallen und einen unsäglich verächtlichen Gesichtsausdruck sich Durchlass zu erzwingen.
Hermann Henze hatte die Schmiede immer mit besonderem Interesse betrachtet, wenn er vors Tor ging, um draussen im Schafgraben ein Bad zu nehmen. Ihr Treiben sagte ihm zu. Er konnte ja schmieden. Ehe er in die Lehre gekommen war nach Berlin, hatte er ein Jahr in der Dorfschmiede geholfen, Handreichungen dort getan; das Erste hatte er da gelernt.
Die Schmiede war im Dorf das erste Gehöft. Wenn man noch nicht aus dem Walde heraus war, hörte man schon ihren taktmässigen Hammerschlag, und trat man dann zwischen den Bäumen vor, so sah man russige Männer wie Riesen um ein Feuer stehen, sah auf dem Amboss das Eisen weiss glühen und unterm wuchtigen Schlag des Hammers ganze Garben von Funken sprühen.
Ja, das war eine Goldgrube, solch eine Schmiede! Schade, dass er nicht Meister darin war, sondern der Schehle, der, ältlich und gelb wie Wachs auf seinem Hofe stand, selber nicht mehr mitarbeitete, sondern nur zusah; aber scharf zusah, das musste man sagen. Es wurde allerlei gesprochen über den Mann. Der Prinz vom Wilhelmsplatz war früher oft selber in die Schmiede gekommen — er hatte damals merkwürdig oft kranke Pferde. Böse Zungen wussten es freilich besser: der kam der schönen Frau des Schmieds wegen. Und dann war der Schehle auf einmal Hofschmied geworden, gerade als ihm eine Tochter geboren wurde. Aber man merkte ihm die Freude darüber nicht an. Ein Pferd hatte ihm einstmals gegen den Leib getreten, ihm die Leber verletzt; es konnte auch daher kommen, dass er so gallig war.
Es war ein Gefühl der Bewunderung, vielleicht auch ein leises Begehren, mit dem der junge Schlosser die Schmiede betrachtete. Das hätte er auch mögen, so dastehen, sehen, wie ihm die Arbeit zuwuchs, wie die Gesellen sich zu mancher Zeit nicht genug sputen konnten, wie die schönen Pferde, die in den Boxes warteten, unruhig wurden, scharrten, schnaubten, wie sie sich dann bäumten, auskeilten, das Pflaster des Hofes schlugen und den Stallknecht, der sie vergebens mit: ‚Oh oh — ohla‘ und leisem Pfeifen zu beruhigen suchte, fast über den Haufen warfen. Die Gesellen troffen von Schweiss.