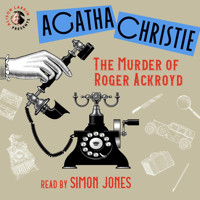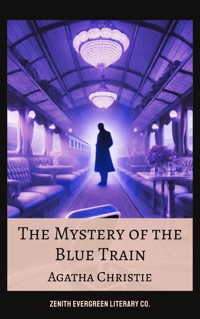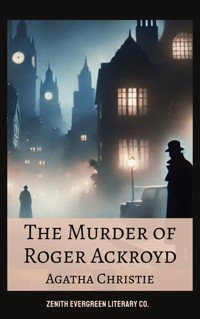9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
Hip Hip Hercule! Vor 100 Jahren löste der berühmteste Ermittler der Welt seinen ersten Fall Wer hat die wohlhabende Mrs Emily Inglethorp auf ihrem Landgut Styles Court vergiftet? Ihr Ehemann Alfred, der es scheinbar auf das Erbe abgesehen hat? Doch auch ihre Stiefsöhne oder die launische Haushälterin könnten die Mörder sein. In seinem ersten Fall nimmt Hercule Poirot alle Bewohner von Styles gründlich unter die Lupe, bis er das fehlende Glied in der Kette gefunden hat. Agatha Christies Debütroman war das Ergebnis einer Wette: Die Autorin, die zuvor noch kein einziges Buch geschrieben hatte, würde es nicht schaffen, eine Detektivgeschichte zu schreiben, bei der der Leser einfach nicht auf den Mörder kommt, obwohl er die gleichen Hinweise erhält wie der Ermittler. Nun, lösen Sie das Rätsel noch vor Poirot?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Agatha Christie
Das fehlende Glied in der Kette
Ein Fall für Poirot
Aus dem Englischen von Nina Schindler
Atlantik
Für meine Mutter
1Ich fahre nach Styles
Das große Interesse, mit dem die Öffentlichkeit seinerzeit den »Fall Styles« verfolgte, hat sich inzwischen etwas gelegt. Doch in Anbetracht des weltweiten Aufsehens, das er erregt hat, wurde ich sowohl von meinem Freund Poirot als auch von der Familie selbst gebeten, einen schriftlichen Bericht über die damaligen Vorfälle zu verfassen. Die reißerischen Gerüchte, die immer noch im Umlauf sind, werden dadurch hoffentlich zum Schweigen gebracht.
Deshalb möchte ich zunächst kurz die Umstände erläutern, wie ich überhaupt in diese Affäre hineingeriet.
Ich war nach einer Verwundung von der Front nach Hause geschickt worden und hatte einige Monate in einem ziemlich trübsinnigen Erholungsheim verbracht, bevor ich noch einen Monat Heimaturlaub erhielt. Da ich weder Freunde noch nahe Anverwandte besaß, war ich unschlüssig, was ich tun sollte, als ich eines Tages zufällig John Cavendish begegnete. Ich hatte ihn in den vergangenen Jahren kaum zu sehen bekommen. Eigentlich hatte ich ihn nie sonderlich gut gekannt. Er war auch etwa fünfzehn Jahre älter als ich, allerdings sah er gar nicht aus wie fünfundvierzig. Als Junge war ich häufig in Styles zu Besuch gewesen, dem Landgut seiner Mutter in Sussex.
Wir plauderten angeregt über die alten Zeiten und das endete damit, dass er mich für die Dauer meines Urlaubs nach Styles einlud.
»Meine Mutter wird sich über deinen Besuch freuen – nach all diesen Jahren«, fügte er hinzu.
»Deiner Mutter geht es doch hoffentlich gut?«
»Oh ja. Wahrscheinlich hast du gehört, dass sie wieder geheiratet hat?«
Ich fürchte, ich zeigte mein Erstaunen nur zu deutlich. Mary Cavendish war bei ihrer Heirat mit Johns Vater, einem Witwer mit zwei Söhnen, eine gut aussehende Frau mittleren Alters gewesen. Sie musste mittlerweile mindestens siebzig sein. Ich erinnerte mich an sie als eine energische, befehlsgewohnte Persönlichkeit mit einer gewissen Neigung zu wohltätigen und gesellschaftlichen Verpflichtungen, die gern Basare eröffnete und die Wohltäterin spielte. Sie war eine äußerst großzügige Dame, die ein beträchtliches Vermögen besaß.
Den Landsitz Styles hatte Mr Cavendish zu Beginn ihrer Ehe erworben. Er hatte bei seiner Frau völlig unter dem Pantoffel gestanden, und zwar so sehr, dass er ihr bei seinem Tod Wohnrecht auf Lebenszeit in dem Haus zugestand und ihr außerdem noch den größten Teil seines Vermögens vermachte – ein für seine Söhne ausgesprochen ungerechtes Testament. Doch ihre Stiefmutter hatte sich den beiden gegenüber stets außerordentlich großzügig gezeigt, und da die Söhne bei der Wiederverheiratung ihres Vaters noch sehr jung gewesen waren, erschien ihnen Mrs Cavendish immer wie ihre leibliche Mutter.
Lawrence, der jüngere der beiden, war als Kind ständig krank gewesen. Er hatte Medizin studiert, den Arztberuf jedoch schon bald wieder an den Nagel gehängt und lebte nun zu Hause, wo er seinen literarischen Neigungen nachging, obwohl seinen Gedichten kein sonderlicher Erfolg beschieden war.
John hatte eine Zeit lang als Rechtsanwalt praktiziert, sich dann aber für das angenehme Leben eines Landedelmanns entschieden. Vor zwei Jahren hatte er geheiratet und lebte nun mit seiner Frau auf Styles. Doch hätte er wohl – so schloss ich scharfsinnig – eine Erhöhung seines Unterhalts vorgezogen, womit er sich ein eigenes Heim hätte leisten können. Mrs Cavendish war jedoch eine Dame, die es vorzog, ihre eigenen Pläne zu machen, und von anderen erwartete, dass sie sich danach richteten. In diesem Fall hielt sie zweifelsohne die Zügel in der Hand, nämlich die Verfügungsgewalt über die Finanzen.
John registrierte meine Überraschung, als er mir von der Wiederverheiratung seiner Mutter erzählte, und lächelte etwas verlegen.
»Und zu allem Überfluss ist er auch noch ein mieser kleiner Lump!«, sagte er heftig. »Ich kann dir sagen, Hastings, der macht uns das Leben ziemlich schwer. Und bei Evie – du erinnerst dich doch noch an Evie?«
»Nein.«
»Ach, dann kam sie erst nach deiner Zeit. Sie ist Mutters Mädchen für alles, ihre Gesellschafterin, ihr Faktotum. Sie ist große Klasse, die alte Evie! Nicht gerade jung und schön, aber jemand zum Pferdestehlen.«
»Du wolltest gerade sagen …«
»Ach ja, dieser Kerl! Der tauchte irgendwann einfach auf und behauptete, er wäre ein entfernter Verwandter von Evie, obwohl die nicht so aussah, als ob ihr an dieser Verwandtschaft fürchterlich viel gelegen wäre. Der Kerl ist ein totaler Außenseiter, das sieht man auf Anhieb. Er hat einen schwarzen Vollbart und trägt bei jedem Wetter Lackschuhe! Aber unsere Mutter war sofort von ihm begeistert und stellte ihn als ihren Sekretär ein – wie du weißt, ist sie ja immer die Vorsitzende von hundert Vereinen.«
Ich nickte.
»Tja, seit dem Krieg sind es nicht mehr hunderte, sondern tausende. Zweifellos war der Kerl ihr ganz nützlich. Aber uns traf beinahe der Schlag, als sie uns vor drei Monaten plötzlich mitteilte, dass sie und Alfred verlobt wären! Der Kerl ist mindestens zwanzig Jahre jünger als sie! Er hatte es zweifellos auf ihr Geld abgesehen – aber was soll man machen – sie tut, was sie will, und also hat sie ihn geheiratet.«
»Das muss für euch ja eine schwierige Situation sein.«
»Schwierig! Sie ist verteufelt unangenehm!«
So geschah es dann, dass ich drei Tage später in Styles St. Mary aus dem Zug stieg, an einem winzigen Bahnhof, der ohne sichtbare Daseinsberechtigung inmitten von grünen Feldern und Landstraßen lag. John Cavendish wartete auf dem Bahnsteig und geleitete mich zu seinem Auto.
»Wie du siehst, habe ich immer noch ein bisschen Benzin«, bemerkte er. »Das verdanke ich hauptsächlich den Aktivitäten unserer Mutter.«
Das Dorf Styles St. Mary war etwa zwei Meilen weit entfernt und Styles Court lag eine Meile dahinter. Es war ein ruhiger warmer Tag Anfang Juli. Beim Anblick dieser grünen, friedlich im nachmittäglichen Sonnenschein liegenden Ebene von Essex konnte man sich kaum vorstellen, dass gar nicht so weit entfernt ein Weltkrieg wütete. Mir war, als hätte ich mich plötzlich in eine andere Welt verirrt.
»Ich fürchte, Hastings, du wirst es hier sehr ruhig finden.«
»Aber lieber Freund, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe.«
»Na ja, es ist ganz schön, wenn man ein Faulenzerleben führen will. Ich exerziere zweimal wöchentlich mit der freiwilligen Bürgerwehr und helfe den Bauern. Meine Frau arbeitet regelmäßig bei der Landhilfe mit. Sie steht jeden Morgen um fünf Uhr auf und melkt die Kühe und dann macht sie weiter bis mittags. Alles in allem ist es eigentlich ein ganz angenehmes Leben – wenn da bloß nicht dieser Alfred Inglethorp wäre!« Plötzlich verlangsamte er die Geschwindigkeit und sah auf seine Uhr. »Vielleicht haben wir ja noch genug Zeit, um Cynthia abzuholen. Nein, sie wird das Krankenhaus jetzt wohl schon verlassen haben.«
»Cynthia? Das ist doch nicht deine Frau?«
»Nein, Cynthia ist ein Schützling meiner Mutter, die Tochter einer alten Schulfreundin, die einen üblen Advokaten heiratete. Er machte Pleite und bald darauf war das Mädchen verwaist und völlig mittellos. Meine Mutter nahm sie auf und jetzt lebt Cynthia schon fast zwei Jahre bei uns. Sie arbeitet übrigens im Roten-Kreuz-Krankenhaus in Tadminster, etwa sieben Meilen von hier.«
Während seiner letzten Worte fuhren wir vor dem schönen alten Haus vor. Eine Frau in dickem Tweedrock beugte sich gerade über ein Blumenbeet und richtete sich auf, als wir näher kamen.
»Hallo, Evie, hier ist unser verwundeter Held! Mr Hastings – Miss Howard.«
Miss Howard schüttelte mir die Hand mit festem, fast schmerzhaftem Griff. Ich blickte in sehr blaue Augen in einem sonnengebräunten Gesicht. Sie war eine sympathische Frau um die vierzig, von herbem Äußeren, mit einer tiefen, beinahe männlichen Stimme, groß und breitschultrig, mit den dazu passenden Füßen – Letztere steckten in guten derben Stiefeln. Ihre bevorzugte Sprechweise, das merkte ich bald, waren Mitteilungen im Telegrammstil.
»Unkraut wächst wie verrückt. Kann damit nicht Schritt halten. Werde Sie zwangsverpflichten müssen. Nehmen Sie sich nur in Acht!«
»Aber ich würde mich mit dem größten Vergnügen nützlich machen«, erwiderte ich.
»Sagen Sie das nicht. Sollte man nie. Werden Sie noch bereuen.«
»Du machst dich über uns lustig, Evie.« John lachte. »Wo trinken wir heute Tee – drinnen oder draußen?«
»Draußen. Viel zu schönes Wetter, um sich im Hause zu verkriechen.«
»Dann komm jetzt, du hast für heute genug im Garten gearbeitet. Du hast dir eine Pause verdient. Komm und ruh dich aus.«
»Hm.« Miss Howard zog die Gartenhandschuhe aus. »Ich stimme dir da zu.«
Sie ging voran ums Haus herum zu dem Tisch, der im Schatten eines großen Ahorns gedeckt war.
Aus einem der Korbsessel erhob sich eine Gestalt und kam uns zur Begrüßung ein paar Schritte entgegen.
»Meine Frau, Hastings«, sagte John.
Niemals werde ich den ersten Anblick von Mrs Cavendish vergessen. Ihre hohe, schlanke Gestalt zeichnete sich vor dem hellen Hintergrund ab. In ihren wunderschönen goldbraunen Augen schien ein verborgenes Feuer zu schwelen, es waren bemerkenswerte Augen, ganz anders als die aller Frauen, die mir jemals begegnet sind. Sie vermittelte den Eindruck großer Beherrschtheit, doch unter dem höchst kultivierten Äußeren war ein ungebärdiger, ungezähmter Geist spürbar. All das ist in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich werde es nie vergessen.
Sie begrüßte mich freundlich mit tiefer, klarer Stimme und ich sank in einen Korbstuhl und freute mich außerordentlich, dass ich Johns Einladung angenommen hatte. Mrs Cavendish goss mir Tee ein und ihre wenigen leisen Bemerkungen verstärkten meinen Eindruck von ihr als einer ungewöhnlich faszinierenden Frau. Ein aufmerksamer Zuhörer wirkt immer anregend und so gab ich einige Anekdoten aus dem Erholungsheim so witzig zum Besten, dass sich – wie ich mir schmeichelte – meine Gastgeberin sehr amüsierte. John ist zwar ein netter Kerl, aber man würde ihn schwerlich als brillanten Unterhalter bezeichnen.
In diesem Augenblick ertönte durch die offene Terrassentür in unserer Nähe eine wohlbekannte Stimme: »Dann wirst du der Prinzessin also nach dem Tee schreiben, Alfred? Wegen des zweiten Tages werde ich selbst an Lady Tadminster schreiben. Oder sollen wir erst die Antwort der Prinzessin abwarten? Falls wir eine Absage erhalten, könnte Lady Tadminster das Fest am ersten Tag eröffnen und Mrs Crosbie am zweiten. Dann wäre da noch die Herzogin – wegen des Schulfests.«
Eine männliche Stimme murmelte eine Antwort, danach erwiderte Mrs Inglethorp: »Aber gewiss doch. Nach dem Tee ist noch genug Zeit. Du denkst aber auch an alles, mein lieber Alfred.«
Die Terrassentür schwang auf und eine schöne, weißhaarige alte Dame mit etwas gebieterischen Zügen trat heraus auf den Rasen. Ein Mann folgte ihr in etwas unterwürfiger Haltung. Mrs Inglethorp begrüßte mich überschwänglich.
»Welch große Freude, Sie nach all diesen Jahren wiederzusehen, Mr Hastings. Alfred, Liebster, Mr Hastings – mein Mann.«
Mit einiger Neugier betrachtete ich den liebsten Alfred. Er hatte wirklich etwas Befremdliches. Ich wunderte mich nicht, dass John sich abfällig über den Bart geäußert hatte. Es war einer der längsten und schwärzesten Vollbärte, die ich jemals gesehen hatte. Er trug einen Kneifer mit Goldrand und seine Gesichtszüge waren merkwürdig unbewegt. Mir kam der Gedanke, dass er auf eine Bühne passen würde, doch im wirklichen Leben wirkte er seltsam fehl am Platz. Seine Stimme war ziemlich tief und salbungsvoll. Er reichte mir steif die Hand und sagte: »Es ist mir eine Freude, Mr Hastings.« Dann wandte er sich an seine Frau: »Liebste Emily, ich glaube, das Kissen ist ein wenig feucht.«
Sie strahlte ihn liebevoll an, als er stattdessen ein anderes hinlegte – ein überzeugender Beweis hingebungsvoller Fürsorge. Eine seltsame Gefühlsverirrung für eine sonst so vernünftige Frau!
Mit der Ankunft von Mr Inglethorp wurde die Atmosphäre auf einmal gespannt, eine verschleierte Feindseligkeit wurde bei den Anwesenden spürbar. Besonders Miss Howard gab sich keinerlei Mühe, ihre Gefühle zu verbergen. Mrs Inglethorp schien jedoch nichts Ungewöhnliches zu bemerken. Sie hatte ihre Redseligkeit, an die ich mich noch von früher erinnerte, in der Zwischenzeit nicht eingebüßt und sie redete ununterbrochen, hauptsächlich von dem bevorstehenden Basar, den sie organisierte und der demnächst stattfinden sollte. Ab und an wandte sie sich mit einer Frage nach Daten oder Terminen an ihren Gatten. Seine aufmerksame Fürsorge ließ keinen Augenblick nach. Von Anfang an fasste ich eine starke, tiefe Abneigung gegen ihn, und ich muss gestehen, dass meine ersten Einschätzungen meist ziemlich zutreffend sind.
Als sich Mrs Inglethorp an Miss Howard wandte, um ihr einige Anweisungen bezüglich eines Briefes zu geben, redete mich ihr Mann in seiner salbungsvollen Stimme an: »Sind Sie Berufsoffizier, Mr Hastings?«
»Nein, vor dem Krieg habe ich bei der Lloyd-Versicherung gearbeitet.«
»Werden Sie nach dem Kriegsende wieder dorthin zurückgehen?«
»Vielleicht. Entweder das, oder ich fange noch einmal etwas ganz Neues an.«
Mary Cavendish beugte sich vor. »Welchen Beruf würden Sie denn wählen, wenn Sie sich nur nach Ihren Neigungen entscheiden könnten?«
»Das hängt von mancherlei ab.«
»Haben Sie kein geheimes Steckenpferd?«, fragte sie. »Gibt es denn nichts, das Sie fasziniert? Eigentlich hat doch jeder eine geheime Leidenschaft – meist etwas völlig Verrücktes.«
»Sie werden mich auslachen.«
Sie lächelte. »Vielleicht.«
»Tja, also, ich wollte heimlich schon immer ein Detektiv sein.«
»Ein echter Detektiv – bei Scotland Yard? Oder mehr so wie Sherlock Holmes?«
»Oh, am liebsten wie Sherlock Holmes. Aber ganz im Ernst – das fasziniert mich ungemein. Ich habe einmal in Belgien einen Mann kennengelernt, einen sehr berühmten Detektiv, und der hat mich richtiggehend angesteckt. Er war ein bewundernswerter kleiner Bursche. Er behauptete immer, gute Detektivarbeit bestünde einzig und allein in einer methodischen Vorgehensweise. Darauf basiert auch mein System – obwohl ich es natürlich weiterentwickelt habe. Er war ein drolliger kleiner Mann, ein richtiger Dandy, aber unglaublich klug.«
»Schätze auch eine gute Detektivgeschichte«, bemerkte Miss Howard. »Aber es wird auch eine Menge Mist verzapft. Die Entlarvung des Verbrechers im letzten Kapitel. Alle sind total überrascht. Bei einem echten Verbrechen – da würde man sofort Bescheid wissen.«
»Es gibt aber eine große Anzahl unaufgeklärter Verbrechen«, widersprach ich.
»Ich meine ja nicht die Polizei, sondern die Menschen, die direkt davon betroffen sind. Die Familie. Die könnte man nicht an der Nase herumführen, die wüsste Bescheid.«
»Dann glauben Sie wohl«, sagte ich belustigt, »dass Sie sofort den Mörder entlarven würden, falls Sie jemals in ein Verbrechen verwickelt würden, zum Beispiel in einen Mord, ja?«
»Selbstverständlich. Könnte es vielleicht einem Rudel von Rechtsanwälten nicht beweisen. Bin mir ganz sicher, dass ich Bescheid wüsste. Würde es in meinen Fingerspitzen fühlen, wenn der Kerl in meine Nähe käme.«
»Vielleicht ist es eine Sie«, wandte ich ein.
»Möglich. Aber Mord ist ein Gewaltverbrechen. Riecht für mich mehr nach einem Mann.«
»Aber nicht Giftmord.« Mrs Cavendishs klare Stimme erschreckte mich. »Dr. Bauerstein sagte erst gestern, es gäbe wahrscheinlich unzählige unentdeckte Giftmorde, weil die Ärzte sich bei den unbekannteren Giften kaum auskennen.«
»Aber Mary, was ist das denn für eine gruselige Unterhaltung!«, rief Mrs Inglethorp. »Da überläuft es mich ja kalt. Oh, da ist ja Cynthia!«
Ein Mädchen in Uniform kam leichtfüßig über den Rasen gelaufen.
»Cynthia, du bist heute aber spät dran. Darf ich dir Mr Hastings vorstellen – Mr Hastings – Miss Murdoch.«
Cynthia Murdoch war ein frisches junges Mädchen, das vor Lebenslust und Energie förmlich strotzte.
Sie warf ihre Uniformmütze zur Seite und ich bewunderte den Schwung ihrer kastanienbraunen Locken und ihre kleinen weißen Hände, die sie nach ihrer Tasse Tee ausstreckte. Mit dunklen Augen und Wimpern wäre sie eine Schönheit gewesen. Sie ließ sich neben John auf die Erde fallen und lächelte zu mir hoch, als ich ihr die Platte mit den Sandwiches reichte.
»Setzen Sie sich doch auch auf den Rasen, hier ist es viel, viel schöner.«
Gehorsam ließ ich mich neben ihr auf dem Boden nieder.
»Sie arbeiten in Tadminster, nicht wahr, Miss Murdoch?«
Sie nickte. »Die reinste Strafarbeit.«
»Sind sie denn dort so unfreundlich zu Ihnen?«, fragte ich lächelnd.
»Das sollen die nur wagen!«, rief Cynthia empört.
»Ich habe eine Kusine, die als Krankenschwester arbeitet«, bemerkte ich. »Sie hat schreckliche Angst vor den Oberschwestern.«
»Das überrascht mich nicht. Oberschwestern sind einfach – ach, Mr Hastings, Oberschwestern sind einfach fürchterlich! Sie machen sich ja gar keine Vorstellung davon, wie fürchterlich sie sind. Aber ich bin keine Krankenschwester, dem Himmel sei Dank, ich arbeite in der Apotheke.«
»Na, wie viele Menschen haben Sie denn schon vergiftet?« Ich lächelte.
Cynthia lächelte ebenfalls.
»Oh, hunderte«, sagte sie.
»Cynthia«, rief Mrs Inglethorp. »Könntest du wohl ein paar Briefe für mich schreiben?«
»Aber gern, Tante Emily.«
Sie sprang sofort auf, und irgendwas in ihrem Verhalten erinnerte mich daran, dass sie von Mrs Inglethorps Großmut abhängig war und dass Mrs Inglethorp sie das bei aller sonstigen Freundlichkeit nie vergessen ließ.
Meine Gastgeberin wandte sich nun mir zu. »John wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Um halb acht gibt es Abendbrot. Seit einiger Zeit verzichten wir auf späte Abendmahlzeiten. Lady Tadminster, die Frau unseres Parlamentsabgeordneten – sie ist die Tochter des verstorbenen Lord Abbotsbury –, macht es genauso. Sie stimmt mit mir darin überein, dass man sparen soll und den anderen mit gutem Beispiel vorangehen muss. Wir sind ein richtiger Kriegshaushalt; hier wird nichts verschwendet, sogar jeder Fetzen Papierabfall wird aufgehoben und zur Sammelstelle gebracht.«
Ich drückte ihr meine Anerkennung aus und John begleitete mich ins Haus und die breite Treppe hinauf, die sich oben teilt und rechts und links in die verschiedenen Flügel des Gebäudes führt. Mein Zimmer lag im linken Flügel mit Ausblick auf den Park.
John ging wieder und einige Minuten später sah ich ihn von meinem Fenster aus langsam untergehakt mit Cynthia Murdoch über den Rasen schlendern. Ich hörte Mrs Inglethorp ungeduldig »Cynthia« rufen und sah das Mädchen zusammenzucken und zurück ins Haus laufen. Im gleichen Augenblick trat ein Mann aus dem Schatten eines Baums und ging langsam in die gleiche Richtung. Er schien um die vierzig zu sein, war dunkelhaarig und hatte ein schwermütiges, glattrasiertes Gesicht. Anscheinend befand er sich in einem Zustand höchster Erregung. Im Vorbeigehen sah er zu meinem Fenster hoch und ich erkannte ihn, obwohl er sich in den fünfzehn Jahren seit unserer letzten Begegnung stark verändert hatte. Es war Johns jüngerer Bruder Lawrence. Ich fragte mich, was diesen eigenartigen Gesichtsausdruck hervorgerufen hatte.
Dann vergaß ich ihn wieder und dachte über meine eigenen Angelegenheiten nach.
Der Abend verging ausgesprochen angenehm und in der Nacht träumte ich von der verwirrenden Mrs Cavendish.
Der nächste Morgen war hell und sonnig und ich war voller Vorfreude auf die nächsten Tage.
Ich sah Mrs Cavendish erst beim Mittagessen wieder, wo sie mir einen Spaziergang vorschlug, und wir verbrachten einen zauberhaften Nachmittag, streiften durch den Wald und kehrten so gegen fünf zum Haus zurück.
Als wir die große Halle betraten, winkte John uns zu, wir sollten ins Herrenzimmer kommen. Ich sah ihm sofort an, dass etwas Unangenehmes passiert sein musste. Wir folgten ihm und er schloss hinter uns die Tür.
»Hör mal, Mary, hier herrscht ein heilloses Durcheinander. Evie hatte einen Streit mit Alfred Inglethorp und will weggehen.«
»Evie? Weg?«
John nickte düster.
»Ja. Weißt du, sie ist zu Mutter gegangen und – ach, hier kommt sie ja selbst.«
Miss Howard kam herein. Sie hatte die Lippen zusammengepresst und trug einen kleinen Koffer. Sie wirkte aufgeregt und entschlossen, als ob sie sich rechtfertigen wollte.
»Jedenfalls«, platzte sie heraus, »habe ich ihr die Meinung gesagt!«
»Meine liebe Evie«, rief Mrs Cavendish, »das kann doch nicht wahr sein!«
Miss Howard nickte grimmig.
»Wahr genug! Habe wohl Emily einige Dinge gesagt, die sie so bald weder vergeben noch vergessen wird. Ist mir aber völlig egal, wenn nur einiges davon hängen geblieben ist. Aber wahrscheinlich war sowieso alles umsonst. Ich sagte ihr direkt ins Gesicht: ›Du bist eine alte Frau, Emily, und die alten Trottel sind die schlimmsten. Der Mann ist zwanzig Jahre jünger als du, also ist doch völlig klar, weshalb er dich geheiratet hat. Wegen deinem Geld! Gib ihm nur nicht zu viel. Bauer Raikes hat eine hübsche junge Frau. Frag doch mal deinen Alfred, wie viel Zeit er dort verbringt.‹ Sie wurde sehr wütend. Ist doch klar! Ich machte weiter: ›Ich warne dich, egal, ob du es hören willst oder nicht. Dieser Mann ist im Stande und bringt dich noch in deinem eigenen Bett um. Er ist eine ganz üble Type. Ob es dir nun passt oder nicht, ich muss dich warnen. Er ist eine ganz üble Type!‹«
»Und was hat sie gesagt?«
Miss Howard schnitt eine äußerst ausdrucksvolle Grimasse.
»›Alfred, mein Liebling‹ – ›mein liebster Alfred‹ – ›bösartige Verleumdungen‹ – ›gemeine Lügen‹ – ›bösartiges Weib, die meinen geliebten Mann verleumdet!‹ Je schneller ich ihr Haus verließe, desto besser. Deshalb gehe ich weg.«
»Aber doch nicht jetzt schon?«
»Augenblicklich!«
Wir saßen alle da und starrten sie an. John versuchte sie zum Dableiben zu überreden, doch ohne Erfolg, schließlich ging er, um die Abfahrtszeiten der Züge nachzusehen. Seine Frau folgte ihm und murmelte, dass sie Mrs Inglethorp dazu bringen wollte, ihre Meinung zu ändern.
Als sie den Raum verlassen hatte, veränderte sich Miss Howards Gesichtsausdruck. Sie neigte sich eifrig zu mir herüber.
»Mr Hastings, Sie sind ein anständiger Mensch. Kann ich mich auf Sie verlassen?«
Ich war etwas überrascht. Sie legte ihre Hand auf meinen Arm und flüsterte: »Kümmern Sie sich um sie, Mr Hastings. Meine arme Emily. Sie sind Gauner – allesamt. Oh, ich weiß, wovon ich rede. Alle haben sie Geldprobleme und alle wollen sie von ihr Geld. Ich habe sie so gut vor ihnen beschützt, wie ich konnte. Wenn ich nun nicht mehr da bin, werden sie ihre Gutmütigkeit ausnutzen.«
»Selbstverständlich werde ich alles tun, was ich kann, aber ich bin sicher, dass Sie in Ihrer Aufregung Gespenster sehen.«
Sie unterbrach mich, indem sie mir langsam mit dem Zeigefinger drohte. »Junger Mann, glauben Sie mir. Ich bin schon länger auf der Welt als Sie. Ich bitte Sie doch nur, Ihre Augen offen zu halten. Sie werden schon sehen, was ich damit meine.«
Durch das offene Fenster drang Motorengeräusch und Miss Howard erhob sich und ging zur Tür. Draußen hörte man Johns Stimme. Mit der Hand auf dem Türknauf sah sie über die Schulter zurück und winkte mich zu sich heran.
»Vor allem, Mr Hastings, passen Sie auf diesen Teufel auf – ihren Mann!«
Es blieb keine Zeit für weitere Erklärungen. Miss Howard wurde von lebhaftem Protest- und Abschiedsgeschrei verschlungen. Die Inglethorps ließen sich nicht sehen.
Als das Auto losfuhr, löste sich Mrs Cavendish plötzlich von der Gruppe, überquerte die Auffahrt und ging einem hoch gewachsenen, bärtigen Mann entgegen, der offensichtlich auf dem Weg zum Haus war. Während sie ihm die Hand entgegenstreckte, stieg ihr das Blut in die Wangen.
»Wer ist das?«, fragte ich ungehalten, denn instinktiv lehnte ich diesen Mann ab.
»Das ist Dr. Bauerstein«, antwortete John knapp.
»Und wer ist Dr. Bauerstein?«
»Er wohnt zurzeit im Dorf und erholt sich von einem schweren Nervenzusammenbruch. Er ist ein Londoner Wissenschaftler. Ein sehr kluger Mann – einer der bedeutendsten Experten unserer Zeit für Gifte, glaube ich.«
»Und er ist ein enger Freund von Mary«, warf Cynthia ein, die sich immer einmischen musste.
John Cavendish runzelte die Stirn und wechselte das Thema.
»Komm, Hastings, lass uns ein Stück spazieren gehen. Das war ja eine höchst peinliche Angelegenheit. Sie hatte schon immer eine scharfe Zunge, aber es gibt in ganz England keine zuverlässigere Freundin als Evelyn Howard.«
Wir liefen auf dem Feldweg zum Dorf und weiter bis zum Wald, der an das Gut grenzte.
Als wir auf unserem Rückweg wieder durch das Parktor kamen, begegnete uns eine hübsche, junge, etwas zigeunerhafte Frau, die uns lächelnd grüßte.
»Das ist aber ein hübsches Mädchen«, bemerkte ich anerkennend.
Johns Gesicht verfinsterte sich.
»Das ist Mrs Raikes.«
»Die, von der Miss Howard –«
»Genau«, erwiderte John unnötig schroff.
Ich dachte an die weißhaarige alte Dame im Herrenhaus und an das strahlende, schalkhafte kleine Gesicht, das uns eben zugelächelt hatte, und eine unbestimmte böse Vorahnung beschlich mich. Ich ignorierte sie jedoch.
»Styles ist wirklich ein wundervolles altes Haus«, sagte ich zu John.
Er nickte, doch er wirkte ziemlich bedrückt.
»Ja, es ist ein schöner Besitz. Eines Tages werde ich ihn erben – eigentlich müsste er mir schon längst gehören, wenn mein Vater damals ein gerechtes Testament gemacht hätte. Dann wäre ich nicht so knapp bei Kasse, wie ich es jetzt bin.«
»Was, du bist knapp bei Kasse?«
»Mein lieber Hastings, ich sage dir in aller Offenheit, dass ich vor lauter Geldsorgen nicht mehr weiterweiß.«
»Könnte dir denn dein Bruder nicht helfen?«
»Lawrence? Der hat jeden Penny, den er jemals hatte, für die Veröffentlichung seiner Gedichte in Luxusbänden ausgegeben. Nein, wir sind arm wie die Kirchenmäuse. Meine Mutter hat sich uns gegenüber immer äußerst großzügig verhalten – das heißt, bis jetzt. Seit ihrer Heirat natürlich …« Er brach ab und sah sorgenvoll drein.
Ich spürte, dass zusammen mit Evie etwas Undefinierbares aus der Atmosphäre verschwunden war. Ihre Anwesenheit hatte Sicherheit bedeutet. Jetzt war diese Sicherheit verschwunden und nun war die Luft voller Verdächtigungen. Das finstere Gesicht von Doctor Bauerstein stieg unangenehm vor meinem inneren Auge auf. Ein unbestimmter Verdacht gegen alles und jedes erfüllte mich. Einen Augenblick lang bedrückte mich die Vorahnung eines näher kommenden Unheils.
2Der 16. und 17. Juli
Am 5. Juli war ich in Styles angekommen. Im Folgenden berichte ich vom 16. und 17. dieses Monats. Zur besseren Orientierung der Leser werde ich die Ereignisse jener Tage so exakt wie möglich wiedergeben. Sie wurden später bei der Gerichtsverhandlung während langwieriger Kreuzverhöre ans Tageslicht gebracht.
Einige Tage nach ihrer Abreise erhielt ich einen Brief von Evelyn Howard, in dem sie mir mitteilte, sie arbeite als Krankenschwester in einem großen Krankenhaus in einer etwa fünfzehn Meilen entfernten Industriestadt. Sie bat mich um eine Mitteilung, falls Mrs Inglethorp je den Wunsch äußerte, sich wieder mit ihr zu versöhnen.
Das einzig Störende während dieser friedlichen Tage war Mrs Cavendishs höchst merkwürdige und in meinen Augen völlig ungerechtfertigte Vorliebe für die Gesellschaft Doctor Bauersteins. Ich konnte nicht begreifen, was sie in diesem Mann sah, aber sie lud ihn ständig ins Haus ein und machte häufig Ausflüge mit ihm. Ich muss gestehen, dass ich nichts Anziehendes an ihm bemerkte.
Der 16. Juli fiel auf einen Montag. Es war ein chaotischer Tag. Der angekündigte Basar hatte am Samstag stattgefunden und an diesem Abend sollte nun während einer damit verbundenen gesellschaftlichen Veranstaltung Mrs Inglethorp ein Kriegsgedicht rezitieren. Am Vormittag waren wir alle eifrig beschäftigt, den Dorfsaal, wo das Ereignis stattfinden sollte, herzurichten und zu dekorieren. Wir nahmen mittags einen späten Imbiss zu uns und verbrachten den Nachmittag im Garten. Mir fiel auf, dass John sich anders als sonst verhielt. Er erschien mir sehr aufgeregt und unruhig.
Nach dem Tee legte sich Mrs Inglethorp hin, um vor den abendlichen Anstrengungen auszuruhen, und ich forderte Mary Cavendish zu einem Tennisspiel auf.
Ungefähr um Viertel vor sieben trieb Mrs Inglethorp uns zur Eile an, weil wir sonst zum Abendessen zu spät kämen, da an diesem Abend früher als gewöhnlich gegessen wurde. Wir mussten uns sehr beeilen, um rechtzeitig fertig zu werden, und noch vor Beendigung der Mahlzeit wartete schon das Auto vor der Tür.
Die Veranstaltung wurde ein großer Erfolg, Mrs Inglethorps Rezitation erhielt donnernden Beifall. Es wurden auch noch lebende Bilder gestellt, wobei Cynthia mitmachte. Sie kehrte nicht mit uns zurück, da sie noch zu einem Essen eingeladen war und den Abend mit ein paar Freunden verbringen wollte, die bei den lebenden Bildern mitgewirkt hatten.
Am folgenden Morgen frühstückte Mrs Inglethorp im Bett, da sie ziemlich erschöpft war, aber sie kam äußerst energiegeladen gegen halb eins nach unten und rauschte mit Lawrence und mir im Schlepptau zu einer Luncheinladung davon.
»Was für eine reizende Einladung von Mrs Rolleston. Sie ist Lady Tadminsters Schwester, müssen Sie wissen. Die Rollestons kamen schon mit Wilhelm dem Eroberer nach England – eine unserer ältesten Familien.«
Mary hatte sich entschuldigt, sie hätte eine Verabredung mit Doctor Bauerstein.
Die Mahlzeit verlief sehr vergnüglich, und als wir losfuhren, machte Lawrence den Vorschlag, über Tadminster zurückzukehren, was höchstens eine Meile Umweg bedeutete, und bei Cynthia in ihrer Apotheke eine Stippvisite einzulegen. Mrs Inglethorp erwiderte, das sei eine glänzende Idee, aber da sie noch mehrere Briefe zu schreiben hatte, würde sie uns dort absetzen, und wir wollten dann später mit Cynthia in der Ponykutsche zurückkehren.
Wir wurden von einem misstrauischen Krankenhauspförtner festgehalten, bis Cynthia erschien und sich für uns verbürgte. In ihrer weißen Tracht sah sie sehr adrett und hübsch aus. Sie nahm uns nach oben in ihr Allerheiligstes mit und stellte uns ihrer Kollegin vor, einer furchteinflößenden Person, die Cynthia fröhlich mit Nibs anredete.
»Was für eine Menge Flaschen!«, rief ich aus, als ich meinen Blick in dem kleinen Raum herumwandern ließ. »Wissen Sie wirklich, was in jeder drin ist?«
»Sagen Sie doch mal was Originelles«, stöhnte Cynthia. »Jeder, der hier hochkommt, fragt dasselbe. Wir haben uns schon überlegt, ob wir dem Ersten, der das nicht sagt, einen Preis geben sollen. Und ich weiß auch schon, was Sie als Nächstes sagen werden: Wie viele Menschen haben Sie schon vergiftet?«
Ich lachte und bekannte mich schuldig.
»Wenn ihr wüsstet, wie schrecklich leicht es ist, jemanden aus Versehen zu vergiften, würdet ihr keine Witze drüber machen. Kommt, lasst uns Tee trinken gehen. Wir haben alle möglichen geheimen Vorräte in diesem Regal. Nein, Lawrence, das ist der Giftschrank. Der große da, stimmt.«
Wir tranken in ausgelassener Stimmung unseren Tee und halfen Cynthia hinterher beim Abwaschen. Gerade als wir den letzten Teelöffel weggeräumt hatten, klopfte es an die Tür.
Cynthia und Nibs sahen plötzlich ganz streng und furchteinflößend aus.
»Herein«, sagte Cynthia in höchst professionellem Ton.
Eine junge und ziemlich erschrocken dreinschauende Krankenschwester erschien mit einer Flasche, die sie Nibs geben wollte. Doch die verwies sie an Cynthia mit der ziemlich rätselhaften Bemerkung weiter: »Ich bin heute eigentlich gar nicht da.«
Cynthia nahm die Flasche und begutachtete sie mit der Strenge eines Richters.
»Das hätte schon heute Morgen hier herauf geschickt werden müssen.«
»Der Schwester tut das sehr leid. Sie hat es vergessen.«
»Die Schwester sollte die Anweisungen draußen an der Tür lesen.«
Der Ausdruck auf dem Gesicht der kleinen Krankenschwester verriet mir, dass sie der gefürchteten Oberschwester diese Botschaft bestimmt nicht ausrichten würde.
»Das kann deshalb erst morgen erledigt werden«, beendete Cynthia ihren Satz.
»Könnten wir es nicht vielleicht heute noch kriegen?«
»Hm. Wir sind zwar sehr beschäftigt, aber wenn wir es schaffen, dann bekommen Sie es«, sagte Cynthia gnädig.
Die kleine Krankenschwester ging wieder und sofort nahm Cynthia ein Glasgefäß vom Regal, füllte die Flasche wieder auf und stellte sie auf den Tisch draußen auf dem Flur.
Ich lachte.
»Die Disziplin muss gewahrt werden?«
»Ganz recht. Kommen Sie auf unseren kleinen Balkon. Von dort aus können Sie alle anderen Stationen sehen.«
Ich folgte Cynthia und ihrer Freundin und sie zeigten auf die verschiedenen Stationen und erklärten sie mir. Lawrence blieb drinnen, aber schon kurz darauf rief Cynthia ihm zu, er solle doch zu uns nach draußen kommen. Dann sah sie auf ihre Uhr.
»Nichts mehr zu tun, Nibs?«
»Nein.«
»Wie schön. Dann können wir ja zuschließen und gehen.«
An diesem Nachmittag hatte ich Lawrence von einer ganz neuen Seite kennengelernt. Im Vergleich zu John war er sehr verschlossen, und man kam nur sehr schwer an ihn heran. Er war in fast jeder Hinsicht das genaue Gegenteil seines Bruders: ungewöhnlich schüchtern und zurückhaltend. Dennoch besaß er einen gewissen Charme, und ich gewann den Eindruck, dass man ihn bei näherem Kennenlernen sehr lieb gewinnen konnte. Ich hatte mir immer eingebildet, sein Verhalten Cynthia gegenüber wäre eher zurückhaltend und sie verhielte sich in seiner Gegenwart eher schüchtern. Aber an diesem Nachmittag waren beide äußerst fröhlich und schwatzten miteinander wie zwei Kinder.
Als wir durchs Dorf fuhren, fiel mir ein, dass ich noch Briefmarken brauchte, deshalb hielten wir vor der Post an.
Beim Herauskommen stieß ich mit einem kleinen Mann zusammen, der gerade hineinging. Ich wich zur Seite und entschuldigte mich, als er mich plötzlich mit einem lauten Ausruf in die Arme schloss und herzlich küsste.
»Mon ami Hastings!«, rief er. »Das ist ja tatsächlich mon ami Hastings!«
»Poirot!«
Ich ging mit ihm zu der Ponykutsche.
»Das ist ein sehr erfreuliches Wiedersehen für mich, Miss Cynthia. Darf ich Ihnen meinen alten Freund, Monsieur Poirot, vorstellen? Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen.«
»Oh, wir kennen Monsieur Poirot«, sagte Cynthia fröhlich. »Wir hatten aber keine Ahnung, dass er ein Freund von Ihnen ist.«
»Natürlich kenne ich Mademoiselle Cynthia«, sagte Poirot ernst. »Meine Anwesenheit hier ist eine Folge von Mrs Inglethorps Güte.« Als ich ihn fragend ansah, fuhr er fort: »Ja, mein Freund, sie hat ihre Gastfreundschaft auch sieben meiner Landsleute zuteilwerden lassen, die unglücklicherweise als Flüchtlinge ihre Heimat verlassen mussten. Wir Belgier werden ihrer immer mit höchster Dankbarkeit gedenken.«
Poirot war ein kleiner Mann von ungewöhnlichem Aussehen. Er war knapp einen Meter sechzig groß, aber seine Haltung verriet Würde. Sein Kopf hatte genau die Form eines Eies, und er neigte ihn stets ein wenig zur Seite. Sein Schnurrbart war mit militärischer Strenge steif gezwirbelt. Seine Erscheinung war von geradezu unglaublicher Korrektheit, wahrscheinlich hätte ihm ein Staubkorn mehr Unbehagen verursacht als eine Schusswunde. Doch zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass dieser seltsame geschniegelte kleine Mann jetzt stark hinkte, er, der doch zu seiner Zeit einer der berühmtesten Mitarbeiter der belgischen Kriminalpolizei gewesen war. Für einen Detektiv hatte er ein außergewöhnliches Flair bewiesen, und er hatte Triumphe gefeiert, als er einige der rätselhaftesten Fälle seiner Zeit gelöst hatte.
Er wies auf das kleine Haus, das er zusammen mit seinen Landsleuten bewohnte, und ich versprach, ihn so bald wie möglich zu besuchen. Dann lüftete er Cynthia gegenüber schwungvoll seinen Hut und wir fuhren weiter.
»Er ist ein reizender kleiner Mann«, sagte Cynthia, »ich hatte keine Ahnung, dass Sie ihn kennen.«
»Sie hatten eine Berühmtheit zu Gast und waren sich dessen nicht bewusst«, erwiderte ich.
Dann erzählte ich ihnen auf dem Rest des Heimwegs von den verschiedenen Heldentaten und Triumphen Hercule Poirots.
In bester Stimmung kehrten wir heim. Als wir die Eingangshalle betraten, kam gerade Mrs Inglethorp aus ihrem Boudoir. Ihr Gesicht war gerötet und sie sah aufgebracht aus.
»Ach, ihr seid es«, sagte sie.
»Stimmt irgendetwas nicht, Tante Emily?«, fragte Cynthia.