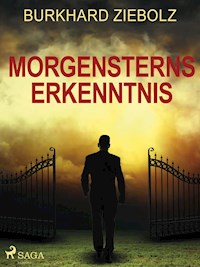Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein spannender Krimi, der Realität und Fiktion verbindet!Der italienische Physiker Ettore Majorana verschwindet im Frühjahr 1938 spurlos und tauchte nie mehr auf. Jedoch nicht, bevor er die Zeugnisse seiner Arbeit vernichtet hat. Auf dieser wahren Begebenheit baut Ziebolz seine Geschichte aus und liefert eine fiktive Erklärung für die Geschehnisse: Majorana versucht der Bedrohung der Geheimdienste zu entfliehen, nachdem er eine revolutionäre Entdeckung gemacht hat. Und setzt sich und seine Umgebung in seiner Verzweiflung immer mehr Gefahren aus...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Ziebolz
Das geheime Leben des Ettore Majorana - Kriminalroman
Saga
Das geheime Leben des Ettore Majorana - KriminalromanCopyright © 2000, 2019 Burkhard Ziebolz und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726086782
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Mein Dank gilt wieder einmal Sabine, Christiane, Peter und Michael, für ihr hartnäckiges, fast trotziges Korrekturlesen und ihre ungebrochene Diskussionsbereitschaft. Prof. Christian Kleint danke ich für seine freundliche Kooperation und Sabine Zinke für die fleißige Übersetzung aus dem Italienischen.
Der Kommune Catania danke ich dafür, daß sie alle meine Anfragen konsequent ignoriert und damit meinen Gedanken mehr Freiheit gegeben hat.
Prolog
Ettore Majorana
1906
Geboren in Catania, Sizilien
Bis 1923
Besuch des humanistischen Gymnasiums in Catania
1923 – 1928
Studium der Ingenieurswissenschaften an der Universität zu Rom
1929
Promotion in theoretischer Physik, unter Leitung von Enrico Fermi, danach als freier Mitarbeiter am Institut für Physik, theoretische Forschungen verschiedener Natur
1933
Studienreisen nach Deutschland und Dänemark
1933-37
Zurück in Rom, wieder am Institut für Physik, arbeitet viel zu Hause.
1938
Professur an der Universität Neapel
März 1938
Verschwunden aus seinem Leben
Teil 1: Der Sizilianer
»Wo soll ich beginnen? Die Welt ist so groß. Ich werde also mit dem Land beginnen, das ich am besten kenne, mit meinem eigenen. Aber mein Land ist so groß. Ich fange doch lieber mit meiner Stadt an. Aber meine Stadt ist so groß.
Am besten beginne ich mit meiner Straße. Nein, mit meinem Haus.
Nein, mit meiner Familie. Ach was, ich beginne bei mir.«
Elie Wiesel
»Beginne am Anfang«, sagte der König ernst, »und fahre fort, bis du ans Ende kommst: dann höre auf«
Lewis Carroll
1.
Der Weg scheint endlos und ist doch nur dreißig Meter lang, sein Ende deutlich zu erkennen. Sogar das Namensschild sieht Himmelreich, der langsam geht, als könne jede hastige Bewegung seine Umgebung verschwimmen lassen, wie eine Bewegung im Wasser die Ordnung der Oberfläche zerstört.
Alfred Winkler.
Die Tür ist aus dickem, dunklem Holz, mit Masern rot wie Blut, die Klingel ein angenehm dunkler Gong. Sie öffnet sich schnell, als hätte sie auf ihn gewartet. Das Gesicht hinter der Tür – alt geworden, mit tiefen Furchen, aber immer noch unverkennbar dieselbe Person, und immer noch brennt die alte Kraft aus dunklen Augen. Kein Erschrecken, keine Angst findet sich in der Stimme, die noch kräftig und laut ist; sie klingt eher, als hätte er ihn schon seit langer Zeit erwartet.
»Victor. Wir haben uns lange nicht gesehen.« Und, als Victor nicht antwortet, sondern ihn nur anschaut: »Ich wußte, daß du irgendwann kommen würdest.«
»Du mußtest damit rechnen«, antwortet Himmelreich.
Die Schultern des anderen sinken ein Stück vornüber. Die Gestalt, früher kraftvoll und sehnig und nun nur noch der ausgemergelte Schatten eines anderen Lebens, tritt beiseite und gibt den Weg frei ins Innere des Hauses.
»Es gibt viel zu erzählen, und wenig Zeit dafür.«
Die Mauser drückt an der rechten Brustseite. Es gibt zeitgemäßere Waffen, leichter, kleiner und effektiver, aber Himmelreich bevorzugt das alte Ding, weil es ihn an alte Tage erinnert.
Die Pistole ist ein Fossil, Relikt einer anderen Epoche und einer anderen Umgebung, aber ist er nicht selber auch eines?
Dann sitzen sie sich endlich gegenüber. Das Haus ist groß, und sein Bewohner – ist er allein hier? – scheint nur einen kleinen Teil zu nutzen. Das Zimmer ist vollgestopft mit Erinnerungsstücken aus allen Teilen der Welt, Fotoalben, Kisten mit Dias, gerahmten Bildern an den Wänden, ein Magazin der Erinnerung. Ein ganzes Leben auf fünf mal fünf Metern, aber dennoch, würde man das Material hier auswerten, man wüßte immer noch nicht, wer oder was sein Besitzer wirklich war, dessen ist sich Himmelreich sicher.
Himmelreich sitzt leicht vorgebeugt auf der Kante eines braunledernen Clubsessels, seine Jacke öffnet sich am Revers und gibt den Blick frei auf den antiquierten Bakelitgriff der Waffe. Er sieht die vielen Pillendosen und das Spritzbesteck auf dem kleinen Glastisch.
»Bist du krank?«
Der andere zuckt mit den Schultern.
»Ein wenig Zucker, ein wenig die Lunge, ein wenig von allem. Und selber?«
»Man muß zufrieden sein.«
Eine Pause entsteht. Wie sagt man jemandem, daß man gekommen ist, ihn zu töten? Denn sagen muß man etwas, bevor man es tut. Das Urteil muß verkündet werden, mit allen Begründungen, sonst wäre es keine Strafe.
Auch wenn der Verurteilte den Richterspruch schon kennt.
»Wohnst du alleine hier?«
»Ja.«
»Du nennst dich hier Winkler.«
Die Stimme ist schwer, die Worte kommen heraus wie zäher Sirup.
»Alfred Winkler. Ein Name ist so gut wie der andere.«
Wieder eine Pause, und dann:
»Du weißt, warum ich hier bin?«
»Ich kann es mir denken.«
»Es ist wegen Irmgard.«
Das Gesicht bleibt ausdruckslos. Ein Krächzen, kaum als Lachen zu erkennen, drängt zwischen den trockenen Lippen hervor.
»Ja. Dabei gäbe es bessere Gründe, mich zu erledigen.«
Himmelreich nickt zum Zeichen des Verständnisses.
»Ganz bestimmt, nur fällt das nicht in meine Verantwortung. Mich geht nur ein Fall an. Mein persönlicher Fall.«
»Du kommst, um sie zu rächen?«
»Ich komme, um dich zu bestrafen.«
Wieder das trockene Lachen.
»Ohne Verhandlung? Ohne mir die Möglichkeit zur Rechtfertigung zu geben? Du hast dich verändert, Victor. Du bist nicht mehr derselbe wie früher. Nicht mehr Victor, der Gerechte.«
»Leute wie du haben dafür gesorgt.«
Man merkt, wie es in Winkler arbeitet, seine Augen wandern ohne Unterlaß durch den Raum als suchten sie etwas, an dem sie sich festmachen können, einen Anker, einen Rettungsring.
»Und du bist den Dingen von damals auf den Grund gegangen.«
»Ich kenne die Einzelheiten.«
»Wirklich alle Einzelheiten? Weißt du genau, wie das mit Irmgard war? Und was aus Ettore geworden ist?«
Himmelreich lehnt sich zurück. Eigentlich hatte er die Zeit nicht eingeplant, aber vielleicht ist es richtig so, vielleicht muß wirklich noch einmal über alles geredet werden. Es wird ihm selber helfen, wenn er den Weg zurückgeht. Und es gibt ihm noch ein wenig Zeit.
Außerdem fehlen ihm tatsächlich noch ein paar Bausteine, um das Bild vollständig zu sehen.
»Also schön.«
Der andere atmet hörbar auf. Nur noch ein krankes Bündel welkes Fleisch, aber dennoch, er hängt am Leben wie alle anderen auch.
»Vielleicht siehst du nicht, welche Rolle ich wirklich gespielt habe vor vierzig Jahren. Wir schreiben jetzt 1975, und alles hat sich geändert. Damals taten wir nur, was wir tun mußten, zum Wohle unseres Volkes. Und meine Gründe ...«
»Sag, was du zu sagen hast.«
»Ich wollte vorschlagen, daß du beginnst. Bei dir fing alles an, meine Rolle begann erst später. Und ich kenne die Vorgeschichte der Affäre Majorana nicht.«
Die Affäre Majorana. So hieß die Geschichte damals in der Presse, und die Zeitungen waren voll davon. Ein junger genialer Atomphysiker, Zögling Fermis, verschwunden von einem Tag auf den anderen, nachdem er alle seine Forschungsergebnisse vernichtet hatte. Himmelreich schließt für einen Moment die Augen und sieht die Schlagzeilen wieder vor sich, dicke Balken auf den Titelseiten der europäischen Zeitungen. Die Erinnerung ist zwar immer da gewesen, aber die Zeit hat sie schwächer gemacht. Jetzt, in diesem Moment, strömt sie in ihn zurück wie ein mächtiger Strom, der ein lange trocken gelegenes Becken füllt. Winkler will Zeit gewinnen, das ist ihm klar, aber zu groß ist die Verlockung, endlich über alles reden zu können, mit jemandem, der wirklich weiß, worum es geht.
Auch wenn dieser jemand ein Mörder ist.
2.
Victor Himmelreich ist Student der Physik im achten Semester in München im Jahr 1933, als man an ihn herantritt. Ob er Lust hätte, nach Leipzig zu gehen, zu Heisenberg. Man könnte das arrangieren. Um das Geld würde man sich auch kümmern, um finanzielle Unterstützung und um ein Zimmer. Das wäre alles kein Problem.
Himmelreich ist, als träume er.
Werner Heisenbergs Ruf ist schon von internationaler Bedeutung und durchbraust die wissenschaftliche Gemeinde überall auf der Welt wie ein Sturm, der alles durcheinander wirbelt und nichts an seinem Platze läßt. Nach der Gastprofessur in Chicago hat er den Lehrstuhl für Physik in Leipzig übernommen. In seiner Nähe zu arbeiten, durch seine Schule zu gehen, ist eine Empfehlung, höhere Weihen mit dem Beigeschmack der Zugehörigkeit zur Elite. Und wenn Himmelreich zurückdenkt, muß er feststellen, daß ihn die Zeit dort wirklich und in jeder Hinsicht weitergebracht hat. Es ist nicht allein der Stoff, der vermittelt, und die Projekte, an denen gearbeitet wird, es ist ganz einfach das intellektuelle Klima und besonders Heisenbergs Genius, der allem seinen Stempel aufdrückt. Man spürt, man ist unter denkenden Leuten, man diskutiert, und es entstehen Gedanken in einem, die an einem anderen Platz niemals entstanden wären.
All das weiß der kleine, schlanke Student mit der energischen Nase, den tiefliegenden Augen und dem sauber gestutzten Oberlippenbärtchen zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Seine Vorstellungen sind auch nur vage, wenn er an seine berufliche Zukunft denkt, und dennoch hätte er alles getan, um an diesen Ort zu gelangen. Also fragt er nach der Gegenleistung, die er zu erbringen hat, denn eine Gegenleistung muß es geben. Sie sagen es ihm, freundlich, sachlich, und er findet absolut nichts dabei. Es ist nichts Kriminelles dabei, noch nicht einmal etwas Anstößiges in der damaligen Zeit.
Ein paar Informationen soll er beschaffen, über eine ihm damals noch völlig unbekannte Person, die mit ihm in Leipzig arbeiten würde.
Nein, nicht ganz unbekannt.
Er kennt den Mann, um den es geht, aus der Fachpresse und aus dem, was über ihn geredet wird.
Und was er über ihn gehört hat, macht ihn gespannt.
3.
Im Frühjahr 1933 treffen sich zwei Männer in einem repräsentativen Büro des Berliner Reichstages. Der Raum ist riesig, fast schon ein Saal, und komplett mit Holz vertäfelt, dunkel mit feinen Intarsien, die Wappen, Fahnen und allegorische Tiere darstellen. Um einen großen, runden Tisch in der Mitte stehen ledergepolsterte Stühle aus massivem Ebenholz, und die Wände schmücken zwei riesige Schlachtengemälde aus dem vorigen Jahrhundert; ein Gemenge von blauen und roten Uniformen, gezückten Säbeln, stolzen Pferden und ästhetisch leidenden Verwundeten, bunter, glorifizierender Abgesang der Kriegskunst einer anderen Epoche, bar jeglicher Realität und von jemandem gemalt, der nie ein wirkliches Schlachtfeld gesehen hat.
Am anderen Ende des Büros, direkt vor den hohen Fenstern, sitzt hinter einem Schreibtisch von riesigen Ausmaßen ein Mann und blickt Friedrich von Callwitz kühl entgegen.
»Mein lieber von Callwitz. Es freut mich, daß wir uns endlich kennenlernen.«
»Ist mir eine Ehre, Herr Reichskriegsminister.«
Callwitz´ Hacken knallen mit einer Lautstärke zusammen, die sicher bis auf den Flur zu hören ist. Er schrickt selbst ein wenig zusammen. Alte Angewohnheiten wie diese wird man schwer wieder los, und in seinem Geschäft kann man sie sich eigentlich nicht leisten. Einmal, vor vier Jahren in Bulgarien, hat sie ihn fast das Leben gekostet. Er konnte sich damals nur retten, indem er seinen Gesprächspartner erschoß; eine sehr bedauerliche Konsequenz angesichts der Tatsache, daß er ihn eigentlich als Informationsquelle hatte nutzen wollen.
Ohne aufzustehen, weist der Minister mit einer kleinen, präzisen Bewegung der rechten Hand auf den Besucherstuhl vor seinem Tisch.
»Ich habe wenig Zeit, darum will ich gleich zur Sache kommen. Sie sind mir empfohlen worden, beziehungsweise, ihre Referenzen haben Sie empfohlen. Einer der fähigsten Agenten der alten Regierung, loyal, Auslandseinsätze, mehrere Sprachen fließend, und so weiter und so weiter, sehr beeindruckend, das.«
Callwitz schweigt. Es gibt Situationen, da profiliert man sich am besten durch Schweigen. Die Wirren der letzten Monate haben sich auch auf sein Geschäft ausgewirkt, und er ist froh, nach zwei Jahren Verwaltungstätigkeit wieder für etwas anderes im Gespräch zu sein. Als Sprößling eines alten Adelsgeschlechtes mit vierhundertjähriger Tradition in der Armee verbindet ihn wenig mit den neuen Machthabern, aber letztendlich ist ihm egal, wer die Befehle gibt, wenn sie nur interessante Aufgaben für ihn bringen.
»Danke, Herr Reichskriegsminister.«
Von Blomberg lehnt sich zurück und mustert eindringlich den jungen Mann, der kerzengerade aufgerichtet auf seinem Stuhl sitzt und wartet, gleichzeitig entspannt und aufmerksam. Groß, blond, blauäugig, der arische Urtypus, als Agent leicht zu erkennen und daher für die Aufgabe wenig geeignet; dennoch, seine Erfolge sprechen für sich. Blomberg fragt sich, was intelligente, gebildete Menschen in einen solchen Beruf treibt, in Unsicherheit, Gefahr und ständige Anspannung.
Wahrscheinlich muß man dazu geboren sein.
Er seufzt, setzt seine runde Nickelbrille ab und beginnt, sie akribisch mit einem Taschentuch zu putzen, das er frisch gebügelt einer Schublade des Sekretärs entnimmt.
»Wir haben eine Aufgabe für Sie, Callwitz. Wie gut waren Sie in Physik, damals auf dem Gymnasium?«
»Oberes Drittel der Klasse, Herr Reichskriegsminister. Nicht unbedingt mein Lieblingsfach, aber ganz ordentlicher Abschluß.«
»Natürlich. Nun, eigentlich ist es auch egal, aber der Mann, um den es geht, ist Physiker, und er arbeitet an Dingen, die möglicherweise von großer Bedeutung für das Reich sein könnten. Der Führer hat ein großes Interesse daran, daß wir uns seiner Dienste versichern.«
Callwitz wartet. Die Sache mußte einen Haken haben, sonst wären sie nicht zu ihm gekommen, sondern hätten nur die Staatskasse bemüht.
Blomberg läßt sich Zeit. Er beugt sich vor, greift nach einer großen, polierten Zedernholzkiste und zieht sie über die lederbezogene Schreibtischoberfläche zu sich heran. Er öffnet sie und hält sie Callwitz hin.
»Zigarre?«
Callwitz greift zu, auch der Minister bedient sich. Die Zigarre könnte ein Hinweis auf die Länge sein, die das Gespräch noch haben wird, und damit auf seine Bedeutung. Wenn der Reichskriegsminister sich eine Stunde Zeit für ein Gespräch mit einem Fremden nimmt, kann es keine Lappalie sein, über die geredet wird.
Sie setzen die Havannas umständlich in Brand.
»Es gibt zwei Dinge, die uns im Weg stehen. Zum einen ist der Mann Italiener, gehört also einer uns nahestehenden Nation an. Wir haben deshalb nicht ganz so viel Bewegungsraum wie in anderen Fällen.«
Callwitz weiß immer noch nicht, worauf der andere hinaus will.
»Eine Frage, Herr Reichskriegsminister, wenn Sie gestatten.«
Er wartet Blombergs Nicken ab, bevor er fortfährt.
»Warum nutzen wir nicht die offiziellen Kanäle und bitten die italienische Regierung um Unterstützung?«
Blomberg wehrt ab.
»Es gibt bestimmte politische Gründe gegen ein solches Vorgehen. Und dann – wir glauben, daß die Italiener gar nicht wissen, was Sie an diesem Mann haben, und wir möchten nicht diejenigen sein, die sie darauf hinweisen. Uns würde das Wissen dieser Person jedenfalls mehr nützen als den Italienern, so nahe uns diese auch im Herzen stehen mögen. Wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Keine weiteren Fragen dazu. Callwitz weiß, wann er noch mit Antworten zu rechnen hat und wann nicht mehr. Sein Geschäft kann schmutzig sein, aber die Politik ist es in noch viel stärkerem Maße.
»Jawohl. Und der andere Grund?«
»Der andere Grund. Der andere Grund ist, daß wir vermuten, daß der Mann nicht unbedingt wild darauf sein wird, uns zu helfen.«
»Dann kaufen Sie ihn.«
Blomberg lächelt matt.
»Er hat Geld genug. Jedenfalls für seine Bedürfnisse.«
»Nehmen Sie es ihm weg.«
»Dazu haben wir nicht die Möglichkeit, beziehungsweise, das würde nicht ohne Aufsehen abgehen. Sie sehen, es ist schwierig. Eine Aufgabe für einen Spezialisten. Eine Aufgabe für Sie. Glauben Sie, Sie schaffen das?«
Callwitz pafft und stößt eine gewaltige Rauchwolke in den Raum, dann gestattet er es sich, die aufrechte Haltung aufzugeben und in die Rückenlehne zu sinken.
»Es gibt immer einen Weg.«
4.
Hartmanns senkrechte Stirnfalte vertieft sich jedesmal, wenn ihm etwas bedenklich vorkommt und er darüber nachdenken muß. Seit er Victor Himmelreich kennengelernt hat und um die Art und Weise weiß, wie dieser an das Institut gekommen ist, furcht sie sich jedesmal, wenn er den jungen Mann sieht. Der klein gewachsene Hartmann hat nichts gegen Fürsprache oder Empfehlung, aber nur bis zu einer bestimmten, von ihm selbst definierten Grenze; in Himmelreichs Fall scheint diese überschritten worden zu sein. Weil er aber von Natur aus zu höflich ist – seine Frau nennt es schlicht feige –, seiner Kritik direkt und verbal Ausdruck zu verleihen, erschöpft sich diese in der Stirnfalte, und in gelegentlichem Runzeln der dichten Augenbrauen.
»Herr Himmelreich, darf ich Ihnen Doktor Majorana vorstellen. Er ist für einige Zeit an unser Institut gekommen, um sich über unsere Arbeiten zu informieren und uns an seinen Erkenntnissen teilhaben zu lassen.«
Himmelreich kennt Majorana natürlich, nicht erst aus den Vorgesprächen mit den Männern, die ihn nach Leipzig geschickt haben. Er kennt den Lebenslauf des gebürtigen Sizilianers, weiß um seine Arbeiten an der Universität in Rom, hat einiges davon gelesen und teilweise sogar verstanden. Vieles aber ist ihm verschlossen geblieben, liegt hinter einer Tür, die durch Intelligenz und Eifer allein nicht zu öffnen ist.
»Herr Majorana, darf ich Ihnen Victor Himmelreich vorstellen. Er kommt von Professor Schneider aus München zu uns, um seine Studien bei Professor Heisenberg fortzusetzen.«
Majoranas dunkles Gesicht mit den dicken Lippen, möglicherweise Erbe afrikanischer Vorfahren, verbreitert sich in ein höfliches Lächeln. Er ist größer, als Victor ihn sich vorgestellt hat, entspricht aber sonst genau den Bildern, die er bei seinen Berliner Auftraggebern gesehen hat: Schwarzes Haar, mit Pomade zu einer korrekten Frisur geformt, dunkle, melancholische Augen, eine relativ breite Nase. Sein Deutsch ist holprig und unsicher, er sucht nach jedem Wort, aber man versteht ihn.
»Guten Tag.«
»Professor Heisenberg hilft Herrn Majorana ein wenig mit dem Deutschen, und er hat schon viel dazu gelernt während seines Aufenthaltes.«
Hartmann fühlt sich offenbar zu dieser Entschuldigung genötigt, so, als trüge er selbst die Verantwortung für das schlechte Ausdrucksvermögen seines Gastwissenschaftlers.
Himmelreich lächelt ebenfalls und reicht dem Sizilianer die Hand. Sein Italienisch, das bis vor ganz kurzer Zeit noch so hölzern geklungen hat wie Majoranas Deutsch, ist durch den Intensivkurs – acht Stunden am Tag, vierzehn Tage lang – flüssig und auf dem aktuellsten Stand italienischer Sprachgewohnheiten.
»Freut mich ebenso. Und es freut mich besonders, daß ich mein Italienisch etwas üben kann.«
Über das Gesicht des Gegenübers huscht ein Ausdruck der Freude, schnell wie der Schatten eines Vogels. Als er antwortet, scheint er ein anderer Mensch zu sein. Wie wichtig es ist, sich ausdrücken zu können, denkt Himmelreich. Intelligenz ist wichtig, aber Sprache ist für den ersten Eindruck noch wichtiger. Sie macht den Menschen, gibt ihm Gesicht und Charakter; ohne Sprache ist er nichts.
»Wo haben Sie so gut Italienisch gelernt? Es ist fast perfekt.«
Himmelreichs Lächeln ist wie eingemeißelt. Er ist kein Schauspieler, es fällt ihm schwer, eine bestimmte Miene ohne natürliche Veranlassung über längere Zeit beizubehalten. Aber er hat sich gut auf den Moment der ersten Begegnung vorbereitet, und er denkt daran, daß er nicht hier wäre, gäbe es den Italiener nicht.
»Meine Mutter war Halbitalienerin. Leider starb sie zu früh, deshalb sind meine sprachlichen Fähigkeiten eher begrenzt geblieben. Aber ich war einige Male in ihrem Land, im Urlaub.«
Die erst Lüge, die ersten zwei sogar, von vielen, die noch kommen werden. Sie geht ihm flüssig von den Lippen, und es bleibt nichts zurück in seinem Mund, kein bitteres Gefühl der Schuld oder auch nur der schale Geschmack von Schäbigkeit.
Hartmanns Staunen ist nicht zu übersehen. Er betrachtet Himmelreich auf einmal anders, mit mehr Respekt und interessierter, so, wie man im Zoo ein seltenes, schönes Tier begutachtet.
»Ich wußte nicht, daß Sie des Italienischen mächtig sind.«
Himmelreichs Lächeln ist nicht weniger nachsichtig als das Majoranas vorher, und nur etwas demütiger.
»Es gab keinen Grund, das an die große Glocke zu hängen, zumal es auch mit meinem Fachgebiet nichts zu tun hat. Außerdem ist es nicht so gut.«
»Wie auch immer, es freut mich sehr für unseren italienischen Kollegen. Offen gestanden, außer Professor Heisenberg hat er hier nicht viel Kontakt. Er spricht kaum deutsch, und die meisten der Mitarbeiter scheuen den Ausflug auf ein sprachliches Terrain, das ihnen fremd ist. Ich nehme mich da übrigens nicht aus.«
Majorana, der der deutsch geführten Unterhaltung mit Interesse und offenkundigem Unverständnis gefolgt ist, blickt Himmelreich auffordernd an. Er blickt nicht Hartmann an, sondern Himmelreich, wie dieser mit Befriedigung registriert. Der andere hat ihn offenbar schon akzeptiert, und nicht nur das, er räumt ihm nach der kurzen Bekanntschaft schon eine Sonderstellung ein: Ansprechpartner, vielleicht Beistand, wenn es mal Verständnisprobleme oder andere Schwierigkeiten gibt.
Victor Himmelreich, Sohn eines Ladenbesitzers aus Nürnberg, ist mit sich zufrieden.
5.
Anfang Juni gibt Heisenberg ein Fest für einige Freunde und Kollegen des Institutes – natürlich ist auch Majorana eingeladen. Heisenberg hat großes Interesse an dem jungen Mann, größeres als an vielen anderen seiner Mitarbeiter. Die zwei spielen abends oft Schach zusammen, und Heisenberg tut sein Bestes, um dem Italiener die deutsche Sprache näher zu bringen.
Als seine Mutter ihn einmal fragt, wieso er Majorana diese Sonderbehandlung unter all seinen Mitarbeitern angedeihen läßt, antwortet Heisenberg:
»Weil er Physik denkt. Er arbeitet nicht als Physiker, er lebt Physik, und denkt Physik.«
»So wie du«, ergänzte seine Mutter, und Heisenberg hatte genickt.
Es stimmte. Majoranas alleiniges Interesse richtete sich auf sein Fachgebiet, und dafür ist ihm eine Art natürlicher Begabung in die Wiege gelegt worden. Majorana lebt Physik, atmet Physik, bewegt sich in ihr wie in einer fremden Dimension, die nur wenigen Eingeweihten zugänglich ist. Daß seine Karriere dennoch nicht bilderbuchmäßig verläuft wie bei Heisenberg und schließlich wie bei diesem zwangsläufig mit dem Nobelpreis endet, liegt an seiner introvertierten Art und fast manischen Zurückhaltung. Er haßt es, im Mittelpunkt zu stehen, und behält daher seine Gedanken – so gut sie auch sein mögen – für sich, so lange es nur eben geht. Heisenberg ist in diesem Punkt übrigens völlig anders, er will immer überall der Beste sein – egal ob in der Physik, beim Spiel oder Sport – und wenn er es ist, zeigt er es auch.
Enrico Fermi, Majoranas alter Chef und Doktorvater in Rom, seinerseits einer der begnadetsten Physiker seiner Zeit, hat Ettores Art akzeptiert und entsprechende Rücksicht darauf genommen. Hätte er ihn zwingen sollen, mehr aus sich zu machen? Damit wäre niemandem gedient gewesen, am allerwenigsten Ettore selbst. Also läßt er ihn einfach arbeiten, und wo er kann, macht er die Gedanken seines Zöglings der Öffentlichkeit zugänglich und festigt dessen Ruf als Wissenschaftler von beachtlichem Rang. Und Majorana, der dies wohl bemerkt und zu schätzen weiß, dankt es ihm mit absoluter Loyalität.
Trotzdem werden die zwei niemals richtige Freunde.
Sie unterhalten sich oft privat, und wenn sie im Institut alleine sind, messen sie sich manchmal scherzhaft im Wettrechnen: Fermi löst dabei eine komplizierte Gleichung mit Papier und Bleistift, und Majorana rechnet dasselbe im Kopf. Wenn Fermi fertig ist, hat Majorana die Gleichung meistens schon gelöst. Das ist der Unterschied, den Heisenberg meint.
Der eine erarbeitet es sich und wendet dabei Methoden an, die er gelernt hat.
Der andere denkt es einfach.
Die Gesellschaft in Heisenbergs Haus in Leipzig setzt sich aus Freunden und ein wenig lokaler Prominenz zusammen. Außer Majorana sind nur drei Institutsangehörige eingeladen: Paul Hartmann, Saito Nishimura, ein japanischer Gastforscher, und natürlich – weniger aufgrund seiner guten Beziehungen nach Berlin als aus einer Laune Heisenbergs heraus – Victor Himmelreich. Insgesamt sind an diesem Abend etwa dreißig Personen anwesend.
Majorana fühlt sich in großen Gesellschaften immer unwohl. Er hat das Gefühl, daß die anderen Gäste ihn beobachten wie irgendein exotisches Tier, und vielleicht sogar etwas Besonderes von ihm erwarten, irgendein Kunststückchen oder einen Beweis seines überragenden Intellekts. Natürlich passiert das nie wirklich, und gewöhnlich legt sich das unsichere Gefühl nach einer Weile, wenn er durch die Gespräche abgelenkt ist.
Nur heute legt es sich nicht.
Halb unbewußt dreht er den Kopf hin und her. Ist da nicht vielleicht wirklich jemand, der ihn ansieht? Natürlich gibt es immer irgendwen, der in seine Richtung blickt, aber tut er dies möglicherweise mit größerem Interesse als es der Situation angemessen wäre? Er sieht sich verstohlen die Gesichter an, eines nach dem anderen, wird dabei – paradoxerweise – selbst zum Beobachter der anderen, ohne irgend etwas Ungewöhnliches entdecken zu können.
»Darf ich mich setzen?«
Die Stimme ist zu hoch für einen Mann, und zu tief für eine Frau. Ettore blickt auf, direkt in das lächelnde Gesicht des japanischen Gastforschers Saito Nishimura. Sein Deutsch, auf der Schule in Osaka ausgefeilt, ist sehr gut, ohne die asiatische Abkunft leugnen zu können.
»Bitte.«
Der Japaner verbeugt sich leicht, stellt sich vor und nimmt in dem Sessel ihm gegenüber Platz. Er zieht ein silbernes Zigarettenetui aus der Tasche und bietet es ihm an.
»Möchten Sie? Ah, ich sehe, Sie haben schon.«
Ettore hält demonstrativ seine eigene Packung Macedonia hoch.
»Trotzdem – vielen Dank.«
Nishimura zündet eine türkische Zigarette an und saugt den Rauch tief ein. Er trägt einen perfekt sitzenden Cut. Über der Weste, unter der Jacke, erkennt Majorana eine rote Schärpe mit fremdartigen Schriftzeichen, die quer über der Brust liegt. Eine Auszeichnung vielleicht, oder das Zeichen der Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe.
»Sie sind Herr Majorana, nicht wahr? Ich habe mit großem Interesse Ihre letzte Abhandlung Über die Kerntheorie gelesen. Alles, was sie geschrieben haben, war für mich sehr schlüssig und nachvollziehbar. Und Ihre Doktorarbeit über die Quantentheorie der radioaktiven Atomkerne war wirklich herausragend. Meine Gratulation.«
»Vielen Dank.«
Majoranas Antwort fällt einsilbig aus. Er hofft, der andere wird nicht weiter auf dem angefangenen Thema bestehen; dafür ist er sogar bereit, seine schüchterne Zurückhaltung zu überwinden und die Initiative des Gespräches zu übernehmen.
»Und Sie sind Doktor Nishimura, aus Hiroshima in Japan. Auch ich bin mit einigen ihrer Arbeiten vertraut und finde sie ausgezeichnet. Wie lange sind Sie schon hier in Deutschland?«
»Etwa ein halbes Jahr. Zuerst in Hamburg, seit ein paar Tagen hier in Leipzig.«
»Ihr Deutsch ist hervorragend, soweit ich dies als Ausländer beurteilen kann. Wo haben Sie es so gut gelernt?«
Das Lächeln des Asiaten scheint seinem Naturell zu entsprechen. Es verändert sich nicht; kein einziges Mal während ihres Gespräches wird es intensiver oder weniger freundlich, sondern bleibt immer gleich flach – eine perfekt sitzende Maske.
»In der Schule. Deutsch war eines meiner liebsten Fächer, überhaupt alle Sprachen.«
»Und dennoch sind Sie dann Physiker geworden.«
»Physik war mir noch lieber. Und wie war es bei ihnen?«
Ja, wie war es eigentlich? Ettore hat sich nie darüber Gedanken gemacht, warum aus einem sizilianischen Jungen das geworden ist, was er heute ist.
»Also, Sprachen waren nicht mein bevorzugtes Gebiet. Aber die Physik ... seltsam, mir ist nie der Gedanke gekommen, ich hätte etwas anderes machen können.«
Nishimura nickt, ruckartig, wie zur eigenen Bestätigung. Der Italiener bemerkt am Revers des Mannes eine Anstecknadel, silbern mit einem japanischn Schriftzeichen, das beinahe wie eine germanische Rune aussieht.
Der Japaner registriert seinen Blick, und einen Moment lang zuckt Unbehagen durch sein Gesicht wie ein Blitz durch eine Regenwolke.
»Sie kommen von Professor Fermi in Rom?«
»Ja, von Fermi.«
»Einer der fähigsten Köpfe der Gegenwart, zusammen mit unserem Gastgeber. Und Ihnen, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen.«
Ettore fühlt einen seltsamen Geschmack im Mund, der nicht von dem kommt, was er getrunken oder gegessen hat. Warum tut der andere das? Warum schmeichelt er ihm?
»Das ist zuviel der Ehre. Die beiden Herren sind doch noch eine andere Klasse als ich.«
Majoranas Blick irrt hilflos durch den Raum, um schließlich an Victor Himmelreich hängen zu bleiben, der mit Hartmann auf der anderen Seite des Raumes steht. Victor prostet ihm quer durch den Raum mit dem Cognacglas zu. Ettore kann das Wort Salute von seinen Lippen ablesen und nickt ihm verstehend zurück.
Der Japaner läßt sich nicht ablenken.
»Sie sind zu bescheiden. Woran haben Sie denn bei Fermi gearbeitet?«
Der Mann ist denkbar untypisch für die Mentalität seines Landes. Ettore kennt ein paar andere Japaner. Alle sind zurückhaltende Zeitgenossen, die nicht viel reden und selten eine Frage stellen, die nicht imbedingt nötig ist. Eine Konversation wie diese hier hat er noch nie erlebt.
»Wir haben auf dem Gebiet der Quantentheorie gearbeitet.«
Dieser Allgemeinplatz, einem Kollegen gegenüber geäußert, ist fast schon eine Beleidigung und zeigt überdeutlich, daß er nicht darüber reden will, aber der Japaner bleibt ganz gelassen und freundlich und verfolgt weiter sein Konzept.
»Ah ja, ich habe darüber gelesen. Sehr interessant. Sagen Sie, es gab Gerüchte über Forschungen an Waffentechnologien an ihrem Institut. Ist da etwas dran?«
»Nein. Ich habe auch davon gehört, aber das ist völlig aus der Luft gegriffen. Bei Fermi findet nur Grundlagenforschung statt.«
Das Lächeln im Gesicht des anderen bleibt, verändert sich aber leicht, in einer Art, die Ettore nicht deuten kann.
»Ach, schade. Ich finde die praktische Anwendung der Forschung immer genauso spannend wie die Forschung selbst. Entschuldigen Sie mich jetzt – dort ist unser Gastgeber, und ich habe ein paar Fragen an ihn.«
Nishimura erhebt sich und macht eine Verbeugung auf die ihm typische Art. So schnell, wie er gekommen ist, verschwindet er wieder.
Majorana, dessen Unruhe durch das Gespräch noch zugenommen hat, wendet sich wieder in Richtung Himmelreich. Als er sieht, daß dieser allein ist, nimmt er sein Glas und seine Zigarette und gesellt sich zu ihm.
Er spricht ihn auf italienisch an, wie immer, wenn sie allein sind.
»Kennst du diesen Nishimura?«
»Nicht besser als du. Wollte er etwas Bestimmtes?«
Die beiden haben sich angefreundet in den letzten Wochen. Wie sein Auftraggeber es geplant hat, ist Victor über den Status eines Kollegen hinausgewachsen, ist fast schon ein Freund geworden. Und jetzt, ... jetzt ist die Zeit reif für die eigentliche Arbeit, den lange vorbereiteten Zweck der Operation.
Nur die Gelegenheit hat sich noch nicht ergeben.
»Nur allgemeine Konversation.«
Himmelreich grinst.
»Er ist ziemlich abrupt aufgestanden. Ich hoffe, du hast ihn nicht beleidigt.«
»Bei diesen Asiaten weiß man ja nie. Aber ich glaube, ich habe nur eine seiner Fragen nicht erwartungsgemäß beantwortet. Er wollte wissen, ob Fermi an Waffen gearbeitet hat.«
Die Chance. So schnell hat der andere nicht damit gerechnet. Nun heißt es ruhig bleiben und die Gunst der Stunde nutzen. Er sammelt sich, wie soll man anfangen, und er merkt, daß ihm schwerfällt zu tun, weshalb er eigentlich hier ist.
Aber dann kommen die Worte doch heraus.
»Und? Hat er?«
»Natürlich nicht. Du weißt, was wir getan haben.«
»Aber es gibt diese Gerüchte ...«
Ettore verdreht die Augen in komischer Ungeduld.
»Du meinst die Todesstrahlen.«
»Eben die. Ein Strahl, von Italien aus einer von Fermi gebauten Apparatur abgeschossen, tötet eine Sekunde später in Algerien eine friedlich grasende Kuh.«
»Äthiopien. Ich kenne die Geschichte auch. Wie dem auch sei – es klingt wie ein Witz, und es ist auch einer.«
Er klingt glaubwürdig, wie er das so abstreitet, aber wer kann schon in einen Menschen hineinblicken? Himmelreich weiß, was er weiß.
»Du darfst nicht darüber reden, stimmt´s? Mit der Technologie dieser Strahlen ließe sich eine Menge erreichen, und viel Geld machen. Ich kenne da jemanden, der ...«
Er bricht ab, als er Ettores erstaunten Blick auf sich fühlt. Es ist kein normales Thema für Ettore, merkt er erschreckt. Ich bin unbedacht einen Schritt zu weit gegangen, denkt er, über die Grenzen der Freundschaft hinaus. Verdammt, ich kann das nicht. Warum nehmen sie keinen Experten für so etwas.
Glücklicherweise erlöst ihn einen Augenblick später Paul Hartmann aus der unangenehmen Situation. Er hat den letzten Teil von Himmelreichs Rede noch gehört.
»Die Todesstrahlen? Das wäre was für uns. Das würde uns endlich dahin bringen, wo wir hingehören.«
Hartmann ist angetrunken, ein Zustand, den weder Himmelreich noch Majorana bisher an ihm gesehen haben. Etwas schwankend steht er da, mit wäßrigen, vorquellenden Augen, ein halbleeres Glas in der Hand.
Ettore räuspert sich.
»Wo gehören wir denn hin? Und wer sind wir?«
Hartmann sieht ihn auf schwer zu deutende Weise an, einerseits wohlwollend, andererseits mit leichtem Widerwillen.
»Wir sind die Deutschen, und wir gehören an die Spitze. Und unser Führer Adolf Hitler wird uns dorthin bringen, das können Sie mir glauben. Die Erde wird zittern, und wohl den Völkern, die sich zu unseren Verbündeten zählen dürfen.«
Er redet sich in Rage, wobei er sich der abgehackten Diktion bedient, die die rhetorische Norm dieser Tage darstellt. Schweißperlen stehen auf seiner Stirn und bilden einen glänzenden Film. Er sieht ungesund aus, wie er da in seinem schlecht sitzenden grauen Anzug steht, ungesund nicht auf eine physische, sondern auf eine moralische Art.
Seine beiden Zuhörer beobachten ihn mit unterschiedlichen Gefühlen. Himmelreich fühlt leichtes Unbehagen. Hartmanns Exkurs hat zwar wenig mit ihm zu tun, aber er ahnt, daß er selber ein Teil dessen ist, was der Mann da eben propagiert, und daß er dazu beiträgt, den Zielen der Nationalsozialisten zu dienen, obwohl er im tiefsten Inneren so unpolitisch ist, wie man es nur sein kann. Und Majorana – nun Majorana sieht das Ganze eher wie ein Zuschauer im Theaterparkett; froh, nicht zu den Protagonisten zu gehören, mit Distanz und Belustigung gegenüber der besonders gelungenen Darstellung eines Narren.
»Gut, daß unsere Führer sich so hervorragend verstehen.«
»Der Duce denkt wie Adolf Hitler, das ist wahr. Aber natürlich ist klar, wer von beiden der überlegenere Geist ist.«
Majorana bemüht sich um eine energische Sprache.
»Natürlich. Sie sind Mitglied der Partei?«
Hartmann knallt die Hacken zusammen; was zackig aussehen soll, wird aufgrund seines Zustandes zu einer schwach parodistischen Einlage.
»Von Anfang an. Wie so viele, die den elenden Zustand unseres Landes vor Augen hatten, habe ich frühzeitig erkannt, daß es nur ein Mittel gibt, uns wieder zu neuer Größe zu führen. Und ich habe etwas dafür getan.«
Er ist völlig verändert, und daran ist sicher nicht nur der Alkohol schuld. Zwar ist er im alltäglichen Leben nicht unbedingt schüchtern, aber zu einem Auftritt wie diesem hätte er sich bis vor ein paar Monaten niemals hinreißen lassen.
Zuhause in Italien hat Ettore Verhaltensweisen wie die Hartmanns oft genug beobachtet in den letzten Jahren, hat sie aber dort der natürlichen Begeisterungsfähigkeit seiner Landsleute zugeschrieben. Es würde interessant sein zu beobachten, bei wie vielen der kühlen Deutschen die Begeisterung ebenso hohe Wogen schlagen wird wie bei Doktor Paul Hartmann. Sicher sind es weniger als im Land Mussolinis.
Er setzt sich etwas von der Gruppe ab, spaziert durch die Halle auf die breite Fensterfront zu. Die Fenster gehen zum Garten hinaus; sie sind hoch, zweiflügelig, und reichen bogenförmig bis fast unter die Decke des Raumes. Sie – wie überhaupt der ganze Raum – erinnern ihn an das Haus seiner Familie in Sizilien.
Er tritt an die Scheiben. Draußen ist es Nacht; über den schwarzen Himmel ziehen dunkelgraue Wolken wie eine niemals endende Karawane formloser, gehetzter Tiere. Der Vollmond leuchtet in intensivem Ocker, und ein heller Hof umgibt ihn wie ein Heiligenschein.
Ettore schaut nachdenklich, ohne eigentlich etwas zu sehen. Er starrt in die dunkle Unendlichkeit, in Gedanken ist er weit fort. Sein Blick ist auf den Garten gerichtet: alte Bäume, hochaufgerichtet wie Schiffsmasten, dazwischen alle Arten von Büschen, ein finsteres Dickicht, wie es im tiefsten Wald kaum dichter sein kann. All das nimmt er nur verschwommen wahr, wie durch eine dicke, viel zu starke Brille.
Da auf einmal macht sich sein Blick an etwas fest, an einer Unregelmäßigkeit; etwas ist dort draußen, das nicht dorthin gehört. Mit einem Schaudern, das er sich nicht erklären kann, bemerkt er, daß es ein Mensch ist, der dort steht und in die hell erleuchteten Fenster hinein blickt.
Es ist ein alter Mann, in einem abgetragenen, braunen Anzug. Klein und verkrümmt steht er dort, völlig bewegungslos, und starrt in Richtung des Hauses. Im hellen Mondlicht kann Ettore jede Einzelheit des Gesichtes ausmachen. Es ist braun und von Wind und Wetter gegerbt wie Leder, ein fadendünner Schnurrbart zieht einen feinen Strich unter die riesige, gekrümmte Hakennase. Der Mann wirkt arabisch, maurisch, wie ein Nomade der Wüste oder wie ein Zigeuner: Er ist Sinnbild dessen, der sich nie lange an einem Ort aufhält, immer in Bewegung ist, weil nur in der Bewegung seine Sicherheit liegt.
Plötzlich weiß Ettore, daß der Mann dort draußen nur wegen ihm gekommen ist. Er sieht nur ihn an, nicht das Haus oder irgend etwas anderes, sondern nur ihn, Ettore Majorana. Und er hat eine Mission, die ihn betrifft.
So stehen sie eine kleine Weile, und Majoranas Schaudern weicht einem Gefühl tiefen Friedens. Keine Bedrohung geht von dem Braunen aus. Sie fixieren sich, als gäbe es nur sie beide auf der Welt, und der Sizilianer hat Angst, sich zu rühren, wagt kaum zu atmen, weil dann der Mann verschwinden könnte wie eine Fata Morgana oder wie ein Reh, das sich erschreckt.
Langsam, ganz langsam verzieht sich das Gesicht des Alten zu einem Lächeln, entblößt zwei Reihen riesiger, tierhafter Zähne, die stark und weiß aus dem dunklen Gesicht leuchten. Dann nickt er, einmal, zweimal, wie um sich selbst etwas zu bestätigen.
Ettore geht durch den Garten, langsam, aber ohne Furcht – er weiß, von diesem Mann droht ihm keine Gefahr. Dann erhebt der Alte seine Stimme, und sie ist so rauh und heiser, daß Ettore unwillkürlich die Vision von Tausenden von Zigaretten und ebenso vielen Schnapsgläsern befällt:
»Ettore.«
6.
Einmal, als ich noch ein Kind war, spielten wir auf einem alten Grundstück am Stadtrand. Es war eine Ruine, ein altes, großes Haus, das früher sicher mal das Heim reicher Leute war.
Luigi zählte und wir versteckten uns. Ich rannte in den Keller des Hauses, ein dunkler, unheimlicher Ort, und allein deshalb ein gutes Versteck. Schon die Treppe war ein Abenteuer, so verfallen wie sie war; ich tastete mich hinab, Schritt für Schritt, langsam, um nicht zu stolpern, aber auch, um mich nicht durch ein Geräusch zu verraten.
Die Treppe war lang, und schon auf halber Strecke brach mir der Schweiß aus. Ich war sechs Jahre alt, und alles andere als mutig. Ich hielt an. Von oben drang das Zählen Luigis herab – bis fünfzig, hatten wir ausgemacht. Er war bei zwanzig.
Da stand ich nun. An Umkehren war nicht zu denken, mein Erscheinen im Erdgeschoß wäre genau mit Luigis Fünfzig zusammengefallen, er hätte mich sofort gesehen. Hier stehenbleiben konnte ich aber auch nicht.
Ich blickte nach unten. Natürlich gab es kein Licht mehr in dem alten Gebäude, und keiner von uns hatte an eine Lampe gedacht, als wir hierher kamen. Es war sehr dunkel am Ende der Treppe.
Ich mußte weiter.
Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, trieb es mich voran. Ich versuchte, das Dunkel mit den Augen zu durchdringen, und je tiefer ich kam, um so klarer wurde mir, daß keine Dunkelheit wirklich vollkommen und überall ein wenig Licht ist. Naja, so ähnlich dachte ich jedenfalls.
Dann war ich unten angekommen und sah, warum es nicht ganz dunkel war: Aus einer Nische fiel ein schwacher Lichtstrahl. Wie magisch angezogen ging ich in die Richtung und stand schließlich unter einem spinnwebenverhangenen Kellerfenster.
Ganz ruhig stand ich da, ohne mich zu rühren. Das Zählen hatte aufgehört und es drang kein Geräusch mehr in den Keller. Das einzige, was ich noch hörte, war mein eigener Atem, leise und doch unnatürlich laut in der staubigen Ruhe des Raumes.
Offenbar hatten die anderen nicht gehört, wo ich hingegangen war.
Nach zehn Minuten, in denen sich weder Luigi noch irgend ein anderer meiner Freunde auf der Treppe gezeigt hatte, war ich sicher, das beste Versteck von allen gefunden zu haben. Die Angst vor dem dunklen Keller war mein wirkungsvollster Schutz, spürte ich, und ich war nicht wenig stolz, daß ich selber sie halbwegs besiegt hatte.
Allmählich hatten sich die Augen an das Dunkel gewöhnt, und ich begann, wieder Einzelheiten auszumachen. Der Keller war beinahe leer und unglaublich schmutzig. Spielende Kinder, vielleicht auch herumstreunende Tiere, hatten offenbar alles hereingetragen, was sie in der Umgebung gefunden hatten: leere Flaschen, Blätter Zeitungspapier, ein brauner Filzhut, ein Stück Leder, das so aussah, als hätte es einmal zu einem Pferdegeschirr gehört, ein Bündel brauner Lumpen in einer der Ecken des Raumes und vieles mehr, alles überzogen von einer dicken Schicht Staubes. Aber es gab auch andere Dinge, die wohl schon immer hier gestanden hatten, ein alter Stuhl, ein Tisch mit nur noch drei Beinen. Nichts davon reizte meine Neugier.
So wartete ich noch mal zehn Minuten. Für ein spielendes Kind ist das eine Ewigkeit! Wieder gingen meine Augen auf Wanderschaft, in einer Mischung aus Furcht und Neugier tasteten sie den Fußboden ab, glitten über Wände und Decken. Dann blieben sie an etwas hängen.
Es schien ein Fleck an der Decke direkt über mir zu sein. Ich trat zögernd einen Schritt vor. Nein, kein Fleck, es war ein Loch, fünfzehn mal fünfzehn Zentimeter, vielleicht eine Stelle, an der ein Stein aus der Decke gefallen war und eine leere Höhle hinterlassen hatte.
Aus irgendeinem Grund fesselte das Loch meine Aufmerksamkeit. Es fesselte sie so sehr, daß mir der Abmarsch meiner Freunde völlig entging. Nach langer Suche hatten sie es aufgegeben, mich in der Ruine finden zu wollen, und waren auf dem Weg nach Hause, in der Hoffnung, mich dort anzutreffen.
Ich war allein in dem großen, verfallenen Haus. Ein sechsjähriger Knabe, völlig allein in einem fremden, dunklen Keller. Angst? Nein, Angst hatte ich in diesem Moment nicht mehr. Wie gesagt, ich konnte wieder etwas sehen, das machte mich sicher, und dann war da das interessante Loch.
Ich trat noch näher, war nun direkt darunter. Es ... schien sich etwas zu bewegen in den Tiefen der Höhlung. Ich beobachtete angestrengt. Da ... da war es wieder. Ein Huschen, schnell und verstohlen, begleitet von einem kurzen, trockenen Rascheln. Dann war es vorbei.
Dem mußte ich auf den Grund gehen.
Wie bitte? Ja, vielleicht haben Sie recht, wenn Sie da den kleinen Forscher sehen. Vielleicht war das schon immer in mir. Ich denke aber eher, es war nur kindliche Neugier. Jedenfalls, ich wartete bestimmt zwanzig Minuten unter dem Loch, ohne daß sich etwas tat: keine Bewegung, kein Geräusch. Wie hypnotisiert starrte ich hinauf. Ich wußte, da war etwas gewesen, dachte an eine größere Höhlung hinter der, die ich sehen konnte; die Decke wäre dick genug gewesen, ein niedriges Zwischenstockwerk aufzunehmen, zumindest aus meiner damaligen Sicht.
Aber es tat sich nichts.
Ein Stock stand zwei Meter von mir entfernt, an die Wand gelehnt. Eigentlich war es eher ein Ast, aber ein sehr gerader und gleichmäßig gewachsener ohne Nebenäste. Ich nahm ihn in die Hand. Er war schwer, und er war lang genug und würde hinauf reichen.
Dann stand ich wieder unter dem Loch, hob den Stock und schob ihn ganz langsam hinein, als hätte ich Angst, etwas darin zu zerstören. Nach ungefähr dreißig Zentimetern, so schätze ich, stieß ich auf harten Widerstand.
Es ging nicht weiter.
Ich stocherte weiter, angestrengt, erhitzt, den Kopf hochrot, in dem Loch herum, fast besessen kratzte ich und stieß an die Seitenwände, den Blick immer nach oben gerichtet.
Da passierte es.
Etwas haariges, großes Schwarzes fiel herab, ich spürte das Gewicht mitten in meinem Gesicht, auf dem linken Jochbein, und kroch auf flinken Beinen in Richtung meines Hemdkragens.
Meine Erinnerung an diesen Moment ist nicht ganz klar, aber das Gefühl der Panik in mir ist immer noch präsent wie damals. Ich weiß, ich schrie wie am Spieß, ließ den Stock fallen und fegte mit den Händen wie ein Besessener über Gesicht und Hals, immer wieder. Die Spinne war sicherlich die größte gewesen, die ich jemals gesehen hatte, eine Tarantel vielleicht oder sonst etwas Unangenehmes. Glücklicherweise zeigte sie keinerlei Interesse, mein Hemd als Ersatz für ihre Höhle zu benutzen. Vielmehr ließ sie sich auf den Boden fallen und verschwand blitzschnell in der Dunkelheit.
Ich schrie weiter, auch als sie schon weg war. Durch den Lärm hindurch, den ich selber machte, nahm ich aber auf einmal noch ein Geräusch war: Ein dröhnendes Lachen. Jemand lachte, ganz ungeniert laut und ganz nah bei mir.
Ich fuhr herum. Das braune Kleiderbündel in der Ecke, daß ich für Müll gehalten hatte, hatte seine Form verändert. Es war ein Mensch, die ganze Zeit war jemand mit mir zusammen hier unten gewesen, bewegungslos, am Anfang vielleicht schlafend und dann durch meine Bewegung aufgewacht. Er hatte alles mit angesehen!